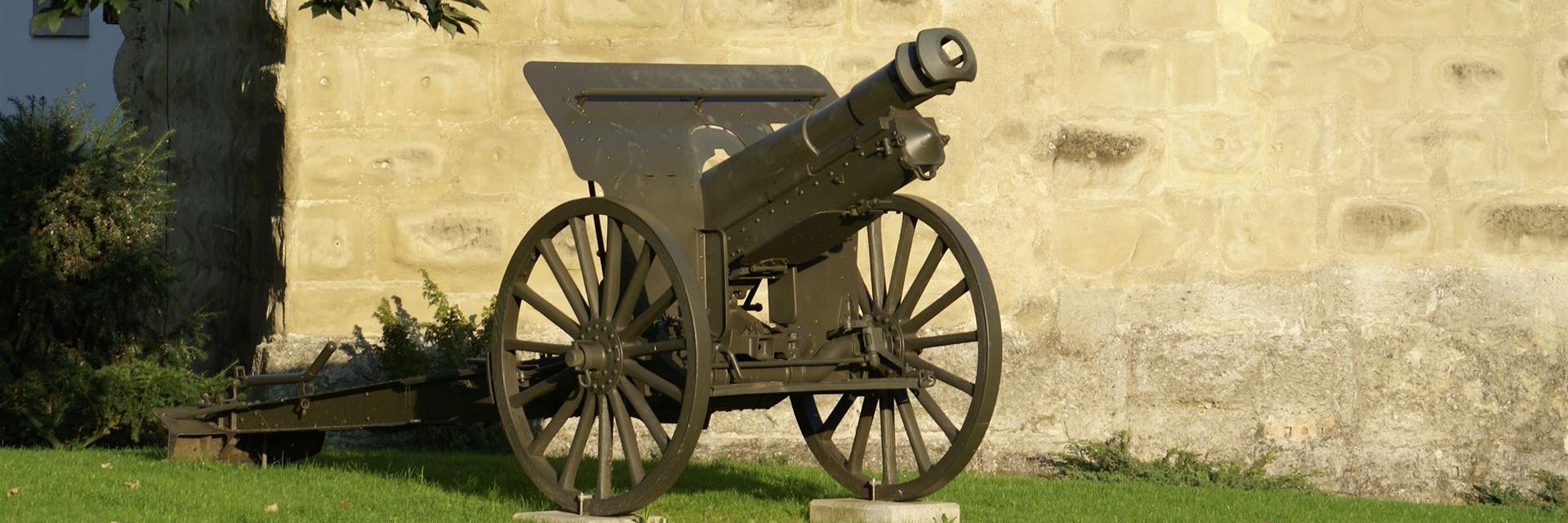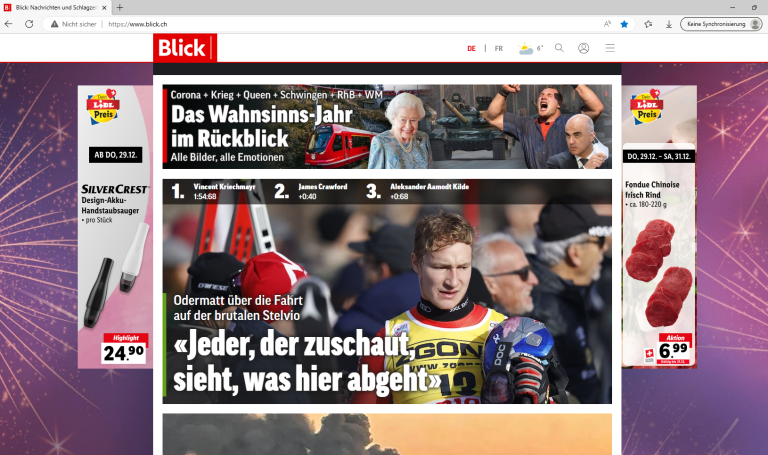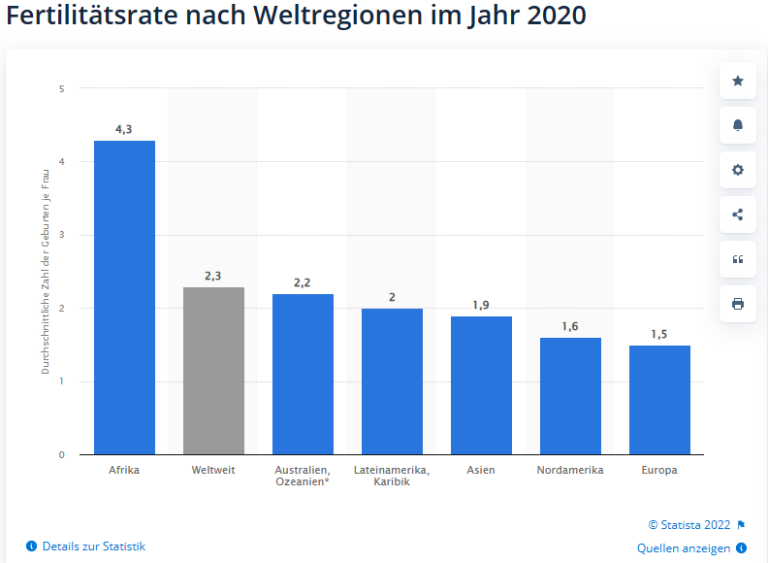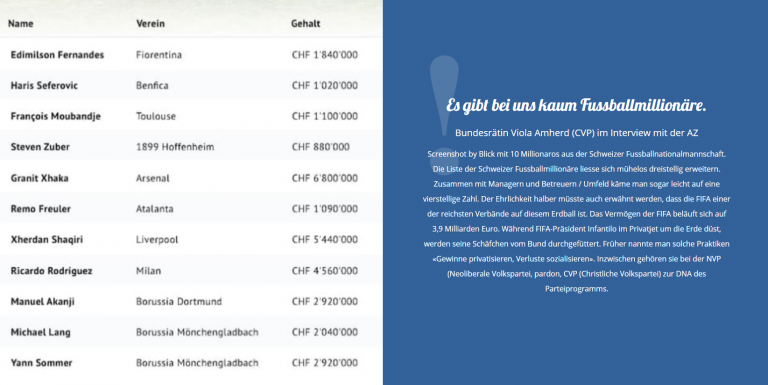Schlagzeilen des Tages
-
31.12.2022 - Tag der Bad News vs. Good News
Ghana verbietet negative Weissagungen für das Jahr 2023
Dies ist die Zeit der Propheten. Den Beginn eines neuen Jahres pflegen Afrikas religiöse Oberhirten zu nutzen, um ihren verängstigten Schäfchen klare Ansagen für die Zukunft zu geben. Vor allem im Westen des Kontinents mit seinen riesigen charismatischen Glaubensgemeinschaften sind Weissagungen für das bevorstehende Jahr en vogue. Einer der populärsten Propheten, der im vergangenen Jahr verstorbene T. B. Joshua, hatte für 2016 einen Wahlsieg Hilary Clintons über Donald Trump prophezeit und vier Jahre später "das Ende des Coronavirus" für den 27. März 2020 vorhergesagt.
Dass es nicht ganz so kam, erklärte der Kirchengründer später damit, dass im ersten Fall die Gesamtzahl der Stimmen und nicht die nach dem komplizierten US-Wahlsystem gewichteten gemeint gewesen seien. Im zweiten Fall habe er die göttliche Eingebung für die chinesische Wuhan-Provinz mit der für die gesamte Welt verwechselt. Dem Ansehen des Oberhirten tat das keinen Abbruch.
Der Rechtsstaat deckt Falsches auf
Solange die Vorhersagen fernen Ländern gelten und keine explosiven politischen Sprengsätze enthalten, lässt die Obrigkeit die Propheten ungehindert prophezeien. Etwas anderes ist es, wenn ein Land in einer tiefen ökonomischen Krise steckt und die Hellseher den Fall seines Präsidenten oder die Kernschmelze seiner Wirtschaft prognostizieren. Dann hört der Spaß auf – wie derzeit in Ghana, wo die Polizei jetzt darauf hinwies, dass es unter den Gesetzen des westafrikanischen Staates verboten sei, "Stellungnahmen oder Gerüchte zu veröffentlichen, die Angst hervorrufen, Alarm auslösen oder den öffentlichen Frieden gefährden". Wer dagegen verstoße, habe mit bis zu fünf Jahren Gefängnis zu rechnen, drohte die Polizeiführung.
Ihre Erklärung stieß in dem gottesfürchtigen und demokratiefreundlichen Land auf heftige Kritik. Es gebe kein Gesetz, das der Polizei die Macht einräume, "Weissagungen zu regulieren", wetterte der Anwalt Sammy Darko: Die Religions- und Meinungsfreiheit deckten zweifellos auch Prophezeiungen ab – ob sie sich später als falsch oder als zutreffend herausstellten. Den Zorn des Juristen erregte vor allem ein Detail der Ordnungshüter-Demarche, wonach das Verbot im Besonderen "absichtlich falschen oder irreführenden Äußerungen" gelte. Der Rechtsgelehrte wollte wissen, wie eine Weissagung schon lange vor dem vorausgesagten Ereignis als falsch beurteilt werden könne – falls es sich bei den Polizisten nicht selbst um Propheten handele. Schreibt DER STANDARD.
In einem Land wie Ghana, wo noch immer vorsintflutlicher Aberglaube in breiten Kreisen der Bevölkerung herrscht, ist die Massnahme der Polizei irgendwie verständlich. Auch wenn deren Wirkung nur marginale Erfolge erzielen dürfte.
Jetzt hämisch auf Ghana zu blicken steht uns nicht zu. Auch in den hehren Demokratien der westlichen Wertegemeinschaft verkaufen sich Bad News und esoterisches Gesülze jenseits von Gut und Böse nun mal besser als faktenbasierte News.
Das ist eine Tatsache. Wer daran zweifelt, soll mal auf seinem TV-Gerät via «Replay-Funktion» durch das TV-Programm der Weihnachtstage zappen. Sie werden staunen, wie viele Dokus über Hitler in den letzten sieben Tagen gesendet wurden. Von Mutter Theresa finden Sie keine einzige.
-
30.12.2022 - Tag des Teuerungsausgleichs für den Bundesrat
Magistraler Teuerungsausgleich: Bundesratslohn steigt fünfstellig!
Die Inflation ist 2022 in der Schweiz so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Vielerorts werden deshalb die Löhne angepasst. Bei den Mitgliedern des Bundesrats schenkt das richtig ein.
Auf die meisten Schweizerinnen und Schweizer kommen schwere Zeiten zu: Alles wird teurer. Knapp drei Prozent wird die Teuerung in diesem Jahr betragen. Um das zumindest teilweise auszugleichen, werden in verschiedenen Branchen die Löhne angepasst.
Mehr Lohn bekommen auch die Bundesangestellten. Alleine der Teuerungsausgleich beträgt 2,5 Prozent. Davon profitieren auch die Bundesrätinnen und Bundesräte. Ihr Lohn wird ebenfalls angepasst, wie die Zeitungen von CH Media berichten. Das ist in der Verordnung der Bundesversammlung über die Besoldung von Magistratspersonen so vorgesehen.
11'421 Franken mehr
Bei den Mitgliedern der Landesregierung läppert sich das. Mit dem Teuerungsausgleich von 2,5 Prozent steigt das Jahreseinkommen um 11'421 Franken auf 468'275 Franken. Pro Monat entspricht das einem Zustupf von etwas mehr als 950 Franken.
Der Bundespräsident erhält nochmals 12’000 Franken mehr, zudem gilt für alle Bundesräte eine Spesenpauschale von 30’000 Franken. Auch nach ihrer Amtszeit ist für die Bundesrätinnen und Bundesräte gut gesorgt: So erhalten sie für den Rest ihres Lebens die Hälfte des Lohns als Rente.
Grosse Unterschiede in den Kantonen
Auch in den Kantonen erhalten die Regierungsmitglieder mehr Lohn, wie weiter berichtet wird. Allerdings fallen die Teuerungsausgleiche für die Staatsangestellten in den Kantonen unterschiedlich hoch aus. Spitzenreiter ist Zürich mit 3,5 Prozent. Im Aargau, Solothurn oder Luzern bekommen die Beamten einen Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent.
Einen eigenen Weg schlägt der Kanton Basel-Stadt ein. Dort wird der Teuerungsausgleich abgestuft: je höher der Lohn, desto tiefer die Erhöhung. So erhalten die Regierungsräte maximal 65 Prozent des Teuerungsausgleichs von 2,9 Prozent. Schreibt Blick.
«Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf.»
So steht es geschrieben in Psalm 127. Das denken nicht Wenige, die obigen Aufreger zum Frühstück konsumiert haben. Um genau zu sein: Drei Viertel (75 Prozent) folgen laut Online-Blick-Abstimmung «Hat der Bundesrat die Lohnerhöhung verdient?» dem Psalm 127 und stimmen damit der Meinung «Der Lohn (für die Bundesräte) war sowieso hoch genug» zu.
Nur ein Viertel (25 Prozent) der abgegebenen 10'149 Stimmen (Stand 11:22 Uhr) findet die Lohnerhöhung für die Bundesräte gerechtfertigt, denn «Jeder hat Anrecht auf Teuerungsausgleich».
Es sei darauf hingewiesen, dass der zitierte Satz aus Psalm 127 in Wirklichkeit nicht dem entspricht, was wir auf den ersten Blick denken. Auch wenn es der Deutungen viele gibt, was bei uralten religiösen Schriften beinahe immer zutrifft, ist die Auslegung einzig und allein im Kontext des gesamten Psalms verborgen. Dass sich Faulheit lohnt, ist aber definitiv nicht die Message. Würde auf den Bundesrat auch in keiner Art und Weise zutreffen.
Gemessen an den Gehältern plus Boni bei Banken, Pharma, IT und Eisenbahnherstellern et cetera ist das Jahreseinkommen eines Schweizer Bundesrats/Bundesrätin geradezu lächerlich. Die einträglichen Verwaltungsratsmandate sind während der Amtszeit ohnehin verboten. Das grosse Absahnen kommt, wenn überhaupt, erst nach dem Rücktritt vom Amt.
Der reisserische Clickbaiting-Hinweis «fünfstellig» entspricht letztendlich ca. 950 Franken pro Monat. Hätte Blick diese Zahl in der Headline publiziert oder die Gesamterhöhung von 11'421 Franken, wäre der Artikel wohl in der Bedeutungslosigkeit gelandet. Und da gehört er auch hin.
-
29.12.2022 - Tag der chniesischen Touristen in Luzern
Luzerner Tourismus erholt sich ohne China: Bald wieder Grossandrang? Noch kaum Chinesen in Luzern
Die Regierung in Beijing hat die Einreisebestimmungen gelockert und somit Auslandsreisen möglich gemacht. Die Online-Reiseportale laufen bereits heiss. Warum der Tourismus in Luzern auch so schon wieder brummt.
Nach drei Jahren unter strengem Covid-Regime werden in China ab Anfang Januar erstmals die Einreisebestimmungen gelockert. Kurz nach der Ankündigung, seien die Online-Anfragen für Auslandsreisen nach oben geschnellt, berichtet «Reuters» am Dienstagmorgen.
Die Meldung stösst auch in Luzern auf aufmerksame Ohren. Denn chinesische Touristen sind hier schon seit langem eine wichtige Zielgruppe der Tourismusbranche. Nicht umsonst wurden die Preise in einschlägigen Uhren- und Schmuckgeschäften der Luzerner Innenstadt vor der Pandemie häufig auch auf Chinesisch angegeben.
Doch auf eine neue Welle Touristen wird die Stadt wohl noch einige Monate warten müssen, schreibt «Luzern Tourismus AG» auf Anfrage. Zu gross seien die Unsicherheiten bei den Gästen aus China.
In China bricht die Reiselust aus
Ab 8. Januar 2023 müssen Einreisende nach China nicht mehr in Quarantäne, verkündete die chinesische Regierung am Montag. Zuvor galt eine strenge Quarantänepflicht. Chinesen und Ausländer mussten in speziellen Hotels bis zu drei Wochen ausharren.
Der Schritt wird begleitet von landesweiten Protesten gegen die Null-Covid Politik der Regierung in Beijing. Für die Ausreise hatte es bisher keine Regulierungen gegeben, die strengen Einreisebestimmungen hatten die Auslandsreisen von Chinesen aber stark verringert.
Schon dreissig Minuten nach Bekanntgabe der Lockerungen, sollen sich die Anfragen nach grenzüberschreitenden Reisen auf «Ctrip» verzehnfacht haben, schreibt «Reuters» mit Verweis auf die Daten der Reiseplattform. Macau, Hong Kong, Japan, Thailand und Südkorea - diese Länder werden am häufigsten in die Suchleiste eingetragen.
Chinesen in Luzern fehlen sichtlich
Der Markt für chinesischen Tourismus ist gewaltig. 2019 gaben chinesische Touristen weltweit 130 Milliarden US-Dollar aus. Sibylle Gerardi, Kommunikationsverantwortliche bei «Luzern Tourismus AG», erinnert sich: «Bezüglich des Umsatzes in Luzern gibt es keine detaillierten Zahlen. Chinesinnen gaben in der Schweiz aber deutlich mehr aus als Gäste aus Europa, der Schweiz, den USA und den meisten anderen asiatischen Märkten.»
Luzern sei von den Gästen aus China trotzdem nicht abhängig. Bereits vor der Pandemie kamen 19 Prozent der Touristen aus der Schweiz, ebenso viele aus den USA und nur jeweils neun Prozent aus China und Deutschland. Doch bei keiner anderen Gruppe blieben die Besucherzahlen auch im Jahr 2022 so niedrig, wie bei den Chinesen.
Aktuell stammen 0,5 Prozent der Touristen aus China. Per Ende Oktober wurden 4700 Übernachtungen verzeichnet. Das seien 95 Prozent weniger als in derselben Periode im Jahr 2019, schreibt Sibylle Gerardi.
Bis Chinesen wieder reisen, dauert es
Es ist unwahrscheinlich, dass sich an diesen Zahlen trotz der neusten Anpassungen bei den Einreisebestimmungen etwas ändert. Grosse Fluggesellschaften wie «United Airlines» und «Lufthansa» werden erst auf die Nachfrage warten, bis sie ihre Flugpläne anpassen, berichtet «Reuters». Auch Liu Simen von der «China Society for Futures Studies» in Beijing schätzt, dass internationale Reisen von und nach China erst 2024 wieder zum Vor-Pandemie-Niveau zurückkehren.
In Luzern rechnet die «Luzern Tourismus AG» erst im Sommer 2023 mit einem Anstieg chinesischer Gäste. Völlige Erholung erwartet man hier erst 2025/2026. «Es gibt auch jetzt noch grössere Hürden wie Engpässe bei Visa, wenige Flugkapazitäten, generell eine gedrosselte Wirtschaft in China und vor allem die kritische pandemische Lage, die die Strukturen an ihre Grenzen bringt», erklärt Sibylle Gerardi.
Um den Tourismus in Luzern steht es aber besser, als die meisten denken. Es gibt aktuell ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Die Verantwortlichen von «Luzern Tourismus AG» blicken somit zuversichtlich ins neue Jahr. Und warten geduldig auf die Rückkehr der chinesischen Touristen. Schreibt ZentralPlus.
Als Stadtluzerner kann ich bestätigen, dass sich der Tourismus in der Stadt Luzern im Jahr 2022 erfreulich positiv entwickelt hat. Der Massentourismus mit stehenden Schlangen von überfüllten Cars mit vorwiegend chinesischen Gästen in der City musste Corona bedingt dem gehobeneren Individualtourismus weichen, was langfristig auch der angestrebten und öffentlich kommunizierten Tourismusstrategie von «Luzern Tourismus» entspricht.
Es kamen auch so 2022 genügend asiatische Touristen, was man bei jeder Schiffsfahrt auf dem Vierwaldstättersee feststellen konnte. Die «Schifffahrt Vierwaldstättersee SGV» konnte nach den zwei Pandemie-Jahren schneller als erwartet das Vor-Corona-Niveau von 2019 in diesem Jahr sogar übertreffen.
Bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht wieder – wie von der mächtigen City Vereinigung Luzern zum Wohle von ein paar Uhrenklitschen und China-Restaurants am Schwanenplatz und Grendel gewünscht – in die alten Muster zurückfallen, als die Stadt Luzern jährlich von mehr als 300'000 (ja, Sie lesen richtig: Dreihunderttausend) Touristen aus China geflutet wurde. Die Verlockung ist gross. Der Preis, den die Luzerner Bevölkerung dafür bezahlt, allerdings auch.
Es mag ja sein, dass chinesische Gäste mehr Geld ausgeben als diejenigen anderer Länder. Wobei es sich um eine ziemlich steile These von Sibylle Gerardi (Luzern Tourismus) handelt. Da keine Zahlen vorliegen sind Zweifel angebracht.
Fakt ist, dass das Geld von den chinesischen Touristen in Luzern vorwiegend in Uhren- und Souvenirklitschen sowie Chinarestaurants mit Gruppenpreisen von zehn bis zwölf Franken für ein Mittagessen pro Person ausgegeben wurde. Inklusive einem Glas Yasmin Tee. Dass da einige China-Restaurants pleite gingen und Konkurs anmelden mussten ist die logische Folge dieses Geschäftsmodells mit dem «Klumpenrisiko».
Uhrenmogul Jörg G. Bucherer wird auch ohne chinesischen Massentourismus einer der reichsten Schweizer bleiben. Einen Grossteil der Belegschaft hat er ja ohnehin schon beim ersten Windstoss der Corona-Pandemie entlassen und nicht in Kurzarbeit geschickt. Er ahnte demzufolge schon damals, dass die Horden von chinesischen Touristen vor seinem Uhrengeschäft am Schwanenplatz in Zukunft ausbleiben werden.
Dem gierigen Blick in den Augen von Frau Gerardi zum Trotz sollte Luzern Tourismus der Verlockung des chinesischen Massentourismus widerstehen und den eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit im Tourismussegment konsequent weiterführen.
-
28.12.2022 - Blick-Seite von Google als unsicher bezeichnet
Was Odermatt über die Fahrt auf der brutalen Stelvio zu sagen hat, ist eigentlich nicht wichtig, wenn Sie derzeit gerade den Blick lesen.
Viel wichtiger ist, dass das vermutlich publikumswirksamste Schweizer Onlineportal derzeit für alle Benutzer*innen laut Google eine Gefahr darstellt. Sehen Sie sich die URL-Zeile ganz genau an. Das Warnzeichen kann deutlicher nicht sein.
Sowas kann gegen Jahresende passieren. Die üblichen Dezember-Updates müssen auf den Servern verarbeitet werden. Oder das Abo für die Sicherheitsbestätigung der Website ist abgelaufen. Möglicherweise, aber kaum vorstellbar, ist die gesamte IT-Abteilung von Ringier infolge Weihnachtsferien abwesend.
Nicht passieren dürfte allerdings, dass Blick trotz einem Hinweis per Mail von meiner Wenigkeit vor zwei Tagen bis jetzt nicht reagiert hat, um das Übel zu beheben. Das ist für einen Medienkonzern dieser Grössenordnung fast schon fahrlässig.
Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass Medien einen Tummelplatz für Cybercrime darstellen. Erinnern Sie sich noch an die Malware-Attacke auf 20 Minuten 2016, als 20Minuten selbst vom Bund gesperrt werden musste?
Mit der Sicherheit im Internet lässt sich nicht spielen, auch wenn der Vorfall bei Blick vermutlich auf einen internen Lapsus zurückzuführen ist.
Entwarnung: Nach nun vier Tagen ist heute (29.12.2022) die Google-Warnung «nicht sichere Webseite» aus der URL-Zeile von Blick verschwunden. Sie können die Blick-Schmonzetten somit wieder gefahrlos geniessen.
-
27.12.2022 - Tg der Autofahrerinnen aus der Region Zofingen
«Es lief die Beine runter»: Aargauerin erklärte Fahrerflucht vor Gericht mit Durchfall
Wer einen Verkehrsunfall verursacht, muss sich bei der Polizei melden. Eine Frau aus der Region Zofingen AG hat dies unterlassen – aus speziellen Gründen. Jetzt wurde sie verurteilt.
Vor dem Bezirksgericht Aarau ist unlängst ein Fall von Fahrerflucht verhandelt worden. Die Angeklagte, eine Mittdreissigerin aus der Region Zofingen, hatte auf der Tramstrasse in Suhr einen Selbstunfall gebaut. Danach fuhr sie mit dem beschädigten Auto nach Hause.
Beim Unfall kamen keine Personen zu Schaden. Auch die Autofahrerin selber blieb unverletzt. Es entstanden allerdings Schäden an Inselschutzpfosten und am Wagen. Verschiedene Autoteile sowie ein Kontrollschild blieben an der Unfallstelle liegen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, versuchte die Frau dem Gericht zu erklären, weshalb sie nicht die Polizei informierte.
Zum Unfall sei es gekommen, als es sie plötzlich an den Beinen und Füssen gejuckt habe. Weil sie sich vorgebeugt habe, um sich mit der rechten Hand zu kratzen, sei ihre linke Hand vom Steuer gerutscht. In der Folge kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Inselschutzpfosten.
«Das war mir grauenhaft peinlich»
Die Frau gab ausserdem an, wegen einer Hauterkrankung in ärztlicher Behandlung zu sein und Cortisonpräparate zu verwenden. Wegen der Medikamente habe sie Durchfall gehabt – und sich in die Hose gemacht. «Es lief die Beine runter, gruusig», sagte sie vor Gericht, wie die «Aargauer Zeitung» weiter schreibt. «Das war mir grauenhaft peinlich. So konnte ich nicht zur Polizei gehen, das wäre menschenunwürdig gewesen.»
Zu Hause angekommen, duschte die Frau zuerst. Anstatt die Polizei zu informieren, legte sie sich danach schlafen. Zur Rechtfertigung vor Gericht nannte sie zuerst ein Update-Problem ihres Handys und dann ein Problem mit dem Internet, und auch am nächsten Morgen habe sie nicht die Polizei anrufen können, weil sie so beschäftigt bei der Arbeit gewesen sei. Daher meldete sie erst am Nachmittag den Unfall. Nur: Die Polizei hatte da schon längst das Nummernschild am Unfallort entdeckt. Es war zu spät.
Erinnert an den Schnellfahrer John L.
Die Durchfall-Erklärung genügte dem Gericht nicht. Es verurteilte die Frau zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 130 Franken und zu einer Busse von 3500 Franken. Der Verteidiger hatte verlangt, die Frau nur wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit zu verurteilen, da wegen der späten Meldung kein Alkoholtest gemacht werden konnte. Das Gericht sprach die Frau jedoch in allen Punkten schuldig, darunter pflichtwidriges Verhalten nach einem Unfall und Inverkehrbringen eines Fahrzeugs in nicht betriebssicherem Zustand.
Die Höhe des Tagessatzes wurde wegen der hohen Kredit- und Steuerschulden der Angeklagten auf 90 Franken reduziert, die Anzahl Tagessätze auf 45 gesenkt. Von der Busse muss die Frau aus gleichem Grund nur 1000 Franken bezahlen.
Der Fall erinnert an den Schnellfahrer John L.*, der geblitzt worden war. Der Berner erklärte letztes Jahr vor Gericht, er habe starke Darmprobleme gehabt. Doch dies liess das Bundesgericht nicht gelten. * Name bekannt.Schreibt Blick.
Liebe Autofahrerinnen aus der Region Zofingen: «An apple a day keeps the doctor away» sagt ein amerikanisches Sprichwort. «Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern». Und damit auch die Aargauer Justiz, wenn's wieder mal ganz dünn kommt.
Was ein Apfel am Tag allerdings nicht von uns fernhält, sind die intellektuell über alle Zweifel erhabenen Blick-News am frühen Morgen auf der Frontseite.
-
26.12.2022 - Tag der Pfaffenstaaten
Netanjahu, Israel und die Juden
Die New York Times hat in einem ungewöhnlich scharfen vorweihnachtlichen redaktionellen Leitartikel vor einer Gefährdung der Demokratie in Israel gewarnt. Einen Tag vorher hatte der dreifache Pulitzer-Preisträger, Thomas L. Friedman, in einem langen Bericht die bevorstehende Bildung einer ultrarechten und ultranationalistischen Regierung unter Benjamin Netanjahu als einen besorgniserregenden Wendepunkt beschrieben. Vier Parteiführer in der Regierungskoalition seien wegen Korruption oder Anstiftung zum Rassismus verhaftet, angeklagt, verurteilt worden oder im Gefängnis gewesen. Politiker vom äußersten rechten Rand sollen Schlüsselpositionen zur Kontrolle der nationalen Sicherheit, des Siedlungsbaus und des Bildungswesens erhalten.
Grundlagen des Rechtsstaats bedroht
Die Pläne zur Entmachtung des Obersten Gerichtshofes und der unabhängigen Staatsanwaltschaft bedrohen die Grundlagen des Rechtsstaates. Der 73-jährige Netanjahu, der schon 15 Jahre lang regiert hat, ist zu weitgehenden Konzessionen an die rechtsextremen Koalitionspartner bereit, um seinen seit 2019 laufenden Korruptionsprozess zu beenden und politisch zu überleben. Zu diesem Zweck soll unter anderem ermöglicht werden, Beschlüsse des Obersten Gerichtshofes durch eine einfache Parlamentsmehrheit für nichtig zu erklären.
Die fünfte Wahl in vier Jahren spiegelt die Rechtsschwenkung der israelischen Bevölkerung. Rund 60 Prozent der jüdischen Israelis werden als rechtsgerichtet betrachtet, bei der Jugend zwischen 18 und 24 Jahren steigt es auf 70 Prozent. Auch bei den arabischen Israelis, über 20 Prozent der Bevölkerung, wird vor allem bei den Jugendlichen eine Radikalisierung festgestellt. Die 37. israelische Regierung, die sechste seit 1996 unter Netanjahu, könnte sich unter dem Druck der nationalistisch-religiösen, homophoben und korrupten Verbündeten, mit 400.000 radikalen Siedlern in der besetzten Westbank unter drei Millionen Arabern, als Brandstifter entpuppen. Die Folgen der Spaltung zwischen dem liberal-säkularen Lager und dem nationalistisch-religiösen Lager, vor allem die geplanten Maßnahmen zum Abbau des Rechtsstaates, würden nicht nur die Spannungen innerhalb Israels, sondern auch in der ganzen Region heute mit noch unabsehbarer Intensität steigern.
Verwandlung Israels
Darüber hinaus warnen prominente Persönlichkeiten des Weltjudentums, wie Abe Foxman, der frühere Direktor der US-amerikanischen Anti-Diffamierungs-Liga, dass die Verwandlung Israels zu einem "fundamentalistisch-religiösen Staat, zu einem Staat des theokratischen Nationalismus" Israel von 70 Prozent des Weltjudentums abschneiden würde. Im Jahr 2018 lebten von 14,6 Millionen Juden in der Welt nur 1,36 Millionen in Europa, rund 6,5 Millionen in Israel und im besetzten Westjordanland, fast genauso viele wie in Amerika (davon 5,7 Millionen allein in den USA).
Israel ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte, eine blühende Hightech-Großmacht, der einzige pluralistische Staat in der ganzen Region. Man darf aber nicht verschweigen, verdrängen oder unterschätzen, dass allein der Schatten über diesen Rechtsstaat, über das Bekenntnis zu Menschen- und Bürgerrechten, dem Antisemitismus weltweit neue Nahrung geben würde. Schreibt DER STANDARD.
Da wird aber medial ein gewaltiger Popanz um die Regierungsbeteiligung der israelischen Fundamentalisten aufgebaut. Es gab seit der Gründung des Staates Israel kaum eine Regierung, die ohne Regierungs-Beteiligung oder gnädiger Duldung der religiösen Fundamentalisten auskam.
Das dürfte auch einer der nachvollziehbaren Gründe sein, weshalb etliche «Experten» Israel hinter vorgehaltener Hand als «Pfaffenstaat» bezeichnen. Denn ohne die Hardcore-Religiösen läuft in Israel seit jeher rein gar nichts. So viel Wahrheit muss schon sein!
-
25.12.2022 - Tag der religiösen Aufklärung, die niemals stattfinden wird
Gegen Diskriminierung muslimischer Mädchen: Mitte fordert Kopftuchverbot an Schulen
Mitte-Nationalrätin Marianne Binder will Kopftücher an Schulen verbieten. Unterstützt wird sie dabei von weiteren Bürgerlichen. Sie sehen in der Verschleierung eine Diskriminierung der betroffenen Mädchen.
Für sie ist das Kopftuch kein Zeichen der Religionsfreiheit, sondern vielmehr Ausdruck der Unterordnung und Diskriminierung muslimischer Mädchen. Marianne Binder (64) will sich damit deshalb nicht abfinden. Nicht zum ersten Mal nimmt die Aargauer Mitte-Nationalrätin Kinderkopftücher an Schulen und Kindergärten ins Visier.
Mit einem Vorstoss will Binder den Bundesrat ein Verbot prüfen lassen. Gar nicht so einfach, immerhin garantiert die Bundesverfassung die Religionsfreiheit. Genau deshalb will die Mitte-Politikerin abklären lassen, ob sich hier religiöses Recht nicht staatlichem unterzuordnen hat.
«Nicht im Sinne der Verfassung»
Es sei allen Kindern die gleichen Rechte und Freiheiten sowie der Kinderschutz zu garantieren. «In unseren Bildungseinrichtungen muss eine freie Entfaltung aller Kinder ohne Kinderkopftuch garantiert sein», betont Binder. «Sich auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu berufen, um Unterordnung zu rechtfertigen, kann nicht im Sinne der Verfassung sein.»
Für sie ist klar, dass das Kopftuch den Mädchen meist von den Eltern aufgezwungen wird. Die Schule hingegen müsse für den Rechtsstaat und damit für die Freiheit und gleiche Rechte für alle eintreten, sagt sie. «Deshalb soll das Kopftuch für muslimische Mädchen mit sexualisierendem und diskriminierendem Charakter darin keinen Platz haben», fordert Binder. Denn: «Es hemmt die Entwicklung und Bewegungsfreiheit der Mädchen und widerspricht dem pädagogischen Ziel der Gleichberechtigung und Chancengleichheit.»
Unterstützung aus bürgerlichen Parteien
Auch wenn es sich nur um eine kleine Minderheit handle, die betroffen ist: Sie dürfe nicht einfach übergangen werden, zeigt sich Binder überzeugt. Es gehe hier nicht um Sonderrechte gegen Minderheiten, sondern um Recht für eine kleine Minderheit von Kindern.
Binder steht mit ihrer Forderung nicht allein. Unterstützung erhält sie aus mehreren bürgerlichen Parteien. Darunter sind mit Gerhard Pfister (60) und Philipp Bregy (44) nicht nur Präsident und Fraktionschef der Mitte-Partei, sondern auch EVP-Präsidentin Lilian Studer (44), SVP-Nationalrätin Esther Friedli (45) und FDP-Ratskollegin Jacqueline de Quattro (62).
Bundesrat sieht den Ball bei den Kantonen
Ganz anders reagierte bisher der Bundesrat. Er lehnte frühere Forderungen nach einem Kopftuchverbot an Schulen klar ab. Das zuständige Justiz- und Polizeidepartement sah keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Vor allem aber wies die Regierung darauf hin, dass das Schulwesen in der Kompetenz der Kantone sei.
Dieser föderalistische Ansatz habe sich insgesamt sehr gut bewährt, zeigt sich der Bundesrat überzeugt – «gerade auch angesichts grosser konfessioneller und kultureller Unterschiede zwischen den Kantonen und ihrem von lokalen Traditionen geprägten Umgang mit Religion». Mit solch einzelfallgerechten Lösungen vor Ort liessen sich bessere Ergebnisse erzielen als mit einem nationalen Kopftuchverbot an der Schule. Schreibt BLICK.
Und wieder einmal fetzen sich Politiker*innen wegen einem Fetzen Stoff, den weibliche Wesen einer gewissen Religionslehre auf ihrem Kopf tragen.
Der ultra-neoliberale Mitte-Präsident Gerhard Pfister springt über jedes Stöckchen, das man ihm hinhält. Er ist sich auch nicht zu schade, mit billigen SVP-Themen ein paar Wählerstimmen abzustauben.
Dass diese Mission Impossible zum Scheitern verurteilt ist, müsste selbst dem vor Dummheit strotzenden Mitte-Politiker bewusst sein. Man darf sich schon langsam fragen, ob diese verkommenen Polit-Granden in Zeiten wie diesen wirklich keine dringendere Probleme zu wälzen haben?
Ein Kopftuchverbot, egal auf welcher Altersebene, produziert nur muslimische Märtyrerinnen. Sich von diesem Stoff-Fetzen zu befreien, liegt allein in den Händen der Musliminnen und ihren muslimischen Gebietern.
Dass die Musliminnen es nicht einmal in der Schweiz wagen, so sie es denn überhaupt wollen, zeigt einmal mehr, mit welcher Hoffnungslosigkeit der Islam einer Aufklärung hinterherhinkt.
Der Iran und Afghanistan sind derzeit beispielhaft für das Versagen dieser Steinzeit-Religion, die niemals in der Neuzeit ankommen wird.
Denn wie in den früheren Zeiten des Christentums dient auch der Islam einzig und allein dem totalitären Machterhalt der religiösen Nomenklatur bzw. Nomenkleptokratur.
-
24.12.2022 - Tag des chinesischen Plastikplunders
Kriselnde Wirtschaft in China: Traurige Weihnachten unter den Plastiktannen von Yiwu
Das Haupthandelszentrum für westliche Weihnachtsdeko in China hat totale Flaute. Bald drei Jahre Corona lasten schwer.
«Es gibt keine Lösung», sagt dieser Händler im internationalen Handelszentrum von Yiwu. Man weiss nicht genau, ob er lacht oder weint. Seine Verzweiflung jedenfalls ist gross.
Er verdiene kaum noch Geld. Seit drei Jahren. Seit China die Grenzen dichtgemacht hat, wegen Corona. Normalerweise kämen Importeure aus aller Welt hier vorbei. Jetzt sei kaum jemand da.
Weihnachtsschmuck während 365 Tagen im Jahr
Wir gehen die Gänge runter im riesigen Gebäude und steigen die Treppen hoch – die Rolltreppen sind ausgeschaltet. Im vierten Stock der 300 Fussballfelder grossen Anlage hängt der Weihnachtsschmuck während 365 Tagen im Jahr: Leuchtende Rentiere, Stoffsamichläuse, jeglicher Schmuck für den Christbaum, aber auch Plastikschneemänner, Weihnachtssterne und Christbäume aus Plastik – alles, was an Weihnachten aufgestellt und aufgehängt wird, findet man in Yiwu.
Zum Beispiel bei Lu Min Ying. Sie führt den Ausstellungsraum eines Plastikbaumherstellers: «Früher kamen die Kunden in Wellen. Besonders im Februar und März standen sie bei uns Schlange, um ihre Bestellungen aufzugeben. Die Gänge hier waren brechend voll.»
Sie, die seit 20 Jahren Plastiktannen verkauft, zupft bei einem zwei Meter hohen Baum die Äste zurecht. Für wen, ist nicht klar. Denn weit und breit sind keine Kunden zu sehen.
Immerhin bestellten ihre Stammkunden noch online. Neue Kunden gewinnen sei aber kaum möglich und neue Produkte zu vermarkten auch schwierig, wenn man nur Bilder und Videos davon zeigen könne. Wer die Bäume vor Ort anschaue, bestelle tendenziell mehr, sagt Lu Min Ying.
Händler schliessen
Sie schaut den leeren Gang runter und erzählt, dass viele, die neu ins Weihnachtsbusiness eingestiegen sind, in den letzten Jahren wieder schliessen mussten. Wie viele der Weihnachtshändler dicht gemacht haben, will weder der Betreiber des Marktes noch dessen Muttergesellschaft sagen. Auch das Propaganda-Ministerium in Yiwu gibt sich zugeknöpft.
Gemäss Propaganda-Behörde der Stadt stammen 80 Prozent der weltweit verkauften Weihnachtsartikel aus Yiwu. Über 20'000 verschiedene Produkte, die in alle Ecken und Enden der Welt gehen.
Im Jahr vor der Pandemie machten die Weihnachtshändler umgerechnet rund 280 Millionen Franken Umsatz. Dieses Jahr sind es gemäss offiziellen Zahlen zehn bis 15 Prozent weniger. Es sind Zahlen, die nicht überprüfbar sind. Einzig der Eindruck bleibt: die leeren Gänge, die geschlossenen Verkaufsflächen, die stillstehenden Rolltreppen, das Klagen Händler.
Weihnachtswunsch: bessere Geschäfte
Vom Weihnachtsmann wünsche sie sich bessere Geschäfte, sagt eine andere Frau, die mit Nikoläusen handelt. Vom Anhänger bis zum lebensgrossen Samichlaus – auf Skiern, im Schlitten, mit Saxofon – gibt es alles.
Weihnachten feiert sie selbst nicht: «Bei uns gibt es diese Tradition nicht. Weihnachten ist ein Geschäft. Wir verkaufen Weihnachtsartikel.» Und wie sie hoffen viele der Händlerinnen und Händler hier, dass sie bald wieder mehr verkaufen. Jetzt, wo China die Covid-Massnahmen lockert. Die Samichläuse und Plastiktannen stehen auf jeden Fall schön drapiert bereit. Schreibt SRF.
Hatte die MIGROS an der Hertensteinstrasse in Luzern 2019 im Erdgeschoss noch eine eigene Abteilung mit lauter Weihnachtsplunder chinesischer Herkunft, war von alledem in den Jahren 2020 bis zum heurigen Weihnachtsfest nichts mehr zu sehen.
Jetzt aber Hand aufs Weihnachtsherz: Hat jemand diesen billigen Ramsch aus China vermisst? Wer braucht schon einen Plastik-Blumenstrauch mit 200 LED-Lämpchen, die bereits zu Hause beim Auspacken von den Plastikästen fallen?
-
23.12.2022 - Tag des Altersstarssinns
Christoph Blocher: Dank an Ueli Maurer
Mit Bundesrat Ueli Maurer tritt auf Ende Jahr ein bescheidener, volksverbundener Staatsmann zurück. Ihm ging es immer um die gute Sache. Ueli Maurers Rücktritt mag durch die Tatsache erleichtert worden sein, dass die Bundesratskollegen und die Parlamentarier entgegen seinen Warnungen in jüngerer Zeit fast sämtliche Schleusen der Staatsfinanzen in unverantwortlicher Weise geöffnet haben.
Mit dem Zürcher Oberländer tritt eine Ausnahmeerscheinung aus unserer obersten Landesbehörde zurück, die sich um alle Stufen unseres Gemeinwesens verdient gemacht hat: vom Vereinsaktuar in seiner Gemeinde zum Gemeinderat, Kantonsrat, Kantonsratspräsidenten, Nationalrat und schliesslich Bundesrat. Wundert es uns, dass er eine seriösere, wirklichkeitsnähere Politik betrieb als die heutigen Jungspunde, deren Karriere vom Gebärsaal in den Hörsaal und dann in den Ratssaal verläuft? Zumal Ueli Maurer bis zur Wahl in die Landesregierung nie Berufspolitiker war, sondern daneben einem «anständigen» Beruf nachging. Dazu kamen zusammengezählt mehrere Jahre Militärdienst, die ihn bis zum Major der Radfahrertruppen führten. Dazu ist er Familienvater von sechs Kindern. Aber nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, diese medienwirksam ins Parlament zu schleppen – wie wir es heute bei pubertären Politikerinnen und Politikern erleben.
1996 bis 2008 führte er die SVP Schweiz, die damals von der viertstärksten zur stärksten Partei der Schweiz wurde.
Im Verteidigungsdepartement setzte sich Maurer hartnäckig für den Ausbau der Truppenstärke ein. Als Finanzminister sorgte er für einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Und ermöglichte eine rasche finanzielle Hilfe am Anfang der Covid-Pandemie. Dass Ueli Maurer keinerlei Allüren pflegte, zeigte er in seiner Schlussansprache, in der er sagte: «Bundesräte sind nicht mehr als Fussnoten der Geschichte.» Schreibt Christoph Blocher in seinen Regionalblättchen über Swiss Regiomedia AG.
Man kann Blocher bezüglich seiner Laudatio auf den abtretenden Bundesrat Ueli Maurer durchaus beipflichten. Maurer hat vor allem in der Krisenzeit rund um den ersten Corona-Lockdown so ziemlich alles richtig gemacht und Führungsstärke bewiesen. Dass er dann im zweiten Jahr der Pandemie im Zusammenhang mit den Querdenkern*innen aus der Trychlerszene ab und zu in seine alte Rolle als SVP-Parteipräsident schlüpfte, sei ihm verziehen.
Die Seitenhiebe Blochers auf die jüngere Politgeneration sind allerdings eher peinlich. Der Alte vom Herrliberg scheint dem Altersstarrsinn verfallen zu sein. Anders ist es kaum erklärbar, dass er als intelligenter Mensch den Wandel der Zeit, der auch vor den jungen Politikern*innen nicht Halt macht, kaum wahrnimmt geschweige denn akzeptiert.
Dass einer der Propheten aus der jungen Politgarde des heiligen Christophorus vom Herrliberg je nach Blickwinkel inzwischen mit seiner täglichen Videobotschaft über die YouTube-Seite der WELTWOCHE zum absolut peinlichen Clown mutiert, scheint Blocher entgangen zu sein.
Oder er bemerkt nicht, dass sein Zögling und Hardcore-Influencer Roger Köppel den durchaus vorhandenen Intellekt wie seinerzeit Mörgeli der untersten Schublade in Sachen Primitivität geopfert hat, um auch noch den letzten aller Vollpfosten aus der Querdenkerszene zu erreichen.
-
22.12.2022 - Tag der zweiten Meinung
Unsinnig, gefährlich, teuer: Die meisten Rücken-OPs sind überflüssig
Chirurgen in Deutschland operieren zwei- bis dreimal so oft an der Wirbelsäule wie ihre Kollegen in Frankreich oder England. Viele der Eingriffe sind unnötig, einige schaden dem Patienten, ein großer Teil ist rein wirtschaftlich begründet.
Mit Schrauben stabilisieren, mit Federn aufspreizen oder Bandscheiben ersetzen – in Deutschland hat sich in den letzten Jahren die Zahl der Operationen an der Wirbelsäule mehr als verdoppelt. Dabei ist ein chirurgischer Eingriff nach einer Erhebung der techniker-Krankenkasse in 85 Prozent der Fälle nicht nötig. Die Gründe liegen zum einen in wirtschaftlichem Kalkül (eine Operation bringt mehr Geld als die konservative Behandlung), zum anderen auch in der Ungeduld der Rückenpatienten, die schnell wieder funktionieren wollen. Umso schlimmer, dass viele Operationen gar nicht den erhofften Erfolg bringen.
Viele Patienten wollen nicht abwarten
„Dabei liegt es nicht an der Fähigkeit des Chirurgen oder den eingesetzten Techniken“, sagt der Wirbelsäulenspezialist Martin Marianowicz, der diese Probleme in seinem 2010 erschienenen Buch „Aufs Kreuz gelegt“ darstellt. Es wird also nicht zu schlecht operiert, aber oft zu schnell: 90 Prozent der Rückenprobleme gleicht der Körper in zwei bis drei Monaten selbstständig aus. Abwarten wäre also oft ein guter Rat. Zusätzlich helfen konservative Maßnahmen, wie Medikamente und Bewegungstraining. „Viele Patienten wollen oder können diese Zeit jedoch nicht aufbringen, müssen rasch wieder arbeitsfähig sein und entscheiden sich deshalb für eine Operation“, sagt Bernhard Meyer, Direktor der Neurochirurgischen Klinik und Poliklinik am Universitätskrankenhaus rechts der Isar.
Fatale "Bildergläubigkeit"
Eine weitere Ursache für die ausufernde Zahl von Rückenoperationen sind falsch interpretierte Röntgen- und Kernspinaufnahmen. Denn gerade für Wirbelsäulenprobleme gilt: Schäden, die das Untersuchungsbild aufdeckt, müssen nicht unbedingt Ursache der Beschwerden sein. Trotzdem ist die Orthopädie „bildergläubig“ und röntgen wird in vielen Praxen routinemäßig durchgeführt – bevor der Arzt den Patienten überhaupt zu Gesicht bekommen hat.
Zeigt die Aufnahme dann mehrere Probleme an der Wirbelsäule, was für die meisten der über-50-Jährigen zutrifft, rät der Arzt, den augenscheinlich massivsten Schaden möglichst rasch operieren zu lassen. Eine schlechte Empfehlung. Denn dieser muss nicht die Beschwerden auslösen. Eine ausgeprägte Veränderung kann nämlich fast symptomfrei bleiben, eine unauffällige Verengung oder Vorwölbung dagegen starke Schmerzen verursachen. Der Chirurg setzt also das Skalpell womöglich an der falschen Stelle an. Die Operation ist uneffektiv, die Beschwerden bleiben.
Schmerzempfinden individuell unterschiedlich
Allgemeine Behandlungsrichtlinien, die sich ausschließlich am Untersuchungsbild orientieren, sind also wenig sinnvoll. „Für die Orthopädie gilt in erster Linie, dass jede Veränderung, die der Arzt an der Wirbelsäule erkennt, unter der der Patient jedoch nicht leidet, keine Krankheit ist, sondern nur eine Erkenntnis, die meist keine Behandlung erfordert“, stellt Martin Marianowicz fest.
In diesem Zusammenhang gibt es auch Studien. So zeigt eine Untersuchung der Harvard University, dass von beschwerdefreien Patienten (Durchschnittsalter 70 Jahre) auf dem Röntgenbild 92 Prozent einen Bandscheibenvorfall aufwiesen, 40 Prozent eine Wirbelstenose (Einengung des Wirbelkanals).
Beschreibung sagt mehr als ein Röntgenbild
Wesentlich sinnvoller für Diagnose und erfolgreiche Behandlung ist es, den Patienten genau nach seinen Beschwerden zu befragen und sich nicht (ausschließlich) auf bildgebende Verfahren zu verlassen. Warum viele Ärzte die schnelle Röntgenuntersuchung der langwierigen Anamnese dennoch vorziehen, ist nachvollziehbar. Wenn für einen Kassenpatienten nur ein Honorar von rund 30 Euro pro Quartal zur Verfügung steht, rechnet der Arzt mit jeder Behandlungsminute. Die „Bildergläubigkeit“ als Mitursache von unnötigen Rückenoperationen ist also auch wirtschaftlich begründet. Im Hinblick auf die gesamten Gesundheitskosten erscheint das jedoch kurzsichtig: Die Kassen honorieren nicht das ausführliche Gespräch mit dem Patienten, zahlen jedoch oft fünfstellige Summen für die oft aufwändigen und oft sinnlosen Rücken-OPs.
Wann operiert werden muss
Allerdings gibt es auch medizinisch absolut notwendige Rückenoperationen. Für Bandscheibenvorfälle ist die Operation nur richtig, wenn Körperfunktionen leiden. „Bei ausgeprägten Lähmungen oder Störung der Blasen- und/oder Mastdarmfunktion ist eine Operation unumgänglich“, sagt Neurochirurg und Wirbelsäulenspezialist Bernhard Meyer, „Alles andere dagegen sind relative Operationsindikationen“, betont Bernhard Meyer.
Die häufigsten Rückenoperationen sind Eingriffe an der Bandscheibe und Entlastungs- sowie Stabilisierungmaßnahmen bei Stenosen (Verengungen von Wirbelkanälen). Von Wirbelsäulenspreizern, die gedrückten Bandscheiben Entlastung schenken sollen und die erst seit einigen Jahren auf dem Markt sind, hält Bernhard Meyer allerdings wenig. Der Goldstandard sei, unter Mikroskopsicht den Teil der Bandscheibe zu entfernen, der ausgetreten oder verschoben ist, auf Nerven drückt und damit die Probleme verursacht.
Hohe Erfolgsquoten
Etwas aufwändiger ist die Behandlung von Stenosen. Dabei entfernt der Chirurg winzige Knochenteile, um dem Nerv wieder genügend Raum zu geben. Wird dabei eine Stabilisierung des Bereichs nötig, setzt der Operateur Schrauben und Stäbe ein. Die Zufriedenheit von Patienten, die medizinisch notwendige OPs hatten nach einer dieser genannten Bandscheiben-, Stenosen- oder Stabiliserungsmaßnahmen beträgt 70 bis 80 Prozent, so das Ergebnis der nternationalen Studie SPORT (Spine Patient Outcomes Research-Trial). Lag jedoch eine relative Operationsindikation vor – etwa Bandscheibenprobleme, die keine funktionellen Lähmungen auslösen, sondern „nur“ Schmerzen sowie Taubheitsgefühle – ist die Erfolgsquote nach einem Jahr genauso hoch wie die von Patienten mit den gleichen Bandscheibenproblemen, die sich jedoch nicht operieren ließen, sondern sich für konservative Maßnahmen entschieden hatten und abwarteten.
Welchen Weg der Patient wählt, bleibt ihm also in den meisten Fällen selbst überlassen. „Auf keinen Fall sollte er sich dabei von Angst leiten lassen“, sagt Experte Bernhard Meyer. Weder durchs Abwarten – falls nicht bereits funktionelle Lähmungen vorliegen – noch durch die in den allermeisten Fällen erfolgreiche Operation würden Lähmungen drohen. „Hier verbreiten Ärzte oft unnütz Panik“, warnt der Wirbelsäulenspezialist. Eine Zweitmeinung einholen und sich einen Arzt suchen, der sich Zeit für die Untersuchung nimmt, ist der wahrscheinlich beste Weg. Schreibt FOCUS.
Dass nicht selten «unsinnige» medizinische Eingriffe in Kliniken vorgenommen werden, ist keine neue Erkenntnis. Darüber seriös zu berichten stellt sich aber leider oft als schwieriges Unterfangen dar.
Den Journalisten*innen fehlt bei diesem sensiblen und von Politik sowie Gesundheits-Industrie geschützten Thema in der Regel das medizinische Wissen, um die Behauptungen mit Fakten beweisen zu können. Die Halbgötter in Weiss wiederum stehen aus nachvollziehbaren Gründen nur selten als fundierte Experten zur Verfügung. Wer beisst denn schon gern in die Hand, die ihn füttert?
Hinzu kommt, dass viele Kliniken in den letzten Jahrzehnten privatisiert und an global agierende Gesundheitskonzerne aus aller Herren Länder verkauft wurden. Angeblich um die Kosten zu senken. Das Gegenteil ist eingetroffen.
Die Shareholder von Wallstreet, London Stock Exchange, Johannesburg Stock Exchange usw. reiben sich die Hände. In diesen Kreisen zählen nur Umsatz und Gewinn.
Dass selbst Ärzte*innen unter diesen Voraussetzungen und auf Druck des örtlichen Geschäftsführers Berufseid, Berufsethik und Moral beiseite schieben, liegt auf der Hand. Wer es trotzdem wagt, wird aussortiert. Genau darüber sprach kürzlich ein deutscher Arzt in einer Sendung der ARD. Ohne Gesichtserkennung und mit abgewandelter Stimme, wohlverstanden!
Dass aber seriöse Berichterstattung über unnötige Operationen wichtig ist, zeigen Erfahrungen mit der Brustamputation bei Brustkrebs. Nachdem die Medien vor circa zehn Jahren viele der damals beinahe exzessiv durchgeführten Brustamputationen als unsinnig anprangerten und damit ins Rampenlicht der Öffentlichkeit brachten, fand vor allem bei den betroffenen Frauen ein Umdenken statt.
Besonders der Hinweis auf die «zweite Meinung» wurde befolgt. Dadurch konnten bis heute zigtausende von unsinnigen Brustamputationen verhindert werden, ohne die Patientinnen damit dem Tod durch Brustkrebs zu opfern. Andere Behandlungsmethoden, die auch vorher schon bekannt waren, setzten sich durch.
Vertrauen in den Arzt ist nicht nur gut sondern wichtig. Geht es doch öfters um nicht weniger als um Leben oder Tod. Eine gewisse skeptische Vorsicht allerdings auch.
Ist man sich der Sache nicht sicher, hilft beim leisesten Zweifel eine zweite Meinung weiter. Denn wo immer Menschen am Werk sind werden Fehler gemacht.
-
21.12.2022 - Tag eines vorsintflutlichen Drehbuchs namens «Koran»
Taliban verbieten Universitätsbildung für Frauen
In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban ein Bildungsverbot für Frauen verhängt. Studentinnen werden mit sofortiger Wirkung von Universitäten ausgeschlossen.
Die radikalislamischen Taliban haben in Afghanistan Frauen die Universitätsbildung verboten. In einer Regierungserklärung wurden alle privaten und öffentlichen Universitäten angewiesen, das Bildungsverbot für Frauen bis auf Weiteres durchzusetzen. Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine Mitteilung des Ministeriums für Höhere Bildung. Unterzeichnet wurde die Erklärung demnach vom amtierenden Minister Scheich Neda Mohammed Nadim. Eine Begründung gab es nicht.
Der Schritt wird international heftig kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nannte das Verbot eine "beschämende Entscheidung". Die Taliban machten jeden Tag deutlich, dass sie die Grundrechte der Afghanen, insbesondere der Frauen, nicht respektierten, twitterte die Organisation. In einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verurteilten die Vertreterinnen und Vertreter der USA und Großbritanniens den Schritt. "Die Taliban können nicht erwarten, ein legitimes Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu werden, solange sie nicht die Rechte aller Afghanen respektieren, insbesondere die Menschenrechte und die Grundfreiheit von Frauen und Mädchen", sagte der US-Vertreter Robert Wood.
Nur wenige Stunden vor der Ankündigung hatte die neue UN-Sondergesandte für Afghanistan, Rosa Otunbajewa, in der Sitzung des Sicherheitsrats eine Verschärfung des Taliban-Regierungskurses bemängelt: "Wir haben eine Reihe von Einschränkungen erlebt, die besonders für Frauen schädlich sind", sagte Otunbajewa. "Ihr sozialer Raum wird nun ebenso eingeschränkt wie ihr politischer Raum."
Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Trotz internationaler Kritik halten die Taliban an ihrem Kurs fest.
Universitäten waren bereits gezwungen, neue Regeln einzuführen. So wurden Eingänge und Unterrichtsräume nach Geschlechtern getrennt. Frauen durften nur von anderen Frauen oder alten Männern unterrichtet werden. Auch weiterführende Schulen ab der siebten Klasse sind für Mädchen seit dem Machtwechsel geschlossen.
In Kabul ist Frauen seit einigen Monaten der Besuch in öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt. Schreibt DIE ZEIT.
Mit der Science-Fiction-Trilogie «Zurück in die Zukunft» (Back to the future) aus den Jahren 1985, 1989 und 1990 von Regisseur Robert Zemeckis schuf Hollywood drei Blockbuster, die Millionen von Menschen weltweit in die Kinos lockten.
Mit «Zurück in die Steinzeit» produzieren die Taliban keinen Blockbuster. Dafür aber eine menschliche Tragödie, unter der Millionen von Frauen in Afghanistan zu leiden haben.
Das Drehbuch für dieses vorsintflutliche Trauerspiel schrieb Mohammed. Religionsstifter, Prophet und Gesandter Gottes in Personalunion. Geboren irgendwann zwischen 570 und 573 in Mekka.
Regie in diesem für das 21. Jahrhundert unwürdigen Schauspiel führen die afghanischen Taliban. Sie berufen sich auf das «heilige» Drehbuch Mohammeds mit dem Titel «Koran». Finanziell unterstützt werden sie u.a. von Katar und den westlichen Hilfsgeldern.
Für die wissenschaftliche Bedeutungslosigkeit islamischer Länder, die rund ein Fünftel der gesamten Weltbevölkerung stellen, gibt es Gründe. Der Koran ist einer davon. «Islamische Wissenschaftler waren einmal Weltspitze - wenn auch vor tausend Jahren. Als sich das mittelalterliche Europa fest im Griff der Kirche befand, waren es islamische Gelehrte, die das antike wissenschaftliche Erbe der Griechen wiederentdeckten, bewahrten und weiterentwickelten. Vom neunten bis zum 13. Jahrhundert erlebte der Islam eine Blütezeit der Wissenschaften. Doch das Blatt wendete sich: Während Europa sich im Zuge der Aufklärung vom Diktat der Kirche freimachte, gewannen in der islamischen Welt fundamentalistische Strömungen die Oberhand. Der Islam wurde rigider, die auf islamischem Recht basierenden Gesellschaften unfreier. Eine Entwicklung, die bis heute anhält: In Saudi-Arabien ist der dogmatische und konservative wahhabitische Islam Staatsdoktrin.*»
* DER SPIEGEL: «Forschung in islamischen Ländern: Wissenschaft im Namen Allahs»
-
20.12.2022 - Tag der Lieferketten und Schweinedärme
Die kongenialen Brüder: «America First!» hilft deutscher Autoindustrie
"Wir müssen sicherstellen, dass die Zukunft in Amerika gebaut wird." US-Präsident Biden hat die Elektromobilität entdeckt und fährt schwere Geschütze auf: Milliardenschwere Subventionen sollen die heimische Wirtschaft reindustrialisieren. China wiederum soll außen vor bleiben. Und die deutschen Autobauer?
Der Mensch ist zwar bekanntlich seines Glückes Schmied, manchmal jedoch muss er auch zu seinem Glück gezwungen werden. So ähnlich lässt sich die Situation der deutschen Autoindustrie beschreiben, will man die Folgen des Gesetzesvorhabens der US-Regierung unter Präsident Joe Biden - den sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) - auf die hiesigen Hersteller wie Zulieferer herunterbrechen. Mit diesem "Inflationssenkungsgesetz" will die US-Regierung ein 738 Milliarden Dollar schweres Investitions- und Subventionsprogramm auf den Weg bringen, das nicht nur die Inflation bekämpfen und das Klima schützen soll.
Das Gesetz zielt auch auf den grünen Umbau der US-Wirtschaft ab - und damit auch des Automobilmarktes. Zudem sollen damit geopolitisch China und Russland in die Schranken gewiesen werden. "IRA" ist die praktische Umsetzung des Trump-Mottos "MAGA!" - "Make America Great Again!"
Fördern und fordern
Was will Biden? Bis 2030 sollen 50 Prozent der im Land verkauften Neuwagen über einen alternativen Antrieb verfügen - das schließt neben reinen Elektroautos auch Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge mit ein: "Die Zukunft der Autoindustrie ist elektrisch, und es gibt kein Zurück mehr. Die Frage ist, ob wir vorangehen oder zurückfallen", erklärte der US-Präsident. Damit werden die USA zum Gamechanger bei der klimafreundlichen Ausrichtung der Mobilitätspolitik zugunsten des Elektroautos.
Ab 2023 gewährt die US-Administration gestaffelte Subventionen von 7500 Dollar Grundzuschuss beim Kauf eines Elektroautos, zuzüglich 2500 Dollar für Fahrzeuge, deren Endmontage in Nordamerika stattfindet. Weitere 2500 Dollar gibt es, wenn die E-Autos in gewerkschaftlich organisierten US-Werken produziert werden. Gefördert werden Elektroautos bis zu einer Preis-Obergrenze von 50.000 Dollar bei PKW und 80.000 Dollar bei den in den USA so beliebten SUV/Pick-ups. Die Batterien müssen größer als sieben Kilowattstunden sein, und die Subventions-Empfänger dürfen nicht mehr als 150.000 Dollar Jahreseinkommen haben. Tesla-Fahrzeuge ebenso wie die meisten deutschen Marken erfüllen diese Bedingungen nicht, GM und Ford aber schon.
Aber die Regierung Biden fördert nicht nur, sie fordert auch. An die Kaufsubventionen für E-Autos angehängt ist eine Lösung der strategischen Abhängigkeit der USA von bisher unverzichtbaren Rohstoff- und Batterie-Importen aus China. Angestrebt wird eine Reindustrialisierung der USA durch Ersatz von Importen durch Produktion in den USA selber. Konkret müssen ab 2023 für die steuerliche Förderfähigkeit 40 Prozent der kritischen Ressourcen in einer Traktionsbatterie wie etwa Lithium aus den USA oder einem Land stammen, das ein Freihandelsabkommen mit den USA hat. Zum Beispiel aus Kanada (USMCA). Dieser Wert steigt jährlich um 10 Prozentpunkte bis auf 80 Prozent für 2027. Bei den Materialien, die nicht als kritisch bewertet werden - Stahl etwa -, wächst der Mindestanteil von 50 Prozent für 2023 auf 100 Prozent für 2029. Deutschland wäre außen vor.
"Besonders besorgniserregende Länder"
Ab 2025 dürfen US-Elektroautos keine Rohstoffe aus China oder Russland mehr enthalten - für die Zellenproduktion der Speicherbatterien ein K.-o.-Kriterium. Kritische Metalle, die aus einem "country of particular concern" stammen, sind ab dann tabu, will man die Steuergutschrift in Anspruch nehmen. Und das wollen alle Hersteller, denn nirgendwo ist die Marge so hoch, als dass ein Autobauer eine solche Summe aus eigener Tasche bezahlen könnte, will er mit IRA-konformen Anbietern konkurrieren.
Auf dieser Liste der "besonders besorgniserregenden Länder" stehen unter anderem Russland und China. China ist nicht nur das Land, das mit CATL und BYD zwei der drei größten Batterieproduzenten weltweit beheimatet, deren Batterien in jedem Elektroauto deutscher Provenienz stecken. (Tesla arbeitet dagegen mit Panasonic.) Aus China kommen auch sehr große Anteile des Graphits, das in faktisch allen heutigen Zellen als Anodenmaterial verwendet wird. Zusätzlich veredelt China Lithium aus Ursprungsländern wie Australien in großen Mengen zu Lithiumhydroxid. Die Abhängigkeit von China bei der Lieferkette ist enorm - für fast alle europäischen und asiatischen Autobauer.
Die Anordnung des Präsidenten werde es den USA ermöglichen, die "Zukunft des E-Autos voranzutreiben, China zu überholen und die Klimakrise anzupacken", teilte das Weiße Haus mit. "Wir müssen sicherstellen, dass die Zukunft in Amerika gebaut wird." Damit ändern sich die Marktzugangsvoraussetzungen in den USA total: Für chinesische Anbieter entfallen sie komplett. Die Pläne junger chinesischer Autobauer, erst den US-Markt und dann von dort aus Europa zu erobern, wurden somit über Nacht Makulatur. Für europäischen Autohersteller erfordern die Pläne eine komplette Umstellung in Produktion, Logistik und Vertrieb. Und für deutsche Autobauer? Ihre aktuellen Logistikströme bei Produktion und Absatz sind quantitativ kaum betroffen. Für die Zukunft müssen allerdings gravierende Änderungen sämtlicher Werks-, Produktions- und Absatzplanungen erfolgen.
Schnell zu TTIP?
Aus "IRA" ergeben sich folgende Konsequenzen für die deutsche Autoindustrie: Derzeit ist kein deutsches Modell förderfähig, da auch der VW ID.4 die Preisobergrenze überschreitet. Gleichzeitig dürfte der Konkurrenzdruck von unten deutlich zunehmen. Und die zukünftigen Auswirkungen werden noch gravierender: Alle E-Produktionsstandorte und Lieferantennetzwerke weltweit müssen neu sortiert werden. Das bedeutet eine Korrektur der bisherigen Werksstrukturpläne und einen totalen Umbau des Lieferantenpools, den Stopp aller bisherigen Pläne außerhalb der "IRA"-Region und den Neubau von Werken in Nordamerika. VW hat bereits den Werksneubau für E-Autos in Wolfsburg oder der Giga-Batteriefabrik in Braunschweig abgeblasen und die Verlagerung nach Nordamerika angekündigt. Volkswagen wird den ID.4 künftig nicht mehr aus Zwickau zuliefern, sondern muss ihn für den US-Markt an einem neuen Produktionsstandort in Tennessee bauen.
Wollen die deutschen Autohersteller am künftigen Wachstum des globalen Elektroautomarkts teilhaben, müssen sie in allen drei Hauptabsatz-Regionen der Welt autonom vertreten sein. Rund 98 Prozent des heutigen Welt-Absatzes von Elektroautos werden in China, den USA und in Europa erzielt.
Mit "IRA" hat die Biden-Administration die Initiative zur Lösung von Abhängigkeiten ergriffen und damit den übrigen Staaten und Unternehmen die Last eigener Entscheidung abgenommen. Vogel, friss oder stirb! Freiwillig das Notwendige zu tun, erspart viel Frust. Man muss das nicht schlecht finden. Für Europa rächt es sich nun aber, dass das Freihandelsabkommen TTIP bis heute nicht in Kraft gesetzt wurde. Aber das könnte sich nun - dank "IRA" - schnell ändern. Schreibt NTV.
US-Präsident Joe Biden wurde von Donald Trump im Wahlkampf mit Vorliebe als «sleepy Joe» bezeichnet. Der «schlafende Joe» Biden. Mit einem kurzen Nickerchen während einer landesweit gesendeten TV-Sendung und seinem schleppenden Gang lieferte Biden dem Widersacher die Steilvorlage für den Kalauer.
Doch während The Donald während seiner Präsidentschaft nur wenige seiner Versprechen wahr machte, ist «sleepy Joe» aufgewacht. Mit dem «Inflation Reduction Act» (IRA), einem gigantischen Subventionsprogramm, verknüpft Biden einen Wahlkampfslogan Trumps mit dem IRA: «I'll bring back the jobs from China to the USA.»
Der IRA ist viel mehr als bloss ein Instrument zur Bekämpfung der US-Inflation. Er subventioniert nicht nur die US-Automobilbranche und deren Zulieferer wie in vorliegendem Artikel ausgiebig erklärt, sondern auch etliche andere, teilweise systemrelevante US-Industriezweige. So werden beispielsweise auch Kraftwerkbauer subventioniert, wenn sie die Lieferketten-Vorschriften aus dem IRA einhalten. Oder Chip-Fabriken.
Joe Biden trat an mit dem Versprechen, die gespaltene Nation wieder zu einen. Mag er auch mal auf der Gangway der Air Force One stolpern, ist er dennoch ein erfahrener Politiker, der im Gegensatz zu Trump auf seinen Beraterstab hört und kluge Entscheidungen trifft.
Biden ist sich bewusst, dass die Demokraten die nächste US-Präsidentschaftswal 2024 nur gewinnen, wenn sie Erfolge auf dem Arbeitsmarkt vorweisen können. Quasi das von Trump nicht eingehaltene Versprechen «I'll bring back the jobs from China to the USA» in die Tat umsetzen. Aus welchem Land die Jobs letztendlich zurückgeholt werden, spielt eine eher untergeordnete Rolle.
Hauptsache Job. Denn jeder in die USA «zurückgeholte» Arbeitsplatz bedeutet eine oder gar mehrere Wählerstimmen. Biden auf Roosevelts Spuren oder, anders ausgedrückt, «America First» der leisen Töne. Effizientes Handeln mit einem Hauch von «Vogel friss oder stirb» statt längst gescheiterten Fantasie-Parolen wie «Wandel durch Handel».
Autarkie statt exzessiven Lieferketten rund um den Erdball würden nicht zuletzt auch dem Klima helfen, sich langfristig wieder zu erholen. Auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, ist das leider eine andere Geschichte.
Schweizer Schweinedärme werden auch weiterhin für die Wurst einmal um den Globus zirkulieren. Die Verarbeitung in der Schweiz wäre nämlich 16 Rappen, ja Sie lesen richtig: 16 Rappen teurer als in China. Das sollten Sie sich nun zusammen mit einer Olma-Bratwurst samt IGP-Label* auf der Zunge zergehen lassen.
Von der Mutter des Kapitalismus Amerika lernen heisst siegen lernen. Nicht immer. Aber immer öfter.
* IGP-Label: «In der Region erzeugt, verarbeitet und veredelt.» Was schlicht und einfach gelogen ist. Dafür sorgt eine Ausnahmeregelung.
-
19.12.2022 - Tag der alarmistischen Experten
Experte William Gumede (52) warnt gar vor neuem Kalten Krieg: Russland baut seine Macht in Afrika aus
Der afrikanische Kontinent spielt eine wichtige Rolle in der russischen Aussenpolitik. Dies begünstigt den Zerfall afrikanischer Demokratien, ist sich ein Experte sicher.
30’370’000 km², 1216 Milliarden Einwohner, 54 Staaten – Afrika auf seiner Seite zu haben, bedeutet, den zweitgrössten Kontinent – in Sachen Bevölkerung und Fläche – seinen Verbündeten nennen zu dürfen. Dessen sind sich auch China, Russland und der Westen bewusst.
Kein Wunder also, dass der amerikanische Präsident Joe Biden (80) vor wenigen Tagen afrikanische Staatsoberhäupter nach Washington eingeladen hat. «Afrikas Erfolg ist der Erfolg der Welt», lässt er sich auf der Regierungswebsite zitieren. Russland und die USA haben sich in den vergangenen Monaten in Afrika die Türklinke gereicht. Zuerst besuchte der russische Aussenminister Sergei Lawrow (72) im Sommer den Kontinent, kurz darauf machte sich sein US-amerikanischer Amtskollege Antony Blinken (60) auf den Weg in den Süden.
Der Hintergrund: der Krieg in der Ukraine und die ausbleibende Verurteilung durch die afrikanischen Staaten. Denn diese leiden besonders unter dem Krieg und den Sanktionen – alles wird teurer, Getreidelieferungen bleiben aus. Die beiden Blöcke – die USA und Russland – versuchen, afrikanische Staatsoberhäupter von ihren Ansichten zu überzeugen. Aber vor allem die russische Version scheint nach wie vor Gehör in Afrika zu finden.
Russland will in Afrika Verbündete finden
«Es herrscht ein neuer kalter Krieg zwischen den USA und Russland», meint William Gumede (52), Gründer und Vorsitzender der südafrikanischen Organisation Democracy Works, im Gespräch mit Blick. Für ihn scheint aber bereits jetzt klar zu sein: In diesem kalten Krieg wird es wohl eindeutige Verlierer geben: der Westen, für den die USA im weitesten Sinne stellvertretend stehen – und die Demokratie.
Denn vor allem der russische Einfluss sei in afrikanischen Regierungen immer stärker spürbar, so Gumede. Eine Entwicklung, die ihm Sorge bereitet, für ihn allerdings wenig überraschend ist. «Der Krieg gegen die Demokratie in Afrika dauert schon lange an – seit über zwei Jahrzehnten.»
So sind beispielsweise Kämpfer der Wagner-Gruppe seit 2021 in Mali stationiert, deutsche und französische Blauhelm-Operationen wurden kürzlich unterbrochen. Michel Wyss (35), Experte für Stellvertreterkriegsführung an der Militärakademie der ETH Zürich, erklärte Blick im Juni: «Russland bietet sich, wie bereits zuvor in anderen afrikanischen Ländern, als Sicherheitspartner an. Offiziell wird die Wagner-Gruppe eingesetzt, um malische Sicherheitskräfte auszubilden.»
Es sei kein Zufall, dass sich ausgerechnet russische Söldner dem «Schutz» von Mali angenommen haben. «Moskau versucht gezielt, seine Machtposition in Afrika auszubauen», so Wyss. Während die politische Instabilität in Mali zu einem Zerwürfnis mit Europa geführt habe, eröffne sie Russland neue Möglichkeiten in Afrika.
«Sie sehen Putin als Vorbild»
Länder wie Russland und China würden seit Jahren ihren Einfluss auf Afrika ausweiten, auch wirtschaftlich. «Russland und China haben sehr viel in Afrika investiert. Natürlich nicht ohne Hintergedanken», sagt Gumede. «Sie wollen Verbündete finden – denn Russland ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg vom Westen isoliert worden.»
Afrikanische Regierungsoberhäupter scheinen Gefallen an den autokratischen Tendenzen Russlands zu finden. Gumede erklärt: «Während die afrikanische Bevölkerung ganz klar für die Demokratie ist, wollen Regierungsführer diese gar nicht.»
Und schlimmer noch: «Afrikanische Spitzenpolitiker sehen Wladimir Putin (70) als Vorbild.» Dies sei auch der Grund, weshalb viele afrikanische Nationen den Krieg in der Ukraine nicht verurteilten oder diesen gar befürworten. «In Afrika freut man sich, dass Putin dem Westen mit dem Krieg eine Ohrfeige verpasst hat.»
Westen muss sich mit Afrika auseinandersetzen
Und was macht der Westen? «Nichts», meint Gumede. «Der Westen hat kaum mitbekommen, dass das alles passiert – und jetzt ist es beinahe zu spät.» Denn der Westen würde sich nur um Afrika kümmern, wenn der Kontinent für den Westen nützlich sein könnte, meint Gumede. So wie jetzt. Aus diesem Grund wirken auch Bidens Aussagen eher heuchlerisch als unterstützend.
Das Ruder herumzureissen könnte schwierig werden, prophezeit Gumede. Denn: «Der Westen wurde in Afrika schon vor langer Zeit durch Russland ersetzt.» Um die Gunst von Afrika zurückzuerobern, müsse der Westen vor allem eins tun: «Sich wieder langfristig und differenziert mit dem afrikanischen Kontinent auseinandersetzten.» Und das dringender denn je, findet Gumede. Schreibt Blick.
Dass der «Westen nichts macht», ist eine bedenkliche Aussage des «Experten» William Gumede aus Südafrika und deckt einmal mehr auf, dass gegenüber den selbst- oder durch die Medien ernannten «Experten» eine gewisse Skepsis durchaus angebracht ist. Die Behauptungen halten häufig einem Faktencheck nicht stand.
Das ist auch bei diesem Blick-Artikel der Fall. Bis auf die Tatsachen, die ohnehin schon längst bekannt sind. Dass China (an erster Stelle) und Russland (als Juniorplayer) mit langfristig – auch für Afrika – äusserst gefährlichen Strategien den Kontinent Afrika umgarnen, ist nun wirklich keine Neuigkeit.
Dafür aber die Tatsache der hohen Verschuldung afrikanischer Staaten gegenüber China, das für seine strategischen und auf einen langen Zeit-Horizont angelegten Investments reichlich Zinsen fordert.
Zinsen und Rückzahlungen, die von einigen Staaten Afrikas bereits jetzt nicht mehr geleistet werden können und umgeschichtet werden müssen. Zum Beispiel mit der Abtretung von fruchtbarem Ackerland zum Wohle Chinas für die nächsten 50 Jahre oder Lizenzen für den Abbau ertragreicher Minen, in denen wertvolle Bodenschätze lagern und wo dann wirklich nur noch China das Sagen hat.
Auf den von chinesischen Staatsfonds gekauften Ländereien wächst meist Getreide für die eigene Bevölkerung. Die Afrikaner arbeiten für Hungerlöhne, sofern China nicht eigene Arbeitskolonnen entsendet. Die Lebensmittel werden komplett nach China verschifft. Pikantes Detail: China kauft oder pachtet nur die fruchtbaren Ländereien im Uferbereich grosser Flüsse. Den Afrikanern bleibt das dürre Hinterland. Neo-Kolonialisierung vom Feinsten. An der übrigens auch der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé nicht unwesentlich beteiligt ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Für beide Seiten eine tickende Zeitbombe. In welchen Turbulenzen solch gravierende Abhängigkeiten von China enden können, wurde kürzlich in Sri Lanka sichtbar. Der Westen erlebt sein Abhängigkeits-Waterloo derzeit mit Russland. Das mit China steht ihm noch bevor.
China zeigt den Afrikanern, wer Koch und wer Kellner ist. Der chinesische Aussenminister äusserte sich an einer Geberkonferenz in Brüssel mit einem süffisanten Lächeln über Afrikas industrielle Fähigkeiten wie folgt: «Afrika ist nicht in der Lage, einen Kugelschreiber herzustellen.»
Den eher peinlichen technologischen Rückstand Chinas, das bis 2017 die Schreibspitze mit der Schreibkugel noch aus dem Westen importieren musste – vorwiegend aus Deutschland, Frankreich, Japan und der Schweiz –, verschwieg Wang Yi mit vornehmer Zurückhaltung.
Dass sich Russland mit seinen Söldnerbanden auf dem afrikanischen Kontinent in militärische Scharmützel einmischt, ist schon lange bekannt. Ob diese Strategie für Russland langfristig tatsächlich Früchte trägt, ist fraglich. Kriege produzieren nicht nur Sieger, sondern auch Verlierer. Am afrikanischen Stammesverhalten sind schon andere Grossmächte als nur Russland gescheitert.
Zumal man sich fragen darf, was Russland ausser Söldnern, Waffen und Getreide dem afrikanischen Kontinent zu bieten hat. US-Senator John McCain formulierte es einst so: «Russland ist eine Tankstelle mit angeschlossenem Land. Obervolta mit Atomwaffen.» Mit dieser Aussage lag er nicht mal weit daneben.
Letztendlich ist der Westen in Afrika nicht gescheitert, weil er nichts getan hat wie Gumede behauptet, sondern weil aus törichtem Mitleid die falschen Instrumente in ein Fass ohne Boden versenkt wurden. Etwa zwei Billionen Dollar westliche Entwicklungshilfe hat Afrika in den letzten Jahrzehnten erhalten.
Gebracht haben diese Hilfsgelder nichts, meinen selbst afrikanische Ökonomen. Sie machen die Entwicklungshilfe und das westliche Mitleid sogar dafür verantwortlich, dass Afrika immer ärmer wird. Als logische Folge dieser Misere wird der Westen zunehmend mit immer grösser werdenden Flüchtlingskolonnen geflutet.
An der Armut und den Flüchtlingsbewegungen Afrikas wird sich nichts ändern, solange der afrikanische Kontinent die Geburtenrate nicht in den Griff bekommt. So viel Wahrheit muss schon sein! Auch wenn Papst Franziskus das nicht gerne hört, sind doch die Kinder Geschöpfe Gottes. Das mag so sein, aber produziert werden sie immer noch von den Menschen. Nicht immer mit göttlichen Absichten.
Die afrikanischen Staaten sollten sich ihren derzeit grossen Freund und Förderer China zum Beispiel nehmen. Ohne die von Diktator Mao verfügte Ein-Kind-Politik wäre China heute von etwa 2,5 bis 3 Milliarden Menschen bevölkert und noch immer ein Hunger- und Elendsland. Aber definitiv keine Weltmacht. Der Diktatoren mit absoluter Verfügungsmacht gäbe es ja genug in Afrika.
So einfach ist das alles zu erklären, wenn man kein Experte ist. Dafür aber realistisch und faktenbasiert. Ohne unangenehme Wahrheiten unter den Teppich zu kehren.
-
18.12.2022 - Tag der gelebten Schweizer Neutralität
Genfer Chip in russischen Raketen: Putin tötet mit Schweizer Technik
Britische Forscher fanden Schweizer Elektronik in Putins High-Tech-Raketen Kh-101. Mit ihnen bombardiert Russland seit Monaten Zivilisten und die Energieversorgung.
Dunkelheit, Kälte, Angst: Russlands Machthaber Wladimir Putin terrorisiert die Ukraine mit gezielten Angriffen auf die Energieversorgung. In vielen Teilen des Landes ist die Bevölkerung ohne Strom und Heizung – bei Temperaturen weit unter null.
Möglich macht dies auch Schweizer Technik in Hightech-Raketen vom Typ Kh-101. Sie fliegen mit dem Chip einer Genfer Firma.
Ein Forscherteam der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute (Rusi) hat Überreste der Raketen in der Ukraine untersucht – und fand Mikroprozessoren von STMicroelectronics. Der Grosskonzern mit Produktionsstätten in Italien, Frankreich und Singapur hat seinen Hauptsitz in Plan-les-Ouates im Kanton Genf.
Sieben Meter lang sind die Geschosse, die von einem Flugzeug abgefeuert werden. Sie tragen eine halbe Tonne Sprengstoff. Ihre Reichweite: bis zu 2800 Kilometer. Weil die Kh-101 besonders tief fliegen, haben Radarsysteme Mühe, sie zu entdecken. Das macht sie für die Russen zu einer der wichtigsten Waffen im Krieg gegen das Nachbarland.
Keine Antwort aus Genf
Zuletzt kamen Kh-101 am 23. November in grossem Stil zum Einsatz, als Moskau Kiew in den Blackout bombte. Mehrere Menschen starben.
Weiss das Genfer Unternehmen, dass in den Marschflugkörpern des Kremls seine Mikrochips verbaut sind? Der Konzern antwortete nicht auf Fragen des SonntagsBlicks.
Stellung nimmt dagegen der Bund. Antje Baertschi, Sprecherin beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), sagt: «Wir haben Kenntnis von Komponenten mit Bezug zur Schweiz, die in russischen Waffensystemen in der Ukraine aufgefunden worden sind.»
Zu einzelnen Herstellern will sich das Seco nicht äussern. Bisherige Abklärungen hätten ergeben, dass es sich bei den Bauteilen um industrielle Massengüter handle, die bis zum Kriegsbeginn Ende Februar keinen Handelsbeschränkungen unterlagen.
Das änderte sich am 4. März, als Bern den Verkauf zahlreicher Elektronikteile nach Russland verbot. Die Massnahmen wurden mehrmals verschärft. Seco-Sprecherin Baertschi: «Die Güter wären zur Lieferung und zum Verkauf (...) aufgrund der Sanktionen nun verboten.»
Kommt hinzu: Da die Mikrochips der Genfer Firma wohl auch an Produktionsstandorten im Ausland hergestellt werden, gelten für sie zusätzlich auch Exportregeln anderer Länder.
Der Chip ist nicht das einzige Schweizer Bauteil in Putins Kriegsmaschinerie. Die Forscher von Rusi kommen in ihrem Report zum Schluss: «Die Schweiz ist der viertwichtigste Hersteller von Komponenten, die in russischen Waffensystemen gefunden wurden.» Neben der Genfer Firma STMicroelectronics erwähnen die Briten den Thalwiler Konzern U-blox, ein früheres Spin-off der ETH. Wie SonntagsBlick bereits im Juni publik machte, fliegen Moskaus Orlan-Drohnen mit einem GPS-Modul der Firma. U-blox argumentiert, es sei schwierig zu erkennen, «wo etwas am Schluss landet».
Die Elektronik aus dem Westen ist zentral für Putins Krieg. Moskau braucht sie, um neue Drohnen und Raketen herzustellen. Aufgrund der Lieferverbote fehlt es ihm aber zunehmend an Nachschub.
Russland braucht Halbleiter und Konnektoren
Die US-Zeitung «Politico» machte kürzlich eine vertrauliche Liste aus dem Verwaltungsapparat in Moskau publik, auf der dringend benötigte Bauteile stehen. Bei den gesuchten Komponenten handelt es sich vor allem um Halbleiter, Transformatoren, Stecker und Transistoren. Weil sich der Kreml in den vergangenen Jahren auf westliche Zulieferer verlassen habe, sei Russland nicht in der Lage, diese Teile selber herzustellen.
Auf der Liste tauchen auch Schweizer Produkte auf. Mit «Priorität zwei, wichtig» sucht Russland Konnektoren der Schaffhauser Firma TE Connectivity. Eigentlich sind sie Massenware – der Stückpreis liegt unter zehn Franken. Moskau benötigt sie aber dringend. Auch TE Connectivity reagierte nicht auf Fragen.
US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war nach den Angriffen am 23. November optimistisch, Russland werde «wegen der Handelsrestriktionen für Mikrochips und andere Dinge nicht in der Lage sein, schnell Präzisionsmunition zu reproduzieren».
Ein Bericht der englischen Forschungsgruppe Conflict Armament Research (CAR) vom 5. Dezember zweifelt Austins Aussage nun an. Die Waffenexperten untersuchten Trümmer russischer Kh-101-Raketen, die der Kreml vor einem Monat auf die Ukraine abfeuern liess, und stellten fest: Einer der Marschflugkörper wurde zwischen Juni und September 2022 hergestellt, ein anderer zwischen Oktober und November 2022. Ob Russland die westlichen Bauteile noch vorrätig hatte oder ob sie trotz Sanktionen nach Russland gelangten, ist nicht bekannt.
Klar ist: Putin setzt seinen Zermürbungskrieg fort. Am Freitag startete Russland eine neue Angriffswelle und legte erneut grosse Teile der ukrainischen Stromversorgung lahm. Die Folgen: Dunkelheit, Kälte, Angst. Und Tote. Schreibt der SonntagsBlick.
Tja, was will man gegen die «gelebte Neutralität» der Schweiz tun? In einer globalisierten Wirtschaft mit Produktionsstandorten auf allen Kontinenten sind viele der über Russland verhängten Sanktionen schlicht und einfach nicht durchzusetzen.
Putins Russland zahlt möglicherweise etwas höhere Preise für sanktionierte Produkte, die es dringend braucht.
Das spielt aber keine grosse Rolle. Die russische Staatskasse ist dank den extrem gestiegenen Preisen für Gas und Erdöl derzeit noch immer prall gefüllt.
-
17.12.2022 - Tag der failed States und Lachnummern
Hochmodernes Kampfgerät: Kommandeur: Totalausfall von Schützenpanzer "Puma"
Eigentlich sollen die neuartigen Schützenpanzer "Puma" im kommenden Jahr bei der Schnellen Eingreiftruppe der NATO eingesetzt werden. Doch es kommen Zweifel an der Zuverlässigkeit auf. Nach einer Schießübung mit 18 "Puma" meldet ein Kommandeur der Bundeswehr einen Totalausfall.
In einer vertraulichen Brandmail an den Inspekteur des Heeres hat der Kommandeur der 10. Panzerdivision in dieser Woche gemeldet, dass nach einer Schießübung von 18 hochmodernen Schützenpanzern des Typs "Puma" kein einziger einsatzbereit ist. Nach Informationen des "Spiegel" sollten sie im kommenden Jahr für die Schnelle Eingreiftruppe der NATO eingesetzt werden. Die letzten beiden noch einsatzbereiten "Puma" seien "am gestrigen Schießtag nach anderthalb Stunden mit Turmdefekten" auch noch ausgefallen, schreibt Generalmajor Ruprecht von Butler.
Die Art der Mängel seien der Truppe bereits bekannt gewesen, heißt es in der Mail, sie seien "allerdings noch nie in dieser Häufigkeit" aufgetreten. Damit sei nicht zu rechnen gewesen, denn die Systeme seien nur auf Schießbahnen in der norddeutschen Tiefebene bewegt und dort "nicht übermäßig beansprucht" worden. Nach Einschätzung des Schirrmeisters der betroffenen Kompanie, die er für sehr glaubhaft halte, schreibt der General, "müssen wir davon ausgehen, dass die volle Einsatzbereitschaft der Kompanie erst wieder in drei bis vier Monaten hergestellt werden kann".
"Sie können sich vorstellen, wie die Truppe die Zuverlässigkeit des Systems 'Puma' nun bewertet", meldet er dem Heeresinspekteur, "die Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs wird trotz aller guten Vorbereitungen zum Lotteriespiel, ich muss es leider so hart ausdrücken." Mit der üblichen Zuverlässigkeit deutscher Landfahrzeuge sei dies nicht zu vergleichen. "Dies ist gerade auch für die mir unterstellte Truppe belastend." Da der "Puma" voraussichtlich bis Ende April 2023 nun nicht zur Verfügung stehen werde, werde er ihn bei der schnellen Eingreiftruppe der NATO "bis auf Weiteres" durch den alten, aber bewährten Schützenpanzer "Marder" ersetzen.
Der von zahlreichen technischen Problemen geplagte Schützenpanzer "Puma" war erst im vergangenen Jahr für gefechtstauglich erklärt worden. Das von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und der Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS) entwickelte und produzierte Gefechtsfahrzeug hatte zuvor schon als "Pannenpanzer" Schlagzeilen gemacht. Schreibt NTV.
Seit dem Zusammenbruch der UdSSR und dem «Eisernen Vorhang» suhlt sich Deutschland in der sogenannten «Friedens-Dividende». Das Ministeramt für die Deutsche Bundeswehr wurde seither mit wenigen Ausnahmen an unfähige Parteimitglieder delegiert.
Mit der Unfähigkeit der zuständigen Minister*innen wurde auch die Korruption innerhalb des Departements gefördert. Besonders im Bereich der Auftragsvergabe. Wer an dieser Behauptung Zweifel hegt, kann sich über Google orientieren.
Das wirtschaftlich wichtigste Land der EU verwandelt sich – einmal mehr – langsam aber sicher zum «failed State» und die Deutsche Bundeswehr als dominierendes Mitglied der NATO in Europa zur absoluten Lachnummer.
-
16.12.2022 - Tag des Newtonsches Gravitationsgesetzes
Heftiger Tag für Aktienmärkte: Darum gehen plötzlich alle Börsen auf Tauchgang
Für Anlegerinnen und Anleger war der Donnerstag ein rabenschwarzer Tag. Die erneuten Zinsschritte der Zentralbanken lösten an den Börsen einen regelrechten Ausverkauf aus. Zahlreiche Aktien tauchten um 4 und mehr Prozent. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.
Für Anleger war der Donnerstag ein schwarzer Tag: Mit dem SMI hat der grösste Schweizer Index 2,51 Prozent eingebüsst. Der deutsche DAX rasselte gar um 3,28 Prozent runter. Und auch in den USA erlebten die wichtigsten Indizes gestern eine heftige Talfahrt. Der Dow Jones sank um 2,25 Prozent, der US-Techkonzern-Index Nasdaq gar um 3,37 Prozent. Die Aktienmärkte preisen die künftige Entwicklung eigentlich ein, wurden gestern von den harten Zinsschritten der grossen Zentralbanken aber dennoch auf dem falschen Fuss erwischt. Heute Freitag sind die Zeichen tiefrot. Die japanische Börse schliesst im Minus, der Schweizer Leitindex startet mit Verlusten.
Warum haben die Märkte auf die Zinserhöhungen so stark reagiert?
Die Anleger haben aufgrund der rückläufigen Inflation in den USA oder der EU erwartet, dass die Banken bei den Zinserhöhungen vom Gaspedal gehen. Das ist gestern zwar geschehen. So hat die US-Notenbank Fed die Zinsen «nur» um 0,5 Prozentpunkte erhöht, nachdem sie zuvor viermal 0,75 Prozentpunkte draufgepackt hatte. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) haben gestern bei den Zinserhöhungen das Tempo bei den Zinsschritten reduziert. Einige Analysten hatten jedoch erwartet, dass beispielsweise die SNB die Zinsen statt um 0,5 nur noch um 0,25 Prozentpunkte erhöht.
Sind die Zinserhöhungen allein für den Börseneinbruch verantwortlich?
Nein. Was die Märkte noch viel mehr beunruhigt hat: EZB, Fed und SNB haben angekündigt, im Kampf gegen die Inflation auch künftig rigoros einzuschreiten. Dabei haben alle Zentralbanken bereits weitere harte Zinsschritte in Aussicht gestellt. Die Anleger hatten hingegen auf eine Entwarnung an der Inflationsfront gehofft – oder gar auf die Ankündigung, dass keine weiteren Zinserhöhungen mehr geplant sind.
Warum geben die Zentralbanken im Kampf gegen die Inflation noch keine Entwarnung?
Die Inflation ist zwar praktisch überall rückläufig. So sank sie in den USA im November von 7,7 auf neu 7,1 Prozent. Auch in der EU hat sie sich von 10,6 auf 10 Prozent abgeschwächt und in der Schweiz steht sie im November nach wie vor bei vergleichsweise milden 3 Prozent. Im langjährigen Vergleich sind die Inflationsraten jedoch nach wie vor extrem hoch und weit über den Zielraten der Zentralbanken.
Ist die Trendwende bei den Teuerungsraten wirklich noch nicht geschafft?
Nach Einschätzung der Zentralbanken ist dieses Ziel noch nicht erreicht. Zu gross wären die Unsicherheiten im Markt. Einerseits könnte eine weitere Eskalation im Ukraine-Krieg im Frühjahr die Weltwirtschaft erneut vor Probleme stellen. Der Krieg und die Pandemiebekämpfung in China hängen wie ein Damoklesschwert über den internationalen Lieferketten. Zudem bleiben auch die Energiepreise ein Pulverfass, besonders für Europa. Die europäischen Länder werden ihren Energiebedarf im nächsten Jahr ohne Öl und Gas aus Russland stemmen müssen. Der Kampf um die fossilen Energieträger aus anderen Herkunftsländern könnte die Preise erneut in die Höhe treiben und die Inflation einmal mehr befeuern.
Welche Aktien gehören zu den grössten Verlierern?
In der Schweiz erlebten gleich mehrere Industrie-Titel deutliche Kurseinbrüche: Der Hörgerätehersteller Sonova büsste um 5,4 Prozent ein, der Halbleiterhersteller AMS Osram gar 7,3 Prozent. Auch die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Lonza sank um 3,5 Prozent ab, was aber unter anderem auf Medienberichte über eine Kostenexplosion bei der Sanierung der Giftmülldeponie Gamsenried VS zurückgeführt wird. Deutliche Einbüssen erlebten auch Firmen aus dem Bausektor wie Sika (–4 Prozent) oder Holcim (–3,6 Prozent). In den USA war der Donnerstag besonders für die Techkonzerne ein rabenschwarzer Tag. Meta tauchte um 4,5 Prozent, der Streamingdienst Netflix gar um 8,6 Prozent. Schreibt Blick.
1978 schrieb Alan Parsons, ein britische Musiker, Tontechniker, Produzent und Mitbegründer von «The Alan Parsons Projekt», seinen wohl erfolgreichsten Song «What goes up must come down».
Zitieren wir hier die ersten zwei Zeilen aus dem Songtext: «What goes up must come down. What must rise must fall.»
So funktionieren Börsen nun mal. Seit es sie gibt. Von der Tulpenbörse in Amsterdam bis hin zu den neuzeitlichen Krypto- und NFT-Börsen. Was hinauf geht kommt irgendwann herunter, damit es wieder in die Höhe klettern kann. So einfach ist die Newtonsche Gravitationstheorie für Börsianer*innen.
Geld wird auch in den aller wenigsten Fällen an der Börse «verbrannt», wie uns die Medien plakativ weismachen wollen, wenn wieder mal eine Aktie kollabiert. Das Geld wechselt nur den Besitzer. Es gibt ja nicht umsonst die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen. Wo es Verlierer gibt, sind auch die Gewinner nah. Das wusste schon Hölderlin.
Die zweite Zeile hat allerdings einen «gravierenden» Haken. Nicht alles was runter kommt, geht auch wieder rauf. Das zeigen Beispiele des börsennotierten deutschen Zahlungsabwicklers und Finanzdienstleisters «Wirecard», des US-amerikanischen Finanz- und Börsenmaklers und Anlagebetrügers Bernhard «Bernie» Madoff oder der Krypto-Börse FTX von Krypro-Pionier Sam Bankman-Fried.
Doch in solchen Fällen wie Weircard, FTX oder Madoff ist nicht die korrigierende Logik der «Gravitation» für den Totalausfall von Aktienpaketen bzw. Kryptowährungen in Milliardenhöhe verantwortlich, sondern schlicht und einfach Betrug, kriminelle Machenschaften und totales Versagen der Kontrollinstanzen. So es Kontrollinstanzen überhaupt gibt, was bei Krypto- und NFT-Börsen bezweifelt werden darf.
Wer in Aktien oder Kryptowährungen investiert, sollte bei schlechten Nachrichten über die Börsen- und Krypto-Kurse stets den Alan Parsons-Song vor sich hin summen oder mit der Lebensweisheit des britischen Dramatikers George Bernard Shaw vertraut sein: «Beim Spielen müssen viele verlieren, damit wenige gewinnen können.»
-
15.12.2022 - Tag der verwöhnen Energiekonsumenten
Heizung auf 16 Grad runtergeschraubt? Im Coop muss man sich warm anziehen
Energiesparen in Ehren. Aber Schlottern beim Einkaufen? Eine Mitarbeiterin beklagt sich, dass es in ihrem Laden nur noch 16 Grad ist. Und die Kundinnen und Kunden reklamieren.
Coop nimmt es offenbar ernst mit dem Energiesparen. Blick weiss von einer Mitarbeiterin aus dem Kanton Schwyz, dass in allen Coop-Läden die Heizungen massiv runtergedreht wurden. «Wir haben im Laden nur noch 16 Grad und sind alle am Schlottern», sagt sie. Sie würden alle in dicken Jacken arbeiten. «Und die Kundinnen und Kunden beklagen sich.»
Der Entscheid, die Heizungen so drastisch runterzuschrauben, komme «von ganz oben», sagt sie. Die Angestellten seien allerdings nicht informiert worden. «Wir haben uns alle gewundert, warum es plötzlich so kalt war.»
Freiwillige Energiesparmassnahmen
Coop rechtfertigt sich. «Wir setzen schon seit geraumer Zeit freiwillige Energiesparmassnahmen um», sagt ein Sprecher zu Blick. Coop sei es wichtig, in der aktuellen Situation mit verschiedenen Massnahmen einen Beitrag zu leisten.
«Die Temperaturen in Büros, Läden, Logistik sowie Lagern wurden auf 19 Grad Celsius reduziert», sagt er. Dies sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgängig auch so mitgeteilt worden. «Aktuell sind uns keine Reklamationen von Kundinnen und Kunden bekannt», sagt er. Schreibt Blick.
Coop (wie auch andere Detailhändler*innen) können tun was sie wollen: es ist nicht richtig. Doch die von billigen Energiepreisen über Jahrzehnte verwöhnte Gesellschaft würde genau so motzen, wenn Coop & Co. die Heizungen nicht runterschrauben würden, dafür aber die extrem gestiegenen Energiepreise auf die Kundschaft abwälzen würden.
Zumal Kundinnen und Kunden nach den herrschenden Temperaturen im Aussenbereich bekleidet sind. Und die Verkäufer*innen dürften ja wohl einen Pullover im Kleiderschrank haben.
-
14.12.2022 - Tag der Bundeshausmumien
«Voller Energie und Lust»: Alain Berset will auch nach 2023 Bundesrat bleiben
Alain Berset will über das Jahr 2023 Bundesrat bleiben, wie er in einem Zeitungsinterview sagte. Er habe wichtige Projekte, die bei weitem noch nicht abgeschlossen seien. Vergangene Woche hatte ihn die Bundesversammlung zum Bundespräsidenten für 2023 gewählt: Er erzielte ein unterdurchschnittliches Resultat.
Er wolle über 2023 hinaus weiterarbeiten und seine Dossiers vorantreiben, sagte Berset in einem Interview mit der Tageszeitung «Blick». Er werde ab 2023 der Amtsälteste und zugleich der Jüngste sein. Er sei noch voller Energie und habe Lust, weiterzumachen.
Man müsse aber auch bescheiden bleiben. Das Leben könne sich rasch ändern. Das habe man jüngst bei Simonetta Sommaruga gesehen.
Glücklich mit seinem Departement
Gerüchte, wonach er bei der jüngsten Neuverteilung der Departemente nicht ins Finanz- oder Aussendepartement habe wechseln dürfen, kommentierte der SP-Bundesrat nicht. Der Bundesrat habe die Pflicht, das Team so aufzustellen, dass es für das Land am besten sei.
Seine Leidenschaft für das Innendepartement (EDI) sei unverändert gross. Er sei dort sehr glücklich. In der Gesundheitspolitik gebe es viele Baustellen wie die einheitliche Finanzierung von ambulanter und stationärer Leistungen. Das sei ein Generationenprojekt, das Fehlanreize beseitige. Zudem seien zwei Volksinitiativen zu den Gesundheitskosten mit Gegenvorschlägen hängig.
In der Altersvorsorge gehe es um die Reform der zweiten Säule und die Verbesserung der Renten von Frauen und Personen mit niedrigem Verdienst. Was der Ständerat wolle, sei weit weg von dem, was der Bundesrat vorschlage. Das werde kein Spaziergang.
Keine Angst um Energiewende
Berset relativierte Befürchtungen, wonach mit der Übernahme des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) durch SVP-Bundesrat Albert Rösti die Energiewende rückgängig gemacht werden könnte. Ein Departementschef habe zwar einen gewissen Einfluss. Doch folge dann in der Regierung und im Parlament immer eine offene Debatte.
Um den eingeschlagenen Weg der Energiewende zu verlassen, müsste der gesamte Bundesrat seine Meinung ändern. Das halte er nicht für realistisch. Schreibt SRF.
Dass Bundesrat Berset «voller Lust» ist, darf nach dem unappetitlichen Geplänkel um den Erpressungsversuch einer ehemaligen Geliebten angenommen werden. Dumm nur, dass die rein private Angelegenheit den Medien zugespielt wurde, die sich logischerweise genüsslich als Moralapostel darauf stürzten. Ganz so, als ob ein Bundesrat kein Privatleben und schon gar keine Geliebte haben dürfte. Hauptsache, seine Geliebte ist kein «Es», würde Ueli Maurer wohl sagen.
Im Ranking der unbeliebtesten Bundesräte*innen führt Berset mit haushohem Vorsprung vor Cassis. Diese Umfragen sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Es sind Momentaufnahmen und meistens das Papier oder die Terra-Bytes nicht wert, auf dem oder mit denen sie veröffentlicht werden. Der EDI-Chef wird entsprechend auch durch den Kakao gezogen. Köppel sendet kaum eines seiner Deppenvideos auf YouTube ab, ohne Running Gag Berset. Wobei man sich fragen darf, wer von beiden der grössere Grützkopf ist: Berset oder Köppel?
Dabei hat Berset im ersten Lockdown 2020 so ziemlich alles richtig gemacht. Die esoterischen Lügenbeutel der Weltverschwörungsszene und die SVP-Leibgarde der trychelschwingenden Hornochsen sahen das logischerweise anders. Aber noch schadeten deren lächerliche Kundgebungen dem Ansehen Bersets nicht wirklich.
Die Trillerpfeifen ertönten eher für den damaligen Selbstdarsteller und «Mister Corona» Daniel Koch, der zum Feindbild all derer mutierte, für die ein Fetzen Stoff (Gesundheitsmaske) den Untergang des Abendlandes inklusive Demontage aller bürgerlichen Freiheiten bedeutete.
Doch mit dem Abgang von Koch und dem Einzug der Corona-Impfung wandelte sich auch die Qualität der Demonstrationen.
Waren es bis dahin ein paar versprengte Dumpfbacken, kreuzten die Impf- und Maskengegner*innen jetzt mit Heerscharen von Wutbürgern*innen inklusive ein paar Cervelatprominenten in Bataillonsgrösse und einem entsprechenden Krawallpotenzial in den Städten auf.
Ab sofort wurde die ganze Jauche über Berset gekippt, der seinerseits besoffen von seiner eigenen Wichtigkeit in den Fettnapf trat, als er in einer Pressekonferenz erzählte, dass man mit einem Impf-Zertifikat zeigen könne, nicht mehr ansteckend zu sein. Das war natürlich absoluter Blödsinn.
War doch auf dem Zettel, der jeder impfwilligen Person vor oder spätestens nach dem Stich in die Hände gedrückt wurde, schwarz auf weiss ganz klar deklariert, dass die Impfung nicht vor Ansteckungen schütze und im Umkehrschluss auch nicht andere Menschen vor einer Ansteckung durch geimpfte Personen. Aber, und das war ja die eigentliche Message, eine Impfung schütze im Falle einer Ansteckung vor einem schweren Verlauf der Infektion.
Nun denn, Berset hat jetzt eine Strafanzeige am Hals wegen «Amtsmissbrauch» von Investmentbanker und Filmemacher («Grounding») Pascal Najadi, dessen Vater 2013 in Kuala Lumpur ermordet wurde.
Diese Glosse eines mittelmässigen Filmemachers dürfte unserem Gesundheitsminister kein Bauchweh verursachen. Wozu hat man denn Bundespolizei und Bundesrichter?
Ganz abgesehen davon, dass Bundesrätin und Ankündigungsfee Keller-Sutter in ihren unzähligen Pressekonferenzen allein 2022 wohl mehr «Falschaussagen» betreffend Rückführung von Migranten gemacht hat als Berset in seinen nun 20 Jahren im Hohen Haus von und zu Bern.
Egal, wie man zu Alain Berset steht: Er war nie so brillant wie er früher in seinen besseren Tagen von den Medien hochgejubelt wurde. Aber auch nicht so stümperhaft und dilettantisch, wie er jetzt medial dargestellt wird.
Doch nun kommen wir endlich zum Nukleus: Berset wurde 2003 als jüngster Ständerat ins Parlament gewählt und im Dezember 2011 erklomm er gar die höchste Stufe eines Schweizer Politikers. Berset wurde zum Bundesrat erkoren.
Seit 20 Jahren führt uns dieser Mann nun schon durch politische Höhen und Tiefen. Er ist verbraucht. So wie Kohl und Merkel mit ihren 16-jährigen Kanzlerschaften irgendwann ihr Pulver endgültig verschossen hatten. Viele Deutsche konnten die Visage der beiden vollgefressenen King-Size-Mumien nicht mehr ansehen, geschweige denn ertragen. Sowohl Kohl wie auch Merkel mutierten in breiten Schichten der Gesellschaft zu Feindbildern.
Dieses traurige Schicksal blüht auch Berset, sofern er nicht schon mittendrin steckt. Er klebt an seinem Sessel wie ein Klima-Aktivist mit angeklebten Händen auf einer Autobahn.
So wie nur die wenigsten grossen Sportler*innen (Stichwort Christiano Ronaldo als abschreckendes Beispiel) den richtigen Zeitpunkt finden, um in Würde wie beispielsweise ein Russi abzutreten, ergeht es auch vielen Politikern*innen.
Irgendwann haben sie ihren Zenit überschritten. Sie sind abgenutzt, werden zur Bürde und fallen sogar ihren Parteien zur Last. Verhindern sie doch mit ihrem Starrsinn und ausgeprägtem Sitzleder jede Erneuerung durch smarten Polit-Nachwuchs.
Mir einer Amtszeitbegrenzung auf maximal acht oder zehn Jahre bliebe dies Alain Berset erspart.
Wann wird endlich eine Volksabstimmung zur Amtszeitbegrenzung (ab Stufe Stadtpräsident*in wohlverstanden!) initiiert, um diesem grauen Schimmel in den Amtsstuben endlich per Gesetz entgegenzutreten, bevor ein Staat nach dem andern von tollwütigen Populisten übernommen wird oder überhaupt niemand mehr vor lauter Politikverdrossenheit an den Wahlen teilnimmt.
Ein Schicksal, das auch der Schweiz blühen könnte. Damit wäre dann tatsächlich der Zustand einer Diktatur erreicht, von der die letzten zwei Jahre im Lande Wilhelm Tells so viel getrychelt wurde.
-
13.12.2022 - Tag der fiktiven Gespräche
Karl Kraus bewies, dass man Menschen mit Worten vernichten kann
Am 13. Dezember 1918 erschien Karl Kraus’ Weltkriegs-Drama „Die letzten Tage der Menschheit“. Für die Bühne war das Stück zu komplex. Doch es entfaltet bis heute große Kraft – die vor allem jene spürten, die ins Visier des Autors gerieten.
Wie der Autor glauben konnte, mit einem Theaterstück Wirkung zu erzielen, das zu komplex für jede Bühne des Planeten war, wird für immer sein Geheimnis bleiben. Und folgerichtig sind „Die letzten Tage der Menschheit“ nie in Gänze zur Aufführung gelangt, keinem Regisseur oder Ensemble war es möglich, den Stoff in den Griff zu bekommen. 220 Szenen mit ungezählten Schauspielern wären zu bewältigen – wer auch nur annähernd professionell denkt, wird sich an so etwas nicht heranwagen.
Das Wunder bei dem Stück, das am 13. Dezember 1918 erstmalig erschien, ist, dass die Wirkung trotzdem bis heute nachhallt. Kein Erich Maria Remarque und kein Ernst Jünger schilderte das Grauen des Ersten Weltkriegs mit einer derartigen Schonungslosigkeit wie der Wiener Karl Kraus (1874–1936). Bei ihm prallte der ganze Irrsinn in einer Art riesigen Kollage aufeinander: Soldaten, die Gegner zu Krüppeln schossen; Kaiser, und Offiziere, die zwar vom Geschehen an der Front so viel Ahnung hatten wie eine Katze vom Bellen, aber trotzdem Entscheidungen quasi nebenher fällten, die unzählige Menschen das Leben kosteten.
Und dann waren da natürlich noch die gewissenlosen Journalisten, denen alles nicht blutrünstig und martialisch genug zugehen konnte – und die hinterher selbstredend nur in bester Absicht versucht hatten, ihrer Pflicht als Berichterstatter nachzukommen. In der Hauptsache besteht das Werk aus Originalzitaten, aber der Autor wob auch fiktive Kommentatoren ein, um das Panoptikum des Schreckens komplett zu machen; deshalb entfaltet die Schrift bis heute ihre ganze Wucht, wenn man sie liest. Wahrscheinlich war es das, worauf der Autor spekulierte: Seine Formulierungskunst, die er in seiner Zeitschrift „Die Fackel“ auslebte – ein Blatt, unter dessen aufklärerischem Namen bald nur noch einer publizierte, nämlich Karl Kraus selbst.
Ein gebürtiger Wiener war er nicht. Kraus kam 1874 in Böhmen zur Welt, als neuntes Kind eines überaus erfolgreichen jüdischen Papierfabrikanten. Damit gehörte der Nachwuchs dem Großbürgertum an, das zu dieser Zeit in einer bis dahin unbekannten finanziellen Sicherheit lebte. Schon 1877 zog die Familie nach Wien, der Sohn besuchte ein berühmtes Gymnasium um nahm dann – allerdings ohne große Ambitionen – ein Studium der Rechtswissenschaften auf. Entsprechend schloss er es nicht ab, zu sehr reizte ihn das Schreiben, vor allem Theaterkritiken. Angst vor großen Namen hatte er nicht: Im April 1892 erschien eine Rezension von Gerhart Hauptmanns Drama „Die Weber“ als sein erster journalistischer Beitrag in der „Wiener Literaturzeitung.“
Doch der Autor wollte mehr, viel mehr, was bei seinem Talent auch verständlich war. Seine Götter hießen unter anderem Shakespeare, Goethe und Nestroy, und hier kündigt sich ein Motiv an, das ihn sein Leben lang begleiten sollte: Karl Kraus war jemand, der Urteile sprach – und zwar welche von der Art, die nicht den geringsten Zweifel zuließen. Da gab es die Guten und die Bösen, und das Böse musste mit allen Mitteln bekämpft werden. Keine Gnade, kein Vergeben; da war nichts, was sich noch irgendwie hätte verhandeln lassen.
Seine Zeitschrift „Die Fackel“ gründete er 1899, also mit 25 Jahren, das muss man sich erst einmal trauen. Doch schon früh ging es mit den Streitereien los. Geradezu legendär war Kraus’ Ausfall gegen die Prosa Heinrich Heines (1797–1853): Der Wiener warf Deutschlands größtem Satiriker des 19. Jahrhunderts vor, seine Aufenthalte in Frankreich hätten ihn dazu getrieben, die deutsche Sprache zu verschandeln. Französisch sei ein Konstrukt, das sich jedem an den Hals werfe – Kraus benutze deftigere Worte – während das edle Deutsch nur denjenigen belohne, der sich mit ihm abplage, dann dafür aber umso mehr.
Zu Zeiten des Ersten Weltkrieges ist bei dem Autor ein deutlicher Schwenk in der Perspektive zu verzeichnen: War er bis 1916 als Großbürgersohn doch im Zweifel kaisertreu gewesen, las man nun eine immer größere Sympathie für Liberale und Sozialdemokraten in seinen Texten. Vermutlich konnte er den gesellschaftlichen Eliten nicht verzeihen, das Schlachten in Europa zugelassen zu haben. Die „Fackel“ wurde zensiert, aber nicht so, dass jede scharfe Formulierung hätte getilgt werden können – dafür hätte man sie ohnehin verbieten müssen.
Die größte Zeit des Mannes mit der scharf geschliffenen Brille begann, als das große Sterben vorbei war. Selten dominierte eine Persönlichkeit derartig den ganzen literarischen Betrieb wie Kraus im Wien der 1920er-Jahre. Zu seinen „Vorlesungen“, die eher zu Ein-Mann-Inszenierungen gerieten, fand sich alles ein, was sich in der österreichischen Hauptstadt zum Geistesadel zählte, und viele andere kamen ebenfalls.
Der spätere Literatur-Nobelpreisträger Elias Canetti, damals ein Twen, hat den zweiten Band seiner Autobiografie nicht umsonst „Die Fackel im Ohr“ genannt. Gewiss ein kritischer Kopf, konnte auch Canetti nicht umhin, zuzugeben, von der Energie Mal für Mal überrollt worden zu sein, mit der der Mann vor dem Auditorium Heuchler, Kriegsgewinnler und ignorante Herrschende mit sprachlichen Blitzschlägen erledigte.
Ja, der Herr der „Fackel“ leuchtete einen Weg, aber wie so oft bei Moralisten hatte dies eine Rückseite. Wer ihm nicht folgte, der war verloren, für den Mann, für die Sache, für die ganze Welt. Gut 40 Jahren, nachdem er ihm verfallen war, unterzog Canetti sein ehemaliges Idol einer Revision. Er kam zu dem Ergebnis, er habe den Meister irgendwann stürzen müssen.
Kraus’ größte Gabe, das ehrliche Erschrecken über die Zustände, die er um sich herum vorfand, hätten zu einer Sprache geführt, die keinerlei Spielraum mehr zugelassen habe. Quader für Quader habe der Autor eine Mauer errichtet, die er Stück für Stück gebaut habe, so lange wie ihm etwas eingefallen sei – und eingefallen sei ihm viel. Dies sei bei Kraus das einzige Strukturprinzip gewesen. Wer ein wenig in „Die letzten Tage der Menschheit“ hineinliest, wird dem zustimmen.
Viele Experten handeln Karl Kraus als Aphoristiker*. Dem antiken Sinn nach ist das jemand, der sich durch seine Sprache abgrenzt. Die Reihe der wundervollen Aussprüche von ihm ist zu groß, um sie sie hier auch nur ansatzweise zu zitieren: „Es gibt Menschen, die tragen es einem Bettler bis zu ihrem Lebensende nach, ihm kein Geld in den Hut geworfen zu haben.“ Daran ist alles verdreht, gespiegelt und schön. Und es leuchtet ein, warum so viele Menschen den Erschaffer solcher Zeilen für ein Genie halten.
Karl Kraus** starb 1936. Zwei Jahre später sollten die Nationalsozialisten sich Österreich einverleiben, es folgte ein Massensterben, das belegte: Der Erste Weltkrieg waren eben nicht die letzten Tage der Menschheit, schlimmere sollten folgen. Doch das durch seine Prosa zu verhindern, war auch diesem Autor nicht gegeben. Schreibt DIE WELT.
Ein hervorragender Artikel von Philip Cassier mit einem tiefen Blick und entsprechend zutreffender Analyse in die Historie eines grossen Schriftstellers, der kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs das satirische Drama «Die letzten Tage der Menschheit» veröffentlicht hatte.
Dass Kraus mit seiner Wortgewalt allerdings Menschen (wie Heine) zerstört hat, wie Cassier in der Titelzeile schreibt, ist nicht nur leicht übertrieben, sondern schlicht unwahr. Aber das haben Titelzeilen so an sich. Auch der Drama-Titel «Die letzten Tage der Menschheit» hat sich bis heute noch nicht bewahrheitet.
Nur wenigen literarischen Feinschmeckern wird das Werk von Kral Kraus heute noch präsent sein. Und wenn, dann höchstens die Zeile «Serbien muss sterbien!» aus dem I. Akt der 1. Szene, mit der Kraus die Kriegsbegeisterung und Selbstgerechtigkeit der damaligen Eliten inklusive Presse und Volk geisselt.
Diese Zeile für sich allein hier stehen zu lassen wäre eine Sünde gegenüber diesem Theaterstück. Das es allerdings nie wirklich in die Theater schaffte. Zu komplex. Zu schwierig.
Trotzdem hier ein Auszug aus der Rede eines Wieners, der am (damaligen) Ringstrassenkorso, auf einer Bank stehend, eine Ansprache an das gewöhnliche Fussvolk hält, die mit dem Satz endet «Die Sache für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte, da gibt's keine Würschteln, und darum sage ich auch, Serbien – muss sterbien!».
Stimmen aus der Menge: Bravo! So ist es! – Serbien muss sterbien! – Ob's da wüll oder net! – Hoch! – A jeder muss sterbien!
Einer aus der Menge: Und a jeder Russ!
Ein Anderer (brüllend): Ein Genuss!
Ein Dritter: An Stuss! (Gelächter)
Ein Vierter: An Schuss!
Alle: So is! An Schuss! Bravo!
Der Zweite: Und a jeder Franzos?
Der Dritte: A Ross! (Gelächter)
Der Vierte: An Stoss!
Alle: Bravo! An Stoss! So is!
Der Dritte: Und a jeder Tritt – na, jeder Britt!?
Der Vierte: An Tritt!
Alle: Sehr guat! An Britt für jeden Tritt! Bravo!
Ein Bettelbub: Gott strafe England!
Stimmen: Er strafe es! Nieda mit England!
Ein Mädchen: Der Poldl hat mir das Beuschl (Anm. Herz, Lunge, Milz und Leber) von an Serben versprochen! Ich hab das hineingeben in die Reichspost!
Eine Stimme: Hoch Reichspost! Unser christliches Tagblaad!
Ein anderes Mädchen: Bitte, ich habs auch hineingeben, mir will der Ferdl die Nierndln von an Russn mitbringen!
Die Menge: Her darmit!
Ein Wachmann: Bitte links, bitte links.
Ein Intellektueller (zu seiner Freundin): Hier könnte man, wenn noch Zeit wär, sich in die Volksseele vertiefen, wieviel Uhr is? Heut steht im Leitartikel, dass eine Lust is zu leben. Glänzend wie er sagt, der Glanz antiker Grösse durchleuchtet unsere Zeit.
Die Freundin: Jetzt is halber. Die Mama hat gesagt, wenn ich später wie halber zuhaus komm, krieg ich's.
Der Intellektuelle: Aber geh bleib. Schau dir bittich das Volk an, wie es gärt. Pass auf auf den Aufschwung!
Die Freundin: Wo?
Der Intellektuelle: Ich mein' seelisch, wie sie sich geläutert haben die Leut, im Leitartikel steht doch, lauter Helden sind. Wer hätte das für möglich gehalten, wie sich die Zeiten geändert haben und wir mit ihnen.
Zugegeben: Etwas «schwer verträgliche Kost». Und viel zu lang. Das liest heutzutage niemand mehr. Doch diese Aphorismen zu verschweigen, wäre ein literarisches Verbrechen.
Karl Kraus erschuf mitten im Ersten Weltkrieg eine (vermutlich) fiktive Szene auf einer Wiener Strasse, die – abgesehen von Wortslang und Ort – den heutigen Diskussionen um den Ukrainekrieg erstaunlich nahe kommt. Je nachdem, auf welcher Seite und in welchem Medium man sich bewegt.
*Ein Aphorismus ist ein selbständiger einzelner Gedanke, ein Urteil oder eine Lebensweisheit. Er kann aus nur einem Satz oder wenigen Sätzen bestehen. Oft formuliert er eine besondere Einsicht rhetorisch als allgemeinen Sinnspruch. Wikipedia
-
12.12.2022 - Tag der Pfaffenstaaten im Namen von Allahu akbar
Iran-Proteste: Zweiter Demonstrant wegen "Kriegsführung gegen Gott" hingerichtet
Im Iran ist nach Angaben der Staatsmedien ein zweiter Demonstrant im Zuge der systemkritischen Proteste hingerichtet worden. Der wegen "Kriegsführung gegen Gott" angeklagte Majid-Reza R. wurde am Montag in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basij-Miliz mit einem Messer ermordet haben.
Demonstrationen nach Tod von Mahsa Amini
Bereits am letzten Donnerstag war der Rap-Musiker Mohsen Sekari hingerichtet worden. Auch er soll ein Basij-Mitglied mit einer Waffe angegriffen, Schrecken verbreitet und eine Straße blockiert haben. Seine Hinrichtung wurde im In- und Ausland scharf verurteilt. Insgesamt stehen Medienberichten zufolge mindestens 25 Demonstranten auf der Todesliste der iranischen Justiz – zwei von ihnen wurden bereits hingerichtet.
Auslöser der Proteste im Iran war der Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini. Sie starb am 16. September im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war.
Entscheidung über Sanktionen
Während inzwischen nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 475 Demonstranten getötet wurden, geht auch die Justiz mit hartem Kurs gegen Protestteilnehmer vor. Immer wieder werden sie von der Staatsführung als Terroristen oder Krawallmacher bezeichnet.
Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Damit soll auf die anhaltend brutale Unterdrückung der systemkritischen Proteste in dem Land reagiert werden. Schreibt DER STANDARD.
«Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger aber doch reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann (für mich) etwas daran ändern.» Schrieb Albert Einstein in seinem Brief vom 3. Januar 1954 an den jüdischen, deutsch-amerikanischen Religionsphilosophen Eric(h) Gutkind.
Mehr gibt es zu einer (teil)-öffentlichen Hinrichtung wegen «Kriegsführung gegen Gott» nicht zu sagen.
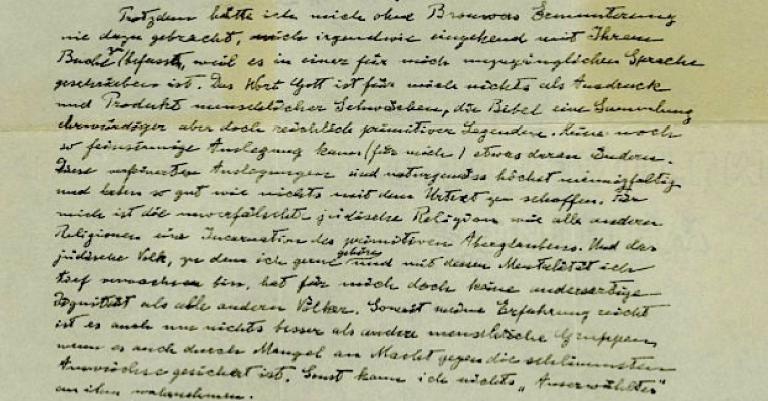
-
11.12.2022 - Tag der Polit-Mumien
«Desaströse Situation» – Partei am Ende? Schweizer Demokraten versinken in Schulden
Die rechtsnationalen Schweizer Demokraten (SD) können nicht mal mehr ihren Parteisekretär bezahlen. Laut internen Dokumenten ist die Lage «desaströs». Hat die Partei noch eine Zukunft?
Übrig geblieben sind knapp 20 Aktive. Sie trafen sich am 12. November zur nationalen Mitgliederversammlung in einer Beiz in Suhr AG. Der harte Kern der Schweizer Demokraten (SD) – einer einst stolzen Rechtspartei, die in den 90er-Jahren fünf Nationalräte stellte.
Übrig geblieben ist auch ein Berg von Schulden. Interne Dokumente der Kleinpartei belegen: In der Kasse der SD fehlt Geld. Viel Geld. Stand Mitte November wies die Parteirechnung mehr als 54'000 Franken an Schulden aus.
Die Lage ist dermassen prekär, dass die SD ihrem letzten verbliebenen Sekretär kündigen musste. Die Partei kann seinen Lohn nicht mehr bezahlen. In einem Sitzungsprotokoll schreiben die Schweizer Demokraten: «Aufgrund der desaströsen finanziellen Situation ist es nicht mehr möglich, ein professionelles Zentralsekretariat zu betreiben.» Als Sofortmassnahme haben die Parteichefs den Mindestmitgliederbeitrag von 20 auf 50 Franken erhöht.
Durchbruch mit der Schwarzenbach-Initiative
Die Schweizer Demokraten befinden sich schon länger im komatösen Zustand. 2007 verloren sie ihren letzten Sitz im Nationalrat. Bei den Parlamentswahlen vor drei Jahren erreichten sie gerade noch einen Wähleranteil von 0,13 Prozent.
Das war nicht immer so. Lange war die Partei fähig, eigene Initiativen zu lancieren. Ihre Politiker sassen in Parlamenten, im Bundeshaus erreichte die SD 1991 Fraktionsstärke.
Den Durchbruch schafften die Schweizer Demokraten 1969 mit der wohl umstrittensten Volksinitiative in der Schweizer Geschichte des 20. Jahrhunderts, der nach ihrem Chef benannten Schwarzenbach-Initiative. Die Partei forderte – damals noch unter dem Namen Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat (NA) – eine Begrenzung des Ausländeranteils auf maximal zehn Prozent. Die Bevölkerung lehnte die Initiative 1970 zwar ab. Mit 46 Prozent Ja-Stimmen erzielten die Schweizer Demokraten aber einen überraschenden Erfolg.
«Bessere Zeiten kommen»?
In den darauffolgenden Jahren eckte die Partei immer wieder mit fremdenfeindlichen Kampagnen an, prominente Mitglieder wurden wegen Rassismus verurteilt. Mitte der 90er-Jahre jedoch begann der Niedergang. Der Wähleranteil sank stetig, 2012 zeigte die Partei das erste Mal Auflösungserscheinungen. Doch die SD raffte sich noch einmal auf – bis heute.
Ist die verschuldete Partei diesmal am Ende? Co-Präsident Christoph Spiess gibt sich kämpferisch: «Ich bin überzeugt, dass es die SD weiterhin geben wird, ja geben muss, und vielleicht auch wieder bessere Zeiten kommen.»
Angesprochen auf die Schulden seiner Partei wiegelt er ab: «Eine aktuelle finanzielle Notsituation besteht nicht.» Es sei immer wieder mal vorgekommen, dass die SD Schulden hatte. «Wir konnten diese jeweils kurz- bis mittelfristig mit Sonderanstrengungen und ausserordentlichen Geldzuflüssen aus Legaten wieder ausgleichen.»
Die Kündigung des Parteisekretärs bestätigt Spiess: «Wir haben uns bedauerlicherweise dazu entschliessen müssen, das langjährige Arbeitsverhältnis mit unserem Zentralsekretär aufzulösen.» Die nötigen administrativen Arbeiten würden in Zukunft aufgeteilt und auf ehrenamtlicher Basis ausgeführt.
SVP hat die SD aufgesogen
Dass tatsächlich wieder bessere Zeiten für die SD kommen, ist nicht absehbar. Die SVP hat die Schweizer Demokraten regelrecht aufgesogen. Neben der grössten Partei des Landes gibt es wenig Platz für eine Rechtsaussenpartei. Spiess: «Wir müssen die Leute dazu bringen, uns als Partei zu unterstützen, statt rechtsbürgerlichen Kreisen nachzulaufen und damit den eigenen sozialen Interessen zu schaden.»
Kommt hinzu: Die SD kann kaum mehr junge Leute rekrutieren. Ein Grossteil der aktiven Parteimitglieder sind Männer im Seniorenalter. Just in den letzten Monaten sind zwei der Aushängeschilder verstorben: der Berner alt Nationalrat Valentin Oehen und der langjährige Thurgauer Parteisekretär Willy Schmidhauser. Schreibt SonntagsBlick.
Wenn der Staubsauger vom Herrliberg erst mal zu saugen beginnt, bleibt ausser ein paar Staubkörnern nichts mehr zurück. Und die werden vom Winde verweht.
Die Trauer um den Verlust dieser Veteranen-Schwurbel-Partei namens SD hält sich in Grenzen. Für die Schweizer Demokratie wäre dies ein Gewinn, wären die Vertreter der puren SD-Hardcore-Ideologie nicht auf dem Herrliberg gelandet.
Doch das Schicksal wird auch bei dieser alten Garde der Übriggebliebenen irgendwann den Hobel ansetzen. Die Gerechtigkeit der Biologie macht keine Ausnahmen. Nicht einmal bei der Staubsaugerpartei vom Herrliberg.
-
10.12.2022 - Tag der Enttäuschungen
Putin ist enttäuscht von Merkel
Der russische Präsident Wladimir Putin (70) hat sich enttäuscht über die jüngsten Äusserungen von Altkanzlerin Angela Merkel (68) zur Ukraine gezeigt. Russland interpretierte Aussagen Merkels in einem Interview der «Zeit» so, dass der Minsker Friedensplan nur geschlossen worden ist, um der Ukraine Zeit zu geben, sich zu bewaffnen und auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. «Ehrlich gesagt war das für mich absolut unerwartet. Das enttäuscht. Ich habe offen gesagt nicht erwartet, so etwas von der früheren Bundeskanzlerin zu hören», sagte Putin am Freitag vor Journalisten in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.
Der Minsker Friedensplan für den unter russischem Einfluss stehenden Osten der Ukraine nach Beginn der Kampfhandlungen 2014 sah weitreichende Verpflichtungen für die Konfliktparteien vor, die nie umgesetzt wurden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (44) hatte erklärt, dass er die unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs getroffenen Vereinbarungen nicht umsetzen werde. Daraufhin hatte Kremlchef Putin am 24. Februar den Krieg gegen die Ukraine begonnen.
«Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Führung der BRD sich uns gegenüber aufrichtig verhält», sagte Putin. Es sei zwar klar gewesen, dass Deutschland auf der Seite der Ukraine stehe, sie unterstütze. «Aber mir schien trotzdem, dass die Führung der BRD immer ehrlich um eine Lösung bemüht war auf Grundlage der Prinzipien, die wir vereinbart haben und die unter anderem im Rahmen des Minsker Prozesses erzielt wurden.»
Merkel hatte in dem am Donnerstag veröffentlichten Interview wörtlich gesagt: «Das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit hat auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht.» Anfang 2015 hätte Putin die Ukraine nach Darstellung Merkels leicht überrennen können. «Und ich bezweifle sehr, dass die Nato-Staaten damals so viel hätten tun können wie heute, um der Ukraine zu helfen.» Schreibt Blick im Ukraine-Liveticker.
Tja, mit seiner Enttäuschung über Angela Merkel ist Vladimir Putin nicht allein. Ein paar Millionen Deutsche sind es auch.
Und dabei handelt es sich nicht nur um AfD-Anhänger, Querdenker und sonstige Verschwörungstheoretiker. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft hat man irgendwann einfach genug. Das musste schon Merkels CDU-Vorgänger Helmut Kohl erleben.
Ganz abgesehen davon, dass jeder Politiker und jede Politikerin auf diesem Level eine grosse Anzahl von Menschen enttäuscht.
Allen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Nicht einmal Putin, über den wohl mehr Leute enttäuscht sind als über Angela Merkel. Ausser Roger Köppel und sonstige Putin-Versteher.
-
9.12.2022 - Tag von Gleich und Gleich gesellt sich gern
China besucht Golfstaaten: Xi Jinping will sich das Öl der Saudis sichern
Chinesischer Staatsbesuch in Saudi-Arabien: Präsident Xi Jinping unterzeichnet milliardenschwere Verträge.
Der Unterschied ist bemerkenswert: Als US-Präsident Joe Biden vor einem halben Jahr Saudi-Arabien besuchte, war die Atmosphäre verkrampft. Biden stand unter Rechtfertigungsdruck, er gehe vor dem umstrittenen saudischen Kronprinzen in die Knie, hiess es in der eigenen Partei. Denn Biden hatte im Wahlkampf Mohammed bin Salman noch scharf verurteilt und eine neue, an Menschenrechten orientierte Golfpolitik versprochen.
Solche Skrupel hat der chinesische Präsident nicht. Er liess sich mit allem Pomp am saudischen Königshof empfangen. Xi sprach dabei von einer «neuen Ära» der Zusammenarbeit. Ein Abkommen über strategische Partnerschaft wurde in Riad unterzeichnet.
China ist auf das Öl der Saudis angewiesen. Doch die Zusammenarbeit geht weit darüber hinaus. Der saudische Kronprinz, der eine umfassende Modernisierung seines ultrakonservativen Königreichs vorantreibt, zählt dabei auch auf chinesische Unterstützung.
Treffen mit anderen Golfstaaten im Programm
Es wurden Verträge für chinesische Unternehmen im Wert von 30 Milliarden Dollar beschlossen, wie es hiess. Darunter einer mit dem umstrittenen chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei, dem im Westen vorgeworfen wird, seine Netzwerke seien nicht sicher vor chinesischem Staatszugriff. Das chinesische Engagement soll von der Informationstechnologie über die grüne Energie bis zum Bausektor reichen. Menschenrechte sind bei dem Besuch kein Thema. Beide Seiten betonen, sie wollten sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einmischen.
Die USA bleiben der wichtigste Sicherheitsgarant am Golf. Doch nicht nur Saudi-Arabien, auch weitere Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, orientierten sich zunehmend stärker nach Asien.
Der Besuch von Xi dokumentiert diese Entwicklung. Neben den direkten Gesprächen mit der saudischen Führung sind zum Abschluss heute auch Treffen des chinesischen Präsidenten mit den Spitzen der anderen Golfstaaten und weiterer arabischer Länder vorgesehen. Schreibt SRF.
Hier kommt zusammen, was zusammen gehört. Der eine lässt missliebige Muslime beim Freitagsgebet aufhängen oder an einem x-beliebigen Tag in der saudischen Botschaft in der Türkei mit einer Kettensäge vierteilen. Der Andere sperrt missliebige Muslime gleich millionenfach ins Uiguren-Camp.
-
8.12.2022 - Tag der Relativitätstheorie und infantilen Weisheiten von Fussball-Experten
«So kann es nicht weitergehen»: SRF-Ruefer stellt Xhaka als Nati-Captain in Frage
Ist Granit Xhaka noch der richtige Captain für die Schweizer Nati? Diese Frage stellt SRF-Kommentator Sascha Ruefer nach den jüngsten Ereignissen beim WM-Spiel gegen Serbien.
Die WM ist für die Schweiz vorbei. Jetzt gilt es, die Spiele zu analysieren. Und auch alles, was drumherum geschah. So sorgte etwa Granit Xhaka (30) mit dem Griff in den Schritt im Serbien-Spiel für Diskussionen. Eine Aktion, die man sich nicht leisten darf, schon gar nicht als Captain, findet Sascha Ruefer (50).
«Als Captain dieser Mannschaft – das klingt vielleicht etwas hart – kannst du dir Geschichten wie die Hand im Schritt einfach nicht erlauben. Das geht nicht», sagt der Nati-Kommentator am Mittwochabend bei SRF. Der Grenchner stellt sogar Xhaka als Mannschaftsführer infrage: «Man muss die Rolle von Granit Xhaka in der Öffentlichkeit diskutieren und auch neu definieren. So kann es nicht weitergehen.»
«Er hat zwei Seiten»
Schon als der Arsenal-Spieler 2018 Nachfolger von Stephan Lichtsteiner (38) wurde, war Ruefer skeptisch: «Ich habe vor vier Jahren schon einmal gesagt: Ich bin nicht sicher, ob es glücklich ist, wenn man Granit Xhaka zum Captain macht.»
Er wolle die Leistungen, die der 30-Jährige für die Nationalmannschaft erbracht habe, in keiner Weise schmälern. «Das ist ein Anführer, ein Alpha-Tier, um ihn baut sich alles auf.»
Aber als Captain stehe er noch mehr im Fokus als andere. «Er hat einfach zwei Seiten. Die Aussenwirkung wird meiner Meinung nach langsam aber sicher zum Problem.» Zudem fehle ihm ein Gegenpol im Team, also jemand, der Xhaka auch mal widerspricht.
Huggel: «Vom Verband muss was kommen»
Ruefer stellt die Frage, ob man mit der Neuvergabe der Captainbinde nicht auch Xhaka einen Dienst erweisen würde, wenn man ihn so etwas aus dem Fokus nimmt. «Für mich wäre es auch keine Degradierung», stellt er klar. Er müsse weiterhin ein Fixpunkt in der Nati bleiben, denn «er ist der beste Spieler, das ist Tatsache».
Ex-Nati-Spieler Benjamin Huggel (45), ebenfalls Teil der SRF-Runde, hält sich in der Captain-Frage bedeckt, geht nicht auf Ruefers Aussagen ein. Der SRF-Experte pflichtet ihm aber bei, dass es Konsequenzen geben müsse: «Aus Verbandssicht glaube ich, dass da etwas kommen könnte. Ich meine, als Verband findet man es schon nicht so gut, wenn dein Captain sowas abzieht wie das mit dem Trikot von Jashari. Ich würde sogar sagen, es muss etwas kommen.» Schreibt Blick.
Gehen wir zurück ins Jahr 1951.
Am 14. März 1951 feierte der intellektuell über alle Zweifel erhabene Wissenschaftler und Schöpfer der Relativitätstheorie seinen 72. Geburtstag. Einstein war zu dieser Zeit eine der berühmtesten und bekanntesten Persönlichkeiten der Welt und entsprechend musste er alle möglichen und unmöglichen Huldigungen, Lobpreisungen und sonstigen Schmeicheleien während einer für ihn veranstalteten Geburtstagsfeier über sich ergehen lassen.
Erschöpft verliess Einstein die Veranstaltung und setzte sich in den Fond des Autos, das ihn nach Hause bringen sollte. Doch eine Traube von Reportern drängte sich vor das Fenster, um ein Foto von dieser weltberühmten Ikone der Physik zu knipsen. Irgendwann wurde es Einstein dann doch etwas zu viel des Guten und als Fotograf Arthur Sasse seine Kamera zückte, streckte der gefeierte Weltraumforscher seine Zunge so weit heraus wie er nur konnte.
So entstand dieses legendäre Bild, das anschliessend weltweit veröffentlicht wurde.
Doch Einstein, dem überschwängliche Feierlichkeiten und die Selbstüberschätzung der eigenen Bedeutung stets ein Gräuel waren, «relativierte» den Vorfall mit einem kurzen Gedicht, das ebenso um die Welt ging.
Von Gutem ist ein ernstes Wort
wenn man’s gebraucht am rechten Ort
Hast du’s zu tun jedoch mit Toren
ist jedes kluge Wort verloren
In solchem Fall, wie ihr entdeckt
hab’ ich die Zung’ herausgestreckt
Man kann es wohl nicht besser machen
als blöde Leute auszulachen.
Tja, waren das noch Zeiten als wir uns am Stammtisch noch über Schwerkraft, Materie, Raum und Zeit unterhielten und die Klügsten der Klugen auf den Frontseiten der Zeitungen zu uns sprachen, die wirklich etwas zu sagen hatten und nicht nur infantilen Müll absonderten.
Vollpfosten gehören logischerweise zu jedem Fussball-Spiel, sonst gäbe es ja keine Pfostenschüsse. Das lehrt uns die Relativitätstheorie.
Wenn der geradezu groteske Schreihals und Vollpfosten der Nation, Fussball-Kommentator Sascha Ruefer, den unbedarften und wie Ruefer von jeglichem Intellekt befreiten Fussball-Star Xhaka wegen einer lächerlichen Lappalie als Captain der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft in Frage stellt, dürfte man ohne Zögern auch Ruefers überhebliche Selbstüberschätzung als Fussball-Kommentator und Fussball-Experte in Frage stellen.
Um bei Einsteins Relativitätstheorie zu bleiben: Auch dem Fussball selbst würde eine «Relativierung» hin zum Sport und weg vom Entertainment nicht schaden. Denn Schwerkraft, Materie, Raum und Zeit – alles ist relativ.
Foto Res Kaderli: «Albert Einstein-Brunnen» in Ulm

-
7.12.2022 - Tag der Samichläuse und Rohstoffhändler
Glencore zahlt Kongo in Schmiergeldaffäre 180 Millionen Dollar
Der Bergbaukonzern Glencore legt eine Korruptionsaffäre in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) mit einer Zahlung von 180 Millionen Dollar bei. Damit werden auch mögliche künftige Forderungen des Landes abgedeckt. Die Vereinbarung decke Ansprüche der Republik ab, die aus «angeblichen Korruptionshandlungen» zwischen 2007 und 2018 entstehen könnten, teilte Glencore mit.
Glencore war wegen seiner Aktivitäten in der DRK von verschiedenen Aufsichtsbehörden ins Visier genommen worden. So etwa vom US-Justizministerium (DOJ) und in der Schweiz von der Bundesanwaltschaft.
Die nun erzielte Vereinbarung unterliege dem kongolesischen Recht, betonte der in Zug ansässige Konzern in einem Communiqué. Die Eingeständnisse, die das Unternehmen mache, bezögen sich einzig auf die Fehltritte, die in einer bereits früher erzielten Resolution mit dem DOJ zugegeben wurden.
Glencore hatte sich im Mai dieses Jahres in einem aussergerichtlichen Vergleich mit dem US-Justizministerium schuldig bekannt, in sieben Ländern Afrikas und Südamerikas in Schmiergeldzahlungen verwickelt gewesen zu sein – unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo. Das Unternehmen wurde seinerzeit zu einer Busse von über einer Milliarde Dollar verurteilt. Schreibt SRF.
Nicht der Rohstoffhändler Glencore bezahlt die 180 Millionen an Kongo, sondern wir alle. Denn die paar Milliönchen werden auf die Rohstoffpreise geknallt. Irgendwann kommen sie dann in Form von Preiserhöhungen bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern an.
Oder glauben Sie noch an den Weihnachtsmann oder den verantwortlichen CEO und die Chefetage von Glencore? Deren Boni sind nicht um einen Dollar gekürzt worden. Im Gegenteil: Sie wurden saftig erhöht. Kann man nachlesen im Deutschen Handelsblatt.
Was soll's? An Weihnachten kommt dieses Millionengeschenk sicher gut an im Kongo, auch wenn es vermutlich in die falschen Taschen fliesst.
-
6.12.2022 - Tag des SVP-Duells um den Bundesratssitz
Rösti oder Vogt? Bundesratswahl ist auch ein Duell SVP Bern gegen SVP Zürich
Die beiden Kantonalparteien stehen auch für zwei unterschiedlichen Kulturen. Dass diesmal ein Berner Favorit ist, ist neu für die erfolgsverwöhnte Zürcher SVP.
Am Mittwoch wird ein neuer Bundesrat für die SVP gewählt: Albert Rösti oder Hans-Ueli Vogt – ein Berner Vollblutpolitiker aus ländlichem Gebiet oder ein Akademiker aus der Stadt Zürich. Es ist also auch ein neues Kapitel in der ewigen Rivalität zwischen den zwei Kantonalparteien mit verschiedenen Kulturen: Hier die behäbige, bodenständige Berner Partei, da die erfolgsverwöhnte, kompromisslose Zürcher SVP.
Druck auf beiden Seiten
Gerade für die SVP Zürich ist der Druck hoch: Sie muss eine Machtposition verteidigen, will als wichtigster Wirtschaftskanton im Bundesrat vertreten sein, so schreibt es die Partei in einer Mitteilung. Doch die Zürcher brauchten lange, um einen geeigneten Bundesratskandidaten zu stellen. Schliesslich kam Alt-Nationalrat Hans-Ueli Vogt aus der Stadt Zürich zum Zug.
Anders die Berner, die gleich zwei profilierte Politiker ins Rennen schicken konnte, am Ende schaffte es Albert Rösti aufs Ticket. Der Nationalrat und ehemalige Parteipräsident gilt als Favorit. Die Berner SVP ist im Aufwind, hat sich aufgerappelt nach den Querelen mit der Zürcher Partei und der Abspaltung der BDP 2008 und ist ganz auf Parteilinie – einfach moderater im Ton. Nun könnte es das erste Mal sein seit 14 Jahren, dass die Berner SVP wieder im Bundesrat ist – auch hier geht es also um viel. Schreibt SRF.
Das SVP-Duell um den Bundesratssessel könnte man auch anders interpretieren. Frei nach Ueli Maurers Äusserung, wonach es ihm egal sei, welcher Kandidat das Rennen mache, solange es kein «Es» sei.
Somit ist die Bundesratswahl um den vakanten SVP-Sitz im Hohen Haus von und zu Bern auch ein SVP-Duell zwischen Heterosexualität und Homosexualität. Oder anders ausgedrückt: Florett gegen Wattebäuschchen.
-
5.12.2022 - Tag des Absturzes, der keiner ist
Häuserpreise fallen erneut: Beginnt jetzt der Absturz des Immobilienmarkts?
Bei den Angeboten für Einfamilienhäuser war im November der erste spürbare Rückgang seit langem zu beobachten. Auch die Angebotsmieten sind leicht zurückgekommen. Dies geht aus dem neusten Swiss Real Estate Offer Index hervor.
Der überhitzte Immobilienmarkt scheint sich definitiv abzukühlen. Der Swiss Real Estate Offer Index, der von der Swiss Marketplace Group (SMG) in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI erhoben wird, zeigt dies deutlich.
Demnach lagen die Preisforderungen für Einfamilienhäuser im vergangenen Monat durchschnittlich um 0,9 Prozent tiefer – der erste spürbare Rückgang seit langem. Mit einem Quadratmeterpreis von durchschnittlich rund 7370 Franken ist das Preisniveau allerdings nach wie vor sehr hoch.
Praktisch kaum Veränderung brachte der November bei den Preisen für Eigentumswohnungen, mit +0,2 Prozent gab es immerhin noch einen kleinen Preisanstieg.
Was macht die Nationalbank?
Setzt die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit dem nächsten Zinsentscheid Mitte Dezember nochmals einen drauf? «Zwar hat sich die Teuerung auf verhältnismässig tiefem Niveau stabilisiert», erläutert Martin Waeber, Managing Director Real Estate der SMG, «sie liegt aber noch immer deutlich über dem Zielwert.» Eine erneute Erhöhung des Leitzinses sei deshalb möglich. Das würde die Kosten von Hypotheken erhöhen. Und dies wiederum die Stimmung der Kaufinteressenten trüben.
Der Referenzzinssatz für Mieten – also der durchschnittliche Zinssatz aller Hypotheken in der Schweiz – bleibt vorerst bei 1,25 Prozent. Mit der erwarteten Erhöhung im Frühjahr 2023 dürften die Mieten dann in einigen Mietverhältnissen um bis zu 3 Prozent angehoben werden.
Angebotsmieten leicht gesunken
Nach mehrmonatigem Anstieg sind die Angebotsmieten im November mit –0,6 Prozent leicht zurückgekommen. Das sind die Mietpreise auf Wohnungsportalen. Je nach Region weicht die Mietpreisentwicklung indes ab. Stärker gesunken sind die Angebotsmieten in der Zentralschweiz (–2,1 Prozent) und in der Grossregion Zürich (–1,3 Prozent). Geringe oder keine Veränderungen zeigen sich im Mittelland (–0,3 Prozent), in der Genferseeregion (–0,2 Prozent) und in der Ostschweiz (0,0 Prozent), während in der Nordwestschweiz (+0,4 Prozent) sowie im Tessin ein Anstieg der Angebotsmieten verzeichnet wurde (+1,0 Prozent).
Detaillierte Informationen und Statistiken zur schweizweiten Entwicklung finden sich unter diesem Link. Schreibt Blick.
Die Blick-Headline-Frage, ob der Absturz des Immobilienmarkts nun beginnt, ist einfach zu beantworten: Nein!
Immobilien an guter Lage sind sowieso «absturzresistent», egal was da kommt. Und diejenigen an schlechter Lage wechseln einfach den Besitzer. Das gilt auch für Eigentumswohnungen, deren Besitzer*innen ihren Wohnungskauf auf dem letzten Drücker finanzierten und nun eventuell durch höhere Zinsen überrascht werden.
So wie das Platzen der angeblichen «Immobilienblase» im Halbjahresmodus von den Medien während der letzten zehn Jahre stetig prophezeit wurde und doch nie eintraf, wird auch kein «Immobilienabsturz» stattfinden.
Katastrophenmeldungen dienen im heutigen «Qualitätsjournalismus» wider besseres Wissen sehr oft nur dem unsäglichen Clickbaiting. «Absturz des Immobilienmarkts» tönt nun mal um einiges schrecklicher als «Beruhigung des Immobilienmarkts».
-
4.12.2022 - Tag der Blick-Tpps
So einfach wird der Backofen wieder blitzblank
Hat auch Ihr Backofen wiedermal eine gründliche Reinigung nötig? Angebranntes und Fettflecken bringt man mit einfachem Spülmittel nicht ganz weg. Mit diesem Hausmittel gelingt es fast mühelos. Schreibt Blick.
Das ist doch mal ein stimmungsvoller Zweiter Adventssonntag in Zeiten der Inflation: Ein BLICK-TIPP-Video, das es in sich hat.
Habe die Anweisungen gemäss Video befolgt und siehe da: Es funktioniert tatsächlich.
Ab sofort kann ich mir den teuren Spezialreiniger von MIGROS für knapp zehn Franken die Dose sparen. Ein Calgon-Power-Tab kostet gerade mal 30 Rappen.
Freude herrscht!
-
3.12.2022 - Tag des Griffs in den Schritt
Griff in den Schritt: Hat diese Provokation noch Konsequenzen für Xhaka?
Droht dem Captain eine Sperre? Granit Xhaka legt sich mit einer eindeutigen Geste mit Serbiens Ersatzspieler an.
Eines hatte der Nati-Staff vor dem Entscheidungsspiel gegen Serbien an der WM in Katar immer wieder betont: Es wird kein zweites Kaliningrad geben. Zur Erinnerung: An der WM 2018 hatten sich die Spieler kosovarischer Abstammung, Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, vom serbischen Publikum provoziert, zur «Doppeladler»-Geste hinreissen lassen.
Bei der Revanche viereinhalb Jahre später – und vor deutlich kleinerem serbischen Anhang – dauerte es lange, bis die Wogen hochgingen. Nach 65 Minuten etwa, als Aleksandar Mitrovic einen gesuchten Penalty nicht zugesprochen erhielt. Und abermals, als sich der sichtlich provozierte Xhaka in der Nachspielzeit bei einem Wortgefecht eine zumindest für den Moment noch nicht folgenschwere Verwarnung einhandelte.
Doch im Nachgang der relativ fair geführten Partie wurde eine Geste publik, die noch ein Nachspiel haben könnte: Bei der beschriebenen Szene, bei welcher die Serben einen Elfmeter forderten, griff sich Xhaka vor der serbischen Bank provokativ in den Schritt und sorgte so für eine Rudelbildung.
Der zum «Man of the Match» gekürte Captain stand SRF nicht für ein Interview zur Verfügung. Er erläuterte an der Medienkonferenz aber ausweichend: «Es war ein Spiel mit vielen Emotionen, Emotionen gehören für mich zum Fussball dazu. Insgesamt war es fair genug. Wir wollten uns auf den Fussball konzentrieren. Uns ist es gelungen, den ersten Schritt zu machen. Wir sind sehr stolz.»
Trainer Murat Yakin nahm seinen Captain in Schutz: «Ich habe einen Granit gesehen, der sich voll und ganz auf den Fussball konzentriert und eine starke Leistung gezeigt hat. Ich habe die serbischen Spieler gesehen, die über die Linie gegangen sind. (…) Das waren normale Emotionen, eine solche Partie kann nicht emotionslos sein. Aber ich weiss nicht genau, was vorgefallen ist.»
SRF-Experte Beni Huggel hofft, dass die Geste keine Konsequenzen hat: «Es war eine unnötige Szene. Die Emotionen sind verständlich, moralisch sollte man ihn nicht verurteilen, das kann passieren.» Huggel betont aber auch: «Hat es für ihn und das Team Konsequenzen, dann ist das dumm.» Noch ist nicht klar, ob die Fifa Untersuchungen einleiten wird. Affaire à suivre ... Schreibt SRF.
O heilige Maria Mutter Gottes! Ein unbedarfter Fussballer mit kosovarischen Wurzeln greift an seine Wurzel. Und was machen unsere nicht mehr ganz so glorreichen Medien aus diesem wirklich absurd lächerlichen Vorfall, der nicht nur im Kosovo sondern bei 90 Prozent aller Männer weltweit bei jeder juckenden Gelegenheit ausgeübt wird? Den big scandal!
Aber wer nun denkt, es geht nicht noch lächerlicher, irrt sich wieder mal wie so oft in der postmodernen Zeit. Die SRF3-Moderatorin fragte heute Samstagmorgen in aller Herrgottsfrühe und mit allem Ernst die SRF3-Korrespondentin vor Ort, welche Strafe die FIFA auf die Komödie des Kosovaren in Diensten der Schweizer Fussballnationalmannschaft aussprechen könnte.
'Das sei ja', meinte sie, 'wie wenn sich eine Frau auf dem Fussballfeld an die Brust greifen würde'.
Ich hätte beinahe ins SRF3-Studio angerufen, um der Moderatorin nach ihrem etwas arg hinkenden Vergleich zu erklären, dass dort, wo Xhaka hin griff, bei den Frauen ebenfalls ein sehr nützlicher, wichtiger und freudenspendender Körperteil zu finden ist, der unter uns Biologen allerdings nicht als «Brust» bezeichnet wird.
Nach ein paar kurzen Hirnwendungen liess ich das Telefonat ins Studio dann doch sein. Wer weiss denn heutzutage in Zeiten der binären und non-binären Verschiebungen der Geschlechter und des «Es» noch, was biologisch da so alles im Schritt steckt?
-
2.12.2022 - Tag der Festplatten-Experten
Riesiges Datenleck in Zürich: Sogar psychiatrische Gutachten landeten im Milieu
Die Zürcher Justizdirektion hat mutmasslich über Jahre bei der Entsorgung von Computern geschlampt. Festplatten mit unverschlüsselten, höchst sensiblen Daten gelangten ins Zürcher Milieu. Ginge es nach den Behörden, sollte die Öffentlichkeit davon nichts erfahren.
Es ist der Albtraum eines Justizbeamten. Vertrauliche, hochsensible Informationen über ihn, über Opfer von Straftaten oder jene, gegen die er ermittelt, gelangen nach aussen. Im schlimmsten Fall in die Hände dubioser Gestalten, die – wenn der Albtraum ganz böse endet – ihn dann mit diesen Informationen zu erpressen versuchen.
Für die Zürcher Staatsanwälte und Polizisten ist der Albtraum Wirklichkeit geworden. Und schuld am Daten-GAU ist ihre eigene Behörde: die Zürcher Justizdirektion.
Psychiatrische Gutachten und Privatadressen
Über Jahre hat die Direktion alte Server und Computer ihrer Mitarbeitenden zur Entsorgung freigegeben, auf deren Festplatten sich teils unverschlüsselte Daten befanden. Darunter Verzeichnisse mit Handynummern von Kantonspolizisten, Privatadressen von Mitarbeitenden, Gebäudepläne, ja sogar psychiatrische Gutachten von Angeklagten. Das geht aus Unterlagen hervor, die Blick vorliegen. Diese Daten gelangten zu Roland Gisler (58), einem mehrfach vorbestraften Mann aus dem Zürcher Milieu. Ihm gehört die Bar Neugasshof, die seit Jahrzehnten im Fokus der Polizei steht.
Die Zürcher Behörden wissen seit zwei Jahren vom selbst verschuldeten Datenskandal. Der Öffentlichkeit haben sie ihn bisher verschwiegen. Wie Blick-Recherchen zeigen, wurde 2020 eine Administrativuntersuchung eingeleitet, die inzwischen abgeschlossen ist. Weder über deren Durchführung noch über ihr Ergebnis hat die Justizdirektion informiert – und die Behörde weigert sich trotz Öffentlichkeitsgesetz, den Abschlussbericht herauszugeben. Selbst die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats (GPK) hat ihn gemäss Blick-Informationen bisher nicht erhalten.
Fehr spielt Skandal herunter
Die zuständige Regierungsrätin Jacqueline Fehr (59, SP) spielt die Angelegenheit gegenüber der GPK des Zürcher Kantonsrats derweil herunter.
Bei der Kommission schrillten die Alarmglocken, nachdem Milieu-Anwalt und SVP-Kantonsrat Valentin Landmann (72) gemeinsam mit weiteren SVPlern am Montag eine Anfrage zum Skandal im Kantonsparlament eingereicht hatte. Dass Landmann von der Sache weiss, liegt daran, dass er selbst in den Fall verwickelt ist. Er ist der Anwalt Gislers.
Gisler ist über seinen Bruder André Gisler (57) an die Festplatten und USB-Sticks der Justizdirektion gelangt. Dieser war ungefähr ab 2000 bis 2014 für die Direktion tätig. Vorsteher der Justizdirektion waren in diesem Zeitraum SP-Parteikollege Markus Notter (62) und später Grünen-Regierungsrat Martin Graf (68). Laut einem IT-Verantwortlichen wurden die Festplatten «immer fachgerecht entsorgt respektive vernichtet», wie er in einem internen Memo beteuerte.
Festplatten lagerten in Holzkiste im Garten
Aussagen von André Gisler und einem ehemaligen Mitarbeitenden lassen daran stark zweifeln.
Der Deal, wie ihn André Gisler in der Einvernahme der Staatsanwaltschaft schildert: Er holte die ausgemusterten Computer, Drucker, Server und andere Geräte bei der Justizdirektion ab und durfte sie als Gegenleistung nach Löschung der sich darauf befindenden Daten weiterverkaufen. Wie er sagt, existierte weder ein Arbeitsvertrag, geschweige denn hätte er je schriftlich bestätigen müssen, die Daten ordnungsgemäss gelöscht zu haben. Die Rede ist von Tausenden Computern, die in den Besitz des Mannes gelangten.
Ein Teil der Festplatten und Sticks gelangte zu seinem Bruder Roland Gisler. Sie lagerten hinter seinem Haus in einer grossen Holzkiste. Beim Durchschauen der Harddisks habe er darauf zig unverschlüsselte Dokumente gefunden, erzählt er. Darunter angeblich auch Einvernahmen sowie Gutachten, die der bekannte forensische Psychiater Frank Urbaniok (60) verfasst habe. Dieser sagt auf Anfrage, sollte das stimmen, sei er nie darüber informiert worden.
Erst vor zwei Jahren flog das Leck auf
Die Zürcher Justiz bekam erst vor zwei Jahren Wind davon, wo ihre Daten gelandet sind. Wie aus Einvernahmeprotokollen hervorgeht, soll sich der ehemalige Mitarbeiter André Gislers zwar schon 2013 an die Behörden gewandt haben, und zwar ans Büro des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (Edöb). Er soll diesem mehrere unverschlüsselte Dokumente der Militärjustiz geschickt haben. Doch daraufhin ist seiner Aussage zufolge nichts geschehen. Er habe nie eine Antwort auf sein Mail bekommen, sagte er.
Erst als Anfang November 2020 plötzlich eine Frau an der Privatadresse eines Staatsanwalts auftauchte (siehe Box), leitete die Justiz Ermittlungen ein. Knapp eine Woche später wurde Roland Gisler festgenommen. Er blieb acht Monate in U-Haft. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, wie die Staatsanwaltschaft Zürich bestätigt.
Gisler wird unter anderem vorgeworfen, dass er versucht habe, mit den Daten die Zürcher Justiz zu erpressen und zu beeinflussen. Der Milieu-Beizer ist vor kurzem unter anderem wegen Drogenhandel und illegalen Waffenbesitzes zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er zog das Urteil ans Bundesgericht weiter, weil er es als Racheaktion der Zürcher Behörden wegen des Datenskandals ansieht.
Risiko Erpressungsversuch
Die Affäre zeigt, welches Risiko das Datenleck birgt. Weitere Erpressungsversuche sind nicht ausgeschlossen. Schliesslich ist unklar, wer alles inzwischen über Festplatten verfügt, auf denen sich noch unverschlüsselte Daten der Zürcher Justiz befinden. Gemäss den Akten gab Gisler mehreren Personen Dokumente weiter.
Dass mit Roland Gisler eine Person ausserhalb der Behörde über «heikle Daten der Justizdirektion verfügt», stand für den zuständigen Staatsanwalt schon nach einer ersten Sichtung der beschlagnahmten Festplatten fest. Das schrieb er im Februar 2021 in einem Schreiben ans Obergericht.
Längst bekannt? Von wegen!
Heute tun die Behörden gegenüber der Öffentlichkeit alles, um den Skandal zu relativieren. Eine erste Blick-Anfrage wimmelte der Sprecher der Justizdirektion mit der Behauptung ab, dass dieser Fall «längst bekannt sei». Das stimmt nicht. Dann stellte man die Angelegenheit als kalten Kaffee dar. Seit 2013 würden Datenträger «professionell zertifiziert» entsorgt. Dieser Prozess sei «unabhängig vom Vorfall 2008» installiert worden, sagt Mediensprecher Benjamin Tommer. Er – wie auch Regierungsrätin Fehr gegenüber der GPK – behaupten, dass 2008 Schluss war mit dem Datenleck. Doch Blick wie auch SVP-Kantonsrat Landmann liegen Unterlagen vor, die von 2001 bis 2012 datiert sind.
Die Staatsanwaltschaft teilt nun ausserdem mit, dass sich nur «einige wenige Daten der Justizdirektion» auf den im Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen Gisler sichergestellten Datenträgern befunden hätten. Das dürfte eine grobe Untertreibung sein. Blick hatte Einsicht in über 30 Dokumente, über zehn enthalten mutmasslich heikle, teilweise sehr heikle Daten.
Justizdirektion lässt Fragen offen
Blick wollte von der Justizdirektion wissen, wie es dazu kommen konnte, dass vertrauliche Unterlagen im Zürcher Milieu landeten. Gab es tatsächlich keine schriftliche Vereinbarung mit der Firma, denen man Geräte mit hochsensible Daten darauf anvertraute? Wie viele Festplatten mit möglicherweise heiklen Informationen sind mutmasslich noch immer im Umlauf? Und: Welche Konsequenzen hatte die Administrativuntersuchung, die dazu in Auftrag gegeben worden war?
Das alles bleibt offen. Die Fragen seien «ausnahmslos Gegenstand der Strafuntersuchung», teilt die Justizdirektion auf Anfrage lediglich mit. Die Antworten kenne man nicht und könne die Fragen deshalb nicht beantworten. Schreibt BLICK.
Die Empörung bei BLICK & Co. sowie den üblichen Verdächtigen aus der Politik ist gross und entsprechend wird ein Drama Shakespeareschen Ausmasses aufgebaut. Dass vor ein paar Tagen bei Facebook über hunderttausend Telefonnummern und E-Mail-Adressen gehackt wurden und in einschlägigen Kreisen bereits zum Kauf angeboten werden, ist in den Medien kaum oder gar nicht thematisiert worden.
Amtsstellen-Bashing ist halt doch etwas lukrativer im Clickbaiting-Gewerbe, als sich mit einer der grössten Techfirmen anzulegen, bei deren Plattform zehn mal mehr Schweizerinnen und Schweizer nonstop versammelt sind, als die Stadt Zürich Einwohner hat.
Natürlich wurde bei der Entsorgung ausgedienter IT-Hardware von den Verantwortlichen in den Zürcher Amtsstuben geschlampt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Die Entsorgungen liegen zwischen zehn und zwanzig Jahren zurück. Dass auch vermeintlich gelöschte Daten auf den Festplatten für die Ewigkeit gespeichert bleiben, war zum Zeitpunkt der Entsorgung nur den Wenigsten bekannt. Selbst IT-Fritzen waren sich damals der Gefahr teilweise nicht bewusst. Entsprechend sorglos war der Umgang mit dem Zeugs.
Natürlich ist es für die Betroffenen unangenehm, wenn nun gewisse Leute aus dem Zürcher Milieu informiert sind, wer alles in der Limmatstadt ein psychisches Problem hat. Doch viel interessanter wäre zu wissen, wer in Zürich eigentlich keinen Vogel hat.
-
1.12.2022 - Tag der gefallenen Kanzler
Ex-Kanzler Sebastian Kurz beklagt im Interview mit dem "Stern" Vorverurteilung und "Kampagne gegen mich"
Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der am Montag den ganzen Tag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einvernommen wurde, beteuert in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Stern" einmal mehr seine Unschuld. "Was diese strafrechtlichen Vorwürfe anbelangt, freue ich mich schon auf den Tag des Freispruchs, weil ich mir nichts zuschulden habe kommen lassen." Gegen Kurz wird wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss und wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt.
In zehntausenden Chatnachrichten deute nichts darauf hin, "dass man mir etwas Strafrechtliches vorwerfen könnte. Jetzt hat sich ausgerechnet derjenige, der mehrerer Straftaten überführt ist, angeboten, straffrei auszugehen, indem er gegen mich aussagt", so Kurz im Hinblick auf das umfassende Geständnis des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium und Öbag-Chefs Thomas Schmid.
Schmid hat Kronzeugenstatus beantragt und unter anderem Kurz schwer belastet, indem er aussagte, dass Kurz Auftraggeber diverser manipulierter und durch Steuergelder finanzierter Umfragen gewesen sei. "Es gibt nichts, das darauf hinweist, dass seine Aussage stimmt", verteidigt sich Kurz im "Stern". Und er verweist einmal mehr auf Zeugen und ein von ihm heimlich aufgezeichnetes Telefonat, die das Gegenteil belegen würden. Deshalb sehe er der Sache "gelassen entgegen".
Auch Medienschelte bringt Kurz in dem Interview an, von diesen sehe er sich zu Unrecht vorverurteilt: "Natürlich ist es eine Kampagne gegen mich, weil man mich in Wahlen nicht schlagen konnte", sagt er. "Die Unschuldsvermutung steht in der Verfassung, aber Realität ist sie nicht." Schreibt DER STANDARD.
DER STERN scheint noch immer ein Herz für gefallene Kanzler zu haben. Folgt jetzt nach «Hitlers Tagebücher» (1983) ein Reload mit «Sebastians Tagebücher»?
-
30.11.2022 - Tag der bigotten Religionen
Er liefert den Deutschen Gas: Katars Energieminister wütet gegen LGBTQ und Deutschland
Katars Energieminister Saad Scharida al-Kaabi lehnt LGBTQ ab. Das macht er auch nach dem Gas-Deal mit Deutschland nochmals deutlich. Er schiesst auch gegen die Deutschen.
Der katarische Energieminister Saad Scherida Al-Kaabi (55) hat Änderungen im Umgang mit homosexuellen Menschen in seinem Land infolge der Fussball-WM eine klare Absage erteilt. Dies im Gespräch mit der deutschen «Bild»-Zeitung, die nach dem öffentlich gewordenen Gas-Deal mit Deutschland mit Katars verantwortlichem Minister sprach.
«Als Muslime glauben wir daran, dass LGBTQ nicht akzeptabel ist in unserer Religion», sagte Al-Kaabi. «Das islamische Gesetz akzeptiert LGBTQ nicht.» Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.
«Westen will uns das diktieren, was er will»
Internationale und die aus Deutschland lautwerdende Kritik an der Haltung Katars in dieser Frage wies er zurück. «Der Westen will uns das diktieren, was er will», sagte er. Er holt weiter aus und meint: «Wo ist mein Menschenrecht, das zu wählen, was ich für meine Religion, mein Land, meine Kinder und meine Familie will?»
Es werde verlangt, «dass wir als Katarer uns verändern müssen. Dass wir unsere Religion, unseren Glauben ändern müssen.» Dies sei «nicht akzeptabel».
Am Dienstagmorgen unterzeichnete Katars Energieminister Saad Scharida al-Kaabi den Gas-Deal mit Deutschland. Ab 2026 wird Katar der Bundesrepublik im Jahr zwei Millionen Tonnen LNG-Flüssiggas senden.
Kritik an deutschem Wirtschaftsminister
Die Kritik an Deutschland aus Katar geht weiter. So attackiert Al-Kaabi den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne). Entgegen seiner Behauptung habe Habeck ihm gegenüber nie etwas Kritisches geäussert.
Es geht um ein Treffen mit dem Minister im Sommer. Al-Kaabi sagt: «Als er hier in Katar war, war das einzige, worüber er gesprochen hat, ob wir mehr Gas liefern können.» Eine Sprecherin des Ministers dementiert diesen direkten Angriff. Habeck habe in Katar «auch die Frage von Menschenrechten und gesellschaftlichen Werten thematisiert», heisst es.
Katars Energieminister legt aber noch nach. Er äussert sich zur Aussage von Habeck, dass die Vergabe der WM an Katar durch Korruption erklärt werden könne. «Wenn man jemanden der Korruption beschuldigt, muss man Beweise vorzeigen. Man ist juristisch haftbar, wenn man sagt, dass jemand korrupt ist.» Der deutsche Minister solle «mehr Respekt vor Katar haben». Zuvor versuchte der Katar-Energieminister zu beschwichtigen. Er gab an, dass er ein gutes Verhältnis zur deutschen Regierung habe. Schreibt BLICK.
Der Kritik von Katars Energieminister Saad Scharida al-Kaabi gegenüber den deutschen Polit-Eliten, allen voran Wirtschaftsminister Robert Habeck, kann man ein gewisses Verständnis entgegenbringen. Der ehemalige Kinderbuchautor Habeck plappert dank seinem Selbstdarstellungswahn, der dem täglichen Ranking seiner Umfragewerte geschuldet ist, in der Tat viel Unsinn in die Mikrophone der Journaille.
Damit steht er allerdings nicht allein in der Polit-Landschaft. Habeck ist wie beinahe alle Politiker*innen der letzten Jahrzehnte ein Opfer der von (angeblich) professionellen Sprach- und Bekleidungsexperten «gecoachten» Volksvertreter*innen. Und dies auf allen Ebenen. Vom Landammann bis zum Kanzler.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Boris Palmer, wurde kürzlich haushoch wiedergewählt. Trotz – oder gar wegen – der Sistierung seiner Parteimitgliedschaft bei den Grünen bis Ende 2023.
Lächerliche Äusserlichkeiten sind heutzutage im Politmarketing wichtiger als politische Schulung. Dass diese Gleichschaltung gesichtslose, parteipolitische Marionetten am Laufmeter produziert, dürfte der Wahlbeteiligung nicht besonders förderlich sein. Politikverdrossenheit fällt nicht vom Himmel. Dafür gibt es viele Gründe. Das Politmarketing ist einer davon.
Wenn der katarische Energieminister im Namen des Korans über LGBTQ wettert, kann man dies kritisieren. Muss man aber nicht zwangsweise. Auch die christliche Kirche hat ein äusserst gespaltenes Verhältnis zur Homosexualität.
Selbst die «queere» Vorzeigenation Deutschland schaffte den Paragraph 175 Strafgesetzbuch (StGB), der die Homosexualität unter Männern (nicht aber unter Frauen!) verbot und damit die staatliche Verfolgung bis hin zur KZ-Einweisung von schwulen und bisexuellen Männern legitimierte, erst per 11. Juni 1994 definitiv ab.
Da dürfte man den Wüstensöhnen durchaus etwas mehr Zeit einräumen, um zumindest die staatliche Verfolgung homosexueller Menschen bis hin zur Todesstrafe (Saudi Arabien, Iran, Afghanistan usw.) abzuschaffen. Den westlichen Staaten wurde sie ja auch gegeben, wie das Beispiel Deutschland zeigt. Von der christlichen Kirche ganz zu schweigen.
Der renommierte afghanische Philosoph, Literaturwissenschaftler und Historiker Ali Mohammed Zahma, der 1985 von Afghanistan nach Österreich migrierte und sich dort den Beinahmen «Der Adorno Afghanistans» erwarb, nahm vor vielen Jahren an einer TV-Sendung teil, in der u.a. über das Thema «Homosexualität im Islam» diskutiert wurde.
Er nannte die Ablehnung von Homosexualität im Namen des Korans eine «Bigotterie». Seiner Meinung nach würden die entsprechenden Suren des Korans widersprüchliche Deutungen zulassen. Zumal das ebenfalls vom Koran auferlegte «Verbot des Geschlechtsverkehrs vor der Ehe» verdeckte Homosexualität wie in keiner anderen Religionsgemeinschaft fördere.
Ein Verbot übrigens, das auch etliche im Westen praktizierte Religionen heute noch mit ihren Bibeln wie tibetanische Gebetsmühlen vor sich hertragen und entsprechende Gelübde ablegen lassen. Es sind dies unter anderen die «Zeugen Jehovas», die besonders in den USA mitgliederstarke «Neuapostolische Kirche», «Mormonen» und «Amische». Bei all diesen vorgenannten Religionen ist auch Homosexualität ebenso verboten wie im Islam. Oder im orthodoxen Judentum.
Was lernen wir daraus? Auch die hehre Wertegemeinschaft des Westens, allen voran die USA, pflegt die Bigotterie.
-
29.11.2022 - Tag der starken Männer in der Politik
Wunsch nach «starkem Führer»: Demokratie braucht Streit
Wahlen? Parlament? Aus Sicht eines Viertels der österreichischen Bevölkerung stark überschätzt. Der jährliche Demokratiemonitor von Sora weist Rekordwerte auf: Jeder neunte Befragte sagte heuer, dass es einen starken Führer geben sollte, der sich eben nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss, weitere 15 Prozent halten das für ziemlich richtig. Klar abgelehnt wird die Idee nur von 46 Prozent.
Aber: Was nach einem Ruf nach einer Diktatur klingt, ist in Wirklichkeit keiner. Denn in derselben Umfrage sagen 87 Prozent, dass die Demokratie "die beste Staatsform ist, auch wenn sie Probleme mit sich bringen mag". Nur jeder 50. Befragte lehnt die Idee der Demokratie als bester Staatsform ab.
Das haben also dieselben Personen gesagt. Wie sich der Widerspruch erklärt? Zunächst einmal mit dem Bild, das die Politik bietet – und das von den Medien mit entsprechendem Verstärkereffekt vermittelt wird: Man kann schon den Eindruck bekommen, dass da nur gestritten wird – oft aus Anlässen und über Themen, die die meisten Menschen nicht berühren. Und Streit mag zwar einen gewissen Unterhaltungseffekt haben – insgesamt ist er aber der überwiegend harmoniebedürftigen Bevölkerung zuwider.
Demokratie braucht aber Streit – ein Ringen um die besten Lösungen. Einen Austausch der besten Argumente. Vorgebracht von vorzüglichen Rednern. Das wäre jedenfalls die Idealvorstellung. Wie weit wir – nicht nur in Österreich – von diesem Ideal entfernt sind, kann jeder selbst abschätzen.
Idealvorstellung
Und dann die Umsetzung! Auch da gibt es die Idealvorstellung, dass der jeweils bestmögliche Kompromiss von einer starken Führungspersönlichkeit rasch und effizient zur Wirkung gebracht wird. Die Realität sieht bekanntlich anders aus – mit üblen Folgen: Wenn Verantwortung hin und her geschoben wird, wichtige Entscheidungen aufgeschoben oder nicht durchgesetzt werden, dann verlieren die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in den Staat und das politische System. Ein Befund, der ebenfalls im Demokratiemonitor abgebildet wird.
Daraus wird besser verständlich, dass sich die Menschen eine solche starke Führung – und ja: auch eine starke Frau oder einen starken Mann – in der Verantwortung wünschen. So in dem Sinn: damit endlich mal was weitergeht.
Das war ja auch die Erfahrung vieler Jahrzehnte: Unter Figl und Raab, unter Klaus und Kreisky gab es wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschritte, die für einzelne Menschen ebenso wie für das ganze Land spürbar waren. Und die eben den genannten Kanzlern und ihrer Führungskraft zugeordnet wurden.
Demokratie braucht nämlich nicht nur den Streit um die beste Idee, sie braucht auch klare Führung. Der heute vielfach geschmähte Kanzler Sebastian Kurz hat das während des ersten Lockdowns ziemlich klar vorexerziert und dafür hohe Zustimmungswerte erzielt.
Aber das funktioniert nur auf Zeit.
Zur demokratischen Kultur einer repräsentativen Demokratie gehört nämlich auch, dass die Führung regelmäßig hinterfragt und gegebenenfalls abgelöst werden kann. In der Zeit dazwischen ist jedoch der Wunsch nach klarer Führung und Fokussierung auf die Themen, die das Leben der Menschen in diesem Land bestimmen, legitim. Wenn die Regierung das nicht hinbekommt, wird sie 2024 zu Recht abgewählt werden. Schreibt DER STANDARD.
Sind wir schon wieder so weit? Die legale Wahl des «Führers» 1933 als «starker Mann» zum deutschen Kanzler bereits vergessen?
Ein unsäglicher Artikel, der so ziemlich an allen Problemstellen der Demokratien in ihrem heutigen Zustand mit einer Ignoranz sondergleichen vorbeizieht und das Gekeife zwischen den Parteien bejubelt, dem der intellektuelle Unterboden meistens fehlt. Dass es sich dabei vorwiegend um ideologische Auseinandersetzungen und Klientel-Bewirtschaftung zwischen den politischen Alpha-Granden handelt, wird ebenfalls verschwiegen.
Starke Männer, man könnte sie auch Diktatoren nennen, stehen nicht für die Bewahrung von Demokratien, sondern für das pure Gegenteil. Konsensfähigkeit, auf der jede Demokratie basiert, gehört nicht zu deren Fähigkeiten. Sich als Starker über die Schwachen zu erheben hingegen schon.
Journalist Conrad Seidl ist sich nicht einmal zu schade, dem ehemals «starken Mann» und aus dem Amt des österreichischen Bundeskanzlers gejagten Sebastian Kurz posthum einen Heiligenschein zu verpassen.
Das sagt mehr über den Journalisten und seinen Zeilen-Honorar-Artikel aus, als über die tatsächlichen Probleme der Demokratien.
-
28.11.2022 - Tag ders dicken Traumtänzers aus Nordkorea
Kim will Nordkorea zur stärksten Atommacht der Welt machen
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat nach den jüngsten Raketentests das Ziel ausgegeben, sein Land zur stärksten Atommacht der Welt zu machen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtete, bezeichnete Kim die neue Interkontinentalrakete des Landes am Samstag als "die stärkste strategische Waffe der Welt". Der Aufstieg zur größten Atommacht sei das "wichtigste revolutionäre Ziel", sagte Kim demnach.
Nordkoreanische Wissenschafter hätten einen "wunderbaren Sprung in der Entwicklung der Technologie zur Anbringung von Nuklearsprengköpfen auf ballistischen Raketen" gemacht, wurde Kim von KCNA weiter zitiert. Dem Bericht zufolge zeichnete Kim bei einer Zeremonie anlässlich des jüngsten Raketentests am Samstag mehr als hundert Beamte und Wissenschaftler für ihre Arbeit an der Interkontinentalrakete Hwasong-17 aus.
Die führenden Beamten und Wissenschafter hätten der Welt das "Ziel Pjöngjangs, die stärkste Armee der Welt aufzubauen", vor Augen geführt, fügte Kim hinzu. Der Aufbau der Nuklearstreitkräfte diene dazu, "die Souveränität des Staats und der Bevölkerung zu schützen". Ziel sei es, die "mächtigsten strategischen Streitkräfte der Welt" zu schaffen.
Hwasong-17 sei laut Experten "Monsterrakete"
Nordkorea hatte in der vergangenen Woche in einem der bisher schlagkräftigsten Raketentests des Landes eine Interkontinentalrakete abgefeuert, die nach japanischen Angaben westlich der Insel Hokkaido im Meer niederging. Bei der Rakete handelte es sich offenbar um Nordkoreas jüngste Interkontinentalrakete mit einer potenziellen Reichweite, die das US-Festland treffen könnte. Experten bezeichnen sie als "Monsterrakete".
Bei dem Fototermin am Samstag rief Kim laut einem weiteren KCNA-Bericht zu einer "grenzenlosen Verstärkung der Verteidigungskapazitäten" auf und forderte die Wissenschafter und Arbeiter auf, "die nukleare Abschreckung des Landes in außergewöhnlich schnellem Tempo auszubauen und zu verstärken".
Die staatliche Zeitung "Rodong Sinmun" veröffentlichte mehr als ein Dutzend Bilder von Kim bei dem Fototermin mit seiner "geliebten Tochter". Nordkoreas Machthaber hatte sie erstmals beim Start der Interkontinentalrakete der Öffentlichkeit präsentiert.
Internationale Sanktionen wegen Waffenprogramm
Pjöngjang hat in diesem Jahr bereits mehr Raketen abgefeuert als in jedem Jahr zuvor. Allein im November waren es vermutlich 30 Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen. Das international abgeschottete Land baut seit Jahren sein Waffenprogramm aus und unterliegt deshalb internationalen Sanktionen. Der UN-Sicherheitsrat hat seit 2006 fast ein Dutzend Resolutionen verabschiedet, in denen Sanktionen gegen Nordkorea wegen seiner Atom- und Raketenaktivitäten verhängt wurden. Mitglieder des UN-Sicherheitsrats hatten den jüngsten Raketentest Nordkoreas am Montag verurteilt, sie verzichteten aufgrund des Widerstands Chinas und Russlands aber auf eine formelle Erklärung.
Die US-Regierung geht davon aus, dass der Schlüssel für ein Einlenken Pjöngjangs bei China liegt, dem wichtigsten Verbündeten des Landes. Nach Angaben eines hochrangigen US-Beamten will Washington Peking darum bitten, seinen Einfluss auf das Land zu nutzen.
Nach nordkoreanischen Angaben bot Chinas Präsident Xi Jinping Nordkorea nun an, mit Kim für den Weltfrieden zusammenzuarbeiten. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, in einer Botschaft an Kim habe Xi seine Bereitschaft signalisiert, sich zusammen mit Pjöngjang für "Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand der Region und der Welt" einzusetzen. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur berief sich auf eine Antwort Xis auf Kims Glückwünsche an den chinesischen Staatschef zur dritten Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Das Schreiben wurde vor den jüngsten Äußerungen Kims zum Aufbau Nordkoreas zur Atommacht verfasst. Schreibt DER STANDARD.
Dass «Rocket Man», wie Trump den Dicken aus Nordkorea nannte bevor er mit ihm eine ebenso dicke Freundschaft fürs Leben schloss, ist bekannt für seine Vollmundigkeit fern jeglicher Realität.
Es könnte aber durchaus sein, dass die Marionette Chinas sein anvisiertes Ziel als stärkste Atommacht des Universums tatsächlich erreicht. Vorausgesetzt, China übernimmt das Armenhaus Asiens nicht nur de facto sondern auch de jure und lässt den Clown weiterhin Emmentaler-Käse Laibweise futtern bis er eines Tages doch noch platzt. Wenn nicht, bleibt immer noch das Uiguren-Camp.
-
27.11.2022 - Tag der Oberwalliser Schamgefühle
Die Briger hadern mit Infantino: «Eine Schande fürs Oberwallis»
Die Walliser haben die Nase voll. Sie verstossen ihren berühmtesten Sohn Gianni Infantino. Ein Cousin des Fifa-Papstes findet das schlimm.
Einst war das Oberwallis stolz auf seinen Sohn Gianni Infantino (52). Der «Walliser Bote» titelte 2016, nachdem die Fifa den gebürtigen Briger zum neuen Papst des Weltfussballs krönte: «Wir sind Fifa», und der Stadtpräsident von Brig verkündete eine Freinacht. Der halbe Kanton trug Infantino auf Händen, manch einer trank sich die Füsse rund. «Ä Wallisr» – «ä Brigr»: Der weltbekannte Fussball-Funktionär war einer von ihnen.
Doch das ist nun vorbei. Letzten Montag titelte der «Walliser Bote»: «Man muss sich vom Oberwallis aus schämen.» Hinter den Bergen hämmerten die Leser in die Tasten: «Eine Schande fürs Oberwallis» und: «Bleiben Sie doch bitte in Katar.» Alt Staatsrat Thomas Burgener (68) kommentierte fleissig mit.
Grund für den Tumult ist Infantinos Katar-Rede. Einen Tag vor dem WM-Start setzte sich der Fifa-Chef vor die Mikrofone und holte tief Luft: «Heute fühle ich mich schwul. Heute fühle ich mich behindert. Heute fühle ich mich wie ein Wanderarbeiter.» Die Welt staunte. Und reagierte prompt mit einem Shitstorm. Das sei eine «bizarre Wutrede», eine «Katastrophe», eine «irre Rede», hiess es mehrheitlich in den Medien. Die sozialen Netzwerke produzierten Spott im Sekundentakt: «Infantino ist ungefähr so schwul, wie er ehrlich ist», so der Komiker Mike Müller (59).
Designerware statt Wanderschuhe
Infantinos Eltern kamen in den 1960er-Jahren aus Italien ins Oberwallis – als Wanderarbeiter. Die Mutter führte am Briger Bahnhof einen Kiosk, der Vater verlegte Schienen für die SBB. Man lebte in einfachen Verhältnissen, wie Infantino vor einiger Zeit in Interviews gern betonte. Er galt als «Büezerbueb», der es an die Spitze des Weltfussballs geschafft hat.
Bei seiner «Wutrede» erinnerte Infantino an seine Biografie. Er betonte, wie hart die Eltern hätten arbeiten müssen, wie schwierig die Lebensbedingungen gewesen, wie schlecht sie als Ausländer behandelt worden seien. Deshalb könne er mit den Gastarbeitern in Katar mitfühlen, von denen viele beim Bau der WM-Stadien ihr Leben verloren. Viele sahen darin eine zynische Rechtfertigung für die Menschenrechtslage im Wüstenstaat. Das unbeugsame Volk am Fuss des Simplons jedoch erkannte darin einen Affront.
Zum Beispiel alt Staatsrat Burgener. In seinem Garten holt der Sozialdemokrat vor der Kulisse der Alpen auf «Wallisertitsch» zum Gegenschlag aus: «Eine Frechheit! Das zeigt, wie unterwürfig Infantino ist. Er lässt sich von den Katarern instrumentalisieren.»
Den Fifa-Papst hält er für abgehoben, er stehe nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden: «Infantino ist keiner von uns.» So erfährt der Aufstieg des Fussball-Funktionärs eine Umdeutung: Statt in Wanderschuhen Viertausender zu besteigen, habe er in Designerschuhen den obersten Rang der Fifa erklommen. Nach all den Skandalen meint Burgener: «Es ist Zeit, zurückzutreten.»
Mit Glühwein gegen Kamerun
Dass der Ex-Politiker gegen Infantino schiesst, hängt womöglich auch mit seinem Wohnort zusammen. Burgener lebt in Visp – und von dort stammt auch Sepp Blatter, der für Infantino abdanken musste. Das Schulhaus trägt dessen Namen. Visp ist Blatter-Land. Die meisten kennen ihn persönlich.
So auch Burgener. «Klar hat Blatter keine drei Heiligenscheine. Aber wer hat die schon? Immerhin machte er aus der Fifa ein Milliardenunternehmen», relativiert Burgener. Zwischen Visp und Brig liegen bloss etwa 8,5 Kilometer. Zwischen den Ortschaften aber herrscht eine alte Fehde. Und ausgerechnet beide stellten je einen Fifa-Präsidenten, die sich heute bekriegen.Selbst in Brig haben sich jedoch viele von Infantino abgewandt, wie ein Besuch auf dem Dorfplatz zeigt. Am Donnerstag stehen dort ungefähr 30 Leute. Bei Glühwein verfolgen sie das Spiel Schweiz gegen Kamerun. Auf Infantino angesprochen, sagt einer: «Dä het än Egge ab», ein anderer: «Er hat alle Sympathien verspielt.»
Andere halten an Infantino fest. Zum Beispiel Stadtpräsident Mathias Bellwald (58). «Ich glaube nicht, dass der Fifa-Präsident als Experte in Sachen Menschenrechte taugt», sagt der Freisinnige. Und: «Wo gehobelt wird, fliegen Späne.» Infantino habe versucht, die einende Kraft des Fussballs zu nutzen, das sei ihm zugutezuhalten.
Bellwald rechtfertigt sogar den Vergleich des Wallis mit Katar: «Auch die Arbeitsbedingungen der italienischen Wanderarbeiter waren desaströs. Zum Beispiel hat der Bau des Simplontunnels zahlreiche Opfer gefordert.» Das war allerdings zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Schreibt SonntagsBlick.
«Sieht aus wie Scheisse. Riecht wie Scheisse. Das muss Scheisse sein.» Mit diesen Worten soll sich ein Tester der Brause-Limonade Red Bull gegenüber dem Gründer des gleichnamigen Imperiums, Dietrich Mateschitz, geäussert haben. So steht's jedenfalls geschrieben in einer autorisierten Biografie von Mateschitz.
Nein, es folgt nun nicht das, was Sie erwarten, obschon... Je nach Blickwinkel und Wortschatz ...
Auf den gebürtigen Italiener aus Kalabrien und FIFA-Boss Gianni Infantilo bezogen – Blick nennt ihn «FIFA-Papst», was der Papst allerdings nicht verdient hat – könnte man den Red Bull-Verriss wie folgt abändern: «Infantilo sieht aus wie ein kalabrischer Mafiaboss. Infantilo handelt wie ein kalabrischer Mafiaboss. Infantilo muss ein kalabrischer Mafiaboss sein.»
Beachten Sie bitte den Konjunktiv. Infantilo ist selbstverständlich kein kalabrischer Mafiaboss. Im Gegenteil. Er ist 2016 angetreten, um den korrupten Sauhaufen rund um den ehemaligen Fifa-Papst Sepp Blatter auszumisten.
Das ist dem Kalabrier mit der libanesischen Ehefrau und Zweitwohnsitz in Katar gut gelungen. Sepp Blatter ist inzwischen reingewaschen und geniesst Heiligenstatus. Auch die laufenden Strafverfahren der Schweizer Justiz gegen Infantilo versandeten irgendwie auf unerklärliche, mysteriöse Art und Weise. Infantilo hat alles richtig gemacht und verlegt gemäss heutiger SDA-Meldung seinen Erstwohnsitz von Zürich in den etwas steuergünstigeren Kanton Zug.
Nur die Korruption innerhalb der FIFA ist geblieben. Auch wenn sie neuerdings mit «Networking» oder «Beziehungspflege» zum Wohle des globalen Billionen-Entertainments «Fussballsport» umschrieben wird.
Ein cleveres Bürschchen, dieser Gianni Infantilo. Auch wenn ihn die Bevölkerung von Brig angeblich als Schande für das Oberwallis betrachtet. Was allerdings nichts anderes als Bigotterie vom Feinsten ist.
Denn letztendlich ist Infantilos Lehrmeister Sepp Blatter aus Visp auch nichts anderes als ein Oberwalliser, über den man sich trefflich schämen könnte.
Doch scheinbar handeln die heuchlerischen Oberwalliser nach dem Sprichwort «Wenn zwei das Gleiche tun ist das noch lange nicht dasselbe.»
-
26.11.2022 - Tag der schweigenden Polit-Eliten
EU-Kommissionsvize zu nächsten Jahren: Ukraine-Flüchtlinge bleiben auch nach Kriegsende
Die über Europa verteilten Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach Meinung der EU-Kommissionsvizepräsidenten Dubravka Suica auch nach Kriegsende nicht sofort in ihre Heimat zurückkehren.
Der EU-Kommissionsvizepräsidenten Dubravka Suica macht klar: «Ihre Schulen sind zerstört, ihre Häuser sind zerstört, ihre Arbeitsplätze sind verloren», sagte Suica dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag).
Gastgeber wie etwa Deutschland oder Polen müssten sich nach ihrer Einschätzung auf einen jahrelangen Verbleib von Flüchtlingen aus der Ukraine auch nach Ende des Kriegs einstellen. «Ich denke, dass wir darauf vorbereitet sein müssen.»
Können gar nicht nach Hause gehen
Ein zentrales Problem sei, dass diese Familien denken, sie könnten am Tag nach dem Krieg nach Hause gehen. «Aber sie werden dann noch nicht Hause gehen», sagte Suica, Vizepräsidentin der EU-Kommission für Demokratie und Demografie. «Ich muss das so offen sagen, ich habe selbst den Krieg in Kroatien im ehemaligen Jugoslawien erlebt.» Schreibt Blick in einer SDA-Meldung.
Das war anzunehmen. Nicht erst seit heute. Nur scheut sich die Politik, offen darüber zu reden. Aus verständlichen Gründen.
Es könnte die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger für die Unterstützung der Ukraine in den europäischen Ländern gravierend beeinträchtigen.
Für die im ständigen Wahlkampfmodus regierenden Polit-Eliten alles andere als beruhigende Nachrichten.
Die rechtspopulistische AfD wurde bei den deutschen Bundestagswahlen 2017 ausschliesslich mit dem Thema «Flüchtlinge / Migration» stärkste Oppositionspartei im deutschen Bundestag. Einen anderen Themenkreis jenseits der Flüchtlingsdebatte hatte die Partei, bei der man einige Mitglieder (u.a. Björn Höcke) gerichtlich sanktioniert sogar «Nazi» nennen darf, nicht anzubieten.
Wir dürfen uns zusammen mit der SVP auf die kommenden National- und Ständeratswahlen 2023 in der Schweiz freuen. Wie sagte Ueli Maurer 2019 ebenso treffend wie "fadegrad": «Die SVP gewinnt Wahlen mit den Themen Flüchtlinge und EU und nicht mit dem Klimawandel.»
Und wer ist derzeit zuständig für die unsägliche Schweizer Migrationspolitik? Genau: Die Modepuppe Karin Keller-Sutter von der FDP. Kein Wunder bemüht sie sich um ein anderes Departement noch vor den Wahlen 2023.
Klappt das nicht, dürfen sich FDP, SP und die Grünen schon mal warm anziehen. Und dies nicht nur wegen der Energiemangellage.
-
25.11.2022 - Tag der sündigen Priester
Mit zwei Dominas erwischt: Priester hatte Dreier auf dem Altar seiner Kirche
In den USA drehte ein ehemaliger Priester ein Sexvideo im Oktober 2020. Dabei wurde er auf frischer Tat ertappt und musste anschliessend vor Gericht beichten.
Travis C.* (39) leistete sich eine unheilige Aktion in der «St. Peter and Paul»-Kirche in Pearl River im US-Bundesstaat Louisiana, in der er Priester war. Der Ex-Geistliche musste vor einem Gericht Beichte ablegen und bekannte sich für schuldig, auf dem Altar seiner Kirche ein Sexvideo mit zwei Frauen gedreht zu haben.
Ein Gemeindemitglied hatte im Oktober 2020 nachts Licht in der Kirche gesehen und wollte nach dem Rechten schauen. Beim Blick durchs Fenster sah der geschockte Mann seinen Priester, der sein Gewand nach oben gezogen hatte. Er war gerade dabei, mit zwei Frauen in Reizwäsche und diversen Sexspielzeugen den Altar zu entweihen. Das Ganze wurde professionell mit zwei Kameras und Beleuchtung gefilmt.
Der Altar wurde verbrannt
Die alarmierte Polizei erwischte den 39-Jährigen, mit Melissa C.* (23) und Mindy D.* (41) auf frischer Tat. Der sündige Gottesmann hatte die Frauen, die als Domina arbeiten, für sein Sexvideo angeheuert. Die Ermittler fanden einen Social Media Eintrag von Mindy D., auf der sie am Vortag angekündigt hatte: «Ich fahre nach New Orleans, um ein Haus Gottes zu entweihen!»
Travis C. wurde von der New Orleans Erzdiözese seines Priesteramts enthoben. Und Erzbischof Gregory Aymond liess den Altar verbrennen. Die Staatsanwaltschaft klagte Travis C. wegen schwer anstössigen Verhaltens in der Öffentlichkeit an. Er bekannte sich für schuldig und kam mit einer dreijährigen Haftstrafe auf Bewährung davon. Schreibt Blick.
Halleluja!
Endlich mal positive Nachrichten von der christlichen Kirche. Es waren zwei professionelle Dominas und nicht die Ministranten, wie William Shakespeare sagen würde.
Wenn das kein positiver Fortschritt ist, was dann?
-
24.11.2022 - Tag der Schlagersängerinnen, die niemand kennt
Sarah-Janes Ehemann ist bereits ausgezogen: Liebes-Aus nach zehn Jahren
Schlagersängerin Sarah-Jane und Ehemann Dani Sparn haben sich vor einigen Wochen nach zehn Jahren Beziehung getrennt. Beruflich möchten die beiden aber weiterhin gemeinsame Sache machen.
Sie galten als Schweizer Musiker-Traumpaar. Doch jetzt ist die Liebe zwischen Schlagersängerin Sarah-Jane (37) und ihrem Mann, dem Bandleader Dani Sparn (36), erloschen. «Ja, es stimmt. Wir sind privat kein Paar mehr», sagt Sarah-Jane. «Aber die Musik wird weiterhin unsere gemeinsame Passion bleiben.» Dani Sparn bestätigt: «Wir haben uns Ende September nach viereinhalb Jahren Ehe getrennt, bleiben aber weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden.»
Bei ihrem gestrigen Auftritt am traditionellen Lachner Weihnachtszauber liess sich Sarah-Jane nichts vom Trennungsschmerz anmerken. Unter anderem sang sie die beliebte Puccini-Arie «Oh mio bappino caro». Ihr Noch-Ehemann hörte im Publikum zu.
Seit zehn Jahren ein Paar
Dani Sparn war zehn Jahre an der Seite der Sängerin. Das Paar musste auch schwierige Zeiten durchstehen: 2019 erlitt Sarah-Jane zwei Fehlgeburten, jeweils in der neunten Schwangerschaftswoche. «Wenn unsere Gedanken danach nur noch um den Familienwunsch gekreist hätten, wären wir daran kaputtgegangen», sagten sie damals. «Wir haben uns arrangiert – auch ohne Kinder. Wir mussten lernen, auch so glücklich zu sein!»
Andere Paare wären vielleicht früher schon gescheitert, wenn mehrere Inseminationen nicht zum Ziel führen. Dani Sparn sagte damals: «Ich bewundere Sarahs Kraft.»
Die Papillon-Hunde Wilma (3) und Bounty (1) gaben dem Paar schliesslich das Glück zurück. Doch es sollte nicht ewig halten.
Die Liebeskrise begann vor einem halben Jahr. Andere Partner sollen aber nicht im Spiel gewesen sein. «Wir haben uns einfach auseinandergelebt», betont Sarah-Jane.
Dani Sparn ist inzwischen aus dem 2015 in Rothenfluh BL erbauten Haus, wo auch die Hunde wohnen bleiben, ausgezogen. Vor einem halben Jahr meinte sie noch: «In diesem Haus möchte ich mit Dani alt werden. Er war eine Stütze in guten und schlechten Tagen. Und er nimmt mich, wie ich bin – mit all meinen Ecken und Kanten.»
Musikalische Zusammenarbeit bleibt
«Wir wollen auf musikalischer Ebene Freunde bleiben», betont der Bandleader. «Wir gehen auch wieder zusammen ins Studio.» Und Sarah-Jane meint: «Ich weiss, unsere Trennung kommt für viele überraschend. Aber das Leben geht manchmal andere Wege, als man sich das erwünscht hat.»
«Da rettet mich ein Engel», sang Sarah-Jane auf ihrem im Frühling erschienenen Album «Mit Herz und Soul». Darin schildert sie, wie sie in einer Alphütte ein Buch liest und ihr plötzlich ein Engel seine Hand beschützend auf ihre Schulter legt.
Diesmal kam der Schutzengel nicht vorbei. Schreibt Blick.
So entstehen Tragödien, wenn die Papillon-Hunde Wilma und Bounty nicht nur bekannter sind als Schlagersängerin Sarah-Jane, sondern auch noch musikalisch überzeugender wirken als ihr Frauchen.
Die Blick-Schmonzette erinnert in verblüffender Ähnlichkeit an die britische TV-Serie «The Sarah Jane Adventures», deren Hauptfigur Sara James (Smith) bei der abrupten Trennung von ihrem Begleiter «Der Doktor», mit dem sie durch Raum und Zeit reiste, einen blechernen Hund namens K-9 erhielt.
Scheint ja fast so, als hätten Sarah-Jane und Dani Sparn das Drehbuch für ihre rührselige Glücks-Post-Geschichte bei der britischen Fernsehserie abgekupfert.
-
23.11.2022 - Tag der unsäglichen Problemlösungen
Personalmangel in der Pflege: Einwanderung jetzt!
Der zunehmende Arbeitskräftemangel trifft die Pflege besonders hart. Vielfach können Betten nicht belegt werden, weil es zu wenig Personal gibt. Und wer privat Pflegekräfte sucht, hat es immer schwerer. Für die in die Jahre kommenden Boomer ist das keine gute Nachricht. Ein Altern in Würde könnte für manchen ein frommer Wunsch bleiben, wenn es so weitergeht.
Und das ist leider anzunehmen. Das Arbeitskräftereservoir in Österreich und Europa reicht nicht aus, um den Bedarf an Pflegepersonen zu decken, sagen Fachleute. Um die Lage zu verbessern, müssten daher auch in weit entfernten Drittstaaten Kräfte angeworben werden.
Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will das jetzt im Rahmen einer EU-weiten Initiative tun. Wenn alle in Europa an einem Strang zögen, gäbe es für die neuen Pflegenden überall die gleichen sozialen Standards, nationales Hinunterlizitieren wäre dann unmöglich, sagt er. Das stimmt, doch gegen die akute Personalnot hilft es nicht. Bis eine solche EU-Initiative tatsächlich wirkt, vergehen Jahren.
Was also tun? Auch wenn es politisch schwer durchsetzbar erscheint: Österreich muss sich weltweit selbst um interessierte Kräfte bemühen – und zwar über den Pflegebereich hinaus. Das wiederum setzt eine Änderung des strengen Einwanderungsregimes voraus. Nicht einmal 5000 Menschen haben 2021 eine Rot-weiß-rot-Karte ergattert. Das ist viel zu wenig. Schreibt DER STANDARD.
Dieser Artikel einer österreichischen Zeitung könnte 1:1 auch auf den Notstand im Schweizer Pflegebereich übertragen werden. Inklusive der mehr als nur einfältigen und nicht wirklich durchdachten Problemlösung von Irene Brucker.
Weder Österreich noch die Schweiz leiden unter einem Defizit an Einwanderung. Das pure Gegenteil ist der Fall! Seit 2015 werden beide Länder mit Ausnahme der zwei Corona-Jahren mit einwandernden Flüchtlingen geflutet. Seit mehr als sieben Jahren also.
Man hätte somit genügend Zeit gehabt, Pflegepersonal zu rekrutieren und den Pflegeberuf als solchen attraktiver zu gestalten. Dabei geht es in erster Linie gar nicht um das Salär, das zumindest in der Schweiz nicht annähernd so tief ist wie häufig kolportiert wird. Doch nichts ist passiert.
Statt in das gewaltige Potenzial von Flüchtlingen zu investieren und mit entsprechenden Programmen für die Pflegetätigkeit im Sinne von «fordern und fördern» zu motivieren, warten wir ab, bis uns die gebratenen Tauben in Form von bestens ausgebildeten Pflegefachkräften aus entfernten Kontinenten in den Mund fliegen.
Dass ausgerechnet die bestens mit der Politik vernetzte Gesundheitsindustrie bezüglich Pflegepersonal seit Jahren mit einem Totalversagen glänzt, sollte uns bezüglich Zustand dieser beiden «Industrien» mehr als nur nachdenklich stimmen.
Ohne Investment in die Manpower der zugewanderten Flüchtlinge wird eine vernünftige Migration nie gelingen. Sie achselzuckend in die Sozialhilfe abzuschieben ist keine Lösung.
-
22.11.2022 - Tag der eigenartigen Hobbys von Stadtpräsidenten
Eine Glaubensfrage: Sein Volk hält zu einem wegen Vergewaltigung verurteilten Bürgermeister
Der Ex-Bürgermeister eines oberösterreichischen Ortes ist wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung einer Mitarbeiterin zu nunmehr sieben Jahren rechtskräftig verurteilt worden. Der OGH lehnte seine Nichtigkeitsbeschwerde ab.
Zeitgleich fand in der Ortschaft eine Solidaritätskundgebung für den Politiker mit rund 150 Personen statt. Dem waren – bei bereits laufendem Verfahren – eine Wiederwahl des ÖVP-Politikers und eine Ehrung durch das Land Oberösterreich vorangegangen. Der Bürgermeister hatte bis zuletzt geleugnet und auch eine einvernehmliche sexuelle Beziehung bestritten (Hauptbeweis war ein Taschentuch mit seiner DNA und der des Opfers). Er hatte auch eine Verleumdungsklage gegen sie eingebracht. Der Ex-Bürgermeister verantwortete sich damit, er habe im Gemeindeamt masturbiert und das Taschentuch in den Müll geworfen.
Die zahlreichen Freunde des Ex-Bürgermeisters glauben an ein krasses Fehlurteil. Es könnte sich aber auch um einen krassen Fall von kompletter Uneinsichtigkeit seiner Anhänger handeln – unterlegt mit krasser Frauenfeindlichkeit. Sie glauben "ihren Jürgen" zu kennen: Der macht so was nicht. Sie glauben aber, dass das Opfer keines war. Denn immerhin singt er seiner Ehefrau auf Youtube ein Lied mit dem Titel Fels in der Brandung. Und – ganz generell natürlich – ein Lied über Frauen, die sich was einbilden. Titel: Die Narzisstenkönigin. Er trägt dabei Clownsmaske. Schreibt Hans Rauscher im STANDARD.
Erinnert irgendwie inklusive Absolution durch das Volk und Täter-/Opferumkehr an einen Vorgang in der Stadt Baden:
«Hol schon mal den Geri raus».
-
21.11.2022 - Wehe wenn sie losgelassen
Drei alkoholisierte Autofahrer verursachen am Wochende drei Selbstunfälle und Sachschaden in der Höhe von 75'000 Franken im Kanton Luzern – drei Personen verletzt
Am Wochenende ereigneten sich im Kanton Luzern drei Selbstunfälle mit Personenwagen. Die Unfallverursacher fuhren ihre Fahrzeuge in alkoholisiertem Zustand. Drei Personen wurden verletzt. Es wurden Blut- und Urinentnahmen verfügt.
Triengen, Ortsteil Winikon, Uffikonerstrasse
Am Samstag, 19. November 2022, ca. 20:00 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin auf der Uffikonerstrasse in Winikon in Richtung Uffikon. Im Gebiet Ziegelhütte kam sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Kurvensignal. Schliesslich kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Autofahrerin verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gefahren. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.93 mg/l. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt.
Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 15'000 Franken.
Pfaffnau, Kantonsstrasse
Am Sonntag, 20. November 2022, kurz nach 02:00 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse von Pfaffnau in Richtung Reiden. Im Gebiet Chäppeli geriet der 22-jährige Autofahrer infolge Angetrunkenheit rechts von der Strasse ab und prallte gegen einen Strassenkandelaber. Das Fahrzeug drehte sich und schlitterte auf dem Dach quer über die Fahrbahn, wo es zum Stillstand kam. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der Mitfahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt. Die Strasse war während der Sachverhaltsaufnahme rund drei Stunden gesperrt. Angehörige der Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil waren für die Verkehrsumleitung und die Reinigung der Strasse verantwortlich. Das Fahrzeug wurde geborgen und abtransportiert.
Der Sachschaden beträgt ca. 35'000 Franken.
Buchrain, Kirchbreitestrasse
Am Sonntag, 20. November 2022, ca. 05:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der Kirchbreitestrasse in Buchrain in Richtung Ronstrasse. Bei der Einfahrt zum Kreisverkehrsplatz auf der Höhe der Buchfeldtrasse fuhr der Autofahrer auf die Mittelinsel. Anschliessend fuhr er im Kreisel auf die Böschung und rollte danach auf der Gegenfahrbahn die Kirchbreitestrasse hinunter, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.35 mg/l. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt.
Aufgrund der Kollision wurde beim Auto die Ölwanne beschädigt und die Strasse mit Motorenöl verschmutzt. Die Strasse war während ca. zweieinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Buchrain örtlich umgeleitet. Zudem musste die Strasse durch eine Putzmaschine vom zentras gereinigt werden.
Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25‘000 Franken. Schreibt die Luzerner Polizei.
In Katar wär' das nicht passiert!
-
20.11. 2022 - Tag der Stimme des Volkes (Volchs) bei Twitter und SVP
Twitter entsperrt Account von Donald Trump
Twitter hat den seit Anfang 2021 gesperrten Account von Ex-US-Präsident Donald Trump wiederhergestellt. Das Profil des Republikaners war am Samstagabend (Ortszeit) wieder auf der Plattform verfügbar – mit dem bis dahin letzten Tweet vom 8. Jänner 2021 obenauf. Wenige Minuten zuvor hatte der neue Twitter-Besitzer Elon Musk die Freischaltung nach einer Umfrage unter Nutzern des Kurznachrichtendienstes angekündigt.
Trump hatte kurz vor Ablauf der Umfragefrist bekräftigt, er wolle bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social bleiben. Trumps Twitter-Account, der einst mehr als 80 Millionen Follower hatte, wurde bei der Abonnentenzahl auf null zurückgesetzt. Einige Minuten nach der Freischaltung folgten dem Profil "@realDonaldTrump" bereits mehr als eine Million Twitter-Nutzer. Bei Truth Social bringt es Trump auf etwas mehr als vier Millionen Abonnenten. Der Ex-Präsident hatte gerade erst bekanntgegeben, dass er ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024 geht – und kann daher eine größere Plattform mit mehr Reichweite gut gebrauchen.
Sturm auf das Kapitol
"Das Volk hat gesprochen", schrieb Musk zu seiner Entscheidung. Die Befragung war allerdings nicht repräsentativ: An der von Musk auf 24 Stunden angesetzten Umfrage nahmen rund 15 Millionen Nutzer teil, während der Dienst nach jüngsten verfügbaren Angaben auf mehr als 230 Millionen täglich aktive Nutzer kommt. Für Trumps Rückkehr sprach sich dabei eine knappe Mehrheit von 51,8 Prozent aus.
Trump ist seit Jänner 2021 von Twitter verbannt. Er hatte am 6. Jänner Sympathie für seine Anhänger bekundet, die das Kapitol – den Sitz des US-Parlaments in Washington – erstürmt hatten. Dort sollte der Wahlsieg von Joe Biden offiziell besiegelt werden. Wegen des Angriffs geschah dies erst Stunden später.
Trump hatte bei seinen Anhängern falsche Erwartungen genährt, dass Vizepräsident Mike Pence an jenem Tag die Bestätigung des Wahlergebnisses verweigern könnte. Noch während des Angriffs twitterte Trump, dass Pence nicht den Mut gehabt habe, das Richtige zu tun. Danach riefen Leute in der Menge: "Hängt Mike Pence!" Twitter wertete Trumps Verhalten als Aufruf zur Gewalt und sperrte seinen Account dauerhaft, da es nicht der erste Verstoß war.
Unter Musk keine lebenslange Sperren
Die anstößigen Tweets vom 6. Jänner fehlen in dem freigeschalteten Profil. Trumps widerlegte Behauptungen über die ihm angeblich von Biden gestohlene Präsidentenwahl sind weiterhin mit Warnhinweisen versehen.
Bis zur Übernahme durch Musk hatten Twitter-Manager stets gesagt, dass kein Weg zur Rückkehr des Ex-Präsidenten vorgesehen sei. Musk, der sich zuletzt zu politischen Positionen von Trumps Republikanern bekannte, hatte dagegen schon vor Monaten betont, dass es bei dem Dienst aus seiner Sicht keine lebenslangen Sperren geben sollte. Er erwähnte dabei ausdrücklich auch Trump als Beispiel.
Trump will nicht zurück
Vor drei Wochen kündigte Musk allerdings an, dass vor der Wiederherstellung bedeutender Accounts ein Rat zum Umgang mit kontroversen Inhalten gebildet werden solle. Dies scheint nun hinfällig.
Trump selbst hatte wiederholt gesagt, er wolle gar nicht zu Twitter zurückkehren. Ihm gefalle es bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social viel besser. Auch am Samstag empfahl er seinen Anhängern dort zwar, an der Umfrage teilzunehmen, schrieb aber dazu: "Wir gehen nirgendwo hin. Truth Social ist besonders!"
Facebook, wo Trump ebenfalls seit Jänner 2021 gesperrt ist, will im kommenden Jänner entscheiden, ob dem Ex-Präsidenten die Rückkehr angeboten werden könnte. Schreibt DER STANDARD.
Twitter braucht The Donald mehr als The Donald Twitter braucht. Das ist beim derzeitigen Zustand von Twitter so sicher wie die Allwissenheit Gottes, in dessen Sphäre sich Elon Musk mit seinem Tweet auf Twitter selbst gebeamt hat.
«The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei.»
Die Stimme des Volkes (Vox Populi) hat gesprochen. Die Stimme Gottes (Vox Dei) also, wie wir Lateiner unschwer aus dem nicht vollständigen lateinischen Zitat klar erkennen. Und wer ist diese «Vox Dei» bei Twitter?
Genau, Sie haben es erkannt. Elon Musk himself, der sein Imperium nach der Highlander-Maxime führt: «There can be only one.» (Es kann nur einen geben.)
Um in diesem Zusammenhang nicht nur Elon Musk zu entlarven sondern auch die SVP und ihren Chef-Propheten vom Herrliberg, folgt hier noch das vollständige Zitat von Alkuin, dem Gelehrten und wichtigsten Berater von Karl dem Grossen, das er seinem Kaiser in einem Brief in lateinischer Sprache schrieb: «Nec audiendi qui solent dicere: 'Vox populi, vox Dei', cum tumultuositas vulgi semper insanię proxima sit.»
Zu Deutsch: «Auf diejenigen muss man nicht hören, die zu sagen pflegen, 'Volkes Stimme, Gottes Stimme', da die Lärmsucht des Pöbels immer dem Wahnsinn sehr nahe kommt.»
Das sollten Sie bedenken, wenn Christoph Blocher die «Stimme des Volkes» (bei Blocher «Stimme des Volchs») zur Rechtfertigung seiner Thesen bemüht.
-
19.11.2022 - Tag der Heteros die aussehen wie Schwule
SRF-Salzgeber bleibt im Visum-Check hängen
SRF-Aushängeschild Rainer Maria Salzgeber (53) hätte eigentlich am Samstagabend zusammen mit SRF-Experte Beni Huggel und weiteren Arbeitskollegen in Doha landen sollen. Tat er aber nicht.
Bei Salzgeber gabs in Zürich Probleme mit der Hayya Card (eine Art Visum), welche zur Einreise nach Katar zwingend benötigt wird. Der TV-Mann versucht sein Glück nun am Sonntag noch einmal. Huggel & Co. hatten bei der Einreise keine Probleme. Schreibt Blick im Fussball-WM-Liveticker.
Liebe Kataris, Rainer Maria Salzgeber dürft ihr ruhig einreisen lassen. Rainer Maria Salzgeber ist nicht schwul. Er sieht dank seiner dämlichen Bekleidung nur so aus.
Dass er zusätzlich zum männlichen Namen auch noch den Frauennamen «Maria» trägt, ist seinem grenzenlosen Geltungsbewusstsein geschuldet und im Schweizer Kanton Wallis das Normalste der Welt.
Also lasst den Mann rein in Katar. Aber bitte nicht mehr raus. Die Schweiz wird Euch samt Eurem Mini-Emirat auf dem Bürgenstock ewig dankbar sein.
Und die Schweizer Handwerker, die Ihr beim Bau des Mini-Emirats um erkleckliche Geldsummen betrogen habt, werden in Zukunft nicht mehr vom «Würgenstock» reden.
-
18.11.2022 - Tag der medialen Selbstkasteiung
Chinas Haltung gegenüber Russland: Heuchlerisches Doppelspiel
Viele Experten behaupten, dass Peking seinen Kurs gegenüber Moskau korrigiert habe. Doch die Fakten sagen etwas anderes.
Als Olaf Scholz in Peking war, haben viele Beobachter lobende Worte an Chinas Staatschef Xi Jinping gerichtet: Der hatte erstmals seit Beginn des Ukrainekriegs den „Gebrauch und den Einsatz von Atomwaffen“ öffentlich abgelehnt. Es handelte sich immerhin um die bis dato deutlichste Kritik Chinas an Russland.
Doch dass die Volksrepublik ihren Kurs gegenüber Moskau korrigiert habe, wie viele Experten behaupteten, ist reines Wunschdenken und entbehrt jeder faktischen Grundlage.
Nach wie vor versucht sich die Volksrepublik an einem heuchlerischen Doppelspiel: Nach außen gibt man sich als neutrale Friedensnation, die sich für Verhandlungen und Gespräche einsetzt. Effektiv jedoch hat man sich auf die Seite Russlands geschlagen. Denn während sich Xi und Putin nur wenige Tage vor der russischen Invasion „grenzenlose Freundschaft“ versprachen, hat Chinas Staatschef mit Wolodimir Selenski seit Kriegsbeginn nicht einmal telefoniert.
In den offiziellen Staatsmedien wird fast ausschließlich die russische Propaganda übernommen. Als die Vereinten Nationen über eine Resolution abstimmten, um „eine Grundlage für künftige Reparationszahlungen von Russland an die Ukraine zu schaffen“, stimmte China – mit Syrien, Nordkorea und Iran – dagegen. Und erst am Dienstag begrüßte Chinas Außenminister Wang Yi seinen russischen Amtskollegen mit herzlichem Lächeln und versprach, „die pragmatische Zusammenarbeit mit Russland vertiefen“ zu wollen.
Natürlich ist Chinas Haltung gegenüber Russland nicht in Stein gemeißelt. Doch über kurzfristige Verstimmungen steht weiterhin Pekings strategisches Interesse, die Weltordnung nach den eigenen Vorstellungen umzugestalten. Und um die westliche Hegemonie zu durchbrechen, braucht es nach chinesischer Logik unbedingt Russland als Partner.
Dass der Einsatz von Atomwaffen eine rote Linie für das Zweckbündnis darstellt, ist natürlich gut. Doch eine solche Haltung sollte eine Selbstverständlichkeit sein – und verdient keinen internationalen Beifall. Schreibt TAZ.
Es waren nicht Experten, sondern selbsternannte «Experten» aus der «Journalistengilde», so man diese Spezies überhaupt noch als Journalisten*innen bezeichnen will, die den Humbug über Chinas angeblichen Gesinnungswandel inklusive TAZ verbreiteten.
Es ehrt TAZ, sich mit etwas Verspätung selbst zu kasteien. Dass es sich bei diesen Meldungen um reine «Placebos fürs dumme Volk» handelte, war bereits am 16.11.2022 thematisiert und angeprangert worden.
Nein, nicht von der TAZ und auch nicht von der NZZ und all den anderen «Superspreader-Bullshit»-Medien, sondern von der Kolumne auf der Website vom Artillerie-Verein Zofingen. Einfach zum 16.11.2022 scrollen.
Das Leben kann so einfach sein. Man muss nur die richtigen Kolumnen lesen.
Nice day!
-
17.11.2022 - Tag der Pyramiden- und Schneeballsysteme
Désirée H. (64) fiel auf gefälschte Blick-Seite von Bitcoin-Betrügern rein: «Ich könnte mich ohrfeigen!»
Désirée H. (64) aus Biel BE hat 650 Franken investiert – nachdem sie auf eine gefälschte Blick-Seite hereingefallen war. Lange dachte sie, auf ein seriöses Angebot gestossen zu sein. Dann gab es ein böses Erwachen.
Fiese Betrugsmasche im Internet! Seit Wochen kursieren in sozialen Medien Inserate, die mit der Aussicht auf einen schnellen Bitcoin-Gewinn oder lukrativen Aktien-Deals locken. Besonders gemein: Die Gauner fälschen für ihre Abzock-Masche das Design bekannter Medienportale wie Blick.ch, missbrauchen bekannte Namen wie den von Roger Federer. Alles, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen.
Blick-Leserin Désirée H.* (64) aus Biel BE stösst im Oktober im Internet auf einen falschen Blick-Artikel. Darin wird ihr versprochen: Sie könne in kurzer Zeit mit Bitcoin ein Vermögen machen. Das Beste dabei: Sie müsse nur etwas Geld einzahlen, den Rest übernehme ein Programm für sie. Ab da nimmt das Unheil seinen Lauf.
Dem Blick sagt die Rentnerin: «Ich bin sonst vorsichtig. Aber vergangenes Jahr starb mein Partner, ich bin nicht auf Rosen gebettet, und plötzlich hatte ich Existenzängste. Weil ich dachte, ich könne diesen Winter die Heizkosten nicht mehr bezahlen!» Sie erstellt ein Handelskonto bei der «Syos Börse», also beim vermeintlichen Unternehmen, und überweist 150 Franken.
Mit «Superbonus» gelockt
Und voilà: Kurz nachdem Désirée H. ihre Kleininvestition eingezahlt hat, zieht der Bitcoin-Kurs angeblich in hohem Tempo an. Sie erhält darum einen Anruf eines «Kundenberaters». Dieser rät ihr – in perfektem Hochdeutsch – aufgrund der guten Entwicklung an der Börse zu weiteren Investitionen. «Er sagte mir, es gebe einen Superbonus, und wollte, dass ich noch 500 Franken mehr einzahle», erzählt Désirée H. Also legt sie nach.
Eine bekannte Masche. Serdar Günal Rütsche (42), Chef der Abteilung Cybercrime der Kantonspolizei Zürich und Leiter des Schweizer Polizeinetzwerks gegen Cybercrime, sagt: «Die Betrüger generieren echt aussehende Webseiten und kontaktieren die potenziellen Opfer unter anderem telefonisch. Sie geben an, dass das entsprechende Angebot nur für kurze Zeit verfügbar ist, und melden sich immer wieder, um so Zeitdruck aufzubauen.»
Genau so passiert das Désirée H. Sie erhält ein Mail von Margaret Zucker, ihrer persönlichen «Anlageberaterin und Crypto-Traderin». Der Absender ist offensichtlich unseriös: Das Mail wurde von einem Google-Mail-Account gesendet, in der Signatur ersichtlich sind eine deutsche Telefonnummer und eine Adresse in Genf. Es ist diejenige des Genfer Finanzdepartements.
Gauner leiten Geld an sich selber weiter
Frau Zucker bittet die Seniorin schliesslich in ihrem Mail, ein Programm auf ihren Computer herunterzuladen, um ihr helfen zu können, «das System für den Handel einzurichten und die Kontonavigation zu erklären». H. tut wie geheissen, erteilt Zucker mittels Programm Zugriff auf ihren Computer. Ein folgenschwerer Fehler.
Denn: Es ist bloss ein weiterer Versuch der Kriminellen, ein Maximum aus ihrem Betrug herauszuholen. Kurz zuvor sollte nämlich Désirée H. bei Swissborg, einer seriösen Schweizer Plattform zum Handeln von Kryptowährungen, ein Konto erstellen und die 500 Franken einzahlen. Bloss: Als sie ihr Guthaben nachschauen will, merkt sie, dass kein Geld darauf ist. Die kriminelle Bande hat H.s Guthaben bereits an sich selber weitergeleitet!
Was H. beruhigt: Der Bitcoin-Kurs auf der Plattform der «Syos Börse» zeigt derweil weiter steil aufwärts. Aus den insgesamt angelegten 650 Franken sind in wenigen Tagen über 7300 Franken geworden. Ein Traum! Désirée H. will sich ihren Gewinn auszahlen lassen. Postwendend erhält sie ein Mail von ihrem «Kundenberater». Darin steht, sie müsse erst eine Provisionszahlung an Frau Zucker von über 1000 Franken leisten, erst dann erhalte sie ihr Geld. Ein weiterer Betrug! H. will anrufen, alles klären. Doch die aufgeführte Telefonnummer, von der aus «Anlageberaterin» Zucker Désirée H. regelmässig anruft, ist nicht in Betrieb. «Da begann für mich die Geschichte zu stinken», sagt H.
«Glaube nicht daran, mein Geld wiederzusehen»
Es zeigt: Die Banden arbeiteten strukturiert und effizient, funktionierten wie Unternehmen mit unterschiedlichen Hierarchiestufen. «Es gibt keine typische Zielgruppe. Grundsätzlich sind alle Personen, die sich im Internet bewegen, potenziell gefährdet. Die Betrüger operieren international», sagt Experte Rütsche. Recherchen zeigen: Die Täter stammen sehr oft aus Osteuropa und Asien.
«Ich könnte mich ohrfeigen! Aber man denkt ja nicht automatisch an das Böse im Menschen», sagt Désirée H. rückblickend. Sie hat alles wieder deinstalliert, kämpft per Mail um die Auszahlung. Nur einzahlen will sie nichts mehr. Anrufe erhält sie aber noch immer täglich. Désirée H. überlegt sich jetzt, zur Polizei zu gehen.
Hoffnung hat sie kaum mehr. Sie sagt: «Ich glaube nicht daran, dass ich mein Geld je wiedersehe. Aber ich will andere Blick-Leserinnen und Leser warnen, darum erzähle ich meine Geschichte.» Schreibt Blick.
Wenn es der guten Désirée H. ein Trost ist: Mit der letzte Woche bankrott gegangenen Krypto-Börse FTX haben Anlegerinnen und Anleger, darunter auch institutionelle Anleger (!), soeben Milliarden verloren. Richtiggehend in den Sand gesetzt. Gegen diese gewaltige Summe sind 600 Franken wirklich Peanuts.
All diese Krypto-Investoren*innen sind aber bei FTX nicht über ein Blick-Inserat in ihr Verderben gerasselt, sondern durch die eigene Gier.
Bei Pyramiden- und Schneeballsystemen profitieren in der Regel nur die Ersten, die da mitmachen. Wer nach ihnen kommt, schaut in die Röhre. Das ist bei Krypto-Börsen, die es im Sinne des Erfinders der Kryptowährung (Bitcoin) eigentlich gar nicht geben dürfte, nicht anders.
Physiker Stephen Hawking äusserte sich einmal etwas kryptisch: «Gier und Dummheit sind die grössten Bedrohungen.» Das trifft den Nagel auf den Kopf. Auch und vor allem bei den unbedarften Kryptokraten*innen. Wer nichts von Kryptowährungen versteht (ich gehöre dazu), sollte tunlichst die Hände davon lassen.
-
16.11.2022 - Tag der Placebos fürs dumme Volk
Mehrheit der G20-Mitglieder «verurteilt» Krieg in der Ukraine
Die G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer hat bei ihrem Gipfel auf Bali trotz großer Meinungsunterschiede zum Ukraine-Krieg eine gemeinsame Abschlusserklärung angenommen. Das bestätigten mehrere Teilnehmer auf der indonesischen Ferieninsel am Mittwoch der dpa. In der Erklärung verurteilte die große Mehrheit der Staats- und Regierungschefs der G20 den seit mehr als acht Monaten dauernden russischen Angriffskrieg aufs Schärfste.
Nur Lawrow beim Gipfel
Auch Russlands abweichende Haltung wurde zu Protokoll genommen. Moskau war beim Gipfel nur mit der zweiten Reihe vertreten. Präsident Wladimir Putin verzichtete von vornherein auf den Flug nach Bali, sondern ließ sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Lawrow verließ den Gipfel aber schon am Dienstag vorzeitig – viele Stunden bevor die Erklärung verabschiedet wurde. Vor dem Gipfel war unsicher gewesen, ob es ein gemeinsames Abschlusspapier geben würde. Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist die G20-Runde gespalten.
In ihrer Erklärung nehmen die Staaten nun Bezug auf eine Resolution der Vereinten Nationen, mit der Russland aufgefordert wird, die Kriegshandlungen einzustellen und seine Truppen aus der Ukraine sofort abzuziehen. "Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste", heißt es dann. Er verstärke die Probleme der Weltwirtschaft, schwäche das Wachstum und lasse die Inflation steigen. Russlands Position wird mit dem Satz festgehalten: "Es gab andere Auffassungen und unterschiedliche Bewertungen der Lage."
Krieg statt "Spezialoperation"
Auffällig ist, dass der russische Angriff klar als Krieg bezeichnet wird – und nicht wie von Putin vorgegeben als "militärische Spezialoperation". Deutliche Worte finden die Staats- und Regierungschefs auch zum Thema Atomwaffen. "Der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen ist unzulässig." Zuletzt hatte die völkerrechtswidrige Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten Sorgen geschürt, dass Putin Atomwaffen einsetzen könnte.
Keine großen Erfolge erzielte der Westen hingegen in Fragen der Energiesicherheit, die vor allem in Europa durch die drastisch gesunkenen Lieferungen von Öl und Gas aus Russland gefährdet ist.
Die G20 äußern sich zudem "tief besorgt" über die globale Ernährungskrise und setzen sich für die Fortsetzung des Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide ein. Ihre Bemühungen im Klimaschutz wollen sie verstärken – die G20-Staaten sind selbst für 80 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Der Gruppe gehören neben der EU Deutschland, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA an. Schreibt DER STANDARD.
Peinlicher geht immer. Ganz besonders an den Konferenzen und Treffen der Mächtigen dieser Welt. Die Statements und Abschlusserklärungen sind oft das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind.
Regiert in den USA zufälligerweise ein ehemaliger TV-Moderator und erratischer Selbstdarsteller, werden solche Papiere mit hehren Erklärungen und Vereinbarungen gar vor versammelten Publikum und laufenden TV-Kameras im Rosengarten vom White House in Fetzen zerrissen. The Donald at its best.
Das könnte man auch ohne Gesichtsverlust mit der Abschlusserklärung der diesjährigen G20-Konferenz zelebrieren. «Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste». Toll!
Peinlich allerdings, dass ausgerechnet die Staatenlenker von China und Indien der «Minderheit» angehören, die bezüglich Verurteilung des russischen Kriegs in der Ukraine etwas anderer Meinung sind. Sprich: Sie verurteilen zwar den Einsatz von Atomwaffen, was eine reine Selbstverständlichkeit ist, aber nicht den Krieg als solches.
Wenn aber die «Minderheit» dieser zwei Staaten bezüglich Bevölkerung und Wirtschaftskraft die überwältigende Mehrheit der G20-Gruppe repräsentiert, ist diese Abschlusserklärung zum G20-Gipfel auf der Insel Bali (Indonesien) an Lächerlichkeit kaum mehr zu überbieten.
-
15.11.2022 - Tag der vor Wärme schwitzenden SVP
Bundesratsrennen wieder spannend: SVP-Vogt bringt Berner ins Schwitzen
Bei der Nachfolge von Finanzminister Ueli Maurer zeichnet sich ein spannendes Rennen ab. Neben Favorit Albert Rösti liefern sich Hans-Ueli Vogt und Werner Salzmann ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Ticket-Platz.
Am Freitag gilts ernst. Dann pilgert die SVP-Bundeshausfraktion ins beschauliche Hérémence VS. In dem 1300-Seelen-Dorf unterhalb der Staumauer Grande Dixence will die Volkspartei entscheiden, wen sie dem Parlament tatsächlich als Nachfolger für den abtretenden Finanzminister Ueli Maurer (71) zur Wahl vorschlagen will.
Ein Zweierticket soll es sein, hat der Fraktionsvorstand am Montag beschlossen – und folgt damit der Findungskommission. Hört man sich in der Partei um, hat Ex-Parteichef Albert Rösti (55) wie erwartet die besten Karten, sich einen Ticketplatz zu sichern. «Um ihn kommen wir nicht herum», so der Tenor bei den Mannen und Frauen der SVP. Bei den Westschweizer Vertretern gilt er zudem als «romand-freundlich».
Vogt hat die Nase vorn
Mehr Spannung verspricht das Rennen um den zweiten Ticketplatz. Hier zeichnet sich eine knappe Ausmarchung zwischen dem Berner Ständerat Werner Salzmann (60) und dem Zürcher alt Nationalrat Hans-Ueli Vogt (52) ab.
Und hier hat Vogt derzeit die Nase vorn. Die Zürcher SVP sei daran, gerade die Ostschweizer Kollegen abzuklopfen, um Vogt genügend Stimmen zu sichern. Er wird von vielen als passende Ergänzung zu Rösti gesehen, mit der man die Facetten der Partei abdecke.
Hier Rösti: das Landei aus einem Nehmerkanton. Dort Vogt: der Urbane aus einem Geberkanton. Regional schön ausgewogen. Kommt hinzu, dass mit einer Nicht-Nomination Vogts die grösste und wichtigste SVP-Sektion just vor den kantonalen Wahlen vor den Kopf gestossen würde.
Salzmanns Nachteil: Zwei Berner ist einer zu viel
Allerdings: Vogt hat sich in seiner Partei mit seinem rumpligen Abgang aus dem Nationalrat nicht nur Freunde gemacht, als er meinte, er habe sich wie ein Tennisspieler auf dem Fussballplatz gefühlt. «Als Bundesrat müsste er mit uns Fussballspielern zurechtkommen», meint einer. Jetzt, wo es ums Filetstück gehe, tauche er plötzlich wieder auf, schnödet ein anderer.
Salzmann dürfe man denn auch nicht unterschätzen. Der gewiefte Militärpolitiker weiss, wie man ein Manöver gewinnt. Gerade bei seinen Ständeratskollegen und den Sicherheitspolitikern in der Partei hat er ein gutes Standing. Gegen ihn spricht vor allem, dass er Berner ist – zwei Berner auf dem Ticket ist vielen dann doch einer zu viel. Was manche abschreckt: Salzmann würde allzu gern das VBS übernehmen. «Dann klebt das VBS ewig an uns», moniert einer. Die Parteistrategen nehmen lieber ein Schlüsseldepartement wie das Energiedepartement ins Visier.
Sogar Dreierticket wird noch diskutiert
Im Fraktionsvorstand war die Beschränkung auf ein Zweierticket unbestritten. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass an der Fraktionssitzung ein Antrag für ein Dreierticket kommt – «damit die Kirche im Dorf bleibt», wie ein SVPler sagt. Allerdings dürfte ein solcher Antrag durchfallen.
Kaum bis keine Chancen werden der Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger (55) sowie dem Zuger Regierungsrat Heinz Tännler (62) eingeräumt. Blöchliger habe mit ihrer verschwiegenen britischen Staatsbürgerschaft ihren Ruf ramponiert, und Tännler fehle in Bern das Netzwerk. Allerdings versuchten manche, den Zuger auf das Ticket zu hieven, um so Rösti noch bessere Chancen im Parlament zuzuschanzen. Die befürchten, dass Vogt am 7. Dezember bei den Linken punkten und Rösti doch noch ausbooten könnte.
Das scheint aber eine Minderheit zu sein. Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass Rösti vom Parlament zum Nachfolger von Ueli Maurer gewählt wird. Und so meint einer lapidar: «Wen wir neben Rösti aufs Ticket setzen, ist eh egal.» Schreibt Blick.
Dass die SVP ins Schwitzen kommt ist ja irgendwie logisch, wenn ein offen bekennender Homosexueller wie Hans-Ueli Vogt aufs Ticket für die Bundesratswahl will. Da wird es halt schon etwas wärmer.
Was aber laut Ueli Maurer für das Bundeshaus bei der herrschenden Energiemangellage in kalten Wintern sogar ein grosser Vorteil wäre. «Hauptsache: Kein Es!».
-
14.11.2022 - Tag des ruhigen Gewissens
Nachhilfe für Möbelhaus: Pfister muss bei Bettwäsche-Deklaration nachbessern
Der Möbelhändler nimmt es mit einem Nachhaltigkeits-Label zu wenig genau.
Vollmundig garantiert das Möbelhaus Pfister auf seiner Internetseite: «Unsere Bett-Textilien sind fast ausnahmslos nach dem Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert.» Dieses Label garantiert, dass die Textilien frei von Schadstoffen sind.
Der entsprechende Oeko-Tex-Hinweis findet sich auch beim Beschrieb einzelner Bettwäsche-Produkte. «Darum dachte ich auch, es sei ein super Produkt – und der hohe Preis gerechtfertigt», erzählt eine Pfister-Kundin dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Sie hatte einen solchen Bettanzug bestellt. Allerdings: Als sie die Bettwäsche zu Hause auspackte, suchte sie das Oeko-Tex-Zertifikat vergebens. Sie vermutet daher einen Etikettenschwindel.
Knapp daneben ist auch vorbei
Um einen Etikettenschwindel handelt es sich hier jedoch nicht. Pfister versichert in einer schriftlichen Stellungnahme, das Produkt werde nach den Vorgaben des Oeko-Tex Standards 100 produziert: «Pfister hat nicht etwas deklariert, das nicht der Wahrheit entspricht.»
Und dennoch ist Pfisters Umgang mit dem Oeko-Tex-Label falsch – und vor allem nicht im Sinne der Kundinnen und Kunden. Denn Oeko-Tex-zertifizierte Produkte müssen rückverfolgbar und überprüfbar sein. Und das sei hier nicht gegeben, heisst es beim zuständigen Prüfinstitut Testex. Sprecher Marc Sidler sagt: «Wenn mit einer Oeko-Tex-Zertifizierung geworben wird, muss die Zertifizierungsnummer sowohl im Onlineshop als auch am Produkt oder auf der Verpackung ersichtlich sein.» Nur so sei die Rückverfolgbarkeit für die Kundschaft gewährleistet.
Pfister verspricht, nachzubessern
Dass dem renommierten Möbelhändler Pfister das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit solchen Zertifikaten fehlt, zeigt der Verlauf der Anfrage von SRF: In einer ersten Stellungnahme geht das Unternehmen auf entscheidende Fragen nicht ein, sondern verweist darauf, dass Verpackungslayouts nicht «mit spezifischer Beschriftung» angepasst werden könnten, weil dies «nicht verhältnismässig» sei.
Erst auf Nachhaken gibt Pfister die Versäumnisse bei der Deklaration zu. Man habe das Produkt nicht genügend gut ausbelobt. «Das ist natürlich ärgerlich und sollte nicht passieren.» Man werde nun alle Lieferanten darauf hinweisen, «das Oeko-Tex-Label auf der Verpackung oder direkt auf dem Produkt anzubringen». Unterstützung erhalten dürfte das Unternehmen vom Prüfinstitut Testex: «Wir gehen in dieser Sache auf Pfister zu», so Sprecher Marc Sidler, der durchaus ein gewisses Verständnis für das Möbelhaus aufbringt. Man kenne das Problem auch von anderen Detailhändlern: «Diese arbeiten mit sehr vielen Zertifikaten mit unterschiedlichsten Anforderungen. Da ist es sicher nicht immer einfach, den Überblick zu behalten.» Schreibt SRF.
Dieser Artikel liesse sich auf unzählige Firmen – auch und vor allem auf Globalplayer – ausdehnen. SRF müsste nur den Firmennamen in Headline und Text auswechseln. Oder glaubt wirklich jemand an die unerschütterliche Lauterkeit all der Labels und Zertifikate?
Da ist nur selten drin was auf den Labels der Verpackung steht. Das ist bei Bio-Produkten ebenso der Fall wie bei Automobilen.
Labels und Zertifikate sind nichts anderes als Marketinginstrumente, die wir an der Ladenkasse auch noch bezahlen.
Oder anders ausgedrückt: Das Zertifikat auf dem Möbel Pfister-Kissen verschafft uns Kunden ein ruhiges Gewissen.
-
13.11.2022 - Tag der chinesischen Abhängigkeit
USA schränken Export ein: Keine Computerchips mehr für China
Die USA wollen keine Computerchips mehr nach China liefern, die für künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Was bedeutet es, wenn eine Technologie für Wissenschaft und Wirtschaft plötzlich sicherheitsrelevant wird?
Für die USA ist es militärisch wichtig, bei der Herstellung von Mikrochips und dem Einsatz von KI einen Vorsprung vor China zu halten. Aus diesem Grund haben die USA Anfang Oktober den Export von Chips nach China stark eingeschränkt.
Betroffen sind leistungsstarke Chips, die für künstliche Intelligenz (KI) verwendet werden, ebenso wie alles, was zur Herstellung dieser Chips benötigt wird: Halbleiter, Maschinen, Software. Zudem dürfen US-Spezialisten chinesische Unternehmen nicht mehr bei der Chipherstellung unterstützen.
Für die nationale Sicherheit
Die USA möchten mit dieser Massnahme verhindern, dass China fortgeschrittene KI und Supercomputer im Militär einsetzen kann.
Zudem halten die US-Behörden fest, dass China KI auch zur Überwachung der Bevölkerung einsetze und damit teilweise Menschenrechte verletze.
Obwohl kein explizites Ziel der Massnahme der US-Behörde, könnte der Bann auch Chinas Wirtschaft beeinflussen. KI kommt in vielen zukunftsträchtigen Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Websuche, bei Bild- und Videoerkennung, beim Übersetzen, bei Produktempfehlungen und in autonomen Autos.
Wo steht China?
China hat die Kapazitäten und Ressourcen, um selbst Chips herzustellen. Allerdings liegt das Land bei der Produktion der fortschrittlichsten Chips noch um etwa drei bis vier Jahre hinter den Fabriken in Taiwan und Südkorea zurück. Zudem fehlt es China an Forschung und Know-how für das Entwickeln neuer Chips – hier sind die USA führend.
China fördert seine Chipindustrie seit Jahren, und die neusten Restriktionen dürften den Bemühungen, ein unabhängiges Chip-Ökosystem zu entwickeln, zusätzlichen Schub verleihen.
Wegen der Komplexität der Chipindustrie dauert es jedoch Jahrzehnte, die nötigen technologischen Kapazitäten zu entwickeln und Hightech-Equipment und -Fabriken zu bauen. Das Embargo der USA dürfte diesen Prozess noch zusätzlich verlangsamen.
Zunehmende Nationalisierung
Chips sind von zentraler Bedeutung für die Wirtschaft, sie stecken in jeder Waschmaschine und jedem Auto, und mit der Digitalisierung nimmt ihre Bedeutung weiter zu.
Die Sicherung der Chip-Lieferkette steht daher nicht nur in China auf der politischen Agenda. Auch in den USA und der EU gibt es Bestrebungen, einen grösseren Teil der Produktion auf eigenen Boden zu holen.
Was heisst das für die Schweiz?
Kurzfristig dürften die neuen Exportbeschränkungen keinen grossen Effekt für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten haben. Möglicherweise werden Produkte etwas teurer, und die Wartezeit könnte sich für einzelne Produkte weiter verlängern. Längerfristig gibt es zwei Risikofaktoren, die für den Alltag relevant werden könnten:
• Die Reaktion von China: China verurteilt zwar die Restriktionen der USA, hat bisher aber noch keine Gegenmassnahmen ergriffen. Denkbar wären Exportbeschränkungen auf weniger komplexe Chips, die in den meisten Produkten verbaut sind, oder auf Rohstoffe, die zum Beispiel für Elektroautos oder Solarpanels gebraucht werden.
• Handelsbeziehungen: Während die USA und die EU ihre Lieferketten zunehmend nationalisieren und untereinander koordinieren, bleibt die Schweiz aussen vor. Im Falle einer Krise könnte sie einen schweren Stand haben, wenn es darum geht, an Chips zu gelangen. Schreibt SRF.
Die USA zeigen endlich wieder Leadership, um die verhängnisvolle Abhängigkeit von China zu reduzieren. Sie handeln. Auch wenn das die US-Oligarchen schmerzt.
Der Westen hingegen verkündet seit der Corona-Pandemie im Tagesrhythmus hehre Botschaften im künftigen Umgang mit China. Doch den Worten folgen keine Taten.
Im Gegenteil. Siehe Deutschland, dessen Wirtschafts-Oligarchen nach wie vor systemrelevante Industrietechnologien zum Nulltarif an Deutschlands wichtigsten Handelspartner China verscherbeln.
Das süsse Gift der unendlichen Bereicherung einiger Konzerne und deren Familien begleitet Deutschland, das wohl wichtigste EU-Land, einmal mehr auf dem Weg zum «failed State». Deutschland weist nicht umsonst den prozentual höchsten Niedriglohnsektor in der EU auf.
Schröder, Merkel und Scholz sind nicht vom Himmel gefallen. Die wohlhabendsten zehn Prozent der deutschen Haushalte* sorgen dafür, dass eine «systemrelevante» Marionette im Kanzleramt sitzt.
* Insgesamt besitzen die wohlhabendsten zehn Prozent der deutschen Haushalte zusammen etwa 60 Prozent des Gesamtvermögens, netto, also abzüglich Schulden. Die unteren 20 Prozent besitzen gar kein Vermögen. Etwa neun Prozent aller Haushalte haben negative Vermögen, sie sind verschuldet. Boeckler / Deutsche Bundesbank
-
12.11.2022 - Tag der nicht eingelösten Wahlkampfversprechen
Wie toxisch ist Donald Trump für seine eigene republikanische Partei?
MAGA – Make America Great Again! Diese Formel hat bei den Zwischenwahlen am Dienstag nicht so gut gezogen wie 2016 und 2020. Aber es wäre verfrüht, Trump abzuschreiben.
Als Ron DeSantis zum ersten Mal Kurs auf das Gouverneursamt in Florida nahm, gab er den vorbildlichen Juniorchef der Firma "Trump Incorporated": Für einen Werbefilm zeigte er seiner Tochter, wie man aus bunten Bausteinen eine Mauer errichtet – wobei unschwer zu erraten war, dass es sich um die Mauer an der Grenze zu Mexiko handeln sollte. Seinem Sohn, damals noch im Babyalter, las er aus The Art of the Deal vor, aus Donald Trumps Businessfibel.
Jetzt, vier Jahre später, am vergangenen Dienstag, wurde der Republikaner mit so klarem Vorsprung wiedergewählt, dass seine Fans von einem Resultat für die Geschichtsbücher sprechen: 19 Prozentpunkte Abstand, das gab es lange nicht in Florida. Und weil DeSantis, einst ohne Abstriche Trump-Loyalist, aus dem Schatten des Altpräsidenten herausgetreten ist, wird er seit den Midterms als der große Trump-Widersacher gehandelt.
Sein Stern strahlt umso heller, da Kandidaten, die Trump an der Parteibasis gegen Bewerber der traditionelleren konservativen Schule durchboxte, in aller Regel schlechter aussahen. Ron DeSantis – der Arzt am Bett der Grand Old Party? Bedeutet sein Aufstieg, dass das rechtspopulistische Fieber allmählich nachlässt? Nicht unbedingt. DeSantis, Harvard-Student, als Jurist auf dem Flottenstützpunkt Guantánamo und im Irak im Einsatz, kam mit der Tea-Party-Welle in die Politik. Auch er weiß sich einer populistischen Sprache zu bedienen.
DeSantis gegen Trump?
Nicht nur, dass er Schülern einer Highschool, die Schutzmasken trugen, zurief, sie sollten endlich aufhören, "dieses Covid-Theater" zu spielen. Anthony Fauci, den renommiertesten Virologen des Landes, porträtierte er als eine Art arroganten Tyrannen der Corona-Pandemie.
Doch während Trump das Märchen von der manipulierten Wahl, seinem angeblich gestohlenen Wahlsieg 2020, ständig wiederholt, geht DeSantis auf das Thema nicht ein. Das reicht schon, um einen markanten Unterschied zu machen. Einen Unterschied, der den 44-Jährigen nun plötzlich als neuen Hoffnungsträger dastehen lässt.
Denn gerade in den sogenannten Swing-States, wo es oft auf der Kippe steht zwischen den beiden großen Parteien der USA, zogen Kandidaten und Kandidatinnen den Kürzeren, die es nicht lassen konnten, das Votum von 2020 als "große Lüge" anzufechten. Offenkundig ist eine Mehrheit der Wählerschaft, zumindest dort, des endlosen Nachkartens überdrüssig. In Pennsylvania hatte Doug Mastriano, ein extremer Verschwörungserzähler, im Rennen um den Gouverneursposten nicht den Hauch einer Chance. Mehmet Oz, ein Fernseharzt, für den Trump eifrig die Trommel rührte, verlor gegen John Fetterman, den Bewerber der Demokraten.
Jedenfalls hat der scharfe Kontrast – hier DeSantis’ Erdrutschsieg in Florida, dort die Ernüchterung in Swing-States wie Pennsylvania, Georgia und Arizona – die Debatte befeuert: den Disput darüber, welche Richtung die Republikaner nehmen sollen.
Zunächst ist es vor allem eine Personaldebatte. Es geht weniger um Konzepte, mehr um die Frage, welche Rolle Donald Trump künftig noch spielen soll. Die kritischen Stimmen sind lauter zu hören, als es vor den Midterms der Fall war.
Da wäre Patrick Toomey, ein Senator aus Pennsylvania, dessen Sitz nun an Fetterman geht. Die zentrale Erkenntnis der Wahl, sagt Toomey, sei die "toxische Wirkung" Trumps im Falle von Duellen, die seine Partei ansonsten gewonnen hätte. "Je mehr ultra-MAGA jemand war, desto mehr blieb er hinter den Erwartungen zurück." MAGA: "Make America Great Again" – Trumps Slogan.
Neue Zielgruppe
Ein echter Richtungsstreit, ein Ringen um Inhaltliches, ist das noch nicht. Eine Rückkehr zu traditionell konservativen Positionen scheint keineswegs garantiert. Nicht zu vergessen, das Phänomen Trump hat tiefe Wurzeln. Wer nach ihnen sucht, muss wohl zurückgehen ins Jahr 2008: Sarah Palin, Gouverneurin Alaskas, wird Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. In North Carolina redet sie ganz offen – und, wie sie glaubt, jenseits der Medienöffentlichkeit – zu Spendern: Das Beste an Amerika stecke in den Kleinstädten, von denen sie so viele besuche; "in diesen wunderbaren Ecken dessen, was ich das wahre Amerika nenne; mit all den hart arbeitenden, sehr patriotischen Menschen in sehr proamerikanischen Gegenden dieser großartigen Nation. In denen jene leben, die unsere Fabriken am Laufen halten, unsere Lebensmittel produzieren, unsere Kriege für uns kämpfen."
In den Augen George Packers, des preisgekrönten Schriftstellers, bedeutet der damals so plötzliche Aufstieg Sarah Palins einen Meilenstein, symbolisiert er doch die populistische Hinwendung der Republikaner zur weißen Arbeiterschaft. "Real America" – das wahre Amerika, so charakterisiert Packer mit Palins Etikett die Denkschule, die für den Schwenk steht. Vorausgegangen war die Dominanz dessen, was er "Free America" nennt. Die Betonung individueller Freiheit, individuellen Erfolgs. Freier Handel, niedrige Steuern, den Staat am besten kleinsparen. Dazu Optimismus, verkörpert durch Ronald Reagan, den Präsidenten der Achtzigerjahre.
Feines Gespür für Trends
Was später folgte, war ein Elitenversagen, das zur Vertrauenskrise führte. Zuerst mit dem Fiasko des Krieges im Irak, dessen physische und psychische Kosten die von Palin beschriebenen, in der Berufsarmee überproportional vertretenen Kleinstadtbewohner zu tragen hatten; dann mit der Finanzkrise, die Millionen von Mittelschichtamerikaner um Haus und Job brachten, während Banken mit Steuermilliarden gerettet wurden.
"Die Schlussfolgerung lag auf der Hand: Das System ist zugunsten von Insidern manipuliert", schreibt Packer in der Zeitschrift TheAtlantic. Zwar behielt "Free America" 2012 noch einmal die Oberhand, indem die Republikaner Mitt Romney, einen Konservativen der Reagan-Schule, ins Rennen ums Weiße Haus schickten. Doch als Donald Trump antrat, konnte ihm die Traditionsfraktion nicht mehr viel entgegensetzen, so sehr man ihn anfangs auch belächelte.
Der Baulöwe hatte ein feines Gespür dafür, wie "Real America" tickte, was er – im Kontrast zu Reagan – mit einer geradezu düsteren Lagebeschreibung verband. Er wurde zum Rächer eines ganzen Milieus. 2016 stimmten 64 Prozent der Wählerinnen und Wähler ohne Hochschulabschluss für ihn, während ihm Collegeabsolventen nur zu 38 Prozent den Zuschlag gaben. Ähnlich war es 2020.
Trump abzuschreiben wäre verfrüht, wenn nicht gar töricht. Gut möglich, dass ein Ron DeSantis, sollte er es denn zur Nummer eins bringen, den Real-America-Fokus übernimmt – vielleicht mit stilistischen Korrekturen, vielleicht optimistischer, vielleicht etwas angenehmer im Ton. Schreibt DER STANDARD.
Wenn 2016 und 2020 64 Prozent der bildungsfernen US-Unterschicht ihr Votum für Trump abgaben, sagt das zwar viel über Trumps Anhängerschaft aus. Aber im Umkehrschluss auch ebenso viel über die Versäumnisse der demokratischen Eliten.
Wenn die Demokraten bei den Midterm-Wahlen nun besser abgeschnitten haben als erwartet, ist das nicht der Verdienst der demokratischen Partei. Vielmehr haben die 64 Prozent Verlierer der abartigen Globalisierung Amerikas mit dem Outsourcing von Millionen Jobs in Billigländer inzwischen doch noch festgestellt, dass die Versprechungen von Donald Trump, mit denen er 2020 die Wahl gewonnen hat, nichts anderes als Luft und Biswind waren.
Trumps wie eine tibetanische Gebetstrommel bei jeder Wahlveranstaltung vor sich hingetragene grossmundige Ansage «I'll bring the jobs from China back to America» entpuppte sich während seiner Amtszeit zu einem Treppenwitz. Zwar wurden ein paar Tausend Jobs aus China weggezügelt. Aber nicht nach Amerika, sondern in andere asiatische Tiefstlohn-Staaten wie Vietnam, Taiwan und Südkorea.
Um dies festzustellen, braucht es kein Universitätsstudium. Anhaltende Arbeitslosigkeit oder – wie in den USA häufig üblich – drei bis vier Billiglohnjobs pro Person entlarven vor allem bei der Unterschicht billige Wahlkampfversprechungen mit etwas Verzögerung als das was sie sind und lassen Hoffnungen platzen wie Seifenblasen.
Joe Biden kämpft nicht umsonst mit Milliarden von US-Dollar als Unterstützung für Konzerne, um neue Industrien (Chip-Prodktion und Klimaschutz-Technologien etc.) in den USA anzusiedeln. Gelingt es ihm, macht er Amerika auch ohne MAGA-Phrasen great again.
Eine Phrase, die übrigens nicht von Donald Trump ins Leben gerufen wurde, sondern bereits Ronald Reagan 1980 zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl verhalft.

-
11.11.2022 - Tag der Social Media-Krise
Zwei Wochen nach 44-Milliarden-Deal: Geht Twitter unter Musk bald pleite?
Der neue Twitter-Besitzer, Elon Musk, wendet sich an seine übriggebliebenen Mitarbeiter. Er schwört sie darauf ein, dass eine Twitter-Pleite nicht ausgeschlossen sei.
Schwere Zeiten für Twitter-Mitarbeiter. Der Eigentümer von Twitter, Elon Musk (51), hat den Mitarbeitern am Donnerstag mitgeteilt, dass er sich nicht sicher ist, wie hoch die Rentabilität des Unternehmens sei. Ein Konkurs sei deswegen nicht ausgeschlossen.
Das berichtet die Nachrichtenseite «The Information» am Donnerstag. Musk nehme an einem Meeting mit Twitter-Mitarbeitern teil, so eine Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens oder dessen Chefs bleibt bislang aus.
Musk schmiss Hälfte der Belegschaft raus
Musk hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen. Unmittelbar darauf kündigte er den bisherigen Chef Parag Agrawal (38) und andere hochrangige Manager. Dann feuerte er rund die Hälfte der zuvor etwa 7000 Personen umfassende Belegschaft.
Twitter schrieb bereits vor der Übernahme zuletzt rote Zahlen. Nach dem Deal beklagte Musk einen Umsatzeinbruch, weil einige grosse Werbekunden Anzeigen auf der Plattform ausgesetzt hatten. Sie sorgen sich, dass ihre Werbung neben anstössigen Tweets auftauchen könnte, wenn Musk wie angekündigt die Inhalte-Regeln lockern sollte.
Auf die Übernahme von Twitter durch Musk folgen offenbar weitere Kündigungen. Medienberichten zufolge verliessen am Donnerstag zwei Manager in Schlüsselpositionen das Unternehmen. Es handelt sich um den für das Herausfiltern anstössiger Inhalte verantwortliche Yoel Roth und Robin Wheeler. Beide waren erst seit kurzem für Beziehungen zu Werbekunden zuständig.
Musk nahm 13-Milliarden-Kredit auf
Auf Twitter lastet zudem der Kredit von rund 13 Milliarden Dollar, den Musk für den Kauf aufnahm. Medienberichten zufolge kostet die Bedienung dieser Schulden rund eine Milliarde Dollar im Jahr. Der Tech-Milliardär will die Werbe-Erlöse, die bisher 90 Prozent der Einnahmen ausmachen, durch ein Abo-Geschäft ergänzen. Der Start seines neuen Abos mit Verifizierungshäkchen sorgte zunächst aber einmal für Chaos, weil einige Nutzer Prominente und Unternehmen mit täuschend echt aussehenden Fake-Accounts imitierten.
Kein Homeoffice, kein Gratis-Essen
Zuvor hatte Musk die Beschäftigten bereits in einer E-Mail vor schwierigen Zeiten gewarnt. Die wirtschaftliche Lage sei «schlimm», besonders für ein Unternehmen, das von Werbeeinnahmen abhänge.
In dem Memo kündigte Musk auch neue Richtlinien in Sachen Homeoffice an – künftig ist Heimarbeit demnach nur noch mit seiner ausdrücklichen persönlichen Erlaubnis zulässig. Auch das Gratis-Essen wird den Mitarbeitern gestrichen. Schreibt Blick.
Internet-Plattformen kommen und gehen. Das war schon immer so. Ältere Semester kennen das aus Erfahrung.
Davon geht die Welt nicht unter. Darüber wusste schon Zarah Leander ein Lied zu singen. Auch der Klassenprimus der Social Media-Plattformen Facebook entlässt derzeit 11'000 Mitarbeiter*innen.
Die Welt würde weder besser noch schlechter, falls Twitter und möglicherweise Facebook verschwinden sollten. Sie würde vielleicht etwas ruhiger.
Würde, denn es ist anzunehmen, dass allfällige Nachfolger-Portale bereits in den Startlöchern stehen. Der Kuchen ist zu gross, um ihn nicht mehr weiter zu backen. Nur die Ingredienzien würden vermutlich etwas anders gemischt.
Dass Twitter allerdings «Pleite» geht wie «Blick» mit gierigem Blick aufs Clickbaiting in der Headline schreibt, ist eher unwahrscheinlich. Die Saudis und Kataris, selber auf positive Nachrichten rund um ihre vorsintflutlich regierten Gottesstaaten angewiesen, werden Elon Musk wohl kaum fallen lassen.
-
10.11.2022 - Tag der Schweizer Nummernschilder-Dekadenz
226'000 Franken für Nummernschild «ZH 100»
In Zürich sind bei einer Auktion 226'000 Franken für ein Nummernschild erreicht worden. Der bisherige nationale Rekord von 233'000 Franken für das Nummernschild «ZG 10» ist somit nicht geschlagen. Der Zuschlag für die Nummer «ZH 100» geht an den Bieter mit dem Namen «mistermh».
Er bot am Mittwoch kurz vor Auktionsschluss die 226'000 Franken und wurde nicht mehr überholt, wie ein Blick auf die Auktionsplattform des Zürcher Strassenverkehrsamtes zeigt.
Vor wenigen Tagen lag das Höchstgebot für «ZH 100» sogar bei 350'800 Franken. Mehrere Bieter entpuppten sich jedoch als unseriös, weil sie gar nicht das nötige Kleingeld hatten. Das Strassenverkehrsamt musste die Auktion vergangenen Freitag stoppen und diese Gebote entfernen. Erst danach führte das Amt die Versteigerung weiter, allerdings lagen die Gebote dann deutlich tiefer.
Der bisherige Rekord für ein Zürcher Nummernschild wird damit dennoch gebrochen: Das bisher teuerste Schild war «ZH 888», das Mitte Juni für 194'000 Franken versteigert wurde. Der landesweite Rekord liegt jedoch bei 233'000 Franken für die Zuger Nummer «ZG 10». Dieser Rekord bleibt somit auch nach der Versteigerung der «ZH 100» bestehen.
Fun-Fact: In den 1950er Jahren war Automechaniker Fritz Schneebeli aus Kilchberg Besitzer von «ZH 100». Die tiefen Nummern waren damals für Garagen vorbehalten. Bezahlen musste er also nichts. Er hatte wohl einfach Glück am Schalter des Strassenverkehrsamts.
Wie Hitler und Kaiser Wilhelm an «Berlin 1» scheiterten
Das gefiel Kaiser Wilhelm gar nicht: Er wollte mit dem Nummernschild IA-1 der Erste sein. Mit IA waren die Fahrzeuge in Berlin gekennzeichnet. Eins stand für Preussen, A für Berlin. Die 1 hatte der Kaufhausbesitzer Rudolph Hertzog an seinem Wagen. Er war wohl der erste Nummernschilder-Fan Europas. So sehr, dass er das Schild nicht einmal dem Kaiser abtreten wollte, obwohl dieser höflich darum gebeten hatte.
Viele Jahre später flatterte eine neue Anfrage ins Haus Hertzog – diesmal aus Hitlers Umfeld. Auch der nationalsozialistische Diktator wollte die 1 am Wagen – und wieder sagten die Hertzogs Nein. Obwohl sie sich Hitler widersetzten, sind keine Konsequenzen bekannt.
Heute kann in Deutschland jeder sein «Wunschkennzeichen» haben – sofern es frei ist. Rund 50 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer personalisieren ihr Schild. Der Aufschlag kostet nur 10.20 Euro. So fahren Exil-Zürcherinnen mit einem B-ZH-Schild durch Berlin, Exil-Berner mit einer M-BE-Nummer durch München. Leider ist «B-ZH 100» nicht mehr frei – das wäre eine optimale Ergänzung für das nun verkaufte, viel, viel teurere «ZH 100»-Schild.Schreibt SRF.
Geht's uns im Land der unbegrenzten Nummernschilder-Dekadenz schlecht? Nur weil die Schweizer Unterschicht demnächst Probleme bekommen wird, die Gasrechnung zu bezahlen?
Stellt Euch vor, einer dieser durchgeknallten Schweizer Nummernschilder-Oligarchen müsste 226'000 Franken Steuern bezahlen. Zum Beispiel als «Reichensteuer», was ja von einigen SP-Politikern*innen und einigen Grüninnen und Grünen diskutiert wird.
FDP, die Gitte aus der Mitte und SVP würden auf die Barrikaden gehen, ein Verbot der SP inklusive lebenslanger Verwahrung von Cédric le Wermuthstropfen fordern, die Trychler-Demos reaktivieren und eine Volksabstimmung gegen den «Kommunismus» initiieren.
Dass selbst GRÖFAZ Hitler und Kaiser Wilhelm der abartigen Anziehungskraft von speziellen Auto-Nummernschildern huldigten, zeigt wessen Geistes Kind die Nummernschilder-Fetischisten sind. Grössenwahn und Minderwertigkeitskomplexe werden in der Psychiatrie nicht umsonst «kommunizierende Röhren» genannt.
-
9.11.2020 - Tag der Klima-Hilfsgelder
Sicher, klein und billig – China baut den ersten Thorium-Reaktor
Er ist nicht größer als ein Badezimmer. In China wird ein Thorium-Reaktor in Betrieb genommen. 2030 soll es zur Serienproduktion kommen – die Mini-Reaktoren versprechen CO2-freien Strom ohne die Gefahr eines Gaus.
Deutschland steigt aus der Kernkraft aus, andere Länder setzen große Hoffnungen in die CO2-freie Methode, Energie zu erzeugen. Neben dem Bau von Kraftwerken, die letztlich verbesserte Versionen alter Designs sind, wird an Zukunftslösungen wie der Kernfusion gearbeitet.
Sehr viel schneller als die Fusionsreaktoren, die nach dem gleichen Prinzip wie die Sonne arbeiten, könnten kleine ungleich sicherere Reaktoren gebaut werden. China hat angekündigt, in nur einem Monat einen ersten Thoriumreaktor fertig zu stellen.
Der chinesische Zeitplan ist ehrgeizig. Der Prototyp soll im nächsten Monat fertiggestellt werden, erste Tests beginnen im September, der Bau der ersten kommerziellen Reaktoren soll bis 2030 erfolgen.
Das Besondere an diesem Reaktortyp: Er benötigt kein Wasser zur Kühlung der Atombrennstäbe und wird mit flüssigem Thorium statt mit Uran betrieben. In ihm zirkuliert ein Salz, das sich bei hohen Temperaturen verflüssigt. Diese Technik kennt keinen Atom-Gau. Unfälle oder Lecks würden nur zu kleinen Schäden führen, weil hier kein radioaktiver Dampf in die Atmosphäre gelangt. Das flüssige Salz würde bei einer Störung oder einem Leck schnell abkühlen und kristallisieren. Das Material wäre immer noch radioaktiv, ließe sich aber in Brocken einsammeln.
Dazu ist der Reaktor sehr klein: Er soll nur 3 Meter hoch und 2,50 Meter breit sein. Das sind allerdings die Maße des reinen Reaktors. Um Strom zu erzeugen, muss er an Turbinen und ans Stromnetz angeschlossen werden. Doch die Minigröße des nuklearen Teils macht es möglich, den Reaktor unter Reinraumbedingungen zu bauen, man muss ihn nicht auf einer Baustelle zusammensetzen. Letztlich wäre eine Serienfertigung wie in der Autoindustrie möglich. Bei Wartungen könnte das Reaktormodul einfach ausgetauscht werden und von einem normalen Lkw zurück zum Hersteller gebracht werden.
Der kommerzielle Reaktor wird 100 Megawatt Strom erzeugen – genug, um 100.000 Menschen mit Strom zu versorgen. Weil die Anlage nur wenig Wasser verbraucht, wird China den ersten kommerziellen Reaktor in Wuwei, einer Wüstenstadt in der Provinz Gansu des Landes bauen.
Wie arbeitet ein Thorium-Reaktor?
Es gibt keine Brennstäbe, das Thorium wird in 600 Grad heißem, flüssigen Fluoridsalz gelöst. Dieses Salz zirkuliert in dem Reaktor, außer dem Brennmaterial muss kein weiteres Kühlmittel radioaktiv verseucht werden. Das Salz wird zum Start mit Neutronen beschossen, so dass sich die Thorium-Atome in Uran-233 verwandeln. Dieses Isotop zerfällt und setzt Energie und weitere Neutronen frei. Das Salzgemisch heizt sich weiter auf, gelangt in eine zweite Kammer, in der die Wärme zur Stromerzeugung genutzt wird. Anders als spaltbares Uran kommt Thorium-232 häufig vor und lässt sich leicht in großer Menge gewinnen. Die Halbwertzeit der radioaktiven Abfallprodukte beträgt nur 500 Jahre anstatt der 10.000 Jahre von Uranreaktoren. Das Material des Reaktors kann zudem nicht zum Bau von Atomwaffen verwendet werden.
Das Konzept ist alt. Schon 1946 arbeiteten IUS-Wissenschaftler daran, mit dem Ziel einen mobilen Reaktor zu erschaffen. Obwohl das Prinzip ganz einfach ist, gelang es nie, die technischen Probleme, die das aggressive heiße Flüssigsalz mit sich bringt, zu bändigen. Und noch ist unklar, welche Lösung die chinesischen Wissenschaftler gefunden haben, damit das Salz nicht die Anlage zerfrisst.
Export geplant
Derzeit ist China der globale Hauptemittent von Kohlenstoff und bläst mehr als alle anderen Industrieländer in die Atmosphäre – bei so einem Vergleich muss natürlich auch die Bevölkerungszahl berücksichtigt werden. Rechnet man pro Kopf, befindet sich China auf Platz 16 und hinter Deutschland. Doch bis 2060 soll das Land komplett kohlenstoffneutral werden, in diesem Zusammenhang kommt den Mini-Reaktoren eine Schlüsselrolle zu. "Kleinreaktoren haben große Vorteile in Bezug auf Effizienz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit", schrieb Yan Rui, Physikprofessor am Shanghai Institute of Applied Physics in der Zeitschrift "Nuclear Techniques". "Sie können eine Schlüsselrolle beim zukünftigen Übergang zu sauberer Energie spielen. Es ist zu erwarten, dass Kleinreaktoren in den nächsten Jahren weit verbreitet sein werden."
Offenbar ist auch ein Export in Länder der "Belt and Road"-Initiative geplant. Mit den Thorium-Reaktoren könnte Peking eine sehr niedrigschwellige Nukleartechnik exportieren. Weil der Reaktor selbst mobil ist, kann ein Land solche klimaneutralen Reaktoren nutzen, ohne zunächst eine eigene Atom-Infrastruktur aufzubauen. Zudem kann Peking bedenkenlos auch an Länder liefern, die keine Uran-Reaktoren erhalten würden, da die Thorium-Reaktoren kein waffenfähiges Material ausbrüten können.
Ein dänisches Start-up will ebenfalls "kompakt Molten Salt Reactors" entwickeln, ist aber nicht soweit, einen Prototyp in Betrieb nehmen zu können. In eine ähnliche Richtung geht auch Bill Gates mit seinem Projekt von natriumgekühlten Mini-Reaktoren. Schreibt Gernot Kramper am 20.9.2021 im STERN.
Nachdem China seit Januar 2011 mehrere Flüssigsalz-Reaktorkonzepte erforscht und entwickelt hat, ging das «Land des Lächelns» nach den Probeläufen vor gut einem Jahr in die Offensive und baut nun den ersten Thorium-Reaktor in der Wüste Gobi. Dass China den Weltmarkt für dieses Reaktor-Konzept beherrschen wird, ist jetzt schon so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn die fernöstliche Wirtschaftsmacht schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.
Für China ist Thorium ideal, um Kraftwerke aufzubauen. Es handelt sich dabei nämlich um ein Abfallprodukt beim Abbau von seltenen Erden, die in elektronischen Geräten wie Handys, Computern oder Energiesparlampen zum Einsatz kommen. China ist in diesem Bereich ohnehin sehr aktiv, weswegen der Vorrat an Thorium hoch ist. Der World Nuclear Association zufolge ist der Abbau von Thorium nur in Kombination mit dem von seltenen Erden wirklich wirtschaftlich, da das Element ausser in Reaktoren nirgendwo einen Nutzen hat. (Quelle: Tech & Nature)
Und was unternimmt die hehre Wertegemeinschaft des Westens? Einige Staaten wie Deutschland und die Schweiz haben in einem Anflug von politischer Hysterie die Atomkraft nach dem Fukushima-Crash als künftige Energiequelle verboten. Für ein paar Wählerstimmen wurde eine bedeutende Industrie inklusive Forschung auf Jahrzehnte hinaus abgewürgt. Ein weiterer Schritt Europas auf dem Weg zur Deindustrialisierung und zur vollkommenen Dienstleistungsgesellschaft.
Dafür pilgern die mächtigen westlichen Staatenlenker*innen und Weltverbesserer*innen von einer UN-Klimakonferenz zur andern, lassen salbungsvolle Worthülsen vor der versammelten Weltpresse erklingen, die an Peinlichkeit nicht zu überbieten sind und versprechen den durch den Klimawandel arg gebeutelten Drittweltstatten Klima-Hilfsgelder in Billionenhöhe. Ja, Sie lesen richtig: In genau dieser schwindelerregenden Höhe der Billionen bewegen sich die Forderungen der betreffenden Länder an der COP27 in Ägypten. Und zwar pro Jahr!
Dass die versprochenen Hilfsgelder niemals bezahlt werden – die Schweiz bildet eine löbliche Ausnahme – ist eine andere Geschichte. Macht die verheerenden Fehlentscheide unserer Politgrössen aber auch nicht besser.
China darf sich über seltene Erden in Hülle und Fülle freuen. Der Westen hat dem nichts entgegenzusetzen ausser selten dämliche Polit-Eliten. Diese aber ebenfalls in Hülle und Fülle.
-
8.11.2022 - Tag der deutschen Tüfler und Ingenieure
Warum wird dieser Wunder-Reaktor nicht schon längst in Serie gebaut?
Seit den 1950er-Jahren werden Thorium-Flüssigsalzreaktoren erprobt. Sie haben gegenüber Kernkraftwerken erstaunliche Vorteile. Höchste Zeit, auf sie zu setzen. Robert Habeck, gehen Sie voran!
Das Zeug heißt Thorium. Es glänzt in einem silbrigen Grau, und die Menge, die nötig wäre, um so viel Energie zu erzeugen, wie Sie in Ihrem ganzen Leben verbrauchen werden, wäre nicht größer als eine Kugel, die locker in Ihren Handballen passt. Dass Thorium so häufig sei wie Sand am Meer, wäre gewiss eine Übertreibung. Es ist aber jedenfalls häufiger als das Uran, das heute in Atomkraftwerken verwendet wird – darum auch sehr viel billiger. Große Vorkommen an diesem schwach radioaktiven Metall gibt es in Indien, den Vereinigten Staaten, in Norwegen; auch in der Türkei werden Hunderttausende Tonnen vermutet.
Bei heutigen Atomkraftwerken handelt es sich im Prinzip um riesige Anlagen, in denen Wasser gekocht wird. Die Nachteile jener Anlagen verrät Ihnen jeder Atomkraftgegner auch ungefragt: Das Ensemble muss ständig mit Wasser heruntergekühlt werden. Wenn das Wasser fehlt (etwa weil Generatoren ausfallen, weil eine Tsunamiwelle sie überschwemmt hat), passiert das, was die Welt mit angehaltenem Atem in Fukushima verfolgt hat: Es kommt zur Kernschmelze.
Auch ohne Super-GAU fällt in herkömmlichen Atomkraftwerken Atommüll an, der noch strahlen wird, wenn sich niemand mehr an unsere Kindeskinder erinnert. Außerdem kann man mit dem Plutonium, das in Atomkraftwerken erbrütet wird, sehr hässliche Bomben bauen. Hier noch ein Problem, das Atomkraftgegner in der Eile meistens vergessen zu erwähnen: Es handelt sich um keine sehr effiziente Art der Stromerzeugung. Nur ein winziger Bruchteil des Urans (0,5 Prozent) wird wirklich genutzt.
Thorium-Abfall strahlt nur 300 Jahre
Thoriumkraftwerke funktionieren grundlegend anders. Es kann nicht zu einer Kernschmelze kommen, da der Kernbrennstoff längst geschmolzen ist – er wurde in einer Flüssigsalzlösung aufgelöst. Kein Dampf entsteht. Nichts steht unter Druck; über keinen Teil der Anlage muss ständig Wasser gegossen werden, damit sie nicht heiß läuft. Die Flüssigkeit, mit der die Turbinen getrieben werden, dient gleichzeitig als Kühlflüssigkeit. An der Unterseite der Anlage befindet sich ein Salzstöpsel, der mit der vom Kraftwerk erzeugten Elektrizität auf eine extrem niedrige Temperatur heruntergekühlt wird.
Bei einer Havarie bleibt der Strom weg, ergo schmilzt der Stöpsel: Die radioaktive Flüssigkeit läuft in einen tiefer gelegenen Tank aus. Dies geschieht auch dann, wenn die Leute, die das Kraftwerk betreiben, Wodka-Gelage feiern oder an akuten Wahnvorstellungen leiden. Waffenfähige Feststoffe werden beim Betrieb eines solches Thoriumkraftwerks gar nicht produziert. Die geringen Mengen an radioaktivem Abfall, die dabei herauskommen, strahlen nur circa 300 Jahre lang. Und das Beste: Mit einem solchen Kraftwerk könnten wir auch den vorhandenen Atommüll peu à peu abbauen und zur Stromerzeugung nutzen.
Der offenkundigste Vorzug des Thorium-Flüssigsalzreaktors sollte zumindest nebenbei auch noch erwähnt werden: Er bläst kein Gramm CO2 in die Erdatmosphäre. Er ist sogar umweltfreundlicher als Windturbinen und Solarzellen: Er zerhackt keine Vögel, und bei seiner Entsorgung müssen keine hochgiftigen Seltenen Erden in Sondermülldeponien verbuddelt werden. Der Thorium-Flüssigsalzreaktor hat zudem den Vorteil, dass er auch bei Flaute und nach Sonnenuntergang funktioniert. Mit seiner Hilfe kann also auch die Stromversorgung einer Stadt wie Shanghai oder Hamburg gesichert werden.
Wenn der Reaktor zu viel Strom produziert, könnten wir die Energie benutzen, um Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten. Mit dem Wasserstoff lassen sich dann Wasserstoffautos betanken, die nicht nur keine Abgase produzieren, sondern die Luft beim Fahren sogar sauberer machen. Oder wir könnten Anlagen betreiben, die CO2 aus der Atmosphäre einfangen und so komprimieren, dass man es unterirdisch einlagern kann.
Der Kalte Krieg war schuld
Das Praktische am Thorium-Flüssigsalzreaktor ist, dass er nicht erst erfunden werden muss. Ein Prototyp wurde 1954 mit Erfolg am Oakridge National Laboratory in Tennessee getestet, ein zweiter Prototyp lief am selben Ort von 1965 bis 1969. Als einziger Nachteil wurde die Korrosion der Metallgehäuse durch das flüssige Salz ermittelt — allerdings waren die Konstrukteure zuversichtlich, dass dieses Problem lösbar sei.
Und heute haben wir mehr Legierungen zur Verfügung als vor einem halben Jahrhundert. Warum wurden dann in den westlichen Industrieländern in den Fünfzigerjahren die altmodischen Uran-Wasserkocher gebaut und nicht die Thorium-Flüssigsalzreaktoren? Nebbich: Der Kalte Krieg war schuld. Zumindest am Anfang wurde in amerikanischen und sowjetischen Kernkraftwerken auch das Plutonium erbrütet, das dann in die Atomsprengköpfe kam.
Die Folge: Es gab danach einfach mehr Infrastruktur für Uranreaktoren — und keine für die ganz und gar friedliche Thorium-Flüssigsalz-Variante. Die breite Autobahn führte in diese Richtung. Nur ein Feldweg – den zudem nur Eingeweihte kannten – führte in eine Zukunft ohne Angst vor Kernschmelzen und ohne menschengemachten Klimawandel.
In China und Indien ist das anders. Dort wird der meiste Strom zwar leider noch auf die schmutzigste Art mit Kohle erzeugt; weil die Regierungen dort aber eingesehen haben, dass das nicht so gut ist, setzen sie verstärkt auf Thorium. Indien will mithilfe von Thorium-Flüssigsalzkraftwerken innerhalb von wenigen Jahrzehnten die Energieunabhängigkeit erreichen.
Deutschland könnte sehr schnell aufhören, Braunkohle zu verbrennen
Hier nun ein praktischer Vorschlag: Die Deutschen, die in ihren besten und schlechtesten historischen Momenten ein Volk der Tüftler und Ingenieure waren, sollten es ihnen gleichtun. Sie sollten Thoriumreaktoren für den eigenen Gebrauch bauen, und sie sollten diese Kraftwerke dann auch noch exportieren. Noch ließe sich auf diese Weise ein enormer Reibach machen – hergehört, Vorstände von Siemens und Uniper!
In ökologischer Hinsicht wäre dies natürlich ein Panthersprung nach vorn: Deutschland könnte sehr schnell aufhören, Braunkohle zu verbrennen. Hässliche Windparks könnten abgebaut werden. Es wäre aber auch ein sozialer Fortschritt: Die Strompreise (die vor allem für arme Haushalte eine Last sind) könnten wieder sinken. Last but not least ergäbe sich daraus ein weltpolitischer Vorteil. Von welchem Land, liebe Leserin, möchten Sie lieber abhängig sein – von Russland oder von Norwegen?
Mit Nord Stream 2 kann schnell große Kälte und Dunkelheit hereinbrechen, wenn Genosse Putin es will (oder sein Nachfolger). Mit Thoriumkügelchen dagegen lassen Sie sich auf eine enge Partnerschaft mit einem Königreich ein (Bevölkerung: circa fünf Millionen, politisches System: verlässlich liberal), dessen außenpolitische Ambitionen sich darauf beschränken, dass es gern Teil der Nato bleiben will.
Von Neubauer bis Merkel sollten alle für Thorium-Flüssigsalzreaktoren sein
Eigentlich, sollte man meinen, sind Thorium-Flüssigsalzreaktoren das, was man in Amerika einen no brainer nennt. Eigentlich sollten alle dafür sein: von Luisa Neubauer bis zu Angela Merkel, von der CSU bis zur Linkspartei, von den Kapitalisten bis zu den Sozialhilfeempfängern. So ist es aber nicht. Atomkraft — jede Art von Atomkraft — gilt in Deutschland als Teufelszeug, obwohl bis heute weniger Leute daran gestorben sind als bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe (an der Reaktorhavarie in Fukushima starb niemand).
Als einziges legitimes Mittel gegen den Klimawandel gilt in Deutschland: Verzicht, Verzicht, Verzicht. Die einzig zugelassene Form der Predigt ist die Moralpredigt. Der Gedanke, dass ein technisches Problem (wir Menschen blasen zu viel von einem bestimmten Gas in die Luft) auch mit technischen Mitteln gelöst werden könnte, gilt beinahe als ketzerisch. Wird sich das je ändern? Vielleicht doch. Frankreich zog sich unter Charles de Gaulle aus Algerien zurück.
Amerika nahm diplomatische Beziehungen mit Rotchina auf, als im Weißen Haus ein ausgewiesener Kommunistenfresser saß – Richard Nixon. Analog wäre vorstellbar, dass die Deutschen sich die Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber von den Augen ziehen und klar in die Welt blicken, wenn endlich ein grüner Kanzler die Regierungsverantwortung übernimmt. Robert Habeck, gehen Sie voran! Schrieb WELT-Journalist Hannes Stein am 2.9.2020 in DIE WELT.
Hannes Stein adressierte 2020 seinen Artikel an den damaligen Hoffnungsträger Robert Habeck von den Grünen Deutschlands. So weit würde er sich heute wohl kaum mehr aus dem Fenster lehnen, nachdem Habeck in der deutschen Ampel-Koalition die Ämter des Vizekanzlers und des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland bekleidet. Hat doch der Schönwetter-Kinderbuchautor Habeck seine Unfähigkeit als Politiker für Krisenzeiten inzwischen mehrfach bewiesen.
Unverständlich an diesem ansonst recht informativen Artikel ist die Tatsache, dass Stein nicht nur den deutschen «Kugelhaufen»-Versuchsreaktor in Jülich unterschlägt, sondern auch den darauf folgenden Prototyp eines Thorium-Hoch-Temperatur-Reaktors des Typs «Kugelhaufenreaktor» im nordrhein-westfälischen Hamm mit einer elektrischen Leistung von 300 Megawatt verschweigt. Warum eigentlich? Weil der 1987 an den Betreiber übergebene Reaktor bereits im September 1989 aus technischen, sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Überlegungen nach nur 423 Tagen Volllastbetrieb endgültig stillgelegt wurde?
War es dem Journalisten peinlich, das totale Versagen deutscher Politik, deutscher Wirtschaft und deutscher Forschung im Zusammenhang mit der Thorium-Technik zu thematisieren? Zugegeben: Das hätte auch nicht wirklich zu seinem übertrieben optimistisch formulierten Bild der «deutschen Tüftler und Ingenieure» gepasst, die den wirklichen Koryphäen auf dem Forschungsgebiet der Atomreaktoren nur noch hinterherhinken. Wissen aufzubauen dauert sehr lange, es zu verlieren geht sehr schnell.
Immerhin widerlegt Hannes Stein die Fabel deutscher Politiker*innen, dass Putins erratisches Verhalten nicht voraussehbar gewesen wäre, mit einem einzigen Satz: «Mit Nord Stream 2 kann schnell grosse Kälte und Dunkelheit hereinbrechen, wenn Genosse Putin es will (oder sein Nachfolger)».
Aber warum wird hier ein zwei Jahre alter Artikel als «Schlagzeile des Tages» aufgebauscht? Das, liebe Leserinnen und Leser, erfahren Sie morgen. Gleiche Zeit. Gleicher Ort.
Sie werden erfahren, warum dieser Wunder-Reaktor nicht schon längst in Serie gebaut wird! Wenn das kein Cliffhänger ist, der Sie vermutlich kaum mehr schlafen lässt, was dann?
-
7.11.2022 - Tag der verkorksten und klebrigen Klimademonstrationen
Klimaaktivismus: «Die Protestformen selbst müssen angepasst werden»
Protestforscher Wolfgang Kraushaar sieht den zivilen Ungehorsam fürs Klima trotz legitimer Gründe kritisch.
Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten berufen sich weltweit immer mehr auf die Methoden des zivilen Ungehorsams. Am vergangenen Samstag haben Mitglieder von Greenpeace und Extinction Rebellion Privatjets auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol Privatjets blockiert. Rund 500 Demonstrierenden war es gelungen, auf das Flughafengelände zu gelangen, einige ketteten sich an Flugzeugen fest.
Auch in der Schweiz hat es bereits Strassenblockaden gegeben. Protestforscher Wolfgang Kraushaar sieht unter anderem die Gefahr, dass Ausschreitungen auftreten könnten. Gemäss dem Forscher ist das Ankleben auf Strassen bereits eine Form von verkehrstechnischer Nötigung, die eigentlich auch nicht mehr von dem abgedeckt ist, was der Rechtsstaat ansonsten zu akzeptieren bereit ist.
Aktivismus durch Strassenblockaden ergeben intuitiv Sinn, denn der Auto- und Flugverkehr, der für das Klima schädlich ist, wird dadurch aufgehalten. Allerdings ist in den vergangenen Wochen auch das Phänomen des Beschmierens von Bildern aufgetaucht, diese werden dabei jedoch nicht nachhaltig beschädigt. Diesen Trend kann Kraushaar nicht nachvollziehen.
«Diese Protestform halte ich für schädlich. Es ist absurd, wenn man Museen, Gemälde oder Kunstwerke als mögliche Objekte des Klimaschutzes herausnehmen würde», sagt Kraushaar. Es sei despektierlich, wenn man Bilder beschmiere. Das würde der Protestbewegung schaden, glaubt der Protestforscher.
Man dürfe die Proteste aber nicht komplett verurteilen: «Die Motive sind schon legitim, aber die Protestformen selbst müssen so angepasst werden, dass es darauf ankommt, politisch etwas zu erreichen.»
Die Aktivistinnen und Aktivisten dürften aber nicht glauben, dass es rein reaktiv möglich sei, den Hebel der Gesellschaft und des politischen Systems einfach so umzuwerfen.
Auch das Argument, die Aktivistinnen und Aktivisten wollen lediglich Aufmerksamkeit generieren und würden deshalb Protestaktionen im Museum starten, lässt der Protestforscher nicht gelten. Denn man müsse immer die Reaktionen im Blick behalten. Dort würden derzeit die negativen Beurteilungen überwiegen.
Bei solchen Aktionen sei die Aufmerksamkeit wichtig, und diese nehme schnell ab, so Kraushaar: «Solche Aktionsformen schleifen sich in relativ kurzen Zeiträumen ab und viele andere Dinge sind dann im Vordergrund». Eigentlich würde man in der Klimakrise einen supranationalen Zugriff auf die Veränderungen der Klimapolitik benötigen und diesen könne man mit solchen Protestaktionen nicht erreichen.
Unterschiedliche Zeithorizonte
Zwischen dem Aktivismus und den Massnahmen gebe es eine grosse Diskrepanz im Zeithorizont. Die Akteure würden auf eine Finalisierung des Protests setzen, damit sich die Politik nun entsprechend bewege.
Anderseits würden die geforderten Massnahmen, um die Klimakatastrophe abzuwenden, sich auf Jahre und Jahrzehnte programmieren. Gegenwärtig sind diese Massnahmen gemäss Kraushaar noch völlig unzureichend. Schreibt SRF.
Wenn man sich das Bild mit der auf dem Strassenpflaster klebenden Geröllhaldentussie anschaut, fallen einem spontan zwei Redensarten ein: «Gott gebe, dass sie für immer klebe» und «Alter schützt vor Dummheit nicht».
Dass stumpfsinnige Protestaktionen dieser dämlichen Art dem Thema um den Klimaschutz kaum förderlich sind, muss wohl kaum betont werden.

-
6.11.2022 - Tag der deutschen Selbstüberschätzung
Russische Drohungen: Chinas Stellungnahme «wichtiges Zeichen»
Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat die chinesischen Warnungen vor einem Atomwaffeneinsatz durch Russlands Präsident Wladimir Putin begrüsst.
«Dass das von chinesischer Seite so deutlich heute auch nochmal angesprochen wurde, ist ein wichtiges Zeichen», sagte die Grünen-Politikerin zum Abschluss eines Treffens mit ihren Amtskolleginnen und Amtskollegen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Münster. Schreibt SRF im Liveticker.
Was die chinesische Seite tatsächlich angesprochen hat, ist nichts anderes als chinesische Folklore und hat auf den russischen Angriffkrieg genau so viel Einfluss wie die mehr als nur unbedarfte deutsche Aussenministerin Baerbock: Nämlich keinen.
-
5.11.2022 - Tag der nichtssagenden Interviews
Credit Suisse und die Saudis: «Auf moralische Themen sind Unternehmen oft schlecht vorbereitet»
Mit dem autokratisch geführten Wüstenstaat Saudi-Arabien holt sich die Credit Suisse eine neue Grossaktionärin an Bord. Das sei auch mit Risiken verbunden, warnt der Lausanner Wirtschaftsethiker Guido Palazzo. Denn die moralische Beurteilung solcher Entscheidungen in der Öffentlichkeit könne ganz schnell kippen.
SRF: Wie problematisch ist es, dass sich die Credit Suisse frisches Kapital in Milliardenhöhe bei den Saudis holt?
Guido Palazzo: Wir haben derzeit ganz viele moralische Themen, die in die Unternehmen hineindrängen. Was die Debatte intensiviert, ist der Ukraine-Krieg. Sogar liberale, wirtschaftlich orientierte Medien wie das «Wall Street Journal» sagen nun, man müsse Unternehmen dazu bringen, Russland zu verlassen.
Aber wenn ein saudischer Investor bei der CS einsteigt, hat das doch nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun?
Der Zusammenhang ist folgender: Wenn wir dreissig Jahre an den Fall der Berliner Mauer und den Beginn der Globalisierung zurückdenken: Damals gingen Unternehmen in alle Welt, machten überall Geschäfte, die Wertschöpfungsketten wurden global. Damals dominierte die Idee: Wenn wir den Handel globalisieren, dann globalisieren wir auch die Demokratie.
Man dachte, freie Märkte würden zu freien Bürgerinnen und Bürgern führen. Darum war man relativ entspannt und tolerant, was die Anwesenheit von unseren Unternehmen in repressiven Regimen angeht. Die Annahme war, das werde dort früher oder später einen positiven Einfluss haben.
Das Schlagwort dazu: Wandel durch Handel …
Ganz genau. Aber jetzt wird klar: Das hat nicht funktioniert. Wir haben heute mehr repressive Regimes als noch vor zehn Jahren. Diese Ernüchterung führt dazu, dass wir sehr viel kritischer auf Unternehmen schauen, die in solchen repressiven Regimes aktiv sind oder die mit solchen repressiven Regimes verbunden sind.
Was sollte die CS nun tun?
Ich denke, man muss das Risiko ganz genau analysieren, dem man sich aussetzt. Das Risiko besteht darin, dass die moralische Beurteilung von solchen Entscheidungen ganz schnell kippen kann. Schauen wir uns noch mal den Ukraine-Krieg an. Es war vorher auch schon ein Problem, in Russland zu investieren. Vorher waren die Strukturen dort auch schon repressiv. Kritiker und Dissidenten wurden erschossen, gefoltert und mundtot gemacht.
Aber durch den Krieg ist das, was vorher schon schwierig war, plötzlich inakzeptabel geworden. In China wäre etwas Vergleichbares der Angriff auf Taiwan. Sobald der erfolgt, ist jedes Investment in China kollabiert, dann ist alles verloren.
Die Frage ist: Was wäre ein ähnlicher Kipppunkt der Moral bei Saudi-Arabien? Das muss sich die CS genau anschauen, um vorbereitet zu sein. Moralische Themen sind oft erstaunlicherweise Themen, auf die sich Unternehmen nicht vorbereiten. Wenn sie dann akut werden, tun die Unternehmen das Falsche, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen.
Das Gespräch führte Jan Baumann. Das vollständige Interview gibt es im SRF-Podcast «Trend». Schreibt SRF.
Das ist kein Interview, sondern ein nettes Säusel Gebräusel inklusive Schönfärberei um Nichts. Rein gar nichts. Denn das Kernthema wird ausgeblendet. «Moral» und «Banken» sind zwei sich widersprechende Begriffe.
Global tätige Banken hatten noch nie eine Moral. Weder in der Schweiz noch anderswo. Seit der neoliberalen Deregulierungsorgie sind die so oft zitierten Begriffe wie Moral und Ethik selbst bei nationalen und regionalen Banken nichts anderes mehr als reiner Feigenblattschmuck. Kantonalbanken eingeschlossen.
Hätten die involvierten Schweizer Banken zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auch nur einen Hauch von Moral besessen, wären niemals Finanzgeschäfte mit Hitler-Deutschland in diesem gewaltigen Umfang getätigt worden. Finanz- und Bankgeschäfte, die laut einigen Historikern sogar die Dauer des Zweiten Weltkriegs verlängert haben.
Am 12. August 1998 willigten die Schweizer Banken ja nicht umsonst oder gar aus purer Nächstenliebe in einen Vergleich ein, 1.25 Milliarden Franken an Holocaust-Opfer zurück zu zahlen. Aus heutiger Sicht betrachtet, kamen sie damit ziemlich glimpflich davon.
Waren doch die wirklich grossen Brocken jenseits der «nachrichtenlosen jüdischen Vermögen» ausgeklammert. Aus gutem Grund. Was jedoch eine andere Geschichte ist. Die aber mit Moral und Ethik auch nichts zu tun hat.
-
4.11.2022 - Tag der wunderbaren Wandlung von Saula zu Paula
Investitionen in Energie: Der «nutzlose» Schweizer Strom im Ausland
Die Schweizer Stromfirmen besitzen in Europa Wind- und Solaranlagen. Im Falle einer Strommangellage nützen diese Kraftwerke hier allerdings nichts.
Ein kalter Februartag im Jahr 2023 – und der Schweiz geht der Strom aus. Das ist ein Szenario, das der Schweiz durchaus drohen könnte.
Da in den Wintermonaten die inländische Stromproduktion den Verbrauch in der Schweiz nicht deckt, importiert die Schweiz in dieser Zeit zusätzlichen Strom aus dem Ausland. Das ist seit Jahren eine bewährte Praxis. Im Zuge der Energiekrise steht diese Strategie nun auf wackligen Füssen: Was, wenn die umliegenden Staaten selber zu wenig Strom haben?
Ausländische Anlagen in Schweizer Besitz
In diesem Fall würden auch die ausländischen Wind- und Solaranlagen im Besitz der Schweizer Stromfirmen nichts helfen, ist Urs Meister, Geschäftsführer der Elektrizitätskommission Elcom, überzeugt: «Im Grunde sind diese Anlagen für die Winterstromversorgung der Schweiz nicht relevant.» Die Elcom überwacht die Stromversorgung in der Schweiz.
Anderer Meinung sind die Elektrizitätsunternehmen: «Jede Kilowattstunde, die in Europa produziert wird, ist hilfreich», entgegnet Michael Frank, Direktor des Verbandes Schweizerischer Energieversorger VSE.
Und in der Tat produzieren die Schweizer Stromversorger im europäischen Ausland mit jedem Jahr mehr Strom: In den vergangenen Jahren haben die Firmen quer durch Europa neue Windparks, Solaranlagen und Wasserkraftwerke gebaut oder gekauft.
Inzwischen verfügen diese Kraftwerke über eine installierte Leistung von rund 4600 Megawatt (MW), wie Recherchen von Radio SRF zeigen. Damit produzieren sie eine Strommenge von knapp neun Terawattstunden. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund zwei Millionen Haushalten. Zum Vergleich: Das Kernkraftwerk Leibstadt, das leistungsstärkste AKW der Schweiz, verfügt über eine Leistung von 1200 MW.
Die Expansion ins Ausland haben die Schweizer Stromkonzerne in der Vergangenheit aus zwei Gründen forciert: Wegen der Profite und der juristischen Blockaden.
Innerhalb der Schweiz stossen neue Windparks oder höhere Staumauern auf Widerstand. «Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass die meisten Projekte in der Schweiz blockiert wurden», klagt VSE-Direktor Frank.
Anders die Situation im Ausland: Dort lassen sich neue Projekte einfacher umsetzen. Zudem haben viele europäische Staaten neue Kraftwerke finanziell gefördert. «Diese Programme haben es möglich gemacht, solche Anlagen profitabel zu realisieren», sagt beispielsweise Andy Heiz, stellvertretender Chef der Axpo.
Angesichts einer drohenden Strommangellage könnte sich dieser Fokus aufs Ausland nun als Bumerang für die Schweiz erweisen, befürchtet die Elcom. Deshalb plädiert die Behörde auch seit Jahren für einen verstärkten Ausbau der inländischen Stromproduktion. Bislang erfolglos.
Erst die aktuelle Energiekrise hat die Politik aufgeschreckt. Vor diesem Hintergrund ist die Elcom jetzt froh, dass die Versorgungssicherheit inzwischen auch in der Politik in den Vordergrund gerückt ist. «Das Parlament ist daran, Korrekturen vorzunehmen», stellt Urs Meister von der Elcom erfreut fest. So hat das Parlament jüngst eine Solaroffensive gestartet, damit beispielsweise Solaranlagen in den Alpen schneller realisiert werden können.
Stromunternehmen vs. kommerzielle Investoren
Die Schweizer Energieversorger sind nicht die einzigen Investoren, die im Ausland in erneuerbare Energiequellen investieren. Beispielsweise investieren Fonds, Pensionskassen oder spezialisierte Unternehmen mit privatem Kapital in Wind- und Solarparks.
In diese Kategorie gehören beispielsweise SUSI Partners oder der UBS Clean Energy Infrastructure Fund. Deren Anlagenportfolio wurde in der SRF-Erhebung nicht berücksichtigt, da es sich in der Regel um rein private Investoren handelt und nicht – wie bei den Schweizer Energieversorgern – um Unternehmen in öffentlicher Hand mit einem direkten oder indirekten Versorgungsauftrag.
Eine Ausnahme bildet die Firma Aventron, die grossmehrheitlich im Besitz von mehreren städtischen Energieversorgern ist und bereits auch in die Erhebung von 2019 eingeflossen war. Schreibt SRF.
Vielleicht hatte unser aller Mutter Theresa vom Herrliberg, die abgrundgute Frau Magdalena Martullo-Blocher von und zu Ems, doch ein bisschen mehr recht mit ihrer Kritik im Blick über «Abzocke» und «Spekulation» der Schweizer Strom-Giganten, als wir gemeinhin annahmen.
Logischerweise sind wir gegenüber Äusserungen von Magdalena Martullo-Blocher bezüglich «Spekulation» und ihrer Glaubwürdigkeit im allgemeinen eher skeptisch eingestellt. Wurde doch ihr heiliggesprochener Vater Christophorus nicht durch seiner Hände Arbeit oder den EMS-Konzern Multi-Milliardär, sondern einzig und allein durch gezielte Spekulation und Firmen-Raiding zusammen mit seinem Spezi Martin Ebner.
Sei's drum. Zitieren wir eine erstaunliche Passage aus ihrem Blick-Interview. Auf die Frage «Muss man den Konzernen wieder einen Versorgungsauftrag geben?» antwortete die Hohepriesterin des Marktes, der bekanntlich im neoliberalen Delirium alles regelt, mit einer erstaunlichen Einsicht: «Ja. Der Markt funktioniert heute nicht, die Versorgung wird längerfristig nicht sichergestellt. Die Aufsichtskommission Elcom hat das klar gesagt.»
Nicht nur die Elcom hat das gesagt, gnädigste Mutter Theresa Magdalena, sondern auch viele Kritiker der abartigen Glorifizierung des längst über alle Ufer getretenen Neoliberalismus radikal-perverser Prägung.
Die Energieversorgung von Bevölkerung und Gewerbe ist und war schon immer eine Kernaufgabe des Staates und nicht von mafiösen Spekulationskonstrukten. Doch leider haben unsere Politeliten querbeet durch alle (!) Parteien den Pfad der Tugend längst verlassen.
Und nun stehen die Parlaments-Gesalbten wie Esel am Berg und wissen nicht, was sie tun sollen. Die wirklich grosse Not, die sie umtreibt, sind nicht etwa die leidende Bevölkerung und die explodierenden Energiekosten, sondern nur die kommenden National- und Ständeratswahlen im Herbst 2023!
Mann/Frau will ja schliesslich wieder an die «Futtertröge der Nation» – von Satirikern*innen öfters auch «Parlament» genannt, gewählt werden.
Welche Daten hat SRF erhoben? (Anhang SRF)
SRF hat die Daten zu den Kraftwerken der Schweizer Energieversorger im Ausland erstmals 2019 erhoben, damals im Vorfeld der Abschaltung des AKW Mühleberg. Nun haben wir die Daten drei Jahre später aktualisiert. Die Zahlen mit Stand November 2022 basieren auf direkten Rückmeldungen der Stromunternehmen und/oder auf öffentlich zugänglichen Quellen wie Geschäftsberichten.
Wie bei der erstmaligen Auswertung sind auch dieses Mal alle Anlagen erfasst, die in Betrieb, betriebsbereit oder im Bau sind. Nicht in die Statistik eingeflossen sind Projekte, die sich erst im Entwicklungsstadium befinden oder bei denen die juristischen Verfahren noch nicht abgeschlossen sind.
Installierte Leistung und produzierte Strommenge
SRF hat in der aktualisierten Erhebung sowohl die installierte Leistung der ausländischen Solar- und Windanlagen, sowie der Wasserkraftwerke erhoben (in Megawatt) als auch die damit produzierte Strommenge (in Terawattstunden). Ein Vergleich der installierten Leistung ist geeigneter, um den Zubau dokumentieren zu können. Die produzierte Strommenge hingegen wird stark durch Wettereinflüsse beeinflusst: So können beispielsweise windschwache Wintermonate oder eine überdurchschnittliche Schönwetterperiode die produzierte Strommenge erheblich beeinflussen.
-
3.11.2022 - Tag der Prognosen eine Nacht danach
Jetzt wirds spannend!: So verändert Sommarugas Rücktritt die Bundesratswahlen
Der Rücktritt von Simonetta Sommaruga macht die Bundesratswahl spannender. Vor allem aber ermöglicht er neue Chancen bei der Departementsverteilung. Für die SP aber birgt er eine grosse Gefahr: Sie muss vielleicht nehmen, was übrig bleibt.
Mehrere Personen in Karin Keller-Sutters (58) Justizdepartement sagen: Sie will weg. Die Chefin liebäugle mit einem Departementswechsel. Mit dem Rücktritt von Energieministerin Simonetta Sommaruga (62) sind die Chancen der St. Galler FDP-Bundesrätin gestiegen, ab kommendem Jahr einen anderen Laden zu führen.
Der Rücktritt der Berner SP-Bundesrätin eröffnet neue Möglichkeiten bei der Departementsverteilung. Immerhin werden gleich zwei Schlüsseldepartemente frei: die Finanzen und das Energie- und Umweltdepartement.
Viele Faktoren zählen
Mit der Doppelvakanz ändert sich auch die Dynamik der Bundesratswahlen selbst. Dort spielt mehr hinein. Wenn National- und Ständeräte am Morgen des 7. Dezember zusammenkommen, wissen alle: Die Wahl, die die Vereinigte Bundesversammlung trifft, bestimmt über die eigenen Chancen, selbst einmal in die Landesregierung einzuziehen.
Es gilt als beschlossene Sache, dass die SP keinen Mann vorschlägt. Und aus SVP-Kreisen ist zu hören, dass es die einzige Kandidatin, Michèle Blöchliger (55), nicht aufs Ticket schafft. Zudem ist klar, dass die Grünen nicht antreten.
Lauter Möchtegern-Bundesräte
Wenn also 246 Möchtegern-Bundesräte und -Bundesrätinnen ab 8 Uhr zuerst über den Nachfolger von Ueli Maurer (71) befinden, wissen sie, dass sie sich mit der Wahl eines jüngeren Kandidaten wie Hans-Ueli Vogt (52) die eigenen Chancen verbauen. Der zehn Jahre ältere Heinz Tännler (62) hingegen dürfte den Sitz nur wenige Jahre lang besetzen. Ähnliche Überlegungen könnten im Rennen um die Nachfolge Sommarugas für die Wahl der SP-Ständerätin Eva Herzog (60) sprechen.
Bei der SVP ist aber immer noch am wahrscheinlichsten, dass der Berner Albert Rösti (55) für die SVP in den Bundesrat einzieht. Seine Chancen und jene des zweiten Berner SVP-Kandidaten Werner Salzmann (59) sind mit Sommarugas Rücktritt gestiegen – denn das Argument, es habe ja schon eine Bernerin im Bundesrat, sticht nicht mehr.
Röstis Wahl wiederum macht es unwahrscheinlich, dass eine Berner Sozialdemokratin auf dem SP-Ticket landet. Denn dass an einem Tag zwei Berner gewählt werden, ist unwahrscheinlich. Allerdings nicht unmöglich: Am selben Tag wie Sommaruga war auch der Berner Johann Schneider-Ammann (70) gewählt worden.
Departementsverteilung als Krimi
Mindestens so spannend wie die Bundesratswahlen, die die Schweiz live verfolgen kann, wird jedoch die Departementsverteilung, die hinter verschlossenen Türen stattfindet. Zwar müssen die beiden neuen Mitglieder die Departemente nehmen, die ihnen die anderen fünf übrig lassen. Doch Absprachen zwischen den Parteien könnten etwas nachhelfen.
Wenn etwa der frisch gewählte Bundesrat Albert Rösti als gestandener Energiepolitiker Sommarugas Umwelt- und Energiedepartement übernehmen will, wäre es förderlich, wenn die SVP vorgängig mit der FDP das Gespräch sucht.
Will FDP-Frau Keller-Sutter nämlich Maurers Nachfolge im Finanzdepartement antreten, können sich beide gegenseitig helfen: Mit vier Bundesratsmitgliedern haben SVP und FDP die Mehrheit in der Regierung.
Für die neue SP-Bundesrätin verheisst das allerdings nichts Gutes: Einigen sich die beiden, muss sie sich im Justiz- und Polizeidepartement mit der nächsten Asylwelle herumschlagen. Schreibt Blick.
Obschon unsere Medien vom Rücktritt Sommarugas überrascht wurden, schreiben sie eine Nacht danach bereits die Drehbücher für den Ablauf der kommenden Bundesratswahlen. Selbstverständlich im Konjunktiv und hoch spekulativ, wie das bei Kaffeesatz nun mal üblich ist.
Man fragt sich manchmal, warum diese alles wissenden Koryphäen, die sogar Krisen lösen bevor sie überhaupt je entstehen, bis auf wenige Ausnahmen (Köppel z.B.) nicht selber für politische Ämter kandidieren.
-
2.11.2022 - Ein weiterer Tag der Polit-Mumien
KNESSET-WAHL: Netanjahu gewinnt Wahlen in Israel
Der Ex-Premier hat gute Chancen auf eine Regierungsmehrheit. Die rechtsextreme Partei erlangte die stärksten Zugewinne, es sieht nach einer dünnen rechten Mehrheit aus. Israel erlebte bei den Wahlen am Dienstag einen deutlichen Rechtsruck. Die Likud-Partei unter dem Rechtskonservativen Benjamin Netanjahu konnte sich zwar nicht verbessern, dafür hat das rechtsextreme Bündnis unter Itamar Ben Gvir stark zugelegt: Laut Wahltagsumfragen konnte sich die antiarabische Liste mehr als verdoppeln, sie ist nun drittstärkste Partei. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Israel eine Regierung bekommt, die ausschließlich von jüdischen, rechtskonservativen bis rechtsradikalen und strengreligiösen Parteien dominiert wird. Araber wären darin nicht vertreten, Frauen stark unterrepräsentiert.
Auszählung über Nacht
Noch ist aber nichts fix. Wie viele Sitze die einzelnen Parteien im Parlament erlangen werden, ist noch unklar. Bislang liegen nur die Wahltagsumfragen vor, die Stimmen werden erst über Nacht ausgezählt. Viele Israelis haben sich erst in letzter Sekunde entschieden, ob oder wen sie wählen wollen. Es zeichnet sich aber ab, dass die Rechtsextremen die stärksten Zugewinne von allen Parteien verbuchen konnten.
Der aktuelle Premierminister, Jair Lapid von der Mitte-links-Partei Jesh Atid, konnte zwar ebenfalls stark zulegen, das ging jedoch auf Kosten anderer Parteien aus dem Anti-Netanjahu-Lager. Dass Lapid eine neue Regierung bilden kann, ist jedoch unwahrscheinlich. Zudem zittern mehrere Kleinparteien aus seinem Lager noch um den Einzug ins Parlament, was seine Chancen, eine Netanjahu-Regierung zu blockieren, noch verringern würde. Ob Netanjahu eine Regierungsmehrheit schafft, ist aber auch nicht gesichert. Viele Parteien haben eine Koalition mit Netanjahu dezidiert ausgeschlossen. Sie werfen ihm vor, dass er sein ganzes politisches Handeln nur seinen persönlichen Zwecken unterordnet und sehen seine aktuelle Korruptionsanklage als Beweis dafür.
Fünfte Wahl in vier Jahren
Es war das fünfte Mal in weniger als vier Jahren, dass die Israelis an die Wahlurnen gerufen wurden, und die Wahlbeteiligung war angesichts des Kopf-an-Kopf-Rennens der beiden Blöcke so hoch wie seit 20 Jahren nicht. Dass so oft gewählt wurde, liegt daran, dass keine der vergangenen Wahlen ein klares Ergebnis brachte. Zwar war Netanjahus Likud-Partei immer die stärkste Partei, doch fehlten ihr ausreichend Koalitionspartner für eine Mehrheitsregierung. Nach der letzten Wahl im März 2021 gelang überraschend dem Anti-Netanjahu-Lager unter Jair Lapid die Bildung einer Acht-Parteien-Koalition aus Linksparteien, Rechtsparteien und Arabern. Diese Regierung zerplatzte nach einem Jahr an ihrer hauchdünnen Mehrheit und an internen Querelen.
Ob Netanjahu jetzt die Regierungsbildung gelingt, hängt an einzelnen Parlamentssitzen. Derzeit sagen Umfragen dem rechts-religiösen Netanjahu-Lager 61 bis 62 Sitze voraus, es hätte damit eine dünne Mehrheit. Bis alle Stimmen ausgezählt sind, kann sich das aber noch ändern. Sollte Netanjahu keine Regierung bilden können, dann steuert Israel in wenigen Monaten wohl auf Neuwahl Nummer sechs zu. Für den amtierenden Premierminister Jair Lapid würde das bedeuten, dass er bis auf weiteres Regierungschef bleibt, bis eine neue Regierung an die Macht kommt. Einfach wird es nicht, die Regierungsgeschäfte zu führen: Die Koalition hat seit Monaten keine Mehrheit mehr im Parlament. Wichtige Reformen drohen von den Oppositionsparteien abgeschmettert zu werden. Schreibt DER STANDARD.
Es sieht danach aus, dass nach Joe Biden (USA) und Luiz Inácio Lula da Silva (Brasilien) sich nun auch Israel mit der Wahl Netanjahus (73 Jahre alt) zum Ministerpräsidenten für eine politische Mumie entschieden hat.
Die drei vorgenannten Untoten aus der Politik eint eine Gemeinsamkeit: Alle sind entweder mit schweren Korruptionsvorwürfen konfrontiert (Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden), wegen Korruption verurteilt und im Knast gelandet (Lula da Silva) oder haben ein Verfahren wegen Korruption am Hals (Netanjahu).
Da braucht man sich in der Tat nicht mehr zu wundern, dass windige Populisten oder gar ein Mussolini-Fangirl (Italien) derzeit Hochkonjunktur feiern. Die fallen nun mal nicht vom Himmel, sondern sind das Produkt der herrschenden Polit-Eliten.
Dass sich das Wahlvolk mit seinen Voten damit vom Regen in die Traufe wählt, wird achselzuckend als Kollateralschaden akzeptiert. Das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit demokratischer Gesellschaften schwindet von Wahl zu Wahl. Kluges und entschiedenes Handeln gegen die grassierende politische Korruption wäre angesagt, bevor es zu spät ist.
Doch wie die Geschichte schon oft bewiesen hat, scheint es die Menschheit im Überschwang von Saturiertheit vorzuziehen, sehenden Auges ins eigene Verderben zu taumeln. Gefährliche Politikverdrossenheit, Zerfall der Demokratie und die Zunahme perverser Dekadenz sind die Vorboten davon.
-
1.11.2022 - Tag der veganen Klimarettung
Weltvegantag – Turnschuh im Trend: So nachhaltig sind vegane Sneaker wirklich
Der Markt für vegane Produkte wächst. Doch ist frei von tierischen Stoffen auch besser für die Umwelt? Wir nehmen am Weltvegantag vegane Sneaker unter die Lupe.
Im Werbefenster von Instagram findet ein Wettlauf statt: Ein veganer Turnschuh jagt hier den nächsten. Als Statussymbol unserer Zeit steigt die Nachfrage nach Nachhaltigkeit auch in der Mode. Fatal ist: Veganes Leder, mit dem zahlreiche Sneaker-Marken werben, ist nicht per se nachhaltiger als Tierleder.
Kein Sieg für veganes Leder
Alexandra Pfister unterrichtet seit zehn Jahren an der Schweizerischen Textilfachschule zum Thema Leder. Am Anfang des Semesters frage sie ihre Studierenden gern zu ihren Erfahrungen mit Leder-Ersatz-Produkten.
Das Fazit ist oft ähnlich: «Wenn man sich bei der Frage der Nachhaltigkeit die ganze Kette anschaut», sagt Pfister und zählt die verbrauchte Energie, die Tragedauer, das Recycling auf, «dann gewinnt veganes Leder den Wettlauf nicht.» Es sei in der Regel schneller abgetragen als herkömmliches Leder. «Und ist am Ende als Sondermüll nicht abbaubar.»
Leder aus Obst
Die älteste Alternative zu Tierleder ist Kunstleder. Produziert wird es aus Kunststoff (aus PU oder PVC) – und damit auf Basis von Erdöl. Mittlerweile suchen immer mehr Firmen nach anderen Stoffen, zum Beispiel in Pflanzenabfällen. Aus Ananasblättern, die bei der Ernte übrig bleiben, Maisabfällen oder Apfelresten, die beim Saftpressen anfallen, wird veganes Leder gemacht.
Nur: Schuhe müssen viel aushalten. Ohne Kunststoff geht es nicht. «Bis Sie aus einem Apfel Leder haben, das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, der sehr viele Chemikalien braucht», weiss Modedesignerin Pfister.
Textilingenieur Kai Nebel bekräftigt das. Der Forscher entwickelt selbst an einem veganen Sneaker mit. «Es gibt im Moment keine vernünftigen Alternativen für synthetische Bindemittel.» Und in diesen steckt Erdöl.
Es wird auch geschummelt
Was alles in einem Schuh verarbeitet ist, muss nicht deklariert werden. Leder-Expertin Pfister meint dazu: «Die Industrie ist sehr clever, je nach Trend kann man ein Produkt entsprechend tunen – da wird zum Teil viel geschummelt.»
Will heissen: Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Schuhen treibt die Hersteller nicht automatisch in eine grüne Richtung. «Sie verkaufen nur ein Lebensgefühl», sagt Textilingenieur Nebel.
Nicht genügend Pflanzenabfälle
Das Gewissen lässt sich vom Marketing vielleicht beruhigen, doch die Realität ist eine andere: Für genügend Schuhe aus Ananas oder Äpfeln müsste man deutlich mehr Obst anbauen, weil die Pflanzenabfälle gar nicht reichen. «Damit würden die Leder-Alternativen aber Nahrungsmittel konkurrenzieren», sagt Nebel. Was auch nicht Sinn der Sache sei.
Das Material alleine sagt folglich nichts über Nachhaltigkeit aus. «Ein Plastik-Sneaker, den ich zehn Jahre tragen kann, ist doch schon recht nachhaltig», sagt Nebel. So viel Erfahrung hat man mit den veganen Materialien zwar noch nicht, doch Nebel ist sicher: «Wir kommen nicht ums Erdöl herum», auch wenn die Entwicklung von Leder-Alternativen noch am Anfang steht.
Wirklich nachhaltig ist der Verzicht
Den vielversprechendsten Versuch für veganes Leder sieht der Textilingenieur in Leder aus Pilzen, genauer gesagt dem unterirdischen Geflecht Myzel. Das braucht weniger Wasser und Platz als andere Rohstoffe.
Welcher Sneaker am Ende am nachhaltigsten ist? Der, den man möglichst lange trägt. «Man muss sich fragen: Wie viele Sneaker brauche ich überhaupt?», meint Modedesignerin Pfister. Schreibt SRF.
So richtig vegan im esoterisch-religiösen Sinn von «vegan» werden vegane Sneaker aber erst dann, wenn man die durchgelatschten Turnschuhe aus Abfallgemüse auch noch grilliert oder heiss gekocht in Bouillon aufessen kann.
Dann bleibt selbst für die malträtierte Umwelt bloss ein kompostier- und damit recyclierbares Häufchen Scheisse übrig. Womit wiederum die hehren Ziele der politischen Klimaschutzprogramme erreicht werden.
-
31.10.2022 - Tag der «demokratischen» Gemeinsamkeiten
Lula gewinnt die Stichwahl in Brasilien: Bolsonaro ist abgewählt
Knappes Ergebnis: Mit 50,9 zu 49,1 Prozent gewinnt der linke Ex-Präsident Lula da Silva die Stichwahl gegen den rechtsextremen Jair Bolsonaro.
Als das Wahlergebnis auf der Pressekonferenz die Runde macht, können viele Mitarbeiter*innen der Arbeiterpartei PT die Tränen nicht mehr halten – es sind Freudentränen. Denn in diesem Moment ist klar: Luiz Inácio „Lula“ da Silva hat die Stichwahl um die brasilianische Präsidentschaft gewonnen. Und vielleicht noch wichtiger: Der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro wird keine weiteren vier Jahre regieren.
Die PT hatte am Sonntag in ein schickes Hotel im Zentrum São Paulos geladen. Neben der internationalen Presse waren auch prominente Gäste anwesend. „Für die Umwelt und Brasiliens Rolle in der Welt war Bolsonaro furchtbar“, sagte der ehemalige britische Labour-Chef Jeremy Corbyn der taz. „Außerdem hat er die Lebensgrundlage der Ärmsten zerstört.“
156 Millionen Brasilianer*innen waren am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Medien schrieben im Vorfeld von „der wichtigsten Wahl in der Geschichte Brasiliens.“ Denn mit Bolsonaro und Lula standen sich die wahrscheinlich wichtigsten Protagonisten von Brasiliens Politik der vergangenen Jahrzehnte im direkten Duell gegenüber.
Am Ende war es ein denkbar knappes Wahlergebnis: Lula kam auf 50,9 Prozent der Stimmen, Bolsonaro auf 49,1 Prozent. Etwas mehr als zwei Millionen Stimmen trennten die beiden Kandidaten voneinander.
Versöhnliche Töne des neuen alten Präsidenten Lula
Im Laufe des Tages mehrten sich die besorgniserregende Berichte: Die Autobahnpolizei soll Menschen die Anfahrt zur Wahl erschwert haben. Zahlreiche Busse wurden angehalten, angeblich um Verbrecher aufzuhalten. Laut Lula-Anhänger*innen soll es sich um eine orchestrierte Aktion gehandelt haben. Die Autobahnpolizei steht Bolsonaro nahe, ihr Chef hatte noch am Sonntag bei Instagram zur Wahl des Rechtsradikalen aufgerufen.
Besonders auffällig: Die Aktionen fanden überproportional im Nordosten statt, wo die Mehrheit der Bevölkerung Lula unterstützt. Medien berichteten, dass die Polizeiaktionen bei einem Treffen im Präsidentenpalast geplant worden sein sollen. Trotz der mutmaßlichen Wahlbehinderungen gewann Lula die Wahl.
Um 20:44 betritt der ehemalige Gewerkschaftsführer unter Jubel die Bühne im Hotel in São Paulo. Fäuste werden in die Luft gereckt, im Chor schallt es „Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula.“ Umringt von Politiker*innen und Aktivist*innen dankt Lula in seiner ersten Rede als frisch gewählter Präsident Gott. Danach hält er eine versöhnliche Rede. Er wolle Präsident aller Brasilianer*innen sein – nicht nur für die, die für ihn stimmten. Lula versprach nichts weniger, als das tief gespaltene Land wieder zusammenzubringen. Doch einfach wird das nicht.
Bolsonaro lag zwar hinter Lula, erzielte aber ein hohes Wahlergebnis. Mit dem Bolsonarismus hat der amtierende Präsident eine überaus aktive Bewegung hinter sich. Außerdem schafften etliche Bolsonaro-nahe Kandidat*innen den Einzug in die Parlamente. In São Paulo setzte sich ebenfalls am Sonntag der Bolsonaro-Kandidat Tarsício Freitas klar gegen den PT-Politiker Fernando Haddad durch. Damit werden die drei größten Bundesstaaten Brasiliens – São Paulo, Rio de Janeiro und Minas Gerais – künftig von Bolsonaro-Verbündeten regiert.
Die befürchtete Gewalt blieb zunächst aus
Eine Frau im roten Blazer steht neben Lula auf der Bühne: Es ist Dilma Rousseff, Brasiliens Ex-Präsidentin. „Dieser Sieg bedeutet viel für Brasilien“, sagt Rousseff, die 2016 durch ein juristisch fragwürdiges Amtsenthebungsverfahren ihren Posten als Präsidentin verlor. „Heute haben wir gezeigt, dass wir zurück sind,“ sagt Rousseff der taz.
Das wollen nicht alle akzeptieren. In einigen Städten blockierten Bolsonaro-Fans Autobahnen und erklärten, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Die gefürchteten größeren Ausschreitungen blieben allerdings aus. Bolsonaro selbst meldete sich nicht zu Wort. Doch viele prominente Verbündete des Präsidenten erkannten den Wahlsieg Lulas an.
Viel war im Vorfeld über Gewalt diskutiert worden, einige hielten sogar einen Putschversuch für möglich. Denn Bolsonaro hatte seit Monaten Lügen über das elektronische Wahlsystem verbreitet und erklärt, nur Gott könne ihm die Präsidentschaft entziehen. Doch für einen offenen Bruch mit der Verfassung dürfte ihm die nötige Rückendeckung fehlen. Es gibt eine aktive Zivilgesellschaft in Brasilien, kritische Medien, und die demokratischen Institutionen funktionieren immer noch. Auch im Ausland setzten viele auf die Abwahl Bolsonaros. US-Präsident Joe Biden zählte am Sonntag zu den ersten Gratulanten Lulas.
Wenige hundert Meter vom Hotel entfernt versammelten sich die zehntausende Anhänger*innen Lulas zu einer Siegesfeier. Es war ein euphorisches Fest bis tief in die Nacht. „Ich verspüre eine große Erleichterung“, sagte der Lehrer Adriel Fernandes, 39, der zusammen mit seinen zwei Kindern zur Wahlfeier gekommen war. „Hoffentlich können wir jetzt zurück zur Normalität.“ Schreibt TAZ.
Die Präsidentschaftswahl 2022 in Brasilien hat viele Gemeinsamkeiten mit der Wahl des US-Präsidenten aus dem Jahr 2020, die von Joe Biden gegen den Amtsinhaber Donald Trump gewonnen wurde.
• Die Wahlberechtigten beider Länder hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera.
• Beide Länder wählten den Amtsinhaber nach nur einer Legislaturperiode ab.
• Sowohl die USA wie auch Brasilien entschieden sich für skandalumwitterte politische Mumien, die ihre besten Tage längst hinter sich haben.
• Joe Biden ist inzwischen 80 Jahre alt, Luiz Inácio Lula da Silva, der vom 7. April 2018 bis 7. November 2019 580 Tage im Gefängnis in Curitiba verbrachte, hat ebenfalls bereits 77 Jahre auf dem Buckel.
• Biden regiert die USA mit einer Pattsituation in den beiden Parlamentskammern, die nur durch die Stimme der Vizepräsidentin zu Gunsten der Demokraten aufgehoben werden kann.
• Bolsonaros Partei «Partido Liberal» (PL) ist in beiden Kammern des brasilianischen Kongresses die stärkste Kraft geworden und stellt ein gewaltiges Hindernis für die Reformbestrebungen der Lula-Regierung dar.
• Auch die mächtigen Landesfürsten (Gouverneure) der brasilianischen Bundesstaaten gehören mehrheitlich der PL an.
• Verlieren Bidens Demokraten die derzeit anstehenden Midterm-Wahlen (ein Drittel der Senatoren und sämtliche Vertreter des Repräsentantenhauses werden neu gewählt), mutiert Präsident Joe Biden zur «lame Duck» und wird kein einziges Gesetz mehr durch den Senat bringen, wenn es den Republikanern nicht gefällt.
• Brasiliens neuer Präsident Lula ist durch die Zusammensetzung des brasilianischen Parlaments bereits eine «lahme Ente».
• Die Abholzung des Regenswaldes wird auch unter Lula allen Schönfärbereien linker Medien zum Trotz munter weitergehen, so wie sie bei seinen bisherigen zwei Amtszeiten (vom 1. Januar 2003 bis zum 1. Januar 2011) in einem verheerenden Ausmass stattgefunden hat. So viel Wahrheit muss schon sein!
Fazit: Zwei grosse und wichtige Länder wählen sich vom Regen in die Traufe.
-
30.10.2022 - Tag der DNA von Investoren
Grossaktionäre unter der Lupe: Schweizer Unternehmen in ausländischer Hand
Die Credit Suisse ist keine Ausnahme: Immer mehr Geld aus dem Ausland fliesst in Schweizer Firmen. Das kann heikel sein.
Ausländische Investoren sind scharf auf Schweizer Firmen. Jüngstes Beispiel: die Credit Suisse. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Saudi National Bank mit 9,9 Prozent bei der krisengebeutelten Bank einsteigt. Schon länger im Aktionariat sind die amerikanischen Harris Associates und weitere Geldgeber aus dem Mittleren Osten. Die CS ist indes keine Ausnahme. An der Spitze der ausländischen Investoren in der Schweiz stehen traditionell solche aus den USA. Sie halten den höchsten Anteil an Schweizer Firmen – und dies mit grossem Abstand. Dahinter kommen Schweden, Norwegen, Grossbritannien und Saudi-Arabien mit einem Anteil von 1,5 Prozent oder weniger.
Doch andere holen auf: Allein die Chinesen investierten 2021 für neun Transaktionen insgesamt 96 Millionen Dollar. Sie sorgen mit ihren Beteiligungen regelmässig für Schlagzeilen. Bereits in chinesischer Hand sind Traditionsunternehmen wie Syngenta, Bally, Gategroup, SR Technics, Swissport, Eterna, Netstal, Swissmetal oder das Luzerner Hotel Palace. Fast gänzlich in ausländischen Händen befinden sich die Pharmaunternehmen Alcon, der Sanitärtechnikkonzern Geberit, der Duftstoffhersteller Givaudan, der Unterhaltungselektronikkonzern Logitech, das Chemieunternehmen Lonza, der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und der Versicherer Zurich Insurance.
Doch der politische Druck, ausländische Investitionen zu prüfen, steigt. Eine Motion des Walliser Mitte-Ständerats Beat Rieder (59) forderte den Bundesrat bereits 2018 auf, die «Schweizer Wirtschaft durch Investitionskontrollen» zu schützen. Vor einem halben Jahr schickte der Bundesrat einen Vorentwurf für ein Investitionsprüfgesetz in die Vernehmlassung. Durch das Investitionsprüfgesetz sollen ausländische Investoren bei der Übernahme von Schweizer Unternehmen vorgängig geprüft werden. Die grösste Gefahr besteht darin, dass Staaten oder ausländische Investoren mit staatsnahen Strukturen die Direktinvestitionen einsetzen, um politische Ziele zu verfolgen. Schreibt SonntagsBlick.
Frei nach dem Zitat, das häufig Kurt Tucholsky zugeordnet wird aber definitiv nicht von Tucholsky stammt: «Wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein.»
Egal, von wem diese Redewendung letztlich stammt, die ethisch-moralische Gesinnung von den meisten Konzernmanagern und einer Elite skrupelloser Industrie- und Wirtschaftsführer inklusive neoliberalster Politiker*innen trifft sie den Nagel auf den Kopf.
Im Sinne von «nach mir die Sintflut» werden die Gewinne privatisiert und die Verluste bis hin zum bitteren Ende inklusive allen gesellschaftlichen Verwerfungen dem Staat vor die Füsse gekippt.
Dieses egoistisch-gierige Verhalten scheint in der menschlichen DNA festgeschrieben zu sein. Soll doch König Artus, über dessen Existenz sich die Wissenschaft auch nicht wirklich einig ist, bereits im 9. Jahrhundert den Rittern der Tafelrunde die an und für sich logische Weisheit offenbart haben, dass «der Starke immer den Schwachen besiegen wird».
Der Sieg Davids gegen Goliat ist leider auch nicht mehr als eine nette Bibelgeschichte.
-
29.10.2022 - Tag der veflixten Namen
Bruno Birrer: «Was ich erzähle, muss nicht immer stimmen»
Über 20 Jahre hat Bruno Birrer Interessierte durch die Gemeinde Cham geführt. Hat Geschichten erzählt und die Leute auch mal in die Dunkelheit mitgenommen. Mit zentralplus blickt der 79-Jährige zurück.
Mittlerweile gilt Bruno Birrer beinahe als Chamer Stadtoriginal. Nicht nur, weil er sich mit abenteuerlichen Tätigkeiten beschäftigt und lange als «Güselkommissar» unterwegs war, sondern auch, weil er einer ist, der die Gemeinde Cham wie nur wenige andere kennt (zentralplus berichtete).
So gut, dass der 79-Jährige seit rund 20 Jahren Stadtführungen für Cham Tourismus durchführt. Und dies, obwohl er, wie er mehrmals betont, kein Historiker sei, sondern ein Geschichtenerzähler. Vor seiner letzten offiziellen Tour am kommenden Samstagvormittag blicken wir mit Birrer auf seine teils schrägen Führungen zurück.
zentralplus: Zunächst einmal: Sind Sie traurig über Ihre letzte Tour?
Birrer: Nein, das ist gut so. Mit dem Historiker Thomas Fähndrich wurde ein guter Nachfolger gefunden. Das war mir wichtig. Ausserdem gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, Stadtrundgänge mit mir zu buchen. Denn ab und zu kommen Leute auch im privaten Umfeld auf mich zu und möchten eine Brand-, Friedhofs- oder eine industriegeschichtliche Führung.
zentralplus: Cham ist nicht riesig, scheint jedoch eine Menge spannender Themen zu bergen.
Birrer: Man staunt, was sich in Cham an Interessantem verbirgt. Die Geschichte des Ortes wurde vom Historiker Michael van Orsouw sehr gut ausgearbeitet. Viele bedeutsame Häuser wurden dank ihm mit Tafeln versehen. Auch schrieb er Bücher über Cham, etwa auch über Adelheid Page. Er verdient eigentlich schon lange einen Orden. Von dieser Vorarbeit zehre ich. Auch wenn ich mich bewusst als Geschichtenerzähler bezeichne.
zentralplus: Das heisst? Nicht alles, was Sie bei den Führungen erzählen, entspricht der Wahrheit?
Birrer: Genau. Die Leute sollen wachsam bleiben. Was ich erzähle, muss nicht immer genau stimmen. Auch dürfen meine Geschichten anecken. Genau das ist auch das Thema am Samstag. Ich will Geschichten erzählen, über die man ins Diskutieren gerät.
zentralplus: Es gibt also nicht einfach die «eine» Stadtführung, die man buchen kann? Sie lassen sich immer etwas Neues einfallen?
Birrer: Ja. Das ist mitunter abhängig von der Gruppe. Letzthin habe ich eine Führung für den Strassenvorstand gemacht. Es ist klar, dass ich da den Fokus eher auf das historische Strassensystem gelegt habe. Das würde ich mit einer Gruppe, die zu drei Vierteln aus Frauen besteht, natürlich nicht tun.
zentralplus: Wer kommt an diese Führungen?
Birrer: Schulen beispielsweise. Aber auch Klassenzusammenkünfte. Das sind die Schlimmsten.
zentralplus: Ach?
Birrer: Ja, denn sie haben sich alle schon lange nicht mehr gesehen und müssen alle währenddessen miteinander reden. Der alte Schulschatz wurde wieder aktiviert und weg ist die Aufmerksamkeit. Heikel sind aber auch Lehrkörper. Sie sind es eher gewohnt, zu reden statt zuzuhören. Doch auch da gibt es natürlich Unterschiede. Kinder sind anspruchsvoll, aber lustig. Da darf man nicht böse sein, wenn ihnen die Aufmerksamkeit abhanden kommt. Die muss man sich dann einfach wieder holen.
zentralplus: Welche Gäste sind Ihnen handkehrum am liebsten?
Birrer: Gruppen von Freunden, die sich regelmässig sehen. Jassfreunde zum Beispiel.
zentralplus: An welche Führung erinnern Sie sich besonders gern?
Birrer: Einmal habe ich eine Führung in der dunkeln Kirche gemacht. Nur ich hatte eine Taschenlampe und konnte damit die Gegenstände und Malereien beleuchten. Die nächtlichen Friedhofsführungen sind mir am liebsten. Weil es dunkel ist, können die Leute nicht abschweifen. Bei den Friedhofsführungen am Tag sind mir immer die meisten Leute verloren gegangen. Es ist ein Ort, den man sonst meist nicht besucht und der dazu verleitet, herumzuschlendern und sich die Grabsteine anzusehen. Vor den Nachtführungen informiere ich jeweils die Polizei. Nicht, dass sie dächten, es seien Grabräuber am Werk.
zentralplus: Seit rund 20 Jahren führen Sie Menschen durch Ihre Gemeinde. Inwiefern hat sich Cham in dieser Zeit verändert?
Birrer: Es ist bunter geworden. Von den Menschen her, aber auch von den Sprachen, die man hört. Es ist wie ein Babylon. Hätte ich einen Wunsch frei, wünschte ich, ich könnte sie alle verstehen und vielleicht gar darauf antworten. Was sich ausserdem verändert hat: Wie sehr die Menschen heute ins Handy versunken sind, während sie durch die Strassen laufen. Eigentlich bräuchte es keine Führungen mehr, man kann ja alles auf Google nachlesen.
zentralplus: Was ist Ihr Lieblingsfakt über Cham, der immer wieder für Erstaunen oder Schmunzeln sorgt?
Birrer: Ich ziehe gern Vergleiche. So auch zwischen Charles Page, dem Gründer der Anglo-Suisse, und Henri Nestlé. Ihre Herkunft, ihre Denkweisen und ihr Auftreten waren grundverschieden. Einer war ein Intellektueller, der andere ein Macher. Ich vergleiche die beiden Konkurrenten gern mit H2O, mit Wasser, dessen Moleküle Wasser- und Sauerstoff in einem bestimmten Winkel stehen müssen, um funktionieren zu können. Ein physikalisch-chemischer Ansatz einer geschichtlichen Begebenheit.
zentralplus: Was fehlt der Gemeinde?
Birrer: Eine Umfahrung, dank der sich das Dorf beruhigen könnte und sich die Menschen stärker begegnen könnten. Heute herrscht eine grosse Hektik auf den Strassen, die Autofahrer sind ungeduldig. Das ärgert mich.
zentralplus: Was macht Cham gut?
Birrer: Vieles. Der Ort ist gut für Familien mit Kindern. Wir haben hier über 20 Spielplätze, das ist toll.
zentralplus: Was kommt für Sie nach Ihrer Zeit als offizieller Stadtführer von Cham Tourismus?
Birrer: Nun, der Aufwand dafür war nicht riesig. Die Vorbereitungen waren jeweils interessant. Doch werde ich künftig wohl mehr Zeit zu haben, Bücher nur für mich zu lesen. Doch es kommen auch neue Projekte dazu. Kommenden Dezember bin ich bei der International School als Samichlaus tätig. Das mache ich auf Deutsch, denn mein Englisch ist sehr schlecht. Mein Schmutzli hingegen spricht sehr gut Englisch. Schreibt ZentralPlus.
«Was ich erzähle, muss nicht immer stimmen» sagt Bruno Birrer. Das liegt eindeutig am Namen Birrer.
-
28.10.2022 - Tag der kommenden Strommangellage in Lugano
Krypto-Valley im Südkanton: Lugano will zur europäischen Bitcoin-Metropole werden
Die Tessiner Metropole hat als Bankenplatz seit dem Ende des Bankgeheimnisses stark an Bedeutung verloren.
3000 Arbeitsplätze wurden seit dem Ende des Bankengeheimnisses gestrichen und die Steuereinnahmen sanken um 30 Millionen. Lugano träumt nun davon, sich als Bitcoin-Metropole neu zu erfinden. Am Freitag und Samstag findet dazu ein Kongress statt.
Die Rede ist vom Plan B. Dieser sieht vor, dass sich in der Stadtmitte ein Kryptozentrum entwickelt. Dort sollen sich Firmen ansiedeln, die mit dieser Technologie arbeiten. Es sollen neue Arbeitsplätze für ein junges urbanes Publikum entstehen und die neuen Firmen sollen Steuern zahlen, hofft Stadtpräsident Michele Foletti.
Angst, dass der Traum vom Plan B für Lugano zum Albtraum werden könnte, hat er keine. Alle Investitionen, zum Beispiel das neue Zentrum, wird von grossen Techfirmen wie Tether getätigt. Lugano habe nichts zu verlieren, sagt Foletti selbstbewusst. Im Gegenteil: Allein schon das Ausrufen des Plan B habe eine grosse Marketingwirkung für die Stadt. Ob die PR-Offensive Früchte trägt, ist aber unklar.
Lugano als Konkurrenz zum Zuger Krypto-Valley?
Die Blockchainbranche beschäftigt viele Personen und zieht in der ganzen Schweiz viel Geld an. Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht, die Branche selbst spricht aber von über 1000 Firmen mit 6000 Arbeitsplätzen. Etwa die Hälfte davon sind in Zug. In Lugano hingegen haben sich bisher erst 50 Kryptounternehmen angesiedelt.
Aber: Die Krypto-Büros in Zug sind zum grossen Teil leer, das Krypto-Valley verteilt sich immer mehr über die ganze Schweiz, nach Zürich, aber eben auch Lugano. Und dass Lugano ein grösseres Stück von diesem Kuchen will, ist nachvollziehbar.
Praktisch niemand zahlt seine Steuern in Bitcoin
Die Stadt Lugano verspricht, dass bald die Steuern, das Feierabendbier oder der Kaffee mit Bitcoin & Co bezahlt werden können. Im Kanton Zug kann man bereits seit letztem Jahr seine Steuern in Bitcoin bezahlen, die Nachfrage dafür ist aber bescheiden.
Laut der Zuger Steuerverwaltung wurden letztes Jahr gerade einmal 50 Steuerzahlungen im Gesamtbetrag von rund 200'000 Franken mit Bitcoin bezahlt. Das ist etwa ein Tausendstel Prozent aller Steuern, also praktisch nichts. Weshalb sollen Bürgerinnen und Bürger ihre Steuern in Bitcoin oder Tether bezahlen, wenn das jetzige System doch gut funktioniert?
Tether – der umstrittene Partner
Gerade Tether löst Bedenken aus. Das Kryptounternehmen stellt Lugano über 100 Millionen Franken zur Verfügung, unter anderem um Startups zu fördern und Kryptobezahlsysteme einzuführen. Tether ist aber umstritten und immer wieder im Visier von Aufsichtsbehörden. So bezahlte das Tech-Unternehmen 2021 in den USA eine Strafe wegen falschen Behauptungen zu seinen Währungsreserven in der Höhe von rund 40 Millionen Dollar.
Im Gegensatz zum Bitcoin behauptet Tether ein sogenannter Stablecoin zu sein: Da die Tether-Währung mit echten US-Dollars unterlegt sei. Das soll die Kryptowährung stabiler machen. Bisher wurden etwa 80 Mrd. Tether ausgegeben. Es ist aber nicht klar, wie viel Kapital wirklich hinterlegt ist. Es dürfte für Lugano also seriösere Partner geben. Aber: Tether gibt es noch, es hat bisher all die Rechtsstreite in den USA überstanden und gilt weiterhin als einer der wichtigsten Kryptoplayer weltweit. Es ist so gesehen mutig von Lugano, mit so einem Partner zusammenzuspannen. Schreibt SRF.
Man darf sich fragen, ob der umtriebige Stadtpräsident von Lugano, Michele Foletti, eine Ahnung davon hat, welche unvorstellbaren Unmengen von Energie (Strom) für die Blockchain-Technologie allein zur Überweisung von Kryptowährungen und fürs Cryptomining verbraucht werden.
Ganz zu schweigen von der kriminellen Energie, die sich in der Krypto-Branche längst zementiert hat.
-
27.10.2022 - Tag der Slim Fit-Anzüge und Beauty-Salons
Bundesratswahl im Dezember: Diese Eigenschaften braucht man, um Bundesrat zu werden
Ist es die Fachkompetenz? Weltoffenheit? Oder dass man gut mit Menschen umgehen kann? Im «Club» antwortete etwa ein Alt Bundesrat, was es für das Amt als Bundesrat oder Bundesrätin braucht.
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sind entscheidend, wenn man Bundesrat oder Bundesrätin werden will? Diese Frage beschäftigt aktuell nicht nur die fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die die Nachfolge von SVP-Bundesrat Ueli Maurer antreten wollen. Alt-Bundesrat Hans-Rudolf Merz, der von 2003 bis 2010 im Amt war, hat sie in der Sendung «Club» aus eigener Erfahrung beantwortet.
Haltung und Herzblut
Wer in den Bundesrat wolle, brauche eine klare Linie, eine gefestigte Meinung, so Merz. Und man müsse dazu bereit sein, sich total in dieses Amt einzubringen: «Das ist eine Grundvoraussetzung.»
Ab dem Zeitpunkt der Wahl verändere sich das ganze Leben: Der Alltag sei komplett durchgetaktet, das Privatleben stark eingeschränkt, Sicherheitsvorkehrungen müssten getroffen werden: «Eines Tages rief meine Frau mich an und sagte, ein paar Handwerker hätten unser Haus verkabelt, im oberen Stock eine Wand herausgerissen und im Schlafzimmer eine Doppeltür mit Spion eingebaut – ich hatte davon keine Ahnung.»
Charakter: Die Lieben und Netten gewinnen
Offenheit, Ehrgeiz, Humor: All das seien Eigenschaften, die einem als Mitglied des Bundesrats zugutekämen, so Merz. Eine brauche es jedoch unbedingt: Verträglichkeit. Der Bundesrat als Gremium komme nur zum Ziel, wenn die Mitglieder sich auch menschlich vertragen würden.
Das betonte auch Journalistin Eva Novak, die seit über 30 Jahren aus dem Bundeshaus berichtet: Teamfähigkeit sei entscheidend. Dazu gehöre auch, den Kontakt zu den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu pflegen, sich zu vernetzen. Wer respektvoll mit den Leuten umgehe und mit allen reden könne, statt zu polarisieren oder sich selbst zu stark in den Vordergrund zu stellen, habe bessere Chancen.
Diese Einschätzung deckt sich mit einer kürzlich erschienen Studie der Universität Bern, die zum Schluss kommt: «Am Wahltag erhalten die Lieben und Netten die meisten Stimmen.»
Führungskompetenzen
Wer im Bundesrat sitzt, ist Chef oder Chefin von tausenden von Mitarbeitenden. Das sei ein Faktor, den alle Kandidierenden unterschätzen würden, so Merz. Für Philippe Hertig stellt die Führung gar den «Hauptjob» des Bundesrats dar. Hertig ist Partner beim Beratungsunternehmen Egon Zehnder und spezialisiert auf die Suche von Führungskräften.
«Ein Bundesrat muss sein Departement strategisch-operativ ausrichten», erklärte Hertig. «Ich habe Mühe, wenn ich Kandidatinnen und Kandidaten sehe, die weder Exekutiv- noch Führungserfahrung haben.» Hans-Rudolf Merz bestätigt: Gerade, weil ein Departement aus so vielen unterschiedlichen Bereichen bestehe, sei es unmöglich, sich in alle detailliert zu vertiefen: «Irgendwann erkennt man: Viel wichtiger ist es, zu führen und Akzente zu setzen.»
Gewandtheit auf dem internationalen Parkett
Bundesrätinnen und Bundesräte repräsentieren die Schweiz auch im Ausland. Darum sei es von Vorteil, mehrere Fremdsprachen zu beherrschen, sagte Bundeshausjournalistin Eva Novak. Die Vergangenheit habe jedoch gezeigt, dass sich fehlende Kenntnisse ausgleichen liessen.
So habe zum Beispiel Alt Bundesrat Adolf Ogi zwar nicht mit perfektem Englisch auftrumpfen können, dafür aber mit seinem menschlichen Auftreten überzeugt: «Er hatte auf seinen Reisen immer einen Bergkristall in der Tasche und hat den verschenkt.» So sei es Ogi gelungen, mit ausländischen Ministerinnen und Ministern freundschaftliche Kontakte zu knüpfen, auch wenn diese politisch komplett andere Positionen vertraten. Schreibt SRF.
Die oben aufgeführten Eigenschaften darf man mehr oder weniger vergessen, weil sie eigentlich bei einigermassen normalen Menschen vorausgesetzt werden. Egal, um welchen Job sie sich gerade bewerben.
Um als Bundesrat / Bundesrätin gewählt zu werden, müssen die Kandidaten / Kandidatinnen einzig und allein von den Parteigremien nominiert werden. Den Rest erledigen PR-Agenturen, Slim Fit-Anzüge bei den Herren und Beauty-Salons bei den Damen. That's it. Mehr braucht es nicht.
-
26.10.2022 - Tag der Ankündigungs-Ministerinnen
Regierungserklärung von Meloni: Gegen die Mafia, für den Süden
Giorgia Meloni, die neue Premierministerin Italiens, hat im Parlament ihre erste Regierungserklärung abgegeben. Die Ansprache dauerte über eine Stunde.
Giorgia Meloni war sich klar, dass ihr heutiger Auftritt im In- und Ausland mit Argusaugen beobachtet würde. «Ich bin das, was die Briten einen Underdog nennen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und musste mich gegen alle Widrigkeiten nach oben durchbeissen. Das habe ich geschafft und habe es auch weiterhin vor», so Meloni.
Meloni blieb auch ihrer Linie aus dem Wahlkampf treu. Sie gab sich als konservativ, wirtschaftsliberal, aber einigermassen moderat. Italien stehe ohne Wenn und Aber zur Nato und zum Westen im Ukrainekrieg. Italien werde innerhalb der EU Politik machen. Nicht gegen die EU. Aber Italien werde ohne Unterwürfigkeit gegenüber anderen EU-Mitgliedern auftreten. Gemeint waren Paris und Berlin.
Dass Italien von den anderen Europäern über den Tisch gezogen werde, ist ein typisches Narrativ der Fratelli d'Italia. Es war schon anfangs des 20. Jahrhunderts ein gängiges Argument der Rechten bis Rechtsextremen.
Meloni grenzte sich zwar klar vom italienischen Faschismus ab, bettete aber diese Abgrenzung in eine Ablehnung gegen jeglichen Totalitarismus ein. Und sie sagte damit quasi: Wir waren nicht die einzigen. Immerhin ergänzte sie, die Verbrechen liessen sich nicht gegeneinander aufrechnen.
Wirtschaftspolitik soll liberaler sein
Giorgia Meloni ist die schwierige Lage Italiens bewusst: Eine Staatsverschuldung von 145 Prozent des BIP, die nur von Griechenland übertroffen wird, eine Inflation von über 11 Prozent, Wachstumsprognosen von unter einem Prozent bis zur Vorhersage einer Rezession.
Meloni kündigte eine liberale Wirtschaftspolitik an, mit Steuersenkungen und Abbau der Bürokratie. Interessant war: Sie hielt an ihrem Ziel fest, in Italien ein Präsidialsystem wie in Frankreich einzuführen, was einer Regierung einerseits mehr Stabilität, aber auch viel mehr Machtfülle gibt.
Corona, Überalterung und Migration
Und sie kündigte an, dass Italien im Falle einer neuen Covid-Welle viel weniger restriktiv als in der Vergangenheit vorgehen werde. Italien habe das strengste Covid-Regime in Europa gehabt, aber trotzdem zu den Staaten mit der höchsten Sterblichkeit und Sterberate gehört.
Meloni widmete einen separaten Punkt in ihrer Rede der Förderung der Jugend und der Überalterung der Gesellschaft. Denn Italien habe die tiefste Geburtenrate seit 1861.
Und sie kündigte an, sich für Hotspots für Flüchtlinge in Afrika einsetzen zu wollen, wo ihre Asylanträge nach Europa geprüft würden. Eine Kontrolle vor der nordafrikanische Küste solle Flüchtlingsboote frühzeitig abfangen.
Im vielem war Melonis Regierungserklärung eine politische Standardrede. Kampf gegen die Mafia, Förderung des Südens, aufrecht gegen Brüssel. Und sie glich in vielen Punkten jenen ihres jetzigen Bündnispartners Silvio Berlusconi vor zehn Jahren.
Was solche Ankündigungen wert sind und wie diese Regierung wirklich tickt, wird sich erst in der Praxis weisen. Beispielsweise, wenn es um Minderheitenrechte oder Abtreibung geht. So viel Geduld muss, so viel Skepsis darf man haben. Schreibt SRF.
Ich habe mir die Rede mit deutscher Übersetzung im Replay vom Anfang bis zum Ende angehört. Und war erstaunt, über die unaufgeregte Sachlichkeit der Ankündigungen durch die «Neo-Faschistin», wie Meloni in den Medien häufig bezeichnet wird. Ob zu Recht oder zu Unrecht kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls kam sie gestern nicht erkennbar als solche daher.
Was Italiens neue Premierministerin beispielsweise zur Flüchtlingsproblematik inklusive einigen (sinnvollen) Vorschlägen verkündete, hätte ebenso gut von unserer Bundesrätin Keller-Sutter vom EJPD stammen können, wenn man deren letzte Pressekonferenzen als Vergleich zu Melonis gestrigen Aussagen nimmt. Dass die Chefin des Schweizer EJPD keine Faschistin ist, dürfte ja wohl unbestritten sein.
Doch wie SRF absolut richtig schreibt: Was Melonis Ankündigungen wert sind und wie diese Regierung wirklich tickt, wird sich erst in der Praxis weisen. Bezüglich theoretischen Ankündigungen im Zusammenhang mit der Migration sind wir Schweizer*innen ja eher gebrannte Kinder. Den hehren Ankündigungen von Keller-Sutter folgten bisher jedenfalls keine nennenswerten Taten, die nicht per Gesetz ohnehin vorgeschrieben sind und trotzdem nicht praktiziert werden.
Der Ausreden dafür gibt es viele. War es in den vergangen Jahren die Coronapandemie, ist es heute der Ukraine-Krieg.
-
25.10.2022 - Tag der Glücksspieler in China
Experte rät Investoren zu Exit-Plänen: Xis Macht macht China gefährlich
Am Parteitag haben die Kommunisten ihrem Vorsitzenden Xi Jinping noch mehr Macht zugeschanzt. Kein gutes Omen, meint China-Experte Ralph Weber. Er warnt vor einem Angriff auf Taiwan und rät ausländischen Investoren, eine Exit-Strategie vorzubereiten.
Nach dem Parteitag der Kommunisten steht fest: Präsident Xi Jinping (69) konnte seine Macht innerhalb der Partei weiter ausbauen und dürfte im Frühling zum dritten Mal zum Staatspräsidenten gewählt werden. Im siebenköpfigen ständigen Parteiausschuss, dem mächtigsten Parteigremium des Landes, hat Xi die letzten Parteifunktionäre entfernt, die nicht auf seiner Linie lagen.
Welche Folgen haben die Entscheidungen der Partei? Mit der Bestätigung als Vorsitzender dürfte einer Herrschaft Xis auf Lebzeiten praktisch nichts mehr im Wege stehen. Somit dürfte auch «die autoritäre Schliessung der Volksrepublik China weitergehen», meint China-Experte Ralph Weber (47) von der Uni Basel.
Verfolgung von Minderheiten, Ausbau der Kontrolle der eigenen Bürgerinnen und Bürger: «Die totalitären Tendenzen mit dem Eingriff des Parteistaates in alle Lebensbereiche scheinen sich zu verfestigen», sagt Weber.
«Eskalation jederzeit möglich»
Auch für Taiwan könnte es definitiv ungemütlich werden. Weber: «Ein Angriff auf Taiwan steht zwar kaum direkt bevor, ein solches Szenario dürfte aber in den kommenden Jahren immer wahrscheinlicher werden.» Je nach der weiteren globalen Entwicklung sei eine überraschende Eskalation jederzeit möglich.
Mit der Zementierung von Xis Macht werde auch die Zusammenarbeit mit Peking heikler. «Die Diskussionen über das Verhältnis Europas zu China werden weitergehen und eine zusätzliche Polemisierung erfahren. Es wird für zahlreiche Akteure noch komplizierter werden, einfach in gewohnten Bahnen mit Akteuren in China weiter zu kooperieren.»
Das zeige etwa der kritisierte geplante Besuch des deutschen Kanzlers Olaf Scholz (64) mit einer Wirtschaftsdelegation in Peking. Solche Handlungen würden viel genauer beobachtet. Weber: «Man muss also gute Gründe liefern können, warum man weiterhin die Kooperation mit einem solchen Regime sucht.»
Für ausländische Investoren werde die Lage nun unsicherer. «Xi Jinping hat im politischen Bericht am Parteikongress deutlich gemacht, dass man zwar weiterhin global handeln und Investitionen anziehen möchte, der Schwerpunkt aber immer mehr auf den heimischen Markt gelegt werden soll», sagt Ralph Weber. «Für das Weiterführen von Wirtschaftsbeziehungen braucht es gute politische Analysen – aber wohl zunehmend auch klare Exit-Strategien.»
Neuer Umgang gefragt
Als Konsequenz aus dem Ausbau der Machtstellung hat der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (50), einen Kurswechsel der EU gegenüber China gefordert. «China verändert sein Gesicht», sagte der Deutsche. Die EU müsse sich darauf einstellen und «ihre Naivität ablegen». Die EU-Staaten dürften ihre Rohstoffabhängigkeit von China nicht weiter erhöhen, sondern müssten neue Partner finden, forderte Weber.
Auch Ralph Weber ist davon überzeugt, dass es im Westen eine Diskussion über einen neuen Umgang mit Peking brauche. Weber: «Diese Diskussion muss mit möglichst sachlicher Information und im Bewusstsein der grundlegenden politischen Differenzen zum chinesischen Parteistaat irgendwo zwischen der Dämonisierung und Romantisierung Chinas erfolgen.» Schreibt Blick.
Erich Maria Remarque leicht abgewandelt zitierend könnte man sagen: Im Osten nichts Neues. Denn dass der Westen gegenüber China in der über Jahrzehnte hinweg selbst geschaffenen Abhängigkeitsfalle gelandet ist, dürfte spätestens nach der Coronakrise bekannt sein.
Dass der China-Experte Ralph Weber den sonst mit allen Wassern gewaschenen Investoren allerdings eine Exit-Strategie empfehlen muss, erstaunt einen. Beinhaltet doch jeder Studiengang in Betriebsökonomie das Thema der Exit-Strategie. Man darf also annehmen, dass die Investoren, die in China ihr Glück versuchen, sehr wohl wissen, dass am Ende jedes Businessplans die Exit-Strategie steht.
Doch die Gier hindert die Glücksspieler, das alte Naturgesetz «wo immer man reingeht, muss man wissen, wie man wieder rauskommt» zu befolgen. Letztlich ist die ewige Gier nach dem nie versiegenden und stetig grösser werdendem Stück vom Kuchen auch nur ein in der menschlichen DNA verankertes Naturgesetz. Selbst wenn der österreichische Bundespräsident Van der Bellen jetzt sagen würde «So sind wir nicht» sind wir eben so.
-
24.10.2022 - Tag der Marketingregeln
Luzerner Initiative trotz Regierungs-Nein: Stimmrechtsalter 16 – Kampf geht trotz Gegenwind weiter
Die Kantone Zürich und Bern sagen nein und in Luzern kommt es gar nicht erst zur Abstimmung. Das Stimmrechtsalter 16 fährt hüben wie drüben Klatschen ein. Die Jungparteien hinter der Luzerner Initiative sind trotzdem überzeugt, dass die Zeit reif ist.
Ein Thema, das immer wieder zurückkommt, wie Neon-Farben in der Modewelt: das Stimmrechtsalter 16. Um die 2010er Jahre hat es in verschiedenen Kantonen erste Bestrebungen gegeben, das Mindestalter für Abstimmungen auf 16 Jahre zu senken. Umgesetzt worden ist es lediglich im Kanton Glarus, der bis heute der einzige Schweizer Kanton mit dieser Regelung ist.
Gut zehn Jahre später kommt die Senkung des Mindestalters für politische Mitbestimmung erneut aufs Tapet. Die Basler Grüne-Nationalrätin Sibel Arslan reichte 2019 eine parlamentarische Initiative ein, die forderte, das aktive Stimmrecht auf 16 Jahre zu senken. Damit löste sie eine Kaskade von kantonalen Vorstössen aus, unter anderem in Luzern.
Mit 61 zu 58 Stimmen versenkte der Luzerner Kantonsrat im vergangenen Dezember äusserst knapp die Initiative von Junge Grüne-Kantonsrat Samuel Zbinden (zentralplus berichtete). Deshalb ist der Entscheid auch nicht vors Volk gekommen. Mit einer neuen Initiative versuchen vier Luzerner Jungparteien, das Stimmrechtsalter 16 trotzdem noch an die Urne zu bringen (zentralplus berichtete).
Für Stimmrechtsalter 16 weht ein rauer Wind
Doch würde eine Volksabstimmung tatsächlich ein anderes Resultat hervorbringen als der Parlamentsentscheid? Ein Blick auf jüngste Abstimmungen der umliegenden Kantone attestieren dem Vorhaben keine gute Karten. Obwohl das Berner Parlament die entsprechende Motion angenommen hat, hat die Bevölkerung die Vorlage mit 67 Prozent Nein-Stimmen bachab geschickt. Im Kanton Zürich gab es trotz Empfehlung der Regierung ein Nein mit 64 Prozent.
Zwar hat sich die Vorlage von Sibel Arslan im Nationalrat knapp durchgesetzt. Mit 99 zu 90 Stimmen hat die grosse Kammer entschieden, dass die Staatspolitische Kommission eine entsprechende Vorlage ausarbeiten soll. Wird diese von beiden Kammern angenommen, kommt die Vorlage vor das Volk. Doch im Rahmen der Vernehmlassung zur Gesetzesrevision kündigt sich bereits Widerstand an. So etwa vom Kanton Luzern.
Jungfreisinnige und Junge SVP sind dagegen
Dagegen sind auch die beiden Jungparteien, die sich nicht an der Initiative beteiligen: die Jungfreisinnigen und die Junge SVP. So räumt JSVP-Co-Präsident Lucian Schneider dem Vorstoss auf Anfrage keine Chance ein.
Für die junge SVP müsse das Stimmrechtsalter zwingend mit der Handlungsfähigkeit gekoppelt sein. «Ausserdem ist es völlig willkürlich, das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre herabzusetzen.» Politisch interessierte 16-Jährige könnten sich bereits heute etwa mit der Mitgliedschaft in einer Jungpartei oder der Mithilfe bei Volksinitiativen ins politische Geschehen einbringen.
Ins gleiche Horn bläst der Präsident der Jungfreisinnigen, Thomas von Allmen: «Mit 16 Jahren über Steuererhöhungen zu entscheiden, ohne selber Steuern zu bezahlen, ist absurd.» Zudem entstünde ein Flickenteppich, wenn 16-Jährige zwar Amtsträger wählen, sich aber nicht selbst zur Wahl stellen dürfen.
Das entscheidende Kriterium für das Stimmrechtsalter sei jedoch politische Reife. «Damit soll den unter 18-Jährigen keinesfalls unterstellt werden, dass sie sich keine Meinung zu einer komplexen Abstimmungsvorlage bilden können», räumt von Allmen ein. Die heutigen Möglichkeiten für 16-Jährige, sich politisch einzubringen, würden jedoch genügen.
Trotz Ablehnung: Zustimmung nimmt zu
Die Befürworter lassen sich von all der Ablehnung nicht ins Bockshorn jagen. So meint etwa Beda Lengwiler, der für die Junge Mitte im Initiativ-Komitee sitzt, auf Anfrage: «Wir sind zuversichtlich, dass das Stimmrechtsalter bald in einzelnen Kantonen und schlussendlich auch national umgesetzt wird. Wir lassen uns von diesem kleinen Rückschlag nicht aufhalten.»
Seiner Meinung nach sei die Bevölkerung zu diesem Thema noch zu wenig sensibilisiert worden. Doch das Interesse der 16- und 17-Jährigen an der Politik habe zugenommen. «Wir möchten unsere Demokratie denjenigen öffnen, welche sich für die Themen interessieren und sich auch in Jungparteien und ähnlichem einsetzen.»
Auch Zoé Stehlin, Co-Präsidentin der Juso, beteuert: «Es kann der jungen Generation weder Desinteresse an der Politik noch mangelnde Reflexion vorgeworfen werden.» Dies zeige sich etwa in den vielen Jugendbewegungen wie dem Klimastreik oder feministischen Kollektiven. Die Parlamente hätten sich in den letzten Jahren ebenso verjüngt.
Die Juso ist daher überzeugt: «Die Zeit ist mehr als reif!» Zwar sei das Anliegen mehrmals abgelehnt worden. Doch: «Die Zustimmungswerte haben tendenziell laufend zugenommen, so zuletzt im Luzerner Kantonsrat, wo das Anliegen nur knapp scheiterte.»
Junge Grüne sehen Parallelen zum Frauenstimmrecht
Junge Grüne Co-Präsidentin Alina Wiget vergleicht die Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16 mit dem Frauenstimmrecht. Beide Reformen hätten eine zentrale Aufweitung der Demokratie zum Ziel. Auch der steinige Weg bis zur Annahme sei ähnlich: «Bereits beim Stimm- und Wahlrecht für Frauen, wie auch beim Stimm- und Wahlrecht ab 18 brauchte es einen Prozess, bis die Änderung Tatsache wurde.»
Nebst der Einführung des Stimmrechtsalter 16 werde etwa ein deutlicher Ausbau der politischen Bildung in der Schule vonnöten, damit Junge an politischen Entscheidungen mitwirken können. Denn: «Gerade junge Menschen sind besonders betroffen von Abstimmungen und Wahlen, da es sie am längsten betreffen wird.»
Stimmrecht für gut 130'000 Personen
Das Initiativ-Komitee hat nun noch bis im April 2023 Zeit, 5000 Unterschriften für ihre Initiative zu sammeln. Die Vernehmlassungsfrist für die Gesetzesänderung auf nationaler Ebene dauert noch bis zum 16. Dezember.
Mit der Initiative auf nationaler Ebene würden gemäss aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik gut 130'000 Jugendliche ein Stimmrecht erhalten. Davon würde jedoch nur ein Bruchteil auch tatsächlich von seinem Recht Gebrauch machen.
In einer Auswertung zur politischen Partizipation 16- und 17-Jähriger aus dem Kanton Glarus, attestiert das Zentrum für Demokratie Aargau den Jugendlichen unterdurchschnittliches politisches Interesse. Da jedoch nur 30 Personen befragt worden sind, sind diese Resultate mit Vorsicht zu betrachten. Zumal auch die Studienleiter anmerken, dass es auch in dieser Altersgruppe «viele Menschen gibt, die stärker politisch involviert sind und ihr Recht zur politischen Partizipation rege nutzen.» Hinweis: Von den Jungen Grünliberalen ist bis Erscheinen des Artikels keine Stellungnahme eingetroffen. Schreibt ZentralPlus.
Frei nach dem Klappentext vom Buch «Die kindliche Gesellschaft» von Robert Bly (veröffentlicht 1996) «ist unsere heutige Gesellschaft geprägt von der Weigerung des einzelnen, erwachsen zu werden. Politisches Bewusstsein, soziales Engagement, die Auseinandersetzung mit den eigenen kulturellen Wurzeln werden mehr und mehr zugunsten von schnellem Erfolg, Geld, Spass und Entertainment aufgegeben.»
Dem ist nur wenig hinzuzufügen. Bly's Thesen aus dem letzten Jahrhundert bestätigen sich auf «kindlichen» Social Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram, wo sich inzwischen das Politmarketing und seine Vertreter*innen mit kindlichen – um nicht zu sagen kindischen – Shortbeiträgen neben Influencern, Weltverschwörern*innen, esoterischen Vogelscheuchen, Rauschgiftdealern, sexverrückten Posern*innen, Netflix-Geschädigten und sonstigen Dumpfbacken tummelt.
Dass eine Umfrage mit 30 Personen kein verwertbares Bild über das politische Interesse Jugendlicher abgibt, ist so klar, dass man eine derartige Umfrage weder durchführen noch erwähnen müsste. Ein Blick auf die Statistik der Beteiligungen der Jungwähler*innen an den Schweizer Wahlen der letzten 20 Jahre hätte genügt: Egal, ob regional oder national, ergibt sich nicht nur ein ernüchterndes Resultat, sondern ein erschreckendes.
Doch was macht unser Bundesrat? Aus Verzweiflung über den unaufhaltsamen Rückgang der schweizerischen Wahlbeteiligung eröffnen die magistralen Zombies mit zehn Stellen (!) tatsächlich einen Account für Shortmessages und «kindliche» Videos bei Instagram, um die politischen Botschaften in die Kinderwagen und psychiatrischen Notfallkliniken der Nation zu tragen.
Man darf sich wirklich fragen, warum die Marketingexperten vom Bund eine der ältesten Marketingregeln nicht kennen. Die besagt nämlich, dass lächerliche Anbiederung durch wesentlich ältere Personen beim jungen Publikum in der Regel nicht gut ankommt. Da helfen selbst Slim Fit-Anzüge, poppige Frisuren und die Übernahme oder Annektierung von «geilen» Worthülsen nicht weiter. Politik und Red Bull sind nun mal verschiedene Welten.
Nicht alles ist «cool» und «easy», nur weil es cool und easy tönt. Es kommt schon noch darauf an, wer es sagt. Sind es die falschen «Rattenfänger von Hameln» ist ein «Fuck you» oder ein «cringe» wahrscheinlicher als ein «mega fly cool».
Oder wie Napoleon es formulierte: «Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt.»
-
23.10.2022 - Tag der verschmähten Wurst
Imbissstand auf Mallorca verwaist: Niemand hat Bock auf Melanie Müllers Wurst
Nicht nur ihre Showkarriere leidet nach den Nazi-Vowürfen die gegen sie erhoben werden: Auch ihr Wurst-Business auf Mallorca steht vor dem Abgrund.
Bei einem ihrer Konzerte sorgte Schlager-Star Melanie Müller (34) für einen Skandal: Auf einem Video ist zu sehen, wie die Deutsche ihren rechten Arm zum Hitler-Gruss hebt. Zudem soll sie mit den Konzert-Besucherinnen und -Besuchern Nazi-Parolen gegrölt haben. In der Folge durchsuchte die Polizei bei einer Razzia ihr Haus. Müller bestreitet, etwas mit dem rechtsextremen Gedankengut am Hut zu haben.
Nachdem sich bereits viele ihrer Fans von ihrer Musik abgewandt haben, scheint nun auch Müllers zweites Standbein unter den Vorwürfen zu leiden: Ihre Grillbuden namens «Grillmüller» auf der Balearen-Insel Mallorca bleiben leer.
Zwei Wurstbuden betreibt die Ostdeutsche in der Sonne Spaniens – zumindest ein Standort ist komplett verwaist, wie die deutsche «Bild» schreibt. Obwohl sich der Imbissstand am Bulevar de Peguera im Örtchen Peguera ansonsten nicht über mangelnde Kundschaft beklagen könne, hätten ihr wohl auch hier ihre treuen Fans den Rücken gekehrt, urteilt die Zeitung.
Leere Stühle
Mallorca erfreut sich in den Herbstmonaten noch einmal an einem stetigen Touristen-Strom. Doch «Grillmüller» bleibt leer. Niemand wolle die Würste der «Dschungelcamp»-Teilnehmerin, niemand sitzt auf den Stühlen vor dem Lokal. Die Bude sieht aus, als ob sie geöffnet hätte, doch hinter dem Tresen steht niemand, der die Gäste bedienen könnte, so die «Bild».
Die Zeitung will ausserdem erfahren haben, dass dieser Zustand schon länger anhalte – unabhängig von der Tageszeit. Alle Entschuldigungs- und Erklärungsversuche seitens der Schlagersängerin scheinen bei ihren (ehemaligen) Fans nicht auf offene Ohren gestossen zu sein.
Müller hatte dabei unter anderem ihren Ex-Mann Mike Blümer (55) angeschwärzt. Sie vermutet eine gezielte Schmutzkampagne. Ausserdem wolle er den gemeinsamen Kindern schaden, behauptete sie weiter. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichnen gegen Müller. Schreibt Blick.
Das Mitleid um das Drama mit Melanie Müllers verschmähter Wurst, die niemand mehr haben will, hält sich in Grenzen. Millionen von Senioren leiden unter dem gleichen Schicksal, ohne je im Blick erwähnt zu werden.
-
22.10.2022 - Tag der Energiemangellage
Benjamin Scheidegger (42) kriegt in Flumenthal SO kein Auge zu: «Die Laterne macht unser Schlafzimmer taghell!»
Ein Kandelaber erhitzt die Gemüter: Die neue LED-Strassenlaterne bestrahlt die Doppelhaushälfte von Benjamin Scheidegger und raubt ihm den Schlaf. Für eine Lösung des Problems muss er selbst sorgen – die Gemeinde winkt ab.
Draussen ist es stockfinster. Doch die Doppelhaushälfte von Benjamin Scheidegger (42) kann man nicht verfehlen, die weisse Fassade wird durch eine LED-Strassenlaterne hell erleuchtet. «So beleuchtet man eine Kirche, aber kein Haus», meint er kopfschüttelnd.
Er zeigt auf seine Terrasse, die ebenfalls im Schein der Lampe erstrahlt: «Wenn wir jetzt abends in den Whirlpool sitzen, sind wir hell beleuchtet. Sehr romantisch.» Er geht die Treppe hoch und öffnet die Tür zum Balkon. Er setzt sich auf den Stuhl und kneift die Augen zusammen, denn von da aus strahlt ihm die neue Lampe direkt ins Gesicht. «Gemütlich ist das so nicht mehr», sagt der Hausherr.
«Im Schlafzimmer ist es taghell!»
Das Problem besteht erst seit letztem Sommer. Damals wurde der Asphalt auf dem Strassenabschnitt saniert und im gleichen Zug auch der stromsparende LED-Kandelaber installiert. Dagegen hat der Software-Applikationstechniker grundsätzlich nichts einzuwenden, auch gegen die ausreichende Beleuchtung der Kreuzung zugunsten der Verkehrssicherheit nicht. «Aber die neue Laterne strahlt so sehr, dass es in unserem Schlafzimmer taghell ist!»
Da die Freundin des Solothurners im Schichtbetrieb arbeitet, nütze es auch nichts, dass die Leuchte werktags um 1 Uhr ausgeschaltet werde. «Manchmal muss sie sehr früh ins Bett und dann brennt die Laterne durchgehend. Und durch die Storen scheint das Licht halt hindurch», führt er aus. «Natürlich könnten wir irgendwelche Nachtvorhänge anbringen oder sonst eine Lösung suchen. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass der Verursacher des Problems dieses auch lösen muss.»
Verursacher ist in diesem Fall die Gemeinde, welche die Strassensanierung und die Erneuerung der Beleuchtung in Auftrag gegeben hat. Doch diese will laut Scheidegger nichts von der Problematik wissen, auch gegenüber Blick nimmt die Behörde auf Anfrage nicht Stellung. Zwar habe sie nach Scheideggers hartnäckigem Intervenieren diverse Lösungsansätze wie beispielsweise das Versetzen des Kandelabers abgeklärt, aber das Ergebnis dieser Abklärungen sei ernüchternd gewesen – und hat den Eigentümer putzhässig gemacht.
«Man hat mir schliesslich gesagt, dass man etwa eine Blende von der BKW an die Leuchte montieren könnte. Die würde jedoch 170 Franken kosten und das müsste ich selbst bezahlen. Ausserdem müsste ich auch die Montage selbst organisieren», meint er entnervt. Dass er als Geschädigter selber zahlen soll, sieht er nicht ein.
Zwar seien 170 Franken nicht die Welt, aber: «Es geht ums Prinzip!» Scheidegger will daher weiter für Gerechtigkeit kämpfen – und auf keinen Fall den Batzen aus dem eigenen Sack zahlen. Schreibt Blick.
Um diese Sorge würden wohl viele den guten Benjamin beneiden. In Zeiten der Energiemangellage und explodierender Strompreise kostenlos Licht konsumieren wenn es notwendig ist und vor dem Einschlafen Rollläden runterlassen oder Vorhänge ziehen. Problem gelöst. That's it!
Studieren geht vor Querulieren, lieber Benjamin. Life can be so simple.
-
21.10.2022 - Tag der besorgniserregenden Übergewinne
Pfizer will Preis für Corona-Impfstoff massiv erhöhen
Das Pharmaunternehmen Pfizer will den Preis für seinen Corona-Impfstoff kräftig erhöhen. Wie Geschäftsführerin Angela Lukin am Donnerstag mitteilte, erwägt das Unternehmen, die Kosten auf 110 bis 130 Dollar (132,95 Euro) pro Dosis anzuheben. Der aktuelle Kaufvertrag mit der US-Regierung laufe demnächst aus, so Lukin. Die US-Regierung zahlt derzeit etwa 30 Dollar pro Dosis an Pfizer und seinen deutschen Partner Biontech.
Es wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2023 nach dem Auslaufen des staatlichen Gesundheitsnotstands in den USA auf private Versicherungen übergehen wird. Bisher ist nicht klar, in welcher Form Menschen ohne Krankenversicherung dann Zugang zu dem Vakzin haben werden.
Gesunkene Nachfrage
Die angestrebte Preiserhöhung hat auch mit der jüngst massiv zurückgegangenen Nachfrage nach Corona-Impfungen zu tun. Pfizer rechnet damit, dass der Markt für Corona-Impfungen künftig in etwa so groß sein wird wie jener für die jährlichen Grippe-Impfungen. Rund 14,8 Millionen Menschen in den USA haben in den vergangenen sechs Wochen eine Impfung mit dem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff erhalten. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum mehr als 22 Millionen Menschen, obwohl damals nur ältere Personen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem für die Drittimpfung zugelassen waren.
Biontech und Pfizer hatten ihren Impfstoff ursprünglich zu einem Preis von 15 bis 30 Euro angeboten. Medienberichten zufolge zahlte die EU im Vorjahr einen Stückpreis von 20 Euro im Rahmen eines Vertrags für den Ankauf von bis zu 1,8 Milliarden Dosen bis zum Jahr 2023. Schreibt DER STANDARD.
Dass sich bei gesunkener Nachfrage die Preise erhöhen müssen, steht zwar so nicht im sakrosankten Wirtschaftsevangelium der HSG geschrieben. Eigentlich müsste bei sinkender Nachfrage das Gegenteil eintreffen, wie uns die Millionen von Inflationsexperten derzeit beinahe täglich wissen lassen. Aber die Pharmabranche hat ihre eigene Wirtschaftsbibel.
Die Pharmariesen zählten dank der Corona-Impfung zu den ganz grossen Gewinnern der Corona-Pandemie. Nicht nur die Gewinne der Pharmafirmen stiegen in unermessliche Höhen, sondern auch ihre Börsennotierungen. Beides zusammengerechnet, reden wir nicht mehr von Milliarden, sondern beinahe schon von Billionen.
So stieg der Kurswert der erst seit 2019 an der Börse gehandelten BioNTech zwischenzeitlich laut Statista auf rund 80 Milliarden Euro. Oder anders ausgedrückt: Von unter zehn Cent im Jahr 2019 auf sagenhafte (ca.) 39,63 Euro pro Aktie. Das Gründerpaar Özlem Türeci und Uğur Şahin zählt nun zu den reichsten Deutschen.
Aber nicht nur die Corona-Impfungen, die mich und Abermillionen anderer Menschen trotz Impfung nicht vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen konnten, reissen besorgniserregende Defizitlöcher in die Staatshaushalte, sondern auch die derzeitige Energiekrise.
Doch während viele Politiker*innen bei den exorbitanten Gewinnen der Energiebranche von «Übergewinnen» sprechen, die für den Staatshaushalt abgeschöpft werden sollen und bereits teilweise entsprechende Massnahmen in Gang setzen, die bis jetzt zwar alle ins Leere laufen, bleibt die Pharmabranche als «Kriegsgewinnler» unangetastet.
Letzten Endes sind aber die Milliardengewinne der Pharmabranche, die dank der Corona-Pandemie erzielt wurden, auch nichts anderes als «Übergewinne». Und dies erst noch mit einem Produkt, dessen tatsächlicher Nutzen für die Gesellschaft im Gegensatz zu Heizöl und Gas nicht mit letzter Sicherheit bewiesen ist. Eben sowenig wie mögliche Langzeitschäden.
Was sagt uns das? Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Die Pharmabranche ist nicht umsonst die im Gleichklang mit der WHO am besten mit der Politik vernetzte Branche der Welt.
Die höchsten Werbeausgaben auf unserem Erdball, die inzwischen schwindelerregende Höhen erreicht haben, zeigen Wirkung. Kommende Generationen werden bei der Bewältigung der astronomischen Staatsschulden vermutlich ein vernichtendes Urteil über die derzeitige Polit-Elite fällen.
-
20.10.2022 - Tag der schwulen Polit-Eliten
Hans-Ueli Vogt kandidiert für den Bundesrat: Zürcher Coup macht SVP-Rennen spannend
Mit ihm hatte keiner gerechnet: Hans-Ueli Vogt (52) hatte sich bereits aus Bundesbern zurückgezogen. Mit Unterstützung der SVP Zürich will der einstige Nationalrat nun aber in die Landesregierung. Er gilt als ernsthafter Kandidat.Hans-Ueli Vogt kandidiert für den Bundesrat
Zürcher Coup macht SVP-Rennen spannend
Mit ihm hatte keiner gerechnet: Hans-Ueli Vogt (52) hatte sich bereits aus Bundesbern zurückgezogen. Mit Unterstützung der SVP Zürich will der einstige Nationalrat nun aber in die Landesregierung. Er gilt als ernsthafter Kandidat.
Niemand hatte ihn auf der Rechnung. Hans-Ueli Vogt (52) verabschiedete sich vergangenes Jahr aus dem Nationalrat. Nun kehrt er zurück auf die Polit-Bühne – und wie: Der Rechtsprofessor der Uni Zürich will Bundesrat werden! Am Mittwoch, zwei Tage vor Ablauf der Meldefrist, gab die Zürcher SVP die Kandidatur bekannt.
Der Kantonalpartei gelingt damit ein Überraschungscoup. Nach der Rücktrittsankündigung von Ueli Maurer (71) war das Feld potenzieller Kandidierender aus Zürich von Tag zu Tag kleiner geworden. Regierungsrätin Natalie Rickli (45) wollte nicht. Die Nationalräte Gregor Rutz (50) und Thomas Matter (56) sagten ab, ebenso wie die meisten andern Zürcher Vertreter im Nationalrat.
Zürich schon aufgegeben
In der Partei schwand langsam, aber sicher der Glaube, noch einen ernst zu nehmenden Kandidaten auftreiben zu können, um den Zürcher Bundesratssitz zu verteidigen – ausgerechnet die Sektion, die der SVP Schweiz jahrelang den Stempel aufgedrückt hat. Prominente Mitglieder fürchteten schon eine Alibi-Kandidatur, mit der sich die Zürcher SVP der Peinlichkeit preisgibt. Mehrfach wurde kritisiert, dass es die Partei in den vergangenen Jahren verpasst habe, mehrheitsfähige und willige Kandidatinnen und Kandidaten aufzubauen.
Doch mit dem Hervorzaubern von Vogt hat die Zürcher SVP gerade noch die Kurve gekriegt. Der ehemalige Nationalrat ist der erste ernsthafte Konkurrent für Kronfavorit Albert Rösti (55) aus dem Kanton Bern. Das Rennen um den Regierungsposten, das für viele Beobachter schon gelaufen schien, ist damit wieder spannender geworden.
Die Eigenen mögen ihn nicht
«Das ist ein geschickter Schachzug: Vogt ist sicher keine Alibi-Kandidatur», kommentieren andere Bürgerliche im Bundesparlament. «Die Zürcher SVP kann froh sein, dass sie noch jemanden gefunden hat. Vogt hilft ihr, einigermassen gesichtswahrend rauszukommen», so einer.
Allerdings werden Vogts Wahlchancen infrage gestellt. Die grösste Hürde könnte für ihn die eigene Bundeshausfraktion sein. Dort sei er wenig verankert, sagt ein anderes Parlamentsmitglied. «Seine Fraktion mag ihn einfach nicht», drückt das eine weitere Person aus.
Denn Vogt ist nicht nur einmal vom offiziellen SVP-Kurs abgewichen, ein Beispiel ist die Konzernverantwortungs-Initiative, bei der er sich gegen den Willen der Partei für einen Gegenvorschlag starkgemacht hatte. Zudem sass der Zürcher, selbst schwul, im Ja-Komitee zur Ehe für alle, die die Mehrheit der SVP ablehnte. «Er ist immer wieder weit weg von seiner eigenen Partei», urteilt ein Bürgerlicher.
Kandidat mit Schönheitsfehler
Doch selbst wenn es Vogt neben Favorit Rösti aufs SVP-Ticket schafft, bleibt es schwierig. Als «Schönheitsfehler» bezeichnet es etwa FDP-Nationalrätin Christa Markwalder (47), dass Vogt nicht mehr im Bundeshaus politisiert. «Wäre er noch im Nationalrat, wäre die Ausgangslage eine andere.»
Allerdings hat sich Vogt erst Ende 2021 aus Bern verabschiedet, sodass er keineswegs bereits in Vergessenheit geraten ist. Insbesondere in der Kommissionsarbeit hat er viele beeindruckt. Da wurde er als «eigenständig und konstruktiv» wahrgenommen, so ein SP-Politiker. Einer, der auch zuhören könne und zu Kompromissen bereit gewesen sei. Ähnlich sieht es Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan (42): «Hans-Ueli Vogt hat mehr als einmal bewiesen, dass er bereit ist, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.»
Blochers Bedeutungsverlust
Immer wieder wird Vogts Intellekt herausgestrichen. Er sei allerdings mehr Experte als Politiker, ist zu hören. «Ihm fehlt die politische Gravität», urteilt einer. «Vielleicht wird es Vogt aufs SVP-Ticket schaffen – er wird aber kein Gamechanger sein», so der Bürgerliche. Favorit ist und bleibt Rösti, da sind sich viele Parlamentarier einig: «Wenn er es aufs Ticket schafft, ist er gewählt.»
Aufs offizielle SVP-Ticket könnten es Vogt wie Rösti schaffen. Über ein solches «Softie-Ticket» würde sich nicht nur das linke Lager freuen. Sogar bei FDP und Mitte reibt man sich die Hände. Schickt die SVP nämlich keinen echten Hardliner ins Rennen, deute diese auf einen «weiteren Machtverlust von Herrliberg hin», analysiert ein Bürgerlicher. «Blocher und Co. scheinen bei der Kandidatenfindung praktisch keine Rolle mehr zu spielen.» Schreibt Blick.
Ein Journalist stellte Vogt bei der Pressekonferenz die Frage, ob die Schweiz für den ersten schwulen Bundesrat bereit sei. Worauf die Zürcher SVP-Politikerin und ehemalige Regierungsrätin des Kantons Zürich, Rita Fuhrer, dem Journalisten wie aus der Pistole geschossen die Gegegenfrage stellte, ob er diese Frage auch einem linken Politiker oder den Stadträten in Zürich gestellt habe.
Als ob es schwule oder lesbische Politker*innen nur bei den Linken geben würde und bei den bürgerlichen Parteien maximal eine Ausnahmeerscheinung wäre. Das eher peinliche Frage- und Antwortspiel wird als Steilvorlage für Comedians in die Geschichte eingehen.
Der guten Frau Fuhrer scheint zudem nicht bekannt zu sein, dass ihre SVP mit «GaySVP» eine erfolgreiche schwul/lesbische Webseite betreibt.
Aber auch der Journalist hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Bei einer Wahl von Vogt zum Bundesrat müsste er nicht zwangsweise der «erste schwule Bundesrat» der Schweiz sein. Es könnte in der Vergangenheit sehr wohl einen schwulen Bundesrat gegeben haben.
Ältere Semester erinnern sich noch an die damals im Boulevard zirkulierenden Gerüchte um den Winterthurer FDP-Bundesrat Rudolf Friedrich (1982 - 1984).
Ob da was dran war müsste man vielleicht seinen Schützling und jetzigen FDP-Ständerat Damian Müller fragen, der ja mit ähnlichen Gerüchten um seine Sexualität konfrontiert ist. Müllers proaktive Verteidigungsstrategie und die damit zusammenhängenden skurrilen, aus der Zeit gefallenen Botschaften aus dem Wahlkampf 2019 bleiben unvergessen.
Was sagen uns diese niveaulosenPolit- und Medien-Possen? Es könnte nicht nur bei der Bundesratswahl schmutzig werden, sondern auch bei den kommenden National- und Ständeratswahlen 2023. Auf diesem intellektuellen Level sind jedenfalls alle Ingredienzen dafür vorhanden. Wetten, dass...?
-
19.10.2022 - Tag der dummen Headlines zum Wohle des Clickbaitings
Kamikaze-Drohnen sind militärisch nutzlos – aber trotzdem wirksam
Russland feuert iranische Kamikaze-Drohnen auf die Ukraine ab. Sie sind billig, aber tödlich. Der Kreml setzt sie als Terrorwaffe ein.
Die Bezeichnung Kamikaze-Drohne ist irreführend. Anders als bei Japans Fliegerangriffen im Zweiten Weltkrieg lässt kein Pilot sein Leben. Denn es sitzt bei dieser Drohne gar niemand an Bord. Vernichtet wird am Ende hingegen die Waffe selber.
«Es handelt sich um Einwegdrohnen», sagt Dominika Kunertova, Drohnenexpertin beim ETH-Zentrum für Sicherheitsstudien: «Die von Russland abgefeuerten iranischen Shahed-136-Drohnen sind weder manövrierbar noch präzis.»
Billige Gefahr in Schwärmen
Doch weil die Drohnen pro Stück bloss um die 20'000 Schweizer Franken kosten, kann Moskau sie massenhaft einsetzen. Oft gleich in tieffliegenden Schwärmen – also mehrere Drohnen visieren gleichzeitig dasselbe Ziel an. «Das ukrainische Abwehrsystem wird so ausgetrickst und überfordert. Dennoch fangen Kiews Streitkräfte an guten Tagen manche ab.», so Kunertova.
Dies bedeutet aber zugleich: Viele Drohnen gelangen ans Ziel. Diese sind selten militärische. Dafür ist die Drohne zu wenig effizient; man gewinnt mit ihnen keine Schlacht. Doch sie genügen, um Zivilpersonen zu töten und Infrastruktur zu zerstören: Wohnhäuser, Spitäler, Schulen, Strassen, Schienen. Zwar sind sie mit maximal 180 km/h recht langsam. Aber die Reichweite von 2500 Kilometern erlaubt den Drohnen problemlos, jede ukrainische Stadt zu attackieren.
Russland setzt auf Terror
Russland feuerte in den acht Monaten Krieg gegen die Ukraine bereits einen beträchtlichen Teil seiner Raketen ab. Vermutet wird etwa die Hälfte. Deshalb weicht man nun zum Teil auf Drohnenangriffe aus.
Die russische Drohnenproduktion jedoch kam weitgehend zum Erliegen. Wegen der westlichen Sanktionen fehlen wichtige Bestandteile. Das Putin-Regime setzt deshalb schlichte iranische Drohnen als Terrorwaffe ein, um die ukrainische Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. 2400 Shahed-Drohnen hat Moskau im Sommer vom Iran gekauft. Dies streitet Teheran ab.
Weitere Käufe von Drohnen und Raketen sind offenbar im Gang. Denn trotz der Sanktionen gegen den Iran läuft die Produktion problemlos. Die Drohnen sind schlicht konzipiert; die meisten Bestandteile sind auf dem freien Markt erhältlich, oft gar online bestellbar.
Auch die Ukraine besitzt Drohnen. Darunter ein paar wenige potente, mehrfach verwendbare und ausgefeilte türkische Bayraktar-Drohnen – mit Stückkosten von rund zwei Millionen Schweizer Franken jedoch recht teuer. Washington lieferte Kiew ein paar hundert Switchblade-Einwegdrohnen. Deren Reichweite ist weitaus geringer als die der iranischen.
Die iranischen Billigdrohnen mit westlichen Luftabwehrmitteln auszuschalten, ist kein gangbarer Weg. Technisch elaborierte Systeme wie das norwegisch-amerikanische Nasams oder das deutsche Iris-T sind viel zu teuer und bei weitem nicht in der nötigen Zahl verfügbar, als dass die Abwehr hunderter simpler Drohnen infrage käme.
Lösung wäre vorhanden
Helfen könnte Israel, das mit iranischen Drohnen Erfahrung hat – doch die Regierung in Jerusalem will sich aus dem Krieg heraushalten. Am effizientesten liesse sich die Zivilbevölkerung schützen, wenn die Ukraine unverzüglich mit einer Vielzahl von Störsendern ausgerüstet würde.
In dem Moment, da Kiews Armee sie besässe, könnte sie einen Grossteil der mörderischen Shahed-Drohnenangriffe vereiteln. Also eine bescheidene Massnahme mit beträchtlicher Wirkung. Schreibt SRF.
Einen dümmeren Titel konnte sich SRF kaum ausdenken. Dürfte einzig und allein dem Clickbaiting geschuldet sein und wird denn auch im Artikel entsprechend relativiert. Eigentlich schade, denn grundsätzlich ist an der Qualität der SRF-Kriegsberichterstattung rund um die Ereignisse in der Ukraine und Russland kaum etwas auszusetzen.
Dass die billigen Kamikaze-Drohnen auch militärisch sehr wichtig und äusserst erfolgreich sein können, beweist der Ukrainekrieg. Immerhin wurden laut dem ukrainischen Präsidenten Selenski 30 Prozent aller ukrainischen Elektrizitätswerke in einer Woche zerstört und mehr als 1'100 Orte in der Ukraine sollen derzeit ohne Strom sein.
Diese Tatsachen spielen Putin und seiner Kriegsstrategie sehr wohl in die Hände. Mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand, der das russische Kriegsbudget massiv schont, erzielt der russische Diktator grösstmögliche Wirkung.
Eine andere Strategie als mörderische Angriffe auf die zivile Infrastruktur ohne Rücksicht auf menschliche Verluste unter der Zivilbevölkerung hatte der grosse Kriegsstratege aus dem Kreml noch nie.
Warum sollte er etwas ändern, was in seinen bisherigen Kriegen langfristig stets erfolgreich war?
-
18.10.2022 - Tag der querdenkenden Stratosphärenhüpfer
Verschwörrungstheoretiker und Stratosphärenspringer Felix Baumgartner im Verkehrshaus Luzern: «Es gibt zu wenig neugierige Menschen.»
Mit einem Fallschirm war Felix Baumgartner 2012 aus der Stratosphäre gesprungen. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums feierte am Sonntag im Verkehrshaus ein Dokumentarfilm dazu Premiere. zentralplus hat sich nach der Uraufführung mit dem Extremsportler getroffen.
Aus einer Höhe von fast 40 Kilometern sprang der Österreicher Felix Baumgartner am 14. Oktober 2012 aus einer kleinen Kapsel im Weltraum. Damit brach er mehrere aeronautische Weltrekorde: den bis dahin höchsten Absprung mit einem Fallschirm, die mit über 1'300 Kilometern pro Stunde höchste Geschwindigkeit eines Menschen im freien Fall sowie den längsten freien Fall.
«Für mich ist es schön zu sehen, dass nach zehn Jahren immer noch so viel Interesse da ist», sagt Baumgartner nach der Doku-Premiere im Filmtheater des Verkehrshauses. Der Film über die Mission wurde in den letzten zwei Monaten gedreht, wesentliche Teile davon auch im Verkehrshaus.
Mit der Mission wurden nicht nur aeronautische Rekorde gebrochen, sondern auch Streaming-Geschichte geschrieben: «Ich weiss, die ganze Welt sieht jetzt zu», sagte Baumgartner kurz vor seinem Absprung vor zehn Jahren. Und tatsächlich: Die mediale Inszenierung war riesig. Knapp 80 Fernsehsender berichteten live über das Ereignis, bis heute hat kein anderes Streaming mehr Live-Zuschauer auf Youtube erreicht als diese Mission.
Baumgartner lebt jetzt seinen zweiten Traum
Kurz vor seinem Stratosphären-Sprung ist Baumgartner nach Arbon (TG) gezogen. Nach seinem Rekordsprung im Jahr 2012 zog er sich vom Extremsport zurück. Langweilig ist ihm aber keinesfalls geworden: «Ich bin nun Hubschrauberpilot. Das war mein zweiter Kindheitstraum neben dem Fallschirmspringen. Mein Leben ist so spannend und umfangreich, langweilig wird mir also nicht.»
Als 16-Jähriger hat Baumgartner mit dem Fallschirmspringen begonnen. Auch nach seinem Rücktritt vom Extremsport bleibt der Adrenalin-Kick noch immer fester Bestandteil seines Lebens. Autorennen, Motocross, Paragliding. Auch heute steht er noch beim Sponsor Red Bull unter Vertrag, lotet seine Grenzen als Akrobatik-Helikopterpilot aus.
Dennoch sieht sich Baumgartner keinesfalls als «Adrenalin-Junkie», sondern als «Risiko-Manager» oder «Geschichtenerzähler». Er sagt denn auch, dass er den Stratosphären-Sprung nicht ein zweites Mal machen würde. Das Risiko bliebe gleich, neue Erkenntnisse könnte er aber nicht erlangen.
Aufmerksamkeit stört Baumgartner nicht
Zehn Jahre nach dem Rekordsprung besteht noch immer reges Interesse an Felix Baumgartner und der Mission «Red Bull Stratos» im Verkehrshaus. Baumgartner, der vor dem Stratosphären-Sprung schon mit Extremsport-Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, wurde mit dem Sprung auf einen Schlag weltberühmt. Dass er noch immer auf seinen Rekordsprung angesprochen wird, stört den 53-Jährigen gar nicht: «Ich liebe meine Arbeit. Was gibt es Schöneres, als wenn du einen Kindheitstraum hast, der dich genau dort hinbringt, wo ich heute bin.»
Zudem sei die Bevölkerung der Schweiz sehr diskret, findet Baumgartner: «In der Schweiz gibt es diesen Hype nicht. Die Schweizer schätzen das Gespräch, brauchen aber weder ein Foto, noch kommen sie in eine grosse Euphorie, wenn sie mich sehen.»
Vor kontroversen Aussagen schreckt Baumgartner nicht zurück
Nebst seinem Stratosphären-Sprung machte Baumgartner auch immer wieder mit politisch umstrittenen Aussagen auf sich aufmerksam. So sprach er sich im Jahr 2012 gegen die parlamentarische Demokratie und für eine «gemässigte Diktatur» aus. Abgeordnete müssten durch Leute aus der Privatwirtschaft ersetzt werden, die sich «wirklich auskennen» würden.
In die Medien schaffte es Baumgartner auch mit harscher Kritik an der Flüchtlingspolitik Österreichs oder mit dem Vorschlag, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen. Die daraus entstandenen Shitstorms lösten bei ihm aber wenig aus. «Skandalschlagzeilen gibt es immer, aber die hat der Papst schon gehabt. Mir ist dies völlig egal, solang die Leute auf der Strasse positiv auf mich zukommen.»
Baumgartner plädiert für mehr Mut
Aus dem Film, dem Talk nach dem Film und dem Interview geht eine Botschaft Baumgartners klar hervor: Man soll mutig sein und seinen Träumen nachgehen. «Wir brauchen wieder mehr von diesen Menschen, wir müssen wieder Neugierde entwickeln. Das vermisse ich heute so sehr. Es gibt zu wenig neugierige Menschen.»
Felix Baumgartner freut sich daher sehr, dass mehrere kleine Kinder ihm nach dem Film ihre eigenen Träume offenbarten. Diesen Träumen soll man nachgehen, auch wenn es Leute gibt, die an der Machbarkeit eines Traums zweifeln. Solche Zweifler gab es auch beim Stratosphären-Projekt. Über diese müsse man jedoch hinwegschauen. «Es gibt im Leben immer viele Leute, die sagen, wie es nicht geht, und ganz, ganz wenige, die sagen, lass es uns probieren.»
Man müsse den Mut behalten und einfach einmal ausprobieren. «Scheitern gehört zum Alltag dazu. Man soll halt nur das Leben nicht verlieren.» Fast schon ironische Worte für einen Extremsportler, der in seinem bisherigen Leben immer wieder die Grenzen des Machbaren ausgelotet hat. Schreibt ZentralPlus.
Ich war am vergangenen Sonntag ebenfalls im Verkehrshaus Luzern. Allerdings nur um dort ein «Kafi Gräm» zu schlürfen. Doch dann wurde mir von einem der anwesenden Red Bull-Marketingkoryphäen am Nebentisch angeboten, beim österreichischen Stratosphären-Hüpfer kostenlos vorbeizuschauen.
Nicht weil ich so ein toller, intelligenter, gutaussehender und stratosphärisch mit allen Wassern gewaschener Mensch bin, sondern weil sich der Aufmarsch zum Baumgartner-Event doch etwas in Grenzen hielt. Da ich aber nicht unbedingt ein grosser Fan des – zugegeben genialen – Red Bull-Marketings bin und mich Diktatur-Feunde wie Baumgartner definitiv nicht faszinieren, verzichtete ich auf das grosszügige Angebot.
Der Absprung Baumgartners vor zehn Jahren mit dem Fallschirm aus 38'969,4 Metern bedeutete einen neuen Weltrekord, den seit 1960 der Amerikaner Joseph Kittinger mit 31'333 Metern gehalten hatte. Während von Kittinger damals kaum Notiz genommen wurde, veranstaltete Red Bull eine der wohl erfolgreichsten Marketing-Kampagnen, wie sie die Welt bis dato nur selten erlebt hat.
Dadurch wurde auch der österreichische Extrem-Sportler ins Licht der Öffentlichkeit gespült. Auf Facebook folgen ihm inzwischen 1,1 Millionen Menschen. Dass sein Sprung der Wissenschaft neue Erkenntnisse über die Möglichkeit eines Notausstiegs aus Raumfahrzeugen eröffnet habe, ist nichts anderes als ein Treppenhauswitz und eine Marketingfloskel von Red Bull.
Baumgartners Rekord hielt nur knapp zwei Jahre. Am 24. Oktober 2014 stellte der Google-Manager Alan Eustace mit einem Sprung aus 41'419 Metern einen neuen Weltrekord auf. Fern von jeglichem Mediengetöse baumelte der amerikanische Freizeit-Sportler im Gegensatz zu Baumgartner ohne Kapsel (!) direkt am Ballon auf die neue Rekordhöhe.
Ich wage jetzt die Behauptung, dass Sie den Namen des Google-Managers Alan Eustace noch nie gehört haben, obschon seine sportliche Leistung (ohne Kapsel beim Aufstieg) wesentlich höher eingeschätzt wird als diejenige von Baumgartner. Sei's drum. Ist eh nur ein Thema für Jumper.
Der ehemalige Basejumper Baumgartner, der u.a. von den Petronas-Towers in Kuala Lumpur, von der Christus-Statue in Rio de Janeiro und vom Millennium-Tower in Wien gesprungen war, jettete nach seinem Rekordsprung von Interview zu Interview rund um den Erdball. Doch wie das in der schnelllebigen Zeit der heutigen Medienwelt so ist, verglühte der neue Publikumsmagnet ziemlich schnell wie ein Komet am Himmel.
Denn Baumgartner schaffte es, von jeglichem Intellekt befreite neue Themen zu setzen. Themen, die glücklicherweise noch nicht mehrheitsfähig sind. Jedenfalls nicht in Demokratien. Er mutierte vom sportlichen Stratosphärenhüpfer mit skurrilen politischen Statements zum dumpfen Querdenker und Verschwörungstheoretiker. So forderte er in allem Ernst den Friedensnobelpreis für den heftig umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.
Was man noch als Witz oder Kalauer eines etwas unbedarften Extremsportlers hätte abtun können, war dann allerdings bei seinen wohlmeinenden und positiven Äusserungen über die rechtsradikalen «Identitären» Österreichs nicht mehr möglich.
Von der Querdenker- und Verschwörer-Blase zwar hoch geachtet, verlor Baumgartner mehr und mehr den Rückhalt bei der österreichischen Bevölkerung. Nach einem Streit mit dem österreichischen Fiskus zog er in die Schweiz, wo Diktatorenfreunde willkommen sind, sofern sie genug Geld mitbringen und wo sich der Medienwirbel um ihn in überschaubaren Grenzen hält.
Das Online-Portal «ZentralPlus» mal ausgenommen. Das hält vermutlich einen Stratosphären-Jump immer noch für die lebensgefährlichste Angelegenheit zwischen Himmel und Erde und dürfte von Alan Eustace noch nie etwas gehört haben.
Dieser mutige Freizeitsportler relativierte nämlich in einem Interview die medial mit Getöse aufgebauschte Gefahr beim Absprung aus der Stratosphäre. Die Gefahr liege höchstens darin, dass sich der Fallschirm nicht öffnen könnte. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Das Red Bull-Marketing sieht das logischerweise etwas anders.
Tja, Marketing funktioniert nun mal nur mit Übertreibungen.
-
17.10.2022 - Tag der nackten Fakten
Sollen allesamt aus der Türkei gekommen sein: Griechische Grenzschützer greifen 92 nackte Migranten auf
In Griechenland haben Grenzschützer am Freitag 92 Migranten aufgegriffen. Die Menschen waren allesamt nackt. Nun beschuldigt Griechenland die Türkei, die Menschen bewusst über die Grenze geschickt zu haben.
Am Grenzfluss Evros im Nordosten Griechenlands haben Grenzschützer nach Angaben griechischer Ministerien 92 nackte Migranten aufgegriffen, die von der Türkei aus über die Grenze nach Griechenland getrieben worden sein sollen. Der Vorfall ereignete sich laut dem griechischen Bürgerschutzministerium bereits am vergangenen Freitag.
In einem Tweet des griechischen Migrationsministers Notis Mitarakis (50) vom Samstag wurde nun ein Foto nackter Männer verbreitet, das den Vorfall belegen soll. Der Minister beschuldigt die Türkei, die Menschen über die Grenze geschickt zu haben. Das türkische Verhalten gegenüber den 92 Migranten sei eine Schande für die Zivilisation. Man erwarte, dass Ankara den Vorfall untersuche, schrieb Mitarakis.
Auch Migranten beschuldigen die Türkei
Gemäss einer Mitteilung vom Samstag seien die Migranten nackt gewesen und hätten keinerlei Gepäck dabei gehabt. Einige der Migranten hätten gegenüber den griechischen Beamten angegeben, in drei Fahrzeugen der türkischen Behörden an den Fluss transportiert und in Schlauchboote platziert worden zu sein, um nach Griechenland überzusetzen. Manche der Menschen sollen Verletzungen aufgewiesen haben, hiess es in einer Mitteilung der griechischen Polizei. Man habe die Migranten bekleidet und versorgt.
Wegen der erhöhten Zahl illegaler Grenzübertritte von der Türkei aus will Athen die Grenze am Fluss Evros im Nordosten des Landes jetzt fast vollständig abriegeln. Die bestehenden 35 Kilometer Grenzzaun entlang des Flusses werden zurzeit um 80 Kilometer verlängert. Nicht nur am Evros, auch in der östlichen Ägäis hatten griechische Grenzer zuletzt einen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen verzeichnet. Schreibt Blick.
Ausser den nackten Fakten inklusive einem Bildli der «füdliblutten» Asylanten für die Voyeure unter uns bietet dieser SDA-Artikel im Blick nichts, was wir nicht schon längst wissen.
Dass männliche Asylanten in Griechenland öfters nackt oder nur dürftig bekleidet mit einer Unterhose eintreffen, ist eine längst bekannte Tatsache. Die müsste eigentlich auch dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis bekannt sein.
Der alles andere als seltene und etwas unkonventionelle Grenzübertritt hängt damit zusammen, dass viele Migranten sowohl ihr Alter wie auch ihre Herkunft verschleiern wollen.
Man darf Erdogan ja viel zutrauen, doch bei den 92 nackten Migranten dürfte es sich wohl eher um die geplante Aktion einer Schlepperbande handeln. Tönt halt einfach besser, den türkischen Behörden den Schwarzen Peter zuzuschieben als eine bezahlte Schlepperbande zu denunzieren.
Da könnten ja gewisse Rückschlüsse getroffen werden, die dem korrupten Milliarden-Business aller mit dem Flüchtlingswesen Beteiligten nicht dienlich wären. Und da gehören die griechischen Behörden ebenso dazu wie die türkischen.
So viel unverfrorene Wahrheit muss an einem Montagmorgen schon sein! Einen sonnigen Start in die neue Woche wünscht Ihnen der Artillerie-Verein Zofingen.
-
16.10.2022 - Tag des TV das gar kein TV ist
Christoph Blocher: 15 Jahre Teleblocher
Letzte Woche fand ein Jubiläum statt: Im «Haus zur Freiheit» im Toggenburg feierte eine fröhliche Besucherschar «15 Jahre Teleblocher». Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge dieser ungewöhnlichsten aller Fernsehsendungen (wobei ich die anderen gar nicht kenne, weil ich keinen Fernsehapparat besitze).
Man schrieb das Jahr 2007, ich sass noch im Bundesrat. Damals fragte mich der inzwischen leider verstorbene Norbert Neininger, Verleger der «Schaffhauser Nachrichten», ob ich in einer wöchentlichen Sendung zu aktuellen politischen Themen Stellung nehmen wolle. Mir gefiel die Idee sofort, denn so bekam ich die Möglichkeit, mich direkt an die Bevölkerung zu wenden. Statt bloss über die Medien, die meine Aussagen nur allzu oft verfälscht wiedergaben.
«Ich habe allerdings nur am Freitagmorgen um sieben Uhr Zeit», wandte ich ein. «Kein Problem», lautete Neiningers Antwort, «wir stehen bereit». Seither haben wir 788 Sendungen aufgenommen und ausgestrahlt.
Natürlich gab es gehörig «Mais» wegen «Teleblocher». Zweimal beriet der Bundesrat, ob es überhaupt erlaubt sei, dass ein Bundesrat so kommuniziere. Er ordnete eine Untersuchung an. Diese hat gezeigt, es ist erlaubt.
Noch heute drehen wir – wöchentlich. Ohne nachträgliches Schneiden, ohne dreinschwatzende Pressesprecher. Meistens bei mir zuhause, vor wechselndem Hintergrund. Das «Teleblocher» erreicht nach wie vor Zehntausende von Zuschauern* – und das in aller Welt. Es handle sich um die älteste Internet-Talkshow überhaupt, habe ich mir sagen lassen.
Alle drei haben wir durchgehalten, Kameramann, Moderator und ich als Befragter. Besonders gross ist der Aufwand für Matthias Ackeret und den Kameramann, müssen sie doch in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um sich manchmal bei Wind, Regen und Schnee zum Drehort durchzukämpfen. Nid lugg la – gwünnt. E gueti Wuche. Christoph Blocher. Schreibt Christoph Blocher in seiner Verlegerkolumne.
Ob der Übervater der SVP und abgewählte ex-Bundesrat Christoph Blocher tatsächlich keinen Fernsehapparat besitzt oder nur damit kokettiert, sei dahingestellt. Er braucht auch keinen. Denn YouTube-Beiträge sind nun mal keine Fernsehsendungen.
Dass «Teleblocher» zehntausende von Zuschauern «aus aller Welt» erreicht, ist etwas arg übertrieben. Der You-Tube-Kanal «Teleblocher» hat gerade mal 7140 Abonnenten. Das ist für YouTube-Verhältnisse beim öffentlichen Bekanntheitsgrad von Blocher gelinde ausgedrückt ein absolutes Nichts. Oder anders ausgedrückt: Bei den Abonnenten dürfte es sich um die Hardcore-Fans des Herrliberger Napoleons handeln.
Nur so nebenbei: Der Artillerie-Verein Zofingen hat auf seiner Website jeden Monat mehr als 30'000 Besucher*innen.
-
15.10.2022 - Tag der Ankündigungen, denen keine Taten folgen
11 Mal von Polizei aufgegriffen, 4 Opfer verprügelt, 2 Mal verurteilt, längst des Landes verwiesen – nun untergetaucht: Warum ist der Tunesier Amin T. (34) immer noch hier?
Die Behörden sind sicher: Sie haben keine Fehler gemacht im Fall des in Aarau geflüchteten Häftlings. Obwohl Amin T. (34) vor acht Jahren die Schweiz hätte verlassen müssen. Man hatte ihm gar einen Flug nach Tunesien gebucht. Doch T. tauchte unter – und wurde kriminell.
Er ist immer noch auf der Flucht: Amin T.* (34), der am 4. Oktober beim Ausstieg aus dem Gefangenenfahrzeug vor dem Migrationsamt in Aarau mit Crocs an den Füssen einem Securitas-Mitarbeiter davonrennen konnte. Die Polizei fahndet seither mit einem Klarbild nach dem Mann. Der Tunesier war in Ausschaffungshaft, nachdem er illegal in der Schweiz gelebt hatte, Straftaten begangen hatte und im 2021 vor Gericht in Olten SO zu 27 Monaten sowie einem achtjährigen Landesverweis verurteilt wurde.
Jetzt zeigen Blick-Recherchen: Der Tunesier, dessen Asylantrag 2014 abgelehnt wurde, scheint von den Behörden jahrelang mit Samthandschuhen angefasst worden zu sein. «Dieser Fall überrascht mich nicht», sagt Martina Bircher (38), Sozialvorsteherin in Aarburg AG und SVP-Nationalrätin. «Es darf nicht sein, dass er acht Jahre später immer noch hier ist. Vor allem, wenn er mehrfach straffällig wurde.»
Flug war bereits gebucht
Angefangen hat es damit, dass man T. im Jahr 2014 nicht nur den Flug nach Tunesien gebucht hat, den er nicht wahrnahm. Man hat ihn, nachdem er ab Juni 2015 mit Delikten begonnen haben soll, auch meist wieder gehen lassen, wenn er von der Polizei aufgegriffen wurde. So soll er unter anderem mit Drogen gedealt haben.
Laut einem Strafbefehl vom 2. Februar 2017 soll T. zwischen Juli 2015 und dem 18. Oktober 2016 zudem mehrere Delikte gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) begangen haben. Dafür wurde er zu einer unbedingten Strafe von 40 Tagen verurteilt.
In Olten soll er zwischen dem 2. April 2017 und dem 24. April 2019 elf Mal von der Polizei erwischt worden sein, weil er gegen Rayonverbote verstossen hatte. Bircher: «Schon da hätten bei den Behörden die Alarmglocken läuten müssen!»
Amin T. wird erneut straffällig
T. soll zwischen dem 14. Februar 2018 und 24. April 2019 erneut Delikte begangen haben. Unter anderem soll er seiner Freundin Knochenbrüche im Gesicht zugefügt und einer Frau zweimal den Kiefer gebrochen haben. Er soll weitere Männer verprügelt haben – wie etwa Sylla F.** (50).
Am 6. Mai 2019 wurde T. schliesslich verhaftet. Aber auch im Gefängnis hörte er nicht auf. Er demolierte eine Zelle in Olten und Solothurn. Vor Gericht in Olten gab er sich grösstenteils unschuldig und zog das Urteil vor Obergericht, wo das Verfahren hängig ist.
Der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin sagt: «Genau solch skrupellose Typen tragen dazu bei, dass die Ausländerfeindlichkeit in unserem Land zunimmt.» Das schade der ausländischen Bevölkerung, die sich in unserem Land korrekt verhalte. «Es ist unverständlich, dass uns derartige Typen auf der Nase herumtanzen und es unsere Behörden nicht schaffen, dem einen Riegel zu schieben.»
«Locker mehrere 100'000 Franken»
Bircher sagt: «Bei den Kosten, die dieser Mann in der Schweiz schon verursacht hat, sträuben sich bei mir die Haare. Bei einem Negativentscheid hat er uns Steuerzahler etwa 1000 Franken pro Monat gekostet – ausser, wenn er gerade irgendwo illegal wohnte.» Hinzu würden die Kosten bei der Polizei, Staatsanwaltschaft, beim Migrationsamt und bei den Gerichten kommen. «Da kommen locker mehrere 100'000 Franken zusammen», ist sich Bircher sicher.
Und was sagen die Behörden? «Die zuständige Staatsanwaltschaft kann bei ausländerrechtlichen Verstössen einen Strafbefehl erlassen und den Beschuldigten unter anderem zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilen», heisst es bei der Solothurner Staatsanwaltschaft. Über die Prüfung ausländerrechtlicher Massnahmen – etwa nach dem Vollzug eines unbedingten Freiheitsentzugs – sei das jeweilige Migrationsamt zuständig.
Dies ist im Fall von T. das Amt für Migration und Integration (Mika) in Aarau. Dort nimmt man zum Hauptvorwurf der Nicht-Inhaftsetzungen nur allgemein Stellung: «Ist das Mika für eine ausreisepflichtige Person zuständig, überprüft es stets, ob eine ausländerrechtliche Haft angezeigt sei.» Seien die Voraussetzungen dafür gemäss dem Ausländer- und Integrationsgesetz nicht erfüllt, könne diese nicht angeordnet werden.
Behörden wollen Verfahren korrekt geführt haben
Für Bircher steht fest: «Da haben das Aargauer Migrationsamt und wohl noch weitere Behörden meines Erachtens versagt!» Fehler wollen aber weder das Migrationsamt noch die Staatsanwaltschaft gemacht haben. Beide sagen für sich: «Das Verfahren wurde korrekt geführt.»
Nationalrat Jauslin, der bei der Beratung des neuen AIG involviert war, sagt: «Wir haben griffige Instrumente geschaffen, damit die Behörden den Schutz der öffentlichen Ordnung sicherstellen kann.» Es sei eine strikte Umsetzung der neuen Gesetze gefordert. Dies solle «hart, aber fair» geschehen. Und: «Schweizer Interessen und Werte haben Vorrang.» Er erwarte, dass die Kantonsbehörden die rigorosen Möglichkeiten «ausschöpfen, strikte anwenden und vollziehen». Es sei äusserst bedenklich, dass man solche Personen wie Amin T. «immer noch mit Samthandschuhen» anfasse.
SEM verweist auf Kantone
Und was sagt das Staatssekretariat für Migration (SEM) in Bern, das für das Asylverfahren von T. zuständig ist? «Für die Anordnung der ausländerrechtlichen Zwangsmassnahmen sind die Kantone zuständig.» Diese könnten, so das SEM weiter, Administrativhaft anordnen, wenn einer der im dafür vorgesehenen Gesetzesartikel aufgeführten Haftgründe erfüllt sei.
Amin T. dürfte mindestens zwei Bedingungen für eine Haft erfüllt haben. Weil er sich rechtswidrig in der Schweiz aufhielt. Und: Weil er ein ihm zugewiesenes Gebiet verliess. Heisst: Hätte das Aargauer Migrationsamt gewollt, hätte es bei T. bereits seit 2017 Administrativhaft anordnen können. * Name geändert ** Name bekannt. Schreibt Blick.
Der Fisch stinkt bekannterweise vom Kopf her. Dass sich die untergeordneten Behörden gegenseitig den Ball bezüglich Totalversagen im Fall des Tunesiers Amin T. zuschieben, ist irgendwie verständlich. Auch wenn für Migration und Flüchtlinge in oberster Instanz das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zuständig ist.
Seit vielen Jahren, nicht erst seit 2015, fehlt ihnen die Unterstützung der politischen Akteure*innen. Fragen Sie doch einmal einen Polizeibeamten und hören Sie ihm gut zu, was er Ihnen hinter vorgehaltener Hand zuflüstert. Das Übel beginnt ganz oben.
Unsere Ankündigungs-Bundesrätin Karin Keller-Sutter von der FDP eilt von einem Treffen bezüglich Migration zum andern. Die Anzahl ihrer danach abgehaltenen Pressekonferenzen und Medienmitteilungen dürften inzwischen rekordverdächtig sein.
Auch heute ist sie wieder mit zwei Ankündigungen vertreten: Madame Keller-Sutter setzt sich am Treffen der Schengen-Innenminister für eine enge Abstimmung unter den europäischen Partnerländern bezüglich irregulärer Migration über die Balkanroute ein. Der serbische Präsident und Putin-Kumpel Vučić wäscht seine Hände in Unschuld und lacht sich wohl einen Schranz in den Bauch.
Ausserdem rühmt die FDP-Bundesrätin ein mit Griechenland abgeschlossenes Abkommen im Migrationsbereich. Kosten 40 Millionen Schweizer Franken. In welchen ominösen griechischen Quellen die 40 Millionen versickern dürften, lässt Frau Keller-Sutter offen.
Dafür posiert die modebewusste Bundesrätin, die immer mehr einer aufgepeppten Barbiepuppe aus einer Geröllhalde ähnelt, für ein hübsches Bildli, das sie mit weit aufgerissenen Augen, goldenem Ohrschmuck und dem griechischen Minister für Migration und Asylwesen, Notis Mitarachi, zeigt.
Der Tunesier Amin T. ist nur einer von vielen Tausend (!) Fällen beim Versagen der obersten Behörde im Zusammenhang mit irregulärer Migration. Dass beispielsweise von den (vermutlich inzwischen) mehr als Tausend irregulären algerischen Asyltouristen trotz Abschiebungsentscheid bisher kaum einer die Schweiz verlassen musste, widerspiegelt sich in den Medienmitteilungen der Schweizer Polizeikorps über Diebstähle, Einbrüche und Messerstechereien beinahe täglich.
Dabei war es doch unsere glorreiche Bundesrätin Keller-Sutter, die am 24. März 2021 nach Algerien reiste, um für das «Rückübernahmeabkommen» algerischer Staatsangehörigen zu werben, das zwischen der Schweiz und Algerien 2006 abgeschlossen worden war.
Dass gleich nach der Rückkehr von Keller-Sutter aus Algerien eine vor Optimismus triefende Pressekonferenz abgehalten wurde, versteht sich von selbst. Die bis zum heutigen Tag kaum vollzogenen Rückführungen suchen allerdings nach einer Erklärung.
Für weitaufgerissene Augen älterer Damen gibt es hingegen eine Erklärung: Glotzaugen, wie Augenexperten dieses Phänomen nennen, entstehen vor allem dann, wenn die Augenbrauen zu intensiv geschminkt werden. Oder wenn die güldene Armbanduhr am Handgelenk, die bei der FDP zum liberalen Dress-Code gehört, zu schwer ist und damit die Kopfhaut nach unten zieht.
-
14.10.2022 - Tag der netten Gedanken
Genug Youtube: Freiburg schenkt den 18-Jährigen ein Zeitungsabo
Jungbürgerinnen sollen im Freiburg einen Bon für regionale Medien erhalten. Der Nutzen ist umstritten.
Junge Menschen konsumieren immer seltener klassische Medien. Das Freiburger Parlament gibt Gegensteuer und will den 18-Jährigen zum Geburtstag ein Abo einer lokalen Zeitung schenken. 3500 Jungbürgerinnnen- und bürger sollen aus sieben regionalen Zeitungen auswählen können. Auch der Kanton Bern prüft, ob Jugendliche künftig Bons für (Online)-Zeitungen erhalten.
Statt Lokalzeitungen zu lesen, swipen sich viele Jugendliche lieber durch Instagram oder schauen Videos auf Youtube. Regionalen Bezug gibt es dabei oftmals kaum. Das Freiburger Kantonsparlament will jetzt Gegensteuer geben.
Zum 18. Geburtstag sollen alle Jugendlichen einen Bon für ein einjähriges Zeitungsabo von lokalen Medien erhalten. «Diese Zeitungen sind wichtig für eine funktonierende Gesellschaft. Darum brauchen sie Unterstützung», sagt Brice Repond von den Grünliberalen, der die Motion zusammen mit der SP eingebracht hat.
Die Freiburger Regierung stemmte sich im Rat vergeblich gegen den Vorstoss. Staatsrat Olivier Curty: «Man muss nicht die Generation Z überzeugen, Zeitungen in Papierform zu lesen. Vielmehr müssen sich die Medien an die neuen Gewohnheiten beim Medienkonsum anpassen.»
Sieben Zeitungen zur Auswahl
Nach dem Willen der Motionäre sollen die jährlich rund 3500 Jungbürgerinnen und -bürger ein Gratisabo eines regionalen Titels bestellen dürfen. Zur Auswahl stünden demnach «La Liberté», «Freiburger Nachrichten», «La Gruyère», «Der Murtenbieter», «Le Messager», «Anzeiger von Kerzers» und «La Broye». Die entsprechenden Abonnemente kosten zwischen 90 und 450 Franken pro Jahr.
Die Motion des Jungparlamentariers geht auf die eidgenössische Abstimmung zum Mediengesetz zurück. Zwar hatte national ein Nein resultiert, im Kanton Freiburg stellten sich die Stimmenberechtigen jedoch zu 57 Prozent hinter ein Massnahmenpaket zugunsten der kriselnden Medien.
Bern will Medien fördern - aber wie?
Das Freiburger Modell interessiert auch im Kanton Bern. Denn im September hat sich das Berner Kantonsparlament für eine indirekte Förderung der Medien entschieden.
Das Bon-System wäre eine Möglichkeit, diese Pläne umzusetzen. «Eine Variante ist, dass man den Jugendlichen ein Online-Abo zur Verfügung stellt, damit sie keine Zeitungen lesen müssen», sagt SVP-Grossrätin Verena Aebischer, welche die zuständige Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen präsidiert.
Wie diese Medienförderung konkret aussehen soll, ist noch offen. Die Kantonsregierung muss jetzt Vorschläge ausarbeiten. Schreibt SRF.
Netter Gedanke. Die (noch existierenden) Zeitungsverlage werden sich wohl die Hände reiben. Man holt sich ja nicht vergebens Nationalräte*innen und Ständeräte*innen als Berater*innen oder Verwaltungsratsmitglieder ins Board.
Doch das Rad der Zeit lässt sich auch durch geschmierte Politiker*innen nicht umdrehen. Und was staatliche Medien-Förderung bringt, sehen wir bei der gedruckten Ausgabe von 20Minuten: Die an fünf Wochentagen in örtlich bestens platzierten Boxen ausgelegten Print-Exemplare bleiben wie Blei in den Kästen liegen.
-
13.10.2022 - Tag des Papiertigers mit dem Namen UNO
UNO-Vollversammlung: Mehrheit verurteilt Annexionen in Ukraine
Die UNO-Vollversammlung hat Mittwochabend in New York mit überwältigender Mehrheit – 143 von 193 Mitgliedsstaaten – die Annexionen Russlands in vier Regionen in der Ukraine verurteilt und für eine entsprechende Resolution gestimmt. Fünf Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Zehn Länder nahmen an der Abstimmung nicht teil. Das Ergebnis ist völkerrechtlich nicht bindend, aber ein deutliches Zeichen für die internationale Isolation Russlands.
Die Resolution verurteilt die Annexionen und erklärt sie für ungültig. Zudem wird der Kreml aufgefordert, die Einverleibung der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen. Sie wurde von der Vertretung der EU ausgearbeitet. Erst Ende September hatte Russland im UNO-Sicherheitsrat als ständiges Mitglied eine Resolution zur Verurteilung der Annexionen mit seinem Veto verhindert.
In der Vollversammlung hat Russland kein Vetorecht. Das Votum in diesem Gremium war als globaler Stimmungstest zu Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine gesehen worden. Zu den Staaten, die sich bei der Abstimmung enthielten, zählen China, Indien, Südafrika und Pakistan. Syrien, Nicaragua, Nordkorea und Belarus stimmten gemeinsam mit Russland dagegen. China warnte am Donnerstag vor einer Blockbildung und einem neuen Kalten Krieg und mahnte Friedensverhandlungen ein.
Zahl der Russland-Unterstützer gesunken
Mit 143 Stimmen ist die Zahl der Russland-Unterstützer um zwei zurückgegangen. Im März war die russische Invasion mit einer damals historischen Mehrheit von 141 Stimmen verurteilt worden. Im Jahr 2014, nach der Annexion der Krim durch Russland, bekannten sich 100 Mitgliedsstaaten zu einer Resolution, die die territoriale Integrität der Ukraine betonte.
Diplomaten hatten im Vorfeld der aktuellen Abstimmung eigentlich damit gerechnet, dass die Zahl der Ukraine-Unterstützer kleiner geworden ist aufgrund der beobachteten Kriegsmüdigkeit in vielen Ländern insbesondere in Afrika und Lateinamerika sowie einer Abhängigkeit von Russland. Sie bezeichneten schon eine Zustimmung von mehr als 120 Staaten als gutes Ergebnis. Geworden sind es weit mehr. Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba dankte auf Twitter den 143 Ländern, die für die Resolution votiert haben. Sein amerikanischer Amtskollege Antony Blinken sprach von einem „bemerkenswerten“ Votum, das die Isolation Moskaus verdeutliche.
USA und Deutschland riefen zu Verurteilung auf
Vor der Abstimmung hatten insbesondere die USA und Deutschland zu einer klaren Verurteilung der Annexionen der Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja aufgerufen. „Heute ist es Russland, das in die Ukraine einmarschiert. Aber morgen könnte es eine andere Nation sein, deren Territorium verletzt wird. Sie könnten es sein. Sie könnten die Nächsten sein“, sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Linda Thomas Greenfield. Sie hatte bereits am Dienstag aufgerufen, dass es um die Verteidigung der UNO-Charta gehe und „nicht um einen Wettbewerb zwischen Russland und den Vereinigten Staaten“.
„Die Grenzen eines jeden Landes – so gross oder klein es auch sein möge – sind durch das internationale Völkerrecht geschützt“, betonte sie. Ihr deutscher Amtskollege Michael Geisler argumentierte ähnlich. Jedes Land sei verpflichtet, die Scheinreferenden und rechtswidrigen Annexionen Moskaus zurückzuweisen. Schreibt ORF.
«Die Mehrheit der UNO-Vollversammlung verurteilt die russischen Annexionen in der Ukraine.» Solche Meldungen am frühen Morgen sind Balsam für unsere von der kommenden Winterkälte gequälten Seelen, tönen gut und geben Anlass zur Hoffnung. Auf den ersten Blick.
Doch leider haben sich auf den zweiten Blick bei der - je nach Medium - aufgepeppten Agentur-Nachricht zwei gravierende Tatsachen eingeschlichen, die nicht (oder kaum) erwähnt werden.
Bezogen auf die an der UN-Vollversammlung anwesende Anzahl von Staaten hat sich tatsächlich eine Mehrheit zur Verurteilung der russischen Gebiets-Annexionen in der Ukraine entschieden.
Zählt man allerdings die Bevölkerung von den 35 Staaten, die sich der Stimme enthalten haben zusammen, – also Staaten wie China und Indien, um nur zwei zu nennen –, ergibt sich eine überwältigende Bevölkerungsmehrheit auf unserem Planeten, die der von den westlichen Medien gefeierten Farce (Verurteilung) in keiner Art und Weise zugestimmt haben. Mohn ist auch nur eine Blume und Stimmenthaltung nichts anderes als Ablehnung. Punkt 1.
Punkt 2: Die Verurteilung der russischen Annexion durch die UNO-Vollversammlung ist rechtlich nicht bindend. Hat somit für Russland keine Konsequenzen.
Was sagt uns das? Die nach dem Zweiten Weltkrieg mit hehren Absichten gegründete UNO, die den nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten «Völkerbund»* ablöste, hat sich zu einem Geld verschlingenden Moloch und Papiertiger entwickelt.
Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats (Frankreich, Russland, die Vereinigten Staaten, die Volksrepublik China und das Vereinigte Königreich) können dank ihrem Vetorecht jede missliebige und rechtlich bindende UN-Entscheidung blockieren.
Fazit: Ausser gigantischen Spesen einmal mehr nix gewesen.
* Der Völkerbund (französisch Société des Nations, englisch League of Nations, spanisch Sociedad de Naciones) war eine zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Genf. Als Ergebnis der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, nahm er am 10. Januar 1920 seine Arbeit auf. Sein Ziel, den Frieden durch schiedsgerichtliche Beilegung internationaler Konflikte, internationale Abrüstung und Rüstungskontrolle und ein System der kollektiven Sicherheit dauerhaft zu sichern, konnte er nicht erfüllen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung der Vereinten Nationen (UNO) beschlossen die verbliebenen 34 Mitglieder am 18. April 1946 einstimmig, den Völkerbund mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Das Deutsche Reich erklärte nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten am 14. Oktober 1933 seinen Austritt aus dem Völkerbund und verliess gleichzeitig die Genfer Abrüstungskonferenz. (Quelle Wikipedia).
-
12.10.2022 - Tag der Brustimplantate und Bottox-Lippen
«Bachelor»-Francesca lüftet Geheimnis: «Ich habe meine Brustimplantate entfernen lassen»
Nach zwei Jahren hat sich Francesca Morgese ihre Brustimplantate entfernen lassen. Zuletzt kämpfte sie mit gesundheitlichen Problemen.
Sie hat die Nase voll von Geheimnissen! «Bachelor»-Star Francesca (24) berichtet ihren Followern auf Instagram: «Ich weiss, dass es dem ein (Anmerkung: Rechtschreibung scheint nicht so ihr Ding zu sein)oder anderen schon aufgefallen ist – und für andere wird es ein Schock sein. Es geht darum, dass ich meine Brustimplantate entfernen lassen habe.»
Blick weiss: Die Operation ist schon einige Tage her. Eine entsprechende Anfrage dazu liess sie jedoch unbeantwortet. Auch ihre Follower vertröstet Francesca Morgese – und geht im jetzigen Moment nicht auf die Gründe für die Operation ein.
Gesundheitliche Probleme seit Monaten
Schon seit Monaten kämpft die Zürcherin mit gesundheitlichen Problemen. Vor kurzem platzte deshalb gar der Traum vom Leben in Dubai. Kurz nachdem sie ausgewandert ist, musste sie zurück in die Schweiz. «Mir ging es gesundheitlich nicht gut», erklärte sie damals. Hier hat sie sich in ärztliche Behandlung begeben. Genaue Details, wie diese aussehe, behielt Francesca Morgese jedoch für sich.
Noch im Juni spekulierte sie im Blick-TV-Interview selbst darüber, ob die gesundheitlichen Probleme mit der Schönheits-OP zusammenhängen. «Seit der Brust-Operation geht es mir nicht gut», sagte sie. Sie kündigte damals an, diesbezüglich bei Spezialisten alles abklären zu lassen – gerade auch, weil viele Followerinnen und Follower sie darauf hinwiesen, dass es sich um Breast Implant Illness handeln könnte. Dies ist ein Krankheitsbild, bei dem psychische oder körperliche Probleme nach der Brustvergrösserung auftreten.
Bekannt durch «Bachelor»-Staffel 2020
Francesca Morgese wurde durch die Teilnahme beim «Bachelor» im Jahr 2020 bekannt. Damals sicherte sie sich die letzte Rose von Alan Wey (31). Noch kurz vor dem Finale liess sie sich damals die Brüste in Zusammenarbeit mit einer Schönheitsklinik vergrössern. Das grosse Pärcheninterview nur wenige danach musste sie vor lauter Schmerzen abbrechen. Chancen auf weitere gemeinsame Auftritte mit Alan Wey gab es danach nur noch wenige: Kurz nach Staffelende trennten sich die beiden.
Heute lebt sie von Onlyfans
Seit einem Jahr ist Francesca Morgese wieder vergeben: Sie verschenkte ihr Herz an den 19-Jähren KV-Lehrabgänger Damian. Mittlerweile lebt sie von der Blüttelplattform Onlyfans – und verdient dort mit teilweise expliziten Inhalten bis zu 30'000 Franken. Schreibt Blick.
Ausser den Blick-Lesern*innen und Online-Pornokonsumenten*innen kennt wohl kaum jemand Francesca Morgese, die ihren Lebensunterhalt auf der Blüttelplattform «Onlyfans» bestreitet.
«Blüttelplattform» ist eine nette Umschreibung von Blick für ein waschechtes Pornoportal, das von soft bis hardcore so ziemlich jede Schweinerei anbietet.
Dass Francesca Morgese ihre Brustimplantate entfernen liess, ehrt sie. Jetzt muss sie nur noch die gespritzte Bottox-Scheisse in ihren Lippen aufräumen, dann könnte aus ihr tatsächlich noch was werden. Nix ist schon.
-
11.10.2022 - Tag der scheinheiligen Empörung
Guterres «zutiefst schockiert» von Angriffen auf Ukraine
UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich «zutiefst schockiert» von den russischen Raketenangriffen auf die Ukraine gezeigt. «Dies stellt eine weitere inakzeptable Eskalation des Krieges dar, und wie immer zahlen die Zivilisten den höchsten Preis», teilte UNO-Sprecher Stephane Dujarric mit. Guterres habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski über die Lage gesprochen. Schreibt SRF im Ukrainekrieg-Liveticker.
Was haben denn all die Polit-Granden und Staatenlenker*innen der «hehren westlichen Wertegemeinschaft» erwartet, die jetzt über Putins Bombenhagel auf ukrainische Städte (und Dörfer) schockiert sind? Putin würde ohne Reaktion sehenden Auges in seinen eigenen Untergang taumeln?
Putin macht das, was er in all seinen Kriegen gemacht hat. Abkommen wie die Genfer Konventionen zur Beschränkung der Mittel und Methoden zur Kriegsführung interessieren ihn nicht. So wie sich auch die USA in ihren unzähligen Kriegen seit 1945 nicht immer daran gehalten haben. So viel Ehrlichkeit sollte schon sein.
Putin zerstört die zivile Infrastruktur seiner Kriegsgegner und scheut sich auch nicht davor, ohne Rücksicht auf Verluste Spitäler, Schulhäuser und Einkaufszentren dem Erdboden gleich zu machen.
Damit produziert er Flüchtlingsströme, die langfristig die westlichen Staaten destabilisieren. Auch das gehört zu Putins strategischer Kriegsführung.
Grosny (Tschetschenien) und Aleppo (Syrien) lassen grüssen. Auch wenn sich das Entsetzen der westlichen Staatenlenker bei diesen beiden Kriegen eher in Grenzen hielt. Zu sehr war man auf die billigen Rohstoffe Russlands angewiesen.
Sind wir zwar immer noch, aber inzwischen hat der Zar aus Moskau ein paar Hähne selber zugedreht oder gleich die Pipelines zerstört. Da kann man seiner Empörung über Kriegsverbrechen ruhig freien Lauf lassen, wenn da ohnehin kein russisches Gas mehr fliesst. Scheinheilig bleibt sie dennoch.
-
10.10.2022 - Tag der politischen Raffgier
Sicherung der Bundesratssitze: Bürgerlicher Geheimplan soll die Grünen ruhigstellen
Statt eines Sitzes im Bundesrat sollen die Grünen das Amt des Bundeskanzlers übernehmen, der allgemein als achtes Regierungsmitglied gilt. So wollen Bürgerliche eigene Machtansprüche sichern. Davon aber halten die Grünen gar nichts.
Alles blickt derzeit auf die SVP: Wer wird der Nachfolger von Finanzminister Ueli Maurer (71)? Doch hinter den Kulissen von Bundesbern tut sich noch ganz anderes. Dort schmieden Bürgerliche bereits Pläne für die Gesamterneuerungswahlen 2023. Denn die FDP wird langsam nervös, genauso wie die SP. Den beiden Parteien sitzen die Grünen im Genick.
Getragen von der Ökowelle haben die Grünen schon bei den Wahlen 2019 kräftig zugelegt – und könnten nächstes Jahr noch stärker werden. Mit Folgen: Die jeweils zwei Bundesratssitze von FDP und SP wackeln mittlerweile bedenklich. Nur haben die beiden Parteien überhaupt nicht im Sinn, ihren Machtanspruch aufzugeben.
Bürgerliche haben deshalb einen Geheimplan ausgeheckt. Im Fokus steht Bundeskanzler Walter Thurnherr (59). Neben den sieben Bundesräten gilt er inoffiziell als achtes Regierungsmitglied. Über die Besetzung dieses Postens wird nun plötzlich hinter den Kulissen heiss diskutiert.
Der Plan: Man könne den Sitz künftig den Grünen geben. So dürften die Grünen schon mal etwas Luft im Bundesratszimmer schnuppern – gleichzeitig wäre der wackelnde Sitz von FDP-Aussenminister Ignazio Cassis (61) zu halten. Auch die SP dürfte entspannter einem Angriff der Ökopartei auf den Bundesrat entgegenblicken.
Umstrittene Zauberformel
Seit Jahren sind sich die Parteien uneinig, wer im Bundesrat sitzen soll. Gemäss der sogenannten Zauberformel, die seit 1959 zur Anwendung kommt, sind die stärksten drei Parteien im Bundesrat mit je zwei Sitzen vertreten; die viertstärkste erhält einen Sitz. Das ergab so lange Sinn, wie es mit SVP, SP und FDP drei grössere Parteien und mit der Mitte eine vierte, kleinere Partei gab.
Der Aufstieg von Grünen und Grünliberalen aber hat die Ausgangslage verändert. Spätestens seit den Wahlen 2019 repräsentiert die Zauberformel den Wählerwillen mehr schlecht als recht.
«Wollen mitregieren»
Seit die grüne Welle auch im Bundesparlament angekommen ist, pochen die Grünen ebenfalls auf einen Sitz in der Regierung. Und sie haben keinesfalls vor, sich mit einem Trostpflaster abspeisen zu lassen: «Wenn, dann wollen wir mitregieren, und werden uns mit dem Amt des Bundeskanzlers nicht zufriedengeben», stellt Grünen-Fraktionschefin Aline Trede (39) klar.
Im Gegenteil: Trede geht zum Gegenangriff über und schlägt stattdessen vor, dass der FDP der Sitz von Thurnherr zufallen solle: «Die FDP hat mit ihren Wahlanteilen jetzt schon keinen Anspruch mehr auf zwei volle Sitze im Bundesrat.»
Einfluss ist nicht zu unterschätzen
Der Vorsitz über die Bundeskanzlei ist nicht zu unterschätzen. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin sind stille Schaffer, welche die Entscheide des Bundesrats vorbereiten und teilweise auch die Öffentlichkeit darüber informieren. Auch diese Person hat Anspruch auf einen Dienstwagen, in dem er an wichtige Anlässe kutschiert wird.
Der aktuelle Bundeskanzler Thurnherr gehört der Mitte-Partei an, und wird darum gerne als zweiter Bundesratssitz der Mitte gesehen. Auch er wurde vom Parlament gewählt, seit 2016 ist er in dieser Funktion. Und es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass er aufhören will.
«Meine Macht ist beschränkt»
Der Posten des Bundeskanzlers ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Thurnherr nimmt nicht nur an den Sitzungen des Bundesrats teil. Er hat dabei auch beratende Stimme und kann selbst Anträge stellen. Zudem ist er auch auf dem offiziellen Bundesratsfoto abgebildet.
«Ich sehe mich nicht als achten Bundesrat, eher als obersten Beamten», wird Thurnherr auf der Website des Parlaments zitiert. «Meine Macht ist beschränkt. Aber ich habe etwas Einfluss. Ich kann vermitteln oder steuern, ich koordiniere und mache Vorschläge.»
Einfach nur Däumchen drehen, bis ihnen die anderen Parteien doch noch einen Bundesratssitz zugestehen, wollen die Grünen wohl ohnehin nicht. Ihre Bundeshausfraktion hat bereits angekündigt, dass sie am 18. Oktober darüber entscheidet, ob sie bereits im Dezember den SVP-Sitz von Ueli Maurer (71) angreifen will, wenn auch noch mit wenigen Chancen auf Erfolg. Schreibt Blick.
Vetternwirtschaft ist in vielen deutschen Städten und Gemeinden gang und gäbe. Ein Oberbürgermeister sagt Raffgier und Geklüngel den Kampf an – er sieht sie als Ursprung der Glaubwürdigkeitskrise von Politik.
Da wird ein Regenrückhaltebecken abgesegnet, grösser, als der Ort es eigentlich bräuchte, damit sich der Auftrag für den Bauunternehmer lohnt, mit dem der Fraktionschef schon im Sandkasten spielte. Oder ein anderes Beispiel: Ein Flurstück wird in der Ratssitzung nur deshalb zu Bauland ernannt, weil eine Fraktion ihre Zustimmung zu einer anderen Entscheidung von diesem Ja abhängig macht. All das ist nicht strafbar, viele mögen es gar für normal halten, zumindest für allzu menschlich. Eine Hand wäscht nun mal die andere, man kennt sich, und man hilft sich. So stand es gestern geschrieben in der deutschen Zeitung WELT.
Wenn Sie sich nun fragen, was dieser WELT-Artikel mit obigem Blick-Artikel zu tun hat, sollten Sie die WELT-Zeilen nochmals in aller Ruhe und ohne Befangenheit lesen. Die Analogien zur Schweiz sind erschreckend.
Vetternwirtschaft, Raffgier, Postengeschacher und Geklüngel sind keine Phänomene der deutschen Politik. Sie finden auch in der Schweiz auf allen politischen Ebenen statt. Vom einfachen, oftmals unbedarften Gemeinderat bis hinauf in die höchsten Sphären der Schweizer Politik.
-
9.10.2022 - Tag der Hobby-Astrologen
Russland-Experte über Kremlchef: «Wenn es so weitergeht, wird Putin innert eines Jahres stürzen»
Immer heftigere Rückschläge und kaum noch Rückhalt in der eigenen Bevölkerung: Für Russland-Präsident Wladimir Putin wird es eng. Ein Experte bezweifelt, dass sich Putin noch lange an der Macht halten kann.
Russland gerät im Ukraine-Krieg immer mehr unter Druck. Auch Präsident Wladimir Putin (70) geniesst im Kreml längst nicht mehr den gewohnten Rückhalt. Hinter den Kulissen regt sich Widerstand. Russische Lokalpolitiker starteten sogar eine Petition, um den Präsidenten abzusetzen.
Auch der Journalist und Chefermittler der Recherche-Gruppe Bellingcat, Christo Grozew, sagt, Putin stehe unter massivem Druck. «Derzeit verändert Putin die Kriegsstrategie im Wochenrhythmus», sagt Grozew in einem Interview mit der «SonntagsZeitung».
Auch Kriegsbefürworter gegen Putin
Erst habe Putin versucht, die Ukraine «im Handstreich» einzunehmen. Das habe aber nicht geklappt. Deswegen habe er private Söldnertruppen und sogar Gefangene an die Front – ebenfalls ohne Erfolg. «Jetzt gibt es offenbar auch massive Probleme mit der Teilmobilmachung. Und das sehen auch die Machteliten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch viel länger mitmachen», so der Experte.
Mittlerweile habe Putin nicht nur Kriegsgegner, sondern auch Befürworter gegen sich. Diese würden ihm vorwerfen, dass seine zögerliche Reaktion nach den herben Niederlagen rund um Kiew und im Osten des Landes für Blutvergiesssen sorgen würden. Grozew ist daher sicher: «Wenn es so weitergeht, wird Putin innert eines Jahres stürzen.» Und er warnt: «Es könnte dabei auch zu grossem Blutvergiessen kommen.»
Wie lange bleibt Putin noch?
Derzeit kommt es in Russland aber noch nicht zu grossen Protesten. Das liege vor allem an der brutalen Reaktion auf die Proteste. «Die Leute werden niedergeprügelt, verhaftet und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt», so der Bellingcat-Journalist zur «SonntagsZeitung». Allerdings sehe man bei der Suchmaschine Yandex, dem russischen Pendant zu Google, eine stark ansteigende Unzufriedenheit. Am Tag der Mobilisierung war eine der häufigsten Anfragen, wann die nächsten Präsidentschaftswahlen stattfinden.
«Wenn Putin durch ein Wunder beim nächsten regulären Wahltermin 2024 noch an der Macht ist, werden viele Menschen gegen ihn stimmen», ist Grozew denn auch überzeugt. Weil Putin in diesem Falle aber die Wahlen wohl fälschen lassen würde, käme es wohl zu grösseren Protesten.
Ob Putin sich bis dann an seine Macht klammern kann, ist für den Russland-Experten aber stark fragwürdig. Schreibt SonntagsBlick.
Die inzwischen im Stundenrhythmus in den Livetickern veröffentlichen Wasserstandsmeldungen der geistigen Erben von Uriella und Mike Shiva über Putins Ende haben einen gravierenden Nachteil. Sie sind alle im Konjunktiv geschrieben.
Also mehr oder weniger sinnlos, denn sie basieren nicht auf faktenbasierten Grundlagen oder historischem Wissen, sondern einzig und allein auf reinen Spekulationen der Art «Wenn meine Tante Räder hätt, wär sie eine Schese!»
Solange Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht verliert, wird es auch keine nennenswerte Opposition gegen den Krieg innerhalb Russlands geben, die sich auf den Plätzen Moskaus oder St. Petersburg sichtbar macht.
Die Hunderttausenden von jungen Russen, die angeblich ihr Land wegen der Mobilmachung verlassen haben, sind ja nicht per se gegen den Krieg. Jedenfalls hörte man bisher von ihnen nichts davon.
Sie fliehen aus Gründen ihrer eigenen Befindlichkeit. Putins Krieg wurde bis zur Mobilmachung akzeptiert, aber dafür in den Kampf zu ziehen und womöglich das eigene Leben zu verlieren liegt nicht in ihrer Zukunftsplanung. Da bleibt einem als Ausweg aus der Misere schlicht und einfach nicht viel mehr als die Flucht.
Ob Putin fällt oder nicht liegt mehr oder weniger ausschliesslich in den Händen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Und der wird bekannterweise von Putin dominiert.
Ohne Zerschlagung des FSB ist es auch ziemlich egal, wer Putin beerben könnte. Dass es ein Hardliner sein würde, ist beim FSB so sicher wie das Amen in der Kirche. Für den Westen alles andere als eine angenehme Vorstellung. Führt sie doch vom Regen direkt in die Traufe.
Es könnte aber auch sein, dass Putin morgen an einem Kreislaufversagen stirbt oder in zehn Jahren noch immer Präsident Russlands ist. Er wäre dann gar nicht viel älter als der derzeitige US-Präsident Joe Biden, der am 20. November 2022 79 Jahre alt wird.
Je mehr Krisen uns heimsuchen, desto heftiger plädiere ich für ein Verbot des Konjunktivs. Zum eigenen Wohle und einer vernünftigen Verarbeitung all der Tragödien. Denn was ich nicht weiss, macht mir auch nicht heiss.
Und Hand aufs Herz: Wie lange Putin noch lebt oder an der Macht bleibt, entscheiden nicht unsere Hobby-Astrologen. Ich übrigens auch nicht. Happy Sunday!
-
8.10.2022 - Tag der hohlen SP-Phrasen
Partei im Formtief: «Wir gewinnen langfristig sowieso»: SP gibt sich kämpferisch
Die SP hat derzeit keinen guten Lauf. Viele Wahlen gehen verloren, jüngst zudem die AHV-Vorlage. Wohin geht der Weg?
Traditionellerweise treffen sich die Zürcher Genossinnen und Genossen im altehrwürdigen Zürcher Volkshaus zu ihren Versammlungen. Die Kantonalpartei hat am Donnerstag dort in einem der nüchternen Konferenzsäle offiziell ihren Zürcher Wahlkampf eröffnet. Eher nüchtern war auch die Stimmung unter den Parteimitgliedern, Wahlkampf-Euphorie war im sogenannten weissen Saal wenig zu spüren.
«Das ganze Land hat verloren, nicht die SP»
Haben die jüngsten Wahl- und Abstimmungsniederlagen den Genossen aufs Gemüt geschlagen? Stellt man diese Frage der ebenfalls anwesenden Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran, sagt sie: «Welche Niederlagen?» Und angesprochen auf die AHV-Abstimmung doppelt Badran nach. «Es schmerzt, aber nicht wegen der Partei. Nicht die SP hat verloren, sondern Millionen von Rentnern und Rentnerinnen haben verloren; das ganze Land hat verloren.»
Anja Gada, seit einem Jahr bei der SP, sieht in der Niederlage sogar eine Chance für die Partei. «Die AHV-Vorlage hat gezeigt, dass die Mehrheit von weissen, alten Männern Frauen überstimmt haben und feministische Anliegen nicht ernst genommen wurden. Dies gibt unserer Partei auch einen Aufschwung für die kommenden Wahlen.»
Alles Schönrederei?
Werden hier Niederlagen schöngeredet, Machtverlust in Gewinn umgewandelt? Nicht alle sehen das so. Andreas Burger zum Beispiel sagt zur AHV-Niederlage klipp und klar: «Wir haben falsch argumentiert, in einer Argumentation, welche nicht mehr zeitgemäss ist.» Zudem sei die Gleichstellungsthematik der falsche Fokus gewesen. Man hätte viel mehr auf die Finanzierung fokussieren sollen.
Auch bei anderen Themen ortet der Zürcher Sozialdemokrat Missstände bei der Kommunikation, beispielsweise beim Thema Corona, wo die SP dafür sorgte, dass den KMUs schnell und unbürokratisch unter die Arme gegriffen wurde oder beim Thema Europa, mit welche sich nun die Grünliberalen profilieren. «Das Problem ist, dass wir es nicht schaffen, bei diesen Themen wahrgenommen zu werden.»
Zuversicht bei den Genossen und Genossinnen
Burger ist nicht der einzige, der so denkt. Tue Gutes und rede darüber, das müsse vermehrt das Motto sein, sagt auch Monika Wicki. «Wir könnten uns pointierter äussern, wollen aber auch nicht populistischer werden.» Genosse Matthias Sagi-Kiss unterstützt sie. «Man muss den Menschen klarmachen, dass die SP für ihre Anliegen kämpft. Anscheinend ist dies zu wenig angekommen.»
Der Tenor bei vielen Zürcher Genossinnen und Genossen gestern im weissen Saal – die SP setzt die richtigen Themen, aber kann sie zu wenig gut beim Volk verkaufen. Hingegen sind alle Befragte überzeugt, dass nach den teils happigen Wählerverlusten kantonal und national die Talsohle erreicht ist. So sagt Genossin Barbara Bussmann: «Ich gehe nicht davon aus, dass die SP verlieren wird.»
Auch Badran zeigt sich optimistisch. «Ich bin zuversichtlich. Die Forderungen der SP – AHV, Frauenstimmrecht, UNO-Beitritt, Fristenlösung – werden irgendwann in der Mitte der Gesellschaft angekommen sein und Realität werden. Wir gewinnen langfristig sowieso.» Bei ihr scheinen Wahlresultate keine so wichtige Rolle zu spielen, bei der Basis doch schon eher. Schreibt SRF.
Der Aderlass an Stimmen bei Wahlen ist wahrlich kein Phänomen der Schweizer SP. Die sozialistischen Parteien Europas mussten mit wenigen Ausnahmen (Dänemark, Schweden) generell Federn lassen und haben einen Grossteil ihrer angestammten Wählerschaft für immer verloren.
Einige, wie die «Parti socialiste» Frankreichs, vor der Ära Macron noch Regierungspartei, haben sich gar bis zur Bedeutungslosigkeit marginalisiert.
Dafür gibt es viele Gründe. Der hoffnungslos veraltete und aus der Zeit gefallene Kampfbegriff «Genossinen und Genossen» mag einer davon sein. Zu sehr erinnert diese Floskel an die unseligen Zeiten des Kommunismus.
Hinzu kommt, dass die SP Schweiz, der wir viele soziale Errungenschaften verdanken, ihre seinerzeit sprichwörtliche Kampagnenfähigkeit verloren hat.
Das mag zu einem gewissen Teil mit ihrem Eintritt in die Landesregierung zusammenhängen. Der SP-Blick richtet sich inzwischen zu häufig auf marginale Splittergruppen und Minderheiten, mit deren Anliegen nun mal kein Blumentopf zu gewinnen ist.
Um wieder Boden zu gewinnen, müsste sich die SP ihrer Polit-Granden*innen entledigen, denn Phrasen wie die Botschaft «an die Menschen, dass die SP für ihre Anliegen kämpfe», sind so unvermittelbar wie falsch und lächerlich.
Beschwichtigungsfloskeln wie «Das ganze Land hat verloren, nicht die SP» grenzen ja beinahe schon an Täter-Opfer-Umkehr.
In erster Linie kämpft das Führungspersonal der SP mit seinem sprichwörtlichen Postengeschacher vor allem für das persönliche Wohlergehen. Und das ist langfristig für eine «soziale» Partei stets der Weg in den Untergang.
Was die Wähler*innen bei den «bürgerlichen» Parteien als Gottgegeben hinnehmen, weil es scheinbar zur politischen DNA der Bürgerlichen gehört, lässt man den «Sozen» nicht durchgehen. Das Wahlvolk bestraft sie gnadenlos an der Urne.
Wenn zwei das Gleiche tun, ist eben noch lange nicht das Gleiche. Eine soziale Ideologie verträgt sich nun mal nicht mit abgebrühtem Neoliberalismus. Da wählt man besser gleich das Original.
Blocher hatte mit seiner Aussage, dass die SP mehr Millionäre unter ihren Mitgliedern aufweise als die SVP für einmal tatsächlich recht. Und das will was heissen.
Fazit: Die SP Schweiz hat weder das Personal noch eine Agenda, um die Menschen für einen «Zeitenwandel» zu begeistern und mitzunehmen. Sie ist nicht die Lösung für die anstehenden Sorgen und Nöte der Bevölkerung, sondern Teil der anstehenden Probleme.
-
7.10.2022 - Tag der potemkinschen Dörfer
Wladimir Putin ist 70 – und seine Kritiker bringen sich in Stellung
Wladimir Putin, seit zwei Jahrzehnten an den Hebeln der Macht, ist 70. Als Pragmatiker gilt er lange nicht mehr, eher wirkt er destabilisierend.
Russlands Präsident Wladimir Putin liebt prunkvolle Paläste und gutes Essen. Doch nach Feiern ist ihm wohl nicht zumute. Heute, Freitag, an seinem 70. Geburtstag, wolle er arbeiten, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Einer Feier am nächsten kommt am ehesten das Programm für den Nachmittag – dann will Putin einen inoffiziellen Gipfel mit den Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) abhalten. Die militärischen Misserfolge der letzten Zeit, öffentliche Kritik an der Teilmobilisierung, die Massenflucht tausender Reservisten ins Ausland – Putin steht unter Druck.
Denn seine Kritiker bringen sich in Stellung. Allen voran der wortgewaltige Ramsan Kadyrow, der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, der die Führung der Kampfhandlungen jüngst kritisierte, den Putin nun aber beförderte. Auch aus der Bevölkerung kommt zunehmend Kritik. Zu spüren ist das in Moskau vor allem bei jüngeren Leuten.
Kämpfe rücken näher
Bis zur Teilmobilisierung russischer Reservisten war die "Spezialoperation" etwas, das weit weg war vom Leben normaler Menschen. Das ändere sich nun, meint der Soziologe Grigori Judin. Es gebe grundsätzlich drei Gruppen in der russischen Gesellschaft. Zum einen die Radikalen, 15 bis 25 Prozent der Bevölkerung. Sie fordern die totale Mobilmachung und eine aggressivere Kriegsführung. Dann die Nichteinverstandenen, ein Viertel der Bevölkerung. Sie lehnen die "Spezialoperation" grundsätzlich ab, haben aber keinerlei Plattform.
Die weitaus größte Gruppe aber, so Judin, seien "die Laien". Eine entpolitisierte Mehrheit, die mit Politik nichts zu tun haben will. Doch genau das haben sie jetzt, nolens volens. Die Mobilisierung kann jeden treffen. Die Kreml-kritische Onlinezeitung Nowaja Gaseta berichtet, mehr als 260.000 Russen hätten schon das Land verlassen, aus Angst vor einer Einberufung. Kreml-Sprecher Peskow sagte laut der regierungsnahen Nachrichtenagentur Ria Nowosti, diese Reaktion sei "hysterisch und hochemotional".
Niederlage nicht als Sieg zu verkaufen
Für Wladimir Putin seien die militärischen Misserfolge gefährlich, so der Soziologe Judin. "Kann er eine Niederlage als Sieg verkaufen? Nein. Die Radikalen werden sie rundheraus als das bezeichnen, was sie ist. Und die Laien werden ihm nicht verzeihen, dass er ihr tägliches Leben in Mitleidenschaft gezogen hat." Judins Fazit: "Die militärische Niederlage in einem Krieg, bei dem er das ganze Land aufs Spiel gesetzt hat, wird Putin nicht überleben."
Politologe Abbas Galljamow kennt den Kreml, er war dort Redenschreiber. "Putin ist heute der größte destabilisierende Faktor", meint er. Doch Galljamow sagt auch, dass Putins Ressourcen noch gewaltig seien. Jedoch, "Putin wird verstehen müssen, dass die Zeit, die ihm die Geschichte für die Wahl seines Nachfolgers eingeräumt hat, nicht unendlich ist. Je schwächer der Präsident in dem Moment sein wird, in dem er den Namen seines Nachfolgers bekanntgibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass einige Eliten ihm den Gehorsam verweigern."
Kampf um Nachfolge
Ein Nachfolger aus dem Machtapparat wäre die wahrscheinlichste Lösung. Putin könnte jemanden benennen, dem er vertraue, meint Galljamow. Als Kandidaten sieht er Sergej Sobjanin, Bürgermeister von Moskau. Nachteil: Er sei "zu pragmatisch, und alle gängigen 'patriotischen' Ideale in Form von Sorge angesichts des Vordringens der Nato nach Osten, der Feindschaft mit den USA, des Kampfs gegen 'Ukrofaschismus' sind ihm unendlich fremd".
Einen echten, designierten Nachfolger für Wladimir Putin gibt es nicht. Und – es gibt eine Unbekannte: die russischen Oligarchen. Auch unter den Oligarchen gibt es Kritik an Putins "Spezialoperation". So verurteilte der Banker Oleg Tinkoff öffentlich die russische Invasion: "Das ist undenkbar und inakzeptabel! Staaten sollten Geld für die Behandlung von Menschen ausgeben, nicht für Krieg."
Wie werden sich die Oligarchen verhalten beim Machtwechsel? Kommen die Machtkämpfe zurück wie in den 1990er-Jahren? Viele in Russland erinnern sich an die Zeit. Allein im Jahr 1994 wurden mehr als 600 Unternehmer, Politiker und Journalisten ermordet. Schreibt Jo Angerer aus Moskau im DER STANDARD.
Jeden Tag wird von den unzähligen Putin-Experten eine neue Sau durchs potemkinsche Dorf getrieben, die das Ende des russischen Diktators prognostiziert. Dass das physische Ende eines 70-Jährigen täglich näher rückt, hat mit Expertenwissen aus der Glaskugel von Uriella selig nichts zu tun, mit Biologie, Medizin und Physik allerdings sehr viel.
Wenn angeblich 260'000 Russen – die geschätzten Zahlen schwanken mit einer Bandbreite bis zu mehr als einer halben Million hin und her – die russische Heimat wegen der Einberufung in die Armee verlassen, bedeutet das noch lange nicht das Ende von Putins Herrschaft.
Der Westen reibt sich die Hände und freut sich über die angeblich russischen IT-Cracks und sonstigen hochgebildeten Koryphäen, die da kommen.
Ein Irrtum, dem die hehre westliche Wertegemeinschaft schon 2015/16 bei der völlig falschen Einschätzung der Flüchtlingswelle aus Syrien und Afghanistan unterlag. Was vermutlich auch als «Beruhigungspille für das Volk» dienen sollte.
Der Exodus dieser jungen, komfortbewussten russischen Männer ist für Putin eher ein Geschenk. Fehlen diese doch als wahrnehmbare Opposition in Russland, um sein Unrechtsregime ein für allemal zu beseitigen.
Wie die Historie des flächenmässig grössten Landes der Welt seit der Herrschaft der Zaren beweist, finden Revolutionen in Russland fast ausschliesslich nach verlorenen Kriegen mit gravierenden Landverlusten und der damit eingehenden Verarmung und Verschlechterung der Lebensbedingungen der Bevölkerung statt.
Doch leider folgte bisher jedem «Regime Change» in Russland eine noch verkommenere Sippe. Was auch bei einem allfälligen Sturz des jetzigen Machthabers Putin der Fall sein dürfte.
-
6.10.2022 - Tag der Impfdosen für den Analsex unter Männern
Trotz Ankündigung Ende August: Affenpocken – Noch immer fehlt dem BAG der Impfstoff
Der Bundesrat hat Ende August beschlossen, 40'000 Impfdosen zu besorgen. Doch noch immer gibt es keine Lieferverträge. Pink Cross kritisiert dafür das BAG scharf.
Die Erleichterung bei der Aids-Hilfe Schweiz und dem Schwulen-Dachverband Pink Cross war gross, als der Bundesrat Ende August beschlossen hatte, 40'000 Impfdosen gegen Affenpocken zu besorgen. Denn bisher haben sich vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, mit den Affenpocken infiziert.
Noch keine Verträge unterzeichnet
Doch in trockenen Tüchern ist der Handel mit der Lieferfirma Bavarian Nordic noch nicht. Auf Anfrage schreibt das zuständige Bundesamt für Gesundheit BAG, dass es «sich derzeit in Vertragsverhandlungen mit dem Hersteller des Impfstoffs und demjenigen von Medikamenten» befinde. «Sobald die Verträge unterzeichnet sind, werden wir darüber informieren.»
Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross, hat dafür kein Verständnis. «Es ist für mich völlig unverständlich, dass der Bund auch sechs Wochen nach dem Entscheid des Bundesrates noch immer keinen Vertrag unterschrieben hat.»
Beim BAG hält man fest, dass diese zentrale Impfstoffbeschaffung durch den Bund einige Hürden zu meistern hatte, wie beispielsweise die Bewilligung durch die Finanzdelegation anfangs September. «Vertragsverhandlungen können Zeit in Anspruch nehmen, da die Bedingungen durch die beteiligten Parteien geprüft und angenommen werden müssen. Weitere Angaben dazu können wir im Moment nicht machen.»
Zeitpunkt der Auslieferung weiterhin unklar
Auch einen ungefähren Zeitpunkt, bis wann die Impfdosen ausgeliefert werden können, will man beim Bund nicht machen. Das sei sehr ärgerlich, sagt Heggli. Ende August habe man darauf gehofft, dass in der Schweiz binnen weniger Tage oder Wochen mit dem Impfen begonnen werden könne.
«Wir spüren jetzt natürlich einen riesengrossen Frust wieder in der Community, weil man immer noch auf diese Impfung wartet, obwohl alle anderen Länder in der EU längst am Impfen sind oder diese Impfung bereits abgeschlossen haben», sagt Heggli.
Mittlerweile scheint der Höhepunkt der Ansteckungswelle überschritten. Seit einem Monat sinken die Fallzahlen in der Schweiz stark. In der letzten Woche wurden gerade noch fünf neue Affenpockenfälle registriert. Schreibt SRF.
«Denn bisher haben sich vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, mit den Affenpocken infiziert», steht da geschrieben. Der Bund ist also laut Forderung von Pink Cross inzwischen auch noch für Analsex unter Männern zuständig?
40'000 Impfdosen sollen besorgt werden, von denen wie viele Millionen genau ungebraucht zu Lasten der Bundeskasse, also zu Lasten der Steuerzahler*innen, irgendwann ähnlich den übrig gebliebenen Corona-Impfdosen entsorgt werden müssen, lässt Pink Cross offen.
Welch glückliches Land, das in Zeiten wie diesen, in denen viele Menschen nicht wissen, wie sie die kommenden Strom- und Heizkosten bezahlen sollen und die Krankenkassenprämien ins Unermessliche steigen, solche Sorgen hat.
Während viele Menschen in der Schweiz wegen Inflation/Teuerung Verzicht üben müssen, scheint Analsex unter Männern beinahe systemrelevant zu sein.
-
5.10.2022 - Tag der Legenden vom 5.10.1962
Heute vor genau 60 Jahren wurde am 5. Oktober 1962 in London Geschichte geschrieben - Ich schaue zurück
In einem Londoner Kino wurde am 5. Oktober 1962 der erste James Bond-Film «James Bond – 007 jagt Dr. No» uraufgeführt. Die beiden Hauptdarsteller Sean Connery und Ursula Andress als «Honey Rider» schafften damit jeweils ihren internationalen Durchbruch.
Die Romanfigur von Ian Fleming eroberte als Blockbuster die Kinos Welt und wird bis zum heutigen Tag in immer neuen Folgen weiterproduziert.
Legendär auch die Bond-Songs, die ab dem zweiten Bondfilm für jede Filmepisode neu komponiert und von diversen Künstlerinnen und Künstlern dargeboten wurden. Wer erinnert sich nicht an «Goldfinger» von Shirley Bassey? Oder «Golden Eye» von Tina Turner.
Der erste Bond-Darsteller Sean Connery verstarb am 31. Oktober 2020 im Alter von 90 Jahren. Das erste Bond-Girl Ursula Andress, geboren am 19. März 1936 in Ostermundigen im Kanton Bern, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt heute in ihrer Residenz in Rom.
Ebenfalls am 5. Oktober 1962 veröffentlichten die Beatles in London ihre erste Single mit dem Titel «Love me do». Damit begann der Siegeszug der «Fab Four» rund um den Erdball.
Mit mehr als 600 Millionen – nach Schätzungen ihrer Plattenfirma EMI sogar mehr als einer Milliarde – verkauften Tonträgern sind die Beatles die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Zwischen 1964 und 1969 führten sie zeitweise in fast allen Ländern auf der ganzen Welt die Hitparaden an.
Ihre öffentlichen Auftritte gerieten zu Massenveranstaltungen, die zunehmend durch ein ekstatisches Publikum (vowiegend junge Frauen) ausser Kontrolle gerieten. Viele der Konzertsäle konnten die vier britischen Superstars nur noch mit starkem Polizeischutz erreichen und wieder verlassen.
Für uns, die wir damals Teenager waren, läuteten beide Ereignisse eine neue Ära ein. Die Haarfrisuren änderten sich und der Mief, vorwiegend noch aus dem vergangenen Jahrhundert stammend, wurde über Bord geworfen.
Sehen Sie sich hier das Video zum Beatles-Song «Love me do» an.
-
4.10.2022 - Tag der neidischen Glatzköpfe
«Das ist eine absolute Frechheit, ja ein Skandal»: FCL-Legenden gehen auf Alpstaeg los
Das Sonntagsblick-Interview mit Bernhard Alpstaeg (77) hat eingeschlagen wie ein Meteorit. Der FCL reagiert mit einem scharfen Communiqué. Und die Klub-Legenden sind fassunglos.
Würde René van Eck heute durch Luzern laufen, die halbe Stadt würde sich vor ihm verneigen. Acht Jahre lang hielt der Holländer seine Knochen für den FCL hin, 1992 wird der Innenverteidiger Cupsieger, auch als Trainer steht er auf der Allmend an der Seitenlinie. Der Mann ist eine lebende Legende. Klar, dass er seinen FC Luzern noch immer hautnah verfolgt. Logisch, dass er die Aussagen von Bernhard Alpstaeg im Sonntagsblick mitbekommen hat.
Der Swisspor-Patron kritisiert die Führung um Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer massiv. Für Van Eck, der aktuell Assistenztrainer beim belgischen Zweitligisten Deinze ist, ein No-Go: «Was Bernhard Alpstaeg aufführt, ist eine absolute Frechheit, ja ein Skandal. Sorry, das geht gar nicht!» Alpstaeg komme sporadisch immer wieder mit diesem Mist. «Alle paar Jahre greift er öffentlich seine Leute an, anstatt das intern zu regeln. Ich weiss nicht, ob er das braucht. Es ist auf jeden Fall unerklärlich. Darüber wird doch vor einem Spiel in der Kabine ausführlich gesprochen, das ist unausweichlich. Und wenn Mario Frick sagt, das habe Einfluss, dann pflichte ich dem voll und ganz bei.»
Dass Alpstaeg die langen Haare von Sportchef Remo Meyer kritisiert, setze dem Ganzen die Krone auf. «Dann kommt er wieder mit dem Zopf bei Remo Meyer. Wie schon bei Heinz Hermann und mir. Unglaublich ist, dass er mich dafür kritisierte, obwohl er mich nicht kannte. Das sagt alles über diesen Menschen. Unfassbar, das Ganze!»
Auch Babbel fassungslos
Auch Markus Babbel hat schon Bekanntschaft mit Alpstaeg gemacht. Der bezeichnete den damaligen Coach als «Birchermüesli-Trainer», kurz darauf wurde Babbel entlassen. Dass Alpstaeg den Zweihänder rausholt sei deshalb nicht überraschend, so der Blick-Kick-Experte. Unnötig sei es gleichwohl: «Nun hat man die schwierige sportliche Situation gemeistert, die Fans kommen wieder vermehrt ins Stadion. Der Trend zeigt klar nach oben, man könnte in Ruhe weiterarbeiten und dann kommt der Investor und glaubt, er müsse dagegen steuern. Was Herr Alpstaeg Sportchef Meyer vorwirft, hört man ja heraus, aber was er genau Präsident Wolf vorwirft, ist mir ein Rätsel.»
Urs «Longo» Schönenberger, der mit dem FCL Meister und Cupsieger wurde, nimmt Alpstaeg in Schutz: «Grundsätzlich hat der Geldgeber das Recht seine Meinung zu äussern – auch öffentlich. Vielleicht hat er dazu nicht den passenden Zeitpunkt gewählt. Nun sollte Alpstaeg entweder schnell handeln oder man soll sich versöhnen. Damit so schnell wie möglich beim FCL Ruhe einkehrt.»
FCL reagiert scharf
Dass dies passieren wird, ist aber mehr als fraglich. Die Fronten sind verhärtet, der FCL reagiert am Montagmorgen mit einem Communiqué auf die Unruhen, ohne dabei Alpstaeg namentlich zu nennen.
Man lasse sich nicht vom Weg abbringen, schreibt der FCL im Namen von Vizepräsident Josef Bieri: «Weder durch mutwillige Falschaussagen, die in den Medien derzeit systematisch gestreut werden, noch durch Störmanöver oder unnötige Machtkämpfe, die gerade in Luzern und in der Innerschweiz der Vergangenheit angehören sollten», so Bieri. «Der FC Luzern schützt seine Mitarbeitenden und reagiert auf Angriffe auf deren Integrität, welche wir klar verurteilen, mit geeigneten Massnahmen.» Der Vizepräsident schliesst mit klaren Worten: Der FC Luzern sei «grösser als jede Person, in welcher Position sie auch immer tätig ist oder Einfluss zu nehmen glaubt». Wummms!
Viel Zuspruch also für die sportliche Führung um Meyer und Wolf. Doch dieses Kapitel ist in Luzern damit nicht zu Ende geschrieben – die Schlammschlacht hat erst begonnen. Schreibt Blick.
Wenn Alpstaeg die langen Haare von FCL-Sportchef Remo Meyer kritisiert, ist das nichts anderem als dem sogenannten «Neid der Besitzlosen» zuzuschreiben, trägt doch «Don Alpensteg», wie der erfolgreiche Unternehmer und Multimillionär in Mafia-Kreisen genannt wird, eine veritable Glatze mit sich herum.
-
3.10.2022 - Tag der arabischen Zustände bei der Immobilienbranche
19° in den Wohnungen: Bundesrätlich angeordnetes Frieren könnte zu Klagen führen
Die vom Bundesrat erlassene Vorschrift, dass Wohnungen im Krisenfall nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden dürfen, kollidiert mit einem Urteil des Bundesgerichts, wonach Wohnungen mindestens 20 Grad warm sein sollten. Ansonsten dürfe eine Entschädigung eingefordert werden. Der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft befürchtet, dass zahlreiche Mieterinnen und Mieter vor Gericht klagen werden, weil ihre Wohnungen ungenügend geheizt seien.
Im Fall einer Mangellage sollen Wohnungen mit Gasheizungen maximal auf 19 Grad beheizt werden, regt der Bundesrat an. Diese Regelung sei derzeit nicht praktikabel umsetzbar, kritisiert die Immobilienwirtschaft. Zudem könnten Vermieter verpflichtet werden, Mietzinsreduktionen zu gewähren.
Recht auf Reduktion des Mietzinses?
Denn eine zu kalte Wohnung gilt gemäss Obligationenrecht wie beispielsweise fleckige Wände, der Ausfall eines Lifts im vierten Stock oder Baulärm in der darüber liegenden Wohnung als «Mangel». Mieterinnen und Mieter können in solchen Fällen auf eine Reduktion des Mietzinses pochen.
Wie hoch eine solche Reduktion ausfällt, bleibt Ermessenssache des Gerichts. Gemäss Merkblatt des Mieterverbandes kann beispielsweise bei einer Raumtemperatur zwischen 16 und 18 Grad mit einer Reduktion der Miete um rund 20 Prozent gerechnet werden.
Im Fall der vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebenen 19-Grad-Regel für Innenräume, die zu mehr als der Hälfte durch den Einsatz von Gas oder durch ein mit Gas betriebenes Fernwärmenetz erwärmt werden, könnte theoretisch ebenfalls ein Mangel vorliegen.
Bund verweist auf Gerichte
«Für Klarheit könnten nur die für das Mietwesen zuständigen Gerichte sorgen», schreibt deshalb auch der Bund in seinem Kommentar zum Entwurf einer Verordnung über Verbote und Beschränkungen der Verwendung von Gas von Ende August, über die die «SonntagsZeitung» berichtet.
Allerdings geht der Bund davon aus, dass der juristische Spielraum für die temporäre Massnahme bei weitem ausreicht. Er weist in seinem Kommentar darauf hin, dass in Innenräumen Temperaturen von 20 bis 22° Celsius üblich seien. Eine lediglich zeitlich befristete Mindertemperatur von rund drei Grad dürfte «in der schweizerischen Mietrechtspraxis durchaus noch als zulässig» gelten.
Verband fordert konkrete Vorgaben
Dass der Bundesrat in seinem Kommentar zum Verordnungsentwurf aber dennoch auf den Gerichtsweg verweist, kritisiert der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft SVIT Schweiz in seiner Stellungnahme vom 20 September. So bleibe die Ausgangslage unklar; den Vermietern könnten Klagen auf Mietzinsreduktionen drohen.
Der SVIT erwartet gemäss Stellungnahme vom Bundesrat, «hier Klarheit zu schaffen und die betreffenden Temperaturen für die Dauer der Anwendung der Verordnung als mietrechtskonform zu bezeichnen».
Der Verband kritisiert zudem, dass sich die 19-Grad-Regel gar nicht praktikabel umsetzen liesse. In Bodennähe sei die Temperatur tiefer als direkt unter der Decke, und im Badezimmer anders als im Schlafzimmer, wird SVIT-Geschäftsführer Marcel Hug in der «SonntagsZeitung».
In seiner Stellungnahme hatte der Verband deshalb verlangt, dass der Bund konkrete Vorgaben zur Raumtemperatur-Messung definiere – «also mit welcher Methode beziehungsweise Gerätschaft, auf welcher Höhe, über welche Dauer, in welchen Räumen und durch wen». Schreibt SRF.
Liebe Mieterinnen und Mieter. Dass der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft SVIT not amused ist, liegt auf der Hand. Aus gut unterrichteten Kreisen kann ich Ihnen ein streng gehütetes Geheimnis verraten, auch wenn ich es nicht dürfte:
Viele Verwalter*innen der «united swiss hohle Hand» Wohnungsvermieterbranche sind gar nicht interessiert, Heizkosten zu sparen. Erstens bezahlen sie diese Kosten ja nicht aus dem eigenen Sack, weil Heizkosten zu 100 Prozent auf die Mieter*innen abgewälzt werden.
Zweitens, und das ist das eigentliche streng gehütete Thema, erhalten sie von den Heizöl- und Gaslieferanten separat abgerechnete Prämien, die in den wenigsten Fällen an das «Mieterpack» weitergegeben werden. Je mehr Heizöl oder Gas bestellt wird, umso höher ist die Prämie.
Dass unter diesen Umständen Energiesparen für die Wohnungsvermieter*innen nicht wirklich sexy ist, erstaunt Insider der Branche denn auch nicht sonderlich.
In arabischen Ländern nennt man das «Bakschisch». In den angelsächsischen «Black Money». Kein Wunder sind Immobilienfritzen im Ranking der am wenigsten angesehenen Branchen/Berufe an zweitletzter Stelle zu finden. Getoppt nur von den Autoverkäufern. Kinderschänder sind in diesem Ranking nicht gelistet. Die würden vermutlich auch noch vor der Immobilienbranche landen.
Gut zu wissen auch, dass die Immobilienwirtschaft nach der Gesundheitsindustrie die am besten mit der Politik vernetzte und verbandelte Branche ist.
Falls Sie dies nicht glauben, sollten Sie mal den/die/das von Ihnen gewählten Nationalrat*in/Ständerat*in auf seine/ihre Mandate im Immobilienbereich überprüfen. Sie werden nur noch staunen und wie Ludwig Hirsch «des gibt's doch net» schreien!
-
2.10.2022 - Tag der Pest und Cholera in Brasilien
Gewalt begleitet Präsidentschaftswahl in Brasilien
In der letzten Phase des Wahlkampfes in Brasilien sind politische Beobachter, das Militär und der Oberste Gerichtshof in Alarmbereitschaft. Sie rüsten sich für den Fall einer Eskalation politischer Gewalt. Brasilien wählt am Sonntag eine Präsidentin oder einen Präsidenten. Die Wahl einer Präsidentin ist dabei aber fast ausgeschlossen. Denn für acht der zehn Kandidatinnen und Kandidaten ist kaum Platz im politischen Diskurs. Zu stark ist die Polarisierung zwischen dem ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, meist nur Lula genannt, und dem Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Lulas Arbeiterpartei belegt das linke und Bolsonaros Partido Liberal (PL) das rechts außen liegende Feld. Die starke Spaltung der Wählerschaft sorgt nicht nur dafür, dass Lula in den jüngsten Umfragen 50 Prozent der Stimmen und Bolsonaro 36 Prozent der Stimmen vorausgesagt werden. Sie sorgen auch für verstärkte Gewalt.
In Cascavel – eine mittelgroße Stadt im Nordosten von Brasilien – ist am Montag laut Medienberichten ein Mann in eine Bar gegangen und hat gefragt, ob einer der Anwesenden Lula unterstütze. Der Barmanager Antônio Carlos Silva de Lima meldete sich und sagte, dass er für den ehemaligen Gewerkschaftsführer stimmen würde. Nach einem darauffolgenden Streit habe der Mann Silva de Lima ein Messer in den Rücken gerammt. Der Barmanager wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, überlebte die Verletzung aber nicht.
Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen, behauptete, dass er zuvor vom Opfer angegriffen worden sei. Zudem wies er jegliche politische Motivation von sich. Doch laut Anklägerseite widersprechen fünf Zeugenaussagen seiner Darstellung. Falls sich die derzeitigen Berichte bewahrheiten, wäre es der vierte politisch motivierte Mord während des diesjährigen Präsidentschaftswahlkampfes in Brasilien.
67 Prozent haben Angst vor politischer Gewalt
Die Morde sind die drastischsten Beispiele der steigenden Gewalt im südamerikanischen Land. In der Mehrzahl der Fälle sind die Täter Anhänger des derzeitigen Präsidenten, Bolsonaro. Doch vergangenen Samstag erstach ein Lula-Unterstützer einen Bolsonaro-Wähler im Süden des Landes. Die beiden waren laut Polizei zunächst in eine heftige politische Diskussion geraten.
Die Beobachtungsstelle für Gewalt in der Politik an der Universität von Rio de Janeiro hat von Januar bis Juni diesen Jahres 214 Akte von Drohungen und Gewalt gegen politisch engagierte Personen oder deren Angehörigen verzeichnet. Solche Fälle sind seit dem letzten Wahljahr 2020 um mehr als 20 Prozent gestiegen. Einer Umfrage vom Wahlinstitut "Datafolha" zufolge haben 67 Prozent der Brasilianerinnen und Brasilianer Angst Opfer von politisch motivierter Gewalt zu werden.
"Diese ideologisch motivierte Gewalt im hat im Präsidentschaftskampf in Brasilien zugenommen", sagt Mayra Goulart, Professorin für Politikwissenschaften an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro (UFRRJ) im Gespräch mit dem STANDARD. "Das liegt auch daran, dass ein Kandidat der extremen Rechten gewählt wurde, der Gewalt als politische Handlungsform anerkennt." Gefragt nach seiner Sicht auf den Mord eines seiner Anhänger an einem Lula-Wähler Anfang Juli, sagte der Bolsonaro, dass er den Fall bedauere. Aber er klagte über die Berichterstattung, die ihm dafür die Schuld in die Schuhe schieben wolle.
Neue Bewaffnete
"Wir werden die PT-Anhänger alle exekutieren", sagte damals noch Kandidat Bolsonaro bei einer Wahlveranstaltung im Amazonasgebiet im Jahr 2018. Im September letzten Jahres sagte der Ex-Militärhauptmann und Präsident, dass die einzigen drei möglichen Wahlausgänge für ihn eine Festnahme, der Tod, oder der Sieg seien. Bei einer Veranstaltung im August 2021 sagte er "das bewaffnete Volk, wird niemals versklavt werden".
Es sind solche radikalen Aussagen, die laut Goulart die Gewaltbereitschaft Bolsonaros extremster Unterstützer befeuern. Darunter sind auch viele neue Waffenbesitzer. 2019 lockerte Bolsonaro die Regeln für den Waffenbesitz und seitdem hat sich die Zahl der registrierten Waffenbesitzer im Land verdreifacht. Wie Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Merkel-Raute hat auch Bolsonaro ein Zeichen – die Fingerpistole.
Der vielgenützte Vergleich zwischen Bolsonaro und dem Waffenlobby-nahen, ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist auch Politikwissenschaftlerin Goulart geläufig. Sie unterstreicht aber einen bedeutenden Unterschied: "Die US-Amerikaner haben eine lange Tradition, Waffen zu tragen. Das Recht darauf steht in ihrer Verfassung", sagt die Professorin. "Bolsonaro bewaffnet eine Bevölkerung, für die das neu ist. Wir haben also viele Menschen, die erst seit Kurzem Gewehre besitzen, die sich berufen fühlen, zu diesen zu greifen, um die amtierende Regierung zu verteidigen." Eine solch gewaltfördernde Rhetorik gebe es weder bei den anderen Parteien, noch Kandidaten, meint Goulart.
Angesichts der Gefahr einer Eskalation während der Wahlen, hat das Oberste Wahlgericht Zivilisten das Tragen von Waffen zwischen Samstag und Montag verboten. Am 9. September setzte der Richter des Obersten Gerichtshofs Edson Fachin Erlasse des Präsidenten vorübergehend aus, die den Kauf und das Tragen von Waffen erleichtert hatten. Auch Fachin begründete dies mit der Gefahr politischer Gewalt.
Keine registrierten Wahlbetrüge
Laut der Zeitung "Estadão" regierungsnahe Politiker parallel zu einem Aufruf des Präsidenten am 7. September Angriffe auf die STF propagiert, um sich gegen die "Willkür" der Mitglieder des Gerichtshofs zu wehren. Bei Bolsonaro selbst sind Angriffe auf die Institution, der auch der Wahlgerichtshof unterliegt, Routine. Bei der Eröffnung einer Straße im Juni sagte der Ex-Militär: "Wenn es sein muss, werden wir in den Krieg ziehen. Aber ich möchte ein Volk an meiner Seite haben, das weiß, was es tut und für wen es kämpft." Die Sager folgten der Behauptung, dass Mitglieder des Obersten Gerichtshof "Diebe" seien, die versuchen würden die Freiheit der Menschen zu stehlen. "Die Freiheit ist wichtiger als das Leben selbst, denn ein Mann oder eine Frau ohne Freiheit hat kein Leben", fügte der Präsident hinzu.
Im Juli diesen Jahres versammelte Bolsonaro mehrere Botschafterinnen und Botschafter, um ihnen – ohne Beweise zu präsentieren – zu zeigen, wie unzuverlässig das brasilianische Wahlsystem sei. Im September sagte er, wenn er nicht 60 Prozent der Stimmen erhalte, sei "etwas im Obersten Gerichtshof falsch gelaufen". Seit Einführung des elektronischen Wahlsystem im Jahr 1996 gab es keinen einzigen gemeldeten Fall von Wahlbetrug. Dennoch lenkte das Obsterste Gerichtshof auf Druck der Regierung ein. Somit wird das Militär zum ersten Mal die Wahlprotokolle überprüfen und Stichproben parallel zur Auszählung nehmen.
"Er lehnt die Idee der Gewaltenteilung ab", sagt Goulart über Bolsonaro, "allein die Vorstellung, dass die Streitkräfte die Transparenz bei den Wahlen gewährleisten müssen, ist bereits ein Beispiel dafür." Auf die Wahlen am Sonntag könnte im Fall, dass keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen erreicht eine Stichwahl am 30. Oktober. Goulart befürchtet eine einen bewaffneten Aufstand, im Fall, dass Bolsonaro die Wahl verlieren sollte und sieht die Stichwahl als möglichen Scheidepunkt. "Die zweite Runde wird wahrscheinlich die interessantere und die gefährlichere." Schreibt DER STANDARD.
Das Wahlvolk von Brasilien kann einem wirklich leidtun. Wie in vielen anderen «demokratischen» Staaten dieser schönen neuen Welt (Aldous Huxley) hat es nur die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Denn eines ist auch an der brasilianischen Sonne sonnenklar: Die sozialistische Partei «Partido dos Trabalhadores» (PT) von Luiz Inácio Lula da Silva (Präsident Brasiliens von 2003 - 2011, vom 7. April 2018 bis zum 7. November 2019 in Curitiba im Süden des Landes 580 Tage wegen Korruption im Gefängnis) ist genau so korrupt wie die Partido Liberal (PL) vom derzeitigen Präsidenten Jair Bolsonaro.
Auch wenn das der WWF und die noch auf dem Erdball verbliebenen sozialistischen Parteien völlig anders sehen.
-
1.10.2022 - Tag der alles dominierenden Gruppen
Riesenmeteoriten kommen in Gruppen
Auf dem Mond wurden Reste von Meteoriteneinschlägen gefunden, die zeitgleich mit großen Einschlägen auf der Erde passierten. Darunter jener, der die Dinosaurier auslöschte. Die Dart-Mission der US-Weltraumagentur Nasa hat kürzlich die Aufmerksamkeit auf die Gefahren großer Meteoriteneinschläge gelenkt. Ein Blick auf die Mondoberfläche mag als Erinnerung daran dienen, wie häufig die Einschläge kosmischer Objekte sind und wie heftig sie ausfallen können. Aufgrund der fehlenden Atmosphäre erreichen Meteoriten den Mond ungebremst, und zudem sorgen fehlende Erosion und Tektonik auf dem Erdtrabanten dafür, dass die entstandenen Krater lange Zeit nahezu unverändert bleiben, was beides für die beeindruckende Kraterlandschaft des Mondes sorgt.
Doch der Mond wird in Summe nicht häufiger von Objekten aus dem All getroffen als die Erde. Eine neue Untersuchung, die auf Analysen von Mondstaub basiert, deutet nun darauf hin, dass Erde und Mond in der Vergangenheit sogar nahezu zeitgleich getroffen wurden. Die Übereinstimmung ist zu groß, um zufällig zu sein, wie Forschende nun herausgefunden haben.
Als Ausgangspunkt diente die chinesische Mondmission Chang'e 5, die im Dezember 2020 im Gebiet des Oceanus Procellarum genannten Beckens auf dem Mond landete, um unter anderem zwei Kilogramm Mondmaterial einzusammeln und zurück zur Erde zu bringen.
In dem gesammelten Material, bei dem es sich um Basalt mit Anteilen von Eisenoxid und Titanoxid handelt, fand sich außerdem sogenanntes Impakt-Glas. Dieses entsteht bei Meteoriteneinschlägen, wenn durch die beim Aufprall entstehende enorme Hitze Gestein schmilzt und winzige Tröpfchen bildet, die dann zu glasartigem Material erstarren. Impakt-Glas gehört zu den wichtigsten Quellen von Information über vergangene Meteoriteneinschläge.
Winzige Glasperlen
Dieses Impakt-Glas untersuchten Forschende von der Curtin University aus Perth in Australien im Rahmen einer Studie, deren Ergebnisse nun im Fachjournal "Science Advances" veröffentlicht wurden. "Wir haben eine breite Palette mikroskopischer Analysetechniken, numerischer Modellierung und geologischer Untersuchungen kombiniert, um zu bestimmen, wie diese mikroskopisch kleinen Glasperlen vom Mond entstanden sind und wann", erklärt Erstautor Alexander Nemchin.
Dabei stießen die Forschenden auf überraschende Parallelen zu irdischen Meteoriteneinschlägen. Die Zeiten und Häufigkeiten von Einschlägen deckten sich mit jenen auf der Erde. Insbesondere zeigte sich, dass der prominenteste Meteoriteneinschlag der Erdgeschichte – jener, der den Chicxulub-Krater auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan zurückließ und das Aussterben der Dinosaurier mitverursacht hat –, ein Pendant kleinerer Einschläge auf dem Mond hatte.
"Die Studie ergab, dass große Einschlagsereignisse auf der Erde wie beim Chicxulub-Krater vor 66 Millionen Jahren von einer Reihe kleinerer Einschläge begleitet worden sein könnten", sagt Nemchin. "Wenn das richtig ist, deutet dies darauf hin, dass die Alters-Häufigkeits-Verteilungen der Einschläge auf dem Mond wertvolle Informationen über die Einschläge auf die Erde oder das innere Sonnensystem liefern könnten."
Weitere Forschungen sollen mehr Klarheit bringen, sagt Nemchins Kollegin Katarina Miljkovic. "Der nächste Schritt wäre der Vergleich der aus diesen Chang'e-5-Proben gewonnenen Daten mit anderen Mondböden, um andere signifikante Aufprallereignisse auf dem Mond aufzuspüren, die vielleicht auch Auswirkungen auf der Erde hatten." Schreibt DER STANDARD.
O heilige Maria Mutter Gottes! Als ob wir mit Gruppensex nicht schon genug Rasselbanden hätten, kommen (bzw. kamen) auch noch die Riesenmeteoriten in Gruppen angeflogen. Wer hätte das gedacht?
Ist ja irgendwie wie bei den Flüchtlingsströmen, die derzeit unser Land wieder fluten. Oder die Trychler auf ihren esoterischen Spaziergängen durch die Stadt Luzern. Auch diese beiden Phänomene treten nur in Gruppen auf. Wie die Schwalben, die derzeit in Schwärmen in der Luzerner Neustadt wegen schlechtem Wetter an den Hauswänden hängen geblieben sind und alles zuscheissen, statt in den Süden weiterzuziehen. Als ob man bei schlechtem Wetter nicht Fliegen könnte. Bundesrat Berset kann es doch auch.
Ganz übel aber wird's im Krieg und in der Politik: Ein Panzer kommt selten allein. Meistens kommt noch ein zweiter. So wie auch ein Andreas Glarner selten allein kommt. Meistens kommt noch ein zweiter «Dumpfplauderer» daher.
So weit so gut. Dass die Dinosaurier durch einen Riesenmeteoriten ausgelöscht wurden, den man nun auf dem Mond angeblich sogar lokalisieren konnte, ist allerdings auch nur eine These von vielen.
Was sagt uns das? Selbst wissenschaftliche Glaubenssätze bedienen sich der Gruppen, wenn es um die Deutungshoheit geht. Die Zeit der Solisten ist endgültig vorbei. Der Papst ist definitiv ein Auslaufmodell.
-
30.9.2022 - Tag der fetten SVP-Hinterteile
Dem Saal den Rücken zugekehrt: Zornige SVP macht Protestaktion im Nationalrat
Der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative, der den gesetzlichen Weg zum Netto-Null-Ziel 2050 vorgibt, hat einen neuen Titel. Die SVP, die das Referendum gegen die Vorlage ergreifen will, ist darüber erzürnt. Bei der Abstimmung protestierte sie.
Am Freitag kam es im Parlament zu einer aussergewöhnlichen Aktion. Vor den Schlussabstimmungen in National- und Ständerat prüft die Redaktionskommission jeweils, ob der Titel einer Vorlage den Inhalt korrekt wiedergibt. Weil das Parlament Änderungen am Gesetz vorgenommen hat, ergänzte die Redaktionskommission beim indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative den Titel.
Aus dem «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» wurde das «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit». Dieser Titel wird auch auf dem Abstimmungszettel stehen, falls die SVP genügend Unterschriften gegen die Vorlage zusammenbringt, wovon auszugehen ist.
«Verfälschung der Abstimmungsfrage»
Der Oberwalliser SVP-Nationalrat Michael Graber (41), der den Kampf der SVP gegen das Klimaschutzgesetz anführt, erzürnte sich über das Vorgehen der Redaktionskommission. Diese habe ihre Kompetenzen «massiv überschritten» und die Abstimmungsfrage «verfälscht», kritisierte er. Die Änderung des Titels sei «einer Demokratie nicht würdig».
Der Antrag, das Geschäft zur Überarbeitung des Titels an die Redaktionskommission zurückzuweisen, scheiterte mit 143 zu 50 Stimmen. Nur die SVP war dafür.
Protestaktion bei der Schlussabstimmung
Bei der anschliessenden Schlussabstimmung über das Gesetz führte die SVP-Fraktion eine Protestaktion durch. Die Mitglieder drückten die Nein-Knöpfe, erhoben sich von den Sitzen und kehrten dem Saal den Rücken zu. Der Nationalrat verabschiedete das Gesetz mit 139 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Schreibt Blick.
Zornige SVP macht Protestaktion im Nationalrat und kehrt dem Saal den Rücken zu, schreibt Blick in der Headline. Das ist nett umschrieben vom Zürcher Boulevardblatt.
«Kindsköpfe aus dem Kindergarten der SVP zeigen dem Parlament ihre fetten Ärscher» würde diese ebenso kindische wie unappetitliche Aktion der vereinigten Partei aller Trychler und sonstigen esoterischen Vollpfosten zutreffender umschreiben.
-
29.9.2022 - Tag der Piloten des Schweizer Gesundheitssystems
Hohe Krankenkassenprämien: «Es herrscht ein Kartell des Schweigens»
Die Krankenkassenprämien treffen nun auch den Mittelstand hart. Braucht es eine individuelle Prämienverbilligung?
«Wir kommen in eine Situation, die wir in der Schweiz noch nie hatten», zeigt sich Mitte-Präsident Gerhard Pfister besorgt. Krankenkassenprämien, steigende Inflation plus hohe Energiekosten zusammen könne der untere Mittelstand nicht mehr stemmen. «Der Bundesrat jedoch verhält sich relativ passiv», kritisiert Pfister.
Hauptursache für den Prämienhammer ist aber nicht die Teuerung, sondern Fehlanreize im System. Der Bundesrat habe 38 Vorschläge gemacht, wie man die Kosten im Gesundheitswesen senken könnte, aber erst drei davon seien umgesetzt, stellt SP-Nationalrätin Samira Marti fest.
Das Problem liege beim Parlament: «Wir haben ein Kartell des Schweigens von verschiedenen Interessensvertreterinnen und Lobbyisten», so Marti. Diese blockieren das Bestreben, die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen.
Das bestätigt auch Mitte-Nationalrat Pfister, der einige Jahre der Gesundheitskommission angehörte: «Ich habe das sonst nirgends erlebt, dass ich praktisch zu jedem Gesetzesartikel ein Mail von irgendeiner Organisation erhalten habe. Es ist ein Kartell.» Für Gerhard Pfister spielt im Gesundheitswesen der Markt schon lange nicht mehr.
Wer in wirtschaftlichen bescheidenen Verhältnissen lebt, hat Anspruch auf Prämienverbilligung. Die Linken und die Mitte fordern nun eine zusätzliche Verbilligung der Prämien. Konkret soll der Bund nächstes Jahr seinen Beitrag um 30 Prozent erhöhen. Und der Ständerat verlangt zusätzliche Abklärungen.
Kritik und Lob an Prämienverbilligung
Für FDP-Ständerat Ruedi Noser sind Prämienverbilligungen nicht zielgerichtet: «Das Bundesamt für Gesundheit konnte mir keine Auskunft darüber geben, wohin das Geld geht; ob es eine Alleinerziehende erhält, die kein Geld für die Zahnoperation hat oder ein 35-jähriger Studierter, der für seine Selbstoptimierung nur 50 Prozent arbeitet.» Dass selbst jedes seiner eigenen Kinder bei Auszug aus dem Elternhaus Anspruch auf Prämienverbilligung habe, sei eine Zumutung.
«Die individuelle Prämienverbilligung ist eines der wenigen Systeme in der Schweiz, das relativ zielgerichtet denen hilft, die es nötig haben», kontert der Mitte-Präsident. Und für SP-Nationalrätin Samira Marti sind die Prämienverbilligungen ein erfolgreiches Instrument, um die unsoziale Finanzierungsform der Krankenkassenprämien auszugleichen: «Eine Professorin bezahlt gleich viel Prämie wie eine Pflegefachfrau. Das ist ein Problem. Die Prämienverbilligung korrigiert dies.»
Kantone unter Druck
Krankenversicherungskosten gehören in einem Schweizer Haushalt zu den grössten Ausgabenposten. Für viele Menschen wird die durchschnittliche Erhöhung der Prämien um 6.6 Prozent zum Problem. Der Druck auf die Kantone steigt, genug Geld für die Prämienverbilligung zu reservieren und der Ständerat muss entscheiden, ob er eine dringliche Erhöhung des Bundesbeitrags für die Prämienverbilligung gutheisst. Schreibt SRF.
Wenn an den Stammtischen der Nation über die seit vielen Jahren ins Uferlose steigenden Krankenkassen-Prämien gesprochen wird, hat so Jeder und Jede eine Lösung zur Hand. Doch die meisten dieser gutgemeinten Vorschläge zur Kostenminderung der überbordenden Gesundheitsindustrie in der Schweiz gehen an den Grundübeln vorbei, die da wären (um nur zwei davon aufzuzählen):
Die Eigenverantwortung. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf startete vor zwei oder drei Jahren eine Kampagne mit der Headline «Gang ned wäge jedem Bobo zom Arzt». Oder so ähnlich. Aufgepeppt wurde sie mit einem Bild vom Luzerner «Weltstar» DJ Bobo. Dass dieser inzwischen doch recht abgehalfterte «Superstar» dafür mit 100'000 Franken entschädigt wurde, ist eine andere Geschichte. Doch im Kern war die Aussage der Kampagne richtig.
Wir rennen nun mal wegen jedem «Boboli» zum Arzt, obschon auch der Besuch einer Apotheke in vielen Fällen helfen würde. Das hätte allerdings zur Folge, dass die Medikamente (je nach Versicherungsmodell) aus eigener Tasche bezahlt werden müssten und nicht von den Krankenkassen.
Die NZZ schrieb vor etwa zehn Jahren in ihrem «Gesundheitsforum», dass Schweizer Hausärzte im Schnitt pro Jahr durch die Medikamentenabgabe an ihre Klienten ein Zusatzeinkommen von 50'000 Franken pro Jahr erwirtschaften. Hinzu kommen noch die «versteckten» Zuwendungen an die Hausärzte durch die Pharmaindustrie. Dieses Zusatzeinkommen dürfte heute um ein Vielfaches höher sein.
Würden wir den Ratschlag von Guido Graf befolgen, könnten nicht Millionen sondern Milliarden von Schweizer Franken eingespart werden. Und die Hausärzte würden trotzdem nicht am Hungertuch nagen.
Die furchtbaren Lobbyisten*innen im Schweizer Gesundheitswesen. Bundesrat Ueli Maurer, damals noch Nationalrat wenn ich mich richtig entsinne, sagte einmal im Parlament, als es um Einsparungen im Gesundheitswesen ging: «Wie soll ein Flugzeug gesteuert werden, das 200 Piloten an Bord hat?»
Eine gute Frage, auch wenn Maurer vergass, dass dieses von ihm gemeinte Flugzeug nicht 200 Piloten (Nationalrat) an Bord hat, sondern zusammen mit den 46 Ständeräten*innen 246.
In Bezug auf Lobbyismus im Schweizer Gesundheitswesen arbeiten auch die Mitglieder des Ständerats äusserst kreativ und lukrativ zu ihren eigenen Gunsten und zum Wohle der Gesundheitsindustrie.
Dass mit diesem «Parlaments-Lobbyismus» ebenfalls Milliarden von Franken versenkt werden, ist längst eine Tatsache.
Es ist auch kein Geheimnis, dass die Schweizer Gesundheitsindustrie eine unglaublich hohe Anzahl von gewählten Parlamentariern*innen direkt (in Anstellungsverhältnissen) oder indirekt (Mandate) alimentiert. Das ist einer Demokratie nicht würdig. Die Parteien täten gut daran, diese legale Korruption endlich ein für allemal stringent zu unterbinden.
Aber die Damen und Herren mit der Spreizwürde der Etablierten ziehen es vor, auch das Kind mit dem Namen «Gesundheitswesen» in den Brunnen fallen zu lassen. Dabei werden sie nach getaner Arbeit in gewohnt perfider Art ihre Hände wie immer in Unschuld waschen.
Niemand hat es angeblich kommen sehen. Das war bei der Flüchtlingskrise 2015/16 und bei Putins Angriffskrieg auf die Ukraine der Fall und wiederholt sich jetzt auch bei der Energiekrise und der Inflation.
Dabei flunkern uns die Parteien doch stets vor, dass nur die Besten ihres Fachs unsere Anliegen in den beiden Kammern des Hohen Hauses von und zu Bern vertreten. Dass dem seit langem nicht mehr so ist, beweisen die momentan verheerenden Krisen, die unseren Alltag wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beeinträchtigen.
Man könnte das «Kartell des Schweigens» durchaus auch als «Kartell der Bundeshaus-Krähen bezeichnen, die sich niemals ein Auge aushacken»! Dieses Kartell muss zwingend gebrochen werden, damit nachhaltige Veränderungen entstehen können.
Wir, das simple Wahlvolk, können diese zwei von mir erwähnten Punkte ändern. Wie? Das werde ich Ihnen nächstes Jahr verkünden, wenn die Schalmeienklänge unserer Politprominenz im ganzen Land erklingen und der Run auf die Futtertröge im Hohen Haus von und zu Bern bei den National- und Ständeratswahlen beginnt.
Versprochen! Immer vorausgesetzt, dass ich wegen meiner derzeitigen Grippe – nein, es ist diesmal nicht Corona – mit einem Tschö mit ö von dannen ziehe. :)
-
28.9.2022 - Tag der Ständerats-Kandidaturen
SP-Kantonsrat David Roth will’s schon wieder wissen – und ins Stöckli
David Roth strebt bei den nationalen Wahlen 2023 den Sprung in den Ständerat an. Der Präsident der Luzerner SP verrät, was ihn antreibt.
David Roth möchte erneut für den Ständerat kandidieren. Dies ist einer aktuellen Einladung zur Mitgliederversammlung der SP Stadt Luzern zu entnehmen. Diese nominiert am Donnerstag zuhanden des kantonalen Parteitags im November.
Der 37-Jährige engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten politisch. Mit 16 Jahren trat er der Juso Luzern bei. 2008 bis 2011 sass er im Grossen Stadtrat Luzern, bis er zum Präsidenten der Juso Schweiz ernannt und im selben Jahr – also 2011 – in den Luzerner Kantonsrat gewählt wurde.
2019 erzielte Roth das zweitbeste Resultat der SP Luzern
Bereits 2019 kandidierte Roth für die kleine und die grosse Kammer. Damals holte er mit gut 19'700 Stimmen das zweitbeste Resultat auf der Luzerner SP-Liste – und lag damit hinter der bisherigen Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo. Diese hat bereits letzten März angekündigt, dass sie zu den Wahlen 2023 nicht mehr antreten wird. Ylfete Fanaj landete bei den Wahlen 2019 auf dem dritten Platz. Sie wird nun für die SP um einen der drei frei werdenden Sitze im Luzerner Regierungsrat kämpfen.
«Wir sind in der SP sehr darum bemüht, möglichst diverse Listen für die Wahlen aufzustellen», so Roth. In den letzten vier Jahren sei viel passiert, die Partei habe sich auch personell erneuert, Aufbauarbeit betrieben und sei heute breit aufgestellt. Roth sagt, dass dies für Konkurrenz innerhalb der Partei sorge – «und das ist auch richtig so».
Wie er auf Anfrage präzisiert, möchte er sowohl für den National- als auch den Ständerat kandidieren. Aber dafür müsse er erst einmal nominiert werden. Die Nomination für den Nationalrat wird im Februar stattfinden.
Linke Interessen bleiben aussen vor
In Luzern hat sich Roth in den letzten Jahren besonders einen Namen gemacht mit dem Gewinn des Prämien-Streits. 2019 hatte das Bundesgericht eine Beschwerde gutgeheissen, die mehrere Privatpersonen mit Unterstützung der Luzerner SP eingereicht hatten. Dies, nachdem die Luzerner Regierung 2017 die Prämienverbilligungen gekürzt hatte. «Kein Thema hat uns in den letzten Jahren mehr beschäftigt», hielt Roth nach dem Sieg vor Gericht fest.
Seit einem Jahr ist Roth in der nationalen Parteileitung der SP tätig. Was treibt ihn an, vermehrt unter der Bundeskuppel mitwirken zu wollen? Roth moniert, dass der Kanton Luzern im Ständerat mit Damian Müller (FDP) und Andrea Gmür (Mitte) nur bürgerlich vertreten ist. Und mit Blick auf den vergangenen Abstimmungssonntag und dem wuchtigen Nein der Luzernerinnen zum Beitrag an die Vatikan-Kaserne hält er fest, dass Luzern eben weitaus vielfältiger sei, als dies Bürgerliche vertreten könnten.
Dies hat seiner Ansicht nach negative Auswirkungen: «Unser Kanton kann viel weniger stark und effektiv seine Interessen in Bundesbern vertreten, weil die Luzerner Interessen im Ständerat nur auf einer Ratsseite gehört werden», ist Roth überzeugt. Beispielsweise werde die Bahninfrastruktur in anderen Kantonen massiv vorangetrieben, während es für Luzern unklar sei, «ob es überhaupt vorwärtsgeht».
Roth erhofft sich gute Chancen
Als Gewerkschafter führe er Verhandlungen in der ganzen Schweiz, auf Deutsch und Französisch. Ohnehin sei er viel auf nationaler Ebene unterwegs. Etwa, wenn es um die Frage des flächendeckenden Service public oder die Digitalisierung der Arbeitswelt gehe. Aber auch das Thema Prämienverbilligung sei gerade in der Zeit der Kaufkraftminderung ein sehr wichtiges Anliegen.
Zumindest für den Sprung in die grosse Kammer dürfte Roth gute Chancen haben, weil Birrer-Heimo keine weitere Legislatur anhängt. Für die Wahl in den Ständerat dürfte es allerdings schwierig werden, weil die beiden bisherigen bekannt gegeben haben, erneut zu kandidieren. Roth ist dennoch zuversichtlich. Er spricht von einem «offenen Rennen im Herbst». Schreibt ZentralPlus.
Unser aller abgrundguter Luzerner Kantonsrat David Roth will also für den Kanton Luzern ins «Stöckli». Christoph Blocher unterstellte dem damaligen Studenten Roth vor Jahren einmal in einer Arena-Sendung, dass er noch nie auch nur einen einzigen Tag gearbeitet habe. So ganz unrecht hatte der greise SVP-Zampano vom Herrliberg nicht mit seinem Seitenhieb gegen Roth.
Sei's drum. Ich kenne David Roth. Als er noch im Grossen Stadtrat der Stadt Luzern politisch agierte, assen wir rein zufälligerweise ab und zu vis à vis vom Luzerner Rathaus in Mama-Li's chinesischem Food-Tempel. Mama Li legte in den Corona-Wirren einen Konkurs hin und verschwand irgendwo im Land des Lächelns. David Roth ist noch da.
Ich lernte Roth als wirklich hochintelligenten und witzigen Tischnachbarn schätzen. In Sachen Rhetorik und Wortgewalt stufe ich ihn auf dem gleichen Level wie Blochers rhetorisches Maschinengewehr Roger Köppel ein.
Auch ein Auge für schöne und interessante Frauen ist ihm nicht abzusprechen, seit ich ihn mal zusammen mit seiner Freundin sah. Wobei festzuhalten ist, dass dieses Auge für das Schöne scheinbar bei allen SP-Granden vorhanden ist.
Sei es SP-Präsident Cédric Wermuth, der mir mal während seiner Luzerner Studienzeit an einem Einkaufs-Samstag in der Hertensteinstrasse samt attraktiver Freundin und einer Gucci-Einkaufstüte über den Weg lief.
Oder SP-Bundesrat Alain «Berserker» Berset, der ja den weiblichen Grazien nicht unbedingt abhold sein soll, wie in Bundesbern gemunkelt wird. Um keine Klage einzufahren weise ich darauf hin: Es wird gemunkelt. Eine schöne Frau schön zu finden, ist ja auch nicht verboten. Dass halt mal ein Bundesrichter eingeschaltet werden muss, kann passieren. Alles halb so schlimm.
David Roth hat jedenfalls beste Chancen, 2023 den Ständerats-Sitz für den Kanton Luzern zu holen. Dieses überrepräsentierte Doppelpack aus einer toxischen Mischung von ungezügeltem Neoliberalismus (Andrea Gmür-Schönenberger, Mitte) und dem kläglichem Freisinn der Pöstchenjägerei (Damian Müller, FDP) bedarf wirklich dringendst einer massiven Korrektur.
Das Luzerner Wahlvolk sollte sich endlich dazu durchringen, Kandidaten*innen für höhere und einflussreiche Ämter zu wählen, die die Sorgen und Probleme der gesamten Einwohnerschaft des Kantons Luzern repräsentieren und nicht nur diejenigen einer mächtigen Minderheits-Klientel.
So wie auch persönliche Bereicherung durch die Vorteile eines Amtes strikte ausgeschaltet werden muss. Geschieht dies nicht, läuft die Demokratie Gefahr – speziell in Zeiten wie diesen – vom grassierenden Populismus verdrängt und übernommen zu werden.
In dieser Hinsicht darf die Luzerner Wahlbevölkerung berechtigte Hoffnung auf das bezüglich Lobbyismus bisher noch unbeschriebene Blatt David Roth setzen. Ob er lukrativer Pöstchenjägerei widerstehen kann, wie sie der derzeitige Luzerner FDP-Ständerat Müller während acht Jahren erfolgreich betrieben hat, ist noch ungewiss. Steht in den Sternen. Oder wie Joschka Fischer sagte: «Du veränderst als Politiker nicht das Amt. Das Amt verändert dich!»
Muss ja nicht unbedingt so sein, nur weil es Joschka Fischer sagte, der nach seiner Amtszeit ebenfalls zu einem hochbezahlten und wirklich unappetitlichen Lobbyist mutierte. (Wikipedia hilft weiter). Gegen Fischers Mandate ist selbst Pöstchenjäger Müller ein Waisenknabe. Allerdings ist der Liebling aller Luzerner Schwiegermütter (noch) nicht Aussenminister, wovor uns Gott behüten möge.
Eines aber ist schon jetzt sonnenklar: Roth muss nicht wie der solariumgebräunte und eitle Gockel Müller in jedem Interview mit einer völlig aus der Zeit gefallenen, proaktiven Verteidigung betonen, dass er nicht schwul ist.
Das interessiert ausser Müller, ein paar Bundeshaus-Klatschtanten und einem Blick-Reporter sowieso niemanden. Die persönliche Bereicherung des Luzerner Staatsmannes Müller hingegen schon.
Wetten, dass genau dies und nicht Müllers Geschwurbel um seine Sexualität im kommenden Luzerner Ständerats-Wahlkampf zum Thema wird? Wenn nicht, wird ein «aufrechtes Fähnchen» dafür sorgen, wie mir ein Vögelchen zugezwitschert hat.
-
27.9.2022 - Tag der Tränendüsen
«Ich kann nicht schmerzfrei Treppensteigen»: Ex-Tennis-Star Del Potro mit Schock-Geständnis unter Tränen
Anfang 2022 wollte Juan Martin del Potro auf die grosse Tennis-Bühne zurückkehren. Stattdessen verkündete er wegen seiner Knieprobleme kurz vor dem Comeback seinen Rücktritt. Mehrere Monate danach schockiert Del Potro mit einem Geständnis über seinen Gesundheitszustand.
Anfang dieses Jahres verkündete del Potro unter Tränen sein Karriereende. Nun packt der 34-Jährige in argentinischen Medien erstmals über die schweren Folgen seiner Verletzungen aus, die ihn zum Karriereende zwangen: «Heute kann ich nur gehen. Ich kann nicht aufs Laufband, ich kann nicht schmerzfrei Treppen steigen.»
Auch lange Autofahrten gehen nicht mehr: «Ich kann nicht mal lange am Stück fahren, ohne eine Pause zu machen und meine Beine zu strecken. Das ist meine Wirklichkeit. Es ist hart und traurig.»
Auch Arzt in der Schweiz kann nicht weiterhelfen
Immer wieder hatte Del Potro auch mit Problemen an den Handgelenken zu kämpfen. Den Tiefpunkt seiner Karriere erlebte Del Potro im Jahr 2019, als er sich beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Kniescheibe bricht.
Die Nachwehen spürt er noch bis heute – und sucht verzweifelt nach Lösungen: «Ich war vor kurzem in der Schweiz und habe dort einen weiteren Arzt gesehen. Diese Behandlung wurde mir von vielen Tennisspielern empfohlen, bis jetzt habe ich aber kein positives Resultat.»
Verletzungen führen auch zu mentalen Problemen
Die körperlichen Beschwerden setzen der ehemaligen Weltnummer drei offenbar auch mental zu: «Mein Kopf kann ein Leben ohne Tennis nicht akzeptieren. Ich hatte einfach keinen fliessenden Übergang. Ich konnte mich nicht vorbereiten und habe keine Ahnung, was andere Spieler machen, die diesen Prozess durchlaufen.» Emotional führt er aus: «Ich war die Nummer drei der Welt. Dann waren plötzlich beide Knie kaputt. Und hier bin ich, mit nichts!»
US-Open Sieg gegen Federer als Highlight der Karriere
In seiner Karriere feierte Del Potro 22 Turniersiege, holte an Olympischen Spielen zwei Medaillen im Einzel. Den grössten Sieg errang der Argentinier 2009, als er im Final der US Open Roger Federer schlägt und so seinen ersten und einzigen Grand-Slam-Titel holt. Nach dem US-Open-Sieg galt er als grosser Mann der Zukunft, konnte dies wegen der anhaltenden Verletzungsmisere aber nie bestätigen. Schreibt Blick.
Es wird etwas arg viel geheult in letzter Zeit. Besonders in erlauchten Kreisen und im Tennis-Sport.
Nachdem uns Königin Elizabeth für immer verlassen hat, was die ganze Welt über Tage hinweg zum Weinen brachte, beendete einige Monate nach Del Potros tränenreichem Rücktritt auch noch King Roger, händchenhaltend und schluchzend im Duett mit Rafael Nadal, in London seine Karriere.
Wie aus gut informierten Kreisen aus London zu vernehmen ist, führt die Themse inzwischen Hochwasser wie seit fast hundert Jahren nicht mehr.

-
26.9.2022 - Tag der Bretter vor dem Kopf
Maurer kritisiert Bevölkerung für Verrechnungssteuer-Nein: «Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge schwindet»
Erneut hat Finanzminister Ueli Maurer eine Steuerreform verloren. Schuld ist seiner Meinung nach das schwindende Wirtschaftsverständnis in der Bevölkerung.
Anleger müssen auf Zinserträge auch künftig 35 Prozent Verrechnungssteuer zahlen. Mit 51,7 Prozent hat die Stimmbevölkerung die Abschaffung der Steuer auf inländische Obligationen verworfen.
Das Nein ist ein Erfolg für die Linke – und eine erneute Schlappe für die Bürgerlichen und Finanzminister Ueli Mauer (71). Schon im Februar hatten sich fast 63 Prozent der Stimmenden gegen die Abschaffung der Stempelsteuer gestellt.
«Verständnis schwindet offensichtlich»
Das erneute Nein zeigt, dass es der Wirtschaft schwerfällt, die Mehrheit der Bevölkerung von Steuersenkungen für Unternehmen zu überzeugen. Maurer deutete das Ergebnis anders. Man könne festhalten, «dass ganz offensichtlich das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge in der Bevölkerung schwindet», kritisierte Maurer den Stimmentscheid der Bevölkerung am Sonntag.
Was insbesondere bei den Siegern Kritik hervorruft. So findet SP-Nationalrätin Samira Marti (28), er beleidige damit das Volk.
Während andere kontern, dass die Linke genauso Mühe habe, Volksentscheide zu akzeptieren – beim Ja zur AHV-Reform etwa sprächen Exponentinnen von einer «Schlag ins Gesicht der Frauen» und rufen zu einer Demo am Montag auf – bekommt sie von anderen Twitter-Usern Zuspruch.
Schon im Abstimmungskampf polarisierte Maurer
Klar ist: Maurer greift zu eher deutlichen Worten. Das hatte er schon im Abstimmungskampf getan. Im Blick-Interview griff er die Linken frontal an: «Die Gegner haben es einfach nicht begriffen und argumentieren an der Sache vorbei!», sagte er damals.
Es gebe keine objektiven Gründe, die gegen die Abschaffung der Verrechnungssteuer sprechen würden, wer dagegen sei, «verirre sich in Klassenkampf-Rhetorik», so der SVP-Finanzminister – und setzte noch einen drauf: «Es haben alle mal ein Brett vor dem Kopf, aber in dem Fall ist der Augenabstand praktisch null.» Schreibt BLICK.
Hier irrt sich der geschätzte Bundesrat Ueli Maurer. Das Verständnis der Schweizer Bevölkerung für wirtschaftliche Zusammenhänge schwindet nicht, sondern es entwickelt sich erstmals positiv. Die Bevölkerung entdeckt langsam aber sicher in Krisenzeiten die Zusammenhänge zwischen den verhängnisvollen Deregulierungen der vergangenen Jahrzehnte und dem dadurch entstandenen Neoliberalismus abartiger Prägung.
Floskeln von Maurer im Vorfeld der Abstimmung wie «Klassenkampf-Rhetorik» sind nichts anderes als die immergleiche «Reflex-Rhetorik» aus dem vorgestanzten Wortseminar der «Bürgerlichen».
Wer die Zeichen der Zeit nicht sieht, hat ein Brett vor dem Kopf. Nicht das Wahlvolk.
-
25.9.2022 - Tag der Kaffeesatzleserei der Putin- und Russland Experten*innen
Russland-Kennerin Belton: "Palastrevolte gegen Putin ist möglich"
Die Buchautorin ("Putins Netz") und ehemalige Moskau-Korrespondentin sieht den Kreml-Herrn stark geschwächt. Die Elite, so sagt sie, könnte angesichts der Lage in der Ukraine die Geduld mit Putin verlieren.
In Catherine Beltons 2020 erstmals erschienenem und vielfach ausgezeichnetem Buch "Putins Netz" zeichnet die frühere Moskau-Korrespondentin der britischen "Financial Times" detailliert den Aufstieg Wladimir Putins vom KGB-Agenten zum beinahe unumschränkten Alleinherrscher im Kreml nach. Im Interview mit dem STANDARD erklärt sie, warum es mit Putins Macht nun aber schnell zu Ende gehen könnte.
STANDARD: Ihr Buch beschäftigt sich mit dem Netzwerk, das Putin an die Macht gebracht hat. Wie einsam ist es nun um ihn geworden?
Belton: Putin hat sich in den zwei Jahren der Pandemie immer mehr isoliert. Sogar seine engsten Berater wie Igor Setschin, der Falke an der Spitze des Kreml-nahen Ölkonzerns Rosneft, mussten sich zwei Wochen lang isolieren, bevor sie ihn treffen durften. In dieser Zeit hat Putin eine Obsession entwickelt, was seine Rolle in der Geschichte betrifft. Leute, die ihn treffen durften, haben ihm nur gesagt, was er hören wollte. So ist auch die Fehlkalkulation entstanden, dass man die Regierung von Wolodymyr Selenskyj in wenigen Tagen stürzen kann, indem man in der Ukraine einmarschiert. Nach Kriegsbeginn hat sich ein Teil der russischen Elite angesichts der massiven Propaganda, es gehe um die Existenz Russlands, um Putin versammelt. Weil Russland nun Positionen im Osten der Ukraine aufgeben und Putin seine "Teilmobilisierung" ankündigen musste, beginnt diese Einheit zu bröckeln.
STANDARD: Sehen Sie irgendeinen Hinweis auf eine Palastrevolte?
Belton: Ja. Manche in der russischen Elite erinnert die aktuelle Situation an die Jahre vor der Revolution von 1917, als das Militär nach einer Serie von Fehlschlägen den Zaren nicht mehr unterstützen wollte. Putins Legitimität als Präsident basiert auf seiner Popularität. Indem er sein eigenes Versprechen, keine Reservisten in den Krieg gegen die Ukraine zu schicken, jetzt brechen musste, unterminiert er die Basis seiner Macht. Wenn russische Familien bald mit der grimmigen Realität von Putins Krieg konfrontiert sein werden, dürfte auch die Staatspropaganda viel von ihrem Einfluss verlieren. Die Elite dürfte die jüngsten militärischen Rückschläge auch als weiteres Zeichen für Putins Schwäche betrachten. Ein russischer Milliardär hat mir gesagt, dass interne Kämpfe um die Macht ausbrechen dürften, sollte Putin den Donbass verlieren. Das wird all jenen, die von Putins Entscheidung für den Krieg schockiert waren und die wegen der Sanktionen des Westens ihre mitunter über 30 Jahre aufgebauten Geschäfte verloren haben, die Möglichkeit geben zurückzuschlagen. Putins Rolle als Präsident hat auch viel mit seinem Versprechen der Stabilität zu tun. Auch das ist durch seine Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, erschüttert worden.
STANDARD: Wovon hängt dies nun ab?
Belton: Entscheidend wird die Einheit des Westens sein, was die Sanktionen und die Unterstützung für die Ukraine betrifft, vor allem in einem schwierigen Winter mit steigenden Energiepreisen. Putins Herrschaft ist jetzt in unsicheren Gewässern, weil auch das Staatsbudget wegen der Sanktionen des Westens unter starkem Druck steht. Ein (im Westen vielerorts angedachter, Anm.) Preisdeckel auf russische Ölexporte würde Putins Position weiter schwächen.
STANDARD: Ist Putin krank?
Belton: CIA-Direktor William Burns meinte Ende Juli, Putin sei "insgesamt zu gesund". Tatsächlich sind die Hinweise auf eine Krankheit im Sommer verschwunden. Bis dahin hat es bei seinen Auftritten in den ersten Monaten des Jahres stark so gewirkt, als würde er sich in Schmerzen winden und sich, etwa bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu, an seinen Tisch klammern. Putin wurde auch immer paranoider, was eine Ansteckung mit Covid betrifft, die Maßnahmen, die er dagegen ergriff, waren extrem. Allerdings wirkt er entspannter, seit er die Taktik seiner Armee verändert hat, sich auf die Ostukraine konzentriert und einen Energiekrieg gegen den Westen gestartet hat. Ein Insider hat mir gesagt, dass davon ausgegangen wird, Putin habe sich im Mai einer Operation unterzogen. Das lässt sich aber nicht überprüfen.
STANDARD: Putin wird schon seit langem eine gewisse Obsession für die russische Geschichte nachgesagt. Ist er ein großrussischer Nationalist?
Belton: Er ist ein Imperialist und war das schon immer. Er glaubt an die Macht des russischen Reiches. Er gehört zu jenem Flügel des Auslandsgeheimdienstes im KGB, der daran glaubt, dass der Kommunismus das russische Reich unterminiert habe – weil er eine Ideologie war, die Russland daran hinderte, mit dem Westen in Wettbewerb zu treten. Das hat er schon in seinem ersten Interview 1992 gesagt, kurz nachdem er zum Vizebürgermeister von Sankt Petersburg ernannt wurde: Die Bolschewiken seien für die Tragödie des Zerfalls der Sowjetunion verantwortlich, weil sie das Land in Republiken unterteilt hätten, die es davor gar nicht gegeben habe. Er sagte auch, dass die Kommunisten zerstört hätten, was Menschen aus zivilisierten Nationen eigentlich verbinde – Handelsbeziehungen. Putin hat immer daran geglaubt, dass die Ukraine eigentlich nicht existieren sollte und nur deshalb als Republik gegründet wurde, weil die Bolschewiken mit den ukrainischen Nationalisten einen Deal eingegangen seien, um ihre Macht zu zementieren. Seine ganze Präsidentschaft über hat er danach getrachtet, Russlands imperiale Position wiederherzustellen.
STANDARD: Zu Beginn des Kriegs war oft davon die Rede, dass sogar hochrangige Militärs es nicht wagten, Putin die wahre Situation in der Ukraine zu verdeutlichen. Glauben Sie das auch?
Belton: Ich denke, dass Putin die Situation ziemlich schnell bewusst wurde – weil seine Armee nicht in der Lage war, Kiew innerhalb weniger Tage einzunehmen, wie es anfangs geplant war. Das vor ihm zu verheimlichen war unmöglich. Putins Sicherheitsdienst, der FSB, hatte ihm vorher nur gesagt, was er hören wollte – und gleichzeitig hat er wohl zu viel Vertrauen in seinen engen Kiewer Verbündeten Wiktor Medwedschuk gesetzt, den Ko-Vorsitzenden einer prorussischen Partei, die von einer schnellen politischen Machtübernahme sprach. Die Armee selbst war nie ordentlich auf einen richtigen Krieg vorbereitet. Tatsächlich ist das einer der Gründe, warum man den Krieg anfangs "militärische Spezialoperation" nannte. Es ging darum, Selenskyj so viel Angst einzujagen, dass er flieht.
STANDARD: Auf wen hört Putin jetzt?
Belton: Vor allem auf seine engsten und radikalsten Berater aus dem KGB. Das sind Sicherheitsleute, mit denen er in Sankt Petersburg eng zusammengearbeitet hat, zum Beispiel Nikolai Patruschew. Er sagt Putin, was zu tun ist: nämlich, dass er Russlands Souveränität schützen müsse und dass die USA die Ukraine als Plattform benutzten, um Russland zu bedrohen. Patruschew war lange eine Art graue Eminenz hinter den Kulissen, die Putin auf einige der dunkelsten Wege seiner Präsidentschaft schickte. Er ist ein Jahr älter als Putin und zog zwei Jahre vor diesem nach Moskau. Der Sankt Petersburger KGB galt als weit skrupelloser als jener in Moskau, weil man dort unter einer Art Minderwertigkeitskomplex gegenüber der Hauptstadt litt.
STANDARD: Nach Kriegsbeginn richteten sich viele Hoffnungen im Westen auf die Kaste der Oligarchen, die ja von den Sanktionen teilweise hart getroffen werden. Warum haben sie sich nicht erfüllt?
Belton: Wer glaubt, die Oligarchen könnten einfach zu Putin gehen und verlangen, er solle den Krieg beenden, versteht Putins Russland nicht. Die Sanktionen hatten dies aber auch gar nicht zum Zweck. Es ging darum, diese sogenannten Oligarchen davon abzuhalten, ihre Soft Power und ihren Einfluss im Westen dazu zu nutzen, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren. Unter Putin sind Oligarchen keine Oligarchen, sie sind Geiseln des Kreml. Man kann ihnen ganz einfach mit Gefängnis drohen oder mit dem Verlust ihres Geschäfts, wenn sie die Befehle des Kreml nicht befolgen. Manche haben ja sehr offen darüber gesprochen. Der Pakt mit dem Kreml, nämlich Befehle zu befolgen und dafür Wohlstand genießen zu können, ist seit dem Krieg aber gebrochen worden, weil die Sanktionen die Unternehmen und den Ruf der Oligarchen beschädigt oder zerstört haben.
STANDARD: Warum sind die alten KGB-Kader rund um Putin so mächtig?
Belton: Weil diese Leute die Macht monopolisiert haben. Vor allem, indem sie das Gerichtssystem untergruben und allen mit Gefängnis drohen können, die ihre Dominanz infrage stellen.
STANDARD: Wer könnte Putin gefährlich werden?
Belton: Die größte Bedrohung für Putin kommt von seinen eigenen Sicherheitsdiensten. Dort gibt es jüngere, fortschrittlicher denkende Mitglieder, denen ähnlich wie ihren Vorgängern in den spätsowjetischen 1980er-Jahren auffällt, dass Putins Kurs in einen internationalen Paria-Status führt und das Land schwer beschädigt. Für diese Leute kann Russland mit dem Westen nur mithalten, wenn es in den Westen integriert ist.
STANDARD: Was kommt dann?
Belton: Das System, das nach der Herrschaft Putins kommt, wird wahrscheinlich weiter von den Sicherheitsdiensten dominiert sein. Vermutlich wird es aber ein weicheres Gesicht zeigen, weil Russland nach dem Krieg an einer Wiederherstellung seiner Position gelegen sein wird. Schreibt DER STANDARD.
Bei der im Konjunktiv herbeigeschriebenen «Palastrevolte gegen Putin» ist wohl eher Wunschdenken Vater / Mutter der Gedanken von Buchautorin und «Russland-Kennerin» Belton.
Ereignisse aus der Zarenzeit in den Jahren vor der Revolution von 1917 als Beweis für die steile These der «Palastrevolution» zu bemühen, sind nicht nur grotesk und lächerlich, sondern beinahe schon Geschichtsklitterung.
Den gesellschaftlichen Zustand Russlands vor 1917 mit dem heutigen auch nur annähernd zu vergleichen ist einer «Russlandkennerin» unwürdig. So viel zur derzeit grassierenden Inflation der Kaffeesatz-Leserei von Putin-Experten*innen und Russland-Kennern*innen.
Wenn schon ein Vergleich aus der russischen Historie herbeigezogen werden muss, dann gibt es nur ein Ereignis aus der (jüngeren) Vergangenheit mit den Ingredienzien für eine Palastrevolution, vor dem sich Putin wirklich fürchten muss: Der verlorene Krieg der UdSSR in Afghanistan.
Am 15. Februar 1989 zogen die letzten sowjetischen Soldaten aus Afghanistan ab. Als kurze (!) «Intervention» (!!) geplant, dauerte der Krieg mehr als neun Jahre. Doch gegen Ende der 80er-Jahre wurde deutlich sichtbar, dass sich die «Intervention» der Sowjetunion in Afghanistan zu einer riesigen Niederlage entwickelte, an der die USA durch massive Unterstützung der Mudschaheddin massgeblich beteiligt waren.
Stichwort tragbare «Stinger-Luftabwehrraketen», mit denen die Afghanen die hochgelobte und in der Tat moderne russische Luftwaffe buchstäblich lahmlegten. Jeder Einsatz der russischen Kampfjets entwickelte sich zum Himmelfahrtskommando. Ab einem gewissen Zeitpunkt weigerten sich die russischen Kampfpiloten, in die Lüfte über Afghanistan aufzusteigen.
Die militärische Katastrophe in Afghanistan wurde zum Symbol der sowjetischen Unfähigkeit. Als dann auch noch die Wirtschaft zusammenbrach und die Menschen in Massen auf die Strassen gingen, war das Ende der Sowjetunion (UdSSR) drei Jahre später am 21. Dezember 1991 endgültig besiegelt.
Die Analogien zwischen der russischen «Intervention» in Afghanistan und der «Spezialoperation» in der Ukraine sind erschreckend und dürften Putin wohl mehr schlaflose Nächte bereiten als irgendwelche historischen Ereignisse aus der Zarenzeit.
Es gibt naheliegende Gründe, weshalb Putin in seinen unsäglichen Monologen niemals vom Afghanistan-Krieg der UdSSR spricht und die tatsächlichen Ereignisse durch die Duma für die Geschichtsbücher entsprechend «revidieren» liess.
-
24.9.2020 - Tag der Doppelzüngigkeit
Mangelndes Vertrauen: Stromkonzern Axpo wird unter die Lupe genommen
Das Vertrauen verspielt: Die Kantone Aargau und Zürich wollen die Geschäftsführung der Axpo durch eine externe Revisionsstelle untersuchen lassen.
Seit der Bund einen Rettungsschirm von vier Milliarden Franken aktiviert hat, weht der Axpo ein rauer Wind aus der Politk entgegen. In den vergangenen Tagen sind die Rufe nach mehr Transparenz an die Adresse der Geschäftsleitung um CEO Christoph Brand und Verwaltungsratspräsident Thomas Sieber immer lauter geworden.
Allen voran die Eignerkantone, die bislang auffällig konziliant auf das drohende Milliardenloch reagiert haben, wollen nun doch mehr darüber erfahren, weshalb der grösste Schweizer Stromkonzern in finanzielle Schieflagen geraten ist – und wie es mit der Axpo weitergehen soll.
Ausserordentlichen Sitzung
Zu diesem Zweck haben die Eigner – darunter die grössten Aktionäre Zürich und Aargau – für die kommende Woche eine ausserordentliche Sitzung anberaumt, wie der SonntagsBlick aus zuverlässigen Quellen erfahren hat.
Im Kern dürfte es darum gehen, wie die Axpo künftig aufgestellt werden soll. Eine radikale Variante sieht vor, den Stromkonzern zu zerschlagen, also die Handelssparte (dort besteht das grösste Risiko) von der Stromproduktion zu trennen.
Zuerst dürften sich die Mehrheitsaktionäre aber mit der Frage beschäftigen, ob die Axpo einer externen Prüfung unterzogen werden muss. Vehementester Fürsprecher für ein unabhängiges Gutachten ist der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler: «Alles andere wäre angesichts der aktuellen Lage nicht seriös.»
Mangelndes Vertrauen
Das hat er diese Woche in einem Schreiben an die Mehrheitsaktionäre, namentlich an Stephan Attiger, Aargauer Finanzdirektor und Vertreter der Eigner, mitgeteilt. Dieser hat nun reagiert. Auf Anfrage von SonntagsBlick bestätigt Attiger: «Der Kanton Aargau und der Kanton Zürich erwägen, eine Geschäftsführungsprüfung der Axpo gemäss Aktienrecht durch eine externe und unabhängige Revisionsstelle durchzuführen.»
Die aktuelle öffentliche Diskussion und die politischen Vorstösse seien ein deutlicher Hinweis auf das mangelnde Vertrauen gegenüber der operativen und finanziellen Führung der Axpom, so Attiger: «Der Regierungsrat ist überzeugt, dass nur eine unabhängige externe Geschäftsführungsprüfung im Sinne der Ausschöpfung der Einsichtsrechte wieder Vertrauen schaffen kann.» Schreibt Blick.
Die Wutrede von Blochers Tochter Magdalena Martullo (beide SVP) über das «skrupellose Spekulations-Casino der Axpo» im Blick scheint bei den AXPO-Aktionären Wirkung zu zeigen.
Auf den ersten Blick.
Doch ein zweiter Blick offenbart eine orchestrierte SVP-Aktion. Denn das Schreiben an die Mehrheitsaktionäre (u.a. Kanton Aargau, Kanton Zürich) für eine externe Überprüfung der AXPO stammt aus dem Kanton Zug, dem kleinsten AXPO-Aktionär. Verfasst vom Zuger Jurist, Regierungsrat und Finanzdirektor Heinz Tännler.
Und welcher Partei gehört Tännler an? Genau! Der SVP.
Ein Schelm wer Böses denkt.
Denn eines ist gewiss: Christoph Blocher und seine Tochter Magdalena Martullo verurteilen den «skrupellosen Casino-Kapitalismus» nur dann, wenn am Roulette keine Blochersche Kugel in der Schüssel mitrotiert.
Christoph Blocher wurde nicht durch seiner Hände Arbeit Milliardär und auch nicht durch seine EMS-Chemie AG. Sein Aufstieg zum Milliardär begann als skrupelloser «Raider» zusammen mit seinem Kumpel Martin Ebner und dessen BZ-Gruppe.
Dass das «Casino» des beinahe-Pleitiers Ebner 2002 nur durch einen Deal mit den Gläubigerbanken – allen voran die öffentlich-rechtliche Zürcher Kantonalbank! – vor dem Konkurs bewahrt wurde, störte damals den grossen SVP-Zampano vom Herrliberg in keiner Art und Weise.
Auch nicht die Tatsache, dass 2002 viele «kleine» Anleger*innen beim BZ-Crash Millionen verloren, die sie im Vertrauen auf Ebner (und BZ-Verwaltungsrat Blocher!) investiert hatten. Gerettet wurden nämlich nur die Filetstücke des BZ-Imperiums.
Die auf einer «Tour de Suisse» von Ebner durch etliche Schweizer Städte bei einfachen Leuten eingesammelten Millionen – unter anderem auch im Luzerner Casino (!), wo ich zwecks einem Interview* mit Ebner dabei war – wurden nämlich von der BZ in Fonds investiert, die schlicht und einfach hopsgingen. Weil sie nichts wert waren.
Der «skrupellose Casino-Kapitalismus» der Axpo ist verwerflich. Keine Frage. Die Doppelzüngigkeit der Blochers samt ihrer SVP-Partei allerdings auch.
* Meine damalige Begegnung mit Ebner im Casino Luzern war geprägt von der Gossensprache Ebners, dem ich beinahe eine Ohrfeige verpasst hätte. Worauf ein ebenfalls anwesender Journalist vom Tagesanzeiger zu mir sagte: «Schade, dass du es nicht getan hast.»
Es könnte durchaus sein, dass ich Ihnen die komplette Geschichte aus dem Casino Luzern eines Tages doch noch erzähle, falls ich meine derzeitige Grippe überlebe.
-
23.9.2022 - Tag des Unterschieds zwischen Impotenz und Fondue
Nach Stink-Behauptung: Richter rechnet mit Collins' Schweizer Ex-Frau ab
Orianne Cevey teilte immer wieder gegen Phil Collins aus. Doch das Gericht schenkt der Schweizer Ex-Frau des Musikers nur wenig Glauben. Der Richter erklärt nun, was dahinter steckt.
Im August triumphierte Phil Collins (71) vor einem Gericht in Florida, als eine 20-Millionen-Dollar-Klage seiner Genfer Ex-Ehefrau abgewiesen wurde. Jetzt wurde die Begründung veröffentlicht. Und die hat es in sich: Richter Alan Fine beschuldigt Orianne Cevey, eine Lügnerin zu sein, die einen Meineid beging.
Im Streit zwischen dem «Genesis»-Frontmann und der Mutter seiner Söhne Matthew (17) und Nicholas (21) ging es um Collins' Villa in Miami, die dieser im Februar 2021 für 40 Millionen Dollar verkauft hatte. Cevey verlangte daraufhin 20 Millionen Dollar. Sie behauptete, dass ihr Collins die Hälfte eines Verkaufs versprochen hatte – wenn sie wieder bei ihm einziehen würde. Richter Fine glaubte Ceveys Ausführungen nicht und wurde in seiner Urteilsbegründung sehr deutlich. «Die Klägerin hat während der Anhörungen absichtlich getäuscht – und unter Eid im Gericht durchgehende Falschaussagen getätigt», erklärte er.
Cevey wollte Dokumente nicht vorlegen
So habe die Klägerin behauptet, dass «bestimmte finanzielle Dokumente von ihrem Schweizer Bankkonto existieren» – sich dann allerdings geweigert, diese dem Gericht und Collins‘ Anwälten zukommen zu lassen. Der Vorsitzende Richter des obersten Bezirksgerichts von Miami-Dade County meint dazu: «Die logische Schlussfolgerung war, dass diese Dokumente nicht existieren. Ihr Motiv hinter ihrer Falschaussage war, den Prozess weiterzuführen, ohne sich an die Auflagen des Gerichts halten zu müssen. Diese Unehrlichkeit ist ein Affront gegen die Interessen der Justiz und der Gerechtigkeit!».
Cevey und Collins waren von 1999 bis 2007 verheiratet. 2015 hatte sich das Paar noch einmal versöhnt. Fünf Jahre später machte der Musikstar jedoch endgültig Schluss mit Cevey, weil diese heimlich einen 25 Jahren jüngeren Partner in Las Vegas geheiratet hatte. Als er sie vor die Tür setzen wollte, weigerte sie sich, ihren goldenen Käfig freiwillig zu verlassen.
Als Collins darauf eine Räumungsklage einreichte, konterte sie mit einer Gegenklage, in der sie ihn als «stinkenden, impotenten Wortbrecher» verunglimpfte. In den Gerichtsunterlagen behauptete Cevey, Collins habe 2017 mit starkem Trinken und dem Missbrauch von Schmerzmitteln angefangen. Laut Gerichtsakten sei er «oft unter dem Einfluss der Alkohol-Medikamenten-Kombi auf den Kopf gefallen und musste sich unter einem falschen Namen ins Krankenhaus einliefern lassen.»
Der Tiefpunkt sei dann 2019 erreicht gewesen: «Er hat sein musikalisches Talent verloren, wurde depressiv, hat mich misshandelt, seine Kinder vernachlässigt und war dann nach einer Operation am Rücken von Schmerzmitteln und Antidepressiva süchtig.» Laut Gerichtsakten habe Collins aufgehört, seine Zähne zu putzen und habe fast ein Jahr lang nicht mehr geduscht. Cevey behauptete weiter: «Sein Gestank war nicht mehr auszuhalten, weshalb er auch keine Leute mehr gesehen hat. Es war ihm auch nicht mehr möglich, Sex zu haben.»
Im November 2020 handelte Collins Anwalt Jeffrey Fisher einen Vergleich aus. Cevey musste alle persönlichen Gegenstände von Phil Collins – darunter Millionen Dollar teure Sammlerstücke – herausrücken, durfte aber noch bis Ende Januar 2021 in dem Domizil wohnen bleiben. Kaum war sie ausgezogen, verkaufte der «Genesis»-Frontmann die 40-Millionen-Dollar-Villa. Schreibt Blick. Wer denn Sonst?
«Stinkender Wortbrecher» geht ja noch. Da kann man beide Augen zudrücken. Aber den eigenen Ehemann als «impotenten Wortbrecher» zu bezeichnen, ist dann doch zuviel des Guten. Selbst für den Richter von Florida ein no go!
Denn auf nichts sind wir Männer so stolz wie auf unsere niemals versiegende Quelle der Potenz. Nur die immerwährende «deutsche Eiche», die jedem Sturm trotzt, macht uns Männer zu dem, was von uns verlangt wird: to be always ready for take off. Sollte dies ausnahmsweise mal nicht der Fall sein, hilft immer noch die blaue Pille.
Stinkende Männer gibt es wie Sand am Meer. Das gehört zur maskulinen DNA. Was wäre ein Mann ohne gesunden Fussschweiss? Eine klägliche, verweichlichte Memme! Wer je eine Rekrutenschule mit den berüchtigten Zehner-Zimmern absolviert hat, weiss wovon hier die Rede ist. Mit dem starken Geschlecht und den Rekruten-Schlafzimmern ist das so wie mit dem Fondue: «Chli stenke muess es.»
Vor vielen Jahren traf ich den damals wohl hippsten Frauenschwarm Udo Jürgens im Zürcher Mascotte für ein längeres Interview. Face to Face. Ein interessanter und angenehmer Mensch in der Blüte seines Lebens. Keine Frage. Aber gesegnet mit einem furchtbaren Mundgeruch. Vermutlich aus den Tiefen seiner Eingeweiden stammend.
Und? Hat es ihm geschadet? Nicht die Bohne! Udo Jürgens war nicht nur einer der erfolgreichsten Singer/Songwreiter des deutschsprachigen Raums, sondern auch ein ebenso begabter und tüchtiger Womanizer, der nichts anbrennen liess. Hunderttausende von Frauen können nicht irren.
Was bei Fondue richtig ist, kann bei Männern niemals falsch sein. Bei Frauen hingegen schon. Impotenz spielt beim femininen Geschlecht ohnehin keine Rolle. 95 Prozent aller weiblichen Orgasmen sind sowieso nur vorgespielt. Merkt Euch das, Ihr unverbesserlichen Machos!
Aber schon der geringste Hauch eines üblen Geruchs oder ein leises Fürzchen lässt die «Krone der Schöpfung» (alttestamentarisch für «Männer») hurtigen Schenkels die Flucht ergreifen. Da hört bei (fast) jedem Mannsbild der Spass definitiv auf. Das sind wir CHANEL N°5-Verwöhnten uns vom schwachen Geschlecht schlicht und einfach nicht gewohnt.
Wunderkind Mozart ausgenommen. Der konnte davon nie genug kriegen. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie wieder mal im trauten Beisein Ihrer Partnerin zwecks intimer Stimulation «Eine kleine Nachtmusik» hören.
-
22.9.2022 - Tag der Empörungsbilder
FDP-Chef zum Handshake zwischen Cassis und Lawrow: «Ein Foto davon ist unglücklich …»
Bald sind wir Mitglied des Uno-Sicherheitsrats. Jedes Wort, jede Tat muss auf die Goldwaage. Doch Bundespräsident Cassis schüttelt am Tag der Mobilmachung die Hand des russischen Aussenministers. Das sorgt für Ärger.
Das hat in der Schweiz einiges Stirnrunzeln ausgelöst. Ausgerechnet am Tag der russischen Mobilmachung trifft der Schweizer Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis (61) den russischen Aussenminister Sergei Lawrow (72) in New York.
Cassis hatte im Vorfeld angekündigt, «die jüngsten Provokationen von Präsident Putin» anzusprechen und die nukleare Drohung zu verurteilen. «Ich werde Aussenminister Lawrow auffordern, auf eine weitere Eskalation in diesem schlimmen Krieg zu verzichten und die russischen Truppen sofort abzuziehen», so der Bundespräsident am Mittwoch an einer Medienkonferenz.
Russland nutzt Bild zu Propagandazwecken
Doch Lawrow macht daraus etwas anders: Ein Bild, das vom russischen Aussenministerium auf Twitter verbreitet wurde, zeigt die beiden händeschüttelnd in die Kamera lächelnd.
Am Tag, als Putin 300'000 Bürger in den Angriffskrieg gegen die Ukraine zwingt, kann Russland – daheim und in der Welt – so den Eindruck erwecken, als sei es noch Teil der Welt- und Wertegemeinschaft.
Geharnischte Reaktionen in der Schweiz
In den sozialen Medien löste Cassis’ Auftritt zum Teil geharnischte Reaktionen aus. Deutliche Worte kommen etwa von Ex-Nationalrat Bernhard Guhl (50, Mitte): «Unser Bundespräsident gibt einem russischen Kriegsverbrecher die Hand. Aber in die Ukraine reiste er nicht. Ich glaubs nicht ...», spart er nicht mit Kritik.
Glücklich über den Auftritt wirkt auch Cassis’ Parteipräsident Thierry Burkart (47) nicht. Wie es seine Aufgabe ist, stellt er sich aber schützend vor seinen Bundesrat: «Wollen wir unsere guten Dienste anbieten? Dann muss man mit Aussenminister Lawrow sprechen, und dann gehört ein Handshake dazu», sagt der FDP-Chef. «Ein Foto davon ist unglücklich, lässt sich aber manchmal nicht verhindern.»
Allerdings: Ansonsten liess sich kein Staatsoberhaupt oder Aussenminister einer westlichen Demokratie mit Lawrow abbilden. Neben Peter Maurer (65), der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, der im Sinne des Auftrags der Organisation immer auch mit Schergen und Autokraten redet, traf Lawrow gemäss Twitter und Bildern der internationalen Fotoagenturen an diesem Mittwoch noch den venezolanischen Aussenminister Carlos Faría Tortosa (59), Faustin-Archange Touadéra (65), Präsident der Zentralafrikanischen Republik, sowie den armenischen Aussenminister Ararat Mirzoyan (42) und den bolivianischen Aussenminister Rogelio Mayta (51).
EDA sieht kein Problem
Das Aussendepartement (EDA) erklärt dazu: «Beim Treffen mit dem russischen Aussenminister Lawrow waren zu Anfang mehrere Bildjournalisten anwesend. Selbstverständlich existieren davon Bilder – wie von allen Treffen des Bundespräsidenten in New York. An der Uno sind Medien zu Beginn aller Treffen zugelassen.»
Selbst wenn es angesichts der neuen Eskalation wohl zahlreiche bilaterale Treffen gegeben hat: Kein anderer Vertreter einer westlichen Demokratie hat sich bislang dazu verleiten lassen, dem Aggressor Russland diese Bühne zu bereiten. Schreibt Blick.
Da wird wieder einmal arg viel Empörung freigesetzt. Dass der Schweizer Aussenminister seinem russischen Amtskollegen die Hand reicht, ist eigentlich unter zivilisierten Menschen das Normalste der Welt.
Wer frei von Sünde ist werfe den ersten Stein: Politiker*innen aller Couleur sind dazu verdammt, ab und zu auch einem Ganoven die Hand zu drücken und den Dialog zu suchen. Politik ist und war schon immer in vielen Bereichen ein schmutziges Geschäft.
Eigenartigerweise hielt sich die Empörung über die wirklich demütigenden «Koch- und Kellner»-Bilder von Macron, Scholz, Nehammer und António Guterres an Putins Psychopathen-Tisch im Moskauer Machtzentrum in Grenzen.
Dabei wurden genau diese bewusst vom Kreml inszenierten Bilder im russischen Fernsehen auf Heavy-Rotation stundenlang gesendet, um die Erhabenheit des neuen russischen Zaren seinem Fussvolk zu beweisen.
Die westlichen Medien waren sich nicht zu schade, den überdimensionalen Putin-Tisch auf die Angst des Diktators vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zurückzuführen.
Dass Putin in der gleichen Zeit-Periode der westlichen Besucher beispielsweise seinen Hofnarren Lukaschenko aus Belarus empfing und ganz normal auf einem Stuhl ohne nennenswerten Abstand neben sich sitzen liess, scheint den westlichen Putin-Experten entgangen zu sein.
Putin war schon immer ein Meister der Inszenierung. Das haben Diktatoren in der Regel so an sich. Besonders dann, wenn sie körperlich nicht unbedingt (Putin 170 cm) die Grössten sind.

-
21.9.2022 - Tag der trojanischen Pferde
Keller-Sutter in Sarajevo: Zahl der Migranten auf der Balkanroute steigt wieder stark
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat am Dienstag an einer Ministerkonferenz in Sarajevo zum Thema Migration teilgenommen. Die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die über die Balkanroute nach Westeuropa kommen, steigt wieder stark - das gilt auch für die Schweiz.
Unter dem Radar des Ukraine-Kriegs kommen wieder mehr Menschen über die Balkanroute nach Westeuropa. Die Zahlen seien «stark gestiegen», sagte Keller-Sutter zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA und verwies auf Österreich, das bis jetzt 56'000 Asylsuchende verzeichnet.
Zwar ist die Schweiz für viele Migranten ein Transitland, trotzdem sind die Zahlen von Asylsuchenden wieder gestiegen: Bis Ende August wurden laut Staatssekretariat für Wirtschaft (SEM) 12'362 Asylgesuche registriert. Zudem korrigierte das SEM die erwarteten Asylzahlen von rund 16'500 auf 19'000 bis Ende 2022.
Da sei es natürlich hilfreich, wenn die Balkanstaaten eigene Rückführungsflüge durchführten, sagte die für Schengen zuständige Justizministerin. Neu hat etwa Bosnien und Herzegowina ein solches Abkommen mit Pakistan. Ein erster Rückführungsflug fand bereits statt. «Auch die Schweiz ist darauf angewiesen.»
Die Gründe für die steigende Migration sind vielfältig. Bekannt ist jedoch, dass seit neuerem Bürger aus Indien, Kuba und Burundi kein Visum mehr brauchen, um nach Serbien zu reisen. «Die Menschen fliegen nach Belgrad und kommen mit Schlepper via Ungarn nach Österreich, um dann weiter zu reisen», sagte die Justizministerin.
Ob das mit Serbien befreundete Russland seine Finger mit im Spiel hat, wie einige osteuropäische Staaten annehmen, ist unklar. Aber das Muster ist laut Keller-Sutter bekannt: Länder wie Polen sollen durch eine hohe Zahl an Migranten aus Krisengebieten, die von Belarus her kommen, destabilisiert werden. Auch hier vermutet man ein Manöver Russlands.
«Es wäre daher wünschenswert, wenn die Visumspolitik der Balkanstaaten mit jener aus dem Schengen-Raum harmoniert würde», so die Justizministerin. Mehrere EU-Staaten planen nun eine Intervention bei der EU-Kommission, an der sich auch die Schweiz beteiligen will. Schreibt Blick.
Die von Keller-Sutter geäusserte Vermutung, die sie sich zwar nicht zu eigen macht wie sie an der Pressekonferenz betonte, dass sich Serbien zum willfährigen Helfer und Handlanger Russlands entwickelt, liegt eigentlich auf der Hand.
Die Ausrede der serbischen Regierung, auf die Visumpflicht zu verzichten, weil Serbien Arbeitskräfte benötige, tönt schon fast nach Satire.
Ausgerechnet der Unrechtsstaat vom Balkan mit einer geschätzten Arbeitslosenquote von rund 10 Prozent, der Hunderttausende seiner Bürgerinnen und Bürger als Arbeitskräfte in viele Länder rund um den Erdball exportiert, will an Arbeitskräftemangel leiden. Wenn das kein Treppenwitz ist, was dann?
Tatsache ist, dass Serbien den (verlorenen) Balkankrieg und damit den Verlust des Kosovos als serbisches Staatsgebiet bis heute nicht verwunden hat.
Hinzu kommt die historisch begründete Verbundenheit Serbiens als slawisches Brudervolk mit Russland sowie die Träume der serbischen Ultrakonservativen von einem «Gross-Serbien».
Dafür – und für billiges Gas/Erdöl – betätigt man sich schon mal als Juniorpartner Russlands für Putins Destabilisierungs-Konzept. Ähnlich dem russischen Hofnarren aus Belarus.
Ob sich die EU bewusst ist, welches trojanische Pferd, das auch mit China stark verbandelt ist, Mitglied der hehren westlichen Staatengemeinschaft werden will?
-
20.9.2022 - Tag der besoffenen Russen
Russischer Abgeordneter droht Deutschland und Grossbritannien mit Atomschlag
In einer Talk-Sendung des russischen Propaganda-Senders Orc-TV drohte der betrunkene Andrei Guruljow, Abgeordneter der Staatsduma, Deutschland und Grossbritannien mit einem Atomschlag. Dies berichtet das Medium Nexta auf Twitter.
Ihm zufolge würde Russland nicht einen Atomangriff auf die Ukraine, sondern viel mehr einen nuklearen Angriff auf Deutschland oder Grossbritannien starten. «Es könnte sein, dass Russland Atomwaffen verwenden wird, aber definitiv nicht in der Ukraine. Wir werden dort immer noch leben müssen», so der russische Abgeordnete. Vielmehr sollte sich der beispielsweise glückliche, wohlgenährte deutsche Bürger, dessen Hintern schon vor dem kommenden Winter kalt wird, vor einem Atomangriff fürchten.
Oder die britischen Inseln, welche die Russen «innerhalb von drei Minuten in eine kriegerische Wüste verwandeln» könnten. Schreibt Blick im Ukraine-Liveticker.
Liveticker-Formate haben auch so ihre Unarten: Sie müssen im Stundentakt mit Inhalten gefüllt werden. Die Qualität spielt deshalb bei diesen Medien-Formaten längst keine Rolle mehr.
Anders kann man sich nicht erklären, weshalb schwachsinniges Talk-Getöse eines besoffenen Russen überhaupt publiziert wird.
Seit die untergegangene UdSSR und Nachfolger Russland die Atombombe in ihrem Waffenarsenal führen, drohten sie bis zum heutigen Tag immer wieder mit einer gewissen Regelmässigkeit anderen Staaten – vorwiegend aus dem Westen – mit dem Einsatz der verheerenden Teufelswaffe.
Doch egal, wer im Kreml gerade die Macht ausübt: Die Allmächtigen Russlands sind sich schon bewusst, dass die Atombombe keine Angriffswaffe ist. Ausser besoffenen Duma-Abgeordneten weiss das so ziemlich jeder, der seine Tassen noch einigermassen geordnet im Schrank hat.
Denn für den Absender einer Atombombe gilt die simple Erkenntnis, dass er definitiv als Zweiter stirbt. Anders ausgedrückt: Zerstörst du mir London, wird kurz darauf Moskau dem Erdboden gleichgemacht.
Atomwaffen sind reine Abschreckungswaffen, die den Besitzer vor Angriffen schützen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nordkorea lässt (erfolgreich) grüssen.
-
19.9.2022 - Tag der Esel, die sich gegenseitig Langohr schimpfen
Nach ihrer Kritik an Stromkonzernen: Axpo-Verwaltungsrat weist Martullo zurecht
Vier Milliarden Franken will der Stromriese Axpo vom Bund, um weiterzugeschäften wie bisher. Das kritisierte SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo im Blick-Interview. Ein Axpo-Verwaltungsrat rüffelte die Ems-Chefin deswegen erneut.
SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo (53) hat die Schweizer Stromkonzerne im Blick-Interview am Samstag scharf kritisiert. Nicht zum ersten Mal – sie tat es schon im Februar. Das stört Axpo-Verwaltungsrat Stefan Kessler (48), wie Martullo nun berichtet.
«Im vergangenen Februar wies ich im Blick auf die Handelsgeschäfte und die grossen Spekulationsrisiken hin und forderte mehr Kontrolle von den Eignerkantonen», so die Ems-Chefin. Der für den Prüfungs- und Finanzausschuss verantwortliche Axpo-Verwaltungsrat habe sich darauf bei ihr gemeldet. «Und wies mich schriftlich zurecht.»
«Vorab informieren»
Martullo berichtet, der Axpo-Verwaltungsrat habe ihre Äusserungen mit «mit grossem Erstaunen» und «selten so etwas Unqualifiziertes und Falsches gelesen» kommentiert. Kessler schrieb ihr weiter, sie solle sich «vorab über Zusammenhänge informieren».
Inzwischen musste sich der Stromkonzern unter den Schutzschirm des Bundes retten. Für den Fall, dass die Axpo ihre Geschäfte bei einem erneuten Strompreis-Sprung rasch mit Hunderten Millionen Franken besichern muss, hat sie sich einen Vier-Milliarden-Kredit gesichert. Für dieses Geld müssen jedoch nicht ihre Eigner geradestehen, die Kantone, sondern der Bund.
Kein bisschen kleinlauter
Wer nun denkt, der Axpo-Verwaltungsrat wäre inzwischen kleinlaut geworden, irrt. Am Samstag hat Kessler ein weiteres E-Mail geschickt – im selben Stil. Die Axpo erklärt dazu am Sonntag: «Die von Frau Nationalrätin Martullo vorgebrachten Vorwürfe sind falsch, da die Kreditlinie des Bundes mit Spekulation nichts zu tun hat und der in der Schweiz produzierte Strom letztendlich auch in der Schweiz ausgeliefert wird.»
Die Axpo führe seit längerer Zeit Gespräche mit interessierten Personen aus der nationalen und kantonalen Politik zur Erklärung der energiewirtschaftlichen Zusammenhänge. Tatsächlich hatte Kessler Martullo schon im Februar angeboten, er stehe zur Verfügung, wenn sie sich über den Strommarkt informieren wolle.
Gegen das Axpo-Management durchsetzen
Dennoch sagt die Ems-Chefin: «Inzwischen höre ich, dass auch kritische Kantonsvertreter so abgewimmelt oder hingehalten wurden.» Heute seien ihre damaligen Befürchtungen Realität geworden «und der Bund muss Milliarden zur Verfügung stellen».
Sie bleibt dabei: «Nun müssen sich der Bund und die Eignerkantone gegen das Axpo-Management durchsetzen und eine fundierte Prüfung der Geschäfte vornehmen.» Die Eigenhandelsgeschäfte seien einzuschränken und es sei eine Geschäftsstrategie mit Konzentration auf die günstige Eigenversorgung der Schweiz zu definieren. Das Seilziehen um die Axpo dürfte weitergehen. Schreibt Blick.
Martullo und Trump haben eine Gemeinsamkeit: Es ist nicht alles falsch, was die beiden zum Besten geben, aber sie sind die falschen Personen. Oder anders ausgedrückt: Sie sind nicht Teil der Lösung, sondern meistens Teil des Problems, das sie kritisieren.
Martullo hat ja absolut recht, wenn sie den Stromhandel und damit die Axpo als Spekulations-Casino der «skrupellosen Boni-Manager» bezeichnet. Doch da gibt es die Geschichte der dem fatalen Neoliberalismus geschuldeten Deregulierungen.
Und an denen war der grosse Zampano vom Herrliberg und Martullos Vater Christoph Blocher mit seiner SVP im Gleichschritt mit FDP, der Mitte-Partei (vormals CVP) und den Grün-Liberalen massgeblich an vorderster Front beteiligt.
Dass dem Staat gewisse Kernaufgaben obliegen wie beispielsweise die Energiesicherheit für Bürgerinnen und Bürger ist eine alte Weisheit. Mit «Kommunismus» und «Sozialismus» hat sie rein gar nichts zu tun. Das sei hier explizit erwähnt. Mit einer funktionierenden Demokratie allerdings sehr viel.
Leider kommt diese Erkenntnis in Zeiten des ungezügelten Neoliberalismus und verantwortungslosen Deregulierungs-Orgien erst in Krisensituationen mit erschreckender Deutlichkeit zum Vorschein. Das war während der Corona-Pandemie der Fall und ist jetzt auch wieder bei der massivsten Inflation der Nachkriegsjahre und dem verheerenden Ukraine-Krieg zu beobachten.
Die alte Mär vom «freien Markt», der alles reguliert, funktioniert nicht einmal in Schönwetterzeiten. Geschweige denn in stürmischen.
-
18.9.2022 - Das «System Lukaschenko» macht Schule in den USA
Protestaktion gegen US-Demokraten: Florida schickt Migranten auf noble Ferien-Insel
Martha's Vineyard liegt weit von Florida entfernt. Dessen republikanischer Gouverneur aber ließ unangekündigt Migranten auf die bei prominenten Demokraten beliebte Ferieninsel fliegen. Das Weiße Haus nannte die Aktion "grausam".
Im Streit über die Einwanderungspolitik in den USA weiten republikanische Gouverneure ihre Methode aus, Migranten in demokratisch geprägte Teile des Landes zu schaffen. Auf der noblen Ferieninsel Martha's Vineyard im Bundesstaat Massachusetts kamen überraschend mehrere Dutzend Migranten per Flugzeug an. Der republikanische Gouverneur von Florida im Süden des Landes, Ron DeSantis, hatte die Menschen dorthin bringen lassen, wie sein Büro in einer Stellungnahme verkündete.
Darin hieß es weiter, Staaten wie Massachusetts hätten die Menschen "eingeladen", in die USA zu kommen, indem sie einen Anreiz für illegale Migration schafften und Bidens "Politik offener Grenzen" unterstützten. Massachusetts hat zwar einen republikanischen Gouverneur, gilt ansonsten jedoch als demokratisch geprägter Bundesstaat, der auch im Senat von zwei Demokraten vertreten wird.
Martha's Vineyard ist bekannt als beliebter Ferienort prominenter Demokraten. Die Obamas besitzen beispielsweise seit ein paar Jahren eine Luxus-Strandvilla auf der Insel. Auch andere Prominente und Wohlhabende verbringen Urlaube auf der Insel.
"Böse und unmenschlich"
Das Weiße Haus verurteilte die Aktionen der republikanischen Gouverneure mit scharfen Worten. Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre nannte ihr Vorgehen "schändlich", "rücksichtslos" und "schlicht falsch". Es handele sich um eine kalte, politische Aktion. Familien und Kinder würden als politisches Druckmittel eingesetzt: "Es ist unmenschlich", sagte sie. "Es ist grausam."
Der örtliche demokratische Abgeordnete Dylan Fernandes schrieb auf Twitter, die Gemeinde habe sofort Betten, Mahlzeiten und medizinische Versorgung für die Migranten organisiert. Er kritisierte das Vorgehen der Republikaner scharf: "Republikaner, die sich selbst als Christen bezeichnen, planen seit einiger Zeit, Menschenleben - Männer, Frauen und Kinder - als politisches Pfand zu benutzen. Das ist böse und unmenschlich." Viele der Migranten wüssten nicht, wo sie sind. Ihnen sei offenbar gesagt worden, dass sie Wohnungen und Jobs bekämen.
DeSantis gilt als möglicher Präsidentschaftsbewerber der Republikaner und als derzeit größter parteiinterner Konkurrent für Ex-Präsident Donald Trump, der seit Wochen Spekulationen anheizt, dass er 2024 für eine zweite Amtszeit antreten könnte. DeSantis ist mitten im Wahlkampf für eine weitere Amtszeit als Gouverneur.
Aus Texas zu Harris' Residenz geschickt
Der texanische Gouverneur Greg Abbott, der ebenfalls im Wahlkampf ist, ließ zwei Busse voller Migranten öffentlichkeitswirksam in die Nähe der Residenz von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington bringen. Ihre Aufgabe ist es, Fluchtursachen zu bekämpfen und illegale Migration so einzudämmen. Harris leugne die Krise und behaupte, die US-Grenze sei sicher, schrieb Abbott auf Twitter: "Wir schicken Migranten in ihren Hinterhof, um die Regierung Biden aufzufordern, ihren Job zu machen und die Grenze zu sichern.
"Im Frühjahr hatten Abbott und sein republikanischer Amtskollege aus Arizona, Doug Ducey, damit begonnen, aus Protest gegen die Migrationspolitik der Regierung von US-Präsident Joe Biden Migranten aus den Grenzgebieten mit Bussen in die demokratisch regierten Großstädte Washington, New York und Chicago zu bringen.
Allein in Washington kamen Berichten zufolge bereits mehr als 9000 Migranten an. Die demokratische Bürgermeisterin Muriel Bowser rief angesichts der eintreffenden Migrantenbusse zuletzt den Notstand aus, um Unterstützung durch den Bund zu bekommen.
Bei der Kongresswahl am 8. November, in der Mitte von Bidens Amtszeit, werden in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an.
Das Thema Migration gehört seit Jahren zu den erbittertsten Streitpunkten zwischen Demokraten und Republikanern. Trump hatte in seiner Amtszeit einen besonders harten Kurs in der Migrationspolitik gefahren und sich auf verschiedensten Wegen bemüht, Einwanderung zu erschweren. Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war das prominenteste Beispiel. Hinzu kamen unzählige Verschärfungen, um Asylsuchende - aber auch andere Einwanderer - fernzuhalten. Biden schlug zu seinem Amtsantritt einen grundlegend anderen Kurs ein. Schreibt Tagesschau.
Erinnert stark an die mit Moskau orchestrierte Aktion von Putins Hofnarr Lukaschenko aus Belarus, der Polen und die baltischen Staaten im Herbst 2021 mit Flüchtlingen flutete, die er zuvor aus allen Himmelsrichtungen einfliegen liess.
Quo vadis Amerika?
-
17.9.2022 - Tag der Saktions-Experten*innen
«Zu viele ausländische Teile» – Russischer Lada-Konzern stellt Prestigeprojekt Xray ein
Er war der erste Lada, der nicht mehr wie ein Lada aussah: Der russische Autohersteller begräbt sein Vorzeigeprojekt Xray, mit dem einst die Modernisierung des Konzerns begonnen hatte – eine indirekte Folge des Krieges gegen die Ukraine.
Der russische Autobauer Lada hat angekündigt, nach mehrmonatiger Unterbrechung der Produktion wegen der Sanktionen die Fertigung vieler Modelle wieder langsam hochzufahren. Nicht mehr im Produktionsprogramm aber: der Lada Xray, ein kompaktes SUV.
Der Grund für das Ende des Xray sei »der sehr hohe Anteil importierter Komponenten«, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti einen Lada-Vertreter. Das Aus für den Xray ist ein durchaus symbolhafter Schritt: Der Wagen gehörte zu den ersten Entwürfen des Designers Steve Mattin, der lange für Mercedes und Volvo Fahrzeuge gestaltet hatte. Seine Mission: Das angestaubte Image des von vielen Krisen gebeutelten Lada-Konzerns aufmotzen und den Fahrzeugen eine moderne, ansprechende Designsprache zu verpassen (ein Interview mit Steve Mattin finden Sie hier).
Keine Lieferanten für 1500 Bauteile
Die Sanktionen haben Russlands Autobranche schwer getroffen. Viele westliche Autobauer haben die Produktion in ihren Fabriken eingestellt. Der langjährige Lada-Partner Renault-Nissan hat sich aus der Kooperation zurückgezogen. Ein akuter Mangel an Bauteilen und Vorprodukten führte im Frühjahr auch bei russischen Herstellern zu massenhaften Fabrikstilllegungen.
Inzwischen hat Awtowas die Herstellung von Fahrzeugen wieder aufgenommen. Die Ladas, die nun vom Band rollen, sehen allerdings nur noch so aus wie die Autos, die vor Beginn des Überfalls auf die Ukraine produziert worden: Einige haben keine Airbags, den Bremsassistenten ABS will das Unternehmen erst ab 2023 wieder verbauen, – sofern bis dahin alternative Lieferanten gefunden sind.
Nach Konzernangaben hat Lada bei insgesamt 1500 von 4500 Bauteilen noch keine alternativen Lieferanten gefunden. Zugleich sind die Neuwagenpreise gestiegen: Im Frühjahr kostete das Modell Lada Vesta noch etwa eine Million Rubel, inzwischen werden bis zu drei Millionen Rubel (50.000 Euro) aufgerufen. Schreibt DER SPIEGEL.
Soviel zu dem beinahe täglich von Politikern*innen – vorwiegend zusammengesetzt aus Putin-Verstehern*innen – und einigen weltfremden Journalisten*innen geäusserten Vorwurf, Sanktionen gegen Russland würden keine Wirkung erzielen.
Einige dieser Besserwisser*innen gehen noch weiter mit ihren Behauptungen. Sanktionen hätten noch nie etwas bewirkt.
Als Beweis für die Richtigkeit dieser Aussage werden sanktionierte Staaten wie Kuba, Nordkorea und Iran genannt. Die verarmte Bevölkerung dieser von Despoten und Gewaltherrschaft dominierten Ländern ist vermutlich anderer Ansicht als unsere westlichen Sanktions-Experten*innen.
Richtig ist, dass die meisten Sanktionen erst mit einer zeitlichen Verzögerung ihre Wirkung entfalten. Richtig ist auch, dass sie häufig diejenigen, die die Sanktionen verhängen, zuerst treffen. Das bestreitet auch niemand. Der Westen erlebt dies gerade schmerzlich bezüglich russischem Gas und Erdöl.
Doch langfristig haben derart massive Sanktionspakete wie derzeit gegen Russland verhängt die Potenz, den Industriesektor eines Landes um Jahre wenn nicht gar Jahrzehnte in seiner Entwicklung zurückzuwerfen. Fehlende Airbags und ABS-Systeme sind wohl eher kleinere Randerscheinungen.
Problematischer wird's bei sanktionierten Hightech-Produkten. Das erfährt die russische Luftfahrt derzeit bereits mit den westlichen Flugzeugen. Etliche davon mussten bereits stillgelegt werden und dienen nur noch als «Ersatzteillager».
-
16.9.2022 - Tag der Propeller-Flugzeuge
Fluglotsen-Streik in Frankreich betrifft auch die Schweiz
Flugreisende in und nach Frankreich müssen sich am Freitag auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Ab den frühen Morgenstunden wollen Fluglotsinnen und Fluglotsen im Land ihre Arbeit für 24 Stunden niederlegen.
Die Generaldirektion für Zivilluftfahrt rief Airlines dazu auf, ihr Angebot auf dem französischen Festland und den Überseegebieten um die Hälfte herunterzufahren.
Air France kündigte an, etwa 55 Prozent der Kurz- und Mittelstreckenflüge am Freitag zu streichen.
Flüge von Zürich und Genf nach Paris betroffen
Von Annullierungen betroffen sind auch einige wenige Flüge von Zürich und Genf mit Zielflughäfen in Frankreich, namentlich nach Paris. Das zeigt ein Blick auf die Liste der Abflüge, die die beiden Flughäfen jeweils online veröffentlichen.
Zu dem Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft SNCTA. Nach sechs Monaten Verhandlungen vermisse man konkrete Antworten der Arbeitgeberseite, hiess es.
Zweite Streikankündigung
Streitpunkte sind die Sicherung des Nachwuchses sowie die Forderung nach Zahlungen zum Inflationsausgleich. Laut der Gewerkschaft wird zwischen 2029 und 2035 ein Drittel der Fluglotsinnen und Fluglotsen in Rente gehen.
Wegen der langen Ausbildung müsse im kommenden Jahr ein Plan für den Nachwuchs stehen. Die Gewerkschaft hat bereits eine zweite Streikankündigung für den 28. bis 30. September veröffentlicht. Schreibt Blick.
Schlechte Nachrichten für Bundesrat Alain «Berserker» Berset: Da wird's wohl nix mit einem kurzen Wochenendausflug mit dem «Privat-Propeller-Jet» nach Frankreich, wo so viele hübsche Damen wohnen.
-
15.9.2022 - Tag des Teufels vs. Beelzebub
«Würden gerne Gas sparen, dürfen es aber nicht», beklagt der Daimler-Truck-Chef
Der Vorstandsvorsitzende von Daimler Truck, Martin Daum, ist sauer auf die Bundesregierung und ihre Energiepolitik. Sein Unternehmen wolle Gas sparen, sei dazu in der Lage, aber dürfe es nicht. Grund dafür: die Bürokratie. Diese sei „wie bei Asterix und Obelix“.
Martin Daum ist Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck und aktuell ziemlich unzufrieden mit der Energiepolitik der Bundesregierung. In einem Interview mit der „FAZ“ kritisiert er diese scharf. „Wir würden gern Gas sparen, dürfen es aber nicht, aus Emissionsschutzauflagen“, so Daum. „Das ist ein absolutes Unding. Wir diskutieren über die Gradzahl beim Duschen und ob wir Monumente nicht mehr beleuchten: Das ist ein absoluter Witz verglichen mit dem, was wir als Industrie sparen können, wenn wir unbürokratisch und schnell unsere Heizkraftwerke auf Heizöl umstellen.“
Das Unternehmen sei bereits seit Anfang August in der Lage, die komplette Prozesswärme auf Heizöl umzustellen. Das könnte nach Angaben des Managers ungefähr 40 Gigawattstunden Gas im Monat sparen. Der Bundestag werde jedoch erst Ende September oder Anfang Oktober darüber entschieden, ob die Bürokratie verkürzt werde. „Irgendwann Ende Oktober dürfen wir dann vielleicht umstellen.“
„Das ist Bürokratie wie bei Asterix und Obelix“
Daum habe es in mehreren Anläufen und auf allen Verwaltungsebenen versucht, aber der Antrag würde vom Landkreis ans Land und von dort an den Bund weitergereicht. „Wir haben eine Betriebsgenehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Die Änderung erfordert Gutachten und Begründungen“, sagte er der „FAZ“ und ging hart mit der Verwaltung ins Gericht. „Das ist die Bürokratie wie bei Asterix und Obelix. Niemand meint es böse. Hätten wir morgen kein Gas mehr, wäre das wahrscheinlich über Nacht möglich.“
Zudem zweifelte der Vorstandschef des Lkw-Herstellers, dessen Geschäft sonst als sehr konjunkturabhängig gilt, an den negativen Prognosen zur Konjunkturentwicklung: „Die Zeichen einer Rezession sind: Arbeitslosigkeit und Angebot übersteigt Nachfrage. Beides beobachte ich nicht.“
Er sei weder im Rat der Weisen, noch Forscher. „Es ist im Moment populär zu sagen: Der Himmel stürzt ein und das Ende der Welt ist gekommen. Das sehe ich nicht, auch wenn das System fragil ist. Wir werden eines Tages vielleicht eine Rezession haben und dann sagen alle: Ich habe es doch gesagt.“ Schreibt DIE WELT.
Bis zum «failed state» ist's in Deutschland (und anderen westlichen Demokratien) wahrlich nicht mehr weit. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Mit der gleichen politischen Elite, die uns in die schlimmste Nachkriegskrise geführt hat, werden wir so schnell nicht aus diesem Schlamassel herauskommen.
Man darf sich langsam fragen, ob wir uns mehr vor unserem Polit-Establishment als vor Putin fürchten müssen. Verkommen sind beide. Zumal es noch nie eine gute Strategie war, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.
-
14.9.2022 - Tag der Produkte, die kein Mensch braucht
Milka, Coca-Cola, Haribo: Viele Produkte werden im Supermarkt bald teurer
Viele Hersteller wie Coca-Cola oder Milka heben ihre Preise an. Für Kunden wird der Supermarkt-Einkauf damit bald noch teurer.
Viele Verbraucher stöhnen bereits jetzt angesichts teils stark angestiegener Preise bei Supermärkten und Discountern. Einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge ist das Ende der Fahnenstange allerdings wohl noch lange nicht erreicht.
Stefan Benett, Managing Director von Inverto, einer Einkaufsberatung für Unternehmen, warnt gegenüber dem Handelsblatt: „Es gibt hohe Kosten in den Lieferketten, die in den Konsumentenpreisen noch nicht angekommen sind“. Vor allem bei Lebensmitteln in Supermärkten dürften die Preise in den nächsten Wochen und Monaten deutlich ansteigen.
Coca-Cola, Haribo und Co. heben die Verkaufspreise an
Einige Beispiele: Die Brauerei Radeberger ziehen ab 1. Dezember die Preise an. Da der Konzern zu den Marktführern gehört, dürften weitere nachziehen. Auch weitere Getränkehersteller wie Coca-Cola oder Berentzen haben bereits Preiserhöhungen angekündigt. Beim Softdrink-Riesen hat dies bereits für einigen Ärger mit Supermarkt Edeka gesorgt.
Auch bei Süßwaren müssen sich Verbraucher auf höhere Preise einstellen. Milka-Hersteller Mondelez und Haribo hatten in der Vergangenheit ebenfalls angekündigt, dass ihre Produkte teurer werden.
Neben den Lebensmitteln müssen Kunden aber auch mit Teuerungen bei Waschmitteln, Duschgels oder Deo rechnen. Nivea-Hersteller Beiersdorfer befindet sich aktuell erneut in Preisverhandlungen mit dem Handel. Auch Henkel hat mit den steigenden Kosten bei Engpässen und Rohstoffen zu kämpfen. Bei Produkten wie Pril oder Persil bahnen sich daher ebenfalls Preiserhöhungen an. Schreibt FOCUS.
Milka, Coca-Cola, Haribo: Drei Dickmacher-Produkte, auf die man ruhig verzichten kann, ohne auch nur ein Quäntchen an Lebensqualität zu verlieren. Im Gegenteil. Unser Gesundheitsbarometer sowie das Körpergewicht werden sich dafür sogar bedanken.
-
13.9.2022 - Tag der Fahrradkette
Blick beantwortet 7 Fragen zum Vormarsch der Ukrainer: Wie rächt sich Putin?
Bei einem Überraschungsangriff im Osten des Landes haben die Ukrainer rund 30 Städte und Dörfer zurückgeholt. Blick erklärt, ob der Erfolg anhalten wird und wie Putin reagieren könnte.
Nachdem die Ukrainer die Russen im Osten überrumpelt und teilweise vertrieben haben, scheint der Kreml Gesprächsbereitschaft zu zeigen. Wie ernst ist das gemeint? Gibts bald Frieden oder holt Putin doch noch die Atomwaffen hervor?
Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum Krieg in der Ukraine, bei dem sich das Blatt definitiv zugunsten der Ukraine zu wenden scheint.
Ist das die Wende, gewinnt die Ukraine nun den Krieg?
Auszuschliessen ist das nicht. Mauro Mantovani (58), Strategieexperte an der ETH-Militärakademie, sagt zu Blick: «Die Ukrainer sind durch diese Erfolge ihrem Kriegsziel, die Russen ganz aus dem Land zu vertreiben, zwar näher gekommen. Der Weg dahin wird aber noch ein langer sein und möglicherweise über eine Eskalation der Gewalt führen.» Laut Mantovani haben die Ukrainer gute Chancen, langfristig sämtliche verlorenen Gebiete zurückzuerobern.
Auch ETH-Sicherheitsexperte Benno Zogg (32) geht davon aus, dass die Ukrainer mit ihrem Verteidigerbonus die eroberten Gebiete halten und weitere Vorstösse unternehmen. «Dieser Krieg bietet aber kaum schnelle Wenden, sondern eher monatelanges, zähes Vorankämpfen.»
Bei den Ukrainern herrscht Euphorie. «Schon in den nächsten Wochen werden wir einen raschen Vormarsch in der Region Luhansk erleben», sagt Sergij Gayday (46), Gouverneur von Luhansk, gegenüber Blick. «Unsere Städte sind von den Russen fast vollständig zerstört worden. Deshalb werden diese keine Schutzmöglichkeiten haben.»
Warum sind die ukrainischen Truppen im Osten so erfolgreich?
Die Ukrainer haben die Russen mit einem Täuschungsmanöver überrumpelt. Es schien in den vergangenen Tagen, dass sie den Fokus auf Cherson legten, worauf sich die Russen im Süden auf die Verteidigung einstellten.
Doch dann schlugen die Ukrainer überraschend und schnell im Osten zu. Mantovani: «Der Durchbruch erfolgte in einem Frontabschnitt, der durch Einheiten der Luhansker Miliz und russische Reservisten nur schwach besetzt war.» Zugleich sei offenbar russische Luftunterstützung ausgeblieben.
«Dass dieses Ablenkungsmanöver gelang, belegt erneut die Schwäche der russischen Nachrichtendienste», sagt Mantovani. Ihr Lagebild sei jenem der Ukrainer, die vom Westen unterstützt werden, deutlich unterlegen.
Dass sich die russischen Truppen teilweise ungeordnet zurückzogen und grosse Mengen an Kriegsgerät und Munition zurückliessen, zeuge nicht nur von einem Überraschungseffekt, sondern auch von einer «desolaten» Kampfmoral. Mantovani ist überzeugt: «Diese Moral dürfte sich nun in den Besatzungstruppen fortpflanzen.»
Wie geschwächt ist die russische Armee?
Die russische Armee habe kaum mehr Reserven, sagt Mauro Mantovani. Das habe sich vergangene Woche im Osten Russlands bei der Routineübung Wostok gezeigt, die von einst angeblich 300’000 auf 15’000 Mann zusammengeschrumpft sei. Mantovani: «Zeitsoldaten zu halten, geschweige denn hinzuzugewinnen, wird schwierig werden. Zudem sind die neuen Rekruten noch lange nicht ausgebildet.»
Die Russen könnten in der Ukraine bestenfalls noch besetzte Gebiete eine Zeit lang halten und weiterhin mit Raketen und Luftstreitkräften im Hinterland Schäden anrichten. «Grossräumig neue Gebiete zu erobern, scheint nun endgültig ausserhalb ihrer Möglichkeiten zu liegen», meint Mantovani.
Wie reagiert Putin auf die Kritik gegen ihn?
Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow (45), der Putin seine berüchtigten Söldner liefert, ist sauer auf den Kreml. Er spricht in einer Audiobotschaft von einer «unfassbaren Situation» an der Front und fordert eine Änderung der Strategie. Kritik soll es auch von hohen Beamten geben.
Solch offene Zweifel an der «Genialität Putins als Feldherr» seien in Russland gefährlich, sagt Mauro Mantovani. Er rechnet mit weiteren Entlassungen von Militärführern und Nachrichtendienstlern.
Wie gross ist die Chance auf Verhandlungen und einen Waffenstillstand?
Der russische Aussenminister Sergej Lawrow (72) hatte am Sonntag Verhandlungen nicht ausgeschlossen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (44) erklärte darauf allerdings, dass er aktuell keine Möglichkeit für Verhandlungen sehe, weil die russische Regierung keine Bereitschaft zu einer konstruktiven Lösung zeige. Eine Einigung könne erst nach dem vollständigen Abzug der russischen Truppen erzielt werden.
Benno Zogg sagt: «Wenn sich russische Verhandlungsangebote konkretisieren dürften, wäre dies als Finte zu werten.» Es deute nichts darauf hin, dass Putin seine Kriegsziele anpassen und die Ukraine plötzlich als gleichwertigen Verhandlungspartner und Land mit Anspruch auf Eigenständigkeit wahrnehmen wolle. «Auf russischer Seite besteht weder der Wille zu Kompromissen, noch ist man militärisch genügend unter Druck.»
Das Gleiche gelte für die Gegenseite. Zogg: «Die ukrainische Armee hat jetzt Momentum, und diese Erfolge dürften die Moral in Armee und Bevölkerung sowie bei ausländischen Partnern stärken.» Selenski wisse, dass russische Verhandlungsangebote nur dazu dienen sollten, sich zu regruppieren und Versorgungslinien wiederherzustellen. «Diese Pause will und soll man der russischen Armee nicht gönnen.»
Wie rächt sich Putin?
Nach dem Vorrücken der Ukrainer kam es im Osten des Landes zu massiven Stromausfällen, Millionen waren im Dunkeln und ohne Wärme. War es die Rache Putins? Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk jedenfalls wirft den russischen Streitkräften vor, Energie-Infrastruktur angegriffen zu haben. Mit der Attacke wolle sich die russische Arme für ihre Niederlage auf dem Schlachtfeld rächen, schrieb Valentin Reznichenko (50) auf Telegram.
Er bezeichnet die Russen als «Terroristen», die es nicht auf militärische Ziele abgesehen hätten, sondern die Menschen in der Ukraine ohne Strom und Heizung zurücklassen wollten. Mauro Mantovani: «Vergeltungsschläge gegen die Zivilbevölkerung beherrschen die Russen leider sehr gut.»
Greift Putin nun zu den Atomwaffen?
Benno Zogg glaubt nicht, dass Putin nach den ukrainischen Erfolgen militärisch gross reagieren werde. «Russland wird sich vorerst kaum strategisch umorientieren, auch um kein Zeichen eigener Schwäche zu zeigen.» Die Erfolge der Ukrainer führten noch nicht zu einem Zusammenbruch der gesamten russischen Front. «Das Thema Atomwaffen wäre daher aus Putins Sicht unverhältnismässig und kaum zielführend», ist Zogg überzeugt. Schreibt Blick.
Geht es Ihnen auch so wie mir? Ich bin jeden Tag aufs Neue entzückt und überrascht über die Heerschar der Militär- und Kriegsexperten*innen.
Nachdem wir die letzten zwei Jahre von gefühlt 8'738'791 Schweizer Virologen*innen und Virusexperten*innen heimgesucht wurden, erleben wir nun nun seit Beginn des Ukraine-Krieg eine Wiederholung: Die 8'738'791 haben im wahrsten Sinne des Wortes die Fronten gewechselt: Vom Corona-Virus zum weit schrecklicheren Virus namens Putin.
Das Boulevardblatt von der Zürcher Dufourstrasse bemüht sich immerhin noch bei seinen täglichen Bullshit-Wahrsagungen im Stil von Uriella und Mike Shiva des Konjunktivs, in dem man so ziemlich alles fabulieren kann. Putin könnte und hätte hätte Fahrradkette...
-
12.9.2022 - Tag der SP-Rettungsschirme
Grosser Rettungsschirm auch für Kleine: SP propagiert Strom-Schock-Hilfsprogramm
Die SP fordert wegen des Strompreis-Schocks ein ähnliches Hilfsprogramm wie bei Corona. Die Partei macht Druck auf SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin.
Der Strommarkt spielt verrückt und die Stromversorger drehen mächtig an der Preisschraube. Per 2023 steigen die Strompreise für die Haushalte um durchschnittlich 27 Prozent. Das gilt auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in der sogenannten Grundversorgung sind.
Doch wehe jenen Firmen, die die 2009 eingeführte Liberalisierung genutzt haben und sich auf dem freien Markt mit Strom eindecken. Für viele gibt es nun ein böses Erwachen. Wie etwa für den Tessiner Mitte-Nationalrat und Rollladenhersteller Fabio Regazzi (60): Statt wie bisher 60'000 Franken soll er 2023 für Strom eine Million Franken berappen.
Ein Preisschock, der zahlreiche weitere Unternehmen im ganzen Land betrifft – und einige Unternehmen sogar in ihrer Existenz bedroht. Das befürchtet auch SP-Co-Chef Cédric Wermuth (36). «Es drohen zahlreiche Konkurse, wenn nichts unternommen wird», sagt der Aargauer Nationalrat.
Bundesfonds mit Übergewinnen
Er fühlt sich an die Corona-Krise erinnert, als die wirtschaftlichen Auswirkungen zu Beginn massiv unterschätzt wurden und der Bund schliesslich mit Notrecht einspringen musste. Die notfallmässige Aktivierung des milliardenschweren Rettungsschirms für die Axpo erachtet Wermuth als Vorboten dafür, dass noch Schlimmeres bevorsteht.
«Wir dürfen nicht – schon wieder – die Grossen retten und die Kleinen vergessen!», macht Wermuth deshalb deutlich. Ihm schwebt ein ähnliches Rettungsprogramm für die Wirtschaft vor wie bei der Corona-Krise: etwa die Möglichkeit von Überbrückungskrediten oder ein Härtefallprogramm.
Er denkt auch an einen «Bundesfonds zur Abfederung von Sonderpreisen für stromintensive Unternehmen». Dieser könnte vorerst mit Bundesgeldern bevorschusst und später mit den absehbaren Übergewinnen von Energieunternehmen refinanziert werden.
Wermuth zeigt sich zudem offen für einen Vorschlag des Gewerbeverbandes, wonach KMU zurück in die Grundversorgung wechseln dürfen. «Allerdings müsste dies an Bedingungen geknüpft werden, beispielsweise an Energieeffizienz-Massnahmen im Betrieb», sagt er. «Und sie müssten sich für ein paar Jahre an die Grundversorgung binden.»
Vorstoss verlangt Antworten
Wermuth will bei den Wirtschaftshilfen nun rasch Nägel mit Köpfen machen. In der nationalrätlichen Wirtschaftskommission hat er eine ausserordentliche Sitzung beantragt. «Bislang allerdings mit abschlägigen Rückmeldungen», so der SP-Mann. «Offenbar sehen die Bürgerlichen einmal mehr keinen Handlungsbedarf.»
Am Montag reicht die SP-Fraktion zudem eine dringliche Interpellation ein. Sie will vom Bundesrat detailliert wissen, wie er Unternehmen und einkommensschwachen Haushalten helfen will, «die von unverhältnismässigen Strompreiserhöhungen betroffen sind». Insbesondere soll der Bundesrat auch einschätzen, inwiefern er das Überleben gewisser Unternehmen aufgrund der Strompreis-Explosion gefährdet sieht und wie er deren Existenz sichern will.
SP macht Druck auf Parmelin
Der Vorstoss zielt auf das Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin (62). Der SVP-Magistrat behilft sich vorerst mit runden Tischen und hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die verschiedenen Vorschläge prüft. Allerdings will der Bundesrat erst im Oktober darüber diskutieren.
«Im Wirtschaftsdepartement bleibt alles sehr vage. Dabei sollte Bundesrat Parmelin jetzt rasch für Klarheit und Sicherheit für die Betriebe sorgen», moniert Wermuth. «Es ist rasches Handeln nötig, um wirtschaftlichen Schaden abzuwenden und Arbeitsplätze zu retten.» Schreibt Blick.
Scheinbar entdeckt die SP ein Zitat des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Gustav Heinemann: «Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt».
Bleibt zu hoffen, dass diese tiefe Erkenntnis der SP nicht nur den kommenden eidgenössischen Wahlen 2023 geschuldet ist. Es wird in diesem Zusammenhang für das Wahlvolk interessant sein, wie sich die «bürgerlichen» Parteien zu diesem Vorstoss der SP verhalten werden.
Man darf auf jeden Fall schon jetzt auf den Eiertanz der Verfechter*innen des neoliberalen «Freien Marktes» gespannt sein. Zündstoff für die Wahlen 2023 ist auf jeden Fall vorhanden.
-
11.9.2022 - Tag der Blaublüter*innen
Litt offenbar an Gefässerkrankung: Die Queen (†96) starb wahrscheinlich an multiplem Organversagen
Die offizielle Todesursache der Queen ist nicht bekannt. Sie sei «friedlich verstorben», liess die königliche Familie lediglich verlauten. Letzte Fotos der Monarchin geben jedoch Aufschluss darüber, woran die Monarchin gestorben sein dürfte.
Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag «friedlich» im Alter von 96 Jahren verstorben. Dies hatte die königliche britische Familie online bekanntgegeben. Zur offiziellen Todesursache schweigt das Königshaus. Aufgrund öffentlich zugänglicher Informationen gibt es jedoch Hinweise, woran die Regentin verstorben sein dürfte.
Als Schlüsselhinweis gelten Fotos der letzten Amtshandlungen der Queen kurz vor ihrem Tod. Beim Treffen mit der neuen britischen Premierministerin Elizabeth Truss (47) am Dienstag, zwei Tage vor dem plötzlichen Ableben der Monarchin, sind deutlich dunkle blaue Verfärbungen auf dem rechten Handrücken der Königin zu erkennen.
«Es sieht so aus, als gäbe es möglicherweise Anzeichen für eine periphere Gefässerkrankung», sagte die australische Ärztin Deb Cohen-Jones der «Daily Mail». Dabei handelt es sich um eine Durchblutungsstörung, bei der sich die Blutgefässe ausserhalb des Herzens und des Gehirns verengen, blockieren oder verkrampfen, so die Ärztin. Dies könne zu einer Herzinsuffizienz führen: «Wenn die periphere Durchblutung so schlecht ist», erklärt Cohen-Jones, «werden die Organe nicht gut mit Blut versorgt. Das kann ein Zeichen für Multiorganversagen sein.»
Fühlte sich kurz vor ihrem Tod noch «wohl»
Wahrscheinlich habe die Königin «eine Menge Schmerzen» erdulden müssen, so die Ärztin. Die Verfärbung der Hand deute auf eine schwere Erkrankung hin. Wie lange die Königin an der Krankheit gelitten haben könnte, ist nicht bekannt. In der Öffentlichkeit trug Queen Elizabeth II. gewöhnlich Handschuhe. Schon in den letzten Monaten hatten sie regelmässig Veranstaltungen abzusagen, da sich ihr Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte.
Wegen ihrer Schwäche hatte die Monarchin die neue Regierungschefin Truss auch im schottischen Balmoral statt in London empfangen, wie es sonst üblich wäre. Schon Anfang Juni hatte die Queen wegen Unbehagen den Feierlichkeiten zu ihrem eigenen 70-jährigen Thronjubiläum fernbleiben müssen. Dies nach einer, so Buckingham Palace, «milden» Coronavirus-Infektion im Februar. Dabei wirkte die Monarchin bereits Ende letzten Jahres immer dünner und fragiler.
Am Ende ging es ganz schnell. Am Tag vor ihrem Tod verordneten die Ärzte der Regentin Ruhe. In einem öffentlichen Schreiben äusserten sie Sorge um ihre Gesundheit. «Nach einer weiteren Untersuchung heute Morgen sind die Ärzte der Königin um den Gesundheitszustand Ihrer Majestät besorgt und haben empfohlen, dass sie unter ärztlicher Aufsicht bleibt», so eine Erklärung des Buckingham Palace. Die Königin fühle sich jedoch «wohl». Wenige Stunden später verstarb Queen Elizabeth II. Schreibt SonntagsBlick.
Wenn es um tote Päpste, Prinzessinnen oder Königinnen geht, liegt Blick mit seinen Vermutungen über die Todesursache stets daneben. Auch bei Queen Elizabeth II.
Blaue Verfärbungen auf dem rechten Handrücken der englischen Königin sind einzig und allein dem blauen Blut der britischen Monarchin geschuldet und haben rein gar nichts mit ihrem Tod zu tun. Man nennt diese königlichen Geschöpfe ja nicht umsonst «Blaublüter*innen». Alles klar?
-
10.9.2022 - Tag der neoliberalen Zauberlehrlinge
Bisher 60'000 Franken, neu 1 Million für Tessiner Rollladenhersteller Fabio Regazzi: 1600 Prozent mehr für den Strom!
Mitte-Nationalrat und Rollladenhersteller Fabio Regazzi (60) aus Gordola TI versteht die Welt nicht mehr. Fürs laufende Jahr zahlt der Tessiner 60'000 Franken an Elektrizität. Für 2023 will der Stromanbieter nun eine Million.
Der Schock sitzt tief. Gut zwei Wochen ist es her, dass der Brief der Società Elettrica Sopracenerina (SES) ins Haus flatterte. Doch so ganz hat der Unternehmer aus Gordola TI die Botschaft noch immer nicht verdaut. «Als ich das Couvert öffnete und den Kostenvoranschlag las, dachte ich, dass sich ein Tippfehler eingeschlichen habe», sagt Fabio Regazzi. «Knapp eine Million Franken will mein Stromanbieter fürs nächste Jahr haben. In diesem Jahr lagen die Stromkosten bei gerade 60'000 Franken. Auch wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, eine Million kann und will ich nicht zahlen.»
Ein Anruf beim Stromanbieter SES bestätigt den unfassbaren Preisaufschlag: Der Preis auf dem freien Markt ist um 1600 Prozent gestiegen! «Das wäre, als würde plötzlich der Liter Benzin an der Tankstelle 25 Franken kosten», sagt Regazzi.
Unternehmer tappte in die Falle des freien Markts
Regazzis Firma beschäftigt 140 Mitarbeiter, setzt im Jahr rund 25 Mio. Franken um. Der Strom wird für Produktion, Beleuchtung, Heizung, Lackiererei und Büros gebraucht. «Wenn ich keine Lösung finde, dann muss ich Stellen abbauen. Wir haben bereits wegen der gestiegenen Materialkosten die Preise erhöht. Mehr geht nicht», klagt der Politiker. «Doch wo soll ich günstigeren Strom herbekommen? Die meisten Stromanbieter machen in diesen Zeiten nicht einmal mehr eine Offerte.»
Fabio Regazzi tappte in die Falle des freien Markts. 2009 wurde der Strommarkt für Unternehmen mit einem Verbrauch von mehr als 100'000 Kilowatt im Jahr liberalisiert. «Seit Bestehen, also seit gut 75 Jahren, ist unser Unternehmen Kunde bei der SES. Das Angebot mit dem sogenannten freien Markt war attraktiv, also haben wir zugegriffen. Doch ich habe nie den Lieferanten gewechselt oder international nach niedrigeren Preisen geschaut. Ich hatte ja keine Ahnung, dass uns so etwas drohen könnte.»
«Es drohen Konkurse und Abbau von Arbeitsplätzen»
Regazzi schloss immer mehrjährige Verträge ab. «Jetzt lief der Vertrag aus, und ich habe eine Offerte eingeholt», sagt der Tessiner. Bereits im März hatte er nachgefragt, «da war der Preis bereits fünfmal so hoch wie im Vorjahr. Ich habe mich dann entschieden, abzuwarten – in der Annahme, die Preise würden wieder runtergehen.» Doch das Gegenteil ist der Fall, stattdessen sind die Preise astronomisch hoch.
Auch als Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) ist Fabio Regazzi zutiefst besorgt. «Der Preisschock trifft viele kleine und mittlere Unternehmen wie Restaurants und Bäckereien. Die können die Rechnung nicht zahlen. Es drohen Konkurse und Abbau von Arbeitsplätzen», sagt Regazzi. «Jetzt muss die Politik schnell handeln.»
Auch Hotelier Fernando Brunner ist geschockt
Im Tessin sind es 40 KMU, die von der SES einen ähnlichen Kostenvoranschlag erhielten. Der Preis auf dem freien Markt sei in diesen Monaten um ein 15- bis 20-Faches gestiegen, bestätigt die SES. Gut 90 Prozent der Kunden hätten rechtzeitig neue Verträge geschlossen, zehn Prozent müssen nun in den sauren Apfel beissen. Wer einmal aus der tarifgeregelten Grundversorgung ausgetreten ist, darf nicht mehr zurück. Das hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) beschlossen. Geschützt sind hingegen alle Firmen, die nie auf dem freien Markt Strom bezogen haben und alle privaten Haushalte, für die die Liberalisierung nie galt. Der Strom würde nach Tarif berechnet und der Preis sei nur um 18 Prozent gestiegen.
Den Schritt in den freien Markt bereut Fernando Brunner (73) heute. Der Tessiner besitzt vier Hotels und je ein Restaurant in Locarno TI und Lugano TI. Bislang kostete der Strom etwa 200'000 Franken im Jahr. «Jetzt werden über 900'000 Franken verlangt», sagt Brunner. «30 Prozent Preisanstieg wären zu schultern gewesen. Aber fast 500 Prozent schaffen wir nicht. Wir müssten die Zimmerpreise um 50 Franken pro Nacht erhöhen. Das macht kein Gast mit.» Wie Fabio Regazzi ist auch der Hotelier geschockt und ratlos.
Nur eines wissen beide schon jetzt: Den neuen Vertrag unterzeichnen sie nicht. Schreibt Blick.
Wenn «Mitte»-Nationalrat und Rollladenhersteller Fabio Regazzi die wunderschöne neue Welt des ultra-neoliberalen «Freien Marktes» nicht versteht, stellt sich automatisch die Frage, was der politisch engagierte Nationalrat eigentlich erwartet hat.
Ist diese späte Erkenntnis des Rollladenherstellers naiv oder gar dumm? Dachte er nie an die Möglichkeit, dass bei solch unkontrollierbaren Konstrukten irgendwann die Rollladen runtergehen könnten?
Aus der Weltfinanzkrise 2007/08 nichts gelernt?
Es war ja seine Partei «Mitte» (ehemals CVP), die in orchestrierten Aktionen unsäglicher «Deregulierungsmassnahmen» zusammen mit den anderen «bürgerlichen» Neoliberalisten*innen der FDP, SVP, GLP und wie sie alle heissen, diese Welt des «Freien Marktes» geschaffen hat.
Über Jahrzehnte hinweg entwickelten genau diese politischen Hasardeure ein nicht mehr kontrollierbares Casino des Wilden Westens. Kernaufgaben des Staates wurden wissentlich «liberalisiert», Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert.
Dass nun ausgerechnet diese Zauberlehrlinge und Apologeten eines ungezügelten «Freien Marktes» jenseits von moralischen oder ethischen Werten am lautesten um Hilfe schreien – wie übrigens schon bei der Corona-Pandemie –, mag einige Leute mit Schadenfreude erfüllen. Hilft uns aber nicht weiter.
Denn die Zeche bezahlen wir alle. Mit Ausnahme der Profiteure dieses Monsters mit dem Namen «Freier Markt». Die lachen sich ins Fäustchen und lassen die Dom Pérignon-Korken zwischen den Herrlibergen und weissen Sandstränden knallen.
Ein Prosit auf den Freisinn. Frei von Sinn!
-
9.9.2022 - Tag der Rappenspalter*innen
Der WC-Bon ist bei Marché nur noch die Hälfte wert – Auf den Marché-Raststätten sind die Toiletten nicht mehr gratis. Grund: Steigende Betriebskosten
Wer auf der Autobahn-Raststätte mal muss, der muss vielerorts vor dem Drehkreuz einen Franken einwerfen. Man hat dort bislang aber in der Regel auch einen Bon im gleichen Wert erhalten, den man dann im Restaurant oder einem Laden in der Raststätte wieder einlösen konnte – sofern man daran gedacht hat.
«Nicht kundenfreundlich»
Zwei Hörer des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso», die privat und beruflich öfters auf der Autobahn unterwegs sind, wundern sich: «Der Bon ist ja nur noch 50 Rappen wert.» Heisst: Das stille Örtchen ist nicht mehr gratis.
Das sei nicht kundenfreundlich, finden die Hörer. Schliesslich kaufe und konsumiere man ja meistens auch noch etwas in der Raststätte. «Und nun soll ich auch noch fürs WC etwas zahlen – das nervt schon.»
Energie, Miete und Verbrauchsmaterial – alles teurer
Die Hörer haben die Raststätten Glarnerland und Heidiland besucht – in diesen beiden und neun weiteren ist die Marché-Gruppe für die WC-Anlagen zuständig. Sie betreibt dort jeweils auch als Pächterin ein Marché-Restaurant. Marché gehörte einst zu Mövenpick, 2014 wurden die Restaurants von Coop übernommen. Und die Marché-Medienstelle bestätigt gegenüber «Espresso», dass man den Ein-Franken-WC-Bon quasi entwertet hat, dass man also für einen Toiletten-Einlass weiterhin einen Franken einwerfen muss, aber nur noch 50 Rappen zurückerhält.
Man habe dies Ende Juli eingeführt, in Absprache mit den Raststätten-Betreibern und den übrigen Mietern, schreibt Marché. Es sei eine Reaktion auf die steigenden Kosten für den Unterhalt der Anlagen. Energiepreis, Miete, Verbrauchsmaterial – alles sei teurer geworden.
Kundenreaktionen wegen der Neuerung habe es bislang nur «sehr wenige» gegeben, so die Medienstelle. Gut möglich, dass viele die Änderung noch gar nicht bemerkt haben. Marché hofft derweil, mit der geplanten Einführung der Coop-Supercard in ihren Raststätten-Restaurants Goodwill zu schaffen.
Auch bei Autogrill und Migrolino?
Wie eine Umfrage von «Espresso» bei anderen Raststätten zeigt, erhält man dort immer noch einen gleichwertigen Bon zurück. Aber man diskutiere angesichts steigender Kosten schon, ob man dereinst nicht auch etwas verlangen soll, heisst es etwa bei Autogrill – mit neun Raststätten-Restaurants und -WC-Anlagen hinter Marché die Nummer 2 in diesem Geschäft.
Auch bei der bekannten Gotthard-Raststätte im Kanton Uri ist die Massnahme ein Thema, wie es dort heisst – aber frühestens ab nächstem Jahr, wie es auf Anfrage heisst. Auch Migrolino schreibt, man zahle zurzeit noch den vollen Betrag als Bon zurück, aber werde mit den Franchise-Nehmern ebenfalls über eine Änderung diskutieren.
Anders bei der Gruppe Thurau, die in der Ostschweiz vier Raststätten betreibt. Bei ihnen sei keine WC-Gebühr geplant.
Gesetz hat nichts gegen kostenpflichtige Raststätten-WCs
Gibt es eigentlich keine Vorschrift, dass Toiletten auf Autobahn-Raststätten gratis sein müssen? Nein, sagt Thomas Rohrbach, Mediensprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra). Im Nationalstrassengesetz gebe es keine solche Vorgabe. Das Bundesrecht verlange eine Tankstelle und öffentlich zugängliche Toiletten, beides müsse rund um die Uhr geöffnet haben, so Rohrbach. «Die Toiletten dürfen aber etwas kosten.» Weitere Vorschriften seien Sache der Standortkantone.
Durchwegs gratis seien hingehen die WCs auf den Rastplätzen. Diese seien aber meist weniger aufwändig unterhalten als jene in den Raststätten und deshalb sei dort unter Umständen auch der Komfort geringer. Schreibt SRF.
Während ich diesen Artikel las, kam mir unweigerlich Paul Watzlawick und sein Bestseller «Anleitung zum Unglücklichsein» in den Sinn. Das beweist mir, dass Multitasking bei mir trotz biblischem Alter immer noch einigermassen funktioniert. Was entsprechende Glücksgefühle bei mir auslöst.
Aber ebenso würde mich auch eine saubere und gepflegte Toilette auf einer Raststätte glücklich machen, statt mich über den Toiletten-Obulus von 50 Rappen künstlich aufzuregen. Den Rappenspaltern*innen sei gesagt, dass schon im alten Rom an belebten Strassen amphorenartige Latrinen aufgestellt waren um den Urin einzusammeln, der wiederum von den Gerbern und Wäschern benötigt wurde. So wie heutzutage, nebenbei bemerkt, Hersteller von Dieselfahrzeugen Urin für das Abgasreinigungsmittel Adblue benötigen.
Um die leeren Staatskassen zu füllen, erhob Kaiser Vespasian auf diese öffentlichen Toiletten von Rom eine spezielle Latrinensteuer. Um die Steuer vor seinem Sohn Titus zu rechtfertigen, hielt ihm Vespasian Geld aus den ersten Einnahmen unter die Nase und fragte ihn, ob der Geruch ihn störe. Titus verneinte, worauf Vespasian gesagt haben soll «Atqui e lotio est» («Und doch ist es vom Urin»). Aus dieser Unterhaltung zwischen Vater und Sohn entwickelte sich imLaufe der Zeit die Redewendung «Pecunia non olet» («Geld stinkt nicht»).
Was dem guten Kaiser Vespasian recht war, sollte auch den Raststätten-Betreibern*innen vergönnt sein.
-
8.9.2022 - Tag der Aufreger die keine sind
Jesus sprach «Es werde Licht», doch der Kolumnist fand in Zeiten der explodierenden Strompreise den Schalter nicht
Wer sucht, der findet. So lautet eine uralte Redensart, die sich auch im Matthäusevangelium «findet». Doch leider können sich auch Bibelsprüche täuschen.
Trotz intensiver Suche in den üblichen Medien habe ich heute keinen Frontseite-Artikel gefunden, der meine Empörung dermassen ins Unendliche getrieben hätte, um eine schriftliche Schnappatmung und damit einen Kolumnenbeitrag auszulösen.
Der Neffe von Friedrich Dürrenmatt, Coiffeur-Weltmeister Martin Dürrenmatt, 2020 von seiner grossen Liebe und Lebensabschnittspartner Miguel de Lima verlassen, äussert sich über die Haarpracht von seiner Kundin Beatrice Egli.
Jetzt mal Hand aufs Schlagerherz: Wer um Gottes Willen interessiert sich für die Kopf-Federn von Beatrice Egli ausser einem schwulen Coiffeur und ein paar unverbesserlichen Blick-Lesern*innen?
Niemand, so viel ist klar. Wie die begnadete Schlagersängerin ihr Übergewicht bekämpft, wäre wohl für die Blick-Leserschaft um einiges interessanter gewesen.
Der neueste UNO-Bericht «Die Welt wird momentan nicht besser, sondern schlechter» von SRF besitzt auf den ersten Blick gewaltiges Empörungspotenzial. Aber eben nur auf den ersten Blick.
Wozu soll man sich über etwas aufregen, was ohnehin schon seit vielen Jahren bekannt ist und plötzlich als neueste Erkenntnis hochgejazzt wird? Der Starke wird immer den Schwachen besiegen. Auch in Zeiten von Pandemien, Inflation, neoliberal angetriebener Heuschreckenschwärme und Energiekrisen. Ausnahmen wie «David vs. Goliath» bestätigen die Regel.
Mein Freund und «wandelndes Lexikon» Res Kaderli, mit dem ich gestern auf Einladung des Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli die Luzerner Altstadt heimsuchte, gab mir einmal eine weise Empfehlung mit auf meinen beschwerlichen Weg zur unendlichen Glückseligkeit:
«Rege dich niemals über etwas auf, was du nicht aus eigener Kraft ändern kannst.» Wie wahr!
Schalom.
(Im Alten Testament (Tanach) wird laut Wikipedia die heute in Israel meistverwendete Grussformel «Schalom» als «Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt» beschrieben. Womit zumindest meine Hoffnung für Morgen intakt bleibt.)
-
7.9.2022 - Tag des Wunschdenkens
Die Sanktionen gegen Russland sind smarter als oft behauptet: Der Vormarsch der russischen Armee kommt nicht nur auf dem Boden zum Stocken
Ein halbes Jahr nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine kommt der Vormarsch der russischen Armee nicht nur auf dem Boden ins Stocken. Wladimir Putins militärischer Komplex kämpft inzwischen mit sich selbst, mit eigenen Schwächen. Der Industrie fehlt es offenbar auf allen Linien an elektronischen Bauteilen, Mikrochips, die zur Herstellung von Hightech-Waffen benötigt werden.
Ohne Halbleiter aus dem Westen und aus Taiwan lassen sich moderne Raketen, Panzer oder Zieleinrichtungen nur schwer nachliefern. Das geht aus Berichten von Politico und New York Times hervor. Der Kremlherr lässt mit langen Einkaufslisten rund um die Welt nach elektronischen Bauteilen suchen.
Es sind neben dem Einbrechen der russischen Wirtschaft sichere Hinweise darauf, dass die Sanktionen besser und präziser – smarter – sind als oft behauptet. Für die EU-Staaten und ihre Bürger gute Nachrichten: Geschwächte russische Kampfkraft bedeutet weniger Tote in der Ukraine. Das war und ist der Sinn der EU-Zwangsmaßnahmen. Sie sollen Putin und seine Armee schwächen.
Auf Social Media verbreitet sich immer mehr die Mär, Europa führe Krieg gegen Russland. Putins Propaganda schürt das kräftig. Nichts ist falscher als diese Verdrehung. Europa will keinen Krieg, nicht wirtschaftlich und schon gar nicht militärisch. Wir wollen Frieden. Putin könnte den Krieg sofort beenden. Aber er will nicht. Er muss dazu gezwungen werden. Schreibt Thomas Mayer in DER STANDARD.
Thomas Mayer stützt seine gewagte Aussage vor allem auf Berichte der US-amerikanischen Tageszeitung «Politico», die aber seit der Übernahme durch den Axel Springer-Verlag auch nicht mehr die investigative Qualitätszeitung ist, die sie einmal war.
Es mag ja sein, dass Russland derzeit Probleme hat, Mikrochips für die Produktion von Hightech-Waffen auf dem Weltmarkt zu besorgen. Fakt ist aber, dass dieses Beschaffungsproblem nicht nur Russland heimgesucht hat, sondern sämtliche Industrienationen. Und dies nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges.
Zumal Putins Freunde aus Nordkorea und China dem russischen Zar frei nach dem Beatles-Song «with a little help» zur Seite stehen werden.
Ausserdem lassen sich Schulen, Kindergärten, Spitäler und Einkaufszentren in den ukrainischen Dörfern und Städten auch mit uralten Schrott-Raketen aus der Sowjet-Zeit dem Erdboden gleichmachen. Wie wir täglich in den Live-Tickern der Medien feststellen können.
Natürlich treffen die westlichen Sanktionen langfristig die russische Wirtschaft. Vorerst aber treffen sie vor allem den Westen, dessen Bevölkerung nicht mehr auf Verzicht abgehärtet ist wie das russische Volk.
Auf die kommenden Verwerfungen zwischen der Bevölkerung und den Regierungen der westlichen Staaten darf man jetzt schon gespannt sein. Tägliche Wasserstandsmeldungen über Putins angeblich miserablen Gesundheitszustand und die kollabierende russische Wirtschaft sind derzeit reines Wunschdenkenfern jeglicher aktuellen Realität.
Was man von der Energiekrise in den westlichen Ländern nicht behaupten kann. Die ist real. Ausser der frohen Botschaft «zieht Euch warm an und öffnet Eure Portemonnaies zu Gunsten der Energiebörsen» haben die mächtigen und weisen Staatenlenker der Wertegemeinschaft nichts anzubieten.
Da sind logischerweise Artikel wie der oben aufgeführte Balsam auf die gequälten Seelen und schlotternden Glieder des westlichen Pippi Langstrumpf-Prinzips: «Ich mach' mir die Welt wie sie mir gefällt.»
Das macht auch Putin. Seit er an der Macht ist. Mit oder ohne Mikrochips. Erdgas-Pipelines können notfalls nach altmodischer Art und Weise auch von Hand abgestellt werden.
-
6.9.2022 - Tag der Propheten und Prophezeiungen
«Es ist nur dieser Winter, dann hat Putin nicht mehr diesen Trumpf in der Hand»
Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk ist nur noch wenige Wochen im Amt. Bei Frank Plasberg blickte der umstrittene Diplomat auf seine Zeit in Berlin zurück, erklärte seinen bisweilen kontroversen Stil – und hatte ein paar versöhnliche Worte für die deutsche Außenpolitik übrig.
Der scheidende ukrainische Botschafter in Berlin Andrij Melnyk hat die Entwicklung der deutschen Unterstützung seines Landes gelobt. In Frank Plasbergs ARD-Talkshow „hart aber fair“ sagte Melnyk, grundsätzlich sei die Hilfe aus Deutschland im Vergleich zu den ersten Kriegsmonaten seither „ein Stück nach vorne“ gekommen, er habe das sogar bereits als „Quantensprung“ bezeichnet.
Melnyk verlässt Deutschland im Oktober, nach acht Jahren als Botschafter in Berlin soll er offenbar als Vize-Außenminister nach Kiew wechseln. In den vergangenen Monaten war Melnyk, der wiederholt die deutsche Politik im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg scharf anging, für einige seiner Aussagen kritisiert worden. So hatte er unter anderem Bundeskanzler Olaf als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet, weil dieser zunächst nicht nach Kiew reisen wollte, nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für einen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt ausgeladen worden war. Das ukrainische Außenministerium distanzierte sich zudem von Äußerungen Melnyks über den Partisanenführer Bandera.
Neben Melnyk waren unter anderem SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner, der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff und die Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Sabine Fischer bei Moderator Frank Plasberg zu Gast.
Obwohl er die Entwicklung seit Kriegsbeginn anerkannte, hatte Melnyk für die deutsche Ukraine-Unterstützung nicht ausschließlich Lob übrig. „Gas als Waffe haben wir schon öfters erlebt, deswegen ist das keine Neuigkeit“, sagte der Diplomat zu den vielfachen Drosselungen russischer Gaslieferungen nach Europa. Ihn störe aber an der Debatte, dass man in Deutschland den Eindruck habe, die Ukraine würde ohne deutsche Hilfe „nicht überleben“.
Die militärische Hilfe für die Ukraine bilde mit 600 Millionen Euro eine Summe, die „hundert Mal weniger“ sei als das jüngste Entlastungspaket mit über 60 Milliarden Euro. Die deutsche Hilfe sei wichtig, man „schätze“ sie, aber sie sei nicht elementar: „Wenn Deutschland plötzlich morgen entscheiden sollte: Okay, die Ukrainer sollen das alleine schaffen – dann werden wir das alleine tun.“ Man habe „diesen Kampfwillen, aber auch die Fähigkeit, uns zu verteidigen, aber auch die Gebiete wieder zu befreien – Stichwort Cherson, Gegenoffensive.“
Zudem gebe es auch einen „moralischen“ Aspekt bei der Unterstützung des angegriffenen Landes: „Ich glaube, das macht auch Sinn für die Deutschen, sich Gedanken zu machen, neben dieser Frage, Rechnungen und so weiter: Wo steht Deutschland in der Geschichte, in den Geschichtsbüchern?“
„Wir tun wirklich viel für die Ukraine“
FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff gab Melnyk in einigen Punkten Recht, kritisierte aber dessen Vergleich der militärischen Hilfe mit dem Entlastungspaket für deutsche Bürger. „Ich finde, Sie sollten über die militärische Hilfe auch die finanzielle Hilfe erwähnen, das sind acht Milliarden Euro. Wir tun wirklich viel für die Ukraine (...).“ Man wolle „diesen Winter gemeinsam schaffen“, damit Russland mit seiner Strategie keinen Erfolg habe und man wieder eine stabile Friedensordnung etablieren könne.
Melnyk sagte, Deutschland sei ein starkes, erfolgreiches Land, das dem russischen Druck standhalten könne. Die Politik solle daher „die Bürger noch mehr beruhigen (...). Es ist schwierig, es ist eine Herausforderung nach 40 Jahren ohne Inflation (...), und jetzt plötzlich diese Delle, diese kalte Dusche von Putin. Ich glaube aber, dass Deutschland, dass die EU imstande sind, diese Herausforderung zu meistern und auch den Menschen mehr Mut zu geben, dass man das schaffen kann.“
Zudem arbeite die Zeit gegen Russland: „Es ist nur dieser Winter, der entscheidend sein kann, dann hat (Putin) nicht mehr diesen Trumpf in der Hand“. Die Deutschen sollten „mehr Vertrauen haben in die eigene Politik“, so Melnyk.
Zu der Aussage des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba, es gehe für die Ukrainer um ihre Existenz, für die Deutschen um „Komfort“, sagte Melnyk, man „verstehe die Sorgen“ der Deutschen, „vor allem die Schwächeren, dass sie nicht wissen, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen“. Allerdings stiegen auch in der Ukraine die Preise, die Wirtschaft sei kriegsbedingt bereits um 40 Prozent eingebrochen.
Auf Plasbergs Frage, was er als Botschafter für die Ukraine rückblickend während seiner Zeit in Berlin geleistet habe, sagte Melnyk, das könne er „nicht beurteilen“. Zumindest habe er versucht, dazu beizutragen, die deutsche Unterstützung für die Ukraine anzukurbeln.
Seine Arbeit sei „nicht einfach“ gewesen, sein Stil sei auch „zuhause nicht immer verstanden“ worden. Auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe er erklären müssen, „wieso ich das eine oder andere getan oder unterlassen habe“. Melnyk weiter: „Es war schon ein Lauf auf dünnem Eis, auch für mich persönlich, auch als Diplomat. Aber ich hatte ja keine Eigeninteressen in diesem Sinne; ich bin kein Politiker, ich möchte nicht gewählt werden.“ Schreibt DIE WELT.
Wenn sich da Andrij Melnyk mit seiner etwas gewagten Prophezeiung um die Trümpfe in Putins Hand nur nicht irrt. Totgesagte (Trümpfe) leben bekanntlich öfters länger als man denkt.
-
5.9.2022 - Tag der Wählerstimmen
Klimakrise in den USA: Petro-Männchen blenden die Wirklichkeit aus
In den meisten Industrieländern fürchten die Menschen die Klimakrise. Aus dem Rahmen fallen vor allem die USA – auf den ersten Blick. Der zweite offenbart die psychologisch-politische Kluft im Land.
Auch in den USA sind die dramatischen Auswirkungen der Erderhitzung nicht mehr zu übersehen. Hitze- und Kältewellen, Dürren, Brände, Wasserknappheit, austrocknende Flüsse und Seen – und dann wieder extreme Regenfälle, Überschwemmungen, Wirbelstürme. Allein 2021 zählte die US-Regierung 20 Extremwetterkatastrophen, die Schäden von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar verursacht haben. Die Gesamtrechnung nur für 2021 liegt bei 145 Milliarden Dollar.
Und doch sind die USA einsamer Ausreißer in einer Studie, die das US-Umfrageinstitut Pew diese Woche veröffentlicht hat. Pew selbst hat über die Mitteilung zu den Ergebnissen diese Überschrift gesetzt: »Der Klimawandel bleibt in einer Umfrage in 19 Ländern die globale Spitzenbedrohung.«
Mehr Angst vor Cyberangriffen als vor der Klimakrise
Tatsächlich landete der Klimawandel bei der Frage, ob man etwas als »große Bedrohung, kleinere Bedrohung oder keine Bedrohung« für das eigene Land einschätze, in den meisten der untersuchten Länder auf Platz eins oder zwei. In Deutschland etwa nannten 73 Prozent der Befragten den Klimawandel als große Bedrohung, knapp davor landete, mit 75 Prozent, Desinformation im Internet.
Die vier Ausreißer auf der Liste sind Israel (47 Prozent), Malaysia (44 Prozent), Singapur (57 Prozent) – und die USA. In den Vereinigten Staaten landete die Bedrohung durch den Klimawandel auf dem letzten Platz, mit 54 Prozent Zustimmung. 71 Prozent fürchten sich dort dagegen vor »Cyberangriffen anderer Länder«.
Es scheint paradox: Die Krise und ihre Auswirkungen sind klar spür- und sichtbar, teuer und tödlich. Und doch will nur etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung der USA eine echte Bedrohung erkennen. Der Anteil derer, die diese Bedrohung sehen, ist in den vergangenen Jahren sogar leicht gesunken. Wie kann das sein?
Weniger als ein Viertel der Republikaner lebt in der Realität
Um das zu verstehen, muss man sich die Daten aus den USA genauer ansehen, was Pew in einer separaten Auswertung auch getan hat . Darin wurde auch die politische Ausrichtung der Befragten berücksichtigt. Das Ergebnis: eine krasse, klaffende Kluft. Sie wird viele vermutlich nicht überraschen, aber ihr Ausmaß ist dennoch erschreckend.
Unter den Befragten in den USA, die die Demokraten unterstützen oder ihnen zuneigen, halten 78 Prozent den Klimawandel für eine große Bedrohung. Unter den Fans und Sympathisanten der Republikaner dagegen sind es nur 23 Prozent. Weniger als ein Viertel.
Die echte »Big Lie« ist viel älter als Bidens Wahlsieg
Die Republikaner und ihre größten Spender belügen ihre Parteigänger in Wahrheit schon seit Jahrzehnten – im Dienste der Fossilbranchen. Donald Trumps »Big Lie« über den Wahlausgang ist ein Neuzugang. Die Leugnung des menschengemachten Klimawandels war lange Zeit eine Kernposition der Partei. Mittlerweile wird sie nicht mehr so offen vertreten , aber unter den eigenen Wählerinnen und Wählern hat sie sich festgesetzt. Die ältere und, global betrachtet, schlimmere »Big Lie« ist: Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, und falls doch, dann ist er kein Problem.
Ein – von den Republikanern eingesetzter – US-Bundesrichter notierte 2019 in einem Verfahren gegen Exxon, Shell, BP und Co .: »Statt die Alarmglocken zu läuten, gaben sich die Beklagten alle Mühe, den wissenschaftlichen Konsens zu vernebeln und Änderungen – obwohl sie existenziell notwendig sind – zu verzögern, die ihren Milliardenprofiten im Weg gestanden hätten.«
In anderen Industrienationen ist das völlig anders
Die 54 Prozent, die die Studie im Ländervergleich für die USA insgesamt ausweist, verschleiern das wahre Bild: In den USA lebt nur ein Teil der Bevölkerung, nämlich die Anhänger der Demokraten, in der gleichen Wirklichkeit wie die Bevölkerungen anderer Industrieländer wie Deutschland, Japan (82 Prozent sehen dort den Klimawandel als große Bedrohung), Frankreich (81 Prozent), Großbritannien (75 Prozent) oder Australien (71 Prozent).
Die Wählerschaft der Republikaner dagegen hat sich mehrheitlich aus dieser global geteilten Realität verabschiedet: über drei Viertel. Daran haben die Ölkonzerne, die »Stiftungen«, »Thinktanks« und gekauften »Fachleute« der Koch-Brüder und anderer fossiler Propagandisten jahrzehntelang mit Milliardeninvestitionen gearbeitet. All das ist glasklar dokumentiert .
Die Ölkonzerne schufen die republikanische Identität
Die Ölkonzerne fürchten sich sehr davor, dass es ihnen eines Tages gehen könnte wie der Tabakindustrie, deren jahrzehntelange Lügen sie Ende der Neunzigerjahre schließlich teuer zu stehen kamen. Es folgten weitere kostspielige Klagen und öffentliche Demütigungen. Die Ölkonzerne haben vor erfolgreichen Klagen so große Angst , dass sie seit vielen Jahren hart daran arbeiten, Gerichte bis hinauf zum Supreme Court mit ihnen wohlgesonnenen Richterinnen und Richtern zu bestücken.
Gleichzeitig aber haben ihre Kampagnen die Identitätskonstruktion von Abermillionen verändert. In einer psychologischen Überblicksstudie , die vergangenes Jahr erschien, ist zu lesen: »In vielen Ländern ist der Klimawandel zu einem politisch polarisierten Thema geworden, wobei Menschen, die sich selbst als liberal einstufen, eher Klimaschutzpolitik unterstützen als Menschen, die sich selbst als Konservative betrachten.« Dafür gibt es viele empirische Belege .
Die Überblicksstudie weist explizit darauf hin, dass dieses Phänomen besonders bei älteren, weißen Männern zu beobachten ist, die Angst vor dem Verlust von Status und Privilegien haben: »Wer zu einer Gruppe gehört, die vom Klimawandel besonders bedroht ist, wird besonders motiviert sein, Eindämmung zu unterstützen, während diejenigen, die vom Status quo profitieren, sich eher gegen Eindämmungsschritte stellen.«
Stammeszugehörigkeit alter, weißer Mann
Psychoanalytiker sprechen in den USA sogar von »Petro-Maskulinität« , die »Aspekte von Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Klimawandelleugnung« umfasse. Das passt hervorragend zur Allianz der Freunde fossiler Brennstoffe mit der reaktionären internationalen Rechten. Die Kulturkampfspaltung der USA, die die Neue Rechte so gern nach Deutschland verpflanzen möchte, ist (auch) eine Konsequenz fossiler Propaganda. Schreibt Christian Stöcker in seiner Kolumne unter der Rubrik «Wissenschaft» in DER SPIEGEL.
Ein hervorragender Artikel von Christian Stöcker, einem Journalisten, der sich wirklich Journalist nennen darf. Trotzdem ist der Artikel für meine Begriffe etwas zu einseitig auf die USA und das Klischee «des alten weissen Mannes» ausgerichtet.
Der Klimawandel wird ja nicht nur in Amerika von erschreckend grossen Massen geleugnet. Auch in Europa und in vielen anderen Staaten, ja selbst in der behäbigen Schweiz, sind die Klimawandel-Skeptiker*innen längst keine vernachlässigbare Randgruppe mehr.
Dafür gibt es Gründe. Um nur zwei zu nennen: Eine hysterische, oft nicht faktenbasierte und nur dem Clickbaiting geschuldete mediale Berichterstattung sowie eine Parteienpolitik, die einzig und allein auf Wählerstimmen ausgerichtet ist.
Denn Hand aufs Herz: Beim Atomausstieg ging es weder Doris Leuthard noch Frau Merkel um Fukushima, sondern nur um Wählerstimmen.
Glühenden Worten und Wahlsiegen (Merkel) folgten keine Taten, den Atomausstieg vernünftig abzufedern. Den Schlamassel, in dem wir jetzt und heute stecken allein auf Putin abzuwälzen, wird dem Thema nicht gerecht.
-
4.9.2022 - Tag der Studien die niemand braucht
Sieben bis acht Stunden: So viel Schlaf braucht unser Gehirn
Forschende an der Harvard University haben herausgefunden, dass Menschen, die sechs oder weniger Stunden Schlaf pro Nacht bekommen, häufiger unter Gedächtnisproblemen leiden. Aber Langschläfer haben nicht nur Vorteile – sie haben mehr Mühe, Entscheidungen zu treffen. Schreibt Blick.
Fantastische Studie: Wer zu wenig schläft, leidet unter Gedächtnisproblemen und wer zu lange schläft, hat Mühe Entscheidungen zu treffen. Langer Rede stumpfer Sinn der «Studie» kurz umschrieben: Hans wie Heiri.
-
3.9.2022 - Tag des Katastrophenjournalismus
Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen (52) lüftet seine Notfallpläne: «Versorgung der Bevölkerung ist sichergestellt, aber...»
Die Migros ist mit fast 100'000 Angestellten die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz. In der Landesversorgung sei sie «systemrelevant», sagt Chef Fabrice Zumbrunnen im Interview. Und erklärt, wie er die Energie- und Teuerungskrise bewältigen will.
Energiekrise, Teuerung und die Massentierhaltungs-Initiative, über die die Schweiz am 25. September abstimmt: Fabrice Zumbrunnen (52) ist in diesen Wochen gleich an mehreren Fronten gefordert. Am Hauptsitz in Zürich erklärt der Migros-Chef Blick, welche Notfallpläne er wälzt und wie er die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz durch den Winter bringen will.
Blick: Was macht Ihnen als Hausbesitzer mehr Sorgen: Gasmangel oder Stromlücken?
Fabrice Zumbrunnen: Ein Stromausfall über mehrere Tage trifft mich mehr, als wenn sich das Gas verteuert oder gar ausbleibt. Aus einem einfachen Grund: Wir heizen mit Geothermie.
Sie wohnen in La Chaux-de-Fonds ...
... wo es im Winter eiskalt werden kann. Auch weil es nachhaltiger ist, haben wir vor zwei Jahren unser Heizsystem von Gas auf die Nutzung von Erdwärme mittels Wärmepumpe umgestellt.
Eine Wärmepumpe benötigt Strom. Ohne heisst es frieren. Haben Sie die dicken Pullover schon bereitgelegt?
Geothermie macht meinen Haushalt heute abhängig von Steigerungen des Strompreises. Wenn der Strom länger ausfällt, bleibt es kalt im Haus. Dann ziehe ich eben einen dicken Pullover an.
Kommt es so schlimm?
Ich glaube nicht. Darum habe ich mir auch keinen Extravorrat an Kerzen, Batterien oder einen Dieselgenerator zugelegt, um Ihre Frage vorwegzunehmen.
Wenn Sie sich da mal nicht verrechnen!
Tagelange Stromausfälle sind aus Expertensicht unwahrscheinlich. Wir sollten besonnen bleiben und Vertrauen haben, dass alle Beteiligten alles tun, um diesen Worst Case zu verhindern.
Auch Sie als Chef der Grossverbraucherin Migros mit ihren vielen Industriewerken sind gefordert?
Gas- und Strommangel beschäftigt mich und unseren Krisenstab praktisch täglich. Wir betreiben noch Gasheizungsanlagen, wie bei unserer Grossbäckerei Jowa. Bei anderen Betrieben haben wir wiederum Investitionen vorgezogen. Elsa, unsere Milchproduktion, wurde von Gas auf ein Pelletheizsystem umgerüstet. Wir prüfen jetzt, wo eine Umstellung Sinn macht und wir diese beschleunigen können.
Wie hilft die Migros, den Stromverbrauch zu senken?
Selbstverständlich machen wir uns auch Gedanken darüber, wie wir mithelfen können, den Stromverbrauch zu senken. Wir haben pragmatisch bereits zahlreiche Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten.
Wie priorisieren Sie bei den Migros-Industrien, wenn Sie weniger Gas oder Strom abbekommen?
Die Migros ist systemrelevant, weil wir Verantwortung in der Landesversorgung tragen. Auch wenn der Strom ausfällt, müssen ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stehen. Fliesst weniger Gas und Strom, müssen wir die Produktionszeiten verkürzen und entscheiden, was weniger oder gar nicht mehr hergestellt wird.
Können Sie ein Beispiel machen?
Nehmen wir unsere Grossbäckerei Jowa. Statt zahlreicher Brotsorten produzieren wir dann vielleicht nur fünf Sorten. Weil die Maschinen dadurch weniger gereinigt und abgestimmt werden müssen, können wir mengenmässig genug Brot bereitstellen, wie wenn wir keine Einschränkungen hätten. Stark eingeschränkt werden könnte beispielsweise das Patisserie-Sortiment, weil dieses nicht lebensnotwendig ist. Diese Überlegungen lassen sich auf alle Produktsegmente übertragen.
Dann gehen in der Industrie, in Baumärkten und Fitnessparks in diesem Winter die Lichter nicht aus?
Stromausfälle von ein paar Stunden kann es geben. Einschränkungen im Angebot auch. Ein Stromunterbruch von einer Woche? Dann würde die gesamte Gesellschaft nicht mehr funktionieren.
Was bedeutet ein Stromausfall für Ihre Migros-Filialen?
Haben wir für ein paar Minuten keinen Strom, können wir dies überbrücken, sodass Kundinnen und Kunden dies nicht spüren. Dauert der Ausfall zwei bis drei Stunden, lassen sich viele Produkte noch retten. Was nicht mehr verkäuflich wäre, ist zum Beispiel Fisch aus der Frischetheke. Haben wir über Tage zu wenig Strom zur Verfügung, schliessen wir Filialen.
Wie viele Filialen wären von Schliessungen betroffen?
Wenn wir aufgrund einer Kontingentierung nur noch 80 Prozent des Stroms bekommen, dann müssen wir uns einschränken. Im Notfall müssen wir die Öffnungszeiten anpassen, das heisst, weniger lang öffnen oder gar einzelne Filialen schliessen. Dadurch sinkt der Verbrauch von Strom, da Kassen, Kühlregale, Beleuchtung, Rolltreppen und Lifte abgestellt werden. Wir werden aber immer noch genug Filialen offen halten, damit die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt ist. Mit Sicherheit schliessen wir dort nicht, wenn es im Umkreis einer Gemeinde nur eine Migros hat.
Haushalte sind von Kontingentierungen nicht betroffen. Sollen Private Energie sparen, damit die Wirtschaft weiterproduzieren kann?
Alle sollten jetzt einen Beitrag leisten. Wenn auch Privathaushalte ihre Möglichkeiten ausschöpfen, zum Beispiel die Raumtemperatur senken, die Beleuchtung auf LED umstellen, den Geschirrspüler in der Nacht auf Eco-Modus laufen lassen, bleibt uns das Schlimmste wohl erspart. Wichtig: Wir dürfen Unternehmen und Privathaushalte nicht gegenseitig ausspielen. Wir sollten als Gesellschaft an einem Strang ziehen.
Die Stromkosten gehen vielerorts durch die Decke. Auch bei der Migros?
Auch wir sind heute von den explodierenden Strompreisen betroffen. Sei es auf der Einkaufsseite am freien Markt, sei es als Mieterin von Liegenschaften. Heute sind wir mit Offerten konfrontiert, die um das Mehrfache höher sind als vor ein paar Jahren.
Überwälzen Sie die Mehrkosten Ihrer Kundschaft?
Im Moment trägt die Migros die steigenden Energiekosten. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden so lange wie möglich davon verschonen. Wir haben auch erst Monate später Preise erhöht, als der Teuerungsschub in diesem Frühjahr einsetzte.
In der Schweiz liegt die Inflation bei 3,4 Prozent. Wo liegt die Teuerung bei der Migros?
Bei uns beträgt die Teuerung gegenwärtig etwas mehr als 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zur Erinnerung: Im April, als überall die Preise hochgingen, hatten wir noch eine Minusteuerung von 0,8 Prozent.
Nun ist der Preisschub im Laden da?
Gewisse Produktkategorien wie Pasta haben sich stärker verteuert, bei Obst und Gemüse stiegen die Preise lediglich um 1 Prozent. Für Milchprodukte und Fleisch zahlt man im Schnitt nun 3 Prozent mehr. Allerdings versuchen derzeit alle Lieferanten, noch höhere Preise durchzusetzen.
Lassen Ihre Kundinnen und Kunden Sie spüren, dass sie die Teuerung besorgt?
Wir bekommen seit einigen Wochen vermehrt kritische Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden zu den steigenden Preisen. Sie fragen aber auch, ob es noch schlimmer werden kann. Es ist sehr schwierig, Prognosen zu machen. Wir hoffen natürlich, dass wir bald den Höhepunkt erreicht haben werden.
Hat sich das Kaufverhalten geändert?
Zum ersten Mal nehmen wir tatsächlich wahr, dass Kundinnen und Kunden ihr Kaufverhalten ändern und statt zu Premiumprodukten oder Bio-Fleisch vermehrt zu billigeren Artikeln greifen. Zudem werden mehr Aktionsartikel gekauft. Wir spüren, dass das Portemonnaie nicht mehr so locker sitzt.
Wird die Initiative gegen Massentierhaltung unser Kauf- und Essverhalten verändern?
Unser Essverhalten ändert sich langsam, und es gibt Trends. Ich glaube nicht, dass sich die Bevölkerung von oben herab diktieren lassen will, was sie zu konsumieren hat. So etwas funktioniert nicht in der Schweiz. Auch die Migros lässt den Kunden immer die Wahl, ob sie zu Bio-Fleisch, zu M-Budget-Fleisch oder zu Fleischersatzprodukten greifen wollen.
Schweine und Hühner sollen mehr Platz bekommen, in kleineren Gruppen gehalten werden, ins Freie können. Das ist doch ein legitimes Anliegen.
Tierwohl ist uns sehr wichtig. Wir bemühen uns heute schon, unsere Fleischprodukte so nachhaltig wie möglich zu produzieren. In den letzten Jahrzehnten haben wir hier massive Fortschritte erzielt. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz heute Vorreiterin beim Tierwohl, unsere Betriebe sind deutlich kleiner. Diese Initiative ist unnötig und nicht zielführend.
Welche Folgen für die Migros hätte eine Annahme der Initiative?
Der hohe Selbstversorgungsgrad der Schweiz ist unseren Kundinnen und Kunden absolut zentral. Gemäss einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz würde dieser beim Poulet von 58 auf 5 Prozent sinken bei einer Annahme der Initiative. Eier von 56 auf 20 Prozent. Bei Schweinefleisch ist es von 92 auf 50 Prozent. Die Auswirkungen wären folglich massiv. Die Ernährungssicherheit, die während der Covid-Krise so gelobt wurde, wäre nicht mehr gewährleistet, wenn wir nur noch Bio haben, wie es die Initiative verlangt.
Die Migros hat eine riesige Fleisch- und Geflügelverarbeitungsindustrie ...
... darum wären wir auch enorm betroffen, wenn das Volk an der Urne ein Ja einlegt. Das gilt nicht nur für uns, sondern für den ganzen Detailhandel, die verarbeitende Industrie, den Grosshandel, die Gastronomie und die Agrarwirtschaft. Nur einer von zehn Betrieben ist Bio. Eine Annahme käme einer Revolution gleich. Ich spüre bereits einen grossen Frust bei befreundeten Bauern.
Frust auch bei Kundinnen und Kunden, weil die Preise im Laden dann massiv steigen?
Wir sehen jetzt schon, dass die Leute wegen der Teuerung sparen und statt Bio-Qualität auf günstigeres Fleisch mit IP-Suisse-Standard ausweichen. Es gäbe keine Alternativen mehr. Aber klar, wir können weitere Fortschritte in der Landwirtschaft erzielen und wir können noch besser erklären, was wir bereits leisten.
Ein Thema, das für Sie durch ist, aber bei vielen noch präsent, ist der abgelehnte Alkoholverkauf in Migros-Läden. Wie sehen Sie das Nein heute?
Das Ergebnis hat mich nicht überrascht, ich habe mit einem Nein gerechnet. Beim Sortiment bleibt alles beim Alten, wobei wir die alkoholfreien Biere weiter ausbauen. Und wir lancieren das Non-Bier, das die St. Galler Brauerei Schützengarten für uns braut.
Verraten Sie jetzt, was Sie in die Urne gelegt haben?
Ob Ja oder Nein spielt auch heute keine Rolle. Es ging um die Abstimmung der Genossenschafter und Genossenschafterinnen. Was der Migros-Chef abgestimmt hat, interessiert hier nicht.
Mit dem lukrativen Alkoholgeschäft ist es nichts geworden. Werden Sie als Gruppe im laufenden Jahr trotzdem wachsen?
Im ersten Semester haben wir beim Umsatz leicht vorwärtsgemacht. Gastronomie, Fitnessanlagen und unsere Reisetochter Hotelplan wachsen stark gegenüber dem Vorjahr. Unsere finanzielle Performance ist aber von steigenden Kosten belastet. Schreibt Blick.
Es tut gut, dieses Interview zu lesen. Migros-Boss Fabrice Zumbrunnen ist ein Pragmatiker durch und durch. Kein Hasardeur. Statt den von den Medien und hilflosen Politkern*innen quasi im Stundentakt bevorstehenden Weltuntergang ebenfalls zu beschwören, strahlt er ideologiefreien, sachbezogenen und lösungsorientierten Optimismus aus.
Ein Satz des Migros-Häuptlings sticht besonders hervor: «Wir sollten besonnen bleiben!» Dass Zumbrunnen damit richtig liegt und dem unsäglichen Katastrophengeheul von Blick & Co. keine Chance gibt, zeigt die vorangegangene Reaktion des Blick-Journalisten: «Wenn Sie sich da mal nicht verrechnen!»
Bad news verkaufen sich nun mal besser als good news. Wäre dem nicht so, wären die Medien voll mit Berichten über Mutter Theresa.
-
2.9.2022 - Tag der Discount-Parlamentsabgeordneten
Ware Freundschaft
Steckt hinter Herbert Kickls Äquidistanz zu Anstand und Wahrheit ökonomisches Kalkül? "Krieg kennt keine Wahrheit", ließ uns die FPÖ diesen Sommer per ganzseitigen Inseraten wissen. Kaum ein anderer hat diesen Spruch so verinnerlicht wie ihr Obmann Herbert Kickl. Im Dezember des Vorjahres erklärte er, dass die FPÖ ihren Freundschaftsvertrag mit Wladimir Putins Partei Einiges Russland nicht verlängern werde. Kurz nach Putins Überfall auf die Ukraine behauptete Kickl sogar, der Vertrag sei schon aufgelöst. Eine von zahlreichen Medien übernommene Geschichte, bei der es sich aber tatsächlich um eine weitere Allegorisierung des Sprichworts "Lügen haben kurze Beine" handelt. Denn nachdem die FPÖ 2021 keine Kündigung vornahm, hat sich der Vertrag automatisch bis 2026 verlängert.
Mangelnde Vertragstreue kann man dem FPÖ-Chef seither ebenso wenig vorwerfen wie Inkonsequenz bei seinem Umgang mit Fakten. Die in diesen beiden inhaltlichen Leitlinien zum Ausdruck gebrachte Äquidistanz zu Anstand und Wahrheit manifestiert sich nun auch in Kickls Aussage, die Sanktionen gegen Russland "schaden nur uns selbst", weshalb er mit seiner Forderung nach Aufhebung aller Strafmaßnahmen gegen Putin eine "Stimme der ökonomischen Vernunft" sei. Angesichts der realen Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft wirkt diese Einschätzung wie Kreml-Propaganda auf Unter-Karin-Kneissl-Niveau.
Was die "ökonomische Vernunft" betrifft, könnte Kickl es aber vielleicht anders gemeint haben. Darauf lässt zumindest ein vom Londoner Dossier Center in Zusammenarbeit mit mehreren europäischen Zeitungen geleaktes Dokument aus dem Medienkonzern des Putin-treuen Oligarchen Konstantin Malofejew schließen. Datiert mit 15. Februar 2016, berichtet darin Malofejews Mitarbeiterin Jekaterina Minachina von einem 20.000-Dollar-Angebot an den FPÖ-Abgeordneten Johannes Hübner. Dieser möge dafür vor den "irreparablen Schäden für die österreichische Wirtschaft durch antirussische Sanktionen" warnen und eine "Resolution zur Aufhebung antirussischer Sanktionen im österreichischen Parlament einbringen", bei deren Erfolg noch einmal 15.000 Dollar gezahlt würden.
Tatsächlich brachte Hübner, der zuvor schon mit Johann Gudenus bei einer Audienz den von Putin geförderten Massenmörder Ramsan Kadyrow hofiert hatte, im Juni 2016 einen Entschließungsantrag mit dem Titel "Aufhebung der Sanktionen gegen Russland" im Parlament ein. Dieser wurde zwar nicht angenommen, aber hat es vielleicht geschafft, ein oft gehörtes Vorurteil zu widerlegen, wonach Entschließungsanträge der FPÖ grundsätzlich vollkommen wertlos seien.
Nein, 20.000 Dollar stellen unzweifelhaft einen Wert dar. In der jetzigen Situation könnten derartige Prämien sogar zu einem kontinuierlichen Einkommen werden, denn die Gefahr, dass ein FPÖ-Antrag irgendwann angenommen wird, tendiert gegen null. Kickls Kampf gegen die Sanktionen ließe sich so gesehen wirklich mit "ökonomischer Vernunft" begründen. Und könnte für alle anderen auch als eine Art kleiner Trost interpretiert werden: Solange wir weiterhin für die Folgen von Putins Überfall auf die Ukraine zahlen müssen, soll dieser wenigstens für blaue Anträge zur Aufhebung der Sanktionen eine Gebühr entrichten. Schreibt DER STANDARD.
Lächerliche 20'000 Dollar Schmiergeld für einen österreichischen Parlamentsabgeordneten sind jetzt aber nicht wirklich eine Menge Heu. Dafür kann sich ja der/die/das Geschmierte nicht mal einen gebrauchten Audi kaufen.
Da scheinen schweizerische Parlamentarier*innen und Pöstchenjäger doch etwas teurer zu sein.

-
1.9.2022 - Tag der menschlichen Unsterblichkeit
Fachleute entschlüsseln Erbgut der unsterblichen Qualle
Schwerelos hängt die gigantische, porzellanweiße Qualle im Blau, schwebt majestätisch vor den Augen der Besucher. In der französischen Serie „Ad Vitam“ verbirgt sich in den Genen dieser kalten Schönheit das Geheimnis des ewigen Lebens: Die Menschen können sich dank der Quallen-DNS beliebig oft verjüngen – mit erheblichen sozialen Verwerfungen. Und tatsächlich gibt es Quallen, die dem Altern ein Schnippchen schlagen können. Doch im Gegensatz zur Serie sind die alterslosen Quallen in Wirklichkeit winzig klein.
Unserer Fantasie sind verschiedene Formen der Unsterblichkeit entsprungen: Seit Menschengedenken glauben Unzählige an eine unsterbliche Seele oder an ewig junge Göttinnen und Götter, Figuren wie Dorian Grey, dessen Bildnis an seiner statt altert, auch Untote wie Vampire faszinieren die Menschen. Dabei ist Unsterblichkeit kein reines Fantasieprodukt, wie die Qualle Turritopsis dohrnii beweist. Die wenige Millimeter große Qualle kommt im Mittelmeer rund um die Balearen vor der spanischen Küste vor – und hat einen erstaunlichen Trick entwickelt: Sie besitzt zyklische Unsterblichkeit.
Bizarre Nesseltiere
Quallen sind gewissermaßen zwei Lebewesen in einem: Zunächst leben sie als fest am Meeresgrund verankerte Polypen, die sich asexuell vermehren. Doch können die Polypen auch in ein Quallenstadium übergehen: Teile der Polypen schnüren sich ab und verwandeln sich in freischwimmenden Medusen. In dieser Form können sich die Quallen nun sexuell fortpflanzen, woraufhin Larven entstehen, die wieder zu festsitzenden Polypen werden.
Nach der Paarung sterben die Quallen gewöhnlich – nicht aber so bei T. dohrnii! Zellen ihres Schirms, also der pulsierenden Außenhaut des Tiers, verwandeln sich in Polypen, die exakte genetische Kopien der Medusa selbst sind. Das gleiche Tier kann so im Prinzip beliebig oft den Quallen-Lebenszyklus durchlaufen und ist biologisch unsterblich. Damit ähnelt die Qualle Dr. Who: Die Hauptfigur der gleichnamigen britischen Kultserie stirbt nicht, sondern regeneriert sich, indem sie einen anderen Körper annimmt – für die Serienmacher ein eleganter Weg ist, wechselnde Darsteller zu erklären.
Gute Gene für ewige Jugend
Anders als Dr. Who könnte sich die Qualle nicht an Ereignisse aus ihren früheren Leben erinnern, dennoch ist ihre Verjüngungskur erstaunlich. Spanische Wissenschafterinnen und Wissenschafter rund um Maria Pascual-Torner von der Universität Oviedo haben sich auf die Suche nach den genetischen Ursachen für die Unsterblichkeit von T. dohrnii begeben. Wie das Team kürzlich im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Science" berichtete, besitzt die Qualle doppelt so viele Gene, die mit DNS-Reparatur zusammenhängen, als ihre enge, aber sterbliche Verwandte Turritopsis rubra.
Aus den genetischen Analysen der Forscherinnen und Forscher geht hervor, dass diese überzähligen Gene Proteine kodieren, die die Tiere etwa vor oxidativen Stress schützen und verhindern, dass sich die Telomere bei der Zellteilung abnutzen. Als Telomere bezeichnen Fachleute die Enden der Chromosomen, also jener Transportform der DNS, wie sie während der Zellteilung vorliegt. Doch die schützenden Kappen schrumpfen bei jeder Teilung – ein Prozess, der mit Altern in Zusammenhang steht.
Mögliche Anwendungen
Doch es ist nicht überraschend, dass T. dohrnii besonders sorgsam mit ihrem Erbgut umgeht. Spannend ist, wie das genetische Drehbuch ihres Verjüngungstricks aussieht. Dazu betrachteten Pascual-Torner und ihr Team Gene, die besonders während der Verwandlung zurück in einen Polypen aktiv sind. Wie sich zeigte, schalten die Quallen in dieser Phase Gene aus, die sonst das Wachstum und die Entwicklung der Tiere steuern. Hingegen wurden DNS-Abschnitte eingeschaltet, die den Zellen erlauben, wieder zu pluripotenten Zellen zu werden, um sich später zu einer neuen Qualle zu entwickeln.
Gemeinsam erlauben diese genetischen Anpassungen der Qualle, zwischen ihren beiden Formen pendelnd ewig zu leben. Wie Pascual-Torner betont, könnten diese Erkenntnisse auch zum Verständnis des menschlichen Alterns beitragen. Denn obwohl uns auf den ersten Blick wenig mit der durchsichtigen Qualle verbindet, teilt sich der Mensch mit dem Tierreich große Teile seiner Erbinformation. Dementsprechend hofft die Forscherin, dass ihre Ergebnisse die regenerative Medizin inspirieren können.
Übrigens, T. dohrnii ist nicht das einzige unsterbliche Nesseltier. Dieses Kunststück beherrschen auch Süßwasserpolypen der Gattung Hydra, wobei die kleinen gallertartigen Wesen ihrem brachialen Fachbegriff nicht gerecht werden. Einige dieser Polypen produzieren laufend Stammzellen, wodurch sie nicht altern und sich sogar regenerieren können, wenn sie zerteilt werden. Im Gegensatz zu unserer Dr.-Who-Qualle handelt es sich hierbei aber um lineare Unsterblichkeit: Die Tiere leben unverändert vor sich hin. Schreibt DER STANDARD.
Die gigantische, porzellanweisse Qualle macht eigentlich nichts anderes als das, was Hugo von Hofmannsthal zu seiner Zeit schon den Menschen zuordnete: «Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen.»
Hoffen wir, dass das ewige Leben für die Menschen eine rein philosophische Angelegenheit bleibt. Ein ewiger Putin ist ja nun wirklich keine wünschenswerte Zukunfts-Perspektive.
-
31.8.2022 - Tag der Gerüchteküche in Florida
Fand das FBI auch dazu Dokumente? Trump prahlt mit Geheiminformationen über Macrons Sexleben
Donald Trump soll mehrfach damit geprahlt haben sehr private Informationen über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu haben. Es gehe um dessen Sexleben.
Donald Trump (76) hat angeblich damit geprahlt, Informationen über das Sexleben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (44) zu haben.
Eine Quelle gibt gegenüber dem «Rolling Stone» an, dass mehrfach darüber tratschte. In seinem Umfeld behauptet er, er wisse von Macrons «unanständigen» Verhaltensweisen.
Informationen angeblich durch Geheimdienst
Und der Ex-Präsident behauptet, er habe von einigen dieser angeblich «schmutzigen Details» durch «Geheimdienstinformationen» erfahren.
So wurde auch bei der FBI-Durchsuchung in Mar-a-Lago ein Dokument mit der Aufschrift «Info über den französischen Präsidenten» sichergestellt. Ob es sich aber bei den beschlagnahmten Unterlagen um diese Informationen handelt, ist unklar.
Trump habe gegenüber einigen seiner engsten Mitarbeiter – sowohl während als auch nach seiner Zeit im Weissen Haus – über jene Informationen gesprochen.
Unklar, ob Trump «Blödsinn» rede
Schon früher äusserte sich Trump über Macrons angeblich «unanständiges» Verhalten, das «nicht viele Leute kennen». Doch zum «Rolling Stones» sagt der Insider auch: «Es ist oft schwer zu sagen, ob er Blödsinn redet oder nicht.»
Trump und Macron hatten während der Amtszeit des Ex-US-Präsidenten eine durchwachsene Beziehung. Zeitweise schien Trump zu versuchen, eine Freundschaft mit Macron aufzubauen. Doch dann wetterte er wieder gegen den französischen Präsidenten. Schreibt Blick.
«Rolling Stone», 1967 in San Francisco gegründet, war über Jahrzehnte hinweg das global führende Musikmagazin mit Schwerpunkt Pop und Rock. Aber auch Themen wie Film, Literatur und Politik gehörten zum inhaltlich breiten Spektrum des hoch angesehenen Magazins. Bei den Enthüllungs-Stories griff «Rolling Stone» hingegen öfters daneben und wurde entsprechend auch mit Klagen überzogen. Wie das in den USA so üblich ist.
Im Zusammenhang mit der FBI-Durchsuchung von Trumps Anwesen in Florida mag das triviale Thema über Trumps Äusserungen zum Sexualleben des französischen Präsidenten Macron für die Boulevardabteilung von «Rolling Stone» möglicherweise ein einträgliches Clikbaiting-Geschäft sein. Vor allem in den USA. Doch hierzulande ist die Story längst durchgekaut.
Macron musste sich schon im ersten Sommer seiner Präsidentschaft mit Sommerlochgerüchten herumschlagen, die ihm eine sexuelle Affäre mit seinem Bodyguard Benalla unterstellten. Macron verteidigte sich mit einer kurzen Stellungnahme «Alexandre Benalla ist nicht mein Freund» und die Geschichte war damit gegessen.
Haarsträubende Gerüchte tauchten allerdings immer wieder auf. So soll laut Online-Netzwerken Macrons Gemahlin Brigitte eine «Transgender-Frau» sein.
Wenn der Insider nun nicht sicher ist, «ob Trump Blödsinn redet oder nicht», zeigt das in etwa auf, was dieser ausschliesslich auf Gerüchten basierende Dumpfbacken-Artikel wert ist: Nichts. Denn Trump redet eigentlich nur Blödsinn.
Dass diese Erkenntnis beim Boulevard-Journalismus und Hardcore-Fans von «The Donald» noch nicht angekommen ist, wird wohl kaum jemanden erstaunen.
-
30.8.2022 - Tag der vielen Ingredienzen für eine Zeitenwende
51 Prozent des Bitcoin-Handels sind möglicherweise fake
Geht es um digitales Geld, so führt kaum ein Weg am Bitcoin vorbei. Er ist immerhin der "Urvater" jener Coins und Tokens, die heutzutage salopp als Kryptowährungen zusammengefasst werden. Bis heute ist das 2009 von Satoshi Nakamoto – dessen Identität nach wie vor nicht zweifelsfrei geklärt ist – ins Leben gerufene Netzwerk auch der Platzhirsch in diesem Bereich. Allein in den USA sollen bereits 46 Millionen Bürger Bitcoin besitzen.
Das bildet sich auch klar im Handelsvolumen ab. Eine Stichprobe von Montagnachmittag (29. August) auf der Plattform Coinmarketcap weist dieses mit einem Gegenwert von über 31 Milliarden Dollar für die letzten 24 Stunden aus, wobei es keine einheitliche Berechnungsmethode gibt. Doch die Handelszahlen, so zeigt nun eine Analyse von Forbes, könnten massiv künstlich aufgeblasen sein.
51 Prozent "Wash-Trading"
Für die Untersuchung wurden Transaktionen auf 157 Kryptobörsen herangezogen. Man fand dabei einige interessante Dinge heraus. Vermutet wird, dass 51 Prozent des aus mehreren Quellen gemeldeten täglichen Bitcoin-Handelsvolumens von 262 Milliarden Dollar (Stand 14. Juni 2022) nicht "echt" sind. Gemeint ist damit, dass es sich um Transaktionen ohne wirtschaftlichem Grund bzw. zur künstlichen Steigerung des Handelsvolumens handelt.
134 Millionen Dollar an Handelsvolumen dürften auf dieses sogenannte Wash-Trading entfallen sein. Ein Beispiel dafür wäre etwa ein Anbieter, der einfach nur zwischen seinen eigenen Wallets Geld verschiebt, ohne dass dies einen konkreten Nutzen hat. Künstlich gesteigerte Aktivität hat durchaus Profiteure. Insider können während sehr aktiver Handelsphasen zu erwartende Preissteigerungen nutzen, um Gewinne zu erzielen. Kryptobörsen wiederum können hohes Handelsvolumen auf ihrer Plattform zur Selbstvermarktung einsetzen, suggerieren diese doch rege Nutzung und hohes Kundenvertrauen.
Binance klarer Marktführer
21 der beobachteten Plattformen erzielten ein tägliches Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Dollar über alle Transaktionsarten. Weitere 33 erreichten 200 bis 999 Millionen Dollar. Mit 27 Prozent Anteil am Gesamtvolumen ist Binance der klare Marktführer, gefolgt von FTX. Geht es nur um Spot-Trades (Käufe und Verkäufe mit Soforterfüllung zum festgelegten Zeitpunkt) mit Bitcoin, so teilen sich Binance, FTX und OKX den Spitzenplatz. Binance, MEXC Global und Bybit sollen in Sachen Fake-Transaktionen das größte Problem sein, zumal diese Plattformen mit wenig bis keiner behördlichen Aufsicht operieren.
Ergebnisse brachte die Untersuchung auch hinsichtlich anderer Kryptowährungen. So hält sich der Stablecoin Tether trotz Sorgen um seine Reserven stark im Handel. Als Fiatwährung in Handelspaaren sind außerdem nicht nur der Euro, das britische Pfund und der US-Dollar beliebt. Auch der koreanische Won und der japanische Yen sind stark nachgefragt. Schreibt DER STANDARD.
Die geschätzten 51 Fake-Prozent dürften eine nette Untertreibung sein. Kommt dereinst der grosse Krypto-Crash, wird sich der Fake-Anteil für die Anleger*innen ausschliesslich bei 100 Prozent bewegen.
Man nennt das «Totalverlust». «Das war über viele Jahre hinweg alles nur Luft und Biswind, Lehman war schon vor dem Crash pleite», wie ein Luzerner Bankster höhnisch beim Zusammenbruch von Lehman Brothers im Zusammenhang mit der Weltfinanzkrise 2010 resümierte. Krypto-Währungen sind auch nichts anderes als ein «Luft- und Biswind»-Produkt.
Nun denn: Die Börsianer*innen von Wallstreet & Co. sitzen auf einem weit gefährlicheren Pulverfass. Die nicht mehr nachvollziehbar hochgejazzten Höchstwerte von Aktien und Wertpapieren verfügen über alle Ingredienzen für eine Weltfinanzkrise. Dass sie kommen wird, steht für die meisten Finanzexperten und Ökonomen fest. Die Frage dreht sich nur noch um den Zeitpunkt.
Es ist ja nicht so, dass global zu wenig Geld im Umlauf ist, das angelegt werden muss, sondern viel zu viel. Zu viel Geld führt aber langfristig seit jeher zur Geldentwertung und damit zur Inflation. Einen Vorgeschmack davon spüren wir derzeit bereits weltweit. Die einen etwas mehr, die andern etwas weniger.
Und weil eine weltweite Inflation selten allein kommt, folgt ihr meistens als noch viel grösseres Übel die Deflation mit unvorstellbarem Zerstörungspotenzial. Dann spielen die angeblich inflationssicheren Kryptowährungen ohnehin keine Rolle mehr. Wo nichts ist, ist nichts!
Sie sehen: Dass wir uns warm anziehen müssen, liegt definitiv nicht nur an der globalen Energiekrise. Alles hängt wie immer mit allem zusammen.
-
29.8.2022 - Tag der Spaltgriffe
Griff fehlt beim letzten Zug: Auch Wickis Sieg hat einen Makel
Drei Jahre nach der bitteren Niederlage gegen Christian Stucki erobert Joel Wicki doch noch den Schwinger-Thron. Wickis Sieg im Schlussgang gegen Matthias Aeschbacher ist aber umstritten.
Die Innerschweiz steht komplett Kopf. Mit Joel Wicki schwingt sich erstmals seit Harry Knüsel 1986 ein ISV-Athlet auf den Thron. Der Luzerner ist nach dem dramatischen Abnützungskampf gegen den Berner Matthias Aeschbacher den Tränen nahe: «Für mich geht ein Bubentraum in Erfüllung.»
Doch die überschwängliche Freude wird dann durch TV-Bilder etwas getrübt: Die Vogelperspektive zeigt, dass Wicki beim entscheidenden Wurf keinen Griff an Aeschbachers Zwilchhosen hatte. Deshalb hätte der Kampfrichter dieses Ergebnis aufgrund des Regulativs nicht geben dürfen. Trotzdem ist der 25-Jährige ein würdiger Schwingerkönig.
Über 2019 wird immer noch diskutiert
Und in seinem Fall darf man sehr wohl von ausgleichender Gerechtigkeit reden. Im Juni hatte Wicki beim Schwarzsee-Schwinget den Berner Michael Ledermann klar besiegt, aber weil der Kampfrichter das verdiente Resultat nicht gab, verpasste er dort den Festsieg. Und über seine Niederlage im ESAF-Schlussgang von 2019 gibt es bis heute kontroverse Diskussionen, ob Joel mit seinen Schultern wirklich zu den geforderten zwei Dritteln im Sägemehl lag. Guido Thürig, technischer Leiter der Nordwestschweizer, sagte kürzlich in einem Interview mit der Aargauer Zeitung: « Wenn man das Video dieses Gangs zwischen Stucki und Wicki sieht, sagt die Hälfte, Wicki war am Boden, die andere, er war es nicht.»
Sieg mit Makel – Beispiele gibt es viele
Unumstritten ist, dass der 1.83 Meter «kleine» und 107 Kilo schwere Maschinenmechaniker und Landwirt vom Sörenberg der beste Schwinger in Pratteln war. Wicki hat kein Gang verloren. Und seinem Schlussgang-Gegner Aeschbacher hatte er ja schon im sechsten Gang den Meister gezeigt.
Einen vergleichbaren Makel findet man übrigens auch bei vielen anderen Königen: Der Appenzeller Thomas Sutter hatte 1995 bei seinem Triumph in Chur bei der entscheidenden Aktion keinen Griff an den Hosen seines Gegners Geni Hasler. Jörg Abderhalden wäre 2007 in Aarau nicht zum dritten Mal König geworden, hätte der Kampfrichter im zweiten Gang gesehen, dass der Toggenburger im Kampf mit Hanspeter Pellet für einen kurzen Moment auf dem Rücken lag.
Deshalb dürfen wir König Joel getrost hochleben lassen. Schreibt Blick.
O je! Wer will, findet immer ein Haar in der Suppe. Und wird ausnahmsweise mal kein Haar gefunden, tut's auch irgendein Spaltgriff. Hauptsache, man hat an der Dufourstrasse in Zürich eine knackige Clickbait-Zeile, die Empörung und Schnappatmung gleichzeitig hervorruft. Aber eben nur auf den ersten (Clickbait-)Blick.
-
28.8.2022 - Tag des Verzichts auf liebgewordene Gewohnheiten
«Dramatik nicht bei allen angekommen» – Bundesnetzagenturchef rechnet mit kalten Saunen im Winter
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, fordert mit Blick auf den kommenden Winter, im Freizeitbereich Gas einzusparen, und kritisiert: »Manche denken offenbar, das Ganze habe nichts mit ihnen zu tun«.
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erwartet für den Winter Einschränkungen bei Saunen und Wellness-Einrichtungen. Er könne sich nicht vorstellen, »dass der Gasverbrauch im Freizeitbereich während des Winters angesichts der extrem hohen Energiepreise einfach weitergeht«, so der 51-Jährige gegenüber der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. »In jedem Fall wäre das in einer Gasmangellage grob unsolidarisch«, ergänzte er.
Weitere Einschränkungen zur Diskussion
Eine Gasmangellage hätte dramatische Folgen für Arbeitsplätze, Betriebe und Produktion, betonte Müller. »Das muss jedem klar sein – Jobs und die Herstellung wichtiger Güter sollten uns in der Energiekrise wichtiger sein als persönliche Annehmlichkeiten.« Die Dramatik sei aber noch nicht bei allen angekommen. »Es wird zwar viel über die hohen Preise diskutiert, aber manche denken offenbar, das Ganze habe nichts mit ihnen zu tun«, sagte Müller.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« indes ein Verbot von Heizstrahlern in der Gastronomie. »Es gibt gute Gründe, Heizpilze in der Außengastronomie zu verbieten«, sagte der BUND-Energieexperte Oliver Powalla dem Blatt. Im Winter werde nicht nur Gas, sondern auch Strom knapp und sehr teuer. »Den Luxus, auch bei kalten Temperaturen gemütlich warm draußen zu sitzen, können wir uns derzeit nicht leisten«, sagte Powalla.
Laut »Bild«-Zeitung schalten mehrere Handelsketten wegen der steigenden Strompreise inzwischen Rolltreppen ab. Dies betreffe etwa Filialen des Elektronikhändlers Saturn und der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Letztere spare auch bereits bei der Beleuchtung. Der Einkaufszentrenbetreiber ECE hält dem Bericht zufolge Rolltreppen in Randzeiten morgens und abends an. Der Möbelhändler Ikea prüfe neben dem Abschalten von Rolltreppen weitere Energiesparmaßnahmen. Schreibt DER SPIEGEL.
In der nun beinahe drei Jahre andauernden Pandemie haben die meisten Menschen gelernt, mit Verzicht auf gewisse Gewohnheiten zu leben. Wegen der Energiekrise geschlossene Saunen und ein paar stillgelegte Warenhaus-Rolltreppen dürften wohl die kleinsten Übel sein, die auf uns zukommen.
Mit Dramatik haben diese beiden Einschränkungen jedenfalls nichts zu tun!
-
27.8.2022 - Tag der Animal Farmen im Politbereich
Einsprache des Bundesrats: Berset wehrt sich gegen Handy-Antenne – und gegen die Vorwürfe
Bundesrat Alain Berset hat sich mit seiner Familie gegen den Bau einer Antenne im Dorf Belfaux (FR) gewehrt. Besonders ein Argument im Brief des Gesundheitsministers lässt aufhorchen.
Eine Baugenehmigung für eine Mobilfunk-Antenne in der Gemeinde Belfaux (FR) wurde widerrufen, nachdem Anwohnende, darunter auch Bundesrat Alain Berset, Einspruch erhoben hatten.
Der in Belfaux wohnhafte Alain Berset sowie drei Mitglieder seiner Familie hatten 2018 als Bürger und Bürgerinnen bei der Gemeinde Einspruch gegen den Bau einer 4G-Antenne durch den Mobilfunkanbieter Swisscom erhoben, wie die Tageszeitungen «La Liberté» und «Blick» am Mittwoch berichteten. Diese hätte später ohne erneute öffentliche Auflage in eine 5G-Antenne umgewandelt werden können.
Gesundheitsminister verwendet umstrittenes Argument
Im Schreiben, das von Berset unterzeichnet wurde, steht unter anderem: «Elektromagnetische Wellen technologischer Herkunft, insbesondere jene, die von der Mobilfunktechnologie ausgehen, haben schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier.» Dass gerade vom Gesundheitsminister Bedenken betreffend möglicher Schäden durch Strahlen geäussert werden, erstaunt. Immerhin sind laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) die in der Schweiz geltenden Höchstwerte unproblematisch.
Einfacher Erfolg erstaunt Anti-5G-Kreise
Der Erfolg des Vorgehens überraschte Gegnerinnen und Gegner der 5G-Antennen. «Wir haben schon Einsprachen mit über 600 Unterzeichnenden eingereicht, sind bis vor das Bundesgericht gegangen und hatten keinen Erfolg. Jetzt aber sehe ich bei dieser Antenne, dass eine Einsprache reicht und das Projekt wird verworfen», erklärte die Präsidentin des Vereins Stop 5G Glâne, Chantal Blanc, gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS.
Verwundert über dieses Vorgehen hat sich die Freiburger 5G-Gegnerin an die Behörden gewandt und durch das kantonale Öffentlichkeitsgesetz den Beschwerdebrief der Familie Berset beschafft und veröffentlicht. Blanc betont aber, dass ihre Aktion keinesfalls darauf abzielte, Alain Berset ins Rampenlicht zu rücken. Allerdings kommt der Verdacht der Ungleichbehandlung auf.
Berset verteidigt sich
Nachdem zuerst Bersets Pressesprecher Stellung genommen hatte, meldete sich mittlerweile auch der Gesundheitsminister selbst zum Fall. Die Einhaltung der gesetzlichen Strahlungsnormen sei von grösster Bedeutung.
In dem thematisierten Fall in Belfaux seien aber nicht Gesundheitsbedenken, sondern der Denkmalschutz Grund für seine Einsprache gewesen. Dies sagte Berset in einem Interview mit «Le Temps», welches am Freitagabend veröffentlicht wurde. Ausserdem habe er nicht mehr Gewicht als andere Bürgerinnen und Bürger. Schreibt SRF.
Bundesrat Alain Berset – im wahrsten Sinne des Wortes der Berserker vom Dienst. Die Polit-Elite erinnert je länger je mehr an George Orwells Roman «Animal Farm» aus dem Jahr 1945. Der Roman galt bei seiner Veröffentlichung als Parabel auf die Geschichte der Sowjetunion, bei der auf die von einem grossen Teil des russischen Volkes getragene Februarrevolution letztlich die Diktatur Stalins folgte.
Kurz zusammengefasst: Die Tiere des englischen Bauernhofs «Herren Farm» wollten das Joch der Unterdrückung durch Bauer Jones abschütteln und starteten erfolgreich eine Revolution, angeführt von den intelligenten Schweinen und übernahmen die Macht auf dem Bauernhof. Als «Verfassung» legten sie die «Sieben Gebote des Animalismus» fest.
Doch eines Tages stellten die anderen Tiere fest, dass die Schweine plötzlich alle auf zwei Beinen liefen und Kleidung trugen. Entgegen den «Sieben Geboten des Animalismus» verbündeten sie sich mit den Farmern aus der Umgebung und betrieben einträgliche Geschäfte mit ihnen. Der Profit landete jedoch ausschliesslich bei den Schweinen, die sich inzwischen auch dem hemmungslosen Whisky-Genuss hingaben. Obschon Alkohol auf der «Animal Farm» verboten war.
Auf der Scheune herrschte ab sofort nur noch ein einziges Gebot: «Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher.»
George Orwell war ein kluger Denker und der Zeit weit voraus. Seine bekanntesten Bücher «Animal Farm» und «1984» (Roman über einen totalen Überwachungsstaat) haben bis zum heutigen Tag nichts von ihrer Aktualität verloren. Nur die von uns in früheren Zeiten angedachten Parabeln auf die Inhalte verändern sich.
-
26.8.2022 - Tag der Zauberlehrlinge
«Es herrscht Wilder Westen am Energiemarkt»
Der deutsche Finanzminister Christian Lindner spricht bei „Maybrit Illner“ über das kommende Entlastungspaket und kündigt 17 Milliarden Euro Schulden für 2023 an. Eine Energieberaterin malt derweil ein düsteres Szenario für den Mittelstand.
«Wir haben auch Anrufer, die vielleicht einfach mal ihren Frust loswerden wollen. Unsere Berater sind heillos überfordert“, klagt Verbraucherschützerin Ramona Ballod am Donnerstag bei „Maybrit Illner“. Ihren Erlebnissen zufolge spüren Gasverbraucher nicht nur die Angst davor, ihre Rechnung nicht mehr bezahlen zu können und im Winter frieren zu müssen, sondern auch Verwirrung mit Blick auf die Reaktionen der Bundesregierung.
Ein Knackpunkt: Die ab Oktober eingeführte Gasumlage. Sie ist eine Belastung für Gasverbraucher – zusätzlich zum hohen Gaspreis, der am Donnerstag nur knapp unter dem Rekordniveau lag. Die Umlage und die deswegen nötigen Entlastungen für die Bürger werden zum Streitthema in der Ampel-Regierung.
Doch wer benötigt die Hilfe des Staats am dringendsten? Das diskutierte Maybrit Illner neben Ramona Ballod mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), der Ökonomin Veronika Grimm und dem stellvertretenden „Welt“-Chefredakteur Robin Alexander.
Ziel der Gasumlage sei der Schutz der Gasverbraucher
Es scheint in Mode gekommen zu sein, dass Mitglieder der drei Regierungsparteien die Gasumlage kritisieren, an eine genaue Kontrolle der Umsetzung appellieren oder faire Entlastungen fordern. Stephan Weils Bitte bei „Maybrit Illner“ nach einer „intensiven Diskussion im Bundestag“ über die Gasumlage wirkt im Vergleich dazu fast schon harmlos. Die Umlage sei „mit Fragezeichen versehen“, welche die Koalition „bestenfalls intern klären“ solle, so Weil.
Andere Vertreter von SPD, FDP und Grüne gehen mit der Gasumlage härter ins Gericht. Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang sagte beispielsweise, es störe ihr Gerechtigkeitsempfinden, „wenn Unternehmen, die an anderen Stellen große Gewinne machen, jetzt ihre Kosten frühzeitig auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umlagern wollen.“ SPD-Chefin Saskia Esken drohte gegenüber WELT sogar mit einer Blockade der Umlage im Bundestag, sollte Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) nicht dafür sorgen, dass keine gutverdienenden Gas-Unternehmen von der Umlage profitieren.
Der Unmut in der Ampelkoalition sorgte dafür, dass sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei „Maybrit Illner“ wegen der Gasumlage rechtfertigen musste. Lindner erklärte, nicht die Rettung von Gas-Konzernen sei die Absicht der Umlage, sondern der Schutz der Verbraucher: „Manche Kundinnen und Kunden haben einen Vertrag mit Gasversorgern abgeschlossen, und der muss nun ausfallendes russisches Gas ersetzen. Diese speziellen Verbraucherinnen und Verbraucher hätten nun exorbitant höhere Gaskosten.“ Um diese Verbraucher zu entlasten, würden die insgesamt höheren Gaskosten unter allen Gasverbrauchern solidarisch verteilt.
Von der Insolvenz bedrohte Unternehmen würden Lindner zufolge Geld aus der Umlage erhalten, „um einen Dominoeffekt zu verhindern, bei dem alle Steine umfallen und am Ende das Stadtwerk betroffen ist.“ Er sagte, man müsse nun darauf achten, dass nicht Unternehmen die Solidarität der Verbraucher ausnutzen, die ohnehin schon von der Energiekrise profitieren. „Wenn es etwas gibt, um dieses Instrument zielgenauer zu machen, dann scheuen wir uns nicht vor Korrektur.“
„Uniper hat wie kein anderer auf russisches Gas gesetzt“
Für WELT-Journalist Robin Alexander geht es bei der Umlage weniger um Solidarität: „Solidarität übt man in unserer Gesellschaft aus, wenn jemand schuldlos in Not geraten ist.“ Das könne man nicht von den beiden Gas-Unternehmen Uniper und Gazprom Germania behaupten, die mehr als 90 Prozent des Gelds aus der Gasumlage erhalten sollen: „Uniper hat wie kein anderer auf russisches Gas gesetzt und Lobbydruck dafür gemacht. Die haben geholfen, uns Putins Schlinge um den Hals zu legen.“
Ökonomin und „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm findet den Ansatz der Umlage gut, die höheren Beschaffungskosten des Gas auf alle Kunden zu verteilen und dadurch einen Sparanreiz zu schaffen. Sie brachte jedoch den Vorschlag eines Gaspreisdeckels in die Runde, für den sich auch die Linke und Teile der Union ausgesprochen haben: Ein Grundbetrag an Gas pro Person soll demnach festgelegt und der Preis dafür gedeckelt werden.
Überschreitet der Gaspreis den Preisdeckel, zahlt der Staat die Differenz – und der Endverbraucher müsste selber zahlen, wenn er den Grundbetrag überschreitet. „Dann würde man so entschädigen, dass der Sparanreiz erhalten bleibt, aber die extreme Belastung der Verbraucher nicht stattfindet.“
„Wenn die Gasmangellage eintritt, gehen die Preise steil hoch“
Dass sich Bürger im Wirrwarr rund um die Kritik an der Gasumlage und verschiedenen Modelle der Entlastung verheddern, bestätigte Energieberaterin Ramona Ballod von der Verbraucherzentrale Thüringen. „Die Leute sind komplett verwirrt. Das ist eine Krisenkommunikation bei der Regierung, die lässt zu wünschen übrig und das Vertrauen sinken.“ Viele staatliche Hilfen seien „mit der Gießkanne ausgegossen“ und dabei Haushalte mit niedrigem Einkommen missachtet worden.
Ballod sagte, die Verbraucherzentrale habe bereits viele Gasversorger wegen unzulässiger Preiserhöhungen abgemahnt. „Die Preise steigen ins Utopische. Es herrscht Wilder Westen am Energiemarkt.“ Sie könne nicht abschätzen, wie hoch die Preise noch steigen werden, warnte jedoch: „Wenn die Gasmangellage eintritt, gehen die Preise steil hoch. Dann ist die Mitte der Gesellschaft locker erreicht, die das nicht mehr zahlen kann.“
Bei solch düsteren Prognosen war es die Aufgabe des Finanzministers, mit Details zum kommenden Entlastungspaket für etwas Hoffnung bei Illners Zuschauern zu sorgen. Lindner versicherte: „Wir werden noch vor Oktober Klarheit haben für das Entlastungspaket für den Winter.“ Man wolle „die besonders bedürftigen Menschen nicht alleine lassen“ und die Mitte der Gesellschaft unterstützen.
Er sagte, die Regierung arbeite an einer Wohngeldreform: „Menschen mit kleinem Einkommen bekommen dann einen Zuschuss zur Miete und künftig zu den Heizkosten.“ Das schließe auch Rentner in Eigenheimen mit ein. Zudem wolle die Regierung Hartz-IV durch ein Bürgergeld ersetzen, mit dem Grundsicherungsbeziehenden die Heizkosten erstattet werden sollen. Beides soll bis zum 1. Januar auf den Weg gebracht werden.
Zwar wolle Lindner 2023 zur Schuldenbremse zurückkehren, er plane dennoch mit 17 Milliarden Euro neuen Schulden „und dutzenden Milliarden Euro, die wir aus einer Rücklage einsetzen.“ Er betonte: „Wir machen uns auf den Weg zu soliden Finanzen, aber wir sparen nicht.“ Schreibt DIE WELT.
Eigentlich schon putzig zu beobachten, wie sich die politischen Eliten und «grossen Staatenlenker» die «Schwarzen Peter» zuschieben, von denen es momentan viele gibt. «Schwarze Peter», die sie und ihre Parteien durch Versäumnisse und mit grenzenloser Naivität selbst geschaffen haben.
Das Pontius Pilatus-Syndrom «Ich wasche meine Hände in Unschuld» feiert derzeit in der Politik Hochkonjunktur, wie vielleicht seit 1939 nicht mehr.
Der Energiemarkt ist nichts anderes als eine der unzähligen Börsen: Warenbörsen für Waren wie Rohstoffe, Effektenbörsen für Wertpapiere, Devisenbörsen für Währungen, Terminbörsen für Terminkontrakte und Spezialbörsen für bestimmte Waren wie Zucker, Kaffee, Getreide und Baumwolle etc. Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen. Bis hin zur Wallstreet.
Die unzähligen Casinos der Spekulation, die mit wesentlich anderen Vorstellungen als Börsen gegründet wurden, haben sich verselbstständigt. Zu Staaten in den Staaten. Damit sind sie unkontrollierbar geworden. Ihre Macht und Einfluss auf Politik und Gesellschaft sind unermesslich. Fast alle globalen Krisen der letzten Dekaden bis hin zu den «Schwarzen Freitagen» (Finanzkrise vom 24.9.1869 in den USA sowie am 25.10.1929, ebenfalls in den USA) wurden im Wesentlichen durch sie verursacht.
Die Börsen haben sich nicht im Sinne der Erfinder entwickelt. Statt Kontinuität in der Preisentwicklung, fairen Erträgen für die Produzenten und Versorgungssicherheit für die Gesellschaften produzieren sie vor lauter Gier das pure Gegenteil. Im Sinne von «der Markt regelt alles» werden monströse Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert.
Wie schreibt Goethe in seiner Ballade «Der Zauberlehrling» so treffend? «Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los.»
-
25.8.2022 - Tag der durch die Decke gehenden Energiepreise
Steigende Kosten: Fast alle Parteien fordern Entlastungen bei den Energiepreisen
Auch der Bundesrat erachtet die steigenden Kosten als Herausforderung. Doch einen Vorschlag, wie der Situation begegnet werden könne, hat er noch nicht präsentiert.
Die Energiepreise steigen, auch für private Haushalte. Wie stark sie genau steigen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn die regionalen Verteiler ihre neuen Preise bekannt geben. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom schätzt, dass es für die Privaten bis zu 30 Prozent teurer werden könnte.
Schon seit längerem prüft der Bundesrat, ob es Massnahmen braucht, um die Haushalte finanziell zu unterstützen. Doch auch diese Woche ist er zu keiner Entscheidung gelangt.
Er sei sich «der Herausforderungen rund um die gestiegenen Energiepreise bewusst», schrieb er in einer Stellungnahme vor einer Woche. In seiner Sitzung am Mittwoch hat er offenbar über das Thema diskutiert, es dann aber trotzdem vertagt.
Die meisten Parteien fordern Entlastungen
An Vorschlägen der Parteien, wie der Situation zu begegnen ist, mangelt es nicht: Neben der bekannten Forderung, den Benzinpreis zu senken, will die SVP zum Beispiel auch eine generelle Obergrenze bei den Energiepreisen prüfen. «Auch private Menschen brauchen eine Sicherheit, wenn es um die Budgetplanung geht», sagt SVP-Nationalrat Mike Egger. Eine Obergrenze entlaste und schaffe Sicherheit.
Von möglichen Massnahmen sollten nicht nur einzelne Gruppen, sondern alle profitieren, so Egger. Ganz anders sieht es die Grüne Nationalrätin Franziska Ryser. Die Massnahmen sollten ihrer Ansicht nach jenen entgegenkommen, die ein geringes Einkommen haben: «Also beispielsweise Haushalte, die auf Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe angewiesen sind.»
FDP sieht keinen Handlungsbedarf
Einen ähnlichen Weg schlagen auch SP und die Mitte-Partei vor. Sie wollen ebenso die finanziell schwächeren Haushalte in der Krise gezielt unterstützen. Ähnlich zurückhaltend wie derzeit der Bundesrat ist einzig die FDP.
Die Partei sieht im Moment keinen Handlungsbedarf bei den Privaten, wie Ständerat Ruedi Noser erklärt: «Die Preisschwankungen beim Benzin wie bei der Elektrizität, auch eine Erhöhung im Rahmen von 10, 20 oder 30 Prozent, sind im marktüblichen Umfeld.»
Der Berner Energieversorger EWB rechnete kürzlich vor, was ein Anstieg der Kosten von 20 Prozent für einen repräsentativen Haushalt in einer 4-Zimmer-Wohnung bedeutet: Für diesen entstünden knapp 110 Franken mehr Energiekosten pro Jahr. Ein Preisanstieg, der zum aktuellen Stand noch von allen Haushalten selbst getragen werden muss.
Ökonom Brunetti: «Direkt aus dem Giftschrank»
Soll der Staat die Preise für Strom, Heizöl oder Gas künstlich begrenzen? Nein, sagt dezidiert Aymo Brunetti, Ökonomieprofessor an der Universität Bern. «Das ist direkt aus dem ökonomischen Giftschrank. Das ist genau das, was man nicht tun sollte, weil man damit verhindert, dass der Preis auf ein bestimmtes Niveau steigt. Dann gibt man einen Anreiz, mehr zu konsumieren, und gleichzeitig gibt man weniger Anreiz, Alternativen zu suchen.»
Deshalb hält Brunetti auch wenig von Tankgutscheinen oder Steuerabzügen für Pendlerinnen und Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, weil auch dies falsche Anreize setze. Auch einen Heizkostenbeitrag an alle Mieterinnen und Mieter lehnt der Ökonom ab. Denn dieser würde auch Menschen zugutekommen, die dies gar nicht nötig hätten.
Wenn der Staat überhaupt Unterstützung leiste, dann sollte er direkt bei den ärmeren Haushalten ansetzen. «Wenn man etwas machen möchte, dann ist es besser, wenn man gezielt zum Beispiel arme Haushalte begünstigt, einen Zuschuss, zum Beispiel über die Krankenkassenprämien, da gibt es ja verschiedene Modelle, dass man über so etwas spricht.» Schreibt SRF.
Es ist ein wahrlich seltenes Ereignis. Doch in diesem Fall einer neuen Bundes-Giesskanne zur Unterstützung der Haushalte bezüglich Energiepreisen stimme ich tatsächlich der FDP zu. Auch ein blindes Huhn findet ab und zu ein Korn. Selbst wenn dieses Korn vermutlich der FDP-Klientel geschuldet ist. Im Herbst 2023 finden bekannterweise die eidgenössischen Wahlen statt. Da verscherzt man es sich ja nicht unbedingt mit den Stammwählern*innen.
Nehmen wir vorerst einmal den Stromverbrauch unter die Lupe. Wenn die geschätzten Mehrkosten des Berner Energieversorgers EWB bei einer Preiserhöhung von 20 Prozent tatsächlich zutreffen und knapp 110 Franken pro Jahr für eine Vierzimmer-Wohnung betragen, ist das für die Bevölkerung tragbar. Das sind pro Monat neun Franken und 16 Rappen. Also eine Schachtel Marlboro oder zwei Café Crème. Durch ein striktes Management des persönlichen Stromverbrauchs im eigenen Haushalt liesse sich vermutlich so viel Strom einsparen, dass die Stromrechnung sogar tiefer als im Vorjahr ausfallen könnte.
Das gilt auch für Haushalte, die mit Gas beheizt werden. Experten sind sich einig, dass sich in diesem Bereich gewaltige Mengen an Gas einsparen liessen. Prognosen für die Gaspreise sind derzeit allerdings unter der Rubrik «Kaffeesatz lesen» einzuordnen. Niemand hat eine Glaskugel, um die wirkliche Preisentwicklung vorauszusagen. Und Mike Shiva lebt nicht mehr.
Wir leben jetzt und heute in einer Zeitenwende, die ein grundlegendes Umdenken verlangt. Vieles wird nicht mehr so sein, wie es früher einmal war. Das war schon immer so. Jede Generation muss ihre eigenen Probleme lösen. Eigenverantwortung wird wichtiger denn je. Darauf muss sich die Zivilgesellschaft einstellen. Hemmungsloser Konsumrausch und ein bedenkenloser Ressourcenverbrauch fordern ihren Tribut. Jetzt und nicht erst morgen.
Je schneller wir und vor allem die handelnden Parteien inklusive Wirtschaft das begreifen umso besser. Denn nebst der Energiekrise warten weit gewichtigere Herausforderungen auf uns, die über Sein oder Nichtsein bestimmen. Der Klimawandel ist nur eine davon. Packen wir's an. Jeder für sich und Gott gegen alle, wie Werner Herzog einen seiner Spielfilme betitelte.
-
24.8.2022 - Tag der Invasoren
Wie den Kaninchen die Invasion in Australien gelang – mit katastrophalen Folgen
Australien beherbergt eine einzigartige Tierwelt. Lange isoliert vom Rest der Welt, entwickelten sich auf dem fünften Kontinent zahlreiche endemische Arten, die sonst nirgends vorkommen. In den vergangenen Jahrhunderten tauchten allerdings immer mehr eingeschleppte Spezies auf, die teilweise für enorme ökologische Probleme sorgten: Die rasante Ausbreitung von Katzen, Füchsen oder der Aga-Kröte drängte viele heimische Arten an den Rand des Aussterbens. Auf eine besonders katastrophale Bilanz kann ein langohriger Einwanderer aus Europa zurückblicken: das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus).
Im 18. Jahrhundert wurden die ersten Kaninchen von Kolonisten nach Australien gebracht – und vermehrten sich in diesem neuen Lebensraum im wahrsten Sinne des Wortes wie die Karnickel: Im Lauf des 19. Jahrhunderts eroberten die Tiere ein Gebiet, das etwa 13-mal so groß war wie ihr ursprünglicher europäischer Lebensraum, kein anderes eingeschlepptes Säugetier konnte sich je so schnell ausbreiten. Die Folgen sind, trotz mitunter brachialer Gegenmaßnahmen, bis heute dramatisch: Durch ihre schiere Zahl setzen die gefräßigen Vertreter der Hasenfamilie nicht nur der australischen Pflanzenwelt und Landwirtschaft massiv zu und zerstören durch ihre Bautätigkeit ganze Landstriche. Sie verdrängen auch heimische Säuger wie den Kaninchennasenbeutler (Macrotis lagotis).
Folgenreicher Weihnachtstag
Dass Kaninchen von europäischen Siedlern etliche Male nach Australien gebracht worden sind, ist gut dokumentiert. Wo aber die massenhafte Ausbreitung der Tiere begonnen hat, ob sie auf eine einzige oder mehrere Einfuhren zurückgeht und woher die "Pionierkaninchen" stammten, war lange unklar. Ein internationales Forschungsteam hat nun in historisch-genetischer Detektivarbeit aufgedeckt, wann und wo genau das australische Kaninchenproblem seinen Anfang nahm. Das Ergebnis, das diese Woche im Fachblatt "PNAS" veröffentlicht wurde, ist überraschend präzise: Der Beginn der hoppelnden Öko-Katastrophe lässt sich auf den 25. Dezember 1859 datieren.
An diesem Tag lief die Ligthning im Hafen von Melbourne ein, an Bord befand sich eine folgenreiche Fracht: 24 Wildkaninchen für den wohlhabenden englischen Siedler Thomas Austin, der die Tiere zur Jagd auf seinem Anwesen nahe Geelong in Victoria ansiedelte.
Wie schnell die Dinge dort ihren Lauf nahmen, war schon bald in Regionalzeitungen zu lesen: Die Zahl der "Austin rabbits" sei bereits auf mehrere tausend Tiere angewachsen, hieß es in einem Bericht von 1862. Drei Jahre später brüstete sich Austin damit, dass bei Jagden auf seinem Anwesen schon an die 20.000 Kaninchen erlegt worden seien. Aufhalten ließen sich die Tiere freilich durch Bejagung längst nicht mehr, wie das Team um Joel Alves von der University of Oxford nun nachgewiesen hat: Obwohl Austins 24 Tiere bei weitem nicht die ersten Kaninchen waren, die Australien erreichten, geht die beispiellose Kanincheninvasion auf sie zurück.
Englische Abstammung
Für ihre Studie untersuchte das Forschungsteam historische Aufzeichnungen und analysierte genetische Daten von 187 Kaninchen, die in Australien, Tasmanien und Neuseeland gesammelt worden waren. Untersucht wurde auch die DNA einiger Tiere aus Großbritannien und Frankreich, um der Ursprungspopulation auf die Spur zu kommen. Wie Alves und Kollegen berichten, gehen so gut wie alle australischen Kaninchen auf gemeinsame Vorfahren zurück, nur zwei lokale Populationen in der Nähe von Sydney stammen von anderen Tieren ab. Das genetische Epizentrum der unüberblickbaren australischen Kaninchenschar, die heute auf rund 200 Millionen Tiere geschätzt wird, konnten die Forschenden in Victoria verorten, in der Nähe von Austins Anwesen. Je weiter sich die Kaninchen entfernten, desto geringer wurde die genetische Vielfalt der Population.
Zudem fanden sich Hinweise auf eine Abstammung der invasiven Population von Tieren aus dem Südwesten Englands, ein weiteres starkes Indiz: Dort, in der Grafschaft Somerset, hatte Austins Familie jene 24 Tiere gefangen, die schließlich nach Australien verschifft wurden. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass trotz der zahlreichen Einschleppungen in Australien eine einzige Einfuhr diese verheerende biologische Invasion ausgelöst hat, deren Auswirkungen noch heute zu spüren sind", sagte Alves.
Genetischer Vorteil, kritischer Zeitpunkt
Warum aber konnten sich die englischen Kaninchen so erfolgreich ausbreiten, dass weder rigorose Tötungsaktionen, ein Anfang des 20. Jahrhunderts errichteter 3.000 Kilometer langer Schutzzaun, noch die absichtliche Verbreitung der Kaninchenpest, einer für Haus- und Wildkaninchen meist tödlichen Virenkrankheit, das Problem eindämmen konnten?
Alves und Kollegen vermuten, dass Austins Kaninchen im Vergleich zu bereits früher eingeschleppten Tieren über einen genetischen Vorteil verfügten: Sie konnten sich schneller an das trockene und halbtrockene Klima anpassen. Dazu kommt, je nach Perspektive, Glück oder Pech: Sie kamen just zu einer Zeit, als große Areale des Outback in Weideland umgewandelt wurden und damit günstige Voraussetzungen für die Ausbreitung herrschten.
Die Ergebnisse seien auch mit Blick auf künftige biologische Invasionen, die die Artenvielfalt gefährden, wichtig, sagte Alves. "Wenn man sie verhindern will, muss man verstehen, wie sie funktionieren. Die Geschichte der australischen Kaninchen erinnert auch daran, dass die Handlungen einer einzigen Person oder einer kleinen Personengruppe verheerende Auswirkungen auf die Umwelt haben können." Schreibt DER STANDARD.
Invasoren haben in der langen Geschichte des Planeten Erde und der Menschheit mit wenigen Ausnahmen noch nie etwas anderes hinterlassen als Katastrophen. Egal, ob Kaninchen, Asteorid oder Putin.
-
23.8.2022 - Tag der kruden Ideologien in den Social Media
«Die Gefühle anderer verletzt»: Ravensburger nimmt Winnetou-Buch aus dem Handel
Die Firma Ravensburger hat sich dazu entschieden, aufgrund von Rassismusvorwürfen das Buch «Der junge Häuptling Winnetou» aus dem Handel zu nehmen. Das sorgt jedoch erneut für Kritik.
Die vor allem für ihre Spiele und Puzzle bekannte Firma Ravensburger hat angekündigt, die Auslieferung der beiden Bücher «Der junge Häuptling Winnetou» zum gleichnamigen Film zu stoppen und aus dem Programm zu nehmen. In einem Instagram-Post begründete die Firma dies mit dem Feedback der Nutzer, das gezeigt habe, «dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben».
Doch auch nach dieser Entscheidung sieht sich die Firma Ravensburger erneut grosser Kritik ausgesetzt. Hunderte Nutzer der Social-Media-Plattform Instagram äusserten ihr Unverständnis über die Entscheidung und bezichtigten die Firma etwa der Zensur oder des Einknickens vor Kritik.
«Romantisierendes Bild mit vielen Klischees»
Ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz im deutschen Ravensburg teilte am Montag auf Anfrage mit, man habe die Entscheidung, die Titel zum Film «Der junge Häuptling Winnetou» aus dem Programm zu nehmen, sorgfältig abgewogen. «Wir vertreten in unserem Unternehmen und mit unseren Produkten seit langer Zeit Werte, an die wir glauben: unter anderem Gemeinsamkeit und Bildung, wozu auch Fairness und Offenheit gegenüber anderen Kulturen gehören, und dies wollen wir in unserem Programm ausgewogen darstellen.»
Bei den genannten Winnetou-Titeln sei man nach Abwägung verschiedener Argumente zu der Überzeugung gelangt, dass angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit, der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, hier ein «romantisierendes Bild mit vielen Klischees» gezeichnet werde. «Auch wenn es sich um einen klassischen Erzählstoff handelt, der viele Menschen begeistert hat: Der Stoff ist weit entfernt von dem, wie es der indigenen Bevölkerung tatsächlich erging.»
Auch Puzzle aus Programm genommen
Vor diesem Hintergrund wolle man als Verlag keine verharmlosenden Klischees wiederholen und verbreiten, auch wenn man den Grundgedanken der Freundschaft – wie bei Winnetou vorhanden – hoch schätze. Neben den beiden Büchern seien auch ein Puzzle und ein Stickerbuch zu dem Film aus dem Programm genommen worden.
Die Kritik hatte sich zunächst an der gleichnamigen Verfilmung entbrannt, weil der Film rassistische Vorurteile bediene und eine kolonialistische Erzählweise nutze. Der Film kam am 11. August in die Kinos. Schreibt Blick.
Es gibt schon Momente, in denen man sich fragen muss, wo unsere Gesellschaft gelandet ist und wo sie hin driftet. Kleinste Minderheiten mit abstrusem Gedankengut beherrschen je länger je mehr den öffentlichen Diskurs.
Politik und Wirtschaft springen über jedes hingehaltene Stöckchen. Man könnte ja Wähler*innen oder Kunden*innen verlieren. Die grossen Stöcke lässt man allerdings durchgehen.
Als ich etwa 13 oder 14 Jahre alt war, hatte ich sämtliche der 65 Karl May-Bücher aus der Pfarreibibliotek bereits gelesen. Als Kinder spielten wir «Indianerlis» und derjenige oder diejenige die von uns Buben und Mädchen eine Indianerfeder auf dem Haupt tragen durfte, war stets der stolze King oder die stolze Könnigin der ganzen Bande. Ein Indianer oder eine Indianerin zu sein war eine grosse Ehre. Von Rassismus war da nie auch nur das Geringste zu spüren.
Kinder werden nicht als Rassisten geboren. Im Gegenteil: Sie sind neugierig. Als ich kürzlich am Morgen Zigaretten im Kiosk holte, kamen mir zwei Erstklässler-Buben entgegen. Hand in Hand. Einer mit weisser Hautfarbe, der andere mit dunkelbrauner. So schlenderten sie Hand in Hand dahin Richtung Schulhaus. Zum ersten Schultag ihres Lebens.
Ich war ergriffen und hätte gerne ein Foto von diesen zwei noch unverdorbenen Jungs gemacht. Doch mein Respekt vor Kindern hinderte mich daran. Aber eines war mir klar: Diese beiden Boys werden mit grösster Wahrscheinlichkeit nie Rassisten.
Dass jetzt ein paar vernachlässigbare Narren und Närrinnen mit ihren schrägen Postings in den Social Media den geschätzten Ravensburger-Verlag in die Knie zwingen können, sollte uns langsam aber sicher Angst machen. Denn Ravensburger bestätigt auf servile Art und Weise die unsäglichen Vorwürfe einer kleinen Minderheit.
Man hätte diesen Spinnern und Apologeten kruder Ideologien auch mit einer vernünftigen Kommunikation seitens Verlag entgegentreten können. Machte man aber nicht, sondern gab klein bei.
Wer oder was ist der/die/das Nächste? Mogli? Globi? Oder gar Felix der Kater? Willkommen in der schönen neuen kranken Welt.
-
22.8.2022 - Tag des Atomstromers
Schweizer wappnen sich für Strom-Blackout im Winter: Sogar der AKW-Chef kauft einen Dieselgenerator
Gewappnet sein für Stromausfälle im Winter. Das wollen immer mehr in der Schweiz, wie Medien berichten. Durch die Decke gehen Verkäufe von Brennholz und Powerstations, aber auch kleinere Stromgeneratoren sind gefragt.
Rüsten für die drohende Energiekrise: Schweizerinnen und Schweizer wollen offenbar nicht länger auf die Politik warten und wappnen sich für den Winter. So gehen beim grössten Schweizer Online-Warenhaus Digitec Galaxus derzeit die Verkäufe von Produkten zur Eigen-Energiegewinnung durch die Decke.
Eine Auswertung des Online-Warenhauses zeigt neue Rekordwerte im August gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode, wie die CH-Media-Titel schreiben. Beispiele: Brennholz-Verkäufe, plus 1897 Prozent! Offenbar stellen sich viele Hausbesitzer auf den Ausfall ihrer Heizung ein oder wollen sich zumindest ihr «Wärme-Level» sichern. Digitec Galaxus: «Die Leute lagern Holz zu Hause für den Fall, dass sie plötzlich kein Gas oder kein Heizöl mehr kriegen.»
Zahlen liegen über den Erwartungen
Fast verzwanzigfacht haben sich ebenfalls die Absätze sogenannter Powerstations. Das sind Riesenbatterien, die – vorausgesetzt sie sind aufgeladen – den Betrieb von Smartphones, Computern oder Wasserkochern sicherstellen. Deutlich über dem Durchschnitt sind die Verkäufe von Stromgeneratoren, Solarpanels, Heizlüftern und Heizkörpern. Laut Digitec Galaxus, die keine Angaben zu absoluten Zahlen machen wollen, bewegen sich die Verkäufe im drei- bis vierstelligem Bereich.
Die Zahlen übertreffen die Erwartungen sogar noch, die im Juli bekannt geworden waren.
AKW-Chef kauft Dieselmotörchen
Doch nicht nur das breite Volk sorgt vor, sondern auch die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Schweiz. Laut den CH-Media-Zeitungen hat sich Herbert Meinecke (58), der mit dem AKW Gösgen einen der zuverlässigsten Stromlieferanten der Schweiz leitet, einen Dieselgenerator zugetan – für den Fall der Fälle. «Dass ausgerechnet der Leiter eines AKWs auf ein Dieselmotörchen zurückgreift, mag erstaunen. Meinecke befindet sich aber in bester Gesellschaft», so die Zeitungen.
«Ich habe mehr Brennholz als sonst bestellt. Taschenlampe und Batterien sind auch parat», sagte Werner Luginbühl (64), Präsident der Schweizerischen Elektrizitätskommission, kürzlich in der «NZZ am Sonntag». Bleibt im Winter die Heizkraft weg, schaltet Marcel Dettling (41), SVP-Nationalrat aus dem Kanton Schwyz, sein Notstrom-Aggregat ein, das sich der Landwirt neu für 7000 Franken Occassionspreis zugelegt hat.
WC-Papier war einmal
Was in der Corona-Krise das WC-Papier war, sind jetzt Holz, Taschenlampen, Batterien und Kerzen. Mit letzteren hat sich Grünen-Nationalrat Bastien Girod (41) unlängst eingedeckt, wie er «Nau.ch» verraten hat. SVP-Nationalrat Albert Rösti rät laut CH-Media den Leuten, sich ein Notstrom-Aggregat zu kaufen. Das habe er in Vorbereitung auf eine Mangellage ebenfalls getan.
Die Schweiz rüstet sich bereits für den Winter. Die Empfehlungen und Massnahmen der Politik lassen auf sich warten – diese sind weiterhin eine Blackbox. Schreibt Blick.
Diesel? Und das in Zeiten der Klimakrise. Wenn das Balthasar Glättli von den Grünen erfährt, ist der Atomstromer seinen Chef-Posten los.
Allerdings sollte man dem Stromer Verständnis entgegenbringen. Wenn's um den eigenen Arsch geht, an den man frieren könnte, fallen alle Hemmungen. Ist bei den Grünen und Grüninnen nicht anders.
-
21.8.2022 - Tag des Godfathers vom Herrliberg
Blocher macht die Schweiz mitverantwortlich am Tod «blutjunger russischer Soldaten»
Alt-Bundesrat Blocher wirft der Schweiz Mitschuld am Tod «blutjunger» russischer Soldaten vor. Die Schweiz sei zur «Kriegspartei» geworden. Wer den Krieg auslöste und dass sich die Ukraine zu verteidigen versucht, darüber verliert der SVP-Doyen kein Wort.
Alt-Bundesrat Christoph Blocher (81) hat mit seiner Kolumne, die regelmässig in diversen Regionalzeitungen erscheint, eine Kontroverse ausgelöst. Diese Woche schrieb der SVP-Mäzen, dass die Schweiz im Ukraine-Krieg die Neutralität gebrochen habe und «Kriegspartei» sei.
Die Schweiz «hilft mit, dass blutjunge russische Soldaten sterben müssen», so Blocher in der «Luzerner Rundschau», «Winterthurer Zeitung» oder «Wiler Nachrichten». Blocher ist deren Verleger.
«Die jungen russischen Soldaten wurden von ukrainischen Soldaten getötet», erklärt Blocher. «Diese wiederum werden durch den Westen bewaffnet, vor allem durch die USA, aber auch durch die EU. Sogar mit Unterstützung der neutralen Schweiz, welche die schweizerische Neutralität brach und damit Kriegspartei ist.»
Blocher verschweigt, wer den Krieg begonnen hat
Die Kolumne trägt den Titel «Halbe Wahrheit». Der SVP-Mäzen sagt, dass man «angesichts der gefallenen russischen Teenager-Soldaten auch die Frage stellen müsste: Warum sind sie tot? Irgendjemand muss sie ja getötet haben.»
Für Blocher sind die toten Russen offenbar nur «die halbe Wahrheit». Dass die Ukraine von Russland angegriffen wurde und sich verteidigt, dass Putin den Krieg begonnen hat, darüber verliert er kein Wort.
Geharnischte Reaktionen
Die Blocher-Kolumne sorgt für geharnischte Reaktionen. Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (44) spricht in der «SonntagsZeitung» von «Geschichtsverdrehung». FDP-Vizepräsident Andrea Caroni (42) sagte der Zeitung, «Putin braucht keinen Propagandaminister mehr – die Blochers machens gratis».
Undiplomatisch reagiert der ukrainische Botschafter in Bern, Artem Rybchenko (39), auf die Blocher-Kolumne: «So etwas kann man nur vom heimischen Sofa aus sagen. Herr Blocher hat keinen Bezug zur Realität.» Ihm komme das vor wie «ein schlechter Witz». Schreibt SonntagsBlick.
«Victim blaming» (Opferschelte) nennt man im Englischen das perfide Spiel, das der Godfather vom Herrliberg mit der absurden «Verlegerkolumne» in seinen Gratis-Blättchen betreibt. Oder «Täter-/Opfer-Umkehr» auf Deutsch.
Die Frage stellt sich unwillkürlich, wohin Don Christoph Blocher in der «Verlegerkolumne» sein Hirn verlegt hat, das in früheren Zeiten tatsächlich vorhanden war?
Ist das Altersdummheit, Alterssturheit oder einfach nur ein dämlicher Gefallen an seine Tochter Magdalena Martullo-Blocher, damit diese weiterhin ohne jegliche Hemmungen oder gar Gewissensbisse mit dem Don von Russland einträchtige Geschäfte führen kann?
-
20.8.2022 - Tag der Ganoven und Ehrenwerten der Rohstoffhändler
Grüne-Präsident Balthasar Glättli über den Rohstoffhandel in Zug: «Vieles geschieht im Dunkeln»
Die Grünen Schweiz wollen den Rohstoffhandel stärker regulieren. Das hat Auswirkungen auf den Rohstoffhandelsplatz Zug, der zu den grössten der Schweiz zählt. «Dieser Wirtschaftszweig darf nicht unter dem Radar fliegen», ist Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli überzeugt.
Der Rohstoffhandel im Kanton Zug hat grosse Tradition. Just dort treffen sich am Samstag die Grünen Schweiz zur Delegiertenversammlung. Im Fokus: zwei Resolutionen, mit denen die Partei die Schweizer Friedens- und Sicherheitspolitik neu ausrichten will.
Unter anderem fordert sie darin den Ausbau von «Freiheits- und Friedensenergien», die Regulierung des Rohstoffhandels und das Finanzieren des Wiederaufbaus in der Ukraine.
zentralplus hat im Vorfeld exklusiv mit Balthasar Glättli, Präsident der Grünen Schweiz, über feministische Aussenpolitik, eine «Kriegsgewinnsteuer» und die Rolle des Kantons Zug für den Rohstoffhandel gesprochen.
zentralplus: Die Grünen Schweiz treffen sich am Samstag zur Delegiertenversammlung in Zug. Ein Zufall?
Balthasar Glättli: Ja, ursprünglich war geplant, die DV in Zug abzuhalten, um den Endspurt der kantonalen Wahlen einzuläuten und Tabea Zimmermann Gibson bei ihrer Kandidatur für den Regierungsrat zu unterstützen. Aber natürlich, unsere Forderungen sind hier besonders aktuell. Die Grünen in Zug verlangen seit Jahren, dass der Rohstoffhandel transparenter wird. Gegen Nordstream 1 haben wir hier protestiert, ebenso gegen Nordstream 2. Insofern ist Zug ein symbolischer Ort für die DV der Grünen Schweiz.
zentralplus: Ihre Partei will den Rohstoffhandelsplatz Schweiz stärker regulieren. Wie soll das konkret geschehen?
Balthasar Glättli: Der Rohstoffhandel in der Schweiz ist intransparent, vieles geschieht im Dunkeln. Ein so wichtiger Wirtschaftszweig darf nicht unter dem Radar fliegen. Es braucht eine unabhängige Aufsichtsbehörde, ähnlich der Finanzmarktaufsicht, welche die Geschäfte der Rohstoffhändler unter die Lupe nimmt. So liessen sich auch griffige Sanktionen verhängen. Unser erster Vorschlag im Parlament erlitt Schiffbruch, doch wir bleiben dran.
zentralplus: Wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr, was den Rohstoffhandel mit Ländern wie Russland anbelangt?
Balthasar Glättli: Vielen Leuten wird je länger je mehr bewusst, dass Geschäfte mit Diktaturen und Oligarchen nicht nur eine Frage der Moral sind. Unsere und die europäische Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas, aber auch vom Handel mit China, macht unsere Wirtschaft und Gesellschaft verletzlich. Die Regulierung des Rohstoffhandels ist also auch eine Frage der Verantwortung.
zentralplus: Welche Auswirkungen hat eine stärkere Regulierung auf die Rohstoffdrehscheibe Zug?
Balthasar Glättli: Für Unternehmen im Rohstoffsektor wäre Zug dadurch sicher weniger attraktiv. Das Klumpenrisiko für den Kanton würde sich hingegen verringern. Mit anständigen Geschäften sollen Rohstoffhändler aber weiterhin Geld verdienen können. Nur müssen die Unternehmen transparenter werden. Die Zahlen dazu existieren intern wohl bereits heute, die Rohstoffhändler mussten sie bislang aber nicht publik machen.
zentralplus: Eng verknüpft mit dem Rohstoffhandel ist eine «Kriegsgewinnsteuer», wie sie unter anderem auch Ihre Partei fordert. Existieren in Ihren Augen legitime «Kriegsgewinner»?
Balthasar Glättli: Das ist eine Frage, die wir diskutieren müssen. Dass eine saubere Abgrenzung zwischen «legitimen» und «illegitimen» Kriegsgewinnern möglich ist, zeigen unsere Nachbarländer. Italien hat zum Beispiel eine Steuer auf sogenannte Übergewinne von Energieunternehmen eingeführt. Das Kernproblem liegt aber an einem anderen Ort: Hätten wir in der Schweiz höhere Unternehmenssteuern, würden ausserordentliche Gewinne sowieso viel höher versteuert. Das Gegenteil ist aber der Fall: Wir haben die Unternehmenssteuern gesenkt, um Firmen anzulocken. Für die zu hohen Gewinne, die sie jetzt einfahren, brauchen wir eine Lösung. In dieser Angelegenheit zähle ich auf Gerhard Pfister, der bereits Interesse angekündigt hat.
zentralplus: Umstritten ist auch, wohin der Ertrag aus der «Kriegsgewinnsteuer» fliessen soll: in die Ukraine oder zu den von der Inflation am stärksten Betroffenen in der Schweiz?
Balthasar Glättli: Das wird die nächste politische Diskussion. Ich sage: Das eine tun, das andere nicht lassen. Es wäre problematisch, würden wir die Erträge aus einer solchen «Kriegsgewinnsteuer» nur in der Schweiz einsetzen. Der Ukraine-Krieg zeigt, dass wir eine grössere Verantwortung haben.
zentralplus: Was versprechen Sie sich von einer «feministischen Aussenpolitik», wie die Grünen in einer zweiten Resolution fordern?
Balthasar Glättli: In Konflikten wie aktuell in der Ukraine werden Frauenrechte immer zuerst verletzt. Es ist die Stunde der Militaristen, die sexuelle Gewalt als Kriegsinstrument einsetzen. In vielen Ländern stehen Frauen strukturell unter Druck und sitzen politisch am kürzeren Hebel. Eine feministische Aussenpolitik legt das Augenmerk auf die Frauenrechte. Wie Hillary Clinton treffend sagte: Menschenrechte sind Frauenrechte und Frauenrechte sind Menschenrechte.
zentralplus: Welche Teile der zwei Resolutionen werden an der DV am Samstag zu reden geben?
Balthasar Glättli: Die Resolutionen sind stark an die Aktualität gebunden. Mich erreichten kritische Rückmeldungen, die forderten, nicht nur die Handlungen von Russland, sondern auch die von China expliziter zu verurteilen. Diese Anregung hat sicher eine Diskussion verdient. Schreibt ZentralPlus.
Dass auf unserer wunderbaren Welt vieles im Dunkeln passiert, war schon Bertolt Brecht bekannt. Im Dunkeln munkeln feiert seit Bestehen der Menschheit Hochkonjunktur. Vor allem unter Ganoven und ehrenwerten Menschen wie Rohstoffhändlern. Erstaunlich, dass sich dem Grüne-Politiker Balthasar Glättli diese Erkenntnis erst jetzt offenbart. Hat denn der gute Balthasar nie Brecht gelesen?
«Denn die einen sind im Dunkeln
Und die anderen sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.»
Aus «Die Dreigroschenoper»
«Und der Haifisch, der hat Zähne
Und die trägt er im Gesicht
Und Macheath, der hat ein Messer
Doch das Messer sieht man nicht»
Aus «Mackie Messer»
-
19.8.2022 - Tag der Fürsten und Familienclans in den Parteien
Bierparteichef Marco Pogo kann bei der Österreichischen Bundespräsidentschaftswahl antreten
Dominik Wlazny hat laut eigenen Angaben die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl gesammelt. Am Freitag will der Chef der Bierpartei, der auch unter seinem Künstlernamen Marco Pogo* bekannt ist, die Erklärungen persönlich – und gemeinsam mit seinem Wahlvorschlag – bei der Bundeswahlbehörde im Innenministerium abgegeben.
Jüngster Kandidat
"Ich bin überwältigt und dankbar, wie viele Österreicherinnen und Österreicher sich die Mühe gemacht haben, mich trotz aller bürokratischer Hürden auf meinem Weg zur Kandidatur zu unterstützen. Das zeigt deutlich, dass viele Menschen meiner Meinung sind: Es muss sich etwas ändern in diesem Land", wird Wlazny in einer Presseaussendung zitiert.
Wlazny ist mit 35 Jahren der jüngste Kandidat, der für das höchste Amt im Staat kandidiert. Das benötigte Wahlalter von 35 Jahren erreicht er somit gerade. Die Wahl findet am 9. Oktober statt. Großer Favorit ist Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, der derzeit ebenfalls Unterstützungserklärungen sammelt. Schreibt DER STANDARD.
Ein weiterer Comedian greift nach einem hohen politischen Amt. Statt sich über dieses Phänomen aufzuregen, das in der Ukraine (Wolodymyr Selensky), Italien (Beppe Grillo), Guatemala (Jimmy Morales) und Island (Jón Gnarr) längst Realität geworden ist, sollte man sich eher Gedanken über die Ursachen machen.
Zwar nicht der einzige, aber ein wesentlicher Grund sind die etablierten Parteien der westlichen, «demokratisch» regierten Staaten, die über viele Dekaden hinweg eine unerträgliche Elite konstruiert haben. Ähnlich den Fürsten und Familienclans vergangener Jahrhunderte. Von den USA bis hin zur Schweiz, wo inzwischen die SVP ebenfalls von einem Familienclan dominiert wird. Gegen die Blochers passiert in dieser Partei nichts, aber auch wirklich rein gar nichts.
Diese Entwicklung der Parteien ist mit ein Grund der querbeet durch alle westlichen Demokratien und Altersschichten feststellbaren Politikverdrossenheit und Wahlenthaltung. «Die da oben machen sowieso was sie wollen» ist eines der meistgenannten Argumente der Frustrierten, die nicht mehr an den Wahlen teilnehmen. Auch wenn das Argument vollkommen falsch ist.
Denn die führenden Parteibonzen*innenbis hin zu den sozialistischen Parteien – siehe Deutschlands Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder – machen eben nicht das, was sie wollen, sondern das, was die Konzerne ihnen diktieren. Anschliessend von der gehorsamen Polit-Kaste frei nach dem Motto «wer bezahlt befiehlt» als «alternativlos» bezeichnet.
Forscher des Instituts für Systemgestaltung in Zürich haben 2007 untersucht, wie Konzerne untereinander verflochten sind. Dabei hat sich eine «Superzelle» von 147 Konzernen herauskristallisiert – mehrheitlich Finanzkonzerne.
Auch wenn die Zürcher Forschungsarbeit eine alte Kamelle ist, hat sich an ihrer Richtigkeit nichts verändert. Ausser den neu hinzugekommen Globalplayern. «Planet Wissen» vom WDR zeigt dies mit der Doku «Rund 150 Konzerne regieren die Welt» aus dem Jahr 2019.
Dass die Comedians aus der Ukraine, Italien, Guatemala und Island bis auf Jimmy Morales mit eigenen, neu gegründeten Parteien angetreten sind, zeigt aber, dass auch sie das eigentliche Problem nicht erkannt haben und ausgetretenen Pfaden folgen. Selenskys und Grillos Parteien sind keinen Deut besser als die ihrer Vorgänger.
Künftige Generationen werden nicht umhin kommen, das System der Parteien grundlegend den gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen. Damit Sätze wie «Gegen die Wallstreet wird niemand US-Präsident» für immer verschwinden.
-
18.8.2022 - Tag der hehren Botschaften von Politikern*innen
Strompreise: Schweden kündigt Milliardenhilfe für Haushalte an
Angesichts der hohen Strompreise will die schwedische Regierung Haushalte mit mehreren Milliarden entlasten. Das kündigte Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm an. 30 Milliarden Kronen (rund 2.8 Milliarden Franken) sollen direkt oder indirekt aus Mitteln der Behörde, die für die Stromversorgung zuständig ist, an die schwedischen Haushalte gehen. Wie und wann das passieren soll, steht noch nicht fest.
«Wir werden nicht zulassen, dass Putin die schwedischen Haushalte und die schwedische Industrie als Geiseln hält», sagte Andersson, knapp vier Wochen vor der schwedischen Parlamentswahl. Der Markt sei für «extreme Situationen wie diese» nicht geschaffen. Schreibt SRF im Ukraine-Liveticker.
Die Erleuchtung der Schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson kommt spät. Aber immerhin kommt sie. Dass der berühmte Markt, der ja laut den Ultra-Neoliberalen und den Konzern-Göttern alles regelt, für «extreme Situationen wie diese» in der Tat nicht geschaffen ist, wird langsam aber sicher zur Gewissheit.
Das deckte auch die Coronapandemie in brutaler Deutlichkeit auf. Die Schwächen und extremen Risiken einer entfesselten Globalisierung führten dazu, dass simple Schutzmasken schlicht und einfach nicht vorhanden waren und lebenswichtige Arzneimittel knapp wurden. Ganz abgesehen davon, dass die Just-in-time-Lieferketten zusammenbrachen.
Einen Schönheitsfehler hat die hehre Botschaft der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin aus Schweden allerdings. In knapp vier Wochen finden in Schweden Parlamentswahlen statt.
«Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd.» Dieses Zitat, das Otto von Bismarck zugeschrieben wird aber viele Väter hat, sagt alles.
-
17.8.2022 - Tag der Wikipedia-Fotografen und deren Anwälte
Aargauerin bestellt Fälschungen: Rechtsanwälte verlangen horrende Beträge für Fake-Markenartikel
Wer gefälschte Markenprodukte online bestellt, muss mit hohen Kosten rechnen. Eine Aargauerin sah in den sozialen Medien Werbung für einen internationalen Online-Shop. Dort fand sie diverse Produkte, die ihr gefielen. Woher die Sachen geliefert werden, stand nicht genau, nur «Übersee» konnte sie lesen und dass die Lieferfrist bis zu 25 Tage dauere. Sie bestellte unter anderem Kinder- und Haushaltsartikel sowie Schmuck und Taschen.
Doch nicht alle Artikel kamen bei ihr zuhause an: Stattdessen erhielt sie Post vom Zoll. Dieser schrieb, dass sechs Produkte zurückbehalten würden, da es sich wahrscheinlich um gefälschte Markenartikel handle. Damit aber nicht genug: Kurz darauf meldeten sich auch zwei Rechtsanwälte bei der Frau und stellten hohe Forderungen – insgesamt knapp 2000 Franken.
Die Anwälte bezogen sich in ihren Schreiben auf Nachahmungen der Marken Gucci und Chanel. Die Beträge seien einerseits für die Zollkosten geschuldet, die durch die Vernichtung der Produkte entstanden seien. Zudem handle es sich um eine Entschädigung für die Marke sowie um das Anwaltshonorar.
Die Online-Kundin erschrak, als sie die Briefe sah. Sie vermutete eine Gaunerei: «Ich dachte, dass diese Schreiben nicht echt sein können. Wie kommen sie auf diese Beträge?»
Anwälte dürfen Forderungen stellen
Wer gefälschte Artikel im Ausland bestellt, muss tatsächlich damit rechnen, dass diese nie ankommen und dass zusätzliche Kosten entstehen: Das Markenschutzgesetz verbietet die Einfuhr gefälschter Artikel. Und so beauftragen Markenartikel-Hersteller die Zollbehörden damit, gefälschte Produkte abzufangen und diese zu vernichten. Die Kosten, die dabei entstehen, werden von den Kundinnen und Kunden zurückverlangt, welche die Produkte bestellt haben.
Aber Markenanwälte dürfen nur tatsächlich entstandene Kosten zurückfordern. Sie müssen belegen können, wie sie auf den geforderten Betrag kommen. Pauschalbeträge dürfen sie nicht verlangen. Der Verein Stop Piracy, der sich gegen Fälschungen stark macht, rät deshalb, dass man sich bei den Anwälten meldet: «Man soll darauf beharren, dass die effektiven Kosten aufgelistet werden – und zwar detailliert», sagt Eveline Capol, Leiterin der Geschäftsstelle von Stop Piracy.
Für Konsumentinnen und Konsumenten sei es jedoch nicht immer einfach im Internet zu erkennen, ob ein Produkt gefälscht sei oder nicht, so Eveline Capol weiter. Etwa, wenn man sich vermeintlich auf einer Schweizer Seite mit «.ch»-Endung befinde.
Hier könne man zum Beispiel auf die Lieferbedingungen achten: «Wenn die Lieferfrist mehrere Wochen beträgt, man ein Produkt nicht zurückschicken kann oder es keine Garantie gibt: Finger weg!» Ein Hinweis kann natürlich auch der Preis sein: Ein Markenartikel zum Spottpreis ist selten ein Original. Schreibt SRF.
Man darf sich schon fragen, wer in diesem von SRF beschriebenen Fall die grösseren Gauner sind: Die Produkte-Fälscher oder die Schweizer Anwälte?
Der Artillerie-Verein Zofingen kann auf ein ähnliches Scharmützel mit einem Basler Anwalt zurückblicken.
Vor ein paar Jahren veröffentlichte der AVZ einen Artikel über das Schweizer Kulturgut «Schloss Lenzburg» aus dem Kanton Aargau, der von der namhaften und absolut seriösen Schweizer Institution «Schweizer Denkmalpflege» als Medieninformation inklusive einem Bild vom Schloss Lenzburg für die freie Veröffentlichung den Medien zur Verfügung gestellt wurde.
Etwa zwei oder drei Jahre nach der Veröffentlichung des Artikels auf der Website vom Artillerie-Verein Zofingen bekam AVZ-Präsident Marc Nyfeler dicke Post mittels einem eingeschriebenen Brief inklusive Einzahlungsschein von einem Basler Anwalt.
Im Namen eines Basler (Wikipedia)-Fotografen, der das Bild vom Schloss Lenzburg für Wikipedia produziert hatte, verlangte der Basler Lawyer aufgrund der beachtlichen Visits der AVZ-Website von über 30- bis 40-Tausend Besuchern*innen pro Monat eine horrende Summe. Bezahlbar innert 30 Tagen.
Präsident Marc Nyfeler leitete das Schreiben mit einem leichten Ton des Vorwurfs umgehend an mich weiter. Wenn sich der Präsident auch nur räuspert, geht man logischerweise umgehend der Sache nach. Was ich denn auch stante Pedes tat.
Und siehe da: Alle, aber auch wirklich alle Dokumente inklusive Fotos vom AVZ sind auf dem Server bis zur Unendlichkeit gespeichert und so fand ich denn auch sehr schnell das Corpus Delicti vom 16. Juli 2018. Wie bei allen Bildern vom AVZ war auch bei diesem die Quelle («Bild ZVG Schweizer Denkmalpflege» inklusive (html-)Link zur Institution) im «Kurztext» unterhalb des Bildes veröffentlicht. Mehr noch: Die Bildquelle wäre auch im Quelltext zu eruieren gewesen, hätten Anwalt und Fotograf auch nur einigermassen seriös recherchiert.
Da mich der glorreiche Anwalt aus Basel partout von seiner unbedarften Sekretärin am Telefon ins Leere laufen liess, schrieb ich ihm als verantwortlicher Webmaster einen höflichen, aber faktenbasierten Brief und erklärte ihm, dass ich, der ich noch NIE ein Bild von Wikipedia veröffentlicht habe (Gott behüte mich davor!), jederzeit bereit sei für einen Gang nach Canossa, also zum Gericht. Um die absolute Schuldlosigkeit des AVZ rechtlich zu beweisen und dass der Fall damit für mich erledigt sei. Das war er denn auch für den Schangli aus Basel. Der AVZ hörte nichts mehr von diesem ehrenwerten Mann.
Die Moral der Geschicht: Mein Freund und «Hoffotograf» vom AVZ, Res Kaderli, meinte, nachdem ich ihm das Wikipedia-Bild des Basler Fotografen gezeigt hatte, dass das ja «qualitativ ein total "beschissenes" Bild sei». Was man durchaus so sehen kann. Und weiter: «Für ein Bild dieser Qualität Geld zu verlangen, ist trotz Urheberrecht eine Frechheit». Dem pflichte ich bei.
Aber scheinbar ist es das Geschäftsmodell des Basler Fotografen. Denn der AVZ war gemäss Recherchen nicht der erste und vermutlich auch nicht der letzte, der von ihm bisher verklagt wurde. Möglicherweis aber der einzige, der sich faktenbasiert gegen eine Bezahlung wehrte.
-
16.8.2020 - Tag der Naivität
«Gute Fee» zockte Hans-Bernd Breuer (80) aus Oberwil BL gnadenlos ab – er versteht ihren Freispruch nicht: «Sie bestahl mich, als ich am verletzlichsten war»
Als der Rentner im Spital liegt, zockt ihn eine Freundin gnadenlos ab, behändigt seine Bankkarte und seinen Autoschlüssel. Jetzt wurde die Marokkanerin überdies vom Richter freigesprochen. Hans-Bernd Breuer (80) aus Oberwil BL versteht die Welt nicht mehr.
Über 51'000 Franken in bar und Gold hat ihn seine Freundschaft mit einer zuerst netten und hilfsbereiten Marokkanerin (52) gekostet. Der Rentner Hans-Bernd Breuer (80) aus Oberwil BL ist enttäuscht. Enttäuscht von der Frau – und enttäuscht von der Schweizer Justiz. Die Frau wurde nämlich vor einer Woche vom Strafgericht in Muttenz BL vollumfänglich freigesprochen!
«Das ist doch keine Gerechtigkeit!», schimpft der ehemalige Ingenieur. Der Deutsche will das Urteil aber nicht anfechten. «Ich schliesse lieber mit der Geschichte ab. Geld ist von ihr auf dem zivilen Weg sowieso keines mehr zu holen, und Chancen habe ich auf dem strafrechtlichen offenbar auch keine.» Denn: Es kam wegen des Rechtsgrundsatzes «in dubio pro reo», also «im Zweifel für den Angeklagten», zum Freispruch.
Marokkanerin besuchte ihn täglich im Spital
Die Geschichte ereignete sich vor fünf Jahren. Hans-Bernd Breuer geht des Öfteren in eine Beiz im grenznahen Frankreich, dort arbeitet die Marokkanerin im Service. «Weil wir oft zusammen draussen rauchen gingen, entwickelte sich eine Freundschaft», erzählt er. Später wird sie zur Freundschaft plus. Der Altersunterschied habe ihn nie gestört. «Ich wollte sie ja nicht heiraten.»
Dann muss der Rentner ins Spital. «Ich hatte in den 60er-Jahren mal einen Keim aufgelesen, und der hat plötzlich Herz und Wirbelsäule befallen», erzählt er. Während sieben Monaten ist er immer wieder für mehrere Wochen im Spital und nur zwischendurch ein paar Tage zu Hause.
«Sie kümmerte sich um meine Wohnung, putzte, leerte die Post und übernachtete manchmal dort. Und sie kam jeden Tag zu mir ins Krankenhaus, das habe ich sehr geschätzt», erzählt er. Wenn er das Spital verlassen durfte, holte sie ihn mit seinem Auto ab. «Als ich dann zu Hause meine Zahlungen erledigen musste, gingen wir zum Bankomaten und dann zur Post. Sie schob mich im Rollstuhl – und hat mir dabei meine PIN-Nummer abgeguckt.»
Plötzlich sind Geld und Gold weg
Dann behändigt die Marokkanerin seine Bankkarte – und klaut über 11'000 Franken sowie 3500 Euro. «Die Bankauszüge liess sie verschwinden, wenn sie mir die Post brachte, so dass ich es vorerst nicht bemerkte», erzählt der Rentner.
Zudem gab die Frau einem ihrer Söhne das neue Auto von Hans-Bernd Breuer und liess diesen damit viele Kilometer fahren. Auch nahm sie von Breuer Erbschmuck, Uhren, Goldvreneli und einen Goldbarren an sich.
«Als ich definitiv aus dem Spital entlassen wurde und ich die Bankauszüge sah, verschwand sie spurlos aus meinem Leben. Sie warf den Autoschlüssel in den Briefkasten, liess ihre Sachen bei mir und ward nie mehr gesehen», schildert der Rentner. Er fasst zusammen: «Als ich am verletzlichsten war, hat sie mich gnadenlos bestohlen.»
«Ich habe das Vertrauen in die Frauen verloren»
Nur: Das Gericht konnte nicht von der Schuld der Frau überzeugt werden. Schliesslich sei nicht ausgeschlossen, dass er ihr die Bankkarte und den Pin-Code im Delirium im Spital selber gegeben habe, kam der Richter zum Schluss.
«Aber das war doch eindeutig Diebstahl!», meint Hans-Bernd Breuer. Eine Landsfrau von ihm, die Richterin in Berlin sei, habe ob der ganzen Sache nur den Kopf geschüttelt – auch dass es bis zum Prozess fünf Jahre dauerte, könne in Deutschland niemand verstehen.
Hans-Bernd Breuer will mit der Geschichte nun einfach abschliessen. Er zieht seine Lehren aus der Sache: «Ich habe das Vertrauen in die Frauen leider verloren.» Die Frau war für Blick für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Schreibt Blick.
«It takes two to tango». Damit ist eigentlich alles gesagt. Ein älterer Herr gibt sich für ein paar zauberhafte Momente rund um die Lendengegend der puren, blauäugigen Naivität hin.
Der kopfschüttelnden Richterin in Berlin sei ein Blick vor die eigene Haustür empfohlen. Die meisten deutschen Strafverfahren landen gar nicht vor dem Richterstuhl. Nur 388.000 der rund fünf Millionen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften mündeten 2020 in einer Anklage - der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Die durchschnittliche Dauer erstinstanzlicher (!) Strafverfahren dauert im Schnitt mehr als 20 Monate.
-
15.8.2022 - Tag der Hühner, die goldene Eier legen
Normalität im Pflegeheim: Im Lindenpark Balsthal leben Demenzkranke nicht hinter einem Zaun
Nach holländischem Vorbild: Ein neues Solothurner Heim für Demenzkranke* kommt ohne «Spitalmief» und Zäune aus.
Manche Demenzkranke bewegen sich von ihrem Pflegeheim weg, erinnern sich aber nicht mehr an den Rückweg und gehen verloren, die Angehörigen machen sich verständlicherweise Sorgen. Wegen solcher Situationen werden Heime für Demenzerkrankte oft zwar mit Umschwung versehen, aber eingezäunt.
So kann niemand weglaufen, das Pflegepersonal muss niemanden suchen. Gehört diese Art der Betreuung der Vergangenheit an? Ein neues Solothurner Demenzzentrum in Balsthal setzt auf ein ganz anderes Konzept. Angelehnt an den Alltag im holländischen Demenzdorf «De Hogeweyk» hat der Lindenpark in Balsthal für 37 Millionen Franken ein Alters- und Pflegeheim gebaut.
Das Zentrum besteht aus zwei Wohngebäuden und einem Hauptgebäude. Integriert sind Bistro, Coiffeur, Aktivierungsraum, Gemeinschaftsraum und weitere Räume. 12 Wohngruppen für 76 Menschen mit Demenz sind nach zwei Jahren Bauzeit nun bezugsbereit.
Sechs Personen teilen sich jeweils eine Wohnung, mit Wohn- und Esszimmer, Küche, Terrasse. Das Restaurant mit Gartenwirtschaft ist öffentlich, das Zentrum ist nicht am Rand des Dorfs, sondern mittendrin gebaut.
Einsperren ist vorbei
Die Philosophie des Solothurner Lindenparks basiert darauf, dass mit dem Betreuungskonzept der Alltag von Menschen mit Demenz so normal wie möglich gestaltet wird. Demente Menschen, die besonders bewegungsfreudig sind, werden mit einem GPS-Sender ausgestattet und werden so im Notfall wieder gefunden.
Trotzdem sind die Wege kurvig statt gerade angelegt, was den Bewohnenden entgegenkommt. «So kann man die Weglaufproblematik grösstenteils verhindern», weiss André Grolimund von der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu, der Besitzerin des Lindenparks.
Im Lindenpark lässt man Langschläfer am Morgen ausschlafen, die Mitarbeitenden tragen keine Berufs-, sondern Alltagskleider, Jeans und T-Shirt anstelle von weissen Kitteln.
Auch ein WC sucht man direkt im Schlafzimmer vergebens. Wie bei einer normalen Wohnung ist es ein separates Zimmer. «Genau das, was wir kennen, wollten wir abbilden. Auch einen Handlauf haben wir nicht. Wir wollten keinen Spitalmief oder Spitalgroove. Es soll wie eine normale Wohnung sein», sagt Projektleiter Patrick Scarpelli.
Die Bewohnenden können bei der Vorbereitung der Mahlzeiten helfen, wenn sie möchten, oder mithelfen beim Bepflanzen der Hochbeete. Das Essen kommt in Töpfen auf den Tisch, jede und jeder bestimmt somit selbst, wie viel sie oder er essen möchte. Ein Alltag wie zu Hause, vor der Erkrankung. Das Ziel sei eine vertraute Umgebung, weil Demenzkranke durch neue Situationen gestresst werden, sagen die Verantwortlichen. Schreibt SRF.
Jetzt noch die unsäglichen Pharmaka zur endlosen Beruhigung weglassen (Demenzkranke werden häufig mit Neuroleptika ruhiggestellt)! Dann könnte aus diesem Modell etwas Sinnvolles für die Zukunft entstehen.
Sofern man daraus nicht wieder eine zusätzliche Industrie für das staatliche Gesundheitswesen und die übliche Selbstbedienungsmentalität der Horden von «Pöstchenjägern» aus der Politik entwickelt.
Die traditionellen Altersheime mit den herkömmlichen Demenzstationen werden dies nicht gerne hören. Gehören doch Pflegepatienten mit Demenzerkrankung leider je länger je mehr zur Gruppe, die mit monatlichen Heimkosten – je nach Pflegestufe – zwischen 17'000 bis 20'000 Franken und mehr nicht nur extrem hohe, sondern auch attraktive Einkünfte sichern. Die Verwaltungsräte von Pflegeheimen freuts!
* «Volkskrankheit» Demenz
Demenz ist der Oberbegriff für mehr als 100 verschiedene Krankheiten, welche die Funktion des Gehirns beeinträchtigen, schreibt der Verband Alzheimer Schweiz.
Besonders die geistigen, die sogenannten kognitiven Fähigkeiten wie das Denken, das Gedächtnis, die Orientierung und die Sprache sind bei Demenz betroffen.
Bei einer irreversiblen Demenz ist das Gehirn direkt erkrankt.
In der Schweiz leben gegen 146'500 demenzkranke Menschen.
Anlaufstellen gibt es unter anderem beim Verband Alzheimer Schweiz.
-
14.8.2022 - Tag der gegenseitigen Schuldzuweisungen in der Schweizer Energiepolitik
Sommarugas Strom-Sparplan: «Heizung runter in öffentlichen Gebäuden»
Energieministerin Sommaruga sagt, wie sie im Winter Gas sparen will: weniger heizen in öffentlichen Gebäuden. Für die Vorwürfe der SVP hat sie wenig Verständnis.
SonntagsBlick: Frau Sommaruga, Werner Luginbühl, der Chef der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, empfiehlt der Bevölkerung, sich angesichts drohender Stromausfälle mit Holz und Kerzen einzudecken. Haben Sie schon Kerzen gekauft?
Simonetta Sommaruga: Ich habe immer Kerzen zu Hause. Aber ich glaube, die Aussage von Herrn Luginbühl ist ein Weckruf für alle, dass die Situation ernst ist. Der Bundesrat ist sich dessen bewusst – nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine.
Tatsächlich?
Wir sind schon vor Weihnachten letzten Jahres aktiv geworden. Als die Energiemärkte verrücktspielten, habe ich eine Taskforce ins Leben gerufen.
Damals stellte der Stromkonzern Alpiq ein Gesuch um Staatshilfe.
Genau. Als Reaktion darauf haben wir einen Rettungsschirm für grosse Stromfirmen aufgegleist und eine Wasserkraftreserve für die kritische Zeit im Winter vorbereitet. Wegen des Kriegs in der Ukraine haben wir zudem die Gasbranche beauftragt, zusätzliches Gas zu beschaffen. Bundesrat Guy Parmelin und ich begleiten diese Arbeiten eng.
Was ist mit dem Bau von neuen Gaskraftwerken, kommen diese nun?
Die Arbeiten für Kraftwerke, die Strom produzieren, laufen auf Hochtouren. Wir klären derzeit, welche Standorte infrage kommen.
Elcom-Chef Luginbühl spricht davon, dass wir im Winter im schlimmsten Fall ein paar Stunden im Dunkeln hocken werden. Das heisst: Wenns dumm läuft, reichen diese Massnahmen nicht aus.
Die Schweiz macht alles, um eine Mangellage zu verhindern. Aber vergessen wir nicht, es herrscht Krieg in Europa. Da gibt es keine Gewissheiten. Die Situation ist auf dem ganzen Kontinent angespannt, wir haben eine weltweite Energiekrise. Deshalb sollte sich auch die Schweiz ein Sparziel vornehmen.
Nach dem Vorbild der EU also, deren Mitgliedstaaten bis im Frühling 15 Prozent Gas einsparen sollen. Setzen Sie der Schweiz dasselbe Ziel?
Das wäre sicher sinnvoll. Entscheiden wird der Bundesrat.
Apropos Sparpläne: Deutschland fährt schon seit Wochen eine riesige Kampagne und appelliert an die Bevölkerung, Energie zu sparen. In der Schweiz ist davon nichts zu sehen
Unser Nachbarland hat eine ganz andere Ausgangslage als die Schweiz. Deutschland verbraucht viel Gas, um Strom zu produzieren und seine Abhängigkeit von russischem Gas ist viel grösser. In der Schweiz produzieren wir einen grossen Teil unseres Stroms aus Wasserkraft. Auf Gas sind wir vor allem im Winter fürs Heizen angewiesen. Das ist auch der Grund, warum wir die Kampagne erst in den kommenden Wochen starten werden: Wenn man den Leuten jetzt im Sommer, wo es so heiss ist, sagt, wie sie sparen müssen, versteht das niemand.
Es geht ja nicht nur darum, Gas zu sparen, sondern Energie an sich. Wenn es in den Speicherseen Ende Winter mehr Wasser hat, weil wir heute Strom sparen, kommt uns das auch zugute.
Wie gesagt, die Kampagne ist vorbereitet und kommt demnächst. Mir war wichtig, dass wir auch die Wirtschaft an Bord haben, die Konsumentenorganisationen – es braucht alle, um das Ziel zu erreichen.
In welche Richtung wird die Kampagne gehen? Heizung runter, Pulli an?
Wir müssen aufhören, Energie zu verschwenden. Das ist die zentrale Botschaft. Beim Heizen haben wir einen grossen Hebel. Schon nur ein Grad weniger spart gut fünf Prozent Energie. Für mich ist klar, dass die öffentliche Verwaltung hier mit gutem Beispiel vorangehen muss: Dass wir in öffentlichen Gebäuden die Heizung etwas runterdrehen. Dafür werde ich mich im Bundesrat einsetzen.
Die SVP hat Ihnen kürzlich vorgeworfen, die Energiestrategie sei gescheitert. Hat sie recht?
Gescheitert ist jene Politik, die blind auf Gas- und Ölimporte gesetzt hat! Sie hat unser Land abhängig und verletzlich gemacht. Warum haben wir heute ein Problem? Weil Russland den Gashahn zudreht und die Schweiz beim Öl und Gas vollständig vom Ausland abhängig ist. Für mich war immer klar: Wir müssen uns von dieser Abhängigkeit lösen und die einheimischen Energien ausbauen. Deshalb habe ich das Gesetz für eine sichere Stromversorgung mit Erneuerbaren auf den Weg gebracht. Es ist seit über einem Jahr im Parlament hängig.
Sie sagen, die SVP sei mit schuld an der heutigen Situation?
Wir alle wissen, wer sich für die erneuerbaren Energien eingesetzt hat. Und wir wissen auch, wer den Ausbau bekämpft hat. Auf nationaler Ebene und in den Kantonen. Was ist denn die Antwort auf den Krieg – noch mehr Öl und Gas? Das ist falsch. Wir müssen rasch vorwärtsmachen mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Das ist auch die richtige Antwort auf die Klimakrise.
Noch sind wir auf die Gasimporte angewiesen, weshalb Sie Solidaritätsabkommen mit den Nachbarstaaten angekündigt hatten. Ist da irgendetwas unterschrieben?
Die Verhandlungen dazu laufen. Ein solches Abkommen greift aber erst, wenn man schon in einer Mangellage wäre. Das Wichtigste ist für den Bundesrat jedoch, diese möglichst zu verhindern; darum muss die Branche zusätzliches Gas beschaffen.
Ein Stromabkommen mit der EU wäre jetzt wohl ganz nützlich. Nur will Brüssel davon nichts wissen, seit der Bundesrat die Verhandlungen übers Rahmenabkommen abgebrochen hat.
Die schwierige Situation, die wir aktuell haben, wurde durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst. Mit dem Stromabkommen hätten wir vielleicht eine einfachere Zusammenarbeit mit der EU, aber das grundsätzliche Problem, – unsere Abhängigkeit bei Öl und Gas vom Ausland – würde das Abkommen nicht verändern.
Vor wenigen Tagen sagten Sie, es sei «Zeit für eine Annäherung an Europa». Wie könnte eine solche aussehen?
Wir sind auf Europa angewiesen. Und wir haben Europa auch etwas zu bieten, mit Pumpspeicherkraftwerken wie Nant de Drance im Wallis. Damit können wir mithelfen, das Stromnetz auf dem Kontinent zu stabilisieren. Im Sommer exportiert die Schweiz Strom, im Winter sind wir auf Importe angewiesen. Deshalb ist eine enge Zusammenarbeit mit Europa, mit unseren Nachbarn, sinnvoll.
Um die Energiewende zu schaffen, will man im Wallis mit einem Pionierprojekt vorangehen und ein ganzes Tal mit Solarpanels zudecken. Was halten Sie davon?
Wenn es gute Projekte für Solaranlagen in den Bergen gibt, bin ich dafür sehr offen; als Ergänzung zum Ausbau auf den Dächern. Wir brauchen mehr Strom – und wir müssen dort, wo es sinnvoll ist, auch den Ausbau der Wasserkraft vorantreiben.
Sie sprechen den runden Tisch an, an dem sich Branche und Politik auf 15 Wasserkraft-Projekte geeinigt haben. Allerdings wollen kleinere Umweltschutzorganisationen ihren Widerstand gegen höhere Staumauern aufrecht erhalten. Haben Sie es verpasst, alle relevanten Akteure mit einzubeziehen?
Die wichtigen Akteure waren alle dabei: WWF, Pro Natura, der Fischereiverband, die Kantone, die Strombranche. Man kann nicht jeden einzelnen Verein einbinden.
Trotzdem: Was ist die Einigung wert, wenn es weiterhin Rekurse hagelt und die Projekte nicht vorankommen?
Der runde Tisch zur Wasserkraft war ein Erfolg. Das zeigt sich auch daran, dass Parlamentarier von links bis rechts die 15 Stausee-Projekte im Gesetz absichern wollen. Das unterstütze ich. Mein Eindruck ist, dass auch bei den Umweltorganisationen ein Umdenken stattfindet.
Woran machen Sie das fest?
Die Stiftung Landschaftsschutz, die am runden Tisch dabei war, aber die Einigung wegen eines der fünfzehn Projekte nicht unterschrieben hat, hat eben die Türe einen Spalt breit aufgestossen. Die Verantwortlichen sagen jetzt: Wir können womöglich eine Lösung finden. Sie sehen: Es geht vorwärts. Schreibt SonntagsBlick.
Es war zu erwarten, dass sich die Parteien bezüglich dem Schweizerischen Energiedebakel den Fehdehandschuh mit gegenseitigen Schuldzuweisungen via Presse zuwerfen werden. Stehen doch in einem Jahr die eidgenössischen Wahlen vor der Tür.
Dass der Schlamassel um die Energieversorgung Sprengkraft besitzt wie kaum ein Thema zuvor, ist allen Beteiligten aus dem Hohen Haus von und zu Bern jetzt schon klar. Wer will denn schon kampflos den Futtertrog der immerwährenden Versorgung verlassen?
Es ist zweifellos richtig, dass die bürgerlichen Parteien mit ihrer Mehrheit im Schweizer Parlament nicht unschuldig sind an der inzwischen unvorstellbaren Abhängigkeit von russischem Gas.
Zur Wahrheit gehört aber, dass alle anderen Parteien sich ebenfalls mit diesem «Klumpenrisiko» abgefunden haben. Mitgegangen mitgefangen. Das hat die Schweizer Wohlfühl-Konkordanz so an sich. Regieren und gleichzeitig Oppositionspolitik zu betreiben ist langfristig noch nie aufgegangen.
Der glorreiche Herr Blocher vom Herrliberg kann ein Lied davon singen. Er wurde ja als Besserwisser der Nation nicht umsonst als Bundesrat abgewählt.
Wären unsere glorreichen Volksvertreter*innen mit der unsäglichen Spreizwürde der Etablierten aus dem Bundeshaus CEOs einer börsenkotierten Firma, wären sie längst gefeuert worden. Selbstverständlich mit goldenem Fallschirm, wie das in diesen Kreisen so üblich ist.
Die eidgenössischen Wahlen 2023 würden durchaus die Möglichkeit bieten, diese Schönwetter-Parlamentarier*innen abzuwählen. Doch wo sind die Alternativen? Nirgendwo.
Wetten, dass alles so bleibt wie es ist und «der Stärkere weiterhin den Schwachen besiegen wird», wie König Artus gesagt haben soll?
-
13.8.2022 - Tag einer Steinzeitreligion - called Islam
Autor Salman Rushdie bei Event im Bundesstaat New York niedergestochen
Der britisch-indische Autor Salman Rushdie wurde bei einem Auftritt im US-Bundesstaat New York am Freitag angegriffen und schwer verletzt. Der 75-Jährige war im Begriff, einen Vortrag zu halten, als ein Mann auf die Bühne der Chautauqua Institution lief und Rushdie und den Interviewer attackierte. Rushdie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert und wurde dort seinem Sprecher zufolge Freitagabend operiert.
Seinem Manager zufolge wurde Rushdie an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er könne nicht sprechen und werde wahrscheinlich ein Auge verlieren, schrieb Andrew Wylie nach Angaben der "New York Times". Nervenstränge in seinem Arm seien durchtrennt und seine Leber beschädigt worden. "Die Nachrichten sind nicht gut."
Angreifer festgenommen
Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Die Polizei identifizierte ihn später als Hadi M., einen 24-jährigen Mann aus New Jersey. Er hatte eine Eintrittskarte für die Veranstaltung mit Rushdie, sein Motiv ist unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er wohl keine Komplizen. "An diesem Punkt gehen wir davon aus, dass er allein war, aber wir versuchen sicherzustellen, dass dies der Fall war", sagte Polizeisprecher James O'Callaghan. Am Tatort sei ein Rucksack sichergestellt worden.
Nach Darstellung der Polizei stürmte der junge Mann die Bühne der von Hunderten Menschen besuchten Veranstaltung gegen 11 Uhr örtlicher Zeit (17 Uhr MESZ) und stach auf Rushdie ein. "Mehrere Mitarbeiter der Veranstaltung und Zuschauer stürzten auf den Verdächtigen und brachten ihn zu Boden", sagte ein Sprecher. Ein Polizist habe den 24-Jährigen festgenommen. Unterdessen wurde Rushdie von einem Arzt aus dem Publikum behandelt bis Rettungskräfte eintrafen.
Ein Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, der Angreifer habe 10 bis 15 Mal auf Rushdie eingeschlagen oder gestochen. Der ebenfalls angegriffene Interviewer erlitt nach Polizeiangaben eine Kopfverletzung.
Vor wenigen Tagen noch hatte Rushdie dem Magazin "Stern" gesagt, dass er sich in den USA sicher fühle. "Das ist lange her", sagte Rushdie im Interview mit Korrespondent Raphael Geiger Ende Juli auf die Frage, ob er noch immer um sein Leben bange. "Für einige Jahre war es ernst", sagte Rushdie weiter. "Aber seit ich in Amerika lebe, hatte ich keine Probleme mehr." Der Autor habe dabei aber auch vor dem politischen Klima und möglicher Gewalt in den USA gewarnt: Das Schlimme sei, "dass Morddrohungen alltäglich geworden sind".
Rushdie 1988 mit Fatwa belegt
Geboren wurde Rushdie im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King's College in Cambridge. Seinen Durchbruch als Autor feierte er mit dem Buch "Mitternachtskinder" ("Midnight's Children"), das 1981 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde. 1992 wurde Rushdie mit dem Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur ausgezeichnet.
Gegen den Schriftsteller wurde 1988 wegen seines Buches "Satanische Verse" eine Fatwa ausgesprochen, in der zu seiner Tötung aufgefordert wurde. Begründet wurde das Urteil vom damaligen iranischen Staatschef Ayatollah Khomenei mit der Ansicht, das Buch sei "gegen den Islam, den Propheten und den Koran". Das Buch wurde in zahlreichen Ländern verboten. Rushdie musste untertauchen und erhielt Polizeischutz. Ein japanischer Übersetzer seines Buches wurde später tatsächlich getötet. Ob der heutige Vorfall damit in Verbindung steht, ist bisher nicht bestätigt.
1989 brachen Großbritannien und der Iran ihre diplomatischen Beziehungen wegen der Causa ab. 2010 wurde eine Liste mit Anschlagszielen der Terrororganisation Al-Kaida veröffentlicht, auf der auch Rushdies Name zu finden war.
Nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hätte die Fatwa des Ayatollahs für Rushdie inzwischen aber längst keine Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr. Die iranische Führung war auch später von der Fatwa abgerückt.
Die Jahre des Versteckens gingen jedoch nicht spurlos an Rushdie vorüber. Er verarbeitete diese Zeit in der nach seinem Aliasnamen benannten Autobiografie "Joseph Anton" aus dem Jahr 2012.
Schumer: "Schockierender Angriff"
Die Tat löste weltweit Entsetzen aus. Die USA und die Welt seien Zeugen eines "verwerflichen Angriffs" geworden, erklärte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am späten Freitagabend (Ortszeit). "Diese Gewalttat ist entsetzlich." Die gesamte US-Regierung bete für eine schnelle Genesung des 75-Jährigen. Sullivan dankte außerdem den Bürgern und Einsatzkräften, die Rushdie "nach dem Angriff so schnell geholfen" hätten.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb, Rushdie sei von "Hass und Barbarei" getroffen worden. Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich "entsetzt".
Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling und Bestseller-Autor Stephen King drückten ebenfalls ihre Bestürzung aus und schrieben, sie hofften, es gehe Rushdie gut. Der US-amerikanische Autorenverband PEN America zeigte sich schockiert über den Angriff auf seinen ehemaligen Präsidenten. Rushdie werde seit Jahrzehnten wegen seiner Worte angegriffen, aber er habe sich nie beirren lassen und nie gezögert, schrieb die Vorsitzende Suzanne Nossel in einem Statement.
Rushdie: "Die Wahrheit ist ein Kampf"
Insgesamt veröffentlichte Rushdie mehr als zwei Dutzend Romane, Sachbücher und andere Schriften. Rushdies Stil wird als Magischer Realismus bezeichnet, in dem sich realistische mit fantastischen Ereignissen verweben. Dennoch sieht er sich unbedingt der Wahrheit verpflichtet. Diese sieht er zunehmend in Gefahr, was auch im Zentrum seiner jüngsten Veröffentlichung von Essays steht, die in Deutschland unter dem Titel "Sprachen der Wahrheit" herauskamen.
Der seit vielen Jahren in New York lebende Schriftsteller stemmt sich darin gegen Trumpisten und Corona-Leugner. "Die Wahrheit ist ein Kampf, das ist keine Frage. Und vielleicht noch nie so sehr wie jetzt", sagte er in einem Interview des US-Senders PBS im vergangenen Jahr. Schreibt DER STANDARD.
Das Leben vergisst viele Menschen, die islamische Fatwa keinen. Allahu akbar.
-
12.8.2022 - Tag des Orgasmus im kommenden Winter
ES IST NIE ZU SPÄT FÜR GUTEN SEX: Kommen Frauen schwieriger zum Orgasmus?
Womit wir schon mitten im Thema sind. Solange sich unsere Vorstellungen von Sexualität stark auf Geschlechtsverkehr und einen raschen Orgasmus, seine Ejakulation fokussieren, hängen wir in heteronormativen Mustern. Für weibliche Lust und Orgasmen braucht es mehr: Wissen, Neugierde, oft Entspannung, Ehrlichkeit, manchmal Zeit, Hingabe, vielleicht auch einmal wieder liebevollen Forschergeist.
Frauen kommen nicht schwieriger zum Orgasmus
Man(n) muss einfach nur wissen, wie. Warum gibt es hier bisher so einen Unterschied? Weil "echter Sex" zu oft mit dem Eindringen des Penis in die Vagina verbunden wird? Für viele Menschen ist Sex untrennbar mit Geschlechtsverkehr verbunden. Weil lustvolle Sexualität, die erregende Freude macht, oft als "Vorspiel" abgetan wird und somit einen ganz anderen Stellenwert als der reine Geschlechtsverkehr bekommt?
Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 der Chapman University in den USA haben 95 Prozent der heterosexuellen Männer Orgasmen im sexuellen Spiel mit Frauen, ähnlich viele durch Solosex, also Selbstbefriedigung. Wie das bei Frauen ist? 91 Prozent der Frauen genießen Orgasmen bei Solosex, 86 Prozent der Frauen bei Sex mit Frauen, aber nur 65 Prozent der Frauen beim Sex mit Männern. Warum diese Unterschiede, dieser Gap? Woran liegt es? An der ewig lange unterdrückten Lust der Frauen, die zu oft abgewertet wurde? Weil die weibliche Lust nicht zur Fortpflanzung nötig ist? Daran, dass viele Frauen lieber Orgasmen vorspielen, weil sie tendenziell mehr Zeit zu Höhepunkten brauchen als Männer? An Männern, die nicht wissen, wie Frauen lustvoll befriedigt werden wollen, ja, auch die gibt es, oder Männer, die glauben, es ist eh alles paletti?
Was wir im Biologieunterricht nicht gelernt haben
Die Klitoris ist das einzige menschliche Organ, das ausschließlich dem Lustgewinn dient. Sie ist viel größer als diese kleine Perle, die wir sehen können und an der so gerne gerubbelt wird. An dieser Klitorisspitze kommen übrigens rund 8.000 Nervenenden zusammen. Zum Vergleich: In der Eichel, dem anatomischen männlichen Pendant, sind es rund halb so viele Nervenenden.
Diese Perle, auch Klitorisköpfchen genannt, ist also hoch empfindsam, und manchmal ist hier weniger deutlich mehr. Was wir nicht sehen: Unter den Vulvalippen verlaufen die empfindsamen Klitorisschenkel, die bisher oft vernachlässigt werden, weil sie ja auch selten bis nie abgebildet werden. Diese Klitorisschenkel gab es dennoch immer schon. Sie umschließen auch die Vagina und strecken sich Richtung Anus, sie sind mit dem Beckenboden im wahrsten Sinne des Wortes gut vernetzt und schwellen bei Erregung an, die Durchblutung läuft auf Hochtouren. Weshalb es auch hoch erotisch sein kann, am Po oder unteren Rücken oder an den oberen Innenseiten der Oberschenkel berührt zu werden. Weibliche Orgasmen können vielfältig ausgelöst werden, die Klitoris ist bei den meisten Frauen fast immer, in welcher Art auch immer, involviert. Übrigens, die Stimulation der G-Zone, einer leicht angerauten Fläche in der Vagina, wenige Zentimeter nach deren Eingang an der zum Nabel hingewandten Seite, ist für viele Frauen auch sehr lustvoll.
Weibliche Anatomie "neu" entdecken
Wird also die weibliche Anatomie bisher nicht ausreichend verstanden? Erliegen wir noch zu männlichen Sichtweisen auf die Sexualität? Wir beginnen ja gerade erst ganz neu, die weiblichen Geschlechtsteile mitsamt der gesamten Klitoris korrekt darzustellen. Entsprechendes Wissen ist noch nicht überall selbstverständlich. Sehr viele Frauen kommen eben nicht durch Geschlechtsverkehr, einen raschen Kuss und dann Penetration, sondern durch die Stimulation der Klitoris zu Orgasmen. Das mit dem Klitorisköpfchen ist ja heute vielen aufgeklärten Menschen bekannt und lässt auch die Vibratorenbranche im wahrsten Wortsinn brummen.
Lasst uns den Orgasmus-Gap schließen
Doch wie gelingen mehr orgiastische Höhepunkte beim Sex zwischen Frauen und Männern? Gemeinsam. Guter Sex ist der, der uns selbst guttut und in dem wir einander in unserer Erregung gut spüren. Zu viele Frauen, das erlebe ich sehr häufig, nehmen ihre Bedürfnisse zurück, damit "er" kommt. Eh schön und lieb, aber hallo: Bringen wir Frauen uns doch deutlicher ins erotische, sexuelle Spiel!
Es braucht einerseits den Wunsch und Willen, ja auch Mut und Selbstverständnis von Frauen, ihre Bedürfnisse deutlicher selbst wahrzunehmen und zeigen zu können. Und ja, dann dauert es eben auch einmal länger. Spielen wir doch bitte keine Orgasmen mehr vor!
Es braucht dann Männer, die "die Neuentdeckung der Sexualität" mit ihren Frauen als Lustgewinn erleben wollen und selbstbewusst genug sind, bisher angelernte Verhaltensweisen zu verändern. Ja, es darf die eigene "Komfortzone der Sprachlosigkeit" gedehnt und verlassen werden. Was auch noch hilfreich sein kann: Wissen, dass viele Frauen Zärtlichkeiten, Berührungen und entspannte Zeit genießen. Braucht es eben in der "Erneuerungsphase" Geduld, Forschergeist und gemeinsames Probieren.
Wollen wir nicht alle mehr glückselige Momente der Ekstase, ja, auch der Orgasmen? Dann schauen wir doch nach vorn und entdecken wir einander und uns selbst liebe- und lustvoll wieder. Schreibt Nicole Siller im STANDARD.
Sie werden sich jetzt sicher fragen, warum der Alte ausgerechnet diesen Artikel um Fragen über den Orgasmus der Frau aus dem Sammelsurium der bunt gemischten Sommerlochartikel fischt?
Diese Frage zu beantworten ist einfach. Wir erleben derzeit einen prächtigen Sommer. Allerdings wird viel über die «unerträgliche Hitze» gejammert. Doch schon bald werden wir uns nach ebendiesem Sommer mit seinen heissen Tagen zurücksehnen.
Die kalten Monate stehen Frost bei Fuss vor der Tür und mit ihnen die Energiekriese. Heizungen müssen mit grosser Wahrscheinlichkeit auf das absolute Minimum heruntergefahren werden.
Da wird uns nicht viel anderes übrig bleiben, als in den kalten Nächten gegenseitig zusammenzukuscheln. Was verdrängt Bibbern, Zähneklappern und triste Gedanken an die explodierenden Heizkosten besser als ein Orgasmus? Nichts!
Sollte es trotz den Ratschlägen der Expertin mit dem Orgasmus schieflaufen, stöhnen Sie trotzdem. Denn zum Stöhnen gibt es im kommenden Winter mehr als genügend Gründe. Believe me, babe!
-
11.8.2022 - Tag des unglübigen Thomas und seinen Stromverbrauch
Disney schliesst im Streaming-Geschäft zu Netflix auf
Walt Disney hat im jüngsten Geschäftsquartal rasantes Wachstum mit seinen Streaming-Diensten verzeichnet. Die On-Demand-Services Disney+, Hulu und ESPN+ brachten es Ende Juni zusammen auf insgesamt rund 221 Millionen Abos. Damit hat Disney zum bisherigen Streaming-Marktführer Netflix aufgeschlossen, der zuletzt Kunden verlor und das vergangene Vierteljahr ebenfalls mit rund 221 Millionen Nutzerkonten beendete.
«Wir hatten ein exzellentes Quartal», verkündete Disney-Chef Bob Chapek bei der Bilanzvorlage. Vor allem Disney+ und ESPN+ florierten mit jährlichen Wachstumsraten von 31 beziehungsweise 53 Prozent auf nun gut 152 Millionen beziehungsweise knapp 23 Millionen Abonnenten.
Dennoch musste das Unternehmen seine Abonnentenprognose für Disney+ senken. Die Gesamtzahl der Disney+-Kunden werde bis Ende September 2024 zwischen 215 Millionen und 245 Millionen liegen, teilte Disney mit. Das ist ein Rückgang gegenüber den 230 Millionen bis 260 Millionen, die Disney zuvor prognostiziert hatte.
Grund für die reduzierten Erwartungen sei der Verlust der Streaming-Rechte für die Kricketspiele der Indian Premier League. Die Streaming-Einheit halte aber weiterhin daran fest, im Geschäftsjahr 2024 erstmals einen Gewinn zu erwirtschaften, sagte Finanzchefin Christine McCarthy.
Preiserhöhung und Angebotserweiterung
Der erst im November 2019 als Netflix-Jäger gestartete Streaming-Service Disney+ gewann in drei Monaten 14.4 Millionen Kunden hinzu – deutlich mehr als von Experten erwartet.
Mit der «Star Wars»-Serie «Obi-Wan Kenobi» und Marvels «Ms. Marvel» landete Disney+ zwei grosse Hits. Die starke Nachfrage nach den Streaming-Diensten nutzte Disney sogleich, um kräftige Preiserhöhungen einzuleiten. So soll der Preis für das werbefreie Standardabo bei Disney+ für Kunden in den USA am 8. Dezember um 3 Dollar auf 10.99 Dollar pro Monat steigen.
Dafür will Disney aber – wie auch Netflix – eine günstigere Variante mit Werbepausen einführen. Dieses Angebot soll monatlich 7.99 Dollar kosten – so viel wie bislang das werbefreie Abo. Bei Hulu geht der Preis je nach Abomodell um ein bis zwei Dollar pro Monat hoch. ESPN+ hatte auch erst kürzlich eine Preiserhöhung in den USA angekündigt.
Auch finanziell lief es gut für das Entertainment-Imperium, zu dem auch noch die klassische Kabelsparte sowie Filmstudios, Themenparks, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffe gehören. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 21.5 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg um 53 Prozent auf 1.4 Milliarden Dollar (1.32 Milliarden Schweizer Franken).
Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Kursanstieg von über vier Prozent. An der Wall Street hatte Disney es zuletzt schwer – die Aktie liegt seit Jahresbeginn mit 28 Prozent im Minus. Schreibt SRF.
Der wirtschaftliche Erfolg sei Disney gegönnt. Aber frei nach Inspektor Colombo hätt' ich da noch eine Frage, Sir: Sind sich die Streamingdienste-Nutzer*innen bewusst, wieviel Strom sie verbrauchen?
Einfach mal so, und sei's auch nur um kurz nachzudenken: In der Schweiz beträgt der durchschnittliche Stromverbrauch eines Haushalts pro Jahr 4500 Kilowattstunden, oder 4,5 Megawattstunden (Stand 2020). Das heisst, mit dem allein bei Netflix für das Video-Streaming (2020) verbrauchten Strom liessen sich 100'000 Haushalte ein ganzes Jahr lang versorgen. Und jetzt nehmen Sie noch alle anderen Streamingdienste wie Disney, YouTube und wie sie alle heissen hinzu. Bis hin zu WhatsApp, Pornoportalen, Clouds und weiss der Teufel was alles. Schätzungsweise 80 Prozent des Datenverkehrs weltweit wird mittlerweile von Streamingdiensten generiert.
Mit dem ungläubigen Thomas musste sich selbst Jesus herumschlagen. Warum sollte es mir, der ich ja nicht einmal barfuss über den Vierwaldstättersee laufen kann, besser ergehen? Wer Zweifel hegt, kann selbstverständlich den Luzerner Nationalrat Franz Grüter fragen, wieviel Strom allein das von seiner Firma «Green» (Telefon +41 56 460 23 23) betriebene Google-Datacenter in Lupfig pro Tag (und Nacht) verbraucht. Was bei Ihnen vermutlich ein Staunen mit offenem Mund auslösen würde, freut die Aargauer AKWs, bei denen die Green AG ein Key-Client sein dürfte.
By the way: Was ist da nur mit Grüters Augenfarbe passiert? Sollte ihm das «Sünneli» nicht mehr passen, wäre die Farbe Grün sicher die bessere Wahl. Dieses Blau in Blau sieht ja aus, als ob er den Dresscode der FDP kopiert. Oder Graf Dracula.

-
10.8.2022 - Tag der Ultra-Neoliberalen Schnappatmungen und Schweissausbrüche
Soziologe aus Moskau über Russland im Krieg: «Putins System steht unter Druck»
Der Moskauer Soziologe Greg Judin* ist überzeugt: Mit Kriegsbeginn hat in Russlands Gesellschaft ein Umsturz stattgefunden. Mit welchem Ausgang?
taz: Herr Judin, trägt die russische Gesellschaft eine Mitverantwortung für Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine?
Greg Judin: Um mit Hannah Arendt zu sprechen: Kraft dessen, dass jeder Mensch einer politischen Gemeinschaft angehört, trägt er für diese auch Verantwortung. Davon kann sich niemand freimachen.
Aber offensichtlich passiert genau das in Russland …
Laut Arendt gibt es Situationen im Leben, in denen es sich nicht lohnt, für den Frieden zu kämpfen. Doch jeder muss sich darüber klar werden, wofür er oder sie in einer bestimmten Situation die Verantwortung trägt. Hier kann man zwei Dinge tun: Position beziehen, selbst wenn das etwas kostet. Und in Russland kann das der Fall sein. Das Zweite ist, darüber nachzudenken, was ich in dieser Situation tun kann. Was hängt jetzt von mir ab? Das muss man sich selbst abverlangen.
Sie haben wiederholt von einer Atomisierung der russischen Gesellschaft gesprochen. Was bedeutet das genau?
Atomisierung ist die Zerstörung von Solidarität, jeder sieht sich nur als Individuum. Russland ist eines der Länder, in dem die Menschen am wenigsten Vertrauen haben. Diese Atomisierung hat schon früher eingesetzt, jedoch hat Wladimir Putin jetzt angefangen, diese Politik auch als strategisches Mittel einzusetzen.
Mit welchem Ziel?
Wenn jeder für sich ist, macht es das Regieren für ein totalitäres Regime leichter. Das heißt: Jede kollektive Aktion blockieren oder den Glauben daran, dass Menschen gemeinsame Interessen haben.
In einem Beitrag zum 9. Mai haben Sie von einem neuen russischen Faschismus gesprochen.
Unter Faschismus verstehe ich die klassische Triade Führer, Staat und Volk, die sich alle miteinander identifizieren. Faschismus, das ist ein totaler Staat, der mit dem Führer und der Gesellschaft eins ist. Du kannst nicht innerhalb der Gesellschaft sein, wenn du kein Teil des Staates bist. Wenn du gegen den Staat bist, bist du gezwungen, die Gesellschaft zu verlassen. Du bist ein Fremder, ein Verräter, ein Feind. Und du musst den Führer unterstützen. In Russland gab es diese Tendenzen schon früher, doch mit dem 24. Februar hat ein Umsturz stattgefunden. Er hat die Kluft zwischen Staat und Gesellschaft verschwinden lassen.
Jeder Faschismus setzt eine Mobilisierung voraus. Bislang gründete Putins Regime auf einer Depolitisierung und Demobilisierung. Eine passive demobilisierte Masse ist das ideale Material für eine Mobilisierung. Warum? Weil zwischen den Menschen keine horizontalen Verbindungen bestehen. Doch das ändert sich jetzt. Der Faschismus ist eine Bewegung und eben mehr als eine Einheit zwischen Führer, Nation und Staat. Wenn wir verstehen wollen, was weiter passieren wird, müssen wir uns nicht nur auf das Regime konzentrieren, sondern auf diese starke faschistische Bewegung, die eine Mission hat. Deshalb wird das alles nicht aufhören, solange diese Mission nicht erfüllt ist oder dieses Regime nicht verschwindet.
Sie unterrichten an der Moskauer School of Economics. Wie wirkt sich die gegenwärtige Entwicklung auf das akademische Leben aus?
Der Druck auf das Bildungssystem ist massiv gewachsen, es ist zu einem Propagandasystem geworden. Hunderte Lehrkräfte und Studierende an staatlichen Hochschulen wurden entlassen oder relegiert. Die, die mit dem Staat nicht einverstanden sind, werden als Verräter gebrandmarkt. Jeden Tag betrifft das Dutzende, ich bekomme entsprechende Nachrichten. Alle Rektoren sind jetzt loyal. Auf den unteren Ebenen werden Lehrkräfte entlassen und durch Leute mit Verbindungen zum Geheimdienst FSB ersetzt.
Was bedeutet das für die nächsten Generationen?
Die Lehrpläne wurden komplett geändert. Der Geschichtsunterricht wird als Bereich angesehen, um Putins Version der Geschichte zu vermitteln, die krank und verrückt ist. In den Schulen gibt es jetzt sogenannte Unterrichtsstunden des Mutes. Das ist eine Kombination aus Putins Ansichten zur Geschichte und militaristischer Propaganda. Das reicht von den Universitäten über die Schulen bis hin zu den Kindergärten. Studenten denunzieren ihre Professoren.
So etwas gab bis zum 24. Februar nicht. Das alles vollzieht sich in einer Atmosphäre der Angst. Die Machthaber wissen ganz genau, dass die Jugend ihre Schwachstelle ist und ihre Ziele nicht unterstützt. Und sie brauchen Kanonenfutter. Sie tun alles, damit die jungen Leute in die Krieg ziehen und bereit sind zu sterben.
Versteht der Westen überhaupt, was in Russland vorgeht?
Die Illusionen sind verflogen. Ein Grossteil der Eliten versteht, dass es keinen Weg zurück gibt. Dennoch gibt es keine strategischen Vorstellungen davon, wie mit Russland weiterverfahren werden soll.
Hat der Westen Fehler begangen?
Es gab Fehler, aber auch eine bewusst schädliche Politik des Westens. So, als ob alles gut gewesen sei, jetzt jedoch plötzlich in Russland ein sibirischer Bär aufgewacht sei. Das ist falsch. Wir haben übrigens jahrelang davor gewarnt, dass das alles so enden wird. Trotzdem hat sich nichts geändert. Im Jahr 2020 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Kremlkritiker Alexei Nawalny in der Charité besucht, jedoch gleichzeitig darauf bestanden, dass der Vertrag über die Pipeline Nord Stream II erfüllt werden müsse. Wie kann so etwas sein?
Haben Sie eine Antwort darauf?
Hier führt es nicht weiter, auf die Beziehungen zwischen einzelnen Staaten zu blicken – Russland und Deutschland oder die Ukraine und Russland. Hier geht es um das globale Kapital, das eng mit Putin verbunden ist und die ganze Welt im Griff hat. Gerhard Schröder, ist das ein russischer Bär, ein russischer Imperialist? Nein, das ist das zynische Kapital, das sich daran gewöhnt hat, alles kaufen zu können, und dass der Stärkere im Recht ist. Putin weiss das und hat darauf gesetzt. Opfer dieser Allianz gibt es überall. Das sind vor allem die Menschen in der Ukraine, die einfach getötet werden. Das gilt ebenfalls für die Menschen in Belarus, die massiven Repressionen ausgesetzt sind.
Doch auch die Russ*innen leiden darunter. Ich möchte nur daran erinnern, dass es auch in Russland unter Putin Aufstandsversuche gab. Diese endeten immer damit, dass Putin irgendeinen gigantischen Milliardenvertrag abgeschlossen hat. Nehmen wir die finnische Firma Nokia. Mittlerweile wissen wir, dass Nokia in Russland ein grosses Überwachungssystem aufgebaut hat, von dem klar war, dass Putin dieses System gegen seine Gegner einsetzen wird. Jetzt tritt Finnland der Nato bei. Wo ist da die Logik? Wenn sich das Kapital verselbstständigt und es unmöglich wird, es zu kontrollieren, dann ist das ein allgemeines Problem.
Welche Perspektiven sehen Sie?
Putins System steht unter Druck wie nie zuvor. Ich glaube, dass es in Russland zu einem Bürgerkrieg kommen wird: Zwischen ultrareaktionären imperialen Kräften, die das Land ins 19. Jahrhundert zurückführen wollen, und sogenannten republikanischen Kräften, die zum Beispiel Nawalny verkörpert. Diesen Konflikt sehen wir im gesamten postsowjetischen Raum, auch in der Ukraine. Dort gibt es ebenfalls Leute, vor allem im Osten, die zu einem Imperium zurück wollen. Sie sind jetzt weniger geworden, doch es gibt sie. Doch darüber wird nicht gerne geredet. Auch in Belarus gibt es dieses Phänomen, dort ist es jedoch einfacher. Ein ultrasowjetischer Präsident und eine republikanische Nation, die vor allem Gruppen junger Leute tragen.
Was Russland angeht, fehlt mir die Vorstellungskraft, ob es zu diesem Rückfall ins 19. Jahrhundert wirklich kommt. Doch wir sehen bereits, dass dieses Projekt darauf gründet, so viele Menschen wie möglich umzubringen. Alle diejenigen, die das Regime als seine Gegner ansieht. Welche Form dieser Konflikt annehmen wird, weiß ich nicht. Vielleicht Terror, ein Bürgerkrieg oder eine Revolution. Viel wird davon abhängen, wie der Krieg gegen die Ukraine endet.
Apropos Krieg gegen die Ukraine: Wie könnte ein künftiges Zusammenleben zwischen Ukrainer*innen und Russ*innen aussehen?
Russland muss anerkennen, dass dieser Krieg ein Verbrechen gegen den Nachbarn war. Das heisst, die Interessen der Ukraine zu ignorieren, sie als Eigentum zu betrachten und Fragen mit dem Einsatz von Gewalt versuchen zu lösen. Oder anders gesagt: Sinnvolle Gespräche können erst stattfinden, wenn sich Russland von der imperialistischen Idee verabschiedet und eine Republik wird. Dann werden die Ukrainer*innen verstehen, dass sie es mit jemandem anderen zu tun haben.
Das kann dauern. Was könnte in der Zwischenzeit getan werden? Nach Wegen für einen Dialog auf der Ebene der Zivilgesellschaft suchen?
Für einen Dialog sehe ich zurzeit nur bei konkreten Fragen eine Chance. Zum Beispiel, wenn Russ*innen in Europa ukrainische Geflüchtete unterstützen. Da kommt dann keiner auf die Idee, nach irgendeinem Pass zu fragen. Ich hoffe, dass es in absehbarer Zeit die Möglichkeit geben wird, über ernsthafte Fragen zu sprechen. Was passiert mit den umstrittenen Territorien? Bis auf Weiteres wird Putin den Krieg in der Ukraine nicht beenden, er ist fest entschlossen, dadurch seine Probleme in Europa zu lösen. Und dafür wird er so viele Menschen töten, wie er das für notwendig hält.
Wenn Russland zu der Erkenntnis kommt, dass die Freundschaft zwischen Russland und der Ukraine diesem barbarischen imperialistischen Projekt zum Opfer gefallen ist, könnten wieder pragmatische Beziehungen aufgebaut werden. Doch da müsste man die Ukrainer*innen fragen. Wenn sie das nicht wollen, könnte ich das auch verstehen. Schreibt TAZ**.
Die taz (Tages-Anzeiger) wird öfters als «linke» Zeitung bezeichnet, was ein absoluter Blödsinn ist. Diese Falscheinschätzung ist im Wesentlichen auf die Reflexbewegungen der Ultra-Neoliberalen zurückzuführen, bei denen jedes Medium, das nicht ausschliesslich der westlichen Konzernpolitik der Mächtigen und Reichen folgt, Schnappatmungen und Schweissausbrüche auslöst. Glaubt man diesen Apologeten der reinen Lehre des Marktes, die alles regelt, steht der Untergang des Abendlandes inklusive Reaktivierung des Kommunismus kurz bevor.
Wer wirklich eine «linke» Zeitung im wahrsten Sinne des Wortes sucht, findet sie. Die «junge Welt», ein Wurmfortsatz der DKP (Deutsche Kommunistische Partei), ist diesem Spektrum zuzuordnen.
Zurück zum Artikel: Während in der Schweiz beispielsweise «Blick» im «Ukraine-Liveticker» beinahe im Tagesrhythmus ständig eine neue Krankheit oder neue Geliebte Vladimir Putins aus dem Hut zaubert, führt eine kluge Journalistin der taz ein Interview mit dem russischen Soziologen und Politikwissenschaftler Greg Judin, der an der Moscow School for the Social and Economic Sciences unterrichtet. Man darf davon ausgehen, dass dieser Mann vor Ort einen besseren Durchblick auf Putin und die russische Gesellschaft hat, als die Glaskugel-«Journalisten» etlicher hochangesehener Medien.
Deshalb empfehle ich diesen taz-Artikel, ohne ihn zu kommentieren. Es lohnt sich, ihn bis zur letzten Zeile zu lesen. Gibt er doch Hinweise darauf, wer uns über Dekaden hinweg in die Bredouille geritten hat, in der wir heute stecken.
* GREG JUDIN : 1983 bei Moskau geboren. Lehrt als Soziologe und Politikwissenschaftler an der Moscow School for the Social and Economic Sciences und schreibt Kolumnen in der Zeitung Wedomosti.
** Das Interview führte BARBARA OERTEL. Ressortleiterin Ausland der taz. Geboren 1964, ist seit 1995 Osteuropa-Redakteurin der taz und seit 2011 eine der beiden Chefs der Auslandsredaktion. Sie hat Slawistik und Politikwissenschaft in Hamburg, Paris und St. Petersburg sowie Medien und interkulturelle Kommunikation in Frankfurt/Oder und Sofia studiert. Sie schreibt hin und wieder für das Journal von amnesty international. Bislang meidet sie Facebook und Twitter und weiss auch warum.
-
9.8.2022 - Tag der Stromspeicher
Wie viele Windräder (moderne, eher grosse) braucht es, um ein österreichisches, grösseres Gaskraftwerk zu ersetzen, in Jahresleistung gerechnet?
Das Gaskraftwerk Mellach, eines der größeren Kraftwerke in Österreich, hat einen sogenannten Volllaststundenwert von 2.000 bis 3.000 Stunden pro Jahr – wobei der letztere Wert schon die obere Grenze bildet. Das heißt, dass das Kraftwerk jährlich 2.000 bis 3.000 Stunden "auf Anschlag" laufen müsste, um die 1,7 bis 2,5 Terawattstunden Strom zu produzieren, die Mellach jährlich ins Netz einspeist. In Wirklichkeit läuft das Kraftwerk natürlich oft auf Sparflamme – die Volllaststunden sind ein theoretischer Wert, um die Auslastung eines Kraftwerks zu messen.
Ein modernes Windrad kommt laut IG Windkraft auf 2.600 bis 3.000 Volllaststunden und zwischen fünf und sechs Megawatt Nennleistung. Im Mittel erzeugt ein solches Windrad 15 Millionen Kilowattstunden Strom (0,015 Terawattstunden) pro Jahr. Es bräuchte also 166 Windräder, um eine Jahresleistung von 2,5 Terawattstunden zu ersetzen. Bei einer Kraftwerksleistung von 1,7 Terawattstunden bräuchte man entsprechend 111 Windräder.
Wie viele Dächer (in Quadrametern) müssten für dasselbe in Photovoltaik bestückt werden?
Eine Umlegung ist laut dem Branchenverband Photovoltaik Austria schwierig und maximal theoretisch möglich. Dennoch seien circa 5,1 Quadratmeter – das entspricht etwa drei Modulen – Photovoltaik erforderlich, um 1.000 Kilowattstunden bzw. eine Megawattstunde Strom pro Jahr zu erzeugen.
Das Gaskraftwerk Mellach hat wie beschrieben eine Jahresleistung von 2,5 Terawattstunden, also 2.500.000 Megawattstunden. Multipliziert man diese Zahl mit 5,1 Quadratmetern erhält man eine Fläche von 12,75 Quadratkilometern. Im Vergleich: Der Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt hat eine Fläche von rund 19 Quadratkilometern.
Bei einer Kraftwerksleistung von 1,7 Terawattstunden pro Jahr wäre entsprechend eine Fläche von rund 8,6 Quadratkilometern nötig. Das entspricht der Fläche des Wiener Bezirks Ottakring. Würde es also reichen, sämtliche Häuser des 16. Bezirks mit Solardächern auszustatten, um Mellach abschalten zu können? Nein, denn die 8,6 Quadratkilometer beziehen sich nur auf die Dachfläche – und Ottakring besteht auch aus Straßen, Gärten und Parks, die sich nicht mit Solarmodulen bestücken lassen.
Bei Freiflächenanlagen ist der Platzbedarf laut dem Verband um einiges größer. Das liegt am auftretenden Schatten und dem Abstand zwischen den Modulreihen, der in der Freifläche größer sein muss.
Wie ist das mit der Kombi aus Photovoltaik (PV) und Sonnenkollektoren für Warmwassergewinnung? Wäre das nicht eine tolle Sache, gerade für kleinere Anlagen?
Laut dem Branchenverband Photovoltaik Austria ist die Kombination denkbar. Es sei aber eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Denn: Sich zwei unterschiedliche Energiesysteme zuzulegen ist kostenintensiv und wird praktisch nicht angewandt. Das liegt auch daran, dass Photovoltaik in den letzten Jahren günstiger und effizienter geworden ist. Die örtlichen Gegebenheiten und der Bedarf der Anwenderinnen und Anwender beeinflussen die Wahl des Systems zusätzlich.
Laut Grundnig sei die Energieversorgung der Zukunft komplett anders zu denken, als wir es aktuell kennen. Außer der Energiespeicherung stellen sich viele Fragen. Ein Stromversorgungssystem, das zu 100 Prozent aus Erneuerbaren und damit zu einem guten Teil aus volatilen Quellen bestehe, bedarf laut Grundnig etwa einen guten Mix aus allen verfügbaren Technologien (Wind, Sonne, Wasse, Biogene), die saisonale Schwankungen untereinander ausgleichen. Zudem brauche es so viel erneuerbare Stromerzeugungsanlagen wie möglich, um Flauten zu reduzieren und Überschüsse zu schaffen. Diese Überschüsse könnten mittels Elektrolyse als Wasserstoff zeitlich verlagert werden und so zu einem Ausgleich beitragen.
Nicht zuletzt seien Flexibilitäten im Gesamtsystem zu nutzen – nicht nur bei Erzeugern, sondern auch bei den Verbrauchern. Dazu gehören etwa kleine Speichereinheiten bei Haushalten, die mit Photovoltaik kombiniert werden oder bidirektional ladefähige E-Autos, die sich auch als Speicher nutzen lassen. Schreibt Florian Koch in DER STANDARD.
Was sagt uns dieser «Faktencheck» aus Österreich? Der Wechsel von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien ist viel komplexer als uns jeweils von den Politikern*innen vor dem Gang an die Wahlurnen weisgemacht wird. Auf substanzielle Fragen wie beispielsweise «Stromspeicher» haben im Gegensatz zu den Politikern*innen selbst ausgewiesene Klima-Experten (noch) keine Antworten jenseits des Konjunktivs.
Erst im Nachhinein wird klar, mit welcher Chuzpe ausgerechnet die Parteipräsidentin der ultra-neoliberalen FDP, Greta «Petra» Gössi, den Parteitag vor den eidgenössischen Wahlen 2019 mit einer Kehrtwende hin zum Klimaschutz überrumpelte. Ausgerechnet die Partei, die vorher sämtliche Abstimmungen zum Klimaschutz im Parlament ausnahmslos mit Ablehnung torpediert hatte.
Doch weil den Grünen Parteien der Schweiz im Vorfeld der Wahlen bei den Umfragen immer höhere Zustimmungswerte attestiert wurden, schluckte der FDP-Parteitag die bittere Pille. Wohlwissend, dass die Partei damit ausgerechnet ihre Klientel aus dem neoliberalen Lager vergraulte. Einige der Industrie- und Wirtschafts-Mogule strichen (oder kürzten) denn auch ihre üppigen Parteispenden aus lauter Zorn.
Ein solcher Fall ist mir persönlich sogar zugespielt worden: Ein Industrieller orientierte den Präsidenten eines regionalen Ablegers der FDP via E-Mail darüber, dass er seinen jährlichen Unterstützungsbetrag von 10'000 Franken ab sofort einstelle.
Gössi wurde denn auch nach dem Parteitag von einigen FDP-Granden wie Nationalrat Christian Wasserfallen für ihre Wendehalspolitik heftig attackiert. Gössi hausierte ihrerseits mit dem Argument, ohne Wandel der Partei hin zu den Klimathemen würde die Partei massiv Stimmen an der Wahlurne verlieren.
Was dann am Wahltag trotzdem passierte. Die FDP verlor vier Sitze im Parlament und Petra «Greta» Gössi kurz darauf ihr Amt als Parteipräsidentin. Das gleiche Schicksal ereilte auch SVP-Präsident Albert Rösti. Dessen Partei büsste gar 12 Parlamentssitze ein. Den Klimawandel zu leugnen lohnte sich für die SVP ebenso wenig wie die Wendehalspolitik der FDP.
Ob die Grünen Parteien allerdings auch bei den kommenden Wahlen im Jahr 2023 weiterhin derart furios wie 2019 zulegen werden, ist ungewiss. Realisiert doch das Wahlvolk inzwischen, dass viele utopische, «grüne» Lösungsansätze und die damit verbundenen Wahlversprechen schlicht und einfach keinem seriösen Faktencheck standhalten. Exorbitante Preissteigerungen bei Strom, Gas und Erdöl werden ihr übriges dazu beitragen.
Dass an diesen Wucherpreisen nicht Putin allein verantwortlich ist, realisiert inzwischen nämlich auch die Bevölkerung. Entsprechend wird sie die Wahlfloskeln der Parteien unter die Lupe nehmen und die Kosten-/Nutzenfrage stellen. Hoffe ich jedenfalls.
Bekannterweise stirbt die Hoffnung zuletzt. Leider befürchte ich, dass all die Turbulenzen, denen wir derzeit ausgesetzt sind, der SVP mit ihrem angehängten Wurmfortsatz der Trychler und sonstigen Verschwörungs-Esoterikern*innen mehr helfen wird als den anderen Parteien.
-
8.8.2022 - Tag des Wokeismus und der alten weis(s)en Männer
René Scheu interviewt Adolf Muschg: «Wokeismus ist Rassismus»
Er ist einer der grossen Schweizer Schriftsteller: Adolf Muschg (88). Im Gespräch mit René Scheu redet er über seinen nahenden Tod, den Krieg in der Ukraine – und seine Probleme mit der Political Correctness.
Adolf Muschg zählt zu den letzten Grossen seiner Art. Der Dichter und Denker spricht auch mit 88 Jahren so furchtlos wie heiter über die Lage der Welt. Im Gespräch mit René Scheu in seiner Männedorfer Idylle äussert sich Muschg humorvoll zum nahenden Tod, zum möglichen Atomkrieg – und zur anödenden Humorlosigkeit der neuen Tugendterroristen.
Blick: Herr Muschg, Sie sind, es ist kaum zu glauben, 88 Jahre alt. Wenn Sie an Ihr potenzielles Ende denken, sind Sie dann gelassener oder besorgter als noch vor zehn Jahren?
Adolf Muschg: Die Antwort darauf suche ich in meinem nächsten Buch. Mal sehen, was der nahe Tod mit meiner Sprache macht.
Sie schreiben bis zuletzt, so viel ist also schon mal klar. Worum gehts im neuen Projekt?
Es hat mit einer Grabmiete angefangen – nicht einer fiktiven, sondern einer wirklichen, nämlich meiner. Das ist eine der wenigen Dispositionen über das Jenseits, die man schon im Diesseits treffen kann.
Sie wollen Ihr eigenes Ende nachempfinden, indem Sie es vorwegnehmen?
Eher folge ich einem bestimmten Toten ins Leben zurück, an den Punkt, wo es sich mit dem meinen berührt hat. Meine Erzählung geht von einer Begebenheit vor 75 Jahren aus, die jetzt erst richtig bei mir angekommen ist. Haben Sie Zeit?
Klar. Deshalb bin ich zu Ihnen nach Männedorf gekommen – Sie leihen mir Ihre kostbare Zeit, ich leihe Ihnen mein Ohr.
Also: Für meine japanische Frau würde es viel bedeuten, einen Platz in der fremden Erde auf sicher zu haben. Wir wohnen gewissermassen auf dem Lande; sie ist in Kyoto aufgewachsen, und es hat sie immer in die Stadt gezogen. Wir haben einen Platz gesucht, der für beide stimmt, und sind im Friedhof Enzenbühl fündig geworden. Er liegt an meinem ehemaligen Schulweg nach Zürich und wird auch von der Stadt verwaltet. Aber ein Stück davon dehnt sich auf den Boden von Zollikon aus. Hier wurde mein Vater als Lehrer eingebürgert und schrieb regelmässig für den «Zolliker Boten», hier habe ich meine Kindheit erlebt. Auf dem Boden dieses interkulturellen Kompromisses können wir allem weiteren doch mit Ruhe entgegensehen. Kennen Sie den Friedhof Enzenbühl?
Vage. Der Schriftsteller Urs Widmer ist da begraben, wenn ich mich richtig erinnere.
Und viele andere Freunde auch, zum Beispiel mein Psychoanalytiker Paul Parin und seine Frau Goldy. Aber auch ein vor hundert Jahren hoch gefeierter Schweizer Schriftsteller, Ernst Zahn, der heute fast vergessen ist. Wir entdeckten, dass sein umfangreiches Familiengrab dem von uns gewählten Plätzchen genau gegenüberliegt.
Ernst Zahn, das war doch ein ziemlich patriotischer Schriftsteller. Wie passt das zu Ihnen?
Die Nachbarschaft hat zweifellos ihre Ironie, denn mit grosser Heimatliteratur kann ich nicht dienen. Aber Ernst war der Sohn eines Wilhelm Zahn, des einstigen Inhabers des Café littéraire an der Storchengasse in Zürich. Später bewirtschaftete er das berühmte Bahnhofrestaurant Göschenen am Eingang des Gotthardtunnels, wo selbst Mäjestäten kurz abstiegen – weil die Dampfloks zum Nachfüllen von Kohle pausieren mussten. Sein Sohn, der besagte Ernst Zahn, führte das Buffet einige Jahre selbst, bevor ihm der literarische Erfolg ein Seegut in Meggen bei Luzern bescherte. Er behielt auch einen Sitz auf der Göscheneralp. Also begann ich, angesichts unserer kommenden Nachbarschaft, seine durchaus nicht gering zu schätzenden Werke zu lesen. Aber was mich ernsthafter beschäftigt, ist etwas anderes. Am Fuss des monumentalen Grabmals, ganz am Rande, entdeckte ich eine bescheidene Bronzeplatte mit einem Namen, der mich elektrisierte.
Jetzt wirds noch spannender. Welcher Name hat Ihre Fantasie beflügelt?
Robin P. Marchev.
Der Name sagt mir nichts.
Das war auch nicht zu erwarten. Ein Junge dieses Namens hat in der Evangelischen Lehranstalt in Schiers meine arme Seele gerettet – wo ich 1948/49 nach dem Tod meines Vaters die Genesung meiner psychisch erkrankten Mutter absitzen musste. Das damals frömmelnde Internat war eine wahre Strafe für ein pubertierendes Einzel- und Heimwehkind wie mich. Robin war schon älter, gehörte zu den sogenannten Selbstregenten und durfte in der Turnhalle Grillparzers Stück «Weh dem, der lügt!» inszenieren – für mich mehr als ein Lichtblick. Eine Erlösung!
Immer der Reihe nach – was genau hat Marchev mit den Zahns zu tun?
Seine Mutter war eine Tochter des Dichters. Sie hatte in Zürich den Arzt Dr. Marchev geheiratet, dessen jüdische Familie, aus Polen zugewandert, in Zürich getauft und wohlhabend wurde. Er war etwa Hausarzt des berühmten Hotels Baur au Lac. Nach der Scheidung der Eltern riss die Verbindung der Familien nicht ab. Robin behielt den Namen seines Vaters, als er bei seiner Mutter lebte, ohne materielle Sorgen, aber auch unbesorgt um die Regeln seines Zürcher Gymnasiums. So wurde er zur Besserung nach Schiers verschickt, das seinen Eigensinn auch nicht brechen konnte. Darum stand seine Ausweisung wieder kurz bevor, als er die Regie eines Schultheaters übernahm – eben des Lustspiels von Grillparzer, zu dem er seine eigene Musik lieferte, und er dirigierte sie auch selbst. Und als der Hauptdarsteller ausfiel, übernahm er dessen Rolle zusätzlich, und in jeder spielte er in einer eigenen Liga.
Sie erinnern sich an jedes Detail.
Ja, denn da ging mir eine andere Welt auf, in der ich atmen konnte und leben wollte. Dabei haben wir uns persönlich nie kennengelernt. Dass er damals nicht nur mich, sondern auch seine Matur gerettet hatte, dürfte ihn wenig gekümmert haben. Er wollte Komponist werden und wurde bei seinem Studienaufenthalt in Paris, wo er Sartre kennenlernte, bereits als grosse Hoffnung gehandelt. Sie sehen: Ich habe recherchiert – und damit erst angefangen. Je mehr ich über ihn weiss, desto mehr erfahre ich über mich selbst. Ich mache mich fein für unser erstes Rendez-vous im Enzenbühl. Es ist nie zu spät, einem grossen Bruder zu begegnen.
In Grillparzers Lustspiel geht es darum, dass Leon, ein junger Koch im Dienste des Bischofs zur Zeit der Merowinger, den Neffen ebendieses Bischofs aus den Fängen der bösen Germanen befreien soll. Und er darf nicht ein einziges Mal lügen, um sein Ziel zu erreichen.
Ja, nur geht es dann gar nicht anders. Um auch nur in die Nähe der Geisel in der germanischen Wildnis zu kommen, muss Leon bluffen, sich verstellen und übernehmen, zum Beispiel als Meisterkoch auftrumpfen – und dann alles, was er vorgibt, auch noch wahrmachen. Es ist ein Tanz auf dem hohen Seil, und als er sich in die Tochter des Burgherrn verliebt, muss er auch noch den Salto mortale lernen. Sein Trick ist: Die Wahrheit so faustdick aufzutischen, dass sie die Gegenspieler nur für gelogen halten können. Das ist eine Tour de Force der Vorstellungskraft, ein Triumph der Fantasie – und im Kern: der Humanität. Wenn diese ehrlich sein will, kann sie keine grade Linie fahren, sonst müsste die Erde platt sein, und der Mensch auch. Man lacht bei einem guten Lustspiel keine Tränen, aber man lernt unter Tränen lachen. Das war ungefähr das Gegenteil von allem, was wir im Internat lernen und beherzigen sollten.
Wer war dieser Marchev, was hat er bewegt – was hat ihn bewegt?
Das recherchiere ich eben. Seine Todesanzeige war unterschrieben von einem einzigen Freund – und als ich diesen im Tiefschnee des Appenzellerlandes heimsuchte, wurde er bald auch der meine. Ihm verdanke ich Robins Lebensdaten. Er war Pressechef des Lucerne Festival und Präsident des Schweizer Aero-Clubs. Als Kandidat für die Kurdirektion in St. Moritz wurde er hochgelobt, aber nicht genommen. Es gab auch – unter Pseudonym – einen Aufenthalt in einem israelischen Kibbuz. Die richtige Stelle fand er als Bruder und Meister der Freimaurerloge Libertas et Fraternitas. Sie wurde am Ende des Ersten Weltkriegs auf dem Monte Verità über Ascona von Künstlern gegründet und auf dem Zürcher Lindenhof von Bürgern fortgesetzt – nach dem zugleich ernsten und verspielten Regelwerk, das er für sie verfasst hat. Es hat viel mit Mozarts «Zauberflöte» zu tun – für seine Loge war Robin zugleich der Hohepriester Sarastro und der Spassmacher Papageno. Er hatte auch etwas von einem Zen-Meister – und nicht umsonst Altchinesisch gelernt. 2019 ist er in Zürich gestorben, immer noch Junggeselle, nicht auf Rosen gebettet, aber ein Mann der «Freiheit und Brüderlichkeit» bis zum letzten Atemzug.
Er ist sozusagen Ihr künftiger Grabes-Bruder. Ein Kreis schliesst sich. Sind Sie also mit Ihrem Leben versöhnt?
So weise – oder so einfältig – bin ich noch nicht. Ich bin Robin und mir noch eine Brudergeschichte schuldig. Real hat es sie nie gegeben – umso mehr werde ich daran noch einmal schreiben lernen müssen. Jetzt ist es an mir, sein Leben zu retten – für Leserinnen und Leser.
Sie sind ein Hypochonder, das ist gut dokumentiert. Die späte Begegnung mit Robin P. Marchev nimmt Ihnen nun die Angst vor dem Tod?
Schauen Sie: Solange der Wolf nicht da ist, hat man leicht «Wolf» rufen. Wenn er an der Tür kratzt, ändern sich die Umgangsformen – es wird buchstäblich lebenswichtig zu hören, was er dir zu sagen hat. Dann outet er sich als ein Stück von dir selbst, und Angst ist nicht mehr die passende Antwort darauf.
Sehr altersweise formuliert! Woher kamen früher diese Angstzustände, diese Gewissheit, an etwas Schlimmem erkrankt zu sein?
Ich hatte einen frommen Vater, der eine Hölle brauchte, um sich an seinem Gott festzuhalten. Schuldgefühle mussten ihm teuer sein, und das Böse heilig – wider Willen. Und in dieser Welt gab es auch keine Gnade für die eigene Schwäche. Er starb zu früh für eine reale Auseinandersetzung zwischen uns. Dafür erbte ich gewissermassen, was meiner Mutter gefehlt hatte. Warum musste sie in eine mehrjährige Depression fliehen, vor ihrer Ehe, aber auch vor mir? Da musste es etwas Unausgesprochenes geben, das ich bis in mein erwachsenes Leben weiterschleppte und für das ich den Freispruch der Ärzte brauchte: Ihnen fehlt nichts Ernstes! Eigentlich war das Gegenteil wahr, aber vorübergehend hat es geholfen, wie ein starkes Schmerzmittel. Was mir am meisten fehlte, war die nötige Heiterkeit mit meinen Defiziten. Dafür sitze ich jetzt bei Robin nach – mit 88 nicht zu früh.
Die Ärzte waren für Sie die Priester, die es im Protestantismus nicht gibt?
Ein Reformierter müsste lernen, sich selbst Absolution zu erteilen – das heisst: sich anzunehmen, wie er ist, ohne Zensuren, dafür mit Neugier, Fantasie und Humor. Die Frage, ob er dann noch ein guter Christ ist, darf er Gott überlassen. Eine schwierige Übung – ich fürchte, sie gelang mir bisher nicht immer.
Wenn wir miteinander telefonieren, sprechen wir jeweils kurz über Ihren Krebs. Täuscht mein Eindruck oder ertragen Sie ihn ziemlich stoisch?
Die Diagnose habe ich 2001 erhalten. Damals war ich geschockt. Doch ich habe gelernt, den Krebs nicht nur ernst zu nehmen. Ich ignoriere ihn die meiste Zeit. Und er revanchiert sich, indem er mich ebenfalls ignoriert. Es scheint, wir brauchen einander immer weniger. Dass ich als Geschöpf nicht nur begrenzt bin, sondern befristet, steht auf einem andern Blatt. Als Schriftsteller lernst du: Ohne Grenze gibt es keine Form, und umgekehrt. Diese Chance wahrzunehmen, betrachte ich inzwischen auch als A und O der Lebenskunst.
Wir sitzen hier in Ihrem malerischen Garten – das Wasser plätschert, die Vögel zwitschern, ein sanfter Wind weht. Wäre nicht der knatternde Rasenmäher des Nachbarn, man müsste sagen: Es ist die perfekte Idylle. Aber natürlich herrscht keine Idylle. Die Welt ist in Aufruhr wie lange nicht mehr. Fürchten Sie sich vor einem Krieg in Europa, gar vor einem Atomschlag?
Wenn ich nicht gerade schreibe oder diskutiere, wie jetzt mit Ihnen, kann ich mich Tag und Nacht fürchten. Besonders für meine Enkelinnen: Ich wünsche ihnen ein Leben ohne tödliche Strahlen. Die Kernspaltung ist eine Technik, mit der sich der Mensch übernommen hat. Und in der Ukraine können jetzt, nach Tschernobyl, noch ein Dutzend A-Werke hochgehen. Davon ist kaum die Rede – auch darum, weil ausgerechnet die Kernkraft plötzlich wieder zur Diskussion steht, als umweltschonende Alternative zu den fossilen Energien. Prometheus, der uns das Feuer vom Himmel stahl, hat wieder die Vorhand über seinen Bruder Epimetheus, der die warnende Erinnerung verkörpert. Die Büchse der Pandora bleibt offen, so oder so: Der Mensch muss mit dem, was er anzurichten vermag, leben, sogar wenn er die Grundlage dafür selbst zerstört. Vielleicht war Homo sapiens in der Evolution eine Mutation zu viel. Aber die Hoffnung ist immer noch in der Büchse – ich glaube daran, nicht obwohl, sondern weil es absurd ist.
Das ist die grosse metaphysische Frage. Konkret ist es nun aber Wladimir Putin, der vor den Toren Europas einen Krieg gegen die Ukraine führt. Die westlichen Werte – unsere Freiheitsrechte und demokratischen Errungenschaften – sind bedroht. Haben Sie sich vorstellen können, so etwas noch zu erleben?
Ich habe gelernt, auch ohne Hypochondrie, dass immer alles möglich ist, das heisst: auch das Schlimmste. Wir haben ein paar Jahrzehnte von der vermeintlichen Friedensdividende flott und fantasielos gelebt, jedenfalls im reichen Westen, und uns eingebildet, das Ende des Kalten Kriegs sei wirklich das Ende der Geschichte – von wegen! Es war gerade diese bequeme Zuversicht, die uns angreifbar gemacht hat. Was wir Globalisierung nennen, brach ein, weil es für die Benachteiligten untragbar wurde. 9/11 war eine Explosion, die eine Lawine lostrat: Die Vormacht USA reagierte mit Kriegen, die sie nicht gewinnen konnte und die, wie sich zeigt, ihre eigene Freiheit beschädigten. Und im Osten, nah, aber auch fern, entstanden autokratische Regime.
Auf welchen Zusammenhang spielen Sie an?
Auf der einen Seite ruft einer unter dem Vorzeichen des nationalen Egoismus – «America first»! – unbeschränkte Macht aus. Auf der anderen Seite begründet einer den unbeschränkten Autoritarismus eines selbst ernannten Gottesstaats. Putin braucht kein freies Russland, sondern ein heiliges. Hier die Freiheit, dort das Imperium, beide Karikaturen des eigenen Anspruchs, und darum umso mehr gezwungen, ihn mit Gewalt durchzusetzen. Putin, der sich in den 1990er-Jahren auf den Westen zubewegt, sogar bei der Nato angedient hat, wurde sich immer sicherer: Wo keine eiserne Ordnung herrscht, bricht das Chaos aus. Sein Schlüsselerlebnis waren wohl die Erfahrungen, die er als KGB-Offizier im aufständischen Dresden der Wendezeit gemacht hat.
Putin will also die Welt durch die Etablierung der alten Ordnung retten – was macht Sie da so sicher?
Wie kann ich sicher sein? Aber seither habe ich die Schriften seines Propheten gelesen, Iwan Iljin, die er an seine Verwalter als Pflichtlektüre verteilt. Darin erscheint Russland als Grösse, der die Rettung der Menschheit vor der Dekadenz aufgetragen ist. Es ist ein autoritärer Heilsplan, der in Putins Kopf offenbar zur persönlichen Mission geworden ist, weil er auch den beleidigten Stolz Russlands wiederherzustellen verspricht.
Und warum hat der Westen dies jahrelang nicht bemerkt?
Weil wir nicht sehen konnten, was wir nicht sehen wollten. Zu gut hatten wir gelernt, auf Russland herabzuschauen. Aber es bleibt eine Atommacht und das flächengrösste Land der Erde, und seine gering geschätzte Ökonomie ist, wie sich zeigt, durchaus imstande, schwere Sanktionen in Instrumente der Erpressung zu verwandeln. Sie bringen den westlichen Energiehaushalt ausser Rand und Band und können uns mehr als einen kalten Winter bescheren.
Das sind in der Tat höchst ungemütliche Aussichten, und sie schmerzen. Was folgt aus Ihrer Sicht daraus?
Ich bin weder Geostratege noch Hellseher, nur ein Zeitgenosse, der Kriege nicht erleben möchte. Auch keine Stellvertreterkriege, in denen der Westen seine Freiheit bis zum letzten Ukrainer verteidigt und das gepeinigte Land zugleich als Testgelände für neue Waffensysteme nützt. Dabei wäre ein Waffenstillstand das Einzige, wofür sich zu kämpfen lohnt – und daran führt ohne Verhandlung mit Putin kein Weg vorbei. Von mir aus darf die List der Vernunft auch wie ein böser Witz aussehen – etwa, wenn lupenreine Demokraten wie Erdogan und der iranische Grossmufti dem Putin den Weg dazu öffnen. Was diesen Krieg beendet, darf meinetwegen auch zum Lachen sein. In der Weltgeschichte sind solche Wendungen normal – für einen Schriftsteller sind es genau die Einfälle, auf die er erst kommen muss. «Mir gefällt zu konversieren / Mit Gescheiten, mit Tyrannen», liest man bei Goethe.
Warum sollte Putin verhandeln wollen, solange er sich seines Siegs sicher ist? Aber lassen wir das. Was mich am dichterischen Blick auf den Menschen mehr interessieren würde – verzweifeln Sie manchmal am Tyrannen, der wohl in jedem von uns steckt?
«Machet euch die Erde untertan» – das ist ein tyrannisches Programm des Menschen von Anfang an. Dass wir selbst – über viele Stufen – dieser Mutter Erde entsprungen sind und wieder in sie hinein müssen, könnte uns im Umgang mit ihr bescheiden machen, dankbar für ihre Gaben. Und damit wir sie lange geniessen können: haushälterisch in ihrem Gebrauch, geschwisterlich im Umgang mit anderen Geschöpfen. Aber wir lernen schwer, da wir bisher nur als Räuber an der Natur zu überleben glaubten. Bleiben wir dabei, so zerstören wir den Boden unter den eigenen Füssen. Dann rettet uns nur noch die Auswanderung zum Mars, wenn wir dafür bei Elon Musk rechtzeitig gebucht haben.
Sie sind nicht nur ein altersweiser Dichter und alterskluger Erzähler – Sie sind auch ein altersmilder Denker. Wir brauchen also mehr Distanz, vielleicht auch mehr Mass und Mitte – und dann wird alles gut?
Achtung: Balancieren ist eine Kunst, die gelernt sein will. Wenn man mit Mass und Mitte anfängt, wird man nichts als ein Langweiler, ein Bünzli, und verblendet sich durch Selbstgefälligkeit – die esoterische inbegriffen.
Einverstanden. Aber anderseits – wenn der Mensch seine Zerrissenheit anerkennt, verschwindet sie deshalb noch lange nicht.
Natürlich nicht. Aber wir werden verständnisvoller und empathischer gegenüber anderen – und uns selbst. Wir verabsolutieren nichts mehr, wir sehen nicht mehr bloss unsere Freiheit, unseren Anspruch, unser Recht. Vielmehr erkennen wir auch die Leiden, Freuden, Freiheiten und Ansprüche der anderen, das Chaos, die Unordnung in uns und um uns. Das macht uns gelassener und demütiger zugleich. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe. Sie werben für mehr Toleranz unter diesen widersprüchlichen Tieren, die die Menschen nun mal sind, in Friedens- und in Krisenzeiten.
Ja, aber keine Toleranz von oben herab – als würde man den anderen bloss dulden. Man muss sich an seine Stelle versetzen können, wie im therapeutischen Theater. Und das geht nur, wenn man sich selber in seiner ganzen Widersprüchlichkeit anerkennt und annimmt – anders als die Anhänger der woken Tugendlehre, die jede Ambivalenz, jede Ironie, jeden gedanklichen Grenzgang aus der Welt tilgen wollen. Mein Grabbruder Robin hat diese Tugend in einem Aufsatz über «Humor und Freimaurerei» einmal «die höchste Stufe humaner Grösse» genannt. Der Humorvolle ist demnach «stark genug, nicht recht haben zu müssen, und somit tolerant». Ist das nicht schön formuliert?
Das ist es. Also lachen Sie heute über die neuen woken Jakobiner?
Hoffentlich, denn ich kenne ihre Motive nur zu gut von mir selbst. Humorfreie Tugendterroristen, die sich unfehlbar wähnen, sind für mich unnötige Karikaturen ihrer selbst. Sie reklamieren für sich eine Reinheit, die sie nicht haben können, weil es sie nicht gibt. Und weil sie das insgeheim wissen, sind sie so intolerant. Sie ertragen nur ihresgleichen – und leben von den Feinden, die sie sich fabrizieren.
Der Wokeismus ist der neuste Kulturimport aus den West- und Ostküsten-Universitäten der Vereinigten Staaten. Woran nehmen Sie genau Anstoss?
Am Schwarz-Weiss-Denken. Menschen werden wieder vor aller Augen nach Rasse, Geschlecht und sexueller Orientierung sortiert, wie in den finstersten Zeiten des vergangenen Jahrhunderts. Nur Schwarze dürfen über Schwarze reden, nur Frauen über Frauen, nur Schwule über Schwule – und die Normalos haben sowieso den Mund zu halten. Das ist auch Rassismus, eine neue Form der Apartheid, die sich auch noch im Namen des Antirassismus breitmacht.
Die intellektuelle Dürftigkeit des Kultus liegt eigentlich auf der Hand, und niemand wäre gezwungen mitzumachen, am wenigsten die Universitäten. Warum aber gibt es in den Schulen und Medien kaum Widerstand gegen diese seltsame Art der geistigen Selbstpeinigung und -verknechtung?
Die Leute haben Angst – vor einem Shitstorm. Sie wollen nicht an den Pranger der «sozial» genannten Medien gestellt werden. Eine Probe davon habe ich auch schon selbst abbekommen – da der Erkenntnisgewinn und die Dialogchance gleich null waren, muss ich diese Nicht-Erfahrung nicht wiederholen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade, selbst wenn ich sie noch im Überfluss hätte.
Das Netz vergisst nicht.
Es vergisst nichts und alles – denn es kennt keine Erinnerung; es ist zugleich Durchlauferhitzer und Gedächtnislücke. In der Datenmenge, die es sammelt, kommt die Menschengeschichte nicht vor: Die kann ja auch nie das Neueste sein, das wir gerade auf dem Schirm haben – was nach Gestern riecht, verschwindet, es sei denn für nostalgische Effekte zu brauchen. Das Gehirn, auch das des IT-Experten, funktioniert fundamental anders als sein Gerät. Von diesem sind wieder nur neue Daten zu erwarten, kein Zusammenhang, keine Erfahrung und schon gar nicht, was man Bildung nennt – sie hat mit «Information» nichts zu tun. Wo kommt der User selbst her, wo geht er hin, what makes him tick? Darüber sagen ihm seine Programme nichts, sie fördern nicht ihn, nur bestenfalls seine Karriere.
Ich möchte Ihnen gerne ein paar modische Begriffe vorlegen und schauen, was passiert, wenn Sie auf Ihren so wachen wie erfahrenen Geist treffen. Was halten Sie von Political Correctness?
Davor gruselt mich noch mehr als vor grenzenloser Selbstgefälligkeit – mit der sie allerhand gemeinsam hat. Dahinter steht binäres Denken: Entweder-oder, Eins oder Null, Freund oder Feind, Wir oder Sie. So etwas hat einmal «pharisäisch» geheissen – jetzt entscheidet es darüber, ob ich dazugehöre oder nicht, ernst genommen werde oder nicht. Wer nicht korrekt ist, mit dem brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Eine junge Biologin, die die Zweigeschlechtigkeit der höheren Säugetiere nicht etwa verteidigte, sondern einfach festhielt, durfte ihren Vortrag an einer Berliner Universität nicht halten. Als die Uni daraufhin einen Shitstorm abbekam, durfte die Biologin ihn plötzlich trotzdem halten, vor vollem Haus – das sind die Kapriolen der Correctness. Nicht nur Gruppen, auch Individuen fällt nichts so schwer wie die Anerkennung von Widersprüchen, obwohl die gute Politik nicht nur mit ihnen, sondern von ihnen leben müsste. Das gilt auch für die persönliche Bildung, denn Widersprüche gefährden keine Identität, sie machen sie aus. Die grosse Kunst – etwa im altgriechischen Theater – hat mit dem Verhandeln unerträglicher Widersprüche angefangen, und dem Erlebnis ihrer Berechtigung. Heute sucht und verfolgt die Zensur der Correctness nicht nur in Meinungen, die nicht sein dürfen, sondern auch in der Sprache, in inkorrekten Wörtern, sogar in alten Brunnenfiguren oder Hausinschriften, aber auch in korrekten Statements, zu denen derjenige, der sie äussert, kein Recht haben soll, etwa, wenn er, wie ich, ein alter weisser Mann ist. Zum Glück ist mir meine Anfechtbarkeit auch ohne Nachhilfe der Korrekten bewusst.
Das war wiederum cool und altersweise! Die Woken finden auch hierzulande immer mehr Anhänger.
Ja, wie Evangelikale im katholischen Brasilien.
Was halten Sie selbst von Gender Studies, die in ihrer Extremform behaupten, Geschlecht sei keine biologische, sondern einzig eine soziale Kategorie, also nichts Naturgegebenes, sondern etwas, das jeder nach eigenem Gusto wählt?
Grossartig! Zur Lösung dieser Frage schlage ich, statt des Streits um korrekte Toiletten, einen Komödienwettbewerb vor. Prämiert wird, wer diesen Stoff am witzigsten darstellt. Die Darsteller: jemand, der sein will, was er nicht ist; jemand, der nicht sein will, was er ist; und jemand, der nichts sein will und doch ständig etwas sein muss. Und als Hauptrolle: einer, der gar nichts weiss und mit Fragen nicht aufhören will, er kann Sokrates heissen, oder auch Xanthippe. Das Ende: Bitte keinen Schierlingsbecher, sondern allgemeine Heiterkeit. Päpste und Ketzer lachen sich tot oder liegen sich in den Armen.
Ich präsentiere den nächsten Modebegriff: Cancel Culture.
Habe ich dazu nicht schon das Nötigste gesagt? Aber um mal krass inkorrekt zu sein, hier zitiere ich ein Wort von Karl Kraus aus dem Jahr 1933: «Zu Hitler fällt mir nichts ein.» Zu seinem Glück hat er den Anschluss Österreichs nicht mehr erlebt.
Herr Muschg, da fällt mir ein – schreiben Sie eine Komödie über unsere gegenwärtige Verwirrung als Ihr Vermächtnis!
Dafür müsste ich Aristophanes heissen – oder Dürrenmatt. Ich schreibe einstweilen getrost an meinem Robin weiter und erinnere mich daran, dass er auf Englisch ein Rotkehlchen wäre, und das Wort «englisch» im älteren Deutsch mit «Engeln» verbunden war. Beides würde ganz gut zu unserm gemeinsamen Aufenthalt passen. Seit im Friedhof so viele Gräber aufgehoben und überwachsen sind, beginnt er über weite Strecken einer englischen Heide zu gleichen. Viele kleine und grosse Marmorengel sind dabei heimatlos geworden. Ob sie auf unsere Gräber passen, werde ich mit Robin kaum zu diskutieren brauchen. Als Dünger für den Nachwuchs der Natur sind wir in unserer Komödie besser besetzt – und haben dabei auch kein Gesicht mehr zu verlieren. Korrekt?
Ich danke Ihnen für dieses berührende und vergnügliche Gespräch.
Interviewer René Scheu ist Philosoph, Blick-Kolumnist und Geschäftsführer des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern.
Ein grossartiges Interview mit einem grossartigen Philosophen und Schriftsteller. Keine Frage, auch wenn es vermutlich nur die Wenigsten – zu deren Minderheit ich für einmal gehöre – vom Anfang bis zum Ende lesen. Dafür ist es einfach zu lang. Sowas funktioniert heutzutage nur noch als Podcast. Wenn überhaupt.
Die Ansichten von Muschg über «Wokeismus»* und «Genderismus» kann man so sehen. Muss man aber nicht. Evolutionen waren noch nie der Ambivalenz und Ironie verpflichtet. Und schon gar nicht alten, weis(s)en Männern.
Seit wir von den Bäumen heruntergestiegen sind, erlebten wir als Menschheit nichts anderes als stetige Veränderung in jeder Hinsicht. Das ist auch heute noch so und wird immer so bleiben. Ebenfalls in jeder Hinsicht. Selbst die Geschwindigkeit des «neverending wind of change» verändert sich von der behäbigen Gemächlichkeit aus der menschlichen Urzeit in eine immer rasantere Geschwindigkeit, die uns Menschen irgendwann überfordern wird.
Wenn Sie anderer Meinung sind, erklären Sie mir bitte mit wenigen Sätzen in verständlicher Art und Weise die Relativitätstheorie von Albert Einstein – auch nichts anderes als eine Evolution im Bereich der Physik. Sehen Sie! Ist gar nicht so einfach.
«Wokeismus» und «Genderismus» sind nur zwei Kinder dieser rasenden Evolution. Muschg würde diese Entwicklung wohl kaum «Evolution» nennen. Andere tun es. Meine Wenigkeit zum Beispiel.Und vermutlich ein paar Milliarden «unweisser» Menschen auf diesem Erdball. Weil auch Evolutionen dem immerwährenden Gesetz der Evolution unterworfen sind.
* Woke (englisch «erwacht», «wach») ist ein im afroamerikanischen Englisch in den 1930er Jahren entstandener Ausdruck, der ein «erwachtes» Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus beschreibt. Aktivistisches oder militantes Eintreten für den Schutz von Minderheiten kann damit einhergehen. Im Zuge der durch die Erschiessung des 18-jährigen Afroamerikaners Michael Brown 2014 ausgelösten Proteste gelangte der Begriff zu weiter Verbreitung, unter anderem in den Reihen der Black-Lives-Matter-Bewegung. In diesem Kontext entwickelt sich auch der abgeleitete Ausdruck «Stay woke» als Warnung vor Polizeiübergriffen und ganz allgemein als Aufruf, sensibler und entschlossener auf systembedingte Benachteiligung zu reagieren.
Die Bedeutung im Duden lautet «In hohem Mass politisch wach und engagiert gegen (insbesondere rassistische, sexistische, soziale) Diskriminierung», wobei auf einen möglicherweise abwertenden Gebrauch hingewiesen wird.
So wird der Ausdruck woke inzwischen von konservativen und rechtsextremen Gruppen als «Anti-Wokeness» politisch instrumentalisiert und – wie die Ausdrücke politische Korrektheit, Cancel Culture und Social Justice Warrior – mit negativer Konnotation und häufig sarkastisch verwendet, um Linke und ihre Ziele abzuwerten. Auf der linken Seite des politischen Spektrums wird der Ausdruck mitunter ebenfalls abwertend gebraucht, um z. B. ein aggressives, rein performatives Vorgehen zu kritisieren.Die Selbstbeschreibung als woke ist indessen rückläufig. Schreibt Wikipedia.
-
7.8.2022 - Tag des politischen Narrenkäfigs von und zu Bern
Editorial von SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty: Stromlücken? Erinnerungslücken!
Die SVP geht mit der Energiepolitik hart ins Gericht. Doch wäre die Schweiz heute besser gewappnet, wäre die Energiepolitik die letzten Jahre von der SVP gestaltet worden? Die Frage lässt sich mit Nein beantworten.
Im August 2015 forderte der damalige SVP-Präsident Toni Brunner in einem Interview, Simonetta Sommaruga solle als Asylministerin abtreten und durch den Berner SVP-Mann Adrian Amstutz ersetzt werden. Im August 2022 fordert SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger», Sommaruga solle als Energieministerin abtreten und durch SVP-Mann Ueli Maurer ersetzt werden.
Frau Sommaruga löst bei ihren Gegnern Reflexe aus, die über die üblichen parteipolitischen Befindlichkeiten hinausgehen. Was immer die SP-Bundesrätin gerade tut oder lässt, die SVP will sie durch einen Mann aus den eigenen Reihen austauschen.
Worin sich 2022 von 2015 unterscheidet: Anders als von Toni Brunner behauptet, versank die Schweiz vor sieben Jahren keineswegs im «Asylchaos» – die absehbare Knappheit von Strom und Gas hingegen bedeutet für unser Land effektiv eine historische Herausforderung. Der Schweiz droht im Winter eine Energiekrise, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.
Stellt sich die Frage: Wäre die Schweiz heute besser gewappnet, wäre die Energiepolitik die letzten Jahre von der SVP gestaltet worden?
Die Frage lässt sich einfacher beantworten, als viele vielleicht denken. Denn in Tat und Wahrheit hat die SVP die Energiepolitik in jüngster Zeit entscheidend geprägt – dafür braucht es gar keinen SVP-General im Bundeshaus. Fast die Hälfte aller Energie in der Schweiz wird für Gebäude verbraucht, insbesondere für Heizen und Warmwasser. Und die politische Verantwortung dafür liegt bei den Kantonen.
2018 beschlossen die Parlamente von Solothurn und Bern, den – eher gemächlichen – Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen; 2019 tat der Aargauer Grosse Rat das Gleiche. Neubauten sollten künftig mit einer Solaranlage ausgerüstet sein. Statt neuer Öl- und Gasheizungen sollten Wärmepumpen oder Pelletöfen installiert werden. Natürlich ging es damals in erster Linie um den Klimaschutz – aber eben nicht nur. Wie formulierte es die grüne Aargauer Grossrätin Gertrud Häseli aus dem Fricktal während der Ratsdebatte im September 2019 so schön? «Möchtest du das Gas von Putin oder das Holz vom Landolt, Gsell oder Öschger?»
Die SVP liess sich von solchen Reden nicht beeindrucken. In Solothurn, in Bern und im Aargau ergriff sie das Referendum gegen das kantonale Energiegesetz – und gewann die Volksabstimmungen. «Damit wird kein einziges Problem gelöst sein», argumentierte der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark im Abstimmungskampf. «Dafür aber werden hohe Kosten und unnötige Aufwände verursacht.»
Der Fairness halber sei gesagt: Die SVP stand mit ihrem Kampf dafür, dass die Schweiz weiterhin möglichst mit Öl und Gas beheizt wird, keineswegs allein. In Solothurn und Bern gab es tatkräftige Unterstützung von der FDP und vom Hauseigentümerverband. So engagierte sich in Bern selbst die als progressiv geltende freisinnige Nationalrätin Christa Markwalder für ein Nein zum kantonalen Energiegesetz, also letztlich für mehr Abhängigkeit von russischem Gas. Eben jene Christa Markwalder, die sich jetzt auf Social Media als entschiedene Gegnerin von Wladimir Putin präsentiert.
Politik ist ein vergessliches Geschäft. Wahrscheinlich war sich SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi diese Woche gar nicht bewusst, dass er mit seiner Idee, Simonetta Sommaruga durch einen SVP-Vertreter zu ersetzen, lediglich eine alte Idee aufwärmte. Gut erinnern sollten sich aber all die Menschen im Aargau, in Bern und in Solothurn – nämlich daran, wer wirklich die Verantwortung dafür trägt, wenn sie im Winter frieren müssen. Schreibt SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty im Editorial vom SonntagsBlick.
Unsere Politgranden*innen verwenden zur Untermauerung ihrer gestanzten Weisheiten und Plattitüden aus den Kommunikationslaboren gerne Zitate berühmter Persönlichkeiten. Das geht manchmal in die Hose. Bundesrat Ueli Maurer erlebte einen mittleren Shitstorm in den Schweizer Medien, als er in einer Rede ein angebliches Zitat von Albert Einstein zitierte, das dummerweise leider nicht vom Schöpfer der Relativitätstheorie stammte. Kann schon mal passieren. Die aufgebauschte Empörungswelle verebbte denn auch so schnell wie sie gekommen war.
Ich erlaube mir, das von SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty in seinem Artikel umschriebene Palaver von Schweizer Politikern und Politikern, an das sich die Gesalbten heute nicht mehr erinnern, mit einer kurzen, aber echten Passage aus «Der Kaufmann von Venedig» von William Shakespeare zu zitieren.
«Es gibt so Leute, deren Angesicht
Sich überzieht gleich einem steh'nden Sumpf,
Und die ein eigensinnig Schweigen halten,
Aus Absicht sich in einen Schein zu kleiden
Von Weisheit, Würdigkeit und tiefem Sinn.
O mein' Antonia, ich kenne derer,
Die man deswegen bloss für Weise hält,
Weil sie nichts sagen: sprächen sie, sie brächten
Die Ohren, die sie hörten, in Verdammnis,
Weil sie die Brüder Narren schelten würden.»
Was will uns William Shakespeare damit sagen? «Reden ist Silber, Schweigern ist Gold», will man nicht im Narrenkäfig landen.
-
6.8.2022 - Tag der Wut-Netzwerke
Rechtsextreme Netzwerke planen «Wutwinter» in Österreich wegen Teuerung
Ein Demonstrant mit Galgen bei einer Veranstaltung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Eine Landärztin, die nach anhaltenden Morddrohungen Suizid begeht. Zwei Gesundheitsminister und zwei Landeshauptleute, die bei ihren Rücktritten die feindselige Stimmung im Land ansprechen.
Irgendetwas ist in Österreich gewaltig aus dem Ruder gelaufen.
Und die Zeichen stehen nicht auf Entspannung: Teuerung, Energiekrise sowie die Gefahr einer neuen Corona-Mutation werden die Stimmung im Land weiter verschärfen. Rechts außen keimt schon die Hoffnung auf einen "Wutwinter", der zu bisher nie dagewesenen Demonstrationen führen soll.
Woher stammt diese Aggression?
Eine Antwort darauf geben die Corona-Proteste. Die erste Infektion in Österreich war noch keine zwei Monate her, als sich die maßnahmenkritische Szene bereits in Grundzügen formierte. Rasch wurde klar, dass die regierungskritischen Demonstrationen großteils von altbekannten Köpfen organisiert und mitgetragen wurden. Da gibt es Leute wie den Kärntner Ex-Politiker Martin Rutter, der früher bei BZÖ, Grünen und Team Stronach angedockt hatte. Rutter habe zwar regelmäßig antisemitische Codes bemüht, zeige aber "eher ein diffuses, nicht wirklich kohärentes rechtsextremes Weltbild", sagt der Politologe Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW). Gleichzeitig sah man bei den Demos aber auch Leute wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung oder den überzeugten, mehrfach verurteilten Nationalsozialisten Gottfried Küssel samt Mitstreitern der ehemaligen "Volkstreuen außerparlamentarischen Opposition" (Vapo) und andere überzeugte langjährige Rechtsextreme. "Die haben nur darauf gewartet, dass das Wasser dieser Protestdynamik endlich auf die für sie richtigen Mühlen fließen kann", analysiert Weidinger.
Monat für Monat wuchs die Protestbewegung, bis zum vorläufigen Höhepunkt im November 2021, als mehr als 40.000 Menschen durch Wien marschierten, um gegen die "Corona-Diktatur" zu kämpfen.
Befanden sich unter den Demonstranten lauter Rechtsextreme? Mitnichten. Die Sektenstelle des Bundeskanzleramts beschreibt eine "aufsteigende Eskalation" in den Einstellungen der Teilnehmenden. Da gebe es zunächst jene, die aus ganz praktischen Gründen gegen die Corona-Maßnahmen protestierten: Sie empfänden Maskenpflicht oder Lockdown als Einschränkung, ohne verschwörungstheoretisch zu denken. Auf der nächsten Stufe würden Corona-Maßnahmen "intellektuell infrage gestellt" werden, also zum Beispiel größere Schäden durch Lockdown und Co als durch das Virus an sich vermutet. Positionen, die im Diskurs zumindest sachlich diskutiert werden können.
Rechte wollen Proteste kapern
Dann aber folgt die auf Demos oft vertretene Masse jener Menschen, die ihre Ansichten in Verschwörungstheorien einbetten: etwa dass durch die Impfung ein Chip implantiert werde, dass Bill Gates für die "Plandemie" verantwortlich sei und viele Abenteuerlichkeiten mehr. Das große Problem laut Sektenstelle: "Allfällige ohne verschwörungstheoretische Inhalte entstandene Proteste und Initiativen werden häufig sehr rasch von Akteurinnen und Akteuren sowie Strukturen mit verschwörungstheoretischer Agenda ersetzt oder verdrängt." Das hat einen Grund: Rechtsextreme sehen die Masse der Maßnahmengegner als ideale Zielgruppe für ihre demokratiefeindliche Agitation.
Das omnipräsente Gefühl, "ohnmächtig und abgehakt ein Komparse in einem weltgeschichtlichen Prozess zu sein", trüge diese Menschen nicht: Das schreibt Martin Sellner, Frontmann und ein Stratege der rechtsextremen Identitären. In der Sezession, einer der wichtigsten neurechten Zeitschriften, hat er ein paar Tipps für seine Szene und den Umgang mit Corona-Verschwörungsmythen: "Wichtig ist, diese Theorien und ihre Vertreter nicht lächerlich zu machen. Ihr Entstehen ist absolut verständlich und entspricht einem natürlichen Empfinden ebenso wie einer unverschuldeten ideengeschichtlichen Unkenntnis."
Rechtsextreme könnten sich "dank jahrelanger Erfahrung in politischer Organisation tätig in Protesten hervortun und dabei Qualität, Weltanschauung und Strategie einbringen", schreibt er weiter.
Aber nicht nur ideologiegetriebene Agitatoren mischen bei den Demonstrationen mit: Auch Geschäftemacher sind in großem Stil unterwegs. Allen voran sogenannte "alternative Medien" wie das rechte Internetportal Auf1 oder der rechtsextreme Wochenblick, die während der Pandemie nicht nur ihre Zugriffszahlen vervielfachen konnten, sondern auch mit Shops ordentlich Geld verdienen.
"Dort verkaufen sie so ziemlich alles, von dem die Menschen glauben, sie brauchen es gegen ihre Angst, die man ihnen zuvor auf derselben Seite gemacht hat", bringt es Weidinger vom DÖW auf den Punkt.
Doch wogegen kann man in puncto Corona-Maßnahmen denn noch demonstrieren? Die Impfpflicht wurde gekippt, sogar die Quarantäne für Infizierte existiert nicht mehr. Kehrt nun also Ruhe ein?
Das Gegenteil ist zu befürchten. Denn die Corona-Proteste waren keine Ausnahme, sondern Teil einer Entwicklung, die nicht erst 2015 in der Zeit der Fluchtkrise begann, wenn sie damals auch eskalierte. Schon 2014 rief der Gründer der rassistischen und islamophoben Pegida, Lutz Bachmann, der 2016 wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, zum ersten "Abendspaziergang" in Dresden auf. Die Pegida-Demos, zuerst auch von manchen Medien als Protest "ganz normaler Bürger" bezeichnet, waren inhaltlich bereits von rechts organisierte Massenaufmärsche, denen sich auch bis dato weniger mit Protestkulturen vertraute, aber durchaus fremdenfeindlich eingestellte Leute anschlossen.
Im Osten Deutschlands hat die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) immer wieder "lautstarke" Erfahrungen damit gemacht. Vor allem in den Jahren nach 2015 wurde sie bei Veranstaltungen mit schrillen Tönen empfangen und ausgebuht. Merkel galt wegen ihrer zunächst liberalen Asylpolitik den damals auch nicht spontan entstandenen, sondern organisierten Protesten als "Volksverräterin". In der CDU versuchte man der Herausforderung technisch entgegenzutreten. Waren die Pfiffe besonders laut, dann drehten die Techniker einfach die Lautsprecher hoch.
Auf Merkel hatten natürlich auch noch unzählige Personenschützer ein Auge. Auch Walter Lübcke stand zeitweise unter Polizeischutz. Der ehemalige CDU-Politiker und Regierungspräsident von Kassel setzte sich in den Jahren nach 2015 für die Aufnahme von Geflüchteten ein und trat immer wieder in Bürgerversammlungen auf.
Rechtsextremer Mord
Am 1. Juni 2019 wurde er auf der Terrasse seines Wohnhauses aus nächster Nähe vom Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen. Dieser wurde im Jänner 2021 vom Oberlandesgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte damals fest, dass H. aus einer "von Rassismus getragenen, völkisch-nationalen Grundhaltung" heraus seinen Ausländerhass auf Lübcke projiziert habe.
Pfiffe, Geschrei, Ausbuhen – das hat in Deutschland zuletzt auch der beliebte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erlebt. "Hau ab, hau ab!", riefen einige Menschen, Habeck wurde auf Plakaten auch als "Kriegstreiber" und "Lügner" bezeichnet. Ähnliches hatte Habeck, noch als Chef der deutschen Grünen, in Chemnitz erlebt, als er dort im Landtagswahlkampf 2019 für seine Partei warb. Viele nahmen ihm damals seine Asylpolitik und sein Eintreten für ein Ende des Verbrennungsmotors übel.
In Österreich hat die Szene nun vor allem den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ins Auge gefasst. In Telegram-Gruppen werden Termine seiner Wahlkampfauftritte verbreitet, um sie gezielt zu stören. Das zeigt: Die Themen sind variabel, oft sind aber die Agitatorinnen und Agitatoren konstant. Die nicht rechtskräftig zu teilbedingter Haft verurteilte Jenny Klauninger, die mit dem Zerreißen einer Regenbogenfahne bei einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo aufgefallen war, polterte etwa schon 2016 im steirischen Spielfeld gegen Flüchtlinge. Die Szene versucht gegen Umweltschutz genauso wie gegen LGBTQI-Rechte Stimmung zu machen.
Doch mit den steigenden Lebenshaltungskosten dürfte im Herbst ein brisantes neues Thema hinzukommen. Eines, das viel mehr Menschen in Österreich wirklich bewegt und betrifft.
Jedes dieser Protestthemen bringt neue Followerinnen und Follower. Besonders auf Telegram haben sich tausende Chatgruppen gebildet, deren Kern Hass und Hetze sind. Allein zwischen Dezember 2020 und April 2021 wuchs die Leserschaft radikaler Telegram-Gruppen um 471 Prozent, erläuterte das Institute for Strategic Dialogue (ISD) in einer Studie. Dafür gibt es praktische und ideologische Gründe: Einerseits stammt Telegram aus Russland und ist damit kein Teil des "US-imperialistischen Systems", das viele sogenannte Querdenker bekritteln. Andererseits kooperiert Telegram kaum mit europäischen Behörden und hat keine Schutzmechanismen gegen Hasspostings und Propaganda eingebaut – im Unterschied zu den Produkten von Meta, das nach der russischen Manipulation des US-Wahlkampfs 2016 bei Facebook, Instagram und Whatsapp Maßnahmen umsetzte.
In den Telegram-Gruppen vernetzen sich Radikalisierte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Oft kann jede und jeder auf jede Chatnachricht in Gruppen mit hunderten Teilnehmern antworten; so entsteht ein ständiger Fluss an neuen Nachrichten, die emotionalisieren und weiter radikalisieren.
Mehr als 1600 Corona-Demos
Sind die österreichischen Behörden dafür gerüstet? Das Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es nicht mehr, stattdessen ist nun die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) für die Beobachtung staatsgefährdender Gruppierungen zuständig. Ihr Direktor Omar Haijawi-Pirchner warnt regelmäßig vor Rechtsextremen als größter Gefahr für die innere Sicherheit.
Aus dem Inneren der DSN heißt es, man sei für die Aufgabe gerüstet, wenngleich es ressourcentechnisch natürlich immer Luft nach oben gebe. Mehr als 1600 Corona-Kundgebungen habe man seit Beginn der Pandemie in Österreich gezählt. In den vergangenen Wochen zeige sich, wie die Szene der Agitatoren nach neuen Themen und Narrativen suche, sagen Experten des DSN. Aber schon vorher sei klar gewesen, dass die Ablehnung der Corona-Maßnahmen nicht absolut im Fokus der Gruppierungen gestanden sei, sondern dass die heterogene Menge vor allem ihre Ablehnung des demokratischen Systems eine. Die Corona-Maßnahmen-Demos seien ein "Auffanglager" für Enttäuschte und Verzweifelte, wobei einige Mitdemonstrantinnen und Mitdemonstranten zumindest anfangs nicht erkannt haben sollen, wer hinter den Veranstaltungen stecke. Klar sei aber, dass durch die wiederholte Teilnahme an solchen Demos viele "ins radikale Milieu" abgleiten würden.
Ebenso eindeutig sei aber auch, sagt ein hochrangiger Beamter der DSN: Die Sicherheitsbehörden können die gesamtgesellschaftliche Spaltung nicht überwinden.
Massiver Vertrauensverlust
Das ist eigentlich Aufgabe der Politik. Doch das Vertrauen sowohl in das politische System als auch in dessen Akteurinnen und Akteure ist mehr als angeschlagen. Das gilt vor allem für die unteren Einkommensschichten.
Das Umfrageinstitut Sora ließ 2021 für seinen Demokratiemonitor Einstellungen dazu abfragen. Die Ergebnisse sind erschreckend: Nur 18 Prozent des untersten Einkommensdrittels denken, dass Menschen wie sie "im Parlament gut vertreten" werden. In der Mittelschicht und der obersten Einkommensklasse denkt das immerhin noch die Mehrheit der Befragten.
Aber auch dort bricht das Vertrauen weg: Meinten im Jahr 2020 noch 70 Prozent der Mittelschicht, das politische System in Österreich funktioniere sehr oder ziemlich gut, dachten das Ende 2021 nur mehr 42 Prozent. Der Zuspruch zur Demokratie als Regierungsform ist allerdings noch sehr stabil, diese wurde von fast neunzig Prozent der Befragten präferiert. Auffällig ist, dass unter den zehn Prozent, die die Demokratie ablehnten, vor allem die Kritik an Corona-Maßnahmen als wichtigstes Anliegen genannt wurde.
Mehr Zahlen gefällig? Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse zeigte im Juni 2022, dass nur 18 Prozent der Befragten der Regierung und nur 22 Prozent der Opposition vertrauen. Groß sei die Sehnsucht nach parteipolitischen Alternativen, hieß es unter den Befragten.
Gibt es sie also wirklich, die "gesamtgesellschaftliche Spaltung"? Realpolitisch besteht die Gefahr, dass das politische System auf den Vertrauensverlust nicht mit schlauen Lösungen für die breite Bevölkerung reagiert, sondern vor den extremen Positionen einer sehr kleinen und sehr lauten Minderheit einknickt. Deren radikale Ansichten fließen so langsam in den politischen Diskurs ein: Etwa indem die ÖVP Angst hat, Stimmen an die FPÖ oder die die Maßnahmen ablehnende und verschwörungsmythisch angehauchte MFG zu verlieren.
Das zeigte sich etwa im oberösterreichischen Landtagswahlkampf im Sommer 2021. Hartnäckig halten sich bis heute Gerüchte, dass die türkis-grüne Bundesregierung auf Drängen von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den Wahltermin im September abgewartet hat, bevor sie auf die sich rasant verschlechternde pandemische Lage reagierte. Das stritt der damalige grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober zwar stets ab, doch die späte Reaktion auf steigende Zahlen führte letztlich dazu, dass im November 2021 zuerst die 2G-Regeln, dann ein allgemeiner Lockdown und schließlich die Impfpflicht beschlossen wurden. Genutzt hat das übrigens nur wenig: Die MFG konnte mit 6,2 Prozent klar die Hürde für einen Einzug in den oberösterreichischen Landtag nehmen.
Gelbwesten in Österreich
Ein Dorn im Auge ist die MFG auch der FPÖ, wenngleich aus anderen Gründen. Traditionell war es die FPÖ, die den "Volkszorn" kanalisieren und aufheizen konnte. Der richtete sich eben gegen "das System" und oft gegen "die Ausländer". Auch bei den Corona-Maßnahmen versuchte man, Anschluss zu finden – das gelang aber erst spät und vor allem nach Herbert Kickls Übernahme der Partei im Juni 2021. Sein Vorgänger Norbert Hofer hatte sich in puncto Corona eher moderat gezeigt und seine eigene Impfung thematisiert.
So ganz verschmolz die FPÖ mit dem Thema aber nie, denn noch deutlicher als in anderen Bereichen wurde eine Lücke zwischen propagierten Inhalten und dem eigenen Verhalten der blauen Politikerinnen und Politiker spürbar. Viele Abgeordnete sind mehrfach geimpft, schützen sich privat vor einer Ansteckung und nahmen, sollten sie positiv getestet werden, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin, das Kickl empfohlen hatte.
Daher dürfte man in weiten Teilen der FPÖ geradezu erleichtert sein, dass neue Protestthemen aufgetaucht sind. Parteistrategen sollen schon von einer österreichischen Gelbwestenbewegung träumen, die im Herbst gegen hohe Sprit-, Strom- und Energiekosten auf die Straße geht. Vorbild ist die Protestbewegung in Frankreich 2018, die ausgelöst durch eine Erhöhung der Spritsteuer ein breites, heterogenes Spektrum an politischen Gruppierung versammelte – darunter auch weit rechts stehende.
Das Mobilisierungspotenzial beim Thema Teuerung ist gewaltig, ein Protestmotiv angesichts der ökonomischen Ungleichheit auch breit nachvollziehbar.
Alternativen anbieten
Wie kann die Politik die Notbremse ziehen? "Man muss die sozialen Verwerfungen, die zuerst durch die Pandemie entstanden und nun durch die Inflation noch härter durchschlagen werden, abfedern", sagt Politologe Weidinger, "damit es keinen Grund gibt, auf die Straße zu gehen." Und man müsse "auf das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden achten", warnt Weidinger, "wenn große Konzerne großzügige Hilfen bekommen und für andere nicht mehr genug da ist, ist das gefährlich".
Das spürt man auch beim Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB). Da wird gerade an einem Plan gearbeitet, wie man das Protestpotenzial nicht den rechtsextremen Gruppierungen überlassen kann. Schon am 17. September soll es zu österreichweiten Demonstrationen kommen, in denen die Kernforderungen des ÖGB verbreitet werden: also strukturelle Maßnahmen gegen die Teuerung, etwa ein Absenken der Mehrwertsteuer.
Die Teuerung treffe zwar am stärksten arme Bevölkerungsschichten, fresse sich aber tief in die Mittelschicht, warnt der SPÖ-Politiker Wolfgang Katzian, der den überparteilichen Gewerkschaftsbund leitet, im Gespräch mit dem STANDARD. Einmalzahlungen seien nett, aber bei weitem nicht ausreichend. Die Regierung setze Maßnahmen zu zögerlich, sagt Katzian, nicht zuletzt müsse das Arbeitslosengeld dringend angehoben werden.
Die Corona-Krise habe gezeigt, dass nicht der Markt der Hero sei, sondern der Sozialstaat. Denn "der Markt hat sich geschlichen und um Hilfen gebettelt", der Sozialstaat hingegen die Verwerfungen aufgefangen. Schreibt DER STANDARD.
Um es vorweg zu nehmen: ein wirklich lesenswerter, gut recherchierter Artikel, den zu lesen sich wirklich lohnt. Ein Sittengemälde der Politik und deren Verstrickungen über Dekaden hinweg mit der heiligen Kuh des alles regelnden Marktes. Querbeet durch alle Parteien hinweg. Egal ob sie gerade in Regierungsverantwortung sind oder Opposition betreiben.
Krisen, die vor allem den unteren Schichten ans Eingemachte gehen, haben schon immer die Populisten hinter dem Ofenbank hervorgelockt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Ein Donald Trump ist nicht vom Himmel gefallen.
Historiker sind sich einig: Selbst ein Adolf Hitler hätte mit grösster Wahrscheinlichkeit niemals die Macht in Deutschland übernehmen können ohne die wirtschaftliche Not und Massenverelendung der Menschen. Hervorgerufen 1929/30 durch den Zusammenbruch der New Yorker Börse. Die deutsche Industrieproduktion sank um 40 Prozent und sechs Millionen Arbeitslose waren die Folge. Drei Jahre später, am 30. Januar 1933, war Hitler (legal) an der Macht.
Festzuhalten ist, dass erst die dem Börsencrash folgende Deflation (und nicht die Inflation aus dem Jahr 1923, wie oft behauptet) Hitlers Partei, die NSDAP, von einer über Jahre hinweg zwar lauten aber dennoch unbedeutenden Kleinpartei zur wirklich namhaften und stärksten Partei Deutschlands beförderte, wie der Schweizer Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann in seinem empfehlenswerten Buch «1931, die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg»* schreibt. Alles hängt mit allem zusammen.
Wetten, dass auch die Schweizer «Wut-Netzwerke» bereits Gewehr bei Fuss stehen? Meldungen wie «Rohstoffhändler Glencore verzehnfacht den Gewinn im ersten Halbjahr 2022» und die Aussicht der Schweizer Mieter*innen, als Folge davon bis zu drei Mal höhere Nebenkosten für die Energiekosten bezahlen zu müssen, sind Wasser auf die Mühlen der Populisten.
Wir gehen stürmischen Zeiten mit lauten Trychel-Klängen entgegen.
* https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1056982769
-
5.8.2022 - Tag der dem Ende zustrebenden Wohlfühl-Oase Schweiz
Empörung über Riesengewinne von Shell, BP und Co: «Mich stört, wenn sich Konzerne an Krisen eine goldene Nase verdienen»
Ölmultis schreiben Rekordgewinne – wir zahlen für Benzin und Gas immer mehr. Jetzt fordert der Uno-Generalsekretär eine Sondersteuer. Auch Schweizer Politiker unterstützen das.
Während die einen sterben, füllen sich die anderen die Taschen. Es tönt furchtbar zynisch, aber es ist wahr: Der Krieg in der Ukraine führt dazu, dass Rohstoffkonzerne Traumgewinne schreiben. So Exxon: Der US-Ölkonzern verbuchte im zweiten Quartal dieses Jahres einen Gewinn von 17,9 Milliarden Dollar, 13 Milliarden mehr als in der Vorjahresperiode. So BP: Der britische Ölmulti schrieb 9,3 Milliarden Dollar, dreimal mehr als vor einem Jahr.
So auch Glencore: Der Zuger Rohstoffhändler hat im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinn von 12,1 Milliarden Dollar gemacht – das Zehnfache des letzten Jahres. Grund dafür sind Rekordpreise für Kohle und der aussergewöhnlich gut laufende Handel mit Energieprodukten. Und so dürfen sich Glencore-Aktionäre über eine schöne Sonderdividende freuen, während Mieter und Hauseigentümer auf der ganzen Welt ein Sparpolster anlegen, um die Heizkosten zu bezahlen.
«Mehr Geld als Gott»
Die Kriegsgewinne stossen weltweit auf Empörung. So kritisierte US-Präsident Joe Biden (79), dass Exxon und andere Multis «mehr Geld als Gott» verdienen würden. Auch Uno-Generalsekretär António Guterres (73) bezeichnete sie am Mittwoch als «unmoralisch».
Er fordert daher Regierungen dazu auf, diese übermässigen Krisengewinne zu besteuern und mit den Einnahmen die am stärksten gefährdeten Menschen zu unterstützen. Man solle eine klare Botschaft an die Erdölbranche und ihre Geldgeber senden, dass ihre Gier die ärmsten Menschen bestrafe und den Planeten zerstöre.
Grüne planen Resolution
Angesichts der Halbjahreszahlen der Ölmultis entbrennt die Diskussion über eine solche Krisengewinnsteuer, auch Windfall Tax genannt, nun auch in der Schweiz. «An der kommenden Delegiertenversammlung Ende August werden wir eine Resolution zum Thema verabschieden und fordern, dass die Schweiz eine solche Windfall Tax einführt», sagt Florian Irminger, Generalsekretär der Schweizer Grünen.
Während der Corona-Krise seien die Pharmakonzerne Krisengewinnler gewesen, jetzt sind es die Ölmultis. «Die Kosten, die entstehen – etwa für Wirtschaftshilfen, aber auch die Aufnahme von Flüchtlingen und den Wiederaufbau der Ukraine –, trägt dann die Allgemeinheit.» Er kündigt für die Herbstsession entsprechende Vorstösse an, die möglichst breit abgestützt sein sollen. Man werde daher auch das Gespräch mit anderen Parteien suchen. «Mitte-Präsident Gerhard Pfister hat ja durchaus Interesse am Thema bekundet.»
Auch Habeck will eine Windfall Tax
In der Tat hat Pfister bereits im Frühsommer eine Anfrage an den Bundesrat gestellt, wie sich dieser zur Einführung einer Windfall Tax stelle. Die Landesregierung kann dem wenig überraschend nicht viel abgewinnen – und dabei will Pfister es vorläufig belassen. Es sei ihm damals mehr darum gegangen, dass der Bundesrat sich vorbereitet, falls eine Windfall Tax international Thema würde.
Unmöglich ist das nicht, in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) werden entsprechende Ideen gewälzt. Und so sagt Irminger auch, die Grünen fühlten sich international gut abgestützt. «Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck will eine solche Krisengewinnsteuer, andere Staaten haben sie schon eingeführt.»
So werden in Grossbritannien alle aussergewöhnlichen Profite der Öl- und Gaskonzerne neu mit 25 Prozent besteuert. Im Verlauf des nächsten Jahres versprechen sich die Briten umgerechnet 5,8 Milliarden Franken zusätzliche Einnahmen. Auch Italien besteuert solche Zufallsgewinne bereits mit 25 Prozent.
Unterstützung aus der FDP
Eine Mitstreiterin könnten die Grünen eventuell auch in Anna Giacometti (60) finden. Die FDP-Nationalrätin aus Graubünden hatte im Frühling ebenfalls gefragt, ob der Bundesrat eine Möglichkeit sehe, die ausserordentlichen Gewinne der multinationalen Unternehmen zu besteuern, um die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz zu entlasten. Doch auch sie wurde enttäuscht.
Aufgeben will sie nicht. Die Antwort des Bundesrats habe sie nicht zufriedengestellt. «Und sie ist auch widersprüchlich: Einerseits sagt er, dass die Abgrenzung von Gewinn und Übergewinn nicht möglich ist. Zwei Zeilen später heisst es, dass Übergewinne bereits besteuert würden.» Das gehe nicht auf.
Und so will Giacometti in der Herbstsession ebenfalls nochmals nachstupfen. «Mich stört, wenn sich Konzerne an Krisen eine goldene Nase verdienen, während etwa die Bevölkerung die Kosten zu tragen hat – wie momentan beim Benzin. Das ist einfach nicht korrekt», sagt sie. Sie werde die Frage der Windfall Tax in der Herbstsession mit der FDP-Fraktion besprechen. «Wenn es eine smarte und faire Lösung gibt, sollte man diese prüfen.» Schreibt Blick.
So leid es mir tut: Das ist eine reine Geister-Diskussion, die übrigens auch in anderen europäischen Staaten wie Deutschland geführt wird. Nur der schlaue Signore Dragi aus Italien hat für seinen Staat erfolgreich eine Möglichkeit gefunden, die Energie-Imperien Italiens zur Kasse zu bitten. Ist in seinem Fall aber auch nicht so schwierig, weil der italienische Staat grosse Beteiligungen am Kapital der italienischen Energie-Konzerne hält. Ähnlich verhält es sich mit der englischen «Übergewinn-Steuer», die allerdings noch nicht in trockenen Tüchern ist. Da sind noch einige Gerichtsbeschlüsse hängig. So viel Wahrheit sollte schon sein.
Dass nun sogar eine Tante aus der abartig neoliberalen FDP Schweiz beinahe sozial-kommunistische Pläne hegt, könnte mit der berühmten Redewendung «Eine einzelne Schwalbe macht noch keinen Sommer» umschrieben werden. Denn dass sich die FDP-Dame auf die exorbitanten Benzinpreise an den Tankstellen bezieht, zeigt eindeutig wessen Geistes Kind Pate ihrer Empörung ist. Die Tankstellenpreise treffen logischerweise auch ihre eigene Klientel. Die von den FDP-Mogulen bevorzugten SUV-Fahrzeuge der Marken Audi, Mercedes und Porsche sind als Benzinschlucker bekannt. Und Mann/Frau will ja schliesslich bei den eidgenössischen Wahlen im kommenden Jahr auch im Kanton Graubünden wieder gewählt werden.
Dass sich aber ausgerechnet Neoliberale wie diese Frau Nationalrätin von der FDP dem Thema widmen, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Sind es doch ausgerechnet die «Bürgerlichen», die unser Land im Gleichklang mit den anderen Schweizer Parteien – eine Krähe hackt nun mal der andern Krähe kein Auge aus – mit ihrer willfährigen Konzern- und Deregulierungspolitik über Jahrzehnte hinweg in diesen Schlamassel geritten haben, in dem wir nun gelandet sind.
Nicht der extrem hohe Benzinpreis birgt den grössten Sprengstoff für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Aufs Auto verzichtet sowieso niemand, egal wie hoch die Benzinpreise nun mal sind. Das zeigt allein schon die verlogene Diskussion um den Klimawandel.
Eine ganz andere Hausnummer im wahrsten Sinne des Wortes stellen jedoch die ins Uferlose gestiegenen Energiepreise für viele Mieterinnen und Mieter dar. Nebenkosten für Gas, Öl und Strom, die sich verdreifachen, könnten an den Wahlurnen im Jahr 2023 ein Beben verursachen. Die SVP mit ihrem Wurmfortsatz der Trychler und sonstigen Wahnwitzigen aus der Esoterik-Abteilung wetzt nicht umsonst bereits die Klingen. Der von der Zuger SVP-Lachnummer und Nationalrat Thomas Aeschi beantragte «Energie-Sondergipfel» ist ein erster Vorbote.
Ändern dürfte sich für die Schweizer Bevölkerung ausser der Sitzverteilung im Hohen Haus von und zu Bern auch nach den Wahlen 2023 kaum etwas. Dafür sorgen die inzwischen längst aus der Wohlfühl-Oase früherer Dekaden gefallene Konkordanz und die sprichwörtlich niedrige Wahlbeteiligung.
In Anlehnung an Goethes «Zauberlehrling» werden wir die politischen Geister, die wir wählten, so schnell nicht wieder los. Da braucht es mehr als nur Wahlen. Spannende Zeiten bahnen sich an. Zündstoff ist genug vorhanden. Aber noch brennt die Lunte nicht ...
-
4.8.2022 - Tag der Inflation
Trinkwasser in der Schweiz: Preis für Wasser könnte in Zukunft steigen
Ein Anreiz, den Wasserverbrauch zu reduzieren, geht über das Portemonnaie mit einer Erhöhung der Tarife im Sommer.
Das Trinkwasser in der Schweiz ist im Allgemeinen von guter Qualität und wird ständig überwacht. Hingegen ist die begrenzte verfügbare Menge an Wasser während heissen und trockenen Sommermonaten immer wieder ein Thema. Vielerorts werden dieser Tage Privathaushalte angehalten, Wasser zu sparen. Ein möglicher Anreiz, den Verbrauch zu reduzieren, geht über das Portemonnaie mit einer Erhöhung der Wassertarife im Sommer.
Eine der wenigen Gemeinden in der Schweiz, wo es keine Wasserzähler in Privathaushalten gibt, ist Würenlingen im Kanton Aargau. Die Gemeinde liegt unweit des Wasserschlosses der Schweiz bei Brugg, wo die drei Flüsse Aare, Reuss und Limmat zusammenfliessen. Sie entwässern gemeinsam 40 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz.
«Es ist aber nicht so, dass wir nichts bezahlen», sagt Patrick Zimmermann, Gemeindeammann von Würenlingen. Der Wasserverbrauch werde pauschal abgerechnet, wie das in der Gemeindeverordnung geregelt sei. Dabei werde an die Eigenverantwortung appelliert, sparsam mit Wasser umzugehen. Politischen Vorstösse, dies zu ändern, sind bislang an der Urne alle gescheitert.
Saisonale Preiserhöhungen denkbar
Aber Wasser wird immer mehr zu einem wertvollen Gut. Den Wasserverbrauch zu senken, wird in Zukunft nötig sein. Beim Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) geht man davon aus, dass durch die Wasserknappheit die Preise in Zukunft steigen werden. Eine saisonale Lösung wäre darum grundsätzlich denkbar.
«Wenn Wasser generell knapper werden sollte, werden auch die Preise steigen. Dies, weil der grösste Teil der Kosten für die Infrastruktur und die Betriebskosten bei der Wasserversorgung anfallen», sagt Christoph Niederberger, Direktor des SGV. Das Wasser selber mache eigentlich nur einen kleinen Teil der Kosten aus. Die Fixkosten aber bleiben und das müsse dann natürlich auf das wenige Wasser aufgeschlagen werden.
Konflikte um die Nutzung von Wasser werden in Zukunft zunehmen, ist Christoph Hugi überzeugt. Der Spezialist für nachhaltiges Ressourcenmanagement und Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz hat schon vergangenen Woche ein neues Berechnungssystem vorgeschlagen.
«Man könnte darüber diskutieren, dass im Sommer, wenn Knappheit herrscht, der Preis steigt, abgestuft nach den entsprechenden Nutzungen, wo das Wasser verwendet wird.» Möchte also der Besitzer eines Schwimmbads seinen Pool füllen, müsste er tiefer in die Tasche greifen als ein Landwirt, der das Wasser für seiner Felder braucht.
Preisüberwacher zeigt sich offen
Für Preisüberwacher Stefan Meierhans sind saisonale Preiserhöhungen eine Möglichkeit, den Konsum zu lenken. Zuerst solle man aber auf Verbote setzen, etwa bei privaten Pools oder der Autowäsche. «Wenn es dann wirklich nötig sein sollte, auf ein differenziertes Tarifsystem einzusteigen, dann ist für mich zentral, was nachher mit dem zusätzlichen Geld passiert, das eingenommen wird.»
Beim Wasser, das alle brauchten, dürfe nicht jemanden sozusagen als Wasserbaron einen grossen Gewinn machen. «Das muss man auf jeden Fall verhindern und darum schaue ich auch hin», erklärt Preisüberwacher Meierhans.
Die Trockenheit und der Wassermangel beschäftigen viele Schweizer Gemeinden bereits heute. Die Diskussionen um einen verursachergerechten Wasserpreis dürften weiter zunehmen. Schreibt SRF.
In Zeiten einer grassierenden Inflation, die noch längst nicht überwunden ist, steigen logischerweise so ziemlich alle Preise. Balsam für unsere gequälten Portemonnaies wären eher Artikel über Produkte, deren Preise sinken. Die gibt es nämlich auch. Wie derzeit zum Beispiel das Heizöl. Aber leider bringen positive Nachrichten halt kaum Klicks. Such is Life. Zumindest bei den Medien.
Und wenn alle Stricke reissen, kann man immer noch den Konjunktiv benutzen.
-
3.8.2022 - Tag des Qualitätsjournalismus
Stimmbürger von Kansas wollen Recht auf Abtreibung beibehalten
Die Mehrheit der Stimmberechtigten im US-Bundesstaat Kansas hat es abgelehnt, einen Zusatzartikel in der Verfassung zu verankern, der die Entscheidung über das Abtreibungsrecht dem Gesetzgeber überlässt. Bisher sind Schwangerschaftsabbrüche in Kansas bis zur 22. Woche erlaubt. Kansas gilt deshalb für Frauen aus nahen Bundesstaaten wie Missouri, Oklahoma oder Texas eine Art Zufluchtsort. Dort ist Abtreibung mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen verboten. Es ist die erste solche Abstimmung, seit das Oberste Gericht der USA im Juni das bis dahin verfassungsmässig geschützte Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten gekippt hat.
Der US-Bundesstaat Kansas hat knapp zwei Millionen Einwohner, liegt in der Mitte der USA und gilt als stramm konservativ. Ausgerechnet dort will eine Mehrheit der Stimmberechtigten ein Recht auf Abtreibung nicht aus der Verfassung kippen. «Landesweit und selbst in einigen konservativen Bundesstaaten gibt es keine Mehrheit und keinen Enthusiasmus für ein Abtreibungsverbot», sagt Bob Beatty, Politologieprofessor an der Washburn University in Kansas.
Das Verfassungsreferendum war schon länger angesetzt. Die republikanische Mehrheit im Parlament von Kansas wollte damit wohl den Weg für eine Einschränkung oder ein Verbot von Abtreibungen freimachen. Das hat sie nicht erreicht.
Mehrheitsmeinung ist nicht die des Supreme Courts
Am 24. Juni kippte das Oberste Gericht in Washington das landesweite Recht auf Abtreibung. Das habe das Nein-Lager, also die Abtreibungsbefürworter in Kansas, mobilisiert. «Zuerst schien das Nein Lager weit unterlegen. Plötzlich hatte es gleich viele Spenden und Geld zur Verfügung wie das Jahr Lager. So einiges von diesem Geld kam wohl von ausserhalb von Kansas», so der Professor.
Dass selbst ein Bundesstaat wie Kansas nicht ein Recht auf Abtreibung aus der Verfassung streichen will, verstärkt ein Argument jener, die ein Recht auf Abtreibung befürworten. Der Oberste Gerichtshof in Washington habe entgegen der Mehrheitsmeinung entschieden, als er vor gut fünf Wochen das landesweite Recht auf Abtreibung kippte. Schreibt SRF.
Erinnern Sie sich noch an die atemlose Berichterstattung über den Entscheid des Obersten Gerichts der USA bezüglich Abtreibung im Juni 2022? Für viele Journalisten*innen war dies nicht nur mit dem Untergang der USA sondern gar mit dem Untergang des Abendlandes gleichzusetzen. Nicht selten wurde auch der unheilvolle Einfluss von Donald Trump und der Republikanischen Partei auf das Oberste Gericht der USA geltend gemacht, was in gewissen Bereichen tatsächlich zutrifft. Nicht aber auf den Entscheid betreffend Abtreibung.
Denn vor lauter Alarmismus wurde eine Tatsache in der Berichterstattung meistens negiert: Die Richterinnen und Richter des Obersten Gerichts der USA urteilten getreu der amerikanischen Verfassung. Ob die nun noch zeitgemäss ist oder nicht ist eine andere Frage. Das Oberste Gericht erklärte nicht die Abtreibung per se als verboten, sondern stellte lediglich fest, dass für das Gesetz über die Abtreibung nicht die US-Regierung zuständig ist sondern die amerikanischen Bundesstaaten. Gelebter Föderalismus zwischen Kantonen und Bund nennen wir dies in der Schweiz, worauf wir zu Recht Stolz sind. Und nichts anderes passiert jetzt in Kansas.
Nur zur Erinnerung: Eine Abstimmung mit Verfassungscharakter ist in der Schweiz auch nur gültig bei einem Ständemehr.
So viel zum Qualitätsjournalismus in Zeiten des Klimawandels...
-
2.8.2022 - Tag des investigativen Sommerloch-Journalismus
Erstes Foto mit Nachwuchs: «Kasachstan»-Christa Markwalder zeigt ihr Baby
Knapp vier Monate ist er alt – der Sohn von FDP-Nationalrätin Christa Markwalder und Regierungsratskandidat Peter Grünenfelder. Nun präsentierten die stolzen Eltern ihren Nachwuchs erstmals der grossen Öffentlichkeit.
Bekannt gegeben hat sie den Nachwuchs am Sechseläuten, am Nationalfeiertag zeigt sich FDP-Nationalrätin Christa Markwalder (47) erstmals mit ihrem kleinen Sohn Michel Luca. «Unser erster 1. August zu dritt mit dem stolzen Papa als Festredner in der Stadt Uster und einer wunderschönen Feier», twitterte die Berner Politikerin am Montag.
Auf die Welt gekommen ist Michel Luca Anfang April – und wie man auf dem Bild sieht, ist er mit rund vier Monaten schon recht interessiert am politischen Geschehen, jedenfalls wenn es auf einer Festbank stattfindet.
Papa will in die Regierung
Der «stolze Papa» von Michel Luca ist kein Unbekannter. Peter Grünenfelder (54) ist Direktor der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Suisse und kandidiert im kommenden Jahr für die FDP bei den Zürcher Regierungswahlen. Da ist es sicher gut, den kleinen Wonneproppen frühzeitig mit Polit-Anlässen vertraut zu machen.
Grünenfelder und Markwalder haben Ende Februar geheiratet. Erstmals gefunkt habe es zwischen den beiden Freisinnigen bei einem Konzert der Band Züri West. Es ist für beide die zweite Ehe. Markwalder war mit dem Arzt Walter Bär verheiratet, Grünenfelder mit der heutigen FDP-Nationalrätin Regine Sauter (56). Schreibt Blick.
Falls auch Sie zur Schweizer Cervelat-Prominenz gehören und einer gewissen Mediengeilheit nicht abgeneigt sind, sollten Sie stets das berühmt berüchtigte mediale Sommerloch für Ihre Zwecke nutzen.
Egal ob Geburt eines Kindes oder gar Ihr eigener Tod: Inszenieren Sie Ihre persönlichen Ereignisse stets im Sommer. So können Sie absolut sicher sein, dass Sie querbeet durch alle Medien Beachtung finden. Meistens sogar auf der Frontseite. Oder auf der Startseite bei den digitalen Portalen. Und dies nicht selten sogar über Tage hinweg.
Sollten Sie gar ein politisches Amt anstreben wie das beim Ehemann von Frau Markwalder der Fall ist, gilt es eine Regel zu beachten. Der ehemalige Bilder-Chef vom SonntagsBlick (inzwischen verstorben) erklärte vor vielen Jahren, welche Bildmotive beim Publikum wirklich Beachtung erzielen: «Kinder, Tiere, Titten. Über die Reihenfolge bezüglich Quote bin ich mir allerdings nicht ganz im Klaren.»
Was Blick in seiner atemlosen und investigativen Berichterstattung jedoch schmählich vernachlässigt ist die Frage nach dem Paten von Frau Markwalders Nachwuchs. Stammt der Götti oder die Gotte gar aus Kasachstan? Könnte ja bei «Kasachstan»-Christa durchaus möglich sein.
-
1.8.2022 - Tag der Politischen schweizer Eliten aus dem Fegefeuer der Eitelkeiten
Die weise Voraussicht von Bundespräsident Willi Ritschard in seiner Rede zum Nationalfeiertag am 1. August 1978 - «Es gilt das gesprochene Wort»
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Man kann Geburtstage auf sehr unterschiedliche Weise feiern. Auch den 1. August, den Geburtstag unseres Landes. Bei nationalen Gedenkanlässen sind wir Schweizer immer ein wenig verklemmt. Wir wissen nie recht, ob es eine Feier ist oder ein Fest. Und darum wissen wir auch nie, was für ein Gesicht wir nun eigentlich dazu machen sollen. Für mich ist der 1. August ein Fest. Ich halte unsere Eidgenossenschaft immer wieder für eine freudige Erscheinung. Und ich freue mich auch über die Tradition, dass der 1. August bei uns vor allem ein Fest der Kinder ist. So ist für manchen von uns dieser Tag eine Erinnerung an eine schöne und glückliche Kindheit.
Wir denken mehr daran als an den Rütlischwur von 1291. Ich halte das für etwas Gutes. Denn Heimat hat nicht einfach nur mit Geschichte, mit Grenzen oder mit einem politischen System zu tun. Heimat ist etwas Persönliches. Es ist die Gewissheit, zu jemandem zu gehören. Mitglied einer Gemeinschaft zu sein. Einer Gemeinschaft, auf die man sich verlassen kann, die einem schätzt und die keinen fallen lässt. Es ist das Gefühl, verstanden zu werden. Die Verpflichtung der Gemeinschaft gegenüber dem einzelnen kommt in der Sozialgesetzgebung des Staates zum Ausdruck. Indem wir gemeinsam unseren alten und invaliden, oder auch sonst bedrängten Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine gesicherte Zukunft garantieren, verteilen wir auch Freiheit. Freiheit kann sich nur in der Sicherheit entfalten. Sich sicher fühlen, in der Gemeinschaft geborgen zu sein, das ist auch das warme Gefühl, dass man eine Heimat hat.
Nicht politische und geographische Grenzen also machen die Heimat aus. Wir müssen uns bemühen, innerhalb von diesen Grenzen möglichst viel Heimat zu verwirklichen. Unser Land hat schlechtere Zeiten erlebt als heute. Die sogenannte «gute alte Zeit» war nicht für alle gut. Sie ist auch einmal die schlechte, neue gewesen. Aber unsere Welt ist komplizierter geworden.
Wir haben zwar alle von den raschen technischen Entwicklungen profitiert und geniessen die Früchte davon. Wir müssen nicht bei Petrollicht fernsehen. Aber gelegentlich scheint es doch, dass wir die Mahnung des Heiligen Niklaus von der Flühe «machet den Zuun nicht zu wyt» nur gerade auf die Geographie bezogen haben. Wir sind ein kleines Land geblieben. Aber wirtschaftlich haben wir die Grenzen des Kleinstaates gesprengt.
Ich will das nicht beklagen. Aber wir müssen wissen, dass unsere weltweiten, wirtschaftlichen Verflechtungen auch ihre Kehrseite haben. Einmal sind wir für viele mitverantwortlich geworden, was in den Ländern geschieht, mit denen wir Handel treiben, Bankgeschäfte abschliessen und an denen wir Geld verdienen. Und wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen.
Dann unterliegen unsere politischen Entscheide mehr und mehr Sachzwängen, die uns von aussen aufgedrängt werden. Und das Gefühl, nicht mehr überall selber zu bestimmen, sondern zu Entscheidungen durch andere, anonyme Kräfte gezwungen zu sein, führt dann manchen in die Resignation. Er interessiert sich so nicht mehr für den Staat und die Politik. Er denkt, das habe doch keinen Wert. Resignation ist aber ein Zurückfallen in die Angst. Und Angst ist immer ein Schritt in die Unfreiheit. Wir sind ein demokratischer Staat. Wir haben die Freiheit und die Möglichkeit, gemeinsam unsere Politik zu bestimmen. Aber Freiheiten, die man nicht benützt, die verschwinden mit der Zeit. Von Freiheit kann man nicht nur reden. Man muss sie auch leben und ausfüllen. Aber ich muss es in der letzten Zeit immer wieder sagen und schreiben:
In der Demokratie bestimmt die Mehrheit. Es ist nicht schwer, ein Demokrat zu sein, solange man zur Mehrheit gehört. Demokratische Gesinnung muss man beweisen, wenn man in die Minderheit versetzt worden ist. Diese demokratische Grundregel anerkennen nur solche Leute nicht, für die Freiheit immer nur ihre Freiheit ist.
Wir haben dieses Jahr den 150. Geburtstag von Henri Dunant gefeiert. Er hat nicht allein das Rote Kreuz gegründet. Er hat unserem Land auch weltweit zum Ruf verholfen, ein humanitäres Land zu sein, das den Menschen helfen will. Ich habe gesagt, dass wir auch mitverantwortlich geworden sind für diese Welt. Und in dieser Welt gibt es noch viel Armut. Armut aber ist eine sehr harte Form von Unfreiheit. Das darf uns nicht unbeteiligt lassen. Friede kann nur sein, wo auch Gerechtigkeit ist. Soziale Gerechtigkeit. Die besteht aber nicht. Die Güter auf der Welt sind ungleich verteilt. Es gibt Armut. Und zwar unverschuldete Armut. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Aber das kann man nicht nur mit Worten tun. Gerechtigkeit kostet etwas. Der Friede ist nicht gratis. Sind wir aber auch heute noch alle bereit, beweiskräftig zu zeigen, dass wir den Frieden wollen und für den Frieden einstehen? Ich weiss sehr gut, dass wir in unserem Lande selber auch noch viele Probleme haben. Wir sollen und müssen uns anstrengen, sie zu bewältigen. Aber wir können unsere Probleme nie nur für uns selber und ohne Rücksicht auf andere lösen. Das wäre unschweizerisch. Wir wollen ja ein solidarisches, ein humanitäres Land sein. Das Land Henri Dunants und des Roten Kreuzes.
Jeder Schweizer soll auf sein Land stolz sein dürfen. Nationalstolz gehört auch zum Heimatgefühl. Aber wer nur an sich selber denkt, hat keinen Grund, stolz zu sein. Dem glaubt seinen Stolz keiner rnehr. Zur Freiheit gehört auch die Selbstverwirklichung. Die Möglichkeit, sich oder seinen Staat zu verändern. Am 24. September dieses Jahres wird es um unsere Fähigkeit gehen, die Jurafrage würdig und eidgenössisch zu lösen. Die Gründung dieses neuen Kantons ist ein freudiges Ereignis für unser Land. Sie beweist, dass unsere Demokratie lebt. Nur was sich wandeln kann, lebt.
Jeder von uns sollte den Groll über Unschönes, das im Jura auch passiert ist, vergessen. Das Ja zum neuen Kanton ist die einzig mögliche Antwort an ein paar Hitzköpfe. Sie bekommen mit einem Ja nicht Recht, wie mancher vielleicht glauben möchte. Sie werden im Gegenteil endgültig ins Unrecht versetzt. Denn dieser neue Kanton ist nach rechtsstaatlichen Grundsätzen gebildet worden. Und er wird ein Staat sein, der mit unvernünftigen und gewalttätigen Elementen fertig werden muss und fertig werden wird. Eine Region bittet das Schweizervolk am 24. September um das Recht, ein eigener Kanton zu werden. Wir wollen zeigen, dass wir als Demokraten zu handeln verstehen. Demokraten nehmen auf Minderheiten Rücksicht. Sie lösen ihre Konflikte friedlich und vernünftig. Ich bitte Euch alle um ein freudiges Ja zum neuen Kanton.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Der 1. August ist für uns alle mit Bedeutung beladen. Wir hätten über Vieles nachzudenken. Aber richtig ist auch, dass wir aus diesem Tag einen festlichen Tag machen. Dazu gehört die Freude, die uns zusammenführt und die uns zeigt, dass wir zusammengehören.
Ich wünsche Euch und unserem Land eine schöne Bundesfeier.
Quelle: Rede Ritschard – Bundesrat / Ansprachen zum Nationalfeiertag
Kürzlich veröffentlichte SRF einen Artikel über den Schweizer Ozeanograf Jacques Piccard, der schon vor 50 Jahren vor den Klimawandel-Folgen warnte, als kaum jemand auf unserem Erdball von Klimawandel sprach. Piccard war ein intelligenter Mann und Visionär. Doch leider wurde seine Message mehr oder weniger von niemandem wahrgenommen. Ebenso erging es dem legendären Schweizer Bundesrat Willi Ritschard.
Willi Ritschard, geboren am 28. September 1918 in Deitingen auf dem Grenchenberg, war ein Schweizer Politiker (SP) aus dem Kanton Solothurn. Als Bundesrat war er zuerst Verkehrs-, dann Finanzminister und bekleidete einmal das Amt des Bundespräsidenten. Er starb am 16. Oktober 1983, 13 Tage nach seiner Rücktrittserklärung, im Amt.
In seiner Rede «Es gilt das gesprochene Wort» zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August 1978 sprach er bemerkenswert offene Worte aus damaliger Sicht über gewisse Herausforderungen, die von der Schweiz in Zukunft zu bewältigen seien.
«Wir sind ein kleines Land geblieben. Aber wirtschaftlich haben wir die Grenzen des Kleinstaates gesprengt. Ich will das nicht beklagen. Aber wir müssen wissen, dass unsere weltweiten, wirtschaftlichen Verflechtungen auch ihre Kehrseite haben. Einmal sind wir für viele mitverantwortlich geworden, was in den Ländern geschieht, mit denen wir Handel treiben, Bankgeschäfte abschliessen und an denen wir Geld verdienen. Und wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen.»
Ritschard sah die Gefahren des globalisierten Neoliberalismus und die Folgen einer mit rasender Geschwindigkeit gedankenlos deregulierten Wirtschaft voraus. Er warnte vor den Verwerfungen, die uns nun im Jahr 2022 mit voller Wucht treffen. Doch leider erging es ihm wie Piccard: Seine mahnenden Worte gingen in der Glückseligkeit des immerwährenden Wachstums unter.
Vergleicht man die Rede Ritschards aus dem Jahr 1978 mit den Plattitüden der 1. August-Reden unserer Bundesräte aus dem Jahr 2022, stellt man mit Erschrecken die Abgehobenheit unserer politischen Eliten aus dem Fegefeuer der Eitelkeiten fest.
So mokiert sich Bundesrat Alain Berset, dass in den Sozialen Medien Dauerempörung, haltlose Polemik und Wut auf Personen, die in der Öffentlichkeit stünden, vorherrschten. Raum für Annäherung, für Dialog und Kompromisse fehle. Dass er selber zu diesen Zuständen einen wesentlichen Anteil beisteuert, ist ihm in seiner Besoffenheit über die eigene Wichtigkeit nicht bewusst.
-
31.7.2022 - Tag des Wiederholungstäters Alain Berset
Unglaublicher Skandal: Bundesrat Alain «Berserker» Berset hat's schon wieder getan
Bundesrat Berset besucht heute, am 31.7.2022, die Stadt Luzern, um eine vorgezogene Festtagsrede zum 1. August in der Stadt der allergrössten Leuchten des Universums zu halten. Inklusive «Netzwerken» mit den anwesenden Wirtschaftsvertretern, Militärpiloten und Sponsoren, wie von OK-Präsidentin Schmid Meyer gewünscht.
Sein von ihm pilotiertes Flugzeug ist bereits heute morgen früh in Luzern gelandet. Bundesrat Berset wurde von der Schweizer Luftwaffe zur Landung beim Verkehrshaus der Schweiz gezwungen (siehe Bild), nachdem sein Jet unerlaubt militärisches Sperrgebiet (LIDO) überflogen hatte und unser aller Alain auf die Funknachricht von Skyguide «Attention, Hotel-Bravo-Tango-Oscar-Romeo, do you receive me?» nicht reagierte.
Irgendwie ist das Verhalten von Bundesrat Berset auch verständlich. Man spricht einen französisch sprechenden Magistraten ja auch nicht in Englisch an.
Dass er beim Überfliegen des Luzerner Lidos aus dem Flugzeug Fotos von leichtgeschürzten Sonnenanbeterinnen gemacht haben soll, ist allerdings eine üble Fake-News, von der sich der Artillerie-Verein Zofingen wie auch der Kolumnist in aller Form distanzieren.
Die Bundesanwaltschaft wurde vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) bereits eingeschaltet und wird den niederträchtigen Verdächtigungen nachgehen.

-
30.7.2022 - Tag der 1. August-Feier in Luzern ohne Beat Züsli
Bundesfeier Luzern: Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) glänzt erneut mit Abwesenheit
Zum vierten Mal führt der Verein «31/07» die Bundesfeier vor dem KKL durch. Und bereits zum vierten Mal ist der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) abwesend. Schade, meint das OK – und äussert eine Vermutung.
Zu sagen, die Stadt Luzern habe eine grosse 1.-August-Tradition, wäre übertrieben. Die letzte offizielle Bundesfeier fand 1976 statt. Danach knallten die Korken zum Nationalfeiertag der Schweiz nur noch einmal, und zwar 1991. Seither feiern die Luzerner Quartiere vereinzelt und in kleinem Rahmen.
Das änderte sich 2017. In diesem Jahr richtete der neu gegründete Verein «31/07» zum ersten Mal eine Bundesfeier auf dem Europaplatz aus. 2000 Gäste erwartete der Verein, dem Mitte-Ständerätin Andrea Gmür vorsteht. Die Festrednerin: Bundespräsidentin Doris Leuthard (CVP).
Auch in den Folgejahren wartete der inoffizielle Anlass, der im Dunstkreis der CVP aus der Taufe gehoben wurde, mit viel Prominenz auf. Bundesrat Johann Schneider-Ammann (FDP) und Bundeskanzler Walter Thurnherr gaben sich die Ehre. Viola Amherd (Mitte, ehemals CVP) hätte 2020 sprechen sollen, die Pandemie machte der Feier allerdings einen Strich durch die Rechnung.
Fernbleiben des Stapi sorgt für Kritik beim Verein «31/07»
Jetzt, nach zwei Jahren Pause, lädt der Verein wiederum vors KKL ein. Mit dabei: Bundesrat Alain Berset (SP), der am 31. Juli vor dem KKL spricht. Mit Abwesenheit glänzt hingegen der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP). An seiner Stelle nimmt Stadträtin Franziska Bitzi (Mitte) an der Bundesfeier teil.
Dass der Stadtpräsident und Parteigenosse von Berset dem Anlass bereits zum vierten Mal fernbleibt, bedauern die Organisatoren. Für Diel Schmid Meyer, Vizepräsidentin des Vereins, ist klar: «Die links-grüne Stadt will den Geburtstag der Schweiz nicht feiern, scheint es», sagt sie.
Und weiter: «Geht es um Beziehungspflege, brilliert der Stadtrat nicht wahnsinnig. Er lässt bewusst eine Gelegenheit verstreichen, um sich in Szene zu setzen und mit Bundesrat Berset und den beteiligten Firmen und Sponsoren am Anlass zu netzwerken», so Schmid Meyer.
Stadtrat soll an der Bundesfeier in Luzern präsenter sein
Die Vizepräsidentin hebt aber auch hervor, dass Stadträtin Bitzi einen «tollen Job» vor Ort mache und dass die Stadt 1500 Franken an den Apéro gesponsert habe. Nur: «Für eine schwarze Null benötigen wir 60'000 Franken. Rondellen wollen wir aber keine verkaufen. Wir würden uns deshalb wünschen, dass sich die Stadt finanziell stärker an der Bundesfeier beteiligt und der Stadtrat präsenter ist», sagt Schmid Meyer.
Bereits 2017 betonte Andrea Gmür gegenüber zentralplus, dass das Parteibuch für die Feier keine Rolle spiele. Dies, obschon viele Initianten des Vereins einen CVP-Hintergrund aufwiesen. Und auch OK-Präsidentin Schmid Meyer sagt: «Die 1.-August-Feier ist mit Vertretern des KKL, von Luzern Tourismus und der Schifffahrtsgesellschaft Luzern breit abgestützt.» Sie verstehe deshalb nicht, weshalb der Stadtpräsident dem Anlass regelmässig fernbleibe.
Bereits 2010 winkte der Stadtrat ab
Sowohl Beat Züsli als auch Franziska Bitzi waren aufgrund der Sommerferien für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Kommunikationsleiter Simon Rimle betont auf Nachfrage von zentralplus aber, dass Stadträtin Bitzi auch dieses Jahr an der Feier teilnehme und ein Grusswort an die Bevölkerung richte.
Rimle weist zudem darauf hin, dass es sich bei der Bundesfeier vor dem KKL nicht um einen offiziellen Anlass der Stadt Luzern handle. «Die Stadt will vorläufig keine eigene 1.-August-Feier organisieren», so Rimle.
Dass Stadtrat und Parlament einer offiziellen Bundesfeier in Luzern nicht erst seit gestern kritisch gegenüberstehen, zeigt ein Blick zurück ins Jahr 2010. Damals forderte die SVP-Fraktion den Stadtrat auf, eine offizielle Feier zu prüfen. Doch dieser winkte ab. Es bestehe kein Interesse seitens der Quartiervereine an einer grossen Feier, zudem müsse sich die Stadt mit einem Sparkpaket herumschlagen.
Dies sahen die Mitglieder des Grossen Stadtrats ähnlich. Sie lehnten das Postulat der SVP grossmehrheitlich ab. Schreibt ZentralPlus.
Wer so hart arbeitet wie der Luzerner SP-Stadtpräsident Beat Züsli – und dies erst noch zu einem Hungerlöhnchen von knapp 300'000 Franken pro Jahr inkl. Sozialleistungen – wird ja wohl auch einmal im Jahr Ferien machen dürfen. Zumal sein Fernbleiben von der 1. August-Feier in Luzern ausser ZentralPlus nun wirklich niemanden interessiert.
Hinzu kommt noch, dass ein Auftritt von Beat Züsli zusammen mit Bundesrat Alain «Berserker» Berset seine Wahlchancen bei den kommenden Stadtratswahlen nicht unbedingt fördern dürfte.
Die Aussage von Madame Diel Schmid Meyer «Geht es um Beziehungspflege, brilliert der Stadtrat nicht wahnsinnig. Er lässt bewusst eine Gelegenheit verstreichen, um sich in Szene zu setzen und mit Bundesrat Berset und den beteiligten Firmen und Sponsoren am Anlass zu netzwerken» ist allerdings mehr als merkwürdig: Dass ein Anlass zur Feier des Schweizerischen Nationalfeiertags zum «Netzwerken» mit Sponsoren missbraucht wird ist wohl kaum im Sinne der Erfinder*innen. Da wird einem Beat Züsli, der dem «Netzwerken» fernbleibt, fast schon wieder sympathisch.
Wer Beat Züsli unbedingt live und wahrhaftig sehen will, soll einfach ab und zu eines der hochpreisigen Luzerner Feinschmeckerlokale besuchen. Dort ist Beat Züsli eher anzutreffen. Möglicherweise sogar öfters als im Rathaus, wie böse Zungen behaupten.
Das sind aber wirklich nur böse Lästerzungen, von denen ich mich in aller Form distanziere, obschon auch ein blindes Huhn wie beispielsweise ein SVP-Trychler ab und zu ein Korn finden kann.
So viel Gerechtigkeit gegenüber der SVP und ihren Trychlern muss sein!
-
29.7.2022 - Tag der intelligenten Menschen und ihren Kontrahenten
Jacques Piccard warnte schon vor 50 Jahren vor den Klimawandel-Folgen
Der Schweizer Ozeanograf war Pionier der Tiefseeforschung und engagierte sich schon früh gegen Umweltverschmutzung.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es ausgerechnet ein Schweizer war, der den tiefsten Punkt des Meeres als Erster erreichte. Am 23. Januar 1960 tauchte Jacques Piccard in einem selbst gebauten U-Boot auf den Grund des Marianengrabens im Pazifischen Ozean auf 10'916 Meter Tiefe.
Seine Schilderungen zeigen, dass solche Touren nicht ganz ohne waren. Bei einem Tauchgang im Mittelmeer seien sie sehr schnell hinuntergetaucht, etwa einen Meter pro Sekunde, erzählte der Forscher 1953 gegenüber Radio Beromünster: «So sind wir tief in den Meeresboden eingesunken. Der Schlamm hat bis zu den Fenstern gereicht.» Der Tauchgang von 1960 musste dann gar wegen Rissen im Fenster vorzeitig beendet werden.
Die Tiefsee lebt
Für seine Pionierleistung erhielt Piccard vom damaligen US-Präsidenten Dwight Eisenhower eine Ehrenmedaille. Wichtiger als diese Auszeichnung war dem Ozeanografen allerdings eine Beobachtung am Meeresgrund: Er hatte dort nämlich einen Fisch gesehen.
Wenn es Tiere in dieser Tiefe gab, bedeutete das, dass auch dort unten eine Strömung Sauerstoff hinbrachte. Dann konnte diese Strömung aber auch andere Dinge wieder wegbringen, beispielsweise radioaktiven Abfall, den man damals nicht selten ins Meer kippte. Diese Erkenntnis verstärkte sein Engagement für die Umwelt noch.
Dass es dem Schweizer in erster Linie nicht um Rekorde ging, sondern um die Wissenschaft, zeigt ein Interview von 1963. Damals kündigte er an, auf den Grund des Genfer Sees tauchen zu wollen. Es gebe auch in geringeren Tiefen sehr viele interessante Dinge zu sehen, erklärte er.
Anlässlich der Expo 64 ermöglichte Piccard dann auch Normalsterblichen tiefe Einblicke. So baute er das erste U-Boot für Touristinnen und Touristen, das über 30'000 Menschen unter die Wasseroberfläche des Genfersees beförderte. Später setzte er das U-Boot für Forschungszwecke ein.
Begnadete Forscherfamilie
Piccards Freude an der Forschung kam nicht von Ungefähr. Bereits sein Vater Auguste Piccard war ein Pionier der Luftfahrt und Meeresforschung. Es gelang ihm, seinen Sohn, der eigentlich Geschichte und Wirtschaft studiert hatte, für die Tiefsee zu begeistern.
Eine weitere Pionierleistung von Jacques Piccard war die Erforschung des Golfstroms an der Ostküste der USA. 1969 liess er sich zusammen mit sechs anderen Forschern einen Monat lang in einem U-Boot im Golfstrom treiben. Dabei konnte er viele Erkenntnisse über die Unterwasser-Flora und -Fauna sammeln.
Seiner Zeit voraus
1972 wurde er deshalb als Sonderberater an die erste UNO-Umweltkonferenz eingeladen. Ein Interview von 1973 verdeutlicht, wie sehr Piccard seiner Zeit damals voraus war: «Man muss nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit systematisch auf saubere Energien setzen», erklärte er. Die sauberste Energie überhaupt sei die Solarenergie.
Bereits damals warnte er hellsichtig vor den Folgen des Klimawandels. «Wenn wir Erdöl und Kohle weiterhin als Energielieferanten nutzen, dann erzeugt das eine sehr grosse Hitze und diese kumuliert sich dann in der Atmosphäre», so Piccard.
Der Ozeanograf verbrachte seinen Lebensabend in der Schweiz im Kanton Waadt, wo er 2008 im Alter von 86 Jahren starb. Sein Bewusstsein für den Umweltschutz lebt jedoch in seinem Sohn Betrand Piccard weiter. 1999 umrundete dieser als Erster die Erde nonstop in einem Heissluftballon. Zudem gründete er eine Stiftung zur Förderung der Solarenergie. Schreibt SRF.
Intelligente Frauen und Männer mit visionärem Blick auf die Gefahren – wie auch auf die Chancen – für die Zukunft von Mensch und Umwelt gab es schon immer und zu jeder Zeit seit Bestehen der Menschheit. Nicht nur in der Schweiz.
Doch was nützen intelligente Menschen, wenn die Staaten der Erde von dummen Politikern*innen im Gleichklang mit den skrupellosen und fern jeglicher Moral und Ethik agierenden Mächtigen aus Industrie und Wirtschaft regiert werden?
-
28.7.2022 - Tag der korrupten Autokraten
Russland-Experte erklärt Putins Plan: Darum schickt Putin seinen Aussenminister auf Afrika-Tour
Putin hat seinen Aussenminister Lawrow auf Afrikareise geschickt. Und so klappert er ein Land nach dem anderen ab. Aber warum? Was steckt dahinter? Russland-Experte Ulrich Schmid erklärt die ungewöhnliche Tour.
Der russische Präsident Wladimir Putin (69) streckt seine Fühler Richtung Afrika aus. Sein Aussenminister Sergei Lawrow (72) ist am Sonntag abgereist, um Ägypten, Äthiopien, Uganda und die Republik Kongo zu besuchen – nicht ohne im Vorfeld Stimmung zu machen.
Vor seiner Abreise schrieb Lawrow in Zeitungen dieser vier Länder: «Wir wissen, dass die afrikanischen Kollegen die unverhohlenen Versuche der USA und ihrer europäischen Satelliten, der internationalen Gemeinschaft eine unipolare Weltordnung aufzuzwingen, nicht gutheissen.»
Um Stimmung gegen den Westen zu machen, nutzen die Russen besonders ein Thema gerne: den Kolonialismus. Europäische Länder waren in der Vergangenheit in afrikanische Länder eingefallen und zwangen den Menschen ihre Lebensweise und Religion auf. Russland sei «nicht mit den blutigen Verbrechen des Kolonialismus befleckt», schrieb Lawrow, und «drängt anderen nichts auf und lehrt sie nicht, wie sie zu leben haben».
Russen wollen Hunger und die sozialen Unruhen Afrikas nutzen
Zudem hat Putin vergangene Woche in einer Ansprache über die «goldene Milliarde» gelästert – die Bevölkerung der reichen G7-Staaten, die auf Kosten Afrikas und Asiens in Wohlstand leben würden.
Was hat Putin mit Afrika vor? «Das isolierte Russland versucht, eine neue geopolitische Koalition zu schmieden», sagt Ulrich Schmid (56), Russland-Experte an der Uni St. Gallen. Putin empfehle sich den afrikanischen Staaten als stabiler Partner, der – anders als die USA mit ihren Mahnungen zu Menschenrechten und Demokratie – ohne moralische Ansprüche auf sie zugehe.
Lawrow wird den Hunger und die sozialen Unruhen Afrikas zum Vorteil Russlands nutzen. Denn wegen des Krieges sind die Preise für lebenswichtige Güter wie Getreide explodiert. Es droht eine Hungersnot. Lawrow hat versprochen, die blockierten Weizen in der Ukraine freizugeben.
Kein afrikanisches Land hat sich den Sanktionen angeschlossen
Dass die Kreml-Botschaft in Afrika ankommt, dafür sorgen die russischen Propagandamedien. Im Gegensatz zum Westen, wo sie teilweise gesperrt worden sind, dürfen sie in Afrika weiterhin ungehindert Desinformationen verbreiten. An mehreren Orten haben die staatlichen russischen Sender Russia Today (RT) und Sputnik ihr Angebot sogar ausgebaut und senden auch auf Französisch, um eine möglichst breite Bevölkerung zu erreichen.
Die Sympathie oder auch die Angst und Abhängigkeit afrikanischer Staaten gegenüber Moskau ist gross – nicht zuletzt auch wegen der privaten Wagner-Truppe, die in verschiedenen Staaten als militärischer Stabilisator der aktuellen Regimes auftritt. Kein afrikanisches Land hat sich den amerikanischen und europäischen Sanktionen angeschlossen, als es darum ging, Russland für den Einmarsch in die Ukraine zu bestrafen.
Ulrich Schmid geht davon aus, dass sich afrikanische Staaten wirtschafts- und geopolitisch auf Russland zu bewegen werden. Der Experte zu Blick: «Das könnte heissen, dass Russland bei den afrikanischen Ländern eine grössere Abstimmungsdisziplin in der UN-Vollversammlung einfordert oder eine Begünstigung bei der Lieferung von Rohstoffen wie seltene Erden verlangt.» Schreibt Experte Guido Felder im Blick.
Wenn sich die afrikanischen Staaten wirtschafts- und geopolitisch auf Russland zu bewegen wie Experte Felder annimmt, ist das für den vielgeschmähten Westen keine schlechte Nachricht: Vielleicht bewegen sich damit ja auch die afrikanischen Flüchtlingsströme auf Russland zu.
Wäre ich ein derart begnadeter Experte wie Guido Felder würde ich die Umarmung zwischen Russland und Afrika frei nach Willy Brandt etwas anders formulieren: «Es wächst zusammen, was zusammen gehört.» Korruption der übelsten Art und autokratische Staaten reichen sich die Hand zum Bund fürs Leben. Denn viel mehr hat Russland nicht zu bieten. Ausser Rohstoffen auch Afrika nicht. Und davon hat Putin ja genug.
Ansonsten sind die Claims auch für Russland in Afrika längst bezogen: China beutet die afrikanischen Rohstoffe aus und die hehre westliche Wertegemeinschaft ist zuständig für die Milliardenbeiträge von Hilfsgeldern. Und vermutlich auch weiterhin für die afrikanischen Flüchtlingsströme. Dafür sorgt die ewig währende Schuld der Kolonialisierung Afrikas durch den Westen.
-
27.7.2022 - Tag der Banksters
Rote Zahlen im zweiten Quartal: Credit-Suisse-CEO Gottstein tritt ab – Ulrich Körner übernimmt
Der Konzernchef der Credit Suisse, Thomas Gottstein, tritt zurück. Neuer Chef wird Ulrich Körner, er tritt sein Amt zum 1. August an. Die CS schreibt das dritte negative Quartalsergebnis in Folge.
Im zweiten Quartal 2022 hat die zweitgrösste Schweizer Bank einen Verlust von 1.59 Milliarden Franken eingefahren, wie die CS bekannt gab. Wie bereits im Juni angekündigt, hat vor allem ein stark negatives Ergebnis in der Investmentbank die Grossbank in die roten Zahlen gezogen. Im gleichen Vorjahresquartal hatte die CS noch einen Gewinn von 253 Millionen Franken erzielt.
Seit zweieinhalb Jahren Konzernchef
CEO Gottstein leitet die Bank seit Mitte Februar 2020, nachdem sein Vorgänger Tidjane Thiam wegen einer Beschattungsaffäre hatte zurücktreten müssen. Unter Gottsteins Ägide hat die Bank jedoch erneut eine Reihe von kostspieligen Debakel erlitten, darunter die Zusammenbrüche von Greensill Capital und Archegos Capital Management Anfang 2021. Gottstein sollte eigentlich die Sanierung der Bank leiten.
Doch riss die Welle der negativen Berichterstattung nie ab, auch am Mittwoch nicht. So wurde bekannt, dass die CS laut einem Gericht in den Bermudas 607 Millionen Dollar in einem Streitfall mit dem früheren georgischen Regierungschef Bidzina Ivanishvili bezahlen muss.
Das Gericht auf der karibischen Inselgruppe hatte die Credit Suisse Ende März zu einer Zahlung an Ivanishvili verurteilt. Allerdings hatte es zunächst die genaue Urteilssumme noch offen gelassen. Die Schweizer Grossbank hatte umgehend angekündigt, das Urteil anzufechten.
Rückendeckung von VRP für Gottstein
Ende April hatte CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann dem unter Beschuss geratenen Gottstein noch den Rücken gestärkt. Die Rückkehr der krisengeschüttelten Grossbank in die richtige Spur solle gemeinsam mit Gottstein geschafft werden, hatte Lehmann in einem Interview gesagt.
Er habe Gottstein nicht ersetzt, weil dieser gut sei, betonte Lehmann. «Er kennt die Investmentbank, die Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft. Bei so vielen Neubesetzungen braucht es an der Spitze auch jemanden, der weiss, wie die ganze Organisation tickt und wer die Schlüsselkunden sind.» Die CS habe in der Führung im Moment eine gute Mischung aus Kontinuität und Veränderung.
Angesprochen auf die Turbulenzen der vergangenen Monate hielt Lehmann fest: «Wir sind in einem Formtief. Aber die Credit Suisse ist nach wie vor eine gute Bank mit viel Substanz.» Die CS habe eine Governance-Krise, ein Vertrauensproblem und müsse konsequent Altlasten abarbeiten. «Es darf keine solche Häufung von unerfreulichen Überraschungen mehr geben».
Aktie im Sinkflug
Die Aktie der Credit Suisse leidet derweil stark unter dem Formtief der Bank. Kostete sie an der Schweizer Börse noch im Februar 2021 rund 13 Franken, so ist das Papier inzwischen für etwas mehr als einen Fünfliber zu haben. Und diesen Monat fiel die Aktie erstmals gar kurzzeitig unter die Schwelle von 5 Franken.
Die zweitgrösste Schweizer Bank hat eine «umfassende strategische Überprüfung» angekündigt, mit der u.a. die Kostenbasis mittelfristig deutlich auf unter 15.5. Milliarden Franken gesenkt werden soll. «Das Ziel der Überprüfung besteht darin, eine fokussiertere, agilere Gruppe mit einer deutlich niedrigeren absoluten Kostenbasis zu schaffen, die allen Anspruchsgruppen nachhaltige Erträge liefern sowie Kundinnen und Kunden herausragende Dienstleistungen bieten kann», schreibt die CS dazu in der Mitteilung. Schreibt SRF.
Wie hoch ist der angebliche Fehlbetrag bei der AHV? Sie wissen es nicht, obschon wir demnächst über die Erhöhung des AHV-Eintrittsalters abstimmen?
Kein Problem, ich kann Ihnen wie immer weiterhelfen: Der Fehlbetrag der AHV beträgt weniger als vier Prozent der 26 Milliarden Boni, die von der CS an ihre Bankster-Koryphäen seit 2014 ausbezahlt wurden und auch weniger als der Verlust von 1,59 Milliarden, den die CS in einem einzigen Quartal eingefahren hat.
1,59 Milliarden innerhalb von drei (!) Monaten zu versenken muss man erst einmal schaffen. Hut ab vor dieser gewaltigen Leistung.
Gemäss einem ehemaligen FDP-Bundesrat, der am Ende seiner Amtszeit öfters mal einschlief, sind diese Boni allerdings mehr als gerechtfertigt. Denn nur mit diesen monetären Lockvögelchen könnten bei den Banken die Allerbesten aller besten Banksters als Mitarbeiter*innen angeworben werden.
Was soll's? Ebendieser etwas schläfrige Bundesrat fiel auch mit weiteren, nicht unbedingt geistreichen Aussagen auf. So verkündete er nach Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten: «Immerhin ist jetzt ein Unternehmer US-Präsident.»
Das sagt weniger über The Donald aus als über die moralische Verkommenheit eines durch und durch abartig neoliberal gestrickten Politikers. «L'État, c'est moi». Der Staat bin ich! Die Unternehmer als neue Sonnenkönige?
Frei nach Forrest Gump, leicht abgewandelt: «Dumm ist der, der Dummes sagt». Es ist nicht verboten, Dummes zu sagen. Problematisch wird es erst, wenn diese Boten der Dummheit ihre eigenen Absonderungen auch noch selber glauben.
Noch Fragen zum abartigen Neoliberalismus, Kienzle?

-
26.7.2022 - Tag der afrikanischen Naturschützer
Afrika nimmt den Naturschutz selbst in die Hand
Afrikanischen Experten ist die Deutungshoheit über den Naturschutz seitens der "Ersten Welt" schon lange ein Dorn im Auge. Die Denkweise ist tief im Kolonialismus verwurzelt.
Zuletzt schlugen die selbsternannten Naturschützer im Juni zu. Wieder einmal sollten die Masaai einer Vergrößerung des Serengeti-Parks weichen: Als sie sich weigerten, schoss die tansanische Polizei mit scharfer Munition und tötete einen Angehörigen der legendären Volksgruppe, deren Hirten mit langen Stöcken in keinem Werbeprospekt der Serengeti fehlen.
Seit der Gründung des Parks mussten die Masaai schon wiederholt dem Schutzgebiet weichen: Zuletzt zugunsten eines Jagdgebiets für arabische Ölscheichs, deren Dollar-Banknoten die Regierung in Dodoma betörten. Schließlich müsse das viele, für den Schutz wilder Tiere nötige Geld auch irgendwo herkommen, heißt es.
Der Vorfall wirft ein grelles Licht auf die Absurdität des afrikanischen Naturschutzes. Eine Volksgruppe, die seit Jahrtausenden in einem Naturparadies lebt und dies beschützt hat, wird aus Gründen des Naturschutzes verjagt. In diesem Fall zugunsten begüterter Ausländer: Die Ölscheichs dürfen wohl auch den einen oder anderen Löwen abknallen. Von ihrer Bezahlung sehen die Masaai allerdings nichts: Das geht zur Regierung in Dodoma – wer weiß, wo die Petrodollar schließlich landen. Ein "unbegreiflicher Vorgang", meint der Geschäftsführer der African Wildlife Foundation, Kaddu Sebunya: "Wir müssen die Art und Weise, wie Naturschutz auf unserem Kontinent betrieben wird, von Grund auf verändern."
Erster afrikanischer Naturschutzkongress
Der kenianische Naturschützer organisierte den "Kongress für Afrikas Schutzgebiete", der in der vergangenen Woche in Ruandas Hauptstadt Kigali stattfand. Das erste Mal, dass sich Regierungsvertreter von 52 afrikanischen Staaten und Manager der rund 8.500 Naturschutzgebiete des Kontinents im eigenen Kreis und nicht unter der Ägide ausländischer Naturschutzorganisationen trafen.
Afrikanischen Experten ist die Deutungshoheit über den Naturschutz seitens der "Ersten Welt" schon lange ein Dorn im Auge: Sie führen deren Denkweise auf den Kolonialismus zurück – und dessen Verständnis des Naturschutzes als "Festung". Europäer sehen Afrikas Bevölkerung als größten Feind der großartigen Fauna und Flora ihres Kontinents: Sie müssen durch Zwangsumsiedlungen, mit Feuerwaffen und Stacheldrahtzäunen von den Schutzgebieten ferngehalten werden.
Dass es die Afrikaner waren, die ihre Tier- und Pflanzenwelt (im Gegensatz zu den Europäern) über Jahrtausende erhalten haben, bleibt genauso unerwähnt wie der Umstand, dass es die Europäer waren, die während der Kolonialzeit mit ihren Jagdflinten für eine Verminderung der afrikanischen Wildbestände um bis zu 90 Prozent sorgten.
Wildparks mit fragwürdiger Geschichte
Dass sie die Wildparks weniger zum Schutz der Natur als zum Schutz ihrer Jagd- und Abenteuerinteressen eingerichtet zu haben, wird den Europäern auch vorgeworfen: Schließlich sind Afrikas Nationalparks ausschließlich auf die Bedürfnisse ausländischer Touristen ausgerichtet – ob sie mit Fotoapparaten oder Repetiergewehren kommen. Dagegen kommen Afrikaner und Afrikanerinnen in den Reservaten vornehmlich als tanzende Mädchen in Baströckchen, als Kellner oder höchstens als Spurensucher vor. Für sie seien Elefanten nur als Fleisch in der Suppe interessant, spotten Touristen gerne. Die Diskrepanz zwischen dem Urlaubsleben weißer Naturfreunde in den Parks und dem ärmlichen Leben afrikanischer Dorfbewohner jenseits der Parks könnte nicht größer sein.
Derzeit fordert die internationale Naturschutzlobby, mindestens 30 Prozent der gesamten Erdoberfläche unter Schutz zu stellen, um der Klimaerhitzung und dem Artensterben zu begegnen. Tansania ist jetzt schon am Ziel angelangt: Ein Drittel seiner Fläche steht unter Naturschutz. Dort darf weder ein einheimischer Rancher seine Rinder weiden noch der Staat nach Bodenschätzen suchen lassen. Wird in einem Schutzgebiet ein Staudamm gebaut, um die Bevölkerung mit Strom zu versorgen, schreit der Rest der Welt auf.
Koexistenz von Mensch und Tier
Solange die Interessen und Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung nicht berücksichtigt werden, könne Naturschutz nur scheitern, sagt Kaddu Sebunya. Unter anderem müsse die Ökonomie in den Regionen um die Parks auf die Schutzgebiete abgestimmt werden, sagt der Sozialwissenschafter: Denn nichts ist für wilde Tiere gefährlicher als arme und unzufriedene Menschen.
Seit einiger Zeit versuchen – auch internationale – Naturschutzorganisationen in Projekten herauszufinden, wie die Koexistenz von Mensch und wilden Tieren aussehen könnte. Einfach ist es nicht, aber machbar, so der Kern ihrer Erkenntnis. Natürlich spielt dabei auch das Geld eine Rolle, das für die Integration menschlichen Wirtschaftens mit der wilden Natur zur Verfügung steht. Bisher verfügten fast ausschließlich ausländische Regierungen und Naturschutzverbände über die Finanzen: Das soll sich nun ändern.
Einer der wichtigsten Beschlüsse der über 2.000 afrikanischen Delegierten in Kigali war die Bildung eines panafrikanischen Fonds, aus dem der Naturschutz finanziert werden soll und in den ausländische Regierungen und Naturschützer einzahlen können. Afrikaner wären dann erstmals in der Lage, selbst darüber zu entscheiden, auf welche Weise die einzigartige Natur ihres Kontinents geschützt werden soll. Schreibt DER STANDARD.
Wird auch langsam Zeit, dass Afrika seine Zukunft selbst in die Hand nimmt und damit aus den milliardenschweren Spendenbudgets des Westens langsam aber sicher verschwindet. Auch wenn dadurch einige NGO und sonstige Bettelorganisationen der hehren «westlichen Wertegemeinschaft» arbeitslos werden. Was wiederum ein Geschenk für die Industrie des derzeit arg gebeutelten Westens bedeuten würde, die ja angeblich «händeringend» Fachkräfte sucht.
Jetzt wäre die neue Weltmacht China gefordert, humanitäre Hilfe in Afrika zu leisten und nicht nur die Rohstoffe des Kontinents zu Discountpreisen zu plündern.
Man sollte sich jetzt nicht allzu grosse Hoffnungen für den afrikanischen Naturschutz machen, sondern den obigen Artikel genau durchlesen. Die 52 afrikanischen Staaten mit mehr als 2'000 teilweise «selbsternannten» Delegierten am «Kongress für Afrikas Schutzgebiete», der in der vergangenen Woche in Ruandas Hauptstadt Kigali stattfand, vertreten nichts anderes als knallharte wirtschaftliche Interessen.
Der Westen täte gut daran, keine weiteren Milliardenzahlungen an den «panafrikanischen Fond» oder sonstige afrikanische Geldvernichtungsinstitutionen mehr zu leisten. Dass diese Unsummen letztendlich im unendlichen Sumpf der afrikanischen Korruption versickern, ist so sicher wie das von christlichen Missionaren in Afrika gepredigte Amen in der Kirche.
China als grosser Profiteur seiner langfristig ausgerichteten Afrikapolitik hätte da sicher bessere Vorschläge für unsere ehemaligen Kolonien. Die chinesische Ein-Kind-Politik wäre einer davon und dürfte wohl das wirksamste Mittel gegen die afrikanische Armut sein und erst noch den Naturschutz und die Artenvielfalt stärken.
-
25.7.2022 - Tag der Boulevard-Schwurbler von der Zürcher Dufourstrasse
Verschärfung im Ukraine-Konflikt: Moskau strebt Regimewechsel in Kiew an
Also doch: Moskau strebt den Regimewechsel in Kiew an. Russland habe es nicht länger nur auf Eroberungen abgesehen. Das bestätigt der russische Chefdiplomat Lawrow. Selenski kontert und appelliert an die nationale Einheit, sich endlich von Russland zu befreien.
Russlands Aussenminister Sergej Lawrow (72) hat im Gegensatz zu früheren Äusserungen erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebt. «Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien», sagte Lawrow am Sonntag in Kairo. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben.
Die russische Führung hat in den vergangenen Tagen öffentlich ihre Position im Ukraine-Krieg verschärft. So drohte Lawrow am Mittwoch mit der Besetzung weiterer Gebiete auch ausserhalb des Donbass. Angesichts der westlichen Waffenlieferungen und deren höherer Reichweite sei es nötig, die Kiewer Truppen weiter abzudrängen von den Gebieten Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine, die Moskau als unabhängig anerkannt hat.
Selenski kontert
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (44) ging gleich auf diese verschärften Drohungen seitens der Russen ein. Die Bewahrung der nationalen Einheit sei die wichtigste Aufgabe der Ukrainer, um den Krieg zu gewinnen und Mitglied der EU zu werden. «Jetzt die Einheit zu bewahren, gemeinsam für den Sieg zu arbeiten, ist die wichtigste nationale Aufgabe, die wir zusammen bewältigen müssen», sagte Selenski am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache.
Selenskis Ansprache war eine Antwort auf Lawrows Kursverschärfung, die «volks- und geschichtsfeindliche Führung» in Kiew stürzen zu wollen. «Nur diejenigen, die die wahre Geschichte nicht kennen und ihre Bedeutung nicht spüren, konnten sich entscheiden, uns anzugreifen», erwiderte Selenski darauf nun. Jahrhunderte seien die Ukrainer unterdrückt worden und sie würden ihre Unabhängigkeit niemals aufgeben, versicherte der ukrainische Präsident.
Wenn die Ukrainer dies schafften, werde ihnen gelingen, was Generationen vorher misslungen sei. Die Unabhängigkeit von Russland zu wahren, sich zu einem der modernsten Staaten der Welt zu wandeln und gleichzeitig den eigenen Weg Richtung Europa zu gehen, der nach Angaben Selenskis mit einer Vollmitgliedschaft in der EU enden wird.
Kurswechsel Moskaus
Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (41) warf Russland Propaganda vor. «Russland benutzt jedes Mal ein anderes Argument. Diesmal sagen sie, es sei wegen der militärischen Unterstützung», sagte die Grünen-Politikerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Deutschen Welle.
Kriegsziele des Kreml sind, dass die Ukraine die Gebiete Donezk und Luhansk abtritt und die bereits 2014 von Russland annektierte Krim als russisch anerkennt.
Mit seiner Ankündigung, die politische Führung in Kiew auswechseln zu wollen, widerspricht Lawrow auch eigenen Aussagen vom April. «Wir haben nicht vor, das Regime in der Ukraine zu wechseln», sagte der russische Chefdiplomat damals in einem Interview mit dem Fernsehsender «India Today». Es sei Aufgabe der Ukrainer zu entscheiden, unter welcher Führung sie leben wollten, versicherte Lawrow damals. Schreibt Blick.
O je! Das ist jetzt aber wirklich nichts Neues aus dem Osten, wie Erich Maria Remarque (leicht abgeändert) schrieb! Was würden die Boulevard-Schwurbler von der Dufourstrasse in Zürich ohne Ukraine-Liveticker im diesjährigen Sommerloch nur machen? Noch mehr Idioten-News über die botoxierten Lippen der unsäglichen Frau Geissen veröffentlichen?
Doch fairerweise sei festgehalten, dass die Zürcher Dufourstrasse einen entsprechenden Markt bedient. Was mehr über den geistigen Horizont unserer Gesellschaft aussagt als über Blick.
-
24.7.2022 - Tag der legalen Korruption
Krankheit auf dem Vormarsch: WHO ruft wegen Affenpocken «internationale Notlage» aus
Wegen Affenpocken-Nachweisen in mehr als 70 Ländern ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine «Notlage von internationaler Tragweite» aus. Das gab WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus an einer Pressekonferenz in Genf bekannt. In der Schweiz sind bislang 229 Affenpocken-Fälle nachgewiesen (Stand 22. Juli).
Die «Notlage von internationaler Tragweite» ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Praktische Auswirkungen hat das zunächst nicht.
Die Einstufung soll die Regierungen der Mitgliedsländer dazu bewegen, Massnahmen zu ergreifen, um den Ausbruch einzudämmen. Sie sollen Ärzte und Kliniken sensibilisieren, bei Verdachtsfällen Schutzmassnahmen treffen und die Bevölkerung aufklären, wie sie sich vor einer Ansteckung schützen kann.
Über 16'000 Fälle in 75 Ländern bestätigt
«Wir haben einen Ausbruch, der sich durch neue Übertragungswege schnell auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Wir wissen zu wenig darüber, aber er erfüllt die Kriterien für eine internationale Notlage», erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstagnachmittag an einer Pressekonferenz in Genf.
Mittlerweile seien über 16'000 Affenpocken-Fälle in 75 Ländern bestätigt, darunter fünf Todesfälle. Das Risiko, sich anzustecken, besteht laut WHO derzeit vor allem in Europa. «Das Virus wird hauptsächlich beim Sex unter Männern verbreitet. Das bedeutet, dass dieser Ausbruch gestoppt werden kann – mit den richtigen Strategien in der richtigen Gruppe», sagte Tedros. Zugleich warnte die WHO vor einer Stigmatisierung dieser Gruppen.
Ob wegen der Affenpocken der Gesundheitsnotstand erklärt werden soll, war in der WHO umstritten. Generaldirektor Tedros erklärte, er habe die Entscheidung gegen die Mehrheit des beratenden Expertenkomitees getroffen. Sechs Mitglieder des Gremiums hätten für diese Einstufung und neun dagegen gestimmt.
Die WHO hatte bereits im Juni wegen der Häufung der Affenpocken-Fälle in Ländern, in denen die Infektionskrankheit bislang praktisch unbekannt war, einen Notfall-Ausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus 16 Fachleuten zusammen, die sich mit der Krankheit auskennen.
In den USA sind inzwischen mehr als 2800 Affenpocken-Fälle bestätigt. Diese Woche sind laut Gesundheitsbehörde CDC auch zwei Fälle von Affenpocken bei Kindern nachgewiesen worden.
In der Schweiz müssen Ansteckungen mit Affenpocken seit dem 20. Juli dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldet werden. Wie das BAG schreibt, sollen so Erkenntnisse über den Übertragungsweg von Affenpocken gewonnen werden. In der Schweiz sind bislang 229 Affenpocken-Fälle nachgewiesen (Stand 22. Juli), der erste Fall trat am 21. Mai auf.
Derzeit geht das BAG von einer «mässigen Gefahr» für die Bevölkerung aus, wie das Bundesamt auf seiner Website schreibt. Man werde die weitere Entwicklung genau beobachten und die Risikobeurteilung den neusten Erkenntnissen anpassen.
Nicht vergleichbar mit Corona
Auch den Ausbruch des Coronavirus Sars-CoV-2 hatte die WHO am 30. Januar 2020 als «Notlage» deklariert. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen sich nun bei Affenpocken auf dieselben Massnahmen wie bei der Corona-Pandemie einstellen müssen. Denn die Krankheiten lassen sich nicht miteinander vergleichen.
Während sich das Coronavirus durch Aerosole mit Virenpartikeln verbreitet, die Infizierte beim Atmen, Sprechen oder Husten ausstossen, erfolgen Infektionen mit Affenpocken nach derzeitigem Wissensstand in der Regel durch engen Körperkontakt. Schreibt SRF.
Scheinbar braucht Big Pharma nach Corona ein neues Betätigungsfeld, um die Milliardengewinne der letzten zwei Jahre sowie die Milliarden an Dividendenausschüttungen an die entsprechenden Aktionäre und Stakeholder weiterhin sprudeln zu lassen.
Anders ist der Alarmismus der WHO bei 16'000 Erkrankten und einer Weltbevölkerung von mehr als 7,96 Milliarden Menschen (Juli 2022) beim besten Willen nicht mehr zu erklären.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO wird mittlerweile zu 80 Prozent von privaten Geldgebern und Stiftungen finanziert. Grösster privater Geldgeber ist die «Bill und Melinda Gates Stiftung». Wesentlich höher sind allerdings die finanziellen Beiträge der «vereinten» Big Pharma.
Dass da unsägliche und absolut irrsinnige Verschwörungstheorien für schlichte Gemüter entstehen, sollte einen nicht wundern, auch wenn diese Theorien noch so hanebüchen sind. Man erinnere sich an den «Mikrochip von Bill Gates», der mit der Coronaimpfung gespritzt werde. Mehr Schwachsinn geht zwar immer, aber solche Behauptungen in Sachen Verblödung zu toppen, wird schwierig.
Nennen wir das Kind doch schlicht und einfach beim Namen: Die legalen Spenden von Big Pharma, Bill Gates & Konsorten sind nichts anderes als Mittel zum Zweck der Einflussnahme. Würde man die hehren Wertemassstäbe der westlichen Wertegemeinschaft wirklich ernst nehmen, müsste man wohl von «legaler Korruption» sprechen.
-
23.07.2022 - Tag des wahltaktischen Parteienpalavers
Zu wenig Gas und Strom? Die Rezepte der Parteien gegen die drohende Energiekrise
Ob Stromgeneral, Stromsparen oder Reserven schaffen – jede Partei hat ein Rezept gegen die drohende Energiekrise.
Das russische Gas fliesst wieder – doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Auch die Schweizer Parteien fordern schnelles Handeln.
SVP
Vor den Medien erklärt die Partei heute, die Schweiz sei völlig ungenügend vorbereitet auf eine mögliche Energiekrise. «Die SVP fordert, dass sich Anfang August alle relevanten Parteien an einem Tisch treffen und dringliche Lösungen suchen, wir müssen diese Energielücke schliessen», erklärt Fraktionschef Thomas Aeschi. Zudem wiederholt er die Forderung der SVP nach einem Stromgeneral: «Eine Person muss verantwortlich sein», so Aeschi weiter.
Weiter möchte die SVP zahlreiche Investitionen im Energiebereich, unter anderem Gas-Lager in der Schweiz. Denn beim Gas ist die Schweiz komplett vom Ausland abhängig und hat deshalb im Ausland Gas-Speicherkapazitäten angelegt, die aktuell gefüllt werden.
FDP
Die Gas-Speicher sind auch bei der FDP ein wichtiges Thema. Im Gegensatz zu der SVP ist die Partei aber zufrieden mit den Massnahmen. FDP-Energiepolitiker Matthias Jauslin ist der Meinung, die Schweiz sei gut vorbereitet auf eine mögliche Krise. «Was wir jetzt sichern müssen, ist die Stromreserve im Winter mit Wasserkraft, da sind entsprechende Vorleistungen gemacht worden, andererseits müssen wir auch im Ausland Gas-Speicher sichern», erklärt Jauslin. Zudem sei es wichtig, dass die Solidarität unter den Staaten funktioniere, damit diese das Gas dann auch weiterliefern.
Grüne
Ebenfalls grossen Wert auf die Speicherkapazität der Wasserkraft legen die Grünen. Sie sind aber weniger zufrieden mit den vorgestellten Massnahmen. Die Schweiz müsse sich besser vorbereiten auf die mögliche Mangellage im Winter, sagt Grünen-Präsident Balthasar Glättli. «Die Massnahmen dürfen nicht erst einsetzen, wenn die Mangellage da ist, wir müssen bereits jetzt alles unternehmen, um die Energieverschwendung zu stoppen», erklärt Glättli. Es sei wichtig, dass die Stauseen dann noch genügend Wasser hätten, wenn wir den Strom brauchen, im Januar, Februar oder März.
SP
Auch die SP möchte den Energieverbrauch senken, erklärt Energiepolitikerin und Nationalrätin Gabriela Suter. Die SP begrüsse die Massnahmen, die gestern präsentiert wurden, sagt sie weiter. Und: «Jetzt sind zwei Dinge besonders wichtig: Einerseits müssen wir unseren Energieverbrauch senken, da sind Private und die Wirtschaft gefordert. Und zweitens ist es wichtig, dass wir Solidaritätsabkommen mit den Nachbarländern haben». Wir könnten die Energiekrise nicht allein lösen, sagt Suter. Aktuell führt die Schweiz Verhandlungen über ein solches Abkommen mit Deutschland. Gespräche laufen auch mit Italien und Frankreich.
GLP
Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Europa betont auch die GLP. Die Massnahmen seien wichtig, erklärt Energiepolitikerin Barbara Schaffner. Beim Strom seien diese wohl genügend, beim Gas hänge es stark von der Zusammenarbeit mit Europa ab. Im Hinblick auf den nächsten Winter schlägt die Partei vor: «Firmen, die bereit sind, ihren Verbrauch auf freiwilliger Basis zu reduzieren, sollen dafür entschädigt werden.» Zudem könne sie sich auf der Produktionsseite Notstromaggregate vorstellen, ansonsten sehe sie kaum Lösungen für die inländische Produktion.
Die Mitte
In eine ähnliche Richtung argumentiert die Mitte-Partei. «Ich bin überzeugt, dass wir heute schon Massnahmen ergreifen müssen im Bereich Stromsparen, Gassparen und Effizienz-Einsparungen», sagt Mitte-Nationalrätin und Urek-Mitglied Priska Wismer-Felder. «Da können wir heute damit beginnen.» Die Partei ist zudem der Meinung, dass die Schweiz nicht unvorbereitet sei, was eine mögliche Mangellage angehe, aber das Tempo noch etwas erhöhen müsse.
Fazit: Ob die Schweiz gut gerüstet ist für eine mögliche Energiekrise nächsten Winter, da sind sich die Parteien nicht einig. Bei den Rezepten schon eher: Hier dominieren die Themen Energiesparen und Reserven schaffen. Schreibt SRF.
Abgesehen davon, dass dies die Aufgabe der Regierung und nicht der Parteien ist: Ausser ideologischem und demzufolge wahltaktischem Palaver ist bei den unsäglichen Experten und Schweizer Parteigranden sowieso nichts zu erwarten, was uns wirklich weiterhilft.
-
22.7.2022 - Tag der Schrumpfhaube und Silbernase Humbel mit dem enormen Sitzleder
Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel kritisiert ihre Partei – und tritt spätestens im Herbst 2023 ab
Die langjährige Aargauer Mitte-Nationalrätin hat über ihren Rücktritt gesprochen und Mobbing in den eigenen Reihen.
Die langjährige Aargauer Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel tritt spätestens Ende der laufenden Legislatur im Herbst 2023 zurück. Das sagte die 65-Jährige in einem Interview. In der Frage um einen möglichen vorzeitigen Rücktritt fühlt sie sich von ihrer Partei «gemobbt».
«Es ist meine letzte Legislatur», sagte Humbel in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung». Die Juristin und frühere Orientierungslauf-Spitzensportlerin aus Birmenstorf ist seit 2003 Nationalrätin. Sie gehört zu den profiliertesten Gesundheits- und Sozialpolitikerinnen der Schweiz.
Humbel schloss im Interview gar einen vorzeitigen Abgang noch vor den Wahlen im Herbst 2023 nicht aus. Einem vorzeitigen Rücktritt aus parteitaktischen Gründen für die Sicherung des Sitzes bei den Wahlen durch einen Bisherigen verschliesse sie sich nicht. «Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen, ich lasse mich nicht treiben.» Einen möglichen vorzeitigen Rücktrittstermin nannte sie nicht.
«Druck, den man als Mobbing bezeichnen kann»
Humbel kritisierte im Interview ihre Aargauer Mitte-Partei, die bereits hatte öffentlich verlauten lassen, dass Humbel noch im laufenden Jahr abtreten werde. Deren Platz im Nationalrat einnehmen will der Zurzibieter Winzer Andreas Meier, der vor den Sommerferien bereits vorsorglich aus dem Aargauer Kantonsparlament zurückgetreten ist.
«Es ist schon ein Druck, den man als Mobbing bezeichnen kann», sagte Humbel. «Zuerst die Ankündigung, ich gehe im Sommer und jetzt der Rücktritt von Andreas Meier aus dem Grossen Rat und seine Ankündigung, er rücke für mich nach.» Es habe ein Gespräch gegeben über einen allfälligen früheren Rücktritt. Es sei von ihrer Seite aber nie die Rede gewesen, dass sie schon im Sommer zurücktrete, sagte Humbel.
Für die Mitte-Politikerin steht zunächst die eidgenössische Abstimmung am 25. September im Vordergrund. «Ich will jetzt zuerst die AHV-Abstimmung gewinnen. In den 19 Jahren, die ich Nationalrätin bin, haben wir noch nie eine Sozialwerk-Reform durchgebracht. Die Zeit ist reif.» Schreibt der Landbote.
Schon eigenartig: Seit 2003 sitzt die Aargauer Schrumpfhaube im Schweizer Parlament als Nationalrätin und «Gesundheitsexpertin». Doch den Wunsch ihrer eigenen Partei, endlich zurückzutreten, bezeichnet sie als «Mobbing». Als ob 20 Jahre «Freude herrscht» im Casino der Eitelkeiten von und zu Bern (auch Hohes Haus genannt, obschon niemand so genau weiss, wie hoch dieses Hohe Haus wirklich ist) nicht genug wären.
Muss Madame auf der Bahre aus dem Bundeshaus getragen werden? Humbels Starrsinn deckt einmal mehr auf, wie wichtig eine Amtszeitbeschränkung in einer wahrhaften Demokratie verdammt noch mal wäre!
Humbels politische Arbeit als «Gesundheitsexpertin» ist überschaubar. Die Krankenkassenprämien konnte sie jedenfalls trotz vollmundigen Ankündigungen nicht bändigen. Aber sie ist immerhin für eines der dümmsten Zitate anlässlich einer «Arena»-Wahlsendung (Eidgenössische Wahlen 2019) im Zitatenschatz des Artillerie-Vereins Zofingen verewigt: «Man verdient sich keine goldene Nase mit Mandaten im Gesundheitsbereich.»
Aber eine silberne dürfte es beim enormen Sitzleder von Frau Humbel schon geworden sein.
-
21.7.2022 - Tag der Parteienherrschaft in Italien (und anderswo)
Regierung vor dem Aus: Mario Draghi und Italien verlieren die Vertrauensfrage
Wahrscheinlich in keinem anderen Land als in Italien kann ein Regierungschef eine Vertrauensabstimmung gewinnen und dennoch zurücktreten müssen. Genau das ist in Rom passiert. Mario Draghi hat zwar die Vertrauensabstimmung siegreich überstanden, aber nur mit 95 Stimmen; theoretisch hätte er 267 Voten erhalten können.
Die Koalitionspartner von rechts, die Lega von Matteo Salvini und die Forza Italia von Silvio Berlusconi, hatten den Saal während der Abstimmung verlassen, die Parlamentarier der Cinque Stelle, welche die Regierungskrise ausgelöst hatten, blieben zwar sitzen, enthielten sich aber. Hätten auch sie das Plenum verlassen, wäre nicht einmal das notwendige Quorum der Anwesenden erreicht worden, das für eine gültige Abstimmung notwendig ist. Mario Draghi wurde von seinen Partnern maximal gedemütigt.
Einmalige Chance
Manöver und Intrigen sind nichts Neues unter der politischen Sonne, aber selten waren sie so unverschämt und dumm wie in diesen Tagen in Rom. Italien hat mit 220 Milliarden Euro aus dem Brüsseler Corona-Hilfsfonds die einmalige Chance, das Land von Grund auf zu reformieren. Nicht nur Strassen und Brücken, sondern auch Justiz und Bürokratie.
Mario Draghi war der Mann, der Italien in Brüssel und auf den Finanzmärkten Glaubwürdigkeit verliehen hat. Nicht nur Mario Draghi hat die Vertrauensabstimmung (nicht numerisch, aber politisch) verloren, auch Italien hat seine Glaubwürdigkeit in Brüssel und in der Welt verspielt. Und für Verlässlichkeit stand Draghi, auch wenn er allein natürlich nicht der Retter Italiens gewesen wäre.
Im schlechtesten Moment in die Krise
Wann, wenn nicht jetzt wäre die Gelegenheit für eine Erneuerung Italiens gewesen? Und die zweite grosse Frage lautet: Kann man Italien politisch überhaupt je vertrauen, wenn es ausgerechnet jetzt mutwillig eine politische Krise auslöst?
Das politische Rom hat die vielleicht beste Gelegenheit seit langem für Italien verstreichen lassen und das Land im schlechtesten Moment in eine Krise geführt. Brüssel hat Projekte für 46 Milliarden Euro Corona-Hilfe im laufenden Jahr bereits bewilligt, die Zustimmung für weitere 21 Milliarden stehen aber noch aus. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation und die Dürre hätten als Herausforderung gereicht; nun drohen auch politische Instabilität und eine noch grössere Verschuldung durch die Reaktion auf den Finanzmärkten.
Wie weiter?
Wer soll das Land jetzt führen? Matteo Salvini, Chef der Lega und Giuseppe Conte, Vorsitzender der Cinque Stelle, haben nicht erst jetzt, aber vor allem in diesen Tagen, bewiesen, dass sie als Regierungschefs untauglich sind. Sie haben die Regierung in diesem kritischen Moment ausschliesslich aus wahltaktischen Gründen gestürzt.
Politik als Spiel und Selbstzweck. Italien zahlt dafür einen sehr hohen Preis. Und was kann man von einer neuen allfälligen Regierung aus den Rechtsparteien Lega, Forza Italia und der rechtsextremen Fratelli d’Italia erwarten? Schreibt SRF.
Putin und Xi Jinping werden sich über diese Neuigkeiten aus Rom freuen. In Moskau knallen die Vodka-Korken und in Peking werden die Tassen mit heissem Jasmin-Tee gefüllt. Das nennt man konzentrierte Globalisierung. Oder gar konzertierte?
Dass Regierungen aus wahltaktischen Gründen gestürzt werden, ist allerdings trotz der italienischen Inflation von Regierungswechseln alles andere als ein italienisches Phänomen.
Parteien in allen Ländern, auch den demokratischen, handeln NUR aus wahltaktischen Gründen zum Wohl der eigenen Partei und deren Eliten. Die Schweiz als Hort der immerwährenden Glückseligkeit und Konkordanz bleibt davon allerdings verschont.
Politikverdrossenheit hat mehrere Namen. Einer davon lautet Parteienschacher. Und wir wundern uns über eine von Donald Trump beherrschte Republikanische Partei in den USA, geschätzte 15 Prozent Deutsche, die sich Hitler zurückwünschen und laut Umfragen geschätzte 30 Prozent Italiener*innen, die Mussolini nachtrauen.
Nur die Schweiz ist noch immer ein Musterland der Demokratie. Die in der Regierung vertretenen Schweizer Parteien handeln alle ausschliesslich zum Wohl des Volkes jenseits von Korruption, unappetitlicher Pöstchenjägerei oder gar Parteiinteressen.
Ausgenommen von diesem hehren politischen Treiben im Bundeshaus sind lediglich ein paar «Schwarze Schafe», die da wären: FDP.DIE LIBERALEN., GRÜNE SCHWEIZ, GRÜNLIBERALE GLP, DIE MITTE, SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI SVP, SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI SP.
Die laut einer Umfrage geschätzten 20 Prozent Schweizer «Putin-Versteher», überwiegend bei der SCHWEIZERISCHEN VOLKSPARTEI SVP angesiedelt, sind vernachlässigbar. Genauso die Karl-Marx- und Lenin-Fans der SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI SP.
Im Gegensatz zu Italien dürfen wir in der Schweiz stolz sein auf unsere Parteien; die «Schwarzen Schafe» mal weggelassen. Auch wenn uns dabei die Schamröte ins Gesicht steigt.
-
20.7.2022 - Tag der Immobilienexperten*innen
Trotz hohen Hypothekarzinsen: Darum steigen die Immobilienpreise weiter
Wohneigentum in der Schweiz ist so unerschwinglich wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das Angebot ist knapp, es wird immer weniger gebaut. Aber erklärt das die hohen Preise?
Obwohl die finanziellen Hürden eines Hauskaufs immer höher werden, schiessen die Preise auf dem Schweizer Immobilienmarkt weiter nach oben. Selbst eine Verdoppelung der Hypothekarzinsen hat daran im letzten Halbjahr nichts geändert.
Die Preise für Häuser stiegen im zweiten Quartal 2022 um 1,6 Prozent. Das zeigen die neuesten Zahlen des Immo-Bewerters Realadvisor. Die Preise für Wohnungen stiegen um 1,9 Prozent. Im Jahresvergleich sind die Preisanstiege beachtlich: Plus 7,9 Prozent für Häuser und 7,7 Prozent für Wohnungen.
«Seit 20 Jahren ist es nicht mehr so schwierig gewesen, in der Schweiz ein Eigenheim zu kaufen», sagt Jonas Wiesel (34), Mitbegründer von Realadvisor, zu den aktuellen Marktbedingungen.
Vorboten für Preisnachlass
Warum hat sich das Preisniveau auf dem Schweizer Immobilienmarkt noch nicht stabilisiert? Zum Vergleich: In einigen Nachbarländern gibt es bereits Indikatoren, die auf eine Verlangsamung des Preisanstiegs hindeuten.
In Frankreich etwa sind die Preise seit Jahresbeginn nur um 1,7 Prozent gestiegen. Die meisten Preissteigerungen in den zehn grössten Städten betragen weniger als 0,5 Prozent. In Deutschland stagnierten die Preise für Häuser im ersten Quartal 2022 mit einem minimalen Wachstum von 0,1 Prozent.
Baueingaben stagnieren
Das Problem: Das Angebot auf dem Schweizer Immobilienmarkt ist und bleibt knapp. Zwar ist die Zahl der zum Verkauf angebotenen Immobilien laut Realadvisor innerhalb von drei Monaten um 10 Prozent gestiegen. Wiesel stellt aber fest: «Das Angebot ist immer noch sehr begrenzt und liegt weit unter dem, was wir vor zwei Jahren beobachtet haben.» Er könne sich nicht vorstellen, dass die Zahl der zum Verkauf angebotenen Objekte mittelfristig signifikant ansteigen werde.
Indikatoren dafür sind auch bei den Baugenehmigungen zu finden. Diese sind seit 2014 nicht mehr gestiegen. Auch die Bauausgaben stagnierten im vergangenen Jahr. Die Investitionen in den Tiefbau stiegen um 1,0 Prozent. Jene in den Hochbau sanken um 0,4 Prozent. Damit gingen die Bauinvestitionen insgesamt um 0,1 Prozent zurück, wie die aktuellen Zahlen der Baustatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigen.
Haushaltsbudgets sind strapaziert
Das Angebot auf dem Häusermarkt wird also so schnell nicht zunehmen. Doch die Nachfrage dürfte zurück gehen und so wenigstens für etwas Beruhigung auf dem überhitzten Immobilienmarkt sorgen. Denn neben den steigenden Hypothekarzinsen belasten auch die Inflation der Verbraucherpreise und die steigenden Energiepreise die obligatorischen Ausgaben der Haushalte.
Das schlägt sich aufs Sparkonto der Schweizer nieder. Und benachteiligt Hauskäufer, wenn es darum geht, das zur Finanzierung erforderliche Eigenkapital aufzubringen. Gut möglich also, dass uns trotz des knappen Angebots bald eine Entspannung auf dem Immobilienmarkt bevor steht. Schreibt Dorothea Vollenweider im Blick.
Vieles von dem, was «Immobilienexpertin» Dorothea Vollenweider im Blick schreibt, ist richtig. Ist ja auch relativ einfach, wenn man/frau nur die offiziellen Zahlen der entsprechenden Bundesämter nachplappern muss.
Doch mit den Hypotheken liegt sie völlig falsch. Es stimmt zwar, dass sich die Hypothekarzinsen verdoppelt haben und macht sich im Sinne von Clickbait-Katastrophenjournalismus gut in der Headline. Nur verschweigt sie, auf welch tiefem Level die Hypothekarzinsen lagen.
Von ca. 0,6 Prozent im Schnitt (je nach Bank und Dauer der Hypothek) ging es rauf auf derzeit ca. 1,2 Prozent (ebenfalls je nach Bank und Dauer). Siehe aktuellen Screenshot von MoneyPark.
Diese Hypothekarzinserhöhung wird wohl kaum jemand davon abhalten, Wohneigentum zu erwerben. Da gibt es wesentlichere Gründe, die aber im Artikel nicht oder nur als marginaler Nebensatz aufgeführt sind.
Wie etwa die derzeit aktuellen Zukunftsängste. Die Frage, ob der Job noch sicher ist angesichts der drohenden Rezession dürfte Kaufwillige wohl eher beschäftigen als 0,6 Prozent höhere Hypothekarzinsen.
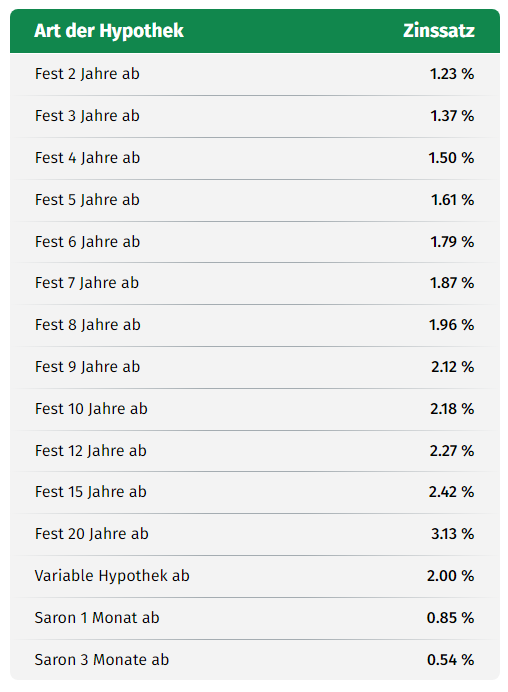
-
19.7.2022 - Tag des Garagengejammers auf hohem Niveau
Elektro-Auto-Boom: Garagen fürchten um ihre Existenz wegen Tesla und Co.
Immer mehr Menschen fahren elektrisch. Viele freie Auto-Werkstätten allerdings sind gar nicht darauf vorbereitet.
Es herrscht Hochbetrieb in der Autowerkstatt von Salim Akes im aargauischen Gebenstorf. Sommerferien kennt der passionierte Automechaniker nicht. Er und seine Angestellten reparieren Fahrzeuge aller Marken, haben «Benzin im Blut», wie es im Volksmund heisst. Und Diesel natürlich auch. Doch Salim Akes hat ein Problem.
«Wir haben aktuell drei Kundinnen und Kunden, die einen Tesla fahren», erzählt der Garagenbesitzer. «Bei diesen Fahrzeugen können wir Scheibenwasser und Reifen, maximal auch die Bremsen mal auswechseln.» Reparaturen am Elektromotor selbst kann und darf Salim Akes nicht ausführen. «Es braucht speziell geschulte Fachleute für Elektromotoren. Das kann nicht jede Garage.»
Als «freie Werkstatt» hat Salim Akes zudem keinen direkten Zugang zu den Fahrzeugherstellern. «Soviel ich weiss, werden Reparaturen bei Elektrofahrzeugen aktuell praktisch nur von Markenvertretungen vorgenommen», sagt er. Eine Recherche im Internet bestätigt diesen Eindruck.
So bietet zum Beispiel der Garagen-Zulieferer Hostettler eine Online-Übersicht zu Elektro-Werkstätten: Freie Betriebe ohne Markenvertretung sind wenige zu finden, schon gar nicht mit umfassendem Serviceangebot für Elektromotoren. Salim Akes wünscht sich deshalb verstärkte Bemühungen der Berufsverbände, zum Beispiel Weiterbildungsangebote für Automechanikerinnen und Automechaniker.
Elektromotoren brauchen weniger Wartung
Diese gebe es bereits, erklärt Oliver Mäder vom Autogewerbeverband Schweiz. «Wir hatten die ersten Kurse im Bereich Hochvolt-Technik vor 10 Jahren, wir bereiten uns also vor auf den Elektroauto-Boom». Zudem betont er, dass ja nur der Motor selbst eine neue Technologie sei. «Rundherum ist es immer noch ein Fahrzeug mit einem Fahrwerk, mit vier Rädern und Bremsen.»
Was allerdings auch Oliver Mäder weiss: Elektromotoren sind praktisch wartungsfrei, es braucht zum Beispiel keine regelmässigen Ölwechsel. Damit entfällt für die Garagen sowieso ein wichtiger Teil des bisherigen Geschäfts. Er bleibt trotzdem optimistisch, auch für freie Garagenbetriebe wie den von Salim Akes: Noch sei der Anteil der Elektrofahrzeuge schliesslich nicht sehr gross.
Verband gibt sich gelassen
«Es braucht Zeit. Zeit, bis die Elektrofahrzeuge wirklich grosse Marktanteile erreichen. Und Zeit, bis die Branche damit ihre Erfahrungen gemacht hat.» Auch Salim Akes in Gebenstorf hat einen Plan, wie er auf die technologische Revolution im Fahrzeugmarkt reagieren kann. «Ich habe einen Sohn, der in der gleichen Branche arbeitet. Er ist gerade in Ausbildung und wird sich wahrscheinlich auf Elektro spezialisieren.»
Künftig kümmert sich dann also vielleicht der Juniorchef um die Elektromotoren, der Seniorchef um Benziner und Diesel-Fahrzeuge. Denn auch darin ist sich die Branche einig: Es wird noch lange dauern, bis Verbrennungsmotoren ganz von der Strasse verschwinden. Schreibt SRF.
Halten wir zuerst einmal fest: Der in der Titelzeile erwähnte «Elektro-Auto-Boom» hält sich derzeit noch in überschaubaren Grenzen. Das bedeutet, dass die Garagen genügend Zeit haben, um sich auf die durch eine neue Technologie veränderten Bedingungen langfristig vorzubereiten. Das ist keine Tragödie.
Forschung, Innovation, Erfindungsgeist sowie Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sind das Elixier erfolgreicher Wirtschaftsnationen. Das war schon immer so und lässt uns heute beispielsweise mit dem neuen Webb-Weltraumteleskop Galaxien erblicken und bildlich festhalten, die 13- und mehr Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Das war bis vor wenigen Tagen bisher ein Ding der Unmöglichkeit.
Ältere Semester erinnern sich noch heute an die seinerzeitigen Verwerfungen, die von der Digitalisierung im Druckereigewerbe verursacht wurden. Tausende von Druckern verloren in der Schweiz ihren angestammten Beruf und mussten sich neue Betätigungsfelder suchen.
Das wird auch der Auto- und Garagenbranche nicht erspart bleiben. Trotzdem geht die Welt dadurch nicht unter.
Sie geht eher unter, wenn wir uns den vier bzw. fünf Kernelementen einer erfolgreichen Wirtschaft (Forschung, Innovation, Erfindungsgeist sowie Effizienz- und Produktivitätssteigerungen) verschliessen und dafür dem Gejammer huldigen.
Das würde die Menschheit sehr schnell auf die Bäume zurückbringen.
-
18.7.2022 - Tag der beschissenen Trychler-Hömmli
Lädelen in Ebnat-Kappel SG statt G20 auf Bali: Ueli Maurer ging Corona-positiv Hemden shoppen
Ein Bild zeigt Ueli Maurer beim Einkauf in Ebnat-Kappel SG. Am gleichen Tag hatte der Bundesrat seine Reise an den G20-Gipfel nach Bali abgesagt. Er war positiv auf Corona getestet worden.
Michael Kauf steht der Stolz ins Gesicht geschrieben. Kein Geringerer als Bundesrat Ueli Maurer (71) beehrte den Inhaber eines Kleidergeschäfts in Ebnat-Kappel SG am späten Montagnachmittag. Kauf lässt ein Foto von sich und Maurer machen, worauf er dem SVP-Finanzminister eines seiner Hemden präsentiert.
Irritierend an dem Ganzen: Ausgerechnet an diesem Montag hatte Blick bekannt gemacht, dass Maurer positiv auf das Coronavirus getestet wurde Darum fand auch seine für denselben Tag geplante Reise ans Finanzminister-Treffen der G20 auf Bali nicht statt. «Corona-positiv kann Bundesrat Maurer natürlich kein Flugzeug besteigen», erklärte Sprecher Peter Minder damals.
Maurer nahm sich Zeit im Laden
Anders sieht das offenbar für ausgedehntes Shopping aus – das «St. Galler Tagblatt» spricht von einem 30-minütigen Einkauf. Maurer soll unterwegs gewesen sein zu seinem Toggenburger Parteikollegen Toni Brunner (47). Der ehemalige SVP-Präsident wird immer mal wieder als möglicher Maurer-Nachfolger genannt.
Auf Blick-Anfrage zum Corona-positiven Bundesrat gibt sich das Toggenburger Hemdengeschäft plötzlich kleinlaut. Man wolle keine Angaben zum Besuch von Ueli Maurer machen. Nur so viel: Alles sei «konform» abgelaufen. Die Ladenbesitzer wussten über Maurers Covid-Infektion offenbar Bescheid. Er habe eine Maske getragen, heisst es. Davon ist auf dem gemeinsamen Bild mit dem Ladenbesitzer allerdings nichts zu sehen. Möglich, dass Maurer sie für den Schnappschuss kurz absetzte.
Fakt ist: Bundesrat Maurer hat mit seinem Ausflug in die Ostschweiz gegen keine Schutzmassnahmen verstossen. Seit der Bund am 1. April sämtliche Corona-Massnahmen aufgehoben hat, ist ein Gang in die Isolation selbst bei einem positiven Corona-Test nicht mehr zwingend.
Meist gegen Corona-Massnahmen gewehrt
Im Gegensatz zu seinem Bundesratskollegen Alain Berset (50), der dieser Tage wegen seiner Flug-Affäre in der Kritik steht, muss sich der SVP-Bundesrat auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, die Prinzipien seiner Partei nicht zu leben. Maurer und die SVP hatten sich zumeist gegen die Corona-Massnahmen des Bundes gewehrt. Der Finanzminister hatte sich im vergangenen September sogar in einem Hemd der Corona-kritischen Freiheitstrychler ablichten lassen.
Dennoch bleibt – gerade angesichts der aktuell hohen Fallzahlen – die Frage, ob Maurer mit seinem unbekümmerten Verhalten nicht etwas gar unvorsichtig agierte. Wie er dazu steht, bleibt vorerst sein Geheimnis. Das Finanzdepartement äussere sich nicht dazu, erklärt Sprecher Lars Hulliger auf Anfrage. Schreibt Blick.
Für einen echten Trychler wie Ueli Maurer ist das ganze Gezeter um Corona ohnehin nur eine Weltverschwörung. Oder eine Biersorte. Wäre es nach ihm gegangen, hätte es vermutlich auch keine Lockdowns gegeben. Was möglicherweise nicht mal die schlechteste Entscheidung gewesen wäre.
Dass sich Maurer ebenso wie wir gewöhnlich Sterbenden vom Plebs ab und zu ein paar neue Hemden kauft, ist eigentlich selbst für einen Corona-Seuchenvogel das Normalste der Welt. Zumal er ja nicht ständig in seinen beschissenen Trychler-Hömmlis herumlaufen kann.
Die Frage, die mich aber bei diesem lächerlichen Sommerloch-Artikel wirklich bewegt, ist eine ganz andere: Hat sich der ehemalige Kiosk-Verkäufer, Pöstchenjäger, grösster Luzerner Staatsmann/frau aller Zeiten und FDP-Ständerrat/Ständerrätin (Grölsaz) Damian Müller zu diesem Thema im Sinne der Müllerschen Doktrin «Privat ist privat» schon geäussert?

-
17.7.2022 - Tag des Geschwurbels von Damian «ich bin nicht schwul» Müller
Erst vergeigen, dann schweigen: Berset liess den Bundesrat im Dunkeln
SP-Bundesrat Alain Berset informierte die Landesregierung nicht darüber, dass die französische Luftwaffe seinem Ausflug ein abruptes Ende setzte. Die Geheimnistuerei hat System.
Es ist nicht so, dass Alain Berset (50) komplett verstummt wäre. Am Freitagabend etwa meldete sich der SP-Bundesrat vom Klassikfestival in Verbier VS. Auf Twitter zeigte er sich berührt von einem gemeinsamen Auftritt ukrainischer und russischer Musiker sowie von ihrer «Botschaft des Friedens und der Solidarität».
Eine Woche zuvor, nachdem Ex-Premier Shinzo Abe einem Attentat zum Opfer gefallen war, hatte der polyglotte Magistrat dem japanischen Volk sein Mitgefühl auf Englisch ausgesprochen.
Während Berset das Weltgeschehen auch in den Sommerferien fest im Blick hat, schweigt er eisern zu heiklen Vorfällen, die ihn und seine Amtsführung unmittelbar betreffen.
Nun auch bei seinem letzten Aussetzer, der dem Sozialdemokraten einen Ehrenplatz in der Galerie der bundesrätlichen Kapriolen sichert.
Privatsache?
Der Innenminister mit Pilotenschein mietete am 5. Juli eine einmotorige Cessna und brach vom freiburgischen Écuvillens in Richtung Frankreich auf. Im Luftraum des Nachbarlandes lief der Trip dann gehörig aus dem Ruder. Berset wurde von einem Rafale-Kampfjet der französischen Luftwaffe abgefangen und zur Landung gezwungen. Eine Rekonstruktion seiner Route legt nahe, dass der Schweizer Magistrat einem Militärflugplatz zu nahe gekommen war. Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron (44) wurde gemäss «NZZ» in Kenntnis gesetzt.
Obwohl der Staatschef im Élysée über den Irrflug informiert war, versuchte Berset, in der Heimat den Vorfall unter dem Deckel zu halten. Wie SonntagsBlick-Recherchen zeigen, informierte Berset nicht einmal seine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat.
Sein Sprecher Christian Favre bestätigt auf Anfrage: «Nach unserem Wissen wurde kein Gerichtsverfahren eingeleitet. Die Situation rechtfertigte keine Information des Bundesrates.» Erst auf Medienanfragen hin reagierte Bersets Departement (EDI) eine Woche nach dem Ausflug mit einem knappen Communiqué. Der Bundesrat sei allein unterwegs gewesen, hiess es. Privatsache.
Demnach dürften Mitglieder der Landesregierung erst aus den Medien erfahren haben, in welche missliche Lage sich ihr Kollege Berset in Frankreich manövriert hatte.
Pokerface
Erst vergeigen, dann schweigen: Das scheint bei dem Freiburger ein Muster zu sein. Der unter dem Deckel gehaltene Irrflug ist nicht Bersets erstes Versteckspiel. Ein weiteres Beispiel: Am 18. Mai 2022 gaben Energieministerin Simonetta Sommaruga (62) und Säckelmeister Ueli Maurer (71) nach der gemeinsamen Bundesratssitzung eine Medienkonferenz in Bern. Thema war der Rettungsschirm für die Strombranche.
Was die Landesregierung nicht wusste: Bersets rechte Hand, sein damaliger Medienchef Peter Lauener (52), sass zu diesem Zeitpunkt bereits seit 24 Stunden im Zürcher Untersuchungsgefängnis. Ihm wirft ein Sonderermittler im Zusammenhang mit der Crypto-Affäre Amtsgeheimnisverletzung vor. Für Berset und Lauener gilt die Unschuldsvermutung.
Auf Anfrage geben sich Maurers und Sommarugas Sprecher diplomatisch: Man kommentiere die Personalgeschäfte anderer Departemente grundsätzlich nicht. Recherchen ergeben jedoch, dass es der Innenminister nicht für nötig befand, das Gesamtgremium über den brisanten Vorgang um seinen Mitarbeiter zu unterrichten. Ein Bundesratsmitglied soll ausser sich gewesen sein, dass es davon aus der Presse erfahren musste.
Während Berset in der Regierung ein Pokerface zeigte, zogen seine Leute im Hintergrund eifrig die Fäden, um ihren wichtigen Mitarbeiter wieder auf freien Fuss zu bekommen. Denn Lauener war mehr als nur Bersets Medienchef. Die zweijährige Pandemie hat die beiden zusammengeschweisst, sie zu Sparringspartnern gemacht.
Regierungsmitglieder driften auseinander
Erst am 22.Mai kam Lauener frei, rechtzeitig zum Start des World Economic Forum (WEF) in Davos GR. Dort hatte sein Chef eine dichte Agenda; Gespräche mit dem kolumbianischen und dem simbabwischen Präsidenten standen an, ebenso Treffen mit den Regierungschefs von Tunesien und dem Kosovo sowie die Teilnahme an einer Debatte über die globale Gesundheit. Dass der Kommunikationschef vom strengen U-Haft-Regime gezeichnet war, lässt sich nur erahnen. Der sonst so sendungsbewusste Innenminister jedenfalls «verzichtet am WEF auf Medienauftritte», wurde lapidar vermeldet.
Zwei Wochen später wurde Lauener geschasst – und die Öffentlichkeit mit einem kurzen Text abgespeist, der nur wenig mit der Realität zu tun hat: «Der ehemalige Journalist und Kommunikationsspezialist will sich beruflich neu orientieren», teilte das Innendepartement am 8. Juni mit.
Intransparenz gegenüber Bundesratskollegen sagt einiges über das Selbstverständnis aus, das dort herrscht. Und noch mehr über die Stimmung in einer Regierung, deren Mitglieder nach dem von der Pandemie erzwungenen Schulterschluss mehr und mehr auseinanderdriften. Eine Sicht, die derzeit viele in National- und Ständerat teilen. Man sehe, dass sich die Bundesräte nicht mehr über den Weg trauten, sagt SVP-Aussenpolitiker Roland Rino Büchel (56, SG). «Das Schlimme ist, dass dieses Misstrauen untereinander gerechtfertigt scheint. Dieses Gremium ist in einer schwierigen Phase.»
«Ich wähle Berset im Winter nicht zum Bundespräsidenten»
FDP-Ständerat Damian Müller (37) betont zwar, dass der Grundsatz «Privat ist privat» gelte. «Aber sicher haben diese Vorfälle auch einen politischen Aspekt, und darum hätte Berset seine Kollegen ins Bild setzen müssen.» Die Geheimnistuerei stehe sinnbildlich für die Atmosphäre im Bundesrat, so der Luzerner.
Auch in der Verwaltung sorgen die Eskapaden des EDI-Vorstehers für Unmut. Ein hoher Funktionsträger aus der Verwaltung sagt zu SonntagsBlick: «Wir arbeiten unter Hochdruck, um die anstehenden Herausforderungen der Nation zu meistern – Inflation, Energiekrise, Flüchtlinge. Ich habe Kollegen im Amt, die sich kaum eine Kaffeepause gönnen. Und der Innenminister gönnt sich einen gemütlichen Rundflug.»
Es gibt bürgerliche Parlamentarier, die Alain Berset im Dezember nicht turnusgemäss zum Bundespräsidenten wählen wollen. Denkbar also, dass sie dem Gesundheitsminister mit einem schlechten Resultat eine symbolische Watsche erteilen: «Ich wähle Berset im Winter nicht zum Bundespräsidenten», sagt SVP-Nationalrat Büchel schon heute. «Und es würde mich nicht überraschen, wenn einige der durchaus fähigen und ambitionierten Leute bei der SP sich überlegen, ob nun ihre Zeit gekommen ist.» Schreibt SonntagsBlick.
Dass sich ausgerechnet der Luzerner Ständerat und freisinniger Pöstchenjäger Damian «ich bin nicht schwul» Müller zu dieser Sommerloch-Schmonzette äussert und die Geheimnistuerei im Bundesrat anprangert, macht aus der Posse um den Irrflug des bundesrätlichen Berserkers eine waschechte Tragikomödie.
Dabei könnte der grossartige Luzerner Staatsmann Müller dem ab und zu clownesk auftretenden Berset in Sachen Geheimnistuerei die Hand reichen.
Luzerner Journalisten wie auch ich selbst (und eventuell auch die Zeitungsleser*innen) erinnern sich nur zu gut an sein pro aktives Interview-Geschwurbel vor den National- und Ständeratswahlen 2019 um seine geheimnisvolle Sexualität. Ungefragt, wohlverstanden.
«Privat ist privat» gilt demnach nur für Müllers sexuelle Präferenzen, nicht aber für Bersets Lausbubenflügli.

-
16.7.2022 - Tag der gutgemeinten Integrationsprojekten
Kritik an Integrationsprojekt: Kinder sollen für eine bessere Durchmischung die Schule wechseln
Ausländische und Schweizer Schulkinder sollen sich besser durchmischen und mehr austauschen. Der Plan stösst auf Kritik.
Es gibt sie überall in der Schweiz: Schulen, in denen Kinder mit Muttersprache Deutsch in der Minderheit sind. Damit alle Kinder Deutsch lernen, wird in den Schulen viel gemacht. Doch oft lernen die Kinder am besten auf dem Pausenplatz, Deutsch zu sprechen.
Damit sich Kinder mit Deutsch als Muttersprache und jene mit Deutsch als Zweitsprache auf dem Pausenplatz auch tatsächlich begegnen, startete Martha Jakob ein Integrationsprojekt. Sie ist Präsidentin der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach in Winterthur, in dem sie den Prozess der besseren Durchmischung durchführte – als schulische Brückenbauerin.
Der Plan für eine intensivere Durchmischung klang einfach: Die Kinder sollen je nach Sprache einer anderen Schule zugeteilt werden. Das stiess aber auf Kritik.
Experiment mit Widerhall
Für viele Kinder bedeutete das nämlich einen längeren Schulweg. Die beiden betroffenen Schulhäuser liegen knapp anderthalb Kilometer auseinander.
Der längere Weg war jedoch eine der grössten Sorgen, die die Eltern vor zwei Jahren bei der Präsentation des Projektes äusserten. Damals war die Aufregung unter einigen betroffenen Eltern gross.
Besonders jene, deren Kinder Deutsch als Muttersprache sprechen, sprachen von einem heiklen «Integrationsexperiment». Es sei nicht erwiesen, ob die sprachliche Durchmischung in der Schule einen positiven Effekt auf den Bildungserfolg habe, wurde gesagt.
Projekt trotz Kritik umgesetzt
Einige Eltern konsultierten deshalb gar einen Anwalt, um gegen den Entscheid juristisch vorzugehen. Der Erfolg blieb aus, denn die Präsidentin der Kreisschulpflege hielt an ihren Plänen fest: Pläne, die den Vorgaben des Zürcher Volksschulgesetzes entsprachen und deshalb juristisch nicht anfechtbar waren.
Auch wenn sie bei gewissen Eltern bis zum Schluss auf taube Ohren stiess: Martha Jakob versuchte, sie in Gesprächen zu überzeugen, warum aus ihrer Sicht eine bessere Durchmischung wichtig ist.
Ihr ging es nämlich nicht nur um die Sprache, sondern vielmehr auch darum, eine Brücke zwischen Schweizer Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund zu bauen – um mehr Chancengerechtigkeit.
Martha Jakob widersprach der Befürchtung, dass Kinder mit Deutsch als Muttersprache in einem Schulhaus mit einem hohen Anteil an Kindern mit Deutsch als Zweitsprache zu wenig gefördert würden. Wenn ein Kind genug mitbringe, um ins Gymnasium zu gehen, schaffe es den Übertritt in jedem Schulhaus, so Jakob: «Der Prozess der Durchmischung ist kein Experiment. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Wir gehören alle zusammen.»
Zwei Jahre ohne verlässliche Zahlen
Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen, seit der Prozess der Durchmischung angestossen wurde. Die Zahlen haben sich leicht angeglichen in den beiden Primarschulhäusern – in Gutschick ist die Zahl der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache leicht gesunken, in Schönengrund leicht gestiegen.
Hat sich die veränderte Durchmischung denn auf die Leistung der Kinder ausgewirkt? Martha Jakob antwortet vorsichtig: Es gebe noch keine verlässlichen Zahlen. Aber sie merkt auch an, dass bei der jüngsten Zuteilung vor den Schulferien, der Sturm der Entrüstung im Quartier ausgeblieben sei: «Offensichtlich ist die Botschaft angekommen.» Schreibt SRF.
Dass die Eltern der wohlhabenden Schicht der Autochthonen kein Interesse an diesem «Integrationsprojekt» haben, ist grösstenteils ein städtisches Phänomen. In ländlichen Gemeinden ist es nicht nur schwieriger, sondern beinahe unmöglich, die Kinder in einem Schulhaus ohne Durchmischung der Schülerinnen und Schüler zu platzieren. Da bleibt meistens nur die Privatschule in der nächstgelegenen Stadt, was zu logistischen Problemen führt und auch das Portemonnaie erheblich strapaziert. Hinzu kommt, dass in den ländlichen Gemeinden viel weniger Migranten angesiedelt sind als in den Städten.
Betrachten wir ein Beispiel aus der Stadt Luzern: Das St. Karli-Schulhaus in direkter Nähe zur Migrantenhochburg der Baselstrasse. Aber auch direkt am Fusse des eher noblen Bramberg-Quartiers gelegen. So sieht man im St. Karli-Schulhaus Schulkinder aller Couleur und Herkunftsländern, jedoch kaum welche vom Brambergquartier. Die Bewohner*innen vom Bramberg können es sich in der Regel leisten, ihre Sprösslinge in einem städtischen Quartierschulhaus jenseits der Migrantenzonen unterzubringen.
In etwa die gleiche Geschichte liesse sich über das Luzerner Maihof-Schulhaus schreiben, das während der Pandemie sogar zu einem Drogenhotspot für Minderjährige mutierte.
So ist das nun mal. Daran ändern auch alle gutgemeinten Integrationsprojekte nichts, solange selbst die zuständigen Politiker*innen ihre Goldschätzchen von den mit Migrantenkindern gefluteten Schulhäusern fernhalten.
-
15.7.2022 - Tag unserer genialen Väter und Mütter mit der Erfindungsgabe
HYPETRAIN: Zug soll mit einer Akkuladung beinahe unendlich lange fahren können
Kein Diesel, keine Emissionen, aber dafür theoretisch unbegrenzte Fahrzeit: Das versprechen die Entwickler des "Infinity Train". Der vollelektrische Zug soll wie ein Kraftwerk auf Schienen mehr Strom erzeugen, als er selbst verbraucht. Für die "unendliche" Fahrtzeit reicht eine Akkuladung der Lokomotive aus.
Nur um eines gleich vorweg klarzustellen: Die Naturgesetze gelten natürlich immer noch, und ein Perpetuum mobile – also eine ewig laufende Maschine – ist nach den Gesetzen der Thermodynamik immer noch nicht möglich. Was das australische Bergbauunternehmen Fortescue Metals Group plant, hat auch wenig mit Hexerei oder Zauberwerk zu: Das Unternehmen lässt die Gravitation für sich arbeiten.
Gewaltige Zugflotte
Fortescue betreibt aktuell eine eigene Flotte aus 54 Diesellokomotiven, die 16 Züge antreiben – jeder davon kann aus bis zu 244 Wagons bestehen. 141 Tonnen kann jeder einzelne Wagen transportieren. Transportiert wird Erz aus der Pilbara-Region im Bundesstaat Western Australia zu einem Verladehafen bei Port Headland. Das gesamte Wagengespann samt Lok kann bis zu drei Kilometer lang werden. Diese Flotte zu dekarbonisieren sei mit Hilfe von rein elektrischen Lokomotiven möglich, wie das Unternehmen bereits im März erklärte.
Dafür holten sich die Australier mit Williams Advanced Engineering, einem Unternehmen das der breiten Masse aus der Formel 1 bekannt sein dürfte, technisches Know-how an Bord. Die Idee hinter dem "Infinity Train" ist eigentlich recht simpel: Rekuperation, also die Rückgewinnung von Bremsenergie, wie sie schon lange bei Elektroautos eingesetzt wird, soll die Lokomotiven mit mehr Energie versorgen, als sie brauchen. Beim sogenannten regenerativen Bremsen wird im Grunde der Elektromotor zum Generator. Er nutzt die Energie, die sonst einfach verloren ginge, zum Aufladen der Akkus.
Das abschüssige Gelände macht es möglich
Doch Rekuperation allein reicht noch lange nicht für einen positiven Energiesaldo. Den Rest des Stroms liefert die Topgrafie Australiens. Das geht so: Der Weg, den die Züge zur Beladestation zurücklegen, führt bergauf. Das heißt, die unbeladenen Züge fahren auf diesem Teilstück mit Energie aus den Batterien. Da die Wagons noch leer sind, ist der gesamte Zug vergleichsweise leicht und der Energieaufwand für die Anfahrt gering.
Sind sie erst einmal beladen, führt der Weg wieder bergab. Durch das immense Gewicht des Erzes und das abschüssige Gelände müssen die Züge tatsächlich kaum angetrieben werden. Durch das Eigengewicht rollt der Zug quasi von allein. Damit sich jeder einzelne der 141 Tonnen schweren Wagons aber nicht verselbstständigt und immer weiter beschleunigt, müssen die Loks auf dem Weg zum Hafen den Zug permanent bremsen – diese Energie wird in die Akkus gespeist, weil der E-Motor beim Rekuperieren zum Generator wird. Theoretisch wird so durch die Kraft der Gravitation mehr Energie erzeugt, als der Zug bei der unbeladenen Anreise verbraucht hat.
Das führt wiederum dazu, dass die Lokomotive diesen Vorgang zumindest theoretisch unendlich lange wiederholen kann – und "Infinity" in den Train kommt. Der überschüssige Strom soll ins Firmennetz eingespeist werden.
Weg mit dem Diesel bis 2030
Bis 2030 will das Unternehmen alle Dieselloks aus der Flotte ersetzen. "Der Dieselverbrauch und die damit verbundenen Emissionen werden eliminiert, sobald der Infinity Train vollständig in Betrieb ist", teilte das Unternehmen mit. Wie Fortescue-Geschäftsführerin Elizabeth Gaines betont, könne man sich so auch kostspielige Ladeinfrastruktur entlang der Strecke sparen.
"Politik und Wirtschaft müssen weltweit zu der Erkenntnis gelangen, dass fossile Brennstoffe nur eine Energiequelle sind und dass es jetzt andere gibt, die sich schnell entwickeln und dabei effizienter, kostengünstiger und umweltfreundlicher sind. So wie die Gravitationsenergie", so ein Unternehmenssprecher. Auch andere australische Bergbauunternehmen haben bereits ihr Interesse an dem Konzept des "unendlichen Zuges" bekundet. Schreibt DER STANDARD.
Toller Artikel in Zeiten wie diesen, in denen wir uns nicht nur mit dem Klimawandel beschäftigen, sondern auch mit den mutmasslichen Verursachern. Diesel-getriebene Lokomotiven gehören definitiv zu dieser umweltschädlichen Spezies.
Mit einem Augenzwinkern und etwas Fantasie könnte man nun frei nach Ricola behaupten, dass dieses System der «immerwährenden» Energie bei Berg- und Talfahrten – ein anderes Prinzip verfolgt ja auch der australische «Infinity Train» nicht – von den Schweizern erfunden wurde.
Genauso wie das Schweizer Lutsch-Bonbon mit den Kräutern aus Schweizer Bergen mit der heilenden Wirkung, die allerdings von einer US-Lady mit einer Privatklage gegen Ricola in Abrede gestellt wird. Tja, hartnäckige US-Hämorrhoiden lassen sich nun mal nicht mit einem Kräuterbonbon weglutschen. Auch wenn die Beschreibung auf der Ricola-Verpackung das möglicherweise suggeriert.
Zurück zum Perpetuum Mobile des australischen Hypertrains, das so neu gar nicht ist wie man auf den ersten Blick meinen könnte: Im beschaulichen Schweizer Städtchen Freiburg (Fribourg) verbindet das «Funiculaire» das Stadtzentrum mit der Unterstadt. Angetrieben wird die Standseilbahn seit mehr als 100 Jahren von den städtischen Abwässern, welche als «Antriebsballast» genutzt werden.
Sie sehen: Manchmal lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, um zu realisieren, mit welch genialer Erfindungsgabe unsere Väter und Mütter die Probleme ihrer Zeit gemeistert haben. Sogar ohne umweltschädliche Akkus.
Das «Funiculaire» von Freiburg ist übrigens im «Schweizer Inventar der nationalen Kulturgüter» gelistet und fährt auch heute noch. Je nach Bedarf alle sechs Minuten.
-
14.7.2022 - Tag der Schizophrenie
Fliegen statt wandern: Tourismus-Boom in den Bergen flaut ab
Zahlreiche Einheimische haben während der Pandemie das Reiseland Schweiz entdeckt. Doch nun wollen viele zurück an den Strand.
Es ist wenige Monate her, da herrschte am Mittelmeer Flaute, während Schweizer Bergregionen zum Höhenflug ansetzten. Im ersten Sommer nach Auslaufen der Corona-Restriktionen wendet sich das Blatt: «Wir rechnen im Sommer mit einem Minus von etwa 20 bis 25 Prozent», bestätigt Andreas Züllig, Präsident Hotellerie Suisse, gegenüber SRF. Der Grund dafür sei einfach: Schweizer Gäste reisen wieder ins Ausland.
Diese Entwicklung hat sich bereits im Frühling abgezeichnet. Für die Monate April (-10.5 Prozent) und Mai (-7.8 Prozent) verzeichneten Schweizer Hotels einen deutlichen Rückgang der Logiernächte von einheimischen Gästen.
Ausländische Gäste kommen zurück
Bei Schweiz Tourismus zeigt man sich davon aber weder überrascht noch enttäuscht. Im Gegenteil: Noch immer rechnet die Organisation bei einheimischen Gästen für 2022 mit einem Plus von acht Prozent gegenüber dem Vor-Pandemiejahr 2019. Zudem sei eine Entspannung beim ausländischen Gäste-Aufkommen zu beobachten. Dieses war während der Pandemie dramatisch eingebrochen.
Die gleiche Trendwende beobachtet auch die Parahotellerie. Allerdings: Jugendherbergen und Campingplätze verzeichnen noch immer 20 Prozent mehr Schweizer Gäste als vor Corona – deutlich über der Entwicklung in Hotels. Bei «Parahotellerie Schweiz» zeigt man sich zudem wegen des Krieges in der Ukraine und anhaltender Sorgen um neue Corona-Massnahmen optimistisch, dass Schweizer Gäste auch künftig einheimische Ferienziele vorziehen: «Viele haben in der Pandemie das Reiseland Schweiz entdeckt», ist Präsidentin Janine Bunte überzeugt.
Was Schweizer Betriebe ebenfalls optimistisch stimmen dürfte: das aktuelle Reisechaos auf internationalen Flughäfen. Es könnte den einen oder anderen Strandtouristen davon überzeugen, dass der nahe Berg gegenüber dem entfernten Strand in puncto Entschleunigung und Entspannung eben doch gewisse Vorteile bietet. Schreibt SRF.
Wer täglich wie ich durch eine Grossstadt (Luzern) wandert, vernimmt allerorten Geseufze: «Diese Hitze bringt mich noch um» und ähnliches. Für mich ein unerklärliches Phänomen, das ich mir nicht erklären kann, was vermutlich aber an mir und meiner mangelnden Empathie liegt.
Die gleichen Jammertanten, Jammertunten und Jammeronkels sitzen ein paar Tage später im Flugzeug, um ihre Ferien in Ländern zu verbringen, wo es bedeutend heisser ist als in der Schweiz.
Man könnte über dieses menschlich absolut verständliche Verhalten hinwegsehen, würde es sich hier nicht um die gleichen Personen handeln, die ihre grossen Sorgen um den Klimawandel wie eine tibetanische Gebetsmühle vor sich hin leiern. Darüber liesse sich ein Buch schreiben. Für Schizophrenie-Experten ein wahrer Leckerbissen.
Doch machen wir's kurz und Brecht: «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral».
Nicht wahr, Alain?
-
13.7.2022 - Tag der grün-liberalen Plaudertaschen
Grünliberaler Bäumle plädiert für Gespräche mit Putin: «Es gibt keine Alternative zu Verhandlungen mit Russland»
Nach den SVP-Nationalräten Magdalena Martullo-Blocher und Roger Köppel plädiert jetzt auch der grünliberale Nationalrat Martin Bäumle für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Ukraine-Krieg.
Der grünliberale Nationalrat Martin Bäumle (58) plädiert im Ukraine-Krieg für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (69). Zuvor hatten schon die SVP-Nationalräte Magdalena Martullo-Blocher (52) und Roger Köppel (57) eine Verhandlungslösung gefordert.
Putin sei nicht einfach zu verteufeln, sondern eine Lösung mit ihm zu suchen, sagte Bäumle, der persönlich enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland unterhält, in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Es brauche eine Verhandlungslösung, die sich an den realpolitischen Möglichkeiten orientiere.
Zur Zeit scheine es so, als wolle Putin nicht verhandeln. Aber es habe immer wieder Signale gegeben. Wenn es zu einer Lösung kommen sollte, müsse man ergebnisoffen in die Gespräche einsteigen.
Harte Worte für Aggressor Putin
Wenn der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (44) von Anfang an nur sage, er verlange von Putin den vollständigen Rückzug aus den eroberten Gebieten inklusive der Krim, dann seien Gespräche unmöglich, sagte Bäumle weiter.
Das gelte umgekehrt natürlich auch für Putin. Es könne nicht sein, dass Putin auf eine Kapitulation Selenskjs und auf der Annexion neuer Gebiete beharre. Zur umkämpften Region Donbass sagte der GLP-Nationalrat, dass er nicht mehr daran glaube, dass sich die dortigen Separatistengebiete in die Ukraine reintegrieren liessen.
Harte Worte findet Bäumle für Putin selbst. Er sei der Aggressor. Er trete das Völkerrecht mit Füssen. Menschenrechte schienen ihm egal, und er regiere Russland zunehmend diktatorisch. Trotzdem gebe es keine Alternative dazu, mit Putins Russland zu verhandeln. Schreibt Blick.
Wusste gar nicht, dass der «grün-liberale» Vollpfosten politisch noch existiert. Sein unsägliches Palaver (... Putin regiere Russland «zunehmend» (!) diktatorisch) um Verhandlungen mit Diktator Putin erinnert mich an ein Zitat von Karl Valentin: «Enden tat das Spiel mit dem Sieg der einen Partei - die andere Partei hatte den Sieg verloren. Es war vorauszusehen, dass es so kam.»
Zu den üblichen Wortmeldungen unserer politischen Elite und denjenigen, die sich dafür halten, ein weiteres Zitat von Valentin: «Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen.»
-
12.7.2022 - Tag der Corona-Impfung
G20-Reise fällt ins Wasser: Jetzt hat das Coronavirus auch Ueli Maurer erwischt
SVP-Bundesrat Ueli Maurer hat sich immer wieder über Schutzmassnahmen geärgert. Doch nun hat sich auch der Finanzminister mit dem Coronavirus angesteckt.
Jetzt hat das Coronavirus auch SVP-Bundesrat Ueli Maurer (71) erwischt. Den Finanzminister, der sich immer und immer wieder über die Schutzmassnahmen seiner Regierungskollegen geärgert hatte und auch öffentlich über sie hergezogen war. Maurer, der sich im vergangenen September sogar in einem Hemd der Corona-kritischen Freiheitstrychler hatte ablichten lassen.
Sprecher bestätigt
Dass nun auch SVP-Bundesrat Maurer von der grassierenden Corona-Sommerwelle erfasst worden ist, wird Blick von seinem Sprecher Peter Minder bestätigt: «Er ist positiv getestet worden.» Das erstaunt wenig: Steigende Fallzahlen, mehr Hospitalisierungen und mehr Patienten auf der Intensivstation – das Virus hat das Land wieder fest im Griff.
Mit seiner Erkrankung fällt auch Maurers anstehende Dienstreise in den Fernen Osten ins Wasser. Auf der indonesischen Insel Bali findet das G20-Finanzministertreffen statt. Der Inselstaat hat derzeit den G20-Vorsitz.
Auch Indien fällt aus
Daneben wäre auch noch ein Höflichkeitsbesuch in Indien vorgesehen gewesen, das turnusgemäss als Nächstes den Vorsitz übernehmen wird. Das alles fällt nun aus. «Corona-positiv kann Bundesrat Maurer natürlich kein Flugzeug besteigen», sagt Sprecher Minder. Schreibt Blick.
Auch wenn seine Trychler-Brigade dies nicht so gerne hört: Bundesrat Ueli Maurer ist geimpft. Aller Voraussicht nach wird er dank Pfizer & Co. einen milden Verlauf erleben. Hoffen wir es jedenfalls für ihn. Dass seine Reise nach Bali ins Wasser fällt, ist auch nicht wirklich eine Tragödie. Sein Chef vom Herrliberg hat für «Bundesratsreisli», wie er sie verächtlich nennt, sowieso nichts übrig.
Jetzt mal Hand aufs Herz: Kennen Sie überhaupt noch jemanden, der nicht vom Coronavirus positiv heimgesucht wurde trotz Impfung? Ich jedenfalls nicht! Selbst mich als verkannter Virusexperte erwischte Omikron am Fecken. Alles halb so wild.
Frei nach Johannes Mario Simmel: Hurra! Ich lebe noch.
-
11.7.2022 - Tag der abartigen Globalisierung
Datenleck: Uber eroberte mit aggressivem Lobbying und zweifelhafter Software Weltmärkte
Was macht ein aufsteigendes Unternehmen aus dem Silicon Valley ohne große moralische Skrupel, das dank Investoren hunderte Millionen Körberlgeld zu Verfügung hat, aber mit seinem neuen Produkt überall auf der Welt die etablierten Platzhirsche gegen sich aufbringt? Richtig: Es nutzt das Geld, um sich Netzwerk an Helfern und Lobbyisten zu schaffen und kämpft gegen die Platzhirsche mit allen möglichen erlaubten und zweifelhaften Methoden.
Das ist im kurzen die Geschichte, die im Rahmen der sogenannten Uber-Files erzählt wird, die am Sonntag von weltweit zahlreichen Medien, darunter dem "Guardian", "Profil" und der "Süddeutschen" veröffentlich worden sind. Dem "Guardian" wurde 124.000 Dokumente, darunter E-Mails, interne Berichte aus dem Unternehmen, aber auch SMS-Nachrichten diverser hochrangiger Uber-Mitarbeiter zugespielt. Der "Guardian" hat diese Daten mit Medien Netzwerk geteilt, in dessen Rahmen die Panama-Papers und andere Steuerskandale aufgedeckt wurden, koordiniert wurde das im Rahmen des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Lobbyismus im Fokus
Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum 2013 bis 2017, als noch Uber-Mitbegründer Travis Kalanick als CEO des Unternehmens fungierte, und zeigen, wie Uber in diversen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Indien, aber auch Österreich, begann, Fuß zu fassen.
Im Gegensatz zu früheren Enthüllungen des ICIJ geht es hier nicht um illegale Machenschaften wie Steuerhinterziehung und Gesetzesbruch, sondern eher Hinterzimmer-Lobbyismus. Ein Teil der veröffentlichten Daten zeigt etwa, wie Frankreichs heutiger Staatschef Emmanuel Macron, damals Wirtschaftsminister seines Landes, für Ubers Interessen in den Jahren 2014 bis 2016 interveniert haben soll. Mehr als 50 Anrufe sind verzeichnet zwischen Macron und Uber-Vertretern in Europa.
SMS an Macron
So soll sich Macron etwa dafür stark gemacht haben, das Verbot des wichtigsten Uber-Angebots, Uber-X, in Marseille aufzuheben. "Herr Minister, wir sind entsetzt", tippte ein Uber-Lobbyist am Abend des 21. Oktober 2015 auf Französisch in sein Handy, wie das "Profil" schreibt. "Könnten Sie Ihr Kabinett veranlassen und uns dabei helfen zu verstehen, was vorgeht?" Macron antwortete bald darauf: "Ich werde mir das persönlich ansehen."
Wie auch der "Guardian" schreibt, sei das Verbot des Uber-Dienstes tatsächlich kurz darauf in Marseille aufgehoben worden. Das aufsteigende US-Unternehmen passte zu Macrons Image, der sich als Wirtschaftsminister modern geben wollte.
Die Daten offenbaren auch ein Treffen zwischen dem damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden und Uber-Chef Kalanick am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Kalanick beschwerte sich in SMS darüber, dass Biden ihn warten lasse, und Biden lobte danach den Fahrtenanbieter – ohne diesen beim Namen zu nennen –, weil er so viele Jobs schaffe.
EU-Kommissarin verwickelt
Auf EU-Ebene sicherte sich Uber dem Bericht zufolge die Unterstützung der EU-Kommissarin für Digitales, Neelie Kroes. Die Niederländerin übernahm nach ihrem Ausscheiden in Brüssel 2014 und nach Ablauf einer durch die Kommission auferlegten 18-monatigen Karenzzeit einen üppig bezahlten Beraterjob bei dem US-Unternehmen.
Unterlagen aus dem Datenleck legen allerdings nahe, dass es schon während der Karenzzeit im Zusammenhang einer Polizeirazzia gegen Uber in Amsterdam im März 2015 Kontakt zwischen Kroes und Uber gab. Das Unternehmen war demnach höchst erpicht darauf, dies geheim zu halten. Es bestehe das Risiko, dass sich an Kroes eine Debatte über "die politische Drehtür und über Günstlingswirtschaft" entzünde, hieß es den Medien zufolge in einer unternehmensinternen Mail.
Der "kill switch"
Ebenfalls in den Dokumenten finden sich Hinweise auf den Einsatz einer "kill switch"-Software. Das war offenbar ein Programm, mit dem Uber-Büros die Software-Verbindung zu Hauptservern unterbrechen konnten, und zwar dann, wenn Razzien bevorstanden. Uber hatte immer wieder Probleme mit regionalen Behörden. Auch das eine Folge des Kampfes, den die Taxiindustrie gegen Uber geführt hat. Der "kill switch" soll in zwölf Ländern eingesetzt worden sein.
Auch zu Österreich gibt es Daten, dabei geht es unter anderen darum, wie Uber PR-Agenturen engagieren wollte. Das Unternehmen selbst reagierte, indem es von Fehlern in der Vergangenheit sprach, die inzwischen von der neuen Konzernführung korrigiert worden seien.
Uber war anfangs in europäischen Ländern auf massiven Widerstand und rechtliche Hürden gestoßen. Den Dokumenten zufolge veranschlagte der Konzern allein im Jahr 2016 ein Lobby-Budget in Höhe von 90 Millionen Euro, um diese auszuräumen. Schreibt DER STANDARD.
Das Datenleck bei Uber ist eigentlich nebensächlich. Viel mehr Gedanken sollten wir uns über die Auswüchse der bis zur Abartigkeit deregulierten Globalisierung machen. Dass US-Konzerne querbeet durch Europa die Hoheit über eine Branche übernehmen, die hierzulande vielen Menschen ein erträgliches Einkommen sicherte, hätte nie passieren dürfen.
Die Taxichauffeure des US-Konzerns werden durchs Band weg zu Niedrigstlöhnen beschäftigt. Die CEOs des US-Multis kassieren Milliardengehälter, die Aktionäre reiben sich über die Dividenden die Hände und die von Uber dank willfährigen neoliberalen Politikern*innen heimgesuchten Staaten übernehmen die Sozialhilfe für die Taxifahrer.
Dieses Modell der abartigen Globalisierung wird auf die Dauer nicht aufgehen.
-
10.7.2022 - Tag der gläubigen Affen
Gott hat es nicht leicht
Die besten Cartoons kommen seit einiger Zeit aus Österreich. Wie diejenigen von Rudi Klein in seiner regelmässig erscheinenden Rubrik «Lochgott» in DER STANDARD.
Die Katze «Meowth» aus der Cartoon-Serie Pokeomon brachte es auf den Punkt: «Wir haben viel gemeinsam, die gleiche Erde, die gleiche Luft, den gleichen Himmel. Vielleicht sollten wir damit anfangen, darauf zu schauen, was wir gemeinsam haben anstatt immer nur danach zu suchen, was uns unterscheidet. Wer weiss?»

-
9.7.2022 - Tag einer bescheuerten Walliserin und einer kriminellen Kosovarin
Betrugs-Opfer Petra Z. ist von der Rapperin enttäuscht: «Loredana ignoriert all meine Nachrichten»
Loredana hat eine Frau um mehrere hunderttausend Franken gebracht. Mit Betrugs-Opfer Petra Z. hat sich die Rapperin inzwischen aussergerichtlich geeinigt. Die Frauen blieben sogar freundschaftlich in Kontakt – bis jetzt. Z. ist vom Kontaktabbruch enttäuscht.
Loredana (26) hatte am Open Air Frauenfeld ihren grossen Auftritt. Mit Tausenden von Menschen feierte sie auf der Bühne. Nur eine war nicht dabei: Petra Z. (55). Die hätte sich ein Wiedersehen mit der Rapperin gewünscht – obwohl die beiden eine verworrene Geschichte verbindet. Loredana brachte Z. um mehrere hunderttausend Franken. * «Sie hat mir versprochen, dass wir in Kontakt bleiben», sagt Z. zu Blick.
Der Reihe nach. Loredana war in einen Betrugsskandal verwickelt, die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelte gegen sie. Der Vorwurf: Die Musikerin und ihr Bruder sollen einem Walliser Ehepaar mit irrwitzigen Lügengeschichten rund 700'000 Franken abgeknöpft haben. Im September 2020 hat sie sich mit ihrem Opfer Petra Z. aussergerichtlich geeinigt. Der Deal: Petra Z. erhielt einen Teil ihres Geldes zurück. Dafür zog sie die Anzeige zurück.
«Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten»
Petra Z. hoffte daraufhin auf eine Freundschaft mit der Musikerin. «Wir haben zuletzt im November 2020 telefoniert», sagt sie. Im Dezember sagte Loredana im Interview mit Apple Music über Z.: «Das ist mir sehr wichtig gewesen, dass ich mit ihr im Guten auseinander bin. Wir telefonieren auch immer noch. Wenn sie was braucht, bin ich da.» Z. fühlt sich von dieser Aussage hintergangen. Sie findet: «Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. Sie ignoriert all meine Nachrichten.»
Als die Deutsch-Rapperin im November 2021 ihren Auftritt beim Red Bull Symphonic in Luzern hatte, wünschte ihr Petra Z. per Whatsapp-Nachricht, die Blick vorliegt, viel Erfolg für den Auftritt. Loredana lud sie zur Show ein – doch Petra Z. konnte wegen ihrer Arbeit nicht kommen. Auf weitere Nachrichten von Z. reagierte Loredana nicht. Auch nicht auf die guten Wünsche für ihren Auftritt am Open Air Frauenfeld.
Loredana blockierte Petra Z.
Die Funkstille wäre für Z. in Ordnung gewesen, wenn Loredana ihr gesagt hätte, dass sie keine Freundschaft möchte. Doch die Aussage von 2020 zeichnete für sie ein anderes Bild. Worüber sie mit Loredana denn so gerne weiter gesprochen hätte? «Über das private Leben», so Z. Möglich ist das jetzt nur noch per SMS. «Loredana hat mich auf WhatsApp und Viber blockiert.»
Blick hat bei Loredanas Management um ein Statement gebeten. Eine Antwort steht noch aus. Schreibt Blick.
Tja, das Mitleid mit der (angeblich) um einige Hunderttausend Franken betrogenen Petra Z. hält sich in Grenzen. Hätte sie sich nicht aussergerichtlich mit der Betrügerin aus dem Kosovo geeinigt, sässe die Betrugsqueen vom Balkan vermutlich hinter Gittern. Nur würde der guten Petra Z. in diesem Fall die erhaltene Rückzahlung aus der aussergerichtlichen Einigung fehlen.
Wer sich für den Spatz in der Hand und nicht für die Taube auf dem Dach entscheidet, muss die Folgen akzeptieren. Von einer Rapperin mit krimineller Energie auf den Social Media-Kanälen blockiert zu werden, ist ja eher eine Wohltat als ein Grund zum Jammern.
* https://www.blick.ch/schweiz/zentralschweiz/abzock-rapperin-und-petra-z-umarmen-sich-in-luzerner-hotel-loredana-und-ihr-opfer-haben-sich-geeinigt-id16107319.html
-
8.7.2022 - Tag der vergewaltigten Wahrscheinlichkeit
Kaum Erfolge für Russland
Die russischen Angriffe auf die Ostukraine gehen unvermindert weiter. Doch Experten sehen Anzeichen dafür, dass sich die Offensive abschwächt.
Nachrichten über Russlands brutalen Feldzug gegen die Ukraine haben seit dem Ausbruch des Krieges am 24. Februar am Donnerstag seit Langem erstmals ernsthafte Konkurrenz bekommen: Die Ankündigung des britischen Regierungschefs Boris Johnson, zurücktreten zu wollen, feierten viele ukrainische Medien ausführlich ab.
Die Nachrichtenseite focus.de fragte sich, wer Boris Johnson gewesen sei und was den Ukrainer*innen von ihm in Erinnerung bleiben werde. „Im Kreml will man eine Spaltung sehen“, schrieb das Nachrichtenportal Novoje Vremja und ließ den Politologen Wladimir Fesenko darüber sinnieren, was die Ukraine mit dem Rücktritt Johnsons verliere.
„Sein Vorteil für Kiew bestand darin, dass er eine starke Figur und sehr emotional engagiert darin war, die Ukraine zu unterstützen.“ Das Wichtigste sei, dass jetzt in der Tory-Partei keine internen Diskussionen über eine Unterstützung für die Ukraine stattfänden, schrieb Fesenko.
Unterdessen gingen die russischen Angriffe auf Gebiete in der Ostukraine weiter. Dabei seien innerhalb von 24 Stunden mindestens neun Zivilist*innen, darunter mehrere Kinder, getötet und sechs weitere verletzt worden, teilte das ukrainische Präsidialamt am Donnerstag mit.
Einheiten verlegt
Offenbar kämpfen russische Truppen immer noch um eine vollständige Kontrolle des bereits weitgehend eroberten Gebiets Luhansk. Dazu hätten die Russen einige ihrer Einheiten verlegt, teilte der ukrainische Generalstab mit. Der Gouverneur von Luhansk, Serhij Gaidai, sprach von Kämpfen in den Außenbezirken von Lyssytschansk. Die strategisch wichtige Stadt hatten russischen Truppen am vergangenen Wochenende eingenommen.
Zudem berichtete Gaidai von veritablem Terror gegenüber Zivilisten in der Stadt Kremennaja. So würden Menschen mit einer proukrainischen Haltung oder solche, die sich weigerten, mit den Besatzern zusammenzuarbeiten, verfolgt. „In Kremennaja hat der Terror ein solches Ausmaß erreicht, dass Menschen direkt auf der Straße erschossen werden. Dabei helfen lokale Kollaborateure, die die Bevölkerung ausliefern, indem sie die genauen Adressen bestimmter Personen weitergeben“, berichtete Gaidai auf Telegram.
Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sei auch das Donezker Gebiet von russischen Truppen erneut beschossen worden. Der Bürgermeister von Kramatorsk berichtete von Luftangriffen auf das Zentrum der Stadt, es gebe Opfer, Rettungskräfte seien im Einsatz. Die Bevölkerung forderte er auf, in Notunterkünften zu bleiben, da die Gefahr noch nicht gebannt sei.
Seit vergangener Woche ist dies bereits der zweite Angriff auf Kramatorsk. Bei einem Raketenangriff auf das örtliche Bahnhofsgebäude Anfang April waren über 50 Menschen getötet worden. Neben Slowansk ist Kramatorsk die zweite größere Stadt in der Region, die noch unter ukrainischer Kontrolle steht. Beide Städte gelten als nächste strategische Ziele Russlands, um den gesamten Donbass unter Kontrolle zu bekommen.
Keine Gebietsgewinne
Wie lange das dauern könnte, ist unklar. Denn Russland könnte nach Einschätzung von Beobachtern seine Offensive in der Ukraine vorläufig abschwächen. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War teilte am Donnerstag mit, das russische Militär habe am Vortag keine Gebietsgewinne in der Ukraine gemeldet – zum ersten Mal seit 133 Tagen. Dies könne ein Hinweis auf eine operative Pause sein, die aber keine vollständige Einstellung der Angriffe bedeute.
„Die russischen Streitkräfte werden sich wahrscheinlich auf relativ kleine Offensivaktionen beschränken“, erklärte das Institut. Gleichzeitig versuchten sie, ihre Kräfte für größere Angriffe neu zu sammeln. Schreibt die TAZ.
Es ist schon erstaunlich, was diese Experten so alles wissen. Auch wenn sich das ausserirdische Wissen ein paar Tage nach der Veröffentlichung meistens als Makulatur erweist.
Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Vor allem, wenn der Konjunktiv und das Wörtchen «wahrscheinlich» exzessiv verwendet werden.
-
7.7.2022 - Tag der Hoffnung
Krieg gegen Russland: Die Ukraine setzt immer noch auf Sieg
Gut 130 Tage nach Beginn der großen russischen Invasion prägen gemischte Gefühle die Stimmung in der Ukraine: Zwar musste die Armee Sjewjerodonezk und Lyssytschansk – die letzten großen Städte des Bezirks Luhansk – aufgeben. Doch die Russen mussten sich dafür von der strategisch wichtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer verabschieden. Auch im größtenteils besetzten südlichen Bezirk Cherson gibt es kleine, vorerst noch wenig erfolgreiche ukrainische Gegenoffensiven. Und natürlich erschüttern Tragödien wie die Zerstörung eines Einkaufszentrums in Krementschuk mit mehr als 20 Toten durch eine russische Rakete die Bevölkerung.
Längst herrscht ein Abnutzungskrieg – mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Nicht zuletzt deswegen wollen die Russen nach den Kämpfen um Sjewjerodonezk und Lyssytschansk auf Befehl ihres Präsidenten Wladimir Putin hin eine "operative Pause" einlegen.
Gesellschaft bestärkt
Doch die ukrainische Gesellschaft zeigt sich weiter geeint und positiv. "Natürlich existiert eine gewisse Kriegsmüdigkeit oder anders gesagt: eine Gewöhnung an den Krieg", erklärt der Politologe Wolodymyr Fessenko. "Der Beschuss von Städten wie Krementschuk bestärkt die Gesellschaft in der Meinung, dass die Fortsetzung des Kampfes absolut notwendig ist. Das ist das Gegenteil dessen, was die Russen erreichen wollen."
Jedoch glaubt Fessenko, der das Penta-Zentrum für angewandte politische Forschung leitet und Präsident Wolodymyr Selenskyj nahesteht, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer noch nicht ganz realisieren, wie lange der Krieg wirklich dauern könnte: "Es gibt Menschen, die an ein Kriegsende in zwei, drei Monaten glauben. Das ist im Moment wenig realistisch", meint er im Gespräch mit dem STANDARD. "Die Offiziellen sprechen meist vom Jahresende. Am realistischsten ist aber die Einschätzung, dass bis dahin zwar die aktive Phase vorbei sein könnte, der Positionskrieg jedoch vermutlich nicht."
Anfängliche Illusionen
Ljudmyla Subryzka, Politologin an der renommierten Kiew-Mohyla-Akademie, sieht das anders. "Es gab am Anfang Illusionen – nicht zuletzt deswegen, weil die offiziellen Kommentatoren lange von zwei oder drei Wochen bis Kriegsende sprachen. Das ist mit der Zeit sogar zu einem geflügelten Wort geworden", sagt Subryzka. "Die Menschen haben nun aber akzeptiert, dass es möglicherweise sehr lange dauern wird."
Aus ihrer Sicht haben sich die für die Menschen akzeptablen Minimalziele verändert: "Als die Russen vor Kiew standen, haben die Menschen die Rückkehr zum faktischen Status quo vom 23. Februar für okay gehalten. Nun will man aber das gesamte besetzte Gebiet zurück. Tragödien wie Krementschuk oder die Zerstörung eines Wohngebäudes im Bezirk Odessa verstärken diese Stimmung."
Aktuelle Umfragen zeigten allesamt, dass mehr als 80 Prozent jegliche territorialen Zugeständnisse ablehnen – was allerdings nicht automatisch die militärische Rückeroberung bedeutet.
Unterschiedliche Erwartungen
Fessenko hält, anders als Subryzka, die Rückkehr zur Ausgangslage vom 23. Februar für Gesellschaftskonsens. Natürlich gebe es in Bezug auf die von Russland annektierte Krim unterschiedliche Erwartungshaltungen. "Ich glaube aber, dass sie sich mit der Zeit immer mehr abmildern werden. Wir wissen ja nicht, wie gut die militärische Hilfe weiter ankommen wird, wann die große ukrainische Gegenoffensive wirklich kommt – oder ob sie überhaupt kommt."
Insgesamt entsteht in der Ukraine der Eindruck, dass der Status quo vor der großen Invasion als "Mindestsieg" gilt – es sind jedoch auch weiterhin sehr unterschiedliche Positionen zu hören. "Der Sieg wäre ausschließlich die Rückeroberung aller besetzten Gebiete – inklusive der Krim", meint etwa die Journalistin Marjana Metelska aus dem westukrainischen Luzk. "Der Krieg könnte Ende dieses Jahres oder in der ersten Hälfte 2023 vorbei sein." Ihr Kollege Roman Sintschuk aus Riwne, ebenfalls Westukraine, ist weniger optimistisch: "Wir würden dann gewinnen, wenn wir erfolgreich eine Verteidigungslinie aufbauen, die die Russen nicht durchbrechen können. Das ist bisher nicht der Fall."
Dmytro Prysiwok, Lehrer aus der östlichen Region Poltawa, wo auch die Industriestadt Krementschuk liegt, betont hingegen: "Der Minimalsieg wäre, die Russen aus allen Bezirken zu vertreiben – mit Ausnahme der Krim." Der Raketenbeschuss mache Kompromisse oder ein Aufgeben undenkbar.
In jedem Fall, auch darauf weisen die Umfragen hin, blickt man in der Ukraine – abgesehen vom Krieg – optimistischer als vor dem 24. Februar in die Zukunft: Laut dem Kiewer Internationalen Soziologie-Institut spüren 52 Prozent der Menschen für die Zukunft großen Optimismus. Im Dezember 2021 lag dieser Wert noch bei mageren neun Prozent. Schreibt DER STANDARD.
Die Hoffnung stirbt bekannterweise zuletzt. Was sollen die Ukrainerinnen und Ukrainer denn sonst tun als an einen «Sieg» zu glauben, wie immer der sich präsentieren wird?
Natürlich hoffen etliche Staatenlenker*innen, Putin-Versteher*innen und verkommene Wirtschafts-Eliten, dass die Ukraine kapituliert und ihr Land endlich an den russischen Diktator übergibt. Das würde immerhin die Energie-Probleme des Westens lösen. Und danach lechzen viele!
-
6.7.2022 - Tag der utopischen Putin-Versteher und Hämorrhoiden
Yves Rossier: «Nicht alles glauben, was im Westen erzählt wird»
Der ehemalige Schweizer Botschafter in Moskau Yves Rossier sieht die Schuld am Krieg in der Ukraine bei Russland. Der Westen und die Ukraine hätten im Vorfeld allerdings Fehler gemacht.
«Die Schuld am Krieg liegt aber einzig und allein bei Russland, das ist klar», sagte Rossier im Interview mit den Zeitungen der CH-Media-Gruppe. Russland habe in der Vergangenheit aber sowohl in die Nato als auch in die EU gewollt. «Das waren verpasste Chancen.» Es habe die Möglichkeit auf ein Europa als dritte Supermacht gegeben. «Aber nur mit Russland», so Rossier.
Dazu komme die westliche Sicht auf die Maidanproteste 2014 in der Ukraine. «Hier ist die Lesart des Westens wirklich falsch», sagte Rossier. Das sei kein Aufstand gegen Autokraten gewesen, sondern fast ein Bürgerkrieg. Die Ukraine habe sich damals gezwungen gesehen, zwischen dem Westen und Russland zu wählen. «So etwas macht ein Land kaputt.»
Eine neutrale Rolle wäre für die Ukraine natürlicher gewesen. Dafür dass die Minsker Abkommen nach der Annexion der Krim nicht umgesetzt worden seien, sei auch die Ukraine mitverantwortlich. All dies rechtfertige aber keinen Angriff auf ein anderes Land, so Rossier.
Über die Sanktionen gegen Russland sagte Rossier: «Wenn man Russland wehtun will, muss man zu leiden bereit sein.» Wolle man Putin den Geldhahn zudrehen, müsste komplett auf Öl und Gas verzichtet werden. Sanktionen führten zudem nie zu einer Änderung der Aussenpolitik eines Landes. Als Beispiele führte er den Iran und Nordkorea an.
Die Stimmung in Moskau, wo er zuletzt Anfang Juni zuletzt war, beschrieb Rossier als «bedrückt, finster. Ich habe nichts gespürt von einem kriegerischen Patriotismus und kein einziges «Z» gesehen.» Die Leute Russlands könnten sich durchaus selbst informieren. «Man sagte mir, wir sollten auch nicht alles glauben, was im Westen erzählt wird. Und ich glaube, das stimmt.»
Seine Begegnungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete er als «sehr angenehm». «Die zwei, drei Male, als ich mit ihm diskutiert habe, hörte er mir zu und ging auf meine Argumente ein.» Schreibt Blick.
Es habe die Möglichkeit auf ein Europa als dritte Supermacht gegeben. «Aber nur mit Russland», sagt Yves Rossier. Eine etwas naiv-optimistische, wenn auch ziemlich unmögliche Vision von Ex-Botschafter Rossier.
Damit wäre die «Supermacht» Europa wohl der abhängige Juniorpartner von Russlands Gnaden gewesen statt von den USA. Vom Regen in die Traufe sozusagen. Ganz zu schweigen davon, was unser aller Weltmacht des Billig-Gerümpels aus dem «Land es Lächelns» dazu gesagt hätte.
Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt setzte politische Utopien quasi mit Hämorrhoiden gleich: «Wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen.»
-
5.7.2022 - Tag der Sommerloch-Wuchtbrummen
Vom siebten Himmel in die Hölle: Melanie S. (37) heiratete einen Kubaner, holte ihn in die Schweiz – dann begann der Ehe-Horror: «Liebe Frauen, seid nicht so dumm wie ich!»
So hatte sie sich ihre Ehe nicht vorgestellt: Melanie S. (37) heiratete die vermeintliche Liebe ihres Lebens spontan in Kuba. Zurück in der Realität, habe sich ihr Traummann in einen Tyrannen verwandelt. Nun will sie mit ihrer Geschichte anderen Betroffenen Mut machen.
Melanie S.* (37) sitzt aufgeregt in einer Walliser Gartenbeiz. Der gelernten Coiffeuse fällt es schwer, über die vergangenen Jahre zu sprechen. Aber: «Was mir passiert ist, sollte niemandem jemals widerfahren. Darum erzähle ich meine Geschichte.»
Juni 2014. Die junge Frau sucht ihr Liebesglück auf einer Dating-Plattform. Eines Tages trifft sie auf Miguel Z.* (32), der in Kuba lebt. Die beiden verstehen sich blendend, einem Online-Übersetzungsdienst sei Dank. «Im März 2015 bin ich dann ganz allein nach Kuba gereist», erzählt sie. Ihrem Umfeld habe sie den Grund für die Reise verschwiegen.
In der Schweiz zeigte er sein wahres Gesicht
In Kuba angekommen, schwebte die Walliserin auf Wolke sieben. «Er war so aufmerksam. Und ich hatte mir gesagt, dass ich ihn – wenn wir uns verstehen – direkt heirate. Das macht halt einiges einfacher.» So kommt es, dass Melanie S. nach nur einer Woche ihre vermeintlich grosse Liebe heiratet.
Zurück in der Schweiz, habe sie sich ins Zeug gelegt, damit Miguel Z. so rasch wie möglich nachkommen konnte. «Am 7. August 2015 kam er in Genf an – und war irgendwie verändert», erinnert sie sich. «Mitte Oktober wurde er das erste Mal gewalttätig.»
Zu Beginn habe sie die Schuld für sein Verhalten bei sich selbst gesucht – sich gesagt, er brauche Zeit, hier anzukommen. «Er hat auch unsere Sprache nicht gelernt und darum keine Arbeit gefunden. Und für manche Jobs war er sich zu schade», erzählt sie seufzend. «Ich habe dann nebst meinem Bürojob jeweils noch mehrere Abende pro Woche in einer Diskothek gearbeitet und am Wochenende Chalets geputzt.» Er sei währenddessen daheim gewesen: «Und ging nicht einmal mit dem Hund spazieren.»
Beschimpft, erniedrigt, geschlagen
Ihr Gatte habe sich die Zeit etwa mit Onlineshopping vertrieben. Die Schulden hätten sich zusammengeläppert. «Ich durfte nie in die Ferien. Er wiederum reiste pro Jahr immer für einen Monat zu seiner Familie», berichtet sie weiter. Auch fremdgegangen sei er regelmässig.
Doch Melanie S. glaubte an die Liebe, ihr Mann habe sich auch immer wieder entschuldigt und Besserung gelobt. Doch: «Er hat mich vier Jahre und zehn Monate lang als ‹dick› und ‹hässlich› beschimpft, mit dem Messer bedroht, geschlagen, mit Füssen getreten und gegen meinen Willen angefasst. Ich hatte mehrmals Todesangst», führt sie aus. «Irgendwann habe ich mich zur Entscheidung durchringen können, zur Polizei zu gehen.»
«Damals hatte ich immer Hoffnung»
Nach der Trennung habe er sie gestalkt: «Darum bin ich ins Ausland gezogen.» Die Kirsche auf der Torte wurde der Walliserin aber erst beim Scheidungsurteil serviert: Da sie berufstätig und ihr Ex arbeitslos war, musste sie ihm fast 23'000 Franken von ihrer zweiten Säule bezahlen. Auch auf den Betreibungen von etwa 70'000 Franken blieb sie sitzen. So wolle es halt das Gesetz, erklärt sie fassungslos.
«Ich bereue nicht, dass ich etwas gewagt und schnell geheiratet habe. Ich bereue es, dass ich nicht früher die Reissleine gezogen habe», sagt sie rückblickend. «Ich habe immer Hoffnung gehabt. Heute weiss ich, dass sich so ein Mensch nie ändert. Liebe Frauen, seid nicht so dumm wie ich!» * Namen geändert. Schreibt Blick.
Einfältige Wuchtbrummen erobern die Frontseiten des Boulevards im Sommerloch, nachdem die Ukraine-Livetickerformate keine Klicks mehr hergeben. Und dies beileibe nicht nur bei Blick. Beim TikTok-Ableger «20Minuten» geht's immer noch einen Tick dicker. Im wahrsten Sinne des Wortes.
-
4.7.2022 - Tag der riesigen Gasvorkommen in der Schweiz
Wir könnten uns mehrere Generationen lang selbst versorgen: Unter der Schweiz lagert genug Erdgas
In der Schweiz und vielen europäischen Ländern droht eine akute Gasknappheit. Doch nun zeigen neue Blicke auf alte Projekte, dass die Schweiz beim Gas zur Selbstversorgerin werden könnte.
«Unter der Schweiz hat es genug Gas, damit wir uns selbst versorgen können!» Das sagt Patrick Lahusen (77), der seit Jahrzehnten in der Schweiz nach Öl und Gas bohrt. Lahusen kennt den Boden unter der Schweiz wie besser als seine Westentasche, ist im Besitz vieler wertvoller Daten für die mögliche Ausbeutung von Lagerstätten.
Das ist ein Lichtblick in der verzweifelten Suche der Schweiz nach Ersatz für russisches Erdgas. Denn die Umleitung der globalen Gasströme ist ein aufwendiges Unterfangen, es brauchte neue Pipelines oder Flüssiggas-Terminals, um das Gas vom Golf oder den USA nach Europa und damit auch in die Schweiz zu leiten.
Viel in der Schweiz gebohrt
Hierzulande wurde immer wieder nach Öl- und Gasvorkommen gesucht. So etwa in der Waadt, am Genfersee oder in Weiach ZH. Dort wurde sogar die umstrittene Fracking-Methode angewandt. Dabei wird unter grossem Aufwand das Lagergestein aufgebrochen, damit die Öl- und Gasvorkommen überhaupt ausgebeutet werden können. Lahusen beruhigt: «Diese Technologie hat man heute viel besser im Griff. Wenn man es richtig macht, gibt das heute keine grossen Probleme mehr.»
Bei den meisten Projekten war Lahusen mit dabei. Es gebe hierzulande einige Bohrungen, die lediglich mit sogenannten Zementbrücken verschlossen sind. «Diese liessen sich innert weniger Wochen wieder öffnen.» Wo die Probebohrungen genau liegen, will Lahusen nicht verraten, aus Rücksicht auf die lokale Bevölkerung. Diese soll nicht aus den Medien erfahren, das unter ihren Häusern möglicherweise die Lösung der Schweizer Gasprobleme liegt.
Gas aus Finsterwald LU
In der Schweiz wurde bislang erst ein nennenswertes Gasvorkommen ausgebeutet. In Finsterwald LU wurde nach Öl gesucht und Gas gefunden. Das Vorkommen wurde zwischen 1985 und 1994 Gas ausgebeutet, das Gas in die nahe Transitpipeline eingespeist. Geld wurde damit keines verdient, aber immerhin konnten die Produktionskosten und ein Teil der Bohrkosten gedeckt werden.
Auch in St. Gallen stiess man bei einem Geothermie-Projekt auf Gas, doch wurde die Förderung des Vorkommens damals nicht in Betracht gezogen. Bis vor wenigen Monaten war es viel billiger, Gas aus dem Ausland zu importieren, als den Energieträger vor der eigene Haustüre zu fördern.
Das hat sich mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges radikal geändert. Denn je höher der Öl- und Gaspreis, desto eher lohnt es sich, selbst in der Schweiz nach Gasvorkommen zu suchen.
Vielversprechende Vorarbeiten
Ganz konkret im Tessin. Dort könnte Erdgas sogar schon sehr bald gefördert werden, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. «Wenn alles rund läuft und uns die verantwortlichen Behörden unterstützen, können wir ab Ende 2025 in der Schweiz Erdgas fördern», sagt Pietro Oesch. Der pensionierte Unternehmer beschäftigt sich schon lange mit der Suche nach Gas im Tessin.
Oesch hat schon früher den Tessiner Boden nach Gasvorkommen durchwühlt: «65 Prozent der Vorarbeiten und Abklärungen wurden in der Zeit zwischen 2000 und 2010 bereits gemacht». Erste Resultate fielen zwar vielsprechend aus. Nicht überraschend, denn im benachbarten Italien wird seit Jahrzehnten Gas gefördert. Doch 2018 wurde das Projekt eingestellt.
Auch wenn Lahusen das Tessin «als grundsätzlich interessant für die Suche nach Gas» bezeichnet, ist er bezüglich des Umfangs der Lagerstätte unter dem Lago Maggiore etwas skeptisch: «Im See gibt es immer wieder Gasaustritte. Das heisst, dass Reservoir rinnt.» Kommt hinzu, dass im Tessin die eurasische und die afrikanische Platte aufeinander stossen. Das heisst, der Druck im Untergrund ist hoch, das Gas in ganz kleinen Gesteinsporen eingeschlossen. Schreibt Blick.
Man ist in struben Zeiten wie diesen geneigt über jeden Strohhalm zu frohlocken. «Let's do it!» schreit unsere gequälte Seele.
Doch im Konjunktiv geschriebene Artikel und Aussagen von 77-jährigen Senioren halten einem Realitätscheck meistens nicht stand.
Ausserdem sollte man sich das «Zeter und Mordio»-Geschrei inklusive Demos der vereinten Weltverbesserer*innen berücksichtigen. Da werden die Politgrössen wohl eher explodierende Nebenkosten in Kauf nehmen als an der Wahlurne abgewählt zu werden.
Nebenbei: Der Begriff «Zeter und Mordio» in seiner eigentlichen Bedeutung ist hier falsch. Aber mir gefällt er so sehr, dass ich nicht von ihm lassen kann. Oder frei nach dem Film von Fritz Lang «Eine Stadt sucht einen Mörder»: Kann nicht. Muss!
Soviel Starrsinn muss mir am 4. Juli erlaubt sein. Immerhin feiere ich heute zusammen mit Tom Cruise («Born on the Fourth of July») meinen 32. Geburtstag. Zum dritten Mal.
-
3.7.2022 - Tag des stresslosen Politikerdaseins
Politikerinnen und Politiker leben länger als die von ihnen Regierten
Die politische Elite lebt in reichen Ländern länger als die Durchschnittsbevölkerung. Elf Nationen wurden für die Analyse herangezogen, darunter Österreich.
Parlamente als Horte der Langlebigkeit? Was regelmäßig vorkommende Schlägereien in den Kammern der Volksvertretung – von Hongkong über Südafrika bis hin zum EU-Parlament – bezweifeln lassen, bestätigt nun eine Studie der Universität Oxford. Politikerinnen und Politiker erfreuen sich im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung einer höheren Lebenserwartung.
Dieses Urteil basiert auf Daten aus elf Ländern mit hohem Einkommen und schließt mehr als 57.500 Politpersönlichkeiten ein. Ihre verblüffenden Erkenntnisse veröffentlichten die Forschenden im Fachjournal "European Journal of Epidemiology". Gesammelt und durchleuchtet wurden Informationen über Politikerinnen und Politiker aus Australien, Österreich, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Neuseeland, der Schweiz, Großbritannien und den USA.
In vielen Staaten wurden kürzlich erreichte Verbesserungen in der Lebenserwartung von der Corona-Pandemie durchkreuzt. Dieser Umstand führte das Forschungsteam von Oxford Population Health zur Frage, ob gewisse elitäre Berufe – etwa in der Politik – mit einer besseren Gesundheit einhergehen. Für ihre Analyse blickten die Forschenden bis ins Jahr 1816 (in Frankreich) zurück und untersuchten die Sterblichkeit bis 2017.
Bis zu sieben Jahre mehr
Damit legt das Team die bisher umfangreichste Untersuchung zum Thema vor. Zuvor haben sich Studien, die die Sterblichkeitsraten zwischen Politikerinnen und Politikern und der von ihnen vertretenen Bevölkerung verglichen, in der Regel auf eine Nation oder wenige Länder konzentriert.
Wie aber ist das nun mit der Politik und dem langen Leben? Die Erkenntnisse aus Oxford konnten tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Beruf und Lebenserwartung herstellen: Der Überlebensvorteil, den der Politberuf vielerorts bringt, ist in einigen analysierten Nationen – etwa den USA – auf dem höchsten Stand seit 150 Jahren.
Doch damit nicht genug: In manch untersuchtem Land überleben Politikerinnen und Politiker die Durchschnittsbevölkerung gar um sieben Jahre. Diesen Rekordwert erreichten die USA, während der Wert etwa in den Niederlanden bei einem Plus von rund vier Jahren liegt. Die Oxford-Gruppe verglich die Anzahl der Todesfälle unter Politikerinnen und Politikern jedes Jahr mit der durchschnittlichen Bevölkerungssterblichkeitsrate.
Zudem berechneten sie die Unterschiede in der Lebenserwartung ab dem Alter von 45 Jahren zwischen den Volksvertreterinnen und -vertretern und der allgemeinen Bevölkerung. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Überlebensvorteil der Politiker heute im Vergleich zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr hoch ist", sagt Laurence Roope, Senior Researcher bei Oxford Population Health und Mitautor der Studie.
Typische Politleiden
Viele mögen auf der Suche nach einer Erklärung zuerst an finanzielle Faktoren denken. Schließlich wirft die Politik Gehälter ab, die jene der durchschnittlichen Bevölkerung bei weitem übersteigen. Dies mag zwar zu den Gründen gehören, den Forschenden zufolge müssen aber auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Denn: Die Ungleichheit bei den Einkommen stieg vor allem ab den 1980er-Jahren, die Unterschiede in der Lebenserwartung zeigten sich aber bereits vor den 1940er-Jahren.
Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter vermuten einen Mix an Ursachen hinter dem Phänomen. Dazu gehört etwa die Verfügbarkeit besserer Therapien für Erkrankungen, die eher Menschen im politischen Geschäft treffen – insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Als Beispiel führen die Forschenden an, dass sowohl US-Präsident Franklin Roosevelt als auch der britische Premierminister Winston Churchill an Bluthochdruck litten. Beide starben schließlich an einem Schlaganfall. Seit jedoch in den 1960er-Jahren blutdrucksenkende Medikamente großflächig verfügbar wurden, ist das Risiko, an Kreislauferkrankungen zu sterben, deutlich gesunken.
Imagepflege
Ausschlaggebend könnte daneben auch ein neuer Politstil sein, der sich seit einigen Jahren immer stärker etabliert. Öffentliche Auftritte und Imagepflege werden dabei für das Ansehen von Politikerinnen und Politikern zusehends wichtiger. Neue Kampagnenmethoden – inklusive Fernsehübertragungen und der Präsenz auf Social-Media-Kanälen – könnten auch die Art der Personen verändern, die sich für eine politische Laufbahn entscheiden.
Es ist auch möglich, dass sich dies auf die Lebenserwartung dieser Gruppe auswirkt. Da die nun vorgelegte Studie Länder mit hohem Einkommen in den Fokus nimmt, sei bei Vergleichen jedoch Vorsicht geboten. So können die Ergebnisse wohl nicht auf Staaten mit mittlerem oder niedrigem Einkommen umgelegt werden, mahnen die Forschenden. Schreibt DER STANDARD.
Könnte es bezüglich der höheren Lebenserwartung von Politikern*innen sein, dass sich die Polit-Elite viel weniger über ihr Wahlvolk und dessen Befindlichkeiten ärgert als umgekehrt?
Psychischer Stress und Schnappatmungen sollen gemäss der Wissenschaft die Lebensdauer nicht unbedingt fördern.
Sollte dies tatsächlich zutreffen, würden unsere Trychler ja wesentlich früher das Zeitliche segnen als ihre Bonzen.
-
2.7.2022 - Tag der toxischen Worte wie «Schlitzauge»
Nasa-Chef warnt vor China: Neues Rennen um Vorherrschaft auf dem Mond
Der Nasa-Chef warnt vor dem chinesischen Weltraumprogramm und einem neuen kalten Krieg im All. Die Chinesen würden die Vorherrschaft auf dem Mond suchen und bald sagen: «Das gehört jetzt uns, und Ihr bleibt draussen.»
Nasa-Chef Bill Nelson hat vor dem chinesischen Weltraumprogramm gewarnt. «Wir müssen sehr besorgt darüber sein, dass China auf dem Mond landet und sagt: Das gehört jetzt uns, und Ihr bleibt draussen», sagte er der Tageszeitung «Bild».
«Chinas Weltraum-Programm ist ein militärisches Weltraum-Programm», sagte Nelson. Anders als beim «Artemis»-Programm der Amerikaner seien die Chinesen nicht gewillt, ihre Forschungsergebnisse zu teilen und den Mond gemeinsam zu nutzen. «Es gibt ein neues Rennen zum Weltraum - diesmal mit China.»
China arbeitet daran, eigene Astronauten auf den Mond zu bringen. Mehrfach ist die Volksrepublik bereits mit Forschungsrobotern auf der Mondoberfläche gelandet und hat auch erfolgreich Mondgestein auf die Erde zurückgebracht.
China stehle Ideen und Technologien
In den 2030er-Jahren, so heisst es in Berichten chinesischer Staatsmedien, soll in einem weiteren Schritt eine permanente Station auf dem Erdtrabanten entstehen. Die Forschungsstation könnte demnach gemeinsam mit Russland aufgebaut und betrieben werden.
Auf die Frage, welche militärischen Zwecke China im Weltraum verfolgen könnte, antwortete Nelson der Zeitung: «Nun, was glauben Sie, was auf der chinesischen Raumstation passiert? Sie lernen dort, wie man die Satelliten von anderen zerstört.»
Darüber hinaus beklagte Nelson auch den chinesischen Technologiediebstahl: «China ist gut. China ist aber auch deshalb gut, weil sie die Ideen und Technologien von anderen stehlen.» Schreibt Blick.
In den Zeiten vor Corona, als die schönste Stadt der Welt Luzern noch von den chinesischen Touristen*innen geflutet wurde, kreischte eine aufgebrachte Luzernerin ins Mikrophon eines Lokaljournalisten, der gerade eine Reportage über die chinesischen Touristen in der Stadt Luzern machte: «Of e Mond met dene forchtbare ....». Das Wort «Schlitzaugen» steht auf dem Index und wurde entsprechend ausgeblendet.
Falls die kreischende Luzernerin den Blick-Artikel liest, wird sie sicher eine klammheimliche Freude empfinden, sollte ihr Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen.
Ni Hao!
-
1.7.2022 - Tag der starken Frauen
Legt Spiess-Hegglin der Boulevardpresse definitiv die Zügel an?
Seit acht Jahren dreht die Geschichte um die frühere Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin und die Ereignisse an der Landammann-Feier. Mit dem jüngsten Urteil gegen Ringier zur Herausgabe von Gewinnen aus Artikeln zeichne sich eine Zäsur ab, sagt SRF-Medienredaktor Salvador Atasoy.
SRF News: Welche Bedeutung hat dieses Urteil des Zuger Kantonsgerichts?
Salvador Atasoy: Das Urteil ist ein Novum in der Schweizer Medienlandschaft. Noch nie musste ein Verlag den Wert von einzelnen Artikeln berechnen. Die Verlage stellten sich bisher immer auf den Standpunkt, das sei gar nicht möglich. So gesehen ist es tatsächlich eine Zeitenwende, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und Ringier das Urteil ziemlich sicher weiterzieht. Das erstinstanzliche Urteil des Kantonsgerichts zeigt aber: Die Forderung steht im Raum und wird juristisch gestützt.
Jolanda Spiess-Hegglin hat mehrere Klagen gegen Ringier am Laufen. Worum geht es bei der aktuellen Klage.
Im Grunde geht es auch hier um Persönlichkeitsverletzungen und die Frage, ob die Geschichte der Landammann-Feier von öffentlichem Interesse ist oder nicht. Bisher ging es allerdings um genau einen Artikel. In diesem Fall urteilte das Zuger Obergericht 2020 zweitinstanzlich zugunsten von Spiess-Hegglin. Ringier akzeptierte das Urteil und entschuldigte sich.
Im jüngsten Urteil geht es ums gleiche Prinzip, allerdings bei mehreren Blick-Artikeln. Die Journalistin, Politikern und heutige Aktivistin Spiess-Hegglin geht aber einen Schritt weiter: Und zwar mit der Forderung, dass Ringier auch die Gewinne aus den umstrittenen Stories herausgeben soll. Das Kantonsgericht sieht den Anspruch der Klägerin in vier von fünf eingereichten Artikeln als berechtigt an.
Ist es überhaupt möglich, die Gewinne zu berechnen, die in der Zeitung und online waren und auch in den sozialen Medien verbreitet wurden?
Das Gericht bejaht: Blick habe dank den Geschichten die Auflage steigern können und müsse deshalb den Gewinn abzüglich Unkosten abgeben, so das Urteil. Das Gericht gibt dazu sogar die Anleitung. Es verlangt, dass Ringier die Einzelverkäufe gewisser Blick-Nummern nennt, ebenso die Kennzahlen der einzelnen Online-Artikel.
Experten wie etwa der ehemalige Chefredaktor von 20 Minuten online, Hansi Voigt, sagt: Der Wert eines einzelnen Clicks zu einem bestimmten Zeitpunkt könne berechnet werden, wenn man Werbeeinnahmen und Konditionen kenne. So zeige sich, was ein Unternehmen mit einer Geschichte verdient habe.
Was würde es für die Medien und künftige Schmutzkampagnen bedeuten, wenn das Urteil bis zum Bundesgericht bestehen bliebe?
Es wäre ein Wendepunkt. Jolanda Spiess-Hegglin geht es letzten Endes darum, einen Schlüssel zu definieren, wie entstandener Schaden materiell berechnet werden kann. Das war bisher nicht möglich. Es geht also darum, einen Präzedenzfall zu schaffen.
Dies wiederum würde bedeuten, dass die Berichterstattung für Medien schwieriger wird und mehr Leute, die sich verletzt fühlen, klagen könnten. Ein Artikel, basierend auf Gerüchten und übler Nachrede, wäre künftig juristisch noch viel heikler als heute. Gerade für den Boulevard wäre das eine harte Einschränkung, lebt dieser doch zumindest teilweise von Gerüchten und Anwürfen.
Das Gespräch führte Roger Brändlin. Schreibt SRF.
Man kann über Frau Spiess-Heglin* denken, was man will, aber ihr Marathon durch die Gerichtsinstanzen nötigt Respekt ab. Ich sage das als einer, der ebenfalls Witze über die Zuger Politikerin gerissen hat.
Sie ging politisch wie auch familiär durch die Hölle des gnadenlosen Boulevards. Doch am Ende siegte sie als starke Frau nicht nur über das Clickbaiting** der einschlägigen Medien, sondern auch über die Primitivität einiger SVP-Granden und deren Durchlauferhitzer «Weltwoche».
Nun müsste sie eigentlich nur noch den Ziehsohn des Paten vom Herrliberg verklagen. Die Schadenfreude wäre wohl sehr gross, würde Christoph Mörgeli*** zu einer saftigen Busse verurteilt.
* Wikipedia über Spiess-Hegglin
** Wikipedia über Clickbaiting

-
30.6.2022 - Tag des Humors in Kriegszeiten
«In jedem Fall ein widerlicher Anblick» – Putin lässt sich von G 7 provozieren
Die jüngsten Scherze beim G-7-Gipfel über die Fotos von Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper kamen beim Kremlchef nicht gut an. Hätten die G-7-Spitzen sich entblößt, wäre dies ein „widerlicher Anblick“ gewesen, sagte der russische Präsident am Mittwoch vor Journalisten in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat.
Die Unterhaltung, auf die Putin einging, ereignete sich beim G-7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern bereits am Sonntagnachmittag. Der britische Regierungschef Boris Johnson fragte angesichts der hohen Temperaturen, ob man die Jacketts wohl ausziehe oder nicht, und fügte hinzu: „Wir alle müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin.“ Der kanadische Premier Justin Trudeau erwiderte unter anderem: Reiten mit nacktem Oberkörper, das müsse man machen. Er spielte damit auf ein bekanntes Foto Putins in solcher Pose an.
„Ich weiß nicht, wie sie sich ausziehen wollten, oberhalb oder unterhalb der Gürtellinie. Ich denke, es wäre in jedem Fall ein widerlicher Anblick gewesen“, wurde Putin nun von der russischen Nachrichtenagentur Tass zitiert.
Für die Harmonie zwischen Körper und Seele müsse man Sport machen, nicht zu viel Alkohol trinken und andere schlechte Angewohnheiten aufgeben, belehrte Putin die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Industrieländer. Bis zur russischen Annexion der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim 2014 war Russland Teilnehmer der erweiterten G-8-Gipfel. Schreibt DIE WELT.
Schön, dass man in Zeiten wie diesen den für unsere Seelen so wichtigen Humor nicht ganz ausser Acht lässt. Doch wie sagte Napoleon treffend? «Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt.» Das gilt für Diktatoren ebenso wie für die Staatenlenker der «hehren westlichen Staatengemeinschaft».
Denn Hand aufs Herz: So ganz Unrecht hat Vladimir Putin für einmal nicht: Joe Biden nackt oder halbnackt zu sehen wäre wohl in der Tat keine Augenweide.
-
29.6.2022 - Tag der trivialen Weltenlenker
Ihr Gespräch im Wortlaut – Macron versus Putin: So lief ihr Telefonat kurz vor dem Krieg ab
Das Bild von Macron mit Kremlchef Putin am langen Verhandlungstisch füllte Titelseiten, später gab es Kritik am intensiven Kontakt des Franzosen nach Moskau. Ein nun veröffentlichtes Telefonat zeigt, wie Putin Macrons Friedensbemühungen vor Kriegsbeginn abwehrte.
Es ist Sonntag, der 20. Februar 2022. Emmanuel Macron steigt ziemlich direkt in das neunminütige Telefon-Gespräch mit dem russischen Machthaber ein. «Ich möchte, dass du mir zuerst sagst, wie du die Situation einschätzt, und mir vielleicht auf ziemlich direkte Weise, wie wir es beide tun, deine Absichten mitteilst.» Daraufhin holt Putin gleich gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski aus. Dieser lüge, wolle das Minsker Abkommen nicht umsetzen und strebe gar nach Atomwaffen. Den Vorhalt Putins, er wolle das Abkommen überarbeiten, weist Macron zurück. «Ich habe gesagt, man muss es umsetzen.»
Das Gerangel geht dann weiter um die Rolle der Separatisten. «Hör mal, Emmanuel, ich verstehe euer Problem mit den Separatisten nicht. Zumindest haben sie auf unser Drängen hin alles Notwendige getan, um einen konstruktiven Dialog mit den ukrainischen Behörden zu eröffnen», meint Putin.
«Es sind nicht die Separatisten, die Vorschläge zu ukrainischen Gesetzen machen werden», kontert Macron. «Ich weiss nicht, wo dein Jurist studiert hat», legt er nach. «Und ich weiss nicht, welcher Jurist dir sagen kann, dass in einem souveränen Land die Gesetzestexte von separatistischen Gruppen vorgeschlagen werden und nicht von den demokratisch gewählten Behörden.»
Als Putin weiter auf das Bemühen der Separatisten pocht, wird Macron ungehalten. «Wie ich dir gesagt habe, sind uns die Vorschläge der Separatisten egal.» Diese müssten vielmehr auf die Ukrainer reagieren. «Jetzt hör mir mal gut zu, hörst du mich?», geht Putin nun den französischen Präsidenten an und pocht darauf, dass der Ball bei der Ukraine liege, es müsse Druck auf die Ukraine aufgebaut werden. «Aber ich habe ein Maximum unternommen, um sie zu bewegen, das weisst du gut», antwortet Macron. «Das weiss ich, aber leider hat das nichts bewirkt», heisst es vom Kremlchef. Er werde Selenski erneut zur Ruhe mahnen, beschwichtigt Macron.
«Lass dich in den nächsten Stunden und Tagen nicht auf Provokationen jeglicher Art ein», setzt Macron fort. Und dann lädt der französische Präsident den Kremlchef zu einem kurzfristigen Spitzentreffen mit US-Präsident Joe Biden ein – das eigentliche Ziel des Telefonats. Putin reagiert zwar höflich. «Vielen Dank, Emmanuel. Es ist mir immer ein grosses Vergnügen und eine grosse Ehre, mit deinen europäischen Amtskollegen sowie mit den Vereinigten Staaten zu sprechen.» Die Amerikaner einzubeziehen, sei eine gute Idee, allerdings müsse so ein Treffen erst vorbereitet werden. «Damit du weisst, im Prinzip bin ich einverstanden.»
Dass es wichtigere Dinge gibt, als den französischen Präsidenten und den Austausch über Krieg und Frieden, macht Putin Macron dann ohne Umschweife deutlich. «Um dir nichts zu verheimlichen, ich wollte jetzt Eishockey spielen gehen und ich spreche aus der Sporthalle zu dir, bevor es mit dem Training losgeht. Ich rufe erst meine Berater an.» Macron dankt Putin. «Wir bleiben in direktem Kontakt. Sobald es etwas gibt, rufst du mich an.» Vier Tage später marschieren die russischen Truppen in die Ukraine ein. Schreibt SRF.
Kurz und barsch: Trivialer geht's eigentlich gar nicht mehr.
Da haben ja die Gespräche mit meinem wandelnden Lexikon mehr Substanz.
-
28.6.2022 - Tag der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel
Streit über Flughafen-Chaos in Deutschland: Union fordert Lösung mit inländischen Fachkräften
Der Konflikt erinnert an frühere Debatten in der Einwanderungspolitik: Die Union warnt die Bundesregierung davor, Flughafenpersonal im Ausland anzuwerben. Das Airport-Chaos müsse mit inländischen Mitarbeitern gelöst werden.
Die Union hat die Bundesregierung aufgefordert, im Kampf gegen das Chaos an deutschen Flughäfen auf inländische Fachkräfte anstelle von ausländischen Helfern zu setzen. »Das Flughafen-Chaos könnte dauerhaft mit inländischen Fachkräften gelöst werden«, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß (CDU), der Düsseldorfer Tageszeitung »Rheinische Post«.
»Ich fordere die verantwortlichen Fachminister auf, in diesem Sinne zu handeln.« Inzwischen schade das Reisechaos dem Ansehen Deutschlands im Ausland, sagte Bareiß weiter. Es belaste außerdem viele Menschen, »die sich ihren Erholungsurlaub verdient haben«.
Furcht vor Ausbeutung und Dumping
Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Regierung die Einreise von hunderten ausländischen Hilfskräften ermöglichen will, die auf den Flughäfen etwa in der Gepäckabfertigung aushelfen sollen. Aus Regierungskreisen hieß es, geholt werden solle eine vierstellige Zahl an Hilfskräften aus der Türkei. Laut dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft seien dafür Ausnahmegenehmigungen deutscher Behörden für den Einsatz von etwa 2000 Arbeitskräften nötig.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte Bereitschaft für eine solche Lösung signalisiert. Dabei müsse allerdings sichergestellt werden, dass jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausgeschlossen sei, so der SPD-Politiker.
Deutschen Fluggesellschaften und vielen Flughäfen macht derzeit vor allem Personalmangel zu schaffen. Flüge werden gestrichen, auf den Flughäfen kommt es zu langen Warteschlangen. In der Coronapandemie waren viele Stellen gestrichen worden, dazu kommen aktuell viele Corona-Erkrankungen. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge fehlen derzeit an deutschen Flughäfen rund 7200 Fachkräfte. Schreibt DER SPIEGEL.
Ausgerechnet die Union von CDU/CSU fordert für das Flughafenchaos eine Lösung mit «inländischen» Fachkräften. Da scheinen ein paar deutsche Politgrössen aus dem abartig neoliberalen CDU/CSU-Dunstkreis vergessen zu haben, wer die letzten 16 Jahre Deutschland regiert hat. Die Konzernhörigkeit von Angela Merkel fällt ihnen nun vor die Füsse.
Die AVZ-Kolumne vom 26.6.2022 - Tag des «failed states» Deutschland, hilft weiter, um das ganze Chaos zu verstehen. So kommt es halt, wenn Politiker*innen blind den «Anweisungen» der Konzerne folgen und zu allem auch noch eine desaströse Migrationspolitik betreiben.
Wer jetzt als Schweizer*in mit Häme auf Deutschland schaut, sollte allerdings bedenken, dass die Schweiz mit ähnlichen Problemen gesegnet ist. Wenn auch nicht in dem Ausmass wie Deutschland es gerade erlebt.
Tja, man darf gespannt sein, wie die allseits beschworene «Zeitenwende» in Europa gemeistert wird.
-
27.6.2022 - Tag des schrägen Vogel von der Downing Street 10
Johnson warnt vor wachsendem Druck auf Ukraine
Der britische Premierminister Boris Johnson befürchtet wegen der wirtschaftlichen Folgen des Krieges wachsenden europäischen Druck auf die Ukraine, ein nicht in ihrem Sinne liegendes Friedensabkommen mit Russland zu schliessen.
«Zu viele Länder sagen, dass dies ein europäischer Krieg ist, der unnötig ist. So wird der Druck wachsen, die Ukrainer zu einem schlechten Frieden zu bewegen – vielleicht sogar zu zwingen», sagte Johnson am Rande eines Commonwealth-Gipfels in der ruandischen Hauptstadt Kigali.
Sollte der russische Präsident Wladimir Putin seinen Willen in der Ukraine durchsetzen können, seien die Folgen gefährlich für die internationale Sicherheit und «eine langfristige wirtschaftliche Katastrophe.» So stand es geschrieben im SRF Liveticker zum Ukrainekrieg.
Man muss den schrägen Vogel von der Downing Street 10 in London nicht mögen. Aber wo er recht hat hat er recht.
Doch leider ist Boris Johnson kein Winston Churchill.
-
26.6.2022 - Tag des «failed states» Deutschland
Personalmangel nach der Pandemie; Bundesregierung will ausländische Hilfskräfte an Flughäfen holen
Gestrichene Flüge, lange Schlangen, verlorene Koffer: Gegen das Chaos an deutschen Flughäfen will die Bundesregierung befristet Helfer aus dem Ausland anlocken. Sozialdumping und Ausbeutung sollen ausgeschlossen werden.
Die Luftverkehrsbranche verlangt, die angespannte Lage an Flughäfen mit Personal aus der Türkei zu entspannen. Ausnahmegenehmigungen deutscher Behörden für den Einsatz von etwa 2000 Arbeitskräften seien nötig, teilte diese Woche der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mit.
Im Kampf gegen die Personalengpässe wollen Innen-, Arbeits- und Verkehrsministerium diesen Wünschen laut einem Bericht nun nachkommen. Sie haben demnach eine gemeinsame Aktion zur befristeten Anstellung von ausländischen Hilfskräften an deutschen Flughäfen angekündigt.
»Die Bundesregierung plant, die Einreise von dringend benötigtem Personal aus dem Ausland für eine vorübergehende Tätigkeit in Deutschland zu ermöglichen«, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil der »Bild am Sonntag«. Dabei solle jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausgeschlossen werden, sagte der SPD-Politiker.
»Die Arbeitgeber müssen Tariflohn zahlen und für die befristete Zeit anständige Unterkünfte bereitstellen.« Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ergänzte: »Wir werden ermöglichen, dass Hilfskräfte aus dem Ausland zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden«. Laut »Bild am Sonntag« solle eine vierstellige Zahl an Fachkräften aus der Türkei nach Deutschland geholt werden, die bestenfalls schon von Juli an für einige Monate eingesetzt werden könnten.
Lufthansa rechnet erst 2023 mit Normalisierung
Die Luftfahrt steckt im Dilemma. Mit Abebben der Coronapandemie, die den Wirtschaftszweig lange lahmgelegt hat, beabsichtigt die Branche endlich durchzustarten. Doch stattdessen kommt es zu Flugstreichungen, Verspätungen und Warteschlangen. Als Knackpunkt gelten Personalmangel und Engpässe bei Sicherheitskontrollen, Check-in und Flugzeugabfertigung. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV ist dort etwa jede fünfte Stelle unbesetzt.
Die Lufthansa hatte zuletzt angekündigt, mehr als 2000 weitere Flüge an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München zu streichen – unter anderem auch, weil sich vermehrt Besatzungen wegen Coronafällen krankmelden. Schon vor gut zwei Wochen hatte sie angekündigt, 900 Verbindungen an Freitagen und Wochenenden im Juli zu canceln. Auch die Billigtochter Eurowings rechnet mit weiteren Streichungen.
Bei der Lufthansa erwartet man angesichts dieser Lage indes erst für nächstes Jahr eine Normalisierung des Flugbetriebs. Aktuell helfe nur, die Zahl der Flüge zu reduzieren. Das sei nicht nur ein deutsches Problem, sondern gelte für die ganze Welt. Bis neue Arbeitskräfte eingesetzt werden können, kann es tatsächlich dauern – auch wegen der branchenspezifischen Sicherheitsüberprüfungen.
Verkehrsminister Volker Wissing wies derweil die Verantwortung für die chaotischen Zustände an den Flughäfen zurück – und sieht die Unternehmen in der Pflicht. »Für die Personalpolitik der Flughafengesellschaften und Airlines ist die Bundesregierung nicht zuständig und nicht verantwortlich«, sagte der FDP-Politiker der »BamS«. In der Verantwortung des Bundesverkehrsministeriums lägen die Flugsicherung und die Koordination des Flugbetriebs. »Und da läuft alles reibungslos.« Branchenexperten halten jedoch die Auslagerung vieler Aufgaben an externe Dienstleister durch die Politik im Laufe der Nullerjahre für eines der größten Probleme für den Betrieb der Flughäfen. Schreibt DER SPIEGEL.
Entwicklung des Arbeitsmarkts 2022 in Deutschland: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai 2022 im Zuge der anhaltenden Frühjahrsbelebung gegenüber dem Vormonat gesunken, und zwar um 50.000 auf 2.260.000. Saisonbereinigt hat die Arbeitslosigkeit um 4.000 abgenommen. Verglichen mit dem Mai des vorigen Jahres ist sie um 428.000 geringer. Die Arbeitslosenquote sank von April auf Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, lag im Mai 2022 bei 3.022.000 Personen. Das waren 435.000 weniger als vor einem Jahr. Schreibt die Bundesagentur für Arbeit.
2 Millionen und 260'000 tausend Arbeitslose füttert Deutschland laut offiziellen Zahlen durch. Inoffiziell dürften es laut deutschen Experten rund zwei Millionen mehr sein, die entweder ausgesteuert oder in staatlichen Beschäftigungsprogrammen dahinvegetieren.
Aus diesem gewaltigen Heer von Arbeitslosen lassen sich keine 2'000 «Hilfskräfte» für die deutschen Flughäfen rekrutieren? Brauchen diese «Hilfskräfte» denn alle eine Universitätsausbildung? Womöglich gar einen Doktortitel? Was können türkische Hilfskräfte, was deutsche Arbeitslose nicht können?
Liegt es möglicherweise daran, dass türkische Arbeitskräfte für «externe Dienstleister» (besser bekannt unter dem Namen «Temporär-Job-Anbieter») zu wesentlich tieferen Löhnen eingestellt werden können? Sogar noch unter dem gesetzlich festgelegten Minimallohn?
Die von der ursprünglichen «sozialen Marktwirtschaft» zur «abartig neoliberalen Konzernwirtschaft» degenerierte Bundesrepublik Deutschland ist tatsächlich auf dem Weg zum «failed state».
Und ausgerechnet diese Bundesrepublik Deutschland soll die Führung Europas durch den anstehenden «Zeitenwandel» übernehmen?
-
25.6.2022 - Tag der Evangelisten und der News vom Artillerie-Verein Zofingen
BlickPunkt über einen erstaunlichen Aufschwung: Wie wir gut durch diese verrückten Zeiten kommen
Krieg, steigende Zinsen, Inflation: das perfekte Krisen-Szenario! Dennoch boomt die Wirtschaft, Firmen suchen händeringend nach Personal. Wie geht das zusammen?
Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert jetzt schon vier Monate – und niemand weiss, wie viele noch folgen. Die Inflation steigt in beängstigendem Tempo – und niemand weiss, wo das enden wird. Die Zinsen explodieren – und niemand weiss, wie viele Eigenheimbesitzer ihre Hypotheken bald nicht mehr zahlen können.
Der weltweite Aktienindex gab seit Anfang Jahr um mehr als 20 Prozent nach, der Wert des Bitcoins fiel von 69'000 auf 20'000 US-Dollar.
Die weltweiten Lieferketten funktionieren noch immer nicht, Benzin- und Gaspreise klettern auf Rekordhoch, für den Winter droht ein Strom-Blackout. In der Schweiz haben sich die Corona-Zahlen verdoppelt, international breiten sich Hunger und Dürre aus.
Wir leben in verrückten Zeiten. Und das Verrückteste: Trotz all dieser Hiobsbotschaften boomt die Wirtschaft!
Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz liegt bei 2,1 Prozent – das ist quasi Vollbeschäftigung. Quer durch alle Branchen herrscht Personalnot – Bewerber können sich aussuchen, für wen sie arbeiten wollen.
Die ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF) gab diese Woche ihre Prognose bekannt: 2,7 Prozent Wachstum für 2022! Die Industrie läuft stabil, der Tourismus boomt geradezu, viele Menschen haben nach den Entbehrungen der Pandemie erstens grossen Nachholbedarf und zweitens viel Erspartes übrig.
Wie lange kann das gut gehen?
Auch die KOF-Forscher sehen im schlimmsten Fall Rezessionsgefahr, wenn der Krieg eskaliert, die Inflation zu stark anzieht und die Nationalbanken ihre Zinsen überstürzt erhöhen. All das kann der normale Bürger, die normale Bürgerin nicht beeinflussen.
Wirtschaft aber ist zu einem grossen Teil Psychologie – und die Konjunkturforscher sehen unsere Seelenlage optimistisch. Sie schreiben: «Es ist davon auszugehen, dass der inländische Konsum die Schweizer Konjunktur tragen wird.»
Will heissen: Wenn wir alle weiter fleissig Geld ausgeben, kommt es gut. Wenn hingegen jeder mit dem Schlimmsten rechnet, kommt es garantiert schlimm, weil dann niemand mehr kauft oder investiert.
Immerhin sind wir nach den letzten beiden Jahren krisenresistent: Deshalb sollten wir den Mut nicht verlieren – so haben wir die grössten Chancen, gut durch diese schwierigen Zeiten zu kommen! Schreibt Christian Dorer, Chefredaktor Blick-Gruppe.
Netter Wochenend-Artikel. Vorwiegend im Konjunktiv zusammengefasste Schreckensszenarien, die uns drohen (könnten). Dazu ein paar gut gemeinte und nette Allgemeinplätze aus der dargebotenen Hand von Blick-Chefredaktor Christian Dorer.
Dorers Wohlfühlempfehlungen erinnern an das Lukas-Evangelium: «Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird.»
Bedenke: Evangelisten und Boulevardzeitungen wie Blick & Konsorten waren noch nie empfehlenswerte Ratgeber.
Es gibt allerdings eine weit sinnvollere Anregung, um «gut durch diese verrückten Zeiten» zu kommen: Reduzieren Sie Ihren Medienkonsum. Machen Sie einen grossen Bogen um alle Liveticker-Formate und vermeintlichen «Experten»-Aussagen. Vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand. Und den täglichen News vom Artillerie-Verein Zofingen!
Es kommt sowieso alles so wie es kommen muss.
-
24.6.2022 - Schweizer Ingenieurs-Wissen versus China-Grümpel im Kampf gegen Sommerhitze
Wie Wohnbauten künftig kühl bleiben können
Die Hitze ballert schon jetzt auf die Häuser – und es wird in den nächsten Jahren noch heißer. Wie schaffen wir es, dass es in den Wohnräumen ausreichend kühl bleibt?
Drastischer hätte sie es nicht formulieren können: Renate Hammer sprach von "lebensbedrohenden Situationen", die uns die drohende Erderwärmung bald in den Städten bescheren werde. "Da kann sich im Sommer niemand mehr draußen aufhalten", sagte die geschäftsführende Gesellschafterin von Building Research & Innovation vor wenigen Wochen beim Verbandstag der Gemeinnützigen.
Nachtlüften in Wien bringt nicht mehr viel
Die Rede war vom sogenannten Szenario RCP 8.5: dem Anstieg der Außentemperatur, der uns droht, wenn nicht genug gegen den Klimawandel unternommen wird, sondern grosso modo alles so bleibt, wie es ist ("Business-as-usual-Szenario"). Dann ist es in einer Hitzewelle weder im Osten noch im Westen des Landes noch "lebbar", denn dann hat es mehrere Tage lang über 45 Grad in der dichten Stadt; in Innsbruck, wo es schon jetzt im Mittel wärmer ist als in Wien, wird das noch schlimmer als in der Bundeshauptstadt.
Dabei bedeute alles über 35 Grad schon jetzt eine "starke thermophysiologische Beanspruchung", sagte Hammer. In Wien wird es wohl 2050 im Sommer regelmäßig so heiß sein, dass man nachts nicht mehr ausreichend lüften kann. Erholung sei nur bis 23 Grad möglich, "wir werden dann aber oft 24 bis 26 Grad haben in der Nacht", erklärt Hammer. Und das werde man auch nicht mehr verhindern können.
Interessanterweise gibt es dabei einen relevanten Unterschied zwischen Wien und Innsbruck. Die beiden Städte hat Hammer in ihrem Vortrag verglichen. Innsbruck sei zwar am Tag jetzt schon wärmer als Wien. "In der engen Tallage fängt sich die Wärme"; damit werden spätestens im Jahr 2080 in der Tiroler Landeshauptstadt während einer Hitzewelle um 15 Uhr nachmittags, der heißesten Periode eines Tages, "viele Orte nicht mehr lebbar sein". Bei Temperaturen jenseits der 40 Grad "kann man keinen Tourismus mehr betreiben, da kann sich draußen keiner mehr aufhalten, die Kinder können nicht spielen, die Alten nicht einkaufen. Es ist eine lebensbedrohende Situation." In der Nacht aber werde es in Innsbruck auch künftig noch so stark abkühlen, dass man noch lüften wird können.
Klimaanlage sticht Sonnenschutz aus
Und dennoch: Tritt das Szenario RCP 8.5 ein, "dann werden wir bald sämtliche Gebäude kühlen müssen", sagt Lutz Dorsch. Er ist Fachbereichsleiter Klima, Umwelt, Gebäude an der FH Salzburg und leitet das Forschungsprojekt "Cool Buildings", an dem u. a. auch die Donau-Uni Krems beteiligt ist. Den drohenden Hitzewellen sei am besten mit passiver Kühlung zu begegnen, sagt er. "Es gibt aber nicht die eine Lösung", beeilt er sich hinzuzufügen.
Ein Sonnenschutz sei einerseits natürlich hervorragend geeignet, um die Wärme erst gar nicht ins Haus zu lassen. Andererseits sei dieser – jedenfalls derzeit – eigentlich nur wenige Wochen im Sommer nötig, und deshalb werde von Bauträgern oft noch versucht, sich diese Kosten zu ersparen.
Klimaanlagen hingegen sind zumindest im gehobenen Segment bei Neubauten durchaus üblich. Dabei sorgen genau sie Dorschs Erfahrung nach oft dafür, dass dann ein vorhandener Sonnenschutz untertags erst gar nicht runtergefahren wird. "Man schaltet am Abend ja eh die Kühlung ein, wozu also untertags beschatten?" Doch das sei natürlich eine energiefressende Variante: Erst kommt die Wärme ins Haus, dann benötigt man viel Energie, um sie wieder rauszubekommen.
Energiebedarf gering halten
Dabei gehe es eigentlich darum, möglichst wenig Bedarf an Energie zu schaffen, "damit wir das, was wir brauchen, mit den Erneuerbaren schaffen können". Gerade an Solarstrom werde es künftig auch weiterhin kein Überangebot geben, ist Dorsch überzeugt; "wir wollen bald ja auch alle unsere Autos damit laden".
Strom, nämlich für eine Umwälzpumpe, braucht man auch dann, wenn man beispielsweise auf Kühlung per Bauteilaktivierung setzt. Grundsätzlich ist auch das eine gute Idee, die sich aber im Westen Österreichs noch nicht so verbreitet habe wie im Osten, sagt Dorsch. "An sich ist das natürlich auch eine Form der aktiven Kühlung", insbesondere dann, wenn man im Sommer Wärme ins Erdreich einträgt, um sie im Winter wieder entnehmen zu können.
Tageslicht ist wichtig
Doch wie heiß darf es in einem Wohnraum eigentlich werden, und wie lange darf ein Mensch dieser Belastung ausgesetzt sein? Diese Fragen des Gesundheitsschutzes werden Dorschs Beobachtung zufolge stiefmütterlich behandelt. "Es fehlt uns da an Zielgrößen." Man müsse diese Fragen zusammen mit Medizinerinnen und Medizinern erörtern, doch das fehle derzeit noch komplett, sagt Dorsch dem STANDARD. Und ebenso wichtig sei die Frage, wie viel Tageslicht der Mensch brauche.
Dass auch diesem Thema etwa im Vergleich mit Brand-, Schall- und Lärmschutzmaßnahmen wenig Stellenwert beigemessen werde, findet auch Johann Gerstmann, Sprecher des Bundesverbands Sonnenschutztechnik. Dabei wurde es mit dem vielfach geübten Homeoffice in der Pandemie sehr wichtig: Im Sommer sind die Rollos unten, um Hitze draußen zu lassen. Weil es dann aber oft zu dunkel ist im Raum, wird das Licht aufgedreht, was Energie frisst.
Dabei könnten bzw. sollten sogar zumindest 15 Prozent der Sonnenenergie ins Gebäude gelangen, sagt Gerstmann. Und er empfiehlt deshalb, den Sonnenschutz untertags nie ganz zu schließen. Am besten funktioniert das mit sogenannten Markisoletten, also knickbaren Markisen, die oben beschatten, unten aber Tageslicht durchlassen.
Maximal 31 Grad in Wiener Wohnraum
Bei der Frage, welche Temperatur in einem Aufenthaltsraum maximal erreicht werden darf, hat sich übrigens kürzlich etwas geändert. Bis 2019 war für Wien eine Maximaltemperatur von 27 Grad in der OIB-Richtlinie 6 vorgeschrieben. Ein Gebäude musste also so geplant werden, dass die Raumwärme an einem Referenztag stets unter diesem Grenzwert bleibt. Die Nachtlüftung durfte dabei berücksichtigt werden.
Seit 2019 gilt aber das sogenannte Standortklima, erklärt Gerstmann. Die neue OIB-Richtlinie 6, in der das geregelt ist, wurde mittlerweile in fast allen Bundesländern implementiert (nur Salzburg fehlt noch). "Da wurde nun vom Fixwert 27 Grad auf ein gleitendes Komfortmodell gewechselt"; der Maximalwert orientiert sich jetzt an der Außentemperatur.
Für Wien ergeben die Berechnungen nun maximal 30 bis 31 Grad, darunter ist man also noch "sommertauglich". Ein Gebäude darf sich jetzt aber eben auch ohne Nachtlüftung auf nicht mehr als 31 Grad aufheizen. "Es ist aber bekannt, dass bei hohen Raumtemperaturen die Leistungsfähigkeit sinkt."
Kühlräume in Wohnhäusern
Um das Maximum einhalten zu können, ist für Renate Hammer ein Sonnenschutz unabdingbar. "Außerdem müssen wir ambitioniert thermisch sanieren, das macht Sinn im Winter wie im Sommer." Und Hochtemperaturprozesse, also etwa Gasfeuerungen, müssen aus den Häusern gebracht werden. Was Fassadenbegrünungen betrifft, gebe es noch keine wirkliche Klarheit über die Wirksamkeit in Sachen Gebäudekühlung. "Da gibt es noch viel zu erforschen."
Eine andere – drastische – Maßnahme könnte aber auch bald nötig sein: kühle Aufenthaltsräume in Wohnhäusern, falls es zu heiß wird in den Wohnungen. "Ein barrierefrei zugänglicher Kühlraum irgendwo im Erdgeschoß, wo man Schutz vor der Hitze suchen kann." Aus anderen Erdteilen kennt man das ja leider bereits. Schreibt DER STANDARD.
Die Überdosis an zusammengeschusterten Katastrophenmeldungen im medialen Sommerloch sind keine Erfindung der durchdigitalisierten Neuzeit. Es gab sie schon immer. Selbst zu Zeiten, als Internet noch hinter den Sternen schlummerte und die Tageszeitungen auf einer Linotype-Setzmaschine im Bleisatz produziert wurden, was gar nicht so lange her ist.
In den 1950er Jahren wurde der Fotosatz entwickelt und verdrängte innert wenigen Jahren den Bleisatz. Am 31. Dezember 1976 wurde die Herstellung der Linotype-Setzmaschinen eingestellt. Der «Bleiletter» fand 500 Jahre nach seiner Erfindung durch Gutenberg das endgültige Ende.
Eines dieser Jahr für Jahr im Sommerloch auftretenden Themen sind überhitzte Wohnräume. Zugegeben: Mutet bei genauer Betrachtung etwas seltsam an, um nicht zu sagen schizophren.
Die gleiche Gesellschaft, die über die allerorts herrschende Hitze hierzulande gebetsmühlenartig jammert, lässt es sich nicht nehmen, mit dem erstbesten Billigflieger in Länder abzutauchen, die noch viel heisser sind als etwa die Schweiz.
Dass Flugzeuge weltweit laut «WWF Schweiz» global für rund sieben Prozent und in der Schweiz sogar für 27 Prozent des menschengemachten Klimawandels verantwortlich sind, kümmert niemanden. Nicht einmal die Mitglieder und Sympathisanten der «Fridays for Future»-Bewegung.
Wasser predigen an Demonstrationen und Wein trinken an den heissesten Stränden rund um den Erdball schliessen sich nicht aus. Eine der menschlichen, möglicherweise seit Adam und Eva genetisch verankerten Untugenden, die man auch Scheinheiligkeit nennen könnte.
Doch frei nach Hölderlin, leicht abgewandelt: «Wo die Wärme am grössten, ist ein kühlender Ratschlag nicht weit.»
Vor vielen Jahren sass ich mit Alois Grüter, dem CEO der IGD Grüter AG in Dagmersellen, schwitzend an einem heissen Sommertag während einer Besprechung in meinem Penthouse. Der Ventilator surrte auf der höchsten Stufe. Allerdings ohne spürbaren Erfolg.
Ich fragte den Immobilienexperten und gelernten Ingenieur, der mit seiner Firma über Jahrzehnte hinweg tausende von Immobilien in der Schweiz realisiert hat, ob er einen Tipp gegen die Hitze in meinem Penthouse habe.
Wie aus der Pistole geschossen antworte Alois Grüter: «Das ist sehr einfach. Frühmorgens die Fenster eine Stunde lang sperrangelweit öffnen, danach schliessen und die Storen oder Rolläden herunterlassen. Dabei beachten, dass die Schlitze bei den Rolläden geöffnet sind, damit es im Raum nicht zu dunkel wird und Du nicht das Licht einschalten musst, was ja auch wieder Wärme schafft und erst noch die Stromrechnung in die Höhe treibt.» Es sei erwähnt, dass damals mein Penthouse noch nicht mit LED-Beleuchtung ausgestattet war, sondern mit ganz normalen Birnen, die in der Tat Hitze abstrahlten.
Ich habe mich während der Sommerzeit seit mehr als einem Jahrzehnt an diesen Tipp von Alois Grüter gehalten. Und siehe da: Seither hatte ich nie mehr eine überhitzte Wohnung. Den Billig-Ventilator aus chinesischer Produktion konnte ich definitiv entsorgen. Xi Jinping möge mir das verzeihen.
Was sagt uns das? Schweizer Ingenieurs-Wissen toppt China-Grümpel.
-
23.2.2022 - Tag der schweizerischen Tabubrüche, die gar keine sind
Tabubruch nach Ukraine-Invasion: Schweiz importiert erstmals wieder russisches Gold
Nach monatelanger Flaute steigen die Goldimporte aus Russland in die Schweiz wieder sprunghaft an. Das sorgt weltweit für Aufsehen, ist die Schweiz doch der wichtigste Goldumschlagplatz der Welt. Es ist allerdings rätselhaft, wer das Gold importiert.
Braunkohle, Holz, ja gar Kaviar aus Russland sind in der Schweiz tabu: Die Güter sind sanktioniert, dürfen nicht mehr importiert werden. Nicht so beim Gold. Es ist von den Sanktionen bisher ausgenommen.
Dennoch ist der Handel mit russischem Gold über die Schweiz seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs praktisch zum Erliegen gekommen. Dies einerseits, weil die in London ansässige Vereinigung zum Handel mit Gold (London Bullion Market Association, LBMA) sechs ihrer Mitglieder, allesamt Gold- und Silber-Raffinerien aus Russland, nach Kriegsausbruch suspendiert hat.
Andererseits wurden russische Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen. Betroffen waren auch Finanzinstitute, die bisher den internationalen Goldhandel abgewickelt hatten. Ausserdem steht die russische Zentralbank – eine wichtige Playerin im Handel mit russischem Gold – auf der Sanktionsliste. Und zu guter Letzt gehen die Schweizer Goldraffinerien weiter als gesetzlich vorgeschrieben und legten den Import von russischem Gold vorsorglich auf Eis: zu hoch das Risiko eines Imageschadens.
Schweiz als Goldhändlerin Nummer 1
Nun scheint der Wind zu drehen: Die Schweiz hat im Mai erstmals seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder russisches Gold importiert. Konkret waren es 3,1 Tonnen im Wert von knapp 200 Millionen Franken. Das geht aus den Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) für den Mai hervor. Darüber berichtete zuerst das Wirtschaftsportal Bloomberg.
Zum Vergleich: Noch vor Kriegsausbruch im Januar 2022 importierte die Schweiz vier Tonnen russisches Gold. Dieser Wert wurde im Mai zwar nicht erreicht, die Branche scheint aber auf bestem Weg zu alter Grösse.
Auch wenn der Handel mit russischem Gold nicht sanktioniert ist, kommt der neuerliche Import einem Tabubruch gleich. Dass Bloomberg, Reuters und andere internationale Medien darüber berichten, ist dafür Beweis genug.
Die internationale Aufmerksamkeit kommt nicht von ungefähr: Die Schweiz gilt als international wichtigste Rohstoffdrehscheibe. Schätzungsweise 80 Prozent des weltweiten Goldhandels laufen über die Schreibtische und Computerbildschirme der hiesigen Trader.
Russland ist der zweitgrösste Goldproduzent weltweit. Für die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und Russland war Gold bis zum Ausbruch des Konflikts denn auch matchentscheidend: Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) machten Edelmetalle bis Kriegsausbruch 80 Prozent der russischen Importe in die Schweiz aus.
Importe sind selbst Experten ein Rätsel
Anders als etwa beim Öl überschreitet ein Grossteil des hierzulande gehandelten Goldes auch physisch die Schweizer Grenze: Die Schweiz ist nämlich nicht nur gross im Handel, sondern auch in der Verarbeitung von Gold. Vier der weltgrössten Goldraffinerien stehen in der Schweiz, drei davon im Tessin. Schätzungsweise zwei Drittel des weltweit geförderten Goldes werden in Schweizer Fabriken eingeschmolzen und weiterverarbeitet: zu Goldbarren, Schmuck, Uhren oder Teilen für die Industrie.
Werfen die Schweizer Goldraffinerien ihre Prinzipien also wenige Monate nach Kriegsausbruch über Bord und machen weiter wie zuvor? Nein. Das beteuert nicht nur die Branche selber. Sondern auch Marc Ummel (29), Rohstoffexperte bei der Nichtregierungsorganisation Swissaid, die den Goldhandel in der Schweiz mit Argusaugen beobachtet.
«Ich kann mir die neuen Importe wirklich nicht erklären», sagt Ummel etwas ratlos. Bei den aktuellen Importen handelt es sich um bereits raffiniertes Gold, nicht um Rohgold direkt aus der Mine. Wurde es vielleicht von einer kleinen Firma importiert, die nicht auf dem Radar der Goldexperten ist? «Möglich», so Ummel. «Aber besonders wahrscheinlich ist es nicht, schliesslich sprechen wir von drei Tonnen!»
Ummel hat beim Seco und beim BAZG nähere Angaben zu den Importen verlangt – bisher ohne Erfolg. Auf Anfrage von Blick teilen die Behörden mit, dass das russische Gold über Grossbritannien in die Schweiz gelangt sei. Wer es importierte, dürfe aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt werden. Sowohl Seco als auch BAZG betonen, dass der Goldimport aus Russland nicht sanktioniert sei.
Goldwäsche via Dubai
Allerdings ist sowieso fraglich, wie aussagekräftig die Importstatistik ist. Importeure müssen lediglich angeben, wo sie ihr Gold kaufen. Wo es ursprünglich geschürft wurde, ist dabei völlig unerheblich. «Eine grosse Gesetzeslücke», findet Ummel.
So nahmen diesen Frühling, nach Kriegsausbruch in der Ukraine, die Importe von Gold aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sprunghaft zu – obwohl es dort keine einzige Goldmine gibt. Die Vermutung von Swissaid: Russisches Gold gelangt nach Dubai und von dort in die ganze Welt. «Goldwäsche» nennt Swissaid das.
Vier der fünf Schweizer Raffinerien importieren kein Gold aus den VAE. Ausgerechnet Branchenführerin Valcambi allerdings scheint sich wenig um den möglichen Ursprung des Dubai-Goldes zu kümmern. Die Tessiner Raffinerie mit Sitz in Balerna unweit von Chiasso importiert laut Angaben von Swissaid Gold aus Dubai und beruft sich dabei darauf, dass man sich an die «geltenden Richtlinien und Sanktionen» halte.
Ob als Direktimport oder mit Zwischenhalt in Dubai: Der russische Präsident Wladimir Putin (69) dürfte sich über den fortdauernden Goldexport freuen – es zahlt in seine Kriegskasse ein. Schreibt Blick.
Wenn es um Gold geht, wirft die neutrale Schweiz alle Bedenken und Hemmungen über Bord. Und dies nicht erst seit heute.
Die Schweizer Banken war sich auch nicht zu schade, während des Zweiten Weltkriegs von Nazi-Deutschland das Zahngold der Juden aufzukaufen, die vom Hitler-Regime umgebracht wurden.
Nein, liebe Freunde von der SVP, das ist keine Verschwörungstheorie. Diese Tatsache wird selbst von der Schweizerischen Nationalbank bestätigt.
Sie sehen: Mit einem «Tabubruch» wie Blick schreibt haben die jetzigen Goldkäufe der Schweiz rein gar nichts zu tun. Egal, ob von Hitler, Putin oder sonstigen Unrechtsregimes: Die neutrale Schweiz kauft alles, was goldig glänzt.
Irgendwie auch verständlich. Wir sind ja schliesslich neutral. Länder, die neutral sind, dürfen so ziemlich alles. Lautet jedenfalls die Doktrin der SVP, die in der neuen Verfassung der Schweiz, besser bekannt als «Weltwoche», festgeschrieben und in Stein gemeisselt ist.
-
22.6.2002 - Tag von Putins wirklicher Krankheit, die alles andere als tödlich ist
Endlich für Sie wissenschaftlich und faktenbasiert in Wort und Bild geklärt, an welcher Krankheit der russische Präsident Vladimir Putin tatsächlich leidet, die alles anderes als tödlich ist. Den Sommerloch-Vermutungen von «Blick» und «20Minuten» zum Trotz!

-
21.6.2022 - Rag des Schweizer Kinosterbens
Auch ohne Corona-Massnahmen: Viele Schweizer Kinosäle sind weiterhin leer
Die Corona-Massnahmen sind längst aufgehoben, noch immer fehlen den Kinos aber die Besucherinnen und Besucher. Die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) von Januar bis Ende Mai 2022 zeigen, dass die Kinoeintritte immer noch deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit liegen. Und dies, obwohl es seit über vier Monaten keine coronabedingten Einschränkungen mehr gibt. Es ist eigentlich wieder wie vor Corona. Man kann gemütlich ins Kino, ausgerüstet mit Popcorn und Getränk. Zertifikat, Maske, Ess- und Trinkverbot: Alles passé. So voll wie vor Corona sind die Säle trotzdem selten.
Erdem Karademir vom Bundesamt für Statistik (BFS) bestätigt den Eindruck vieler Kinobesucherinnen und Kinobesucher. Im Vergleich zu 2019 würden die Kinos in diesem Jahr im Schnitt etwa ein Drittel weniger Eintritte generieren.
«Das ist zwar ein doppelt so gutes Ergebnis, wie wir im ersten Pandemie-Jahr hatten. Und es gibt auch eine leichte Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Aber der Rückstand zur Situation vor der Pandemie ist noch sehr gross», erläutert Karademir.
Immer weniger Kinos
Auch die Anzahl der aktiven Kinos gehe in der Schweiz immer weiter zurück. Aktuell zählt das BFS rund 10 bis 15 Kinos weniger als im Jahr 2019. «Gleichzeitig sieht man in unserer Erhebung auch, dass die Anzahl Kinosäle oder Leinwände konstant bleibt.» Das heisst eigentlich: Es gibt eine Verschiebung von den Einzelkinos hin zu mehr Kino-Komplexen.
Den Trend hin zu Multiplex-Kinos bestätigt auch Blue Cinema, der grösste Kinobetreiber in der Deutschschweiz. Auf Anfrage von SRF teilt der Kinobetreiber – der zur Swisscom gehört – mit, dass man im Herbst ein neues Multiplex-Kino mit neun Sälen in Chur eröffne. Der Kinobetreiber glaube weiter an Multiplex-Kinos und will sogar, wenn möglich, in Entertainment-Häuser investieren.
Ein solches Entertainment-Center gibt es bereits in Winterthur. Dort gibt es neben Kinofilmen auch eine Bowlingbahn, eine Bar sowie eine Game-Zone. Blue Cinema scheint also nicht mehr allein auf Kino zu setzen. Ob und wie stark aber die Kino-Eintritte beim Branchenleader eingebrochen sind, das will man nicht kommunizieren.
Wird sich die Branche je erholen?
Die Coronakrise habe die Bedürfnisse und das Verhalten der Menschen – zumindest vorübergehend – verändert, sagt Edna Epelbaum, Präsidentin des Schweizerischen Kinoverbands. «Wir brauchen in erster Linie sehr viel Geduld. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass, nur weil die Masken weg sind, die Krise ausgestanden ist.»
Die Jungen hätten sich abgewendet, meint Epelbaum. Es gebe eine jüngere Generation, die nach zwei Jahren Pandemie wieder vermehrt lieber nach draussen wollen würde. «Und wir haben eine ältere Generation, die immer noch nicht angstfrei von Zuhause weggeht», so Epelbaum. Schreibt SRF.
Das Kinosterben nun auch noch der Corona-Pandemie in die Schuhe zu schieben, ist schlicht und einfach falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Die Corona-Hilfsgelder des Bundes haben einigen dahinsiechenden Kinos sogar eine Gnadenfrist verschafft.
Der Prozess des schleichenden Wegsterbens der Schweizer Kinos begann viel früher. Bereits ab den späten 1950er Jahren kam es durch die zunehmende Verbreitung des Fernsehens zu einem Rückgang der Besucherzahlen und in der Folge zu einem Kinosterben. Vor allem die Dorfkinos wurden reihenweise geschlossen.
Überdimensionale High-Tech-Flachbildschirme in der eigenen Wohnung, Internet und Streamingdienste wie Netflix & Co. sind die heutigen Totengräber der noch verbliebenen Kinos. Übrig bleiben werden nur multifunktionale Entertainment-Paläste. Das Konzept des reinen Filmabspielens mit Popkorn-Geschmatze ist nicht mehr gesellschaftsfähig.
2021 betrug der durchschnittliche Preis für einen Kinoeintritt in der deutschen Schweiz 16.40 Schweizer Franken, während ein Netflix-Monats-Abo mit HD-Streaming für 16.90 CHF zu haben war. Seit 9. Januar ist der Netflix-Abo-Preis allerdings auf 18.90 CHF gestiegen. Macht den Braten aber auch nicht heisser. Strom steht uns ja schliesslich in Hülle und Fülle zur Verfügung.
Liebe Grüsse an «Fridays for Future»: Etwa 80 Prozent des Stromverbrauchs des Internets soll mittlerweile allein durch Video-Streaming verursacht werden. Sagt jedenfalls die ETH.
-
20.6.2022 - Tag der Luzerner Swimmingpools für Schweine
Artgerechtere Tierhaltung: Luzerner Schweine erhalten Auslauf und einen Pool
Tierwohl und Mastbetrieb: Geht das zusammen? Ja, findet eine Luzerner Stiftung und fördert Betriebe, die auf artgerechtere Tierhaltung umstellen.
Rund 430'000 Schweine gibt es im Kanton Luzern. Doch wenn man durch den Kanton fährt, sieht man nicht viel von ihnen. Denn sie sind häufig im Stall. Manche sogar ausschliesslich. Sie kommen nie an die frische Luft.
So zum Beispiel auch die bis zu 100 Schweine, die im Stall von Silvia Ineichen aufgezogen werden. Die Bäuerin betreibt den Hof Ober Ehrenbolgen im luzernischen Römerswil, leicht am Hang gelegen, mit herrlicher Aussicht auf den Baldeggersee.
Von der die Ferkel in ihrem Stall aber nichts haben. «Das ist ein klassischer QM-Stall.» Ein Ort also, wo die Tiere nach konventioneller Art gemästet werden. Silvia Ineichen aber will umstellen. Weg von den Boxen mit Betonboden, in denen ihre Schweine aufwachsen, hin zu einer artgerechteren Haltung: «Es war schon immer mein Wunsch, dass die Tiere raus können und sie mehr ihren natürlichen Trieben folgen können.»
Nun wird die Bäuerin ihren Wunsch erfüllen können – dank der Unterstützung der Albert-Koechlin-Stiftung AKS. Die Luzerner Stiftung, sonst eher bekannt für ihr Engagement in der Kultur, unterstützt auch Projekte zugunsten des Tierwohls. Das sei im Stiftungszweck so vorgesehen, erklärt Patrick Ambord von der AKS. Aus dem Bereich der Schweinezucht habe die Stiftung aber kaum Gesuche erhalten, weshalb sie extra dafür ein eigenes Projekt lancierte.
Fünf Pilotbetriebe sollen gefördert werden - möglichst unterschiedlicher Art, um möglichst breite Erfahrungen zu sammeln. «Es können grössere und kleinere Betriebe sein, aber auch Mast- und Zuchtbetriebe. Solche, die bereits bekannte Absatzkanäle beliefern, aber auch andere, die auf Direktvermarktung setzen.»
Dass Silvia Ineichens Hof den Zuschlag erhielt, hat damit zu tun, dass sie nicht einfach nur das Minimum realisieren wollte, das von einer Norm vorgeschrieben wäre. Ihr selber geht es auch nicht in erster Linie darum, ein Label zu erhalten, sondern um das Leben ihrer Tiere: «Es ist mein persönliches Empfinden, dass ich das verbessern möchte.»
Zusammen mit der Albert-Koechlin-Stiftung lotete Ineichen aus, was auf ihrem Hof möglich ist. Klar ist: ihre Schweine werden künftig ein anderes Leben haben. Nicht nur, dass sie aus dem Stall hinausgehen können. Draussen werden sie einen Pool haben und einen speziellen Wühlbereich. «Dieser wird etwa 40 Zentimeter tief, wo sie dann wie im Wald graben können», erklärt die Bäuerin ihre Pläne.
Der Umbau auf Ober Ehrenbolgen kann schon bald beginnen, die Baubewilligung ist erteilt. Aber auch wenn der neue Stall mit Umschwung dereinst steht, wartet noch ein anderer grosser Teil der Arbeit auf Silvia Ineichen. Denn der Verkauf von Fleisch aus tiergerechter Haltung ist nicht unbedingt einfacher.
Hoffnung auf höhere Preise
«Leider ist es ja so, dass der Verkauf von Labelfleisch aktuell eher rückläufig ist», sagt Ineichen. Deshalb müsse sie wohl mehr auf Direktvermarktung setzen. Sie hofft, dass sie so höhere Preise für ihre Tiere erzielen kann. Aber ganz abgesehen von der Wirtschaftlichkeit freut sie sich auf ihren künftigen «neuen» Hof: «Mir ist wohl, wenn es meinen Tieren auch wohl ist.» Schreibt SRF.
Vor zwei Monaten noch für eine ziemlich missratene «Sensibilisierungskampagne» der Stadt Luzern gegen Littering missbraucht, wird den wunderbaren Luzerner Schweinen endlich die Gerechtigkeit erwiesen, die ihnen gebührt.
Dass im Zusammenhang mit dieser Wohlfühlaktion «Glückliche Schweine» auch vor der Parteizentrale der Luzerner FDP ein Pool aufgestellt worden sei, entbehrt jeglichen Tatsachen. Es handelt sich bei diesem üblen Gerücht um eine Hitzesommer-Fake-News.
Das hätten die einzigartigen Schweine und künftigen Bio-Koteletten von Frau Ineichen nun wirklich nicht verdient, mit der Luzerner FDP in einen Pool geworfen zu werden.

-
19.6.2022 - Tag der Luzerner FDP und ihren Oligarchen
Amerikaner beschlagnahmen Superyacht von «Luzerner Oligarch»
Nach einer Odyssee über die Weltmeere ist die beschlagnahmte Superyacht eines Oligarchen unter US-Flagge in Hawaii eingelaufen. Der russische Besitzer des 106-Meter-Luxuskahns ist auch als «Luzerner Oligarch» bekannt.
Er wird auch der «Luzerner Oligarch» genannt: Suleiman Kerimow (56), laut dem Magazin «Forbes» zeitweise der reichste Russe mit einem Vermögen von 25 Milliarden Dollar. 2006 raste der gebürtige Dagestaner mit einem Ferrari mit Luzerner Kennzeichen in eine Palme in Nizza (F). Der Ferrari gehörte dem Luzerner Geschäftsmann Alexander Studhalter (53). Studhalter war auch Stiftungsratspräsident der Suleyman Kerimov Foundation, die seit 2007 in Luzern angesiedelt war und unter anderem Spenden des Oligarchen erhielt – für angeblich «gemeinnützige und wohltätige» Zwecke.
Der Oligarch mit den Verbindungen in die Zentralschweiz, der vor einigen Jahren mit fragwürdigen Immobiliendeals in die Schlagzeilen geriet, ist jetzt um eine Superyacht ärmer. Nach einer spektakulären Odyssee über die Weltmeere lag die 106-Meter-Yacht Amadea in Fidschi vor Anker – und wurde dort auf Drängen der US-Behörden beschlagnahmt.
Am Donnerstag lief der schwimmende Oligarchenpalast mit US-Flagge in Hawaii ein. Laut GPS-Trackingdaten liegt das Prunkschiff in Honolulu vor Anker.
Millionenteure Wartung
Wo sich Kerimow derzeit aufhält, ist unbekannt. Er wurde von den USA schon 2014 und 2018 mit Sanktionen belegt, wegen Russlands Vorgehen in Syrien und der Krim. Auch die EU sanktionierte den Multimilliardär. Seit Mitte März steht Kerimow wegen seiner engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) auch auf der Sanktionsliste der Schweiz.
Auch Putin scheint mittlerweile nicht bedingungslos glücklich über den Reichtum dieser Oligarchen. Statt sich um Russland zu kümmern, hätten einige ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Am Freitag sagte Putin an einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg: «Die Oligarchen stahlen das Geld und versteckten es im Ausland.»
Nun haben die USA für die Wartungskosten von Kerimows luxuriöser russischer Superyacht aufzukommen. Schätzungen zufolge belaufen sich diese auf rund 25 bis 30 Millionen Dollar jährlich. Wird die Amadea nicht instand gehalten, kann ihr Wert um rund einen Drittel sinken. Schreibt SonntagsBlick.
Dass der Luzerner Treuhänder und Pochettli*-Träger Alexander Studhalter überall seine manikürierten Fingerchen im Spiel hat, wo's ein «Gschmäckle» gibt wie die Süddeutschen zu sagen belieben, ist in der Leuchtenstadt kein Geheimnis. War es auch nie.
Denn schon beim Vater von Studhalter stiegen ab und zu aus der Studhalterschen «Finanzboutique» unangenehme Rauchschwaden Richtung Pilatus, um dann endgültig irgendwo in der Unendlichkeit des Weltalls zu verschwinden.
Die Studhalters sind ja nicht nur namhafte Unterstützer der Luzerner Parteienlandschaft, sondern geniessen auch deren grosszügige Hilfe, wenn's mal wieder irgendwo brennt. Mehr zu dieser illustren Luzerner Familie gibt es in einem Artikel von «In$ide Paradeplatz» zu lesen.
Luzern liebt nun mal Mogule und Oligarchen, egal woher sie kommen und welche lächerlichen «Stiftungen» zum Wohl der Steuerersparnis daraus entstehen. Wenn das gleiche wie in Luzern in einer, sagen wir mal ukrainischen oder italienischen Stadt abläuft, schreien wir sofort atemlos die Worte «Korruption» und «Mafia» aus uns heraus. Was sagt uns das? Wenn zwei das gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
Der ehemalige Besitzer vom Château Gütsch in Luzern, Alexander Lebedev, seines Zeichens russischer Oligarch, steht inzwischen ebenfalls – zumindest in Kanada – auf der Sanktionsliste russischer Oligarchen.
Seinem Nachfolger im Chateau Gütsch seit Sommer 2021, dem russischen Oligarchen Kirill Androsov, könnte demnächst ein ähnliches Schicksal wie Lebedev blühen.
Es ist allerdings anzunehmen, dass willfährige Leute wie der Luzerner FDP-Lokalpolitiker Damian Hunkeler dies zu verhindern wissen: Er sitzt seit 2020 erneut im Grossen Stadtrat der Stadt Luzern und seit 2011 im Luzerner Kantonsrat. Nebenbei ist Damian Hunkeler noch Verwaltungsrat der Château Gütsch AG.
Sie sehen, wenn in der Stadt am Fusse des Pilatus irgendwo ein «Gschmäckle» auftaucht, ist die Luzerner FDP meistens als mitprägende Duftessenz wahrnehmbar. Das ist seit Urzeiten so und wird auch immer so bleiben.
Die FDP Luzern hat ja nicht umsonst den höchsten Spendensupport aller Luzerner Parteien. Selbst ehemalige FDP-Bundesräte, wie beispielsweise Rudolf Friedrich, sollen ihr riesige Summen aus ihren Vermögen vermacht haben. Sagt jedenfalls die SVP Luzern.
* Der Begriff «Pochettli» (schweizerdeutsch) hat nichts mit dem allerwertesten Po zu tun, wie man vielleicht bei der Nennung des Namens Studhalter vermuten könnte. Das Einstecktuch (auch Kavalierstuch, Stecktuch) ist ein Kleidungs-Accessoire, welches so in die äussere Brusttasche des Sakkos gesteckt wird, dass es daraus hervorschaut. Dabei wird es in unterschiedlichen Techniken gefaltet und geformt. Der Begriff statt aus dem französischen Wort «pochette». Schreibt Wikipedia.
-
18.6.2022 - Tag der SP-Millionäre
Noch-Juso-Chefin präsentiert neue Initiative: Reiche Erben sollen die Hälfte abgeben!
Nach drei Jahren tritt Ronja Jansen von der Juso-Spitze zurück. Doch bevor sie geht, verrät sie, wie die Jungpartei Superreiche für die Klimakrise zahlen lassen will.
Am Sonntag ist Schluss für Ronja Jansen (27). Die Juso-Präsidentin tritt ab und überlässt die Führung der lautesten Jungpartei der Schweiz jemand Neuem. Doch die Delegierten wählen dieses Wochenende nicht nur eine neue Spitze, sondern geben auch den Startschuss für eine neue Initiative. Lange war unklar, was genau der nächste Juso-Streich ist. Im Abschiedsinterview mit Blick verrät Jansen, wen die Juso dieses Mal ins Visier nimmt.
Frau Jansen, nach drei Jahren treten Sie zurück von der Juso-Spitze. Haben Sie genug vom Klassenkampf?
Ronja Jansen: Ich wünschte, er wäre nicht mehr nötig. Aber so lange der Klassenkampf von oben weitergeführt wird, werde ich mich wehren.
Als Sie vor drei Jahren das Präsidium übernahmen, setzten Sie sich zum Ziel für eine feministischere und ökologischere Welt zu kämpfen. Mit Erfolg?
Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass die Welt plötzlich von solchen Krisen durchgeschüttelt wird. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben diese Kämpfe erschwert. Doch die Juso ist in den letzten Jahren nochmals stärker geworden. Wir haben etwa 1000 Mitglieder mehr als vor der Pandemie und sind mit rund 4700 Mitgliedern weiterhin die stärkste Jungpartei.
Was war Ihr grösster Erfolg?
Am meisten geblieben ist mir der Abstimmungskampf zu unserer 99-Prozent-Initiative. Für einen Sieg hat es leider nicht gereicht, aber es war ein Achtungserfolg.
Gerade einmal ein Drittel der Stimmenden sagte Ja. Sie sind grandios gescheitert.
Doch wir haben das Bewusstsein darüber gestärkt, wie ungerecht die Vermögen in der Schweiz verteilt sind. Das ist bitter nötig!
Nun steht schon länger ein neues Initiativprojekt in der Pipeline. Worum gehts konkret?
Wir lancieren unsere neue Initiative, mit der die Reichen für den Klimawandel zahlen sollen. Gestartet wird wohl im Herbst. An der Delegiertenversammlung vom Sonntag verabschieden wir der Initiativtext. Konkret verlangen wir, dass Erbschaften über 50 Millionen Franken zu 50 Prozent besteuert werden. Und die zusätzlichen Einnahmen sollen für den Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt werden.
Wie viele Personen wären davon betroffen?
Nur etwa 2000 Superreiche. Diese kleine Minderheit ist es, die massiv von der Ausbeutung unseres Planeten profitiert. Wenn wir die Klimakrise abwenden wollen, müssen wir die Macht der Superreichen beschränken. Die Klimakrise ist eine Ungleichheitskrise. Die Zerstörung unserer Zukunft wird von den Reichsten vorangetrieben, doch den Preis zahlen andere.
Wer reich ist, ist doch nicht automatisch ein Umweltzerstörer.
Geht es um den Klimaschutz, wird gern mit dem Finger auf Leute gezeigt, die im Winter Erdbeeren oder einen Kafi im Plastikbecher kaufen. Doch ihr individueller Einfluss ist klein im Vergleich zu denen, die am Hebel der Macht sitzen. Sie sind es, die entscheiden, ob nach Öl gebohrt wird oder nicht und was wie produziert wird.
Was ist mit grossen Familienunternehmen? Verunmöglicht die Juso mit der Initiative nicht, dass Unternehmen an die Nachkommen weitergegeben werden können?
Wir reden von Erbschaften über 50 Millionen, das betrifft keine KMU oder Geschwister, die ein Haus erben. Bei grossen Unternehmen sind Lösungen einfach umsetzbar. Möglich wäre beispielsweise, dass die Erbschaftssteuern über längere Zeit abbezahlt werden könnten.
2015 gab es bereits eine Erbschaftssteuer-Initiative, die wohlhabende Erben stärker besteuern wollte. Sie war absolut chancenlos.
Die Stärke unserer Initiative ist, dass absolut klar ist, wen sie betrifft und wen nicht. Die riesige Mehrheit profitiert von unserem Anliegen. Ausserdem hat sich die Situation seit damals noch einmal krass verschärft. Fast 100 Milliarden werden heute jährlich an Leute vererbt, die für das Geld nichts geleistet haben. Wir leben faktisch in einer neuen Adelsgesellschaft!
Sie sind schon mitten im Abstimmungskampf! Die Initiative ist wie alle Juso-Projekte radikal. Rechnen Sie sich ernsthafte Chancen aus?
Extrem ist, dass es überhaupt Vermögen über 50 Millionen gibt! Wir brauchen Geld gegen den Klimawandel, müssen wichtige Investitionen tätigen! Die Initiative schlägt eine super Lösung vor. Aber ich mache mir keine Illusionen. Die rechte Reichen-Lobby wird dagegen ankämpfen und mangels ernsthafter Argumente wieder die Anti-Juso-Keule schwingen.
Sie trifft die Keule nicht mehr. Was werden Sie künftig neben Ihrem Amt als Baselbieter Kantonsrätin tun? Noch den Bachelor in Soziologie und Wirtschaft abschliessen?
Ja, ich habe mich fürs nächste Semester eingeschrieben und will mich nun wieder aufs Studium konzentrieren. Aber zuerst gehe ich jetzt einmal einen Monat in die Ferien und mache mir Gedanken, was ich in Zukunft machen will.
Sie liebäugeln sicher mit dem Nationalrat. Nächstes Jahr sind Wahlen. Das würde ja perfekt passen.
Die nationale Politik interessiert mich natürlich. Aber ich weiss noch nicht, was meine Pläne sind. Fest steht: Ich bin noch lange nicht fertig mit der Politik! Schreibt Blick.
Nun, es ist eine alte Tatsache, 100, 200 oder mehr Prozent zu fordern, um letztendlich einen Bruchteil davon einstreichen zu können. Ein absolut legales Instrument, das auch vom Normalbürger eingesetzt wird. Wer kennt sie nicht, die preislich total überrissenen Inserate für Occasions-Schlitten auf Ricardo & Co.?
Die SP, die laut Blocher mehr Millionäre in ihren Reihen haben soll als die SVP, schiesst allerdings seit vielen Jahren nur noch übers Ziel hinaus und setzt damit ihre politischen Forderungen nicht selten der Lächerlichkeit aus. Dass damit an den Wahlurnen kein Blumentopf zu gewinnen ist, zeigen die Zahlen an den Abstimmungstagen.
Um die Superreichen zur Kasse zu beten, stehen in der Schweizer Verfassung festgeschriebene Instrumente zur Verfügung. Genannt «Steuern». Man müsste sie nur einhalten, was der interkantonale Steuerwettbewerb allerdings zu verhüten weiss. Nicht zuletzt with a little help from my friends, von der SP. Um einen Beatles-Song aus dem Jahr 1967 zu zitieren.
Auch die Jusos sollten sich irgendwann der Tatsache stellen, dass der Kommunismus krachend gescheitert ist, bevor sie ihre üblichen Enteignungs-Lachnummern verbreiten.
By the way: Herzliche Glückwünsche an Beatle Paul McCartney, der heute seinen 80. Geburtstag feiert.
-
17.6.2022 - Tag der Erdbeersträucher
Bill Gates: NFTs basieren auf der Idee, einen grösseren Trottel zu finden
Non-Fungible Tokens (NFTs) polarisieren bereits seit Monaten. Die Idee ist, dass hier unter anderem in der Kunst- und Gaming-Welt digitale Güter in Form von Tokens abgebildet und gehandelt werden können. Manche Menschen sehen dadurch einen neuen, digitalen Kunstmarkt entstehen, andere sind äußerst skeptisch. Zur zweiten Kategorie gehört Microsoft-Gründer Bill Gates.
Auf einem Event des US-Technologiemediums Techcrunch betonte Gates, dass er NFTs als eine Anlageform sehe, die zu 100 Prozent auf der "Greater Fool Theory" basiere – vereinfacht gesagt beschreibt diese Theorie, dass man ein Objekt in der Hoffnung kauft, einen größeren Trottel zu findet, der das Objekt später teurer abkauft.
Gates selbst ist im Feld der Krypto-Assets nicht involviert – er besitzt weder welche, noch hat er diese geshorted. Stattdessen investiert er lieber in physische Objekte oder in Unternehmen, die reale Produkte herstellen, sagt der Gründer des Softwarekonzerns.
Mit einem Schmunzeln merkt er auch an, dass "digitale Bilder von Affen wohl offensichtlich die Welt verbessern werden". Damit spielt er auf eines der bekanntesten Projekte der NFT-Welt, den Bored Ape Yacht Club (BAYC) an. Hierbei handelt es sich um Bilder von Comicaffen, die teils für sechsstellige Beträge den Besitzer wechselten. Zuletzt geriet das Projekt in die Schlagzeilen, weil es Opfer eines Hacks wurde.
Gates: Skeptisch gegenüber Kryptowährungen
Es ist nicht das erste Mal, dass Gates sich skeptisch gegenüber Kryptowährungen äußert. Schon im Frühjahr 2021 warnte er vor den Gefahren für kleine Investoren, wenn sie ihr Geld in solch volatile Investments wie Bitcoin stecken. Oft würden diese mit dem Versprechen auf große Gewinne dazu verleitet, unnötige Risiken einzugehen.
Anfangs schien es so, als wäre Gates zu Unrecht besorgt gewesen, denn noch im November des gleichen Jahres stieg der Wert eines Bitcoin auf das Allzeithoch von rund 63.000 Dollar. Mittlerweile ist der Kurs der weltweit größten Kryptowährung aber auf rund 20.000 Dollar abgestürzt, neben makroökonomischen Faktoren spielten hier auch diverse Skandale wie jener um Terra/Luna oder das Celsius Network eine Rolle. Und auch die von Gates kritisierten NFTs haben zuletzt massiv an Wert verloren. Schreibt DER STANDARD.
Bill Gates? Ist das nicht die Microsoft-Ikone, die laut Botschaft der «Trychler» und weiteren Kreisen aus der esoterischen Abteilung der SVP dafür gesorgt hat, dass uns mit der Corona-Impfung zugleich ein – vermutlich flüssiger – Chip in den Arm gespritzt wurde?
Und nun kommt ausgerechnet dieser Bill Gates mit der Weisheit der «Greater Fool Theory» hinter dem Ofenbänkli hervorgekrochen, die imZusammenhang mit Kryptowährungen und NFTs jedem einigermassen vernünftigen Menschen jenseits der vorgenannten Abteilungen der grössten Schweizer Partei längst bekannt war.
Tyrone Davis veröffentlichte 1973 einen Song mit dem Titel «What Goes Up Must Come Down», der in den internationalen Musik-Charts einschlug wie ein Blitz in den Erdbeerstrauch.
Noch Fragen zu Bill Gates, Kryptowährungen, NFTs, Corona-Impfung oder Erdbeersträuchern?
-
16.6.2022 - Tag der Fake-News um 5 Milliarden des Bundes an die Ukraine
Heute erzähle ich Ihnen, wie ich gestern live und wahrhaftig erlebte, wie Fake-News entstehen können.
Irgendwann um die Mittagszeit erhielt ich gestern eine WhatsApp-Nachricht: «Bund zahlt 5 Milliarden Franken Hilfsgeld an die Ukraine». So stehe es geschrieben auf SRF. Den Kommentar des Absenders zu dieser «Geldverschwendung des Bundes an die Ukraine» erspare ich Ihnen.
Ich nahm mir dann aber doch die Zeit, die WhatsApp-Mitteilung auf SRF schnell zu verifizieren. Fünf Milliarden Franken als «Hilfsgelder» sind ja tatsächlich auch für ein (noch) reiches Land wie die Schweiz eine enorm hohe, kaum vorstellbare Summe, die ohne Zustimmung des Parlaments wohl kaum gespendet werden könnte. Die Zeiten von freiem Schalten und Walten des Bundesrates aus der Corona-Pandemie sind ja (vorerst) vorbei. Festzuhalten gilt, dass auch die während der Corona-Pandemie eingegangenen finanziellen Verpflichtungen des Bundesrates nachträglich vom Parlament genehmigt werden mussten.
Ich fand denn auch die SRF-Meldung im Ukraine-Live-Ticker von SRF sehr schnell und siehe da: Tatsächlich! «Schweiz spendet weitere 5 Milliarden für Geflüchtete». Doch gleich unterhalb der News war auch die Twitter-Botschaft vom SEM (Staatssekretariats für Migration) aufgeführt mit der richtigen Summe des Spende-Betrags: 5 Millionen Schweizer Franken.
Die 5 Milliarden waren somit nichts anderes als ein auf den zweiten Blick klar ersichtlicher Schreibfehler in der News von SRF. Die Live-Ticker-Formate der Internetportale haben es nun mal an sich, vor Schreibfehlern nur so zu strotzen! Rechtschreibung und inhaltliche Korrektheit wird der Schnelligkeit und dem Clickbaiting geopfert.
News sind im Internet längst zur reinen Temposache verkommen. Viele User*innen lesen in der Hitze der medialen Überflutung häufig nur noch die meistens etwas aufgepeppte, um Aufmerksamkeit buhlende Titelzeile. Immerhin hat SRF die Titelzeile irgendwann im Verlaufe des Nachmittags auf den richtigen Betrag korrigiert, wie ich am Abend feststellen konnte (siehe Bild).
Das hat mein Kontakt auf WhatsApp nicht getan. Obschon ich ihn auf die Unstimmigkeit seiner WhatsApp-Message aufmerksam machte. Irgendwie verständlich: Das hätte ja sein Gesülze als reine Fake-News entlarvt. Manchmal, aber wirklich nur manchmal, frage ich mich schon, wie eigentlich intelligente Menschen, und um so einen handelt es sich bei diesem WhatsApp-Kontakt, plötzlich zu Vollpfosten mutieren und zu allem Übel auch noch stolz einen Trychler-Hosengürtel tragen.
Doch was lernen wir aus meiner heutigen Kolumne? Ganz einfach: Fake-News haben viel mit einer Artillerie-Kanone zu tun. Ist das Artilleriegeschoss erst mal abgefeuert, ist es nicht mehr aufzuhalten.

-
15.6.2022 - Tag der unendlichen Gier
Millionenbetrug vor Gericht: Pietro S. (38) verramschte jahrelang wertlose Aktien: Luxusleben auf Kosten von Kleinaktionären
Wer in seine Aktien investiert hat, hat alles verloren. Hinter den Anteilscheinen steckte nichts ausser zwei unrentable Tankstellen. Italiener Pietro S.* hat ein perfektes Lügengebäude aufgebaut. Dafür droht ihm jetzt Knast und Landesverweis.
Er trickste über vier Jahre lang Hunderte von kleinen Investoren in der Schweiz und in Deutschland aus und verramschte ihnen wertlose Aktien. Der Finanzjongleur Pietro S.* (38). Laut Anklageschrift hat der Italiener durch Täuschung Millionen von Franken für sein Luxusleben eingeheimst. Dafür muss er vor das Bezirksgericht Bülach ZH.
Gemäss der Anklage hat er unter anderem Aktien für eine Selbstbedienungs-Tankstellenkette angeboten, die dank tiefen Kosten das Benzin billiger anbieten und so «eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche» sei. In Wirklichkeit gehörten der Firma aber nur zwei Tankstellen, die nie Gewinn abwarfen.
Blick besuchte mehrere Kunden von Pietro S., die weit über 10'000 Franken verloren haben. Hätten sie den Betrug nicht rechtzeitig entlarven können, hätte man etwas besser nachgeforscht?
Perfekte Inszenierung
«Nein», sagt ein über 80-jähriger Rentner, der anonym bleiben will. «Es war alles perfekt inszeniert. Weil ich nicht am Telefon einen Deal abschliessen wollte, traf mich sogar ein Verkäufer im Restaurant. Er machte einen absolut seriösen Eindruck», sagt er zu Blick. Und weiter: «Ich verlor einen Teil meiner Pension. Jetzt muss ich wieder arbeiten.»
Der Verlust schmerzt
Offen über das Fehlinvestment spricht der Informations- und Kommunikationstechniker Patric Büeler (51). Er hat für über 20'000 Franken Aktien gekauft. Er erinnert sich: «Weil ich gelegentlich in kleine Start-ups investierte, bin ich in einer Datenbank. Darum riefen sie mich an. Die Dokumentation leuchtete ein, ich schöpfte keinen Verdacht. Erst als der Brief der Staatsanwaltschaft kam, erfuhr ich von dem Betrug. Ich wusste, es war Risikokapital, aber der Verlust schmerzt trotzdem.»
Finanzprofis unter den Opfern
Pietro S. baute ein Lügengebäude auf, das sogar von Finanzprofis nicht mit vernünftigem Aufwand durchschaut werden konnte. So bestimmte er den Kurs der Aktien selber und publizierte Zahlen über eine Finanzfirma. Die Banken übernahmen die Charts, ohne sie zu überprüfen. Die steigenden Kurse wiederum überzeugten so manchen skeptischen Anleger. Ein Prokurist einer grossen Bank fiel darauf rein, aber auch Mitglieder von Rechnungsprüfungskommissionen mehrerer Gemeinden. Sie alle glaubten, ein gutes Investment zu machen.
Raubtierstimmung im Callcenter
Für Pietro S. arbeiteten laut Anklageschrift zehn bestens ausgebildete Telefonverkäufer. Im Callcenter herrschte Raubtierstimmung, verdient wurde auf Provisionsbasis. Gewonnen hatte, wer das grösste Verkaufsvolumen generierte. Die Anklageschrift zitiert aus einem Leitfaden, was ein Verkäufer sagen soll: «Sie haben Glück, ich vertrete ein Unternehmen, das seit Jahren eine Erfolgsgeschichte vorweisen kann. Da ich auch hinter die Kulissen sehe, kann ich Ihnen das Angebot mit gutem Gewissen unterbreiten. Ja, Herr Muster, es wird Zeit, dass wir zusammen Geld verdienen.»
Gewonnen hat aber nur der Angeklagte. Von Februar 2016 bis Februar 2019 verdiente Pietro S. im Schnitt 10'067 Franken und 53'084 Euro pro Monat. Vom Reichtum ist aber nicht viel übrig: Ein paar Luxusuhren sowie ein paar unbedeutende Liegenschaften in Österreich und ein paar Zehntausend Franken verteilt auf mehrere Bankkonten. Dem gegenüber stehen bei den mindestens 350 Betrogenen Verluste über eine Million Franken und zehn Millionen Euro.
Der Prozess gegen Pietro S. findet im abgekürzten Verfahren statt. Die Staatsanwaltschaft fordert für gewerbsmässigen Betrug und mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung eine Freiheitsstrafe über viereinhalb Jahre und einen Landesverweis über sieben Jahre. * Name geändert. Schreibt Blick.
«Wer sich ins Geschirr von Leuten spannen lässt, die den Hals nicht voll bekommen können, darf sich nicht wundern, wenn er eines Tages verschluckt wird», sagte der deutsche Hobby-Philosoph, Aphoristiker, Satiriker und Buchautor Prof. Querulix (Pseudonym).
Genau das passierte den «Opfern» des italienischen Betrügers. Ihre Investition wurde im wahrsten Sinne von Prof. Querulix' Lebensweisheit verschluckt. Das Mitleid mit den Geschädigten hält sich allerdings in Grenzen.
Wer sich von unbedarften Callcenter-Boys wertlose Finanzprodukte andrehen lässt, muss vor lauter Gier, Vertrauensseligkeit und der Hoffnung, endlich den Stein der Weisen gefunden zu haben, blind sein.
Das gilt auch für die involvierten Banken, denen man allerdings ein gehöriges Mass an Dummheit – oder war es gar Pflichtverletzung? – nicht absprechen kann.
-
14.6.2022 - Tag der Neu-Millionäre
2021 gab es so viele Neu-Millionäre wie noch nie
Eine Million Dollar auf der Seite zu haben, ist ein Luxus, der den meisten das ganze Leben lang verwehrt bleibt. Letztes Jahr schafften den Sprung in den Klub der Millionärinnen und Millionäre so viele Leute wie noch nie.
Nach der Krise kommt der Geldrausch. Anlegerinnen und Anleger rund um den Globus haben im letzten Jahr von gestiegenen Aktienkursen und der Konjunkturerholung nach der Corona-Krise 2020 profitiert. Ihr Vermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent auf den Rekordwert von insgesamt 86 Billionen US-Dollar.
Zugleich wuchs die Zahl der Dollar-Millionäre, wie das Beratungsunternehmen Capgemini berechnete. «Unsere Prognose für 2022 ist allerdings deutlich verhaltener», sagte Capgemini-Experte Klaus-Georg Meyer mit Blick auf die Gesamtentwicklung.
22,5 Millionen Menschen besitzen mindestens eine Million US-Dollar
Zinserhöhungen der Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation belasten die Stimmung an den Aktienmärkten und drücken auf die Börsenkurse. Nach Schätzungen von Capgemini ist das Vermögen der Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, weltweit seit Ende vergangenen Jahres bis Ende April 2022 um etwa vier Prozent geschrumpft.
Im vergangenen Jahr aber wuchs der Klub der Dollar-Millionäre weltweit noch einmal deutlich um 7,8 Prozent auf 22,5 Millionen Mitglieder.
USA, Japan, Deutschland und China führen Liste an
An der Spitze der Länder mit den meisten Dollar-Millionären stehen die USA (7,46 Millionen), gefolgt von Japan (3,65 Millionen). Auf Platz drei liegt Deutschland mit 1,63 Millionen, China folgt auf Rang vier mit 1,54 Millionen vermögenden Privatleuten. Insgesamt konzentrieren sich 63,6 Prozent aller Dollar-Millionäre weltweit in diesen vier Ländern.
Das stärkste Wachstum wurde den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund um den Globus bei den Superreichen verzeichnet, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar verfügen. Das Gesamtvermögen wuchs um 8,1 Prozent. Die Zahl der Superreichen erhöhte sich um 9,6 Prozent auf etwa 220'000.
Zuletzt veröffentlichte Studien zu dem Thema kommen teilweise zu einem ähnlichen Ergebnis, auch wenn die Zahlen wegen Unterschieden in der Methodik nicht identisch sind. Capgemini berücksichtigt bei dem jährlich erstellten «World Wealth Report» Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld sowie Immobilien, sofern sie nicht selbst genutzt werden. Sammlungen oder Gebrauchsgüter zählen nicht dazu. Schreibt Blick.
Bevor Sie sich jetzt Hintersinnen und mitten im wunderschönen Hitzesommer Trübsal blasen: Zumindest einige der Neu-Millionäre sind es bereits nicht mehr. Die Inflation (USA Juni 2022 8,6 %, Deutschland Mai 2022 7,9 %) und teilweise dramatisch sinkende Börsenkurse – die Tech-Aktien derzeit in beinahe freiem Fall – lassen die virtuellen Geldvermögen schrumpfen wie den Schnee auf dem Pilatus an der Sommer-Sonne. Auch bei vielen Kryptowährung-Millionären herrscht derzeit Heulen und Zähneknirschen.
Putzig ist allerdings der Hinweis auf die chinesischen Neu-Millionäre. Xi Jinping und seine kommunistische Partei scheinen die Thesen von Lorenz von Stein, François Noël Babeuf, Karl Marx und Friedrich Engels zu ignorieren. Dafür hält sich die kommunistische Partei der Volksrepublik China an George Orwells «Animal Farm».
Besonders der Schweine-Eber «Hannibal» scheint es Xi Jinping angetan zu haben. «Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher.» Wie schnell chinesische Vermögen von Millionären und Milliardären in die Kassen der kommunistischen Partei wandern, kann Ihnen Alibaba-Gründer Jack Ma erklären. Diejenigen, die vom chinesischen Erdboden für immer auf unerklärliche Weise verschwunden sind, müssen allerdings schweigen. Tote reden nicht.
Geniessen Sie den Sommer 2022. Ich werde Ihnen demnächst einen «Place to be» vorstellen, wo die persönliche Zufriedenheit nicht von Ihrem Bankkonto abhängt.
1'000'000'000 ist auch nur eine Zahl.
-
13.6.2022 - Tag des Orakels am Fusse des Pilatus
Nato-Generalsekretär Stoltenberg ändert Rhetorik: «Wie viel Gebiet ist die Ukraine bereit, für den Frieden zu opfern?»
Die Ukraine müsse entscheiden, wie viel Territorium sie für den Frieden tauschen will. Das sagt Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Frieden habe seinen Preis. Dies, während es im Westen wachsende Signale für gewisse «Ukraine-Ermüdung» zu geben scheint.
Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (63) bekräftigte am Sonntag, dass der Krieg in der Ukraine lediglich am Verhandlungstisch beendet werden kann. Jedes Friedensabkommen fordere auch Kompromisse, so Stoltenberg. Auch in Bezug auf Territorium.
Stoltenberg äusserte sich bei den jährlichen Kultaranta-Gesprächen in Finnland. Auch der Westen sei bereit, für die Stärkung des ukrainischen Militärs «einen Preis zu zahlen», sagte der Vorsitzende des transatlantischen Verteidigungsbündnisses. Aber Kiew werde Moskau einige territoriale Zugeständnisse machen müssen, um den Konflikt zu beenden.
Frieden habe seinen Preis, sagte Stoltenberg: «Frieden ist möglich. Die Frage ist nur: Welchen Preis sind (die Ukrainer) bereit, für den Frieden zu zahlen? Wie viel Territorium, wie viel Unabhängigkeit, wie viel Souveränität sind sie bereit, für den Frieden zu opfern?»
Widersprüchliche Signale an Kiew
Stoltenberg legte keine konkreten Vorschläge der Nato vor, wie den Konflikt zu beenden. Es sei «Sache derjenigen, die den höchsten Preis zahlen, diese Entscheidung zu treffen». Die Nato und der Westen würden den Ukrainern weiterhin Waffen liefern, um «ihre Hand zu stärken», wenn schliesslich eine Lösung ausgehandelt werde.
Dabei erwähnte Stoltenberg auch Finnland, das Karelien im Rahmen eines Friedensabkommens während des Zweiten Weltkriegs an die Sowjetunion abtrat. Stoltenberg bezeichnete die finnisch-sowjetische Vereinbarung als «einen der Gründe, warum Finnland aus dem Zweiten Weltkrieg als unabhängige, souveräne Nation hervorgehen konnte».
Stoltenbergs Erklärung erfolgt in einer Zeit, in der die westliche Allianz mit Kiew nicht mehr so bedingungslos scheint wie zu Kriegsbeginn. Offiziell verlautet insbesondere aus US-amerikanischen und britischen Kreisen weiterhin, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. Mahner wie der französische Präsident Emmanuel Macron (44) warnen davor, Moskau in die Enge zu treiben.
«Ukraine-Ermüdung»
Schon der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (44) warf dem Westen unlängst «Kriegsermüdung» vor. Es gebe ausländische Kreise, die Kiew voreilig zu Friedensverhandlungen drängen würden.
Die einflussreiche internationale Medienplattform Open Democracy spricht von einer «Ukraine-Ermüdung». Die internationale Gemeinschaft sei den «Krieg Russlands gegen die Ukraine leid», so ein Leitartikel: «Für eine Welt, die bereit zu sein scheint, wieder voranzukommen, könnte sich der Widerstand der Ukraine langsam in eine Unannehmlichkeit verwandeln. Und Russland setzt darauf.» Schreibt Blick.
Tja, wie vom Orakel am Fusse des Pilatus vorausgesagt: Irgendwann liegt die «hehre westliche Wertegemeinschaft» Putin doch wieder zu Füssen. Und unsere Staatenlenker werden mit Erstaunen feststellen, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen sind um zu bleiben und nicht um in ihr völlig zerstörtes Heimatland zurückzukehren.
-
12.5.2022 - Tag der unappetitlichen Kolumnenschreiber
Frank A. Meyer – Täter und Komplizen
Roger Köppel, der schrillste Schreihals der Schweizer Politik, definierte die Neutralität kürzlich als «bedingungslose Gleichbehandlung aller Parteien». Mit dieser Festlegung versucht der SVP-Nationalrat, seinem derzeit vordringlichsten Anliegen zu dienen: Die Eidgenossenschaft müsse sich dem «Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland» verweigern.
In der Ukraine tragen also «zwei Parteien» eine Meinungsverschiedenheit aus. Und die Schweiz verweigert beiden Parteien jegliche Hilfe. Soweit Köppels dogmatische Auslegung der Neutralität.
Wie sieht die Wirklichkeit aus? Zerschossene Städte, gemordete Menschen, eine europäische Nation in ihrer Existenz bedroht: Die Ukraine wurde von Russland überfallen – die eine Partei versucht die andere Partei von der Landkarte zu tilgen.
Was bedeutet angesichts dieser Wirklichkeit das Dogma Neutralität? Bedeutet es «bedingungslose Gleichbehandlung» der russischen Aggression und der ukrainischen Selbstverteidigung?
Ist es «Gleichbehandlung», wenn der ums Überleben kämpfenden Ukraine deutsche Panzer verweigert werden, weil sie mit Munition schiessen, die in der Schweiz hergestellt wurde? Ist in diesem Kriegsfall neutrales Verhalten wirklich neutral?
Die Schweizer Neutralität ohne Bezug zur kriegerischen Realität verwandelt sich in fatale Benachteiligung der überfallenen Nation Ukraine – und in eine Vorzugsbehandlung für die russischen Invasoren, deren Ziel es ist, die Nation Ukraine auszulöschen.
Schweizer Munition für Panzer verbieten, die der ukrainischen Verteidigung dienen sollen, heisst: freies Schussfeld für die russischen Truppen.
Neutralität nach dieser Lesart bedeutet auf dem ukrainischen Schlachtfeld, dass die Schweiz sich auf die Seite der Russen schlägt!
Eine historische Spekulation sei gewagt: Was wäre gewesen, hätte sich die Schweiz nicht aus dem Weltkrieg 1939–45 heraushalten können, der faschistische Diktator Mussolini wäre ins Tessin einmarschiert, das er auf seiner Landkarte bereits als Teil Italiens vereinnahmt hatte, wie die Russen heute den Osten der Ukraine, und der Schweiz wären Waffen verweigert worden, wie die deutschen Gepard-Panzer heute der Ukraine verweigert werden?
Krieg ist kein Schachspiel. Im Krieg wird zerstört und getötet. Gleichbehandlung von Täter und Opfer kann für die Schweiz nur heissen: Solidarität mit dem Opfer.
Sonst wird Neutralität zur Komplizenschaft mit dem Täter. Schreibt Frank A. Meyer im SonntagsBlick.
Frank A. Meyer mimt wieder einmal den Moralapostel und arbeitet sich am «schrillen» Putin-Versteher Roger Köppel von der «Weltwoche» ab. Inhaltlich ist – je nach Sichtweise – an der heutigen Kolumne von Frank A. Geier, wie er zu seinen Zeiten als «graue Eminenz» von Michael Ringiers Gnaden an der Dufourstrasse in Zürich hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, nichts auszusetzen.
Ob Frank A. Meyer allerdings mit Blick auf den Ukrainekrieg der richtige Mann für moralingeschwängerte Predigten ist, darf hinterfragt werden. War es doch Meyers Super-Spezi und oberster Putin-Versteher alt-Kanzler Gerhard Schröder, der als gekaufter Vasall Putins für die heutige Gemengelage rund um den Ukrainekrieg und die vom derzeitigen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochene «Zeitenwende» zumindest mitverantwortlich ist.
Die Annexion der Krim 2014 durch Russland wurde von Schröder seinerzeit vehement verteidigt: Die ukrainische Halbinsel Krim sei «altes russisches Territorium», sagte der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder auf einer Wahlkampfveranstaltung der SPD.
Völkerrechtsbruch – die Annexion der Krim war einer – interessiert Schröder nur im Zusammenhang mit dem NATO-Krieg gegen ex-Jugoslawien, so wie es die Stimme des Herrn aus dem Kreml ebenfalls seit Jahren verkündet.
Intellektuell kann Frank A. Meyer in Bezug auf die hohe Intelligenz, den Sprachschatz und die rhetorische Begabung Köppel nicht das Wasser reichen. Eines aber eint sie: Beide hecheln gerne den Mächtigen dieser Welt hinterher. Der eine einem korrumpierten ex-Kanzler, der andere so ziemlich jedem, der sich auf der ultrarechten Seite der Gesellschaft bewegt. Unappetitlich sind sie beide.
-
11.6.2022 - Tag der dargebotenen russischen Hand
Putin vergleicht sich mit Peter dem Grossen und spielt auf weitere Ausdehnung Russlands an
Der Angriff auf die Ukraine sei eine Rückholaktion russischer Erde, findet der russische Präsident Wladimir Putin. So etwas habe schon Zar Peter der Große vor 300 Jahren tun müssen. Ein hochrangiger Bundeswehr-General sieht Deutschland derweil schon im Krieg – und nicht darauf vorbereitet.
Kremlchef Wladimir Putin hat den von ihm befohlenen Krieg gegen die Ukraine auf eine Ebene mit dem Großen Nordischen Krieg unter Russlands Zar Peter I. gestellt und von einer Rückholaktion russischer Erde gesprochen. Peter habe das Gebiet um die heutige Millionenstadt St. Petersburg nicht von den Schweden erobert, sondern zurückgewonnen. „Offenbar ist es auch unser Los: Zurückzuholen und zu stärken“, zog Putin laut der Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag Parallelen zum Krieg gegen die Ukraine. Eben jenes „Zurückholen und die Stärkung“ sei auch heute Aufgabe der Verantwortlichen in Russland. „Ja, es hat Zeiten in der Geschichte unseres Landes gegeben, in denen wir gezwungen waren, uns zurückzuziehen – aber nur, um unsere Stärke wiederzuerlangen und nach vorne zu gehen.“
Am 9. Juni ist der 350. Geburtstag von Peter dem Großen, der sich als erster russischer Zar den Titel Imperator gab und mit Eroberungen im Norden Russland einen Zugang zur Ostsee sicherte – als so genanntes „Fenster nach Europa“. Seit dieser Zeit habe sich fast nichts geändert, behauptete Putin nun in einem Gespräch mit Jungunternehmen im Vorfeld des Internationalen Petersburger Wirtschaftsforums. Auch damals habe kein europäischer Staat das Gebiet als russisch anerkannt. „Dabei haben dort seit Jahrhunderten neben den finno-ugrischen Stämmen auch Slawen gelebt“, sagte der Kremlchef.
Der Staatschef schloss offenbar in seinen Äußerungen auch eine weitere Ausweitung des russischen Gebiets nicht aus. „Es ist unmöglich – verstehen Sie? – unmöglich, einen Zaun um ein Land wie Russland zu bauen“, sagte Putin. „Und wir haben nicht vor, diesen Zaun zu bauen.“
Putin begründete den Krieg gegen die Ukraine einerseits mit der angeblichen Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung im Land. Andererseits verwehrte er aber auch der Ukraine das grundsätzliche Bestandsrecht und meldete Besitzansprüche auf große Teile des Landes an, die historisch gesehen russisches Herrschaftsgebiet gewesen seien.
Der hochrangige Bundeswehr-General Martin Schelleis warnt derweil vor ernsten militärischen Gefahren für Deutschland. „Wir werden akut bedroht und angegriffen“, sagte der Generalleutnant dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom Freitag. „Im Grunde haben wir schon einen Krieg: Krieg im Informationsraum, Cyberangriffe.“ Schelleis ist Inspekteur der Streitkräftebasis und Nationaler Territorialer Befehlshaber der Bundeswehr.
Als „realistische Szenarien“ nannte der Generalleutnant „punktuelle Angriffe auf kritische Infrastruktur, etwa durch Spezialkräfte, mit Drohnen oder Speed-Booten, zur Störung unserer Lebensgrundlagen unter anderem mit militärischen Mitteln“. Dafür seien „wir nicht gut aufgestellt“, warnte Schelleis. „Das muss man leider sagen.“
„Jetzt haben wir einen immensen Nachholbedarf“
Hinzu kommen nach Ansicht des Kommandeurs Bedrohungen wie ein möglicher Beschuss mit ballistischen Raketen, die Russland im Raum Kaliningrad stationiert hatte. „Sie wurden jetzt wegen des Ukraine-Kriegs abgezogen, werden aber sicherlich wieder dort hinkommen“, sagte er. „Diese Raketen könnten ohne Weiteres Berlin erreichen. So, wie Putin einzuschätzen ist, sind Erpressungsversuche gut vorstellbar.“
Der Befehlshaber der zweitgrößten Organisationseinheit der Bundeswehr mit Verantwortung für deren gesamte Logistik beklagte, dass der Bundestag die klar definierten Bedürfnisse zur Landes- und Bündnisverteidigung lange Zeit nicht ausreichend finanziert habe.
„Man hat einfach nicht ernsthaft geglaubt, dass die Bundeswehr je wieder in großem Stil gefordert sein könnte oder gar eingesetzt werden müsste“, sagte er. „Deshalb hat man Defizite in Kauf genommen. Jetzt haben wir einen immensen Nachholbedarf.“ Schreibt DIE WELT.
Der französische Soziologe und Antropologe Emmanuel Todd nennt in seinem Buch «Weltmacht USA. Ein Nachruf» drei Gründe, die in der Geschichte stets den Untergang von Imperien herbeiführten. Einer davon ist die «räumliche Überdehnung», der sicherlich auf die UdSSR (Sowjetunion) mit einer Landfläche von 22,3 Millionen km² zutraf, die unter unseren staunenden Augen in ihre Bestandteile zerfiel.
Eine Republik nach der anderen trat aus der Union aus. Übrig blieb als Nachfolgerin der UdSSR die Atommacht Russland (Russische Förderation), flächenmässig mit 17,1 Millionen km² noch immer das grösste Land der Welt.
Die Unabhängigkeitsbestrebungen innerhalb der UdSSR wurden übrigens vom Westen nicht gefördert, wie heute von vielen Geschichts-Revisionisten wie Köppel & Konsorten behauptet wird.
So wurden die Unabhängigkeitserklärungen der baltischen Republiken erst 1991 anerkannt, nachdem die Führung in Moskau (!) diese auch akzeptiert hatte.
Gorbatschow noch mehr zu schwächen widersprach 1989 den westlichen Interessen. Die Auflösung der staatlichen Ordnung der atomaren Weltmacht mit den nebst Russland atomar bewaffneten Staaten Ukraine, Weissrussland (Belarus) und Kasachstan bot eher Anlass zur Sorge bei den westlichen Staatenlenkern.
Es war übrigens die Schweiz, die als erstes westliches Land am 23. Dezember 1991 die Nachfolgestaaten der UdSSR anerkannte. Einen Tag vor der USA.
So viel «Geschichtsunterricht» jenseits der «Weltwoche» und dem Herrliberg muss schon sein, um Putins revisionistischen Gelüste, Ansprachen und seinen Schmerz über die verlorenen Gebiete einordnen zu können. Ihm täglich alle nur (er-)denkbaren Krankheiten anzudichten, darf ruhig weiterhin dem «Blick» überlassen werden. Gesundheitsprognosen von der Dufourstrasse sind allerdings seit jeher mit Vorsicht zu geniessen. Da wird schon mal auf der «Blick»-Frontseite ein Papst als tot erklärt, der im Vatikan noch immer munter das Evangelium vor sich hin betet.
In einem spannenden Video führt DIE WELT ein Gespräch mit dem deutschen Politikwissenschaftler und Experten für Geopolitik und Strategie Prof. Maximilian Terhalle. Oberstleutnant der Reserve der Bundeswehr Terhalle qualifiziert den Zaren-Vergleich Putins mit folgender Äusserung: «Mit dem Zaren-Vergleich hat Putin sich eine Falle gestellt.»
Terhallen nimmt auch Stellung (ab Minute 7.40) zu den unsäglichen Äusserungen des französischen Präsidenten Macron, der lauthals mit der Forderung wirbt, «Putin nicht zu demütigen». Man stelle sich vor, Churchill hätte davor gewarnt, den Kriegsverbrecher Hitler nicht zu demütigen und mit Samthandschuhen anzufassen. Er wäre vermutlich von der Mehrheit seines eigenen Volkes zum Teufel gejagt worden.
Terhallen wird denn auch deutlich. Macron suche eine Verhandlungsbasis auf Kosten der Ukraine. Er wundert sich über den «sonst so beschlagenen» Macron, was immer das auch heissen mag.
Vielleicht wäre die Frage interessant, wer hat Macrons Wahlkämpfe bezahlt? Dass französische Präsidenten in der Wahl ihrer Geldgeber nicht zimperlich sind, bewies Macrons Vorgänger Sarkozy, der sich laut Gaddafi-Sohn Saif al-Islam Gaddafi den Wahlkampf von seinem Vater Muammar Gaddafi finanzieren liess.
Im Interview mit euronews sagte Saif al-Islam Gaddafi wörtlich: «Sarkozy muss das Geld zurückzahlen, das wir ihm zur Finanzierung seines Wahlkampfes gegeben haben. Wir haben seinen Wahlkampf finanziert, wir haben detaillierte Belege dafür und sind bereit, alles preiszugeben. Das erste, was wir von diesem Clown wollen, ist also unser Geld. Wir haben es ihm gegeben, weil er dem libyschen Volk geholfen hat. Aber er hat uns enttäuscht. Gib uns das Geld zurück. Wir haben alle Details hier, die Bankkonten, die Überweisungsformulare und wir werden das alles bald veröffentlichen.»
Ja, Politk ist oft schmutzig. Sehr schmutzig sogar. Wer sich einen deutschen ex-Bundeskanzler kaufen kann, wird wohl auch an der Seine mit seiner dargebotenen Hand winken. Und dies nicht nur bei Madame Le Pen, die von einer russischen Bank mit einem Millionenkredit «gefördert» wurde.
Sarkozy wurde übrigens 2021 wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt. Das Gaddafi-Sponsoring konnte ihm nicht bewiesen werden. Krähen, die der andern Krähe kein Auge aushacken, gibt es anscheinend auch in Frankreich zu Hauf.
-
10.6.2022 - Tag des ganzjährigen Sommerlochs
«Ich heiratete mit 17 einen zehn Jahre älteren Mann»
Filipova (34) heiratete mit 17. In der Schweiz ist es verboten, vor 18 zu heiraten. Darum reiste Filipova ins Ausland. Nach fünf Jahren liess sie sich scheiden. Ein Prozess, der sie viel Kraft kostete. Schreibt 20Minuten unter der Rubrik «Mini Gschicht» und liefert dazu ein entsprechendes Video.
Ältere Semester werden sich noch an die medialen Sommerlöcher aus der Zeit erinnern, als es noch kein Internet gab. Jahr für Jahr wurde irgendwann im Sommer die immergleiche Geschichte publiziert.
Eine verdrossene Ehefrau schnitt ihrem Göttergatten das beste Stück ab. Mal mit einer Schere, mal mit dem Hackbeil. Aber stets in – damals noch exotischen – Ländern wie Mexiko und Suriname oder gar im Dschungel von Guyana.
Die Geschichte blieb immer die gleiche: Schnipp schnapp, Schnäbi ab. Nur die nicht verifizierbare und meistens nicht existierende Ortschaft wechselte von Sommer zu Sommer.
Sie sehen: Fake-News sind keine Erfindung des Internetzeitalters. Die gab es schon immer. Wenn auch nicht in dieser geballten Ladung wie heute.
Doch das mediale Sommerloch hat sich gewaltig geändert: Es findet nämlich das ganze Jahr lang statt. Von Januar bis Dezember. Und zwar querbeet und ohne Ausnahme durch alle Medien. Mit dem Klimawandel hat diese Ausdehnung auf 12 Monate für einmal nichts zu tun. Mit der menschlichen Dummheit dafür umso mehr.
Geändert haben sich auch die Protagonisten der täglichen Schmonzetten, die ausnahmslos mit einem Aufmacher auf der Frontseite das Publikum zwecks Clickbaiting locken sollen. Waren die obskuren Scherenfrauen früher frei erfunden, gibt es heute genügend Gestörte, die ihren banalen Unsinn nur zu gern der Öffentlichkeit in Wort, Bild und Ton mit Botoxlippen und geschwellten Implantat-Brüsten präsentieren. Der Schwachsinn feiert Hochkonjunktur. Style verdrängt die natürliche Ästhetik.
Nun denn, niemand wird von 20Minuten mit vorgehaltener Pistole gezwungen, Bullshit zu konsumieren. Ärgerlich sind aber die Tatsachen, dass solche Medien bisher auch noch vom Bund finanziell unterstützt wurden und die gedruckten Exemplare von 20Minuten nur noch reine Papierverschwendung darstellen. Liegen sie doch inzwischen wie Blei in den 20Minuten-Kästen.
Gedruckte Gratiszeitungen sind ein Anachronismus, den niemand mehr braucht und der die Umwelt nur zusätzlich belastet. Schade um jedes Blatt des inzwischen massiv teurer gewordenen Papiers. Schade um jeden einzelnen Baum, der dafür gefällt werden muss.
Die TikTok-Gesellschaft, bei deren Online-Portal 20Minuten eigener Angaben zufolge als News-Format führend sein will, braucht bewegte Formate wie Videos und keine Zeitungen. Lesen gehört bei dieser Spezies ohnehin nicht zur Lieblingsbeschäftigung. Der Konsum von nebensächlichen, um nicht zu sagen peinlichen und idiotischen Videos auf der chinesischen (!) TikTok-Grümpel-Plattform hingegen schon.
-
9.6.2022 - Tag der russischen Arschlöcher, Schwuchteln und Scheisshäuser
«Du A****loch»: Putin geht auf seinen Aussenminister Lawrow los
«Arschloch» und «Schwuchtel». In einer Videoschalte soll Russlands Präsident Wladimir Putin (69) seinen Aussenminister massiv angegangen haben. Der Ton in der russischen Elite verschärft sich massiv.
Die Nerven in der russischen Regierung liegen offenbar blank. Nun soll Präsident Wladimir Putin (69) seinen Aussenminister Sergei Lawrow (72) in einer Videokonferenz aufs Übelste beleidigt und angegangen haben. Das berichtet der Telegram-Kanal «General SVR», der von einem Kreml-Insider betrieben werden soll.
Gemäss dem Bericht soll sich Putin mit Lawrow in einer Videoschaltung getroffen und über die Beziehungen mit China diskutiert haben. Putin soll sich dabei frustriert gezeigt haben, dass sich China weigert, Russland angesichts der Sanktionen des Westens «finanziell und materiell zu unterstützen».
«Abfällige und obszöne» Äusserungen
Obwohl sich die beiden Länder vor dem Krieg eine «Freundschaft ohne Grenzen» zusicherten, zeigte sich China seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eher zurückhaltend. Die chinesische Staatsführung verurteilt den Krieg zwar nicht, hilft dem Kreml aber auch nicht aktiv, die Sanktionen des Westens zu umgehen. Mehrere Gespräche in diese Richtung scheiterten. Gemäss Experten fürchtet sich China davor, selbst mit Sanktionen belegt und beispielsweise vom Zugang zu westlicher Technologie abgeschnitten zu werden.
Im Laufe der Schaltung habe sich Putin «mehrmals abfällig und obszön» über den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping (68) geäussert, heisst es in dem Telegram-Eintrag weiter. Nach dem Frust über China habe sich Putin auch direkt an Lawrow gewandt und diesen für das Scheitern der Gespräche mit China verantwortlich gemacht.
Auch Medwedew verschärft seinen Ton
Gemäss dem Bericht habe Putin Lawrow mehrmals unterbrochen, als dieser versucht haben soll, sich zu verteidigen. Schliesslich habe er Lawrow als «Arschloch» und «Schwuchtel» bezeichnet. Gemäss dem Kreml-Insider beleidigt Putin seine direkten Untergebenen immer wieder – allerdings gelangen diese Äusserungen selten an die Öffentlichkeit.
Allgemein scheinen die russischen Politiker ihren Ton in den vergangenen Tagen massiv zu verschärfen. Auch der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew (56) hat sich in einer wutentbrannten Botschaft gegen angebliche Russland-Feinde gerichtet. «Ich hasse sie. Es sind Bastarde und verkommene Menschen», schrieb Medwedew am Dienstag in einer Botschaft auf dem Online-Dienst Telegram. Er werde «alles dafür tun, dass sie verschwinden».
Medwedew schrieb, diese Menschen wollten «den Tod für uns, für Russland». Wen genau er mit seinem Post meinte, sagte Medwedew nicht. Schreibt Blick.
Immer wieder amüsant, wenn ein Arschloch ein anderes Arschloch als Anus bezeichnet, um es etwas vornehmer auszudrücken. Der Wahrheitsgehalt dieser im Konjunktiv veröffentlichten Putinschen Äusserung liegt allerdings bei Null, lässt sich nicht verifizieren und ist vermutlich dem Sommerloch geschuldet, das sich inzwischen nicht nur beim Boulevardblatt Blick über das ganze Jahr erstreckt.
Was aber für einmal definitiv nicht mit dem Klimawandel zusammenhängt.
Zuzumuten wäre es Putin allerdings, dass er seinen Aussenminister als «Arschloch» oder «Schwuchtel» bezeichnet. Die Ganovensprache des russischen Imperators beinhaltet in der Tat immer wieder Wortschöpfungen aus dem Fäkalienbereich.
So verkündete er beim Tschetschenienkrieg an einer Pressekonferenz nachweislich: «Wir werden die Terroristen überall hin verfolgen. Notfalls machen wir sie auch auf dem Scheisshaus kalt. Sonst noch Fragen?».
Ob die Übersetzung aus dem Russischen in die deutsche Sprache korrekt ist, bleibt offen. Das Zitat wird unterschiedlich interpretiert.
Ist auch nicht so wichtig. Ob Scheisshaus oder Klo kommt ja aufs Gleiche raus. Diktatoren und Populisten haben sich schon immer der Vulgärsprache bedient, um beim Volk den starken Mann zu markieren.
Was eigentlich mehr über deren Follower aussagt als über die Sprachgewalt von Diktatoren und Populisten.
-
8.6.2022 - Tag der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel
Drei Punkte, die das Merkel-Interview so bemerkenswert machen
Nach sechs Monaten Funkstille hat Angela Merkel sich zum ersten Mal öffentlich Fragen zu ihrer Russland-Politik gestellt. Das Interview war gleich aus mehreren Gründen bemerkenswert.
Drei Dinge haben mich beeindruckt an Angela Merkels erstem großen öffentlichen Auftritt, dem Interview mit ihrem doch arg berlinernden, wie sie aus dem Osten stammenden Romanautor und Reporter Alexander Osang.
1. Merkel findet zu großen Sätzen zurück
Erstens: Die großen Sätze, zu denen Merkel nach den ganzen, diplomatisch wohl gebotenen, Abschleifungen in ihrem Staatsamt nach 16 Jahren jetzt wieder findet. Einer kommt besonders schlicht daher und hat doch ein großes Rumms-Potential. Er lautet: „Ich habe nicht daran geglaubt, dass Putin durch Handel gewandelt wird.“ Ein anderer Staatsmann aus der Luxusklasse hat daran doch geglaubt und sich dann für seine Russland-Irrtümer entschuldigt: Der Bundespräsident. Die Bundeskanzlerin glaubt, sich für rein gar nichts entschuldigen zu müssen. Auch nicht dafür, die frühe Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato verhindert zu haben.
Denn das ist jetzt eine große Erzählung, die gerade aufgebaut wird. Vom ukrainischen Botschafter in Berlin etwa, Andrij Melnyk, der dem Spiegel-Journalisten eine entsprechende Frage in dessen Block diktierte. Nämlich die, ob Merkel mit dem Nein zur Nato-Mitgliedschaft der Ukraine im Jahr 2008 Putins Überfall 13 Jahre später nicht erst möglich gemacht habe. Merkel sieht es umgekehrt: Wäre die Nato vor gut zehn Jahren bereit gewesen, eine demokratisch nicht gefestigte Ukraine, nach Merkels Worten in der Hand von Oligarchen, aufzunehmen, hätte Putin sie wohl schon damals massiv bedrängt, vielleicht überfallen. Merkel sagt das hier nicht wörtlich, aber anders kann man es gar nicht verstehen.
Merkel verteidigt ihre Weichenstellungen faktenstark, selbstbewusst und souverän
Weil es hier aber um eine bedeutsame Weichenstellung geht, die aus der Vergangenheit noch weit in die Zukunft hinein reicht, und die über Deutschlands Rolle und Ruf in der westlichen Welt mitentscheiden dürfte, wird darüber noch einmal zu reden sein. Merkel jedenfalls verteidigt ihre Weichenstellungen faktenstark, selbstbewusst, staatsmännisch und souverän. Und hier ein anderer großer Satz Merkels, groß, weil mutig just in dieser Zeit: „Russland ist ein faszinierendes Land.“ Und: „Die Tragik wird größer dadurch, dass ich dieses Land mag.“
Merkel beansprucht nach wie vor für sich, die russische Kultur großartig zu finden, erinnert sich an ihre Schul-Lektüren, Bulgakow etwa. Aber die Opern-Diva Netrebko zum Essen einladen: „Nein.“ Und sie findet es müsse möglich sein, Gorbatschow auch heute noch für die deutsche Einheit dankbar zu sein. Ein Russe dürfe nicht verurteilt werden, weil er ein Russe sei. Bei der Beurteilung von Menschen komme es auf jeden Einzelfall an – nicht auf das System, das der Einzelfall Putin installiert habe.
2. Merkels Humor ist zurückgekehrt
Zweitens: Merkels Humor, der nach einem halben Jahr Politik-Pause nun so augenscheinlich zurückehrt. Und ihre Fähigkeit, das Anekdotische mit dem Politischen zu verbinden. „Ich habe mich schon gewundert, dass Sie eine Stunde lang geredet haben“, sagt Merkel zu ihrem Interviewer. Als der sie einmal traf, bat sie ihn, über dessen Zeit in Amerika zu berichten. Was der so lange tat, dass ihm für Fragen keine Zeit mehr blieb. Journalisten können sehr selbstverliebt sein, was Merkel mit ihrem Satz auf einen feinen Punkt bringt, ohne dabei auch nur eine Sekunde lang verletzlich zu sein.
Osang will dann wissen, wie das mit dieser berühmt gewordenen Hunde-Szene bei Putin war, diesem Einschüchterungsversuch, für den es ein wohl einmaliges Foto gibt. Und Merkel erzählt, und zwar von ihrem allerersten Besuch bei Putin, da war sie noch nicht lange im Bundeskanzleramt. Gleich zu Beginn habe Putin, der gelernte Geheimdienstler, nach ihrem gestörten Verhältnis zu Hunden gefragt. Merkel wurde in ihrer Jugend gebissen und hat seitdem vor Hunden Angst. Putin schenkte ihr, so Merkel, einen „riesengroßen“ Stoffhund. Das war, wie gesagt, noch vor der Begegnung mit Putins echtem Labrador. Die nötig ihr dann einen selbstironischen Satz ab: „Eine tapfere Bundeskanzlerin muss mit so einem Hund fertig werden.“
3. Wie Merkel über ihr Selbstverständnis als Ex-Kanzlerin nachdenkt
Drittens: Die Offenheit und Ernsthaftigkeit, mit der Merkel über ihr Selbstverständnis als Bundeskanzlerin a.D. nachdenkt. „Ich muss ja noch vorsichtiger sein als früher.“ Weil auch eine Ex-Bundeskanzlerin noch unter Beobachtung steht, was ihre Freiheit einschränkt. Jedenfalls denkt Merkel so. Anders als Schröder, der seine persönliche Freiheit durch sein früheres Staatsamt nicht einschränken lässt.
Für Merkel gibt es eine institutionell erwachsende Pflicht, die über ihre Amtszeit weit hinausreicht, womöglich bis ans Lebensende. Sie ist auch der Meinung, auch heute noch Gutes für das Land tun zu sollen. Und stünde bereit, wenn sie angerufen wird, was mit einer Ausnahme (Olaf Scholz) aber noch nicht geschehen ist. Womit sie aber nun ausdrücklich auch nicht sagen wolle, dass sie auf einen solchen Anruf warte.
Mit der Definition ihrer neuen Rolle ist Merkel noch nicht fertig, sie sagt es auch: „Ich suche noch nach meinem Weg.“ Fest steht aber jetzt schon, dass sie es „fatal“ findet, für immer schweigen zu sollen; ebenso, wie sich in der heimischen Uckermark einzuschließen. Dies nur, weil Botschafter Melnyk ihr, als sie in Italien urlaubte, via Twitter zurief, sie möge besser nach Butscha fahren als in die italienische Sonne.
Zum Schluss ärgert sich Merkel über die Amerikaner
Die aktuelle Politik will Merkel nicht kommentieren, was nicht bedeutet, nur noch diplomatisch zu sein. An zwei Punkten macht Merkel klar, was das heißt: Weil nun Sozialdemokraten klagen, wie sehr doch Christdemokraten unter der Verantwortung Merkels die Bundeswehr heruntergewirtschaftet hätten, erinnert sie die SPD daran, dass sie sich über Jahre hinweg weigerte, bewaffnete Drohnen einzusetzen.
Merkel enthüllt schließlich, wie sehr sie sich über die Amerikaner geärgert habe, wegen der Sanktionen gegen Deutschland über die Nordstream-Pipeline: „Das kann man mit dem Iran machen, aber doch nicht mit uns.“ Ein Satz, der ihr im Amt nie über die Lippen gerutscht wäre. Aber auch einer, der Erwartungen aufkommen lässt an ihre Erinnerungen, die sie gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Brigitte Baumann aufschreiben will. Vielleicht sollte sie sich, zum Schutz vor einem Absinken in die alten Teflon-Unsitten, doch besser interviewen lassen, als zu versuchen, alles selbst aufzuschreiben. Schreibt FOCUS-Online-Korrespondent Ulrich Reitz in FOCUS.
Was immer man über Frau Merkel denken mag: Warum sollte sie sich für ihr politisches Tun und Handeln entschuldigen? Sie tat es nicht 2015 nach der Flüchtlingsschwemme und sie tut es auch jetzt nicht mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Diese Selbstkasteiung von ihr zu erwarten oder gar zu verlangen, ist lächerlich.
Noch ist Deutschland kein «failed state», wie von vielen behauptet, sondern eine Demokratie. Merkel wurde demokratisch 16 Jahre lang vom Volk beziehungsweise von ihrer Partei, der CDU/CSU, sowie deren Koalitionspartnerparteien FDP und SPD, als Kanzlerin der Bundesrepublik gewählt.
Sie hätte jederzeit an den Wahlurnen oder durch einen Misstrauensantrag durch das Parlament abgewählt werden können. Auch wenn viele Abgeordnete aus ihrer Partei und den wechselnden Koalitionsparteien FDP und SPD– explizit nach 2015– die Faust im Hosensack ballten, war ihnen der Platz am einträglichen Futtertrog im Deutschen Bundestag wichtiger als hehre Überzeugungen. Das sagt mehr aus über die Abgeordneten des Deutschen Bundestags als über Angela Merkel.
Der Fisch stinkt eben nicht immer vom Kopf her, wie uns eine Redensart weismachen will.
PS: Merkels erster grosser Auftritt nach ihrer Kanzlerschaft: Sehen Sie hier das komplette Gespräch
-
7.6.2022 - Tag der Kampfhunde und der Wiener Nacktbar
Staatsanwältin fordert für Dragica B. 24 Monate bedingt und Landesverweis: Rottweiler Slobo beisst Rentnerin halb tot – Halterin haut ab
Von hinten springt Rottweiler Slobo die Rentnerin Miriam Z. (77) im Oktober 2019 an – die Frau überlebt nur mit Glück. Statt zu helfen, ergreift die Halterin nach der Attacke mit ihrem Hund die Flucht. Ab Dienstag stehen sie und ihr Mann deshalb vor Gericht.
Die zierliche Rentnerin Miriam Z.* (77) spaziert in Horgen ZH in Richtung Zürichsee, als ihr Dragica B.* (34) mit ihrem Rottweiler Slobo an der Leine, aber ohne Maulkorb, entgegenkommt. Die Seniorin ist bereits ein paar Schritte vom Hund entfernt, als dieser ihr plötzlich in den Rücken springt. Miriam Z. stürzt zu Boden, beim Aufprall verliert sie das Bewusstsein. Der Rottweiler beisst auf sein Opfer ein.
Irgendwann lässt das Tier von der Frau ab. Statt zu helfen, flüchtet die Halterin mit ihrem Hund. Dafür müssen sie und ihr Mann Radan B.* (35), der Besitzer des Hundes, sich ab Dienstag vor dem Bezirksgericht Horgen ZH verantworten.
Freiheitsstrafe und Landesverweis
Die Staatsanwältin fordert für Dragica B. wegen schwerer Körperverletzung und Unterlassung der Nothilfe eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten und einen Landesverweis von sieben Jahren. Radan B. steht wegen schwerer vorsätzlicher Körperverletzung sowie Tierquälerei vor Gericht. Ihm droht eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten.
Dass Miriam Z. die Attacke am 14. Oktober 2019 überlebt hat, war reines Glück. Laut Anklage erlitt die Rentnerin zahlreiche schwere Bissverletzungen. Im Gesicht beim rechten Jochbein und am linken Ohr, am Rücken links der Wirbelsäule, an den linken und rechten Ober- und Unterarmen und am Nacken. Dazu kommen viele oberflächliche Verletzungen an den Beinen.
Mehrere Bisse lagen in der Nähe von wichtigen Blutgefässen am Hals. Noch zweieinhalb Jahre nach der Attacke leidet die Rentnerin an Todesangst, wenn sie die Wohnung verlässt oder frei laufenden Hunden begegnet. In Folge des Sturzes hat sie wegen einer Hirnblutung noch heute starke Kopfschmerzen.
Anwohnerin rettet das schwer verletzte Opfer
Der härteste Vorwurf gegen Dragica B. ist ihr Verhalten nach der Attacke. Statt der verletzten Rentnerin zu helfen oder eine Notrufnummer zu wählen, packt sie laut Anklage den Hund und geht unverzüglich nach Hause. Die verletzte Rentnerin lässt sie am Boden liegen.
Gerettet wird die schwer verletzte Frau von einer Anwohnerin, mit der das Opfer noch heute Kontakt hat. Vor dem Prozess spricht Miriam Z. auf Anweisung ihrer Anwältin nicht über die Attacke und die Rettung. Auch der Hundebesitzer und seine Frau haben auf Anfragen von Blick nicht geantwortet. Was genau nach dem Vorfall passiert ist und ob der Rottweiler eingeschläfert wurde, ist der Anklageschrift nicht zu entnehmen.
Nicht die erste Attacke
Sicher aber ist, dass mit Slobo vieles falsch gelaufen ist. Laut Anklageschrift hat der Hund schon vor der Attacke in Horgen Menschen angegriffen und gebissen. Neben dem Besitzerehepaar traf es auch eine Freundin der Familie und eine Pflegerin im Tierheim. Ein weiterer Angriff fand fünf Monate vor dem Angriff auf Miriam Z. statt. Slobo attackierte auf dem Horgenberg einen Hund. Die Besitzerin wurde zu Boden gerissen und Slobo schnappte nach ihr. Nur, weil er einen Maulkorb trug, kam es nicht zu schlimmeren Verletzungen.
Ein paar Monate vor der Attacke in Horgen musste Slobo zum Wesenstest beim Experten Hans Schlegel. Er arbeitet seit 30 Jahren als Polizeihunde- und Rettungshundefachexperte. Bei Slobo sah er Handlungsbedarf: «Ich sah ein sehr hohes Gefährdungspotenzial, eine tickende Zeitbombe. Es war klar, dass, wenn die Resozialisierung fehlschlägt, der Hund eingeschläfert werden muss», schreibt er auf Blick-Anfrage.
Termin beim Tierarzt war schon gebucht
Bald nach dem Gespräch habe sich Dragica B. noch einmal gemeldet. Wieder hatte Slobo einen Menschen angegriffen. Schlegel: «Wir entschieden zusammen, aufgrund der Unberechenbarkeit und der Heftigkeit der Bissverletzungen, den Hund einschläfern zu lassen», so der Experte. Er habe bereits am gleichen Tag einen Termin beim Tierarzt abgemacht, aber Dragica B. sei nicht aufgetaucht.
Stattdessen brachte das Ehepaar den Rottweiler zur Resozialisierung ins Ausland. Auf dem Youtube-Kanal einer deutschen Hundetrainerin in Ungarn wird die Behandlung von Slobo noch immer als positives Beispiel aufgeführt – auch wenn er direkt nach der Heimkehr in die Schweiz eine fremde Spaziergängerin angegriffen und schwer verletzt hat. * Namen geändert.Schreibt Blick.
Slobo, der Name ist seit Slobodan Milošević auf dem Balkan und in Den Haag Programm! Die einen vergöttern ihn noch heute, die andern brachten ihn vor Gericht.
Wer wie ich in der siebtgrössten Stadt der Welt, pardon, der Schweiz lebt, weiss, mit welchen Monstern von Kampfhunden unsere orthodoxen Christen aus dem Balkan die Trottoirs beherrschen. Bissiger Kampfhund an der Leine gehört bei denen aus der zweiten Generation und ihrem ausgeprägten Machogehabe zum Statussymbol, wenn sie nicht gerade mit ihren geleasten Protzschlitten lautstark durch die Stadt posen.
Immerhin sind unsere geschätzten muslimischen Mitbewohner*innen aus dem Balkan vom Kampfhundewahn nicht besessen. Laut Koran ist es den Muslimen nämlich nicht gestattet, sich einen Hund anzuschaffen, ausser, wenn er/sie/es diesen Hund für die Jagd oder zur Bewachung von Vieh und Anbau benötigt.
Dafür beherrschen die muslimischen Kosovaren und Albaner den Luzerner Drogenmarkt. Und das ist ja auch was. Für die Gesellschaft möglicherweise sogar gefährlicher als Kampfhunde. Drogen hat Allah leider nicht explizit verboten. Als Arzneimittel sind sie erlaubt. Vermutlich hat auch der Prophet ab und zu «inhaliert», wie Barack Obama «Kiffen» formulierte.
«Allahu akbar». Oder «Alle zur Nacktbar» wie ein durchaus mutiger Wiener Parodistund Provokateur auf seinem T-Shirt in grossen Lettern und dem Bild einer Frau im Burkagewand darunter ausgerechnet im Wiener Bezirk «Favoriten» zum Besten gab, wo die meisten Flüchtlinge Wiens angesiedelt sind! Also sowas wie die Baselstrasse in Luzern. Worauf der Spassvogel logischerweise von ein paar Afghanen spitalreif geprügelt wurde.
PS: Ein T-Shirt oder gar eine Einkaufstasche mit der Aufschrift «Aluhut Nacktbar» – ebenfalls eine Parodie auf den muslimischen Schlachtruf «Allahu akbar» – wird online gehandelt. Google hilft allen Interessierten und Mutigen, die unbedingt eine Tracht Prügel suchen, weiter.
-
6.6.2020 - Tag des Nasenpuders im Luzerner Club Princesse
Aus dem Luzerner Kriminalgericht: 18-Jähriger drückt Partygänger zerbrochene Flasche in den Hals
Streit nach einer Partynacht: Ein 18-Jähriger verletzte zwei Nachtschwärmer mit einer Flasche. Später prügelten er und vier weitere Personen auf die beiden Verletzten ein.
Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Mann (21) aus dem Kanton Bern unter anderem wegen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand und Raufhandels schuldig gesprochen. Im November 2019 hatte der damals 18-Jährige mit vier Kollegen die Nacht im Club Princesse in Luzern verbracht. Von zwei Partygängern, die ebenfalls im Club gewesen waren, wurde er vor dem Nachtclub gegen sechs Uhr morgens nach Zigaretten gefragt und in ein Gespräch verwickelt. Als die beiden wieder gegangen waren, bemerkte der 18-Jährige, dass sein Portemonnaie fehlte. Er nahm an, dass einer der Partygänger sein Portemonnaie gestohlen hatte und wollte sie zur Rede stellen.
Es kam zu einer Auseinandersetzung, wobei der 18-Jährige einem der Partygänger mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf schlug. Das Opfer trug dabei eine Wunde und ein Schädel-Hirn-Trauma davon. Die inzwischen zerbrochene Flasche drückte er dem zweiten Partygänger in den Hals. Dieser erlitt dabei eine acht Zentimeter lange und ein bis zwei Zentimeter tiefe Wunde am Hals.
Fünfergruppe suchte nach den Partygängern
Nach dem Vorfall traf sich der 18-Jährige mit den vier Kollegen, die mit ihm die Partynacht verbracht hatten. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach den beiden anderen Nachtschwärmern. Wenig später kam es bei einer Bushaltestelle in der Nähe des Clubs zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen der fünfköpfigen Gruppe und den beiden Partygängern. Die Fünfergruppe traktierte die beiden mit Faustschlägen und Fusstritten. Ein Opfer trug dabei ein gebrochenes Nasenbein und eine Augenhöhlenbodenfraktur davon. Das zweite Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch.
Das Kriminalgericht verurteilt den heute 21-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Zudem muss er einem der Opfer eine Genugtuung bezahlen und auch die Verfahrenskosten von rund 8000 Franken muss er berappen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berufung wurde angemeldet. Schreibt 20Minuten in Zeiten des Pfingstlochs.
Tja, im übelst beleumdeten, vom Balkan kontrollierten Club Princesse an der Gibraltarstrasse in Luzern werden den Partygängern*innen Stimulationsmittel wie Nasenpuder und ähnliche Präparate frei Tisch geliefert. Da kann es schon mal passieren, dass bei den zugedröhnten Gästen ein Portemonnaie verschwindet. Handfeste Auseinandersetzungen sind die Folge davon. Business as usual im Club Princesse. No big thing.
-
5.6.2022 - Tag der Ursachen und Wirkungen
Wenn Ägypten hungert, ist das auch unser Problem
Wir stehen vor einer Ernährungskrise von historischen Dimensionen. Wann, wenn nicht heute, sollten wir grundsätzlich über Produktion und Konsum unserer Lebensmittel nachdenken?
Wie muss man sich ein Pulverfass kurz vor der Explosion vorstellen? Die ägyptische Regierung vermeldet dieser Tage praktisch jede Tonne Weizen, die im Land geerntet und im Silo eingebracht wird. Mit solchen Erfolgsnachrichten wollen die Behörden den über 100 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern die Gewissheit vermitteln: Es gibt genug Getreide, kein Anlass zur Aufregung! Die Botschaft, die bei den Leuten tatsächlich ankommt, dürfte allerdings genau umgekehrt lauten: Wenn um die Versorgung ein solches Aufheben gemacht wird, gibt es allen Grund zur Panik.
Brot ist in Ägypten das Grundnahrungsmittel schlechthin. Und das Land ist der grösste Weizenimporteur der Welt – wobei im letzten Jahr rund 80 Prozent dieser Einfuhren aus der Ukraine und aus Russland stammten. Wegen Wladimir Putin ist jetzt alles anders. Ein Grossteil des ukrainischen wie des russischen Getreides wird Ägypten nicht erreichen. Das Brot wird knapp. Das Brot wird teuer. Es drohen Hunger und soziale Unruhen.
Dabei ist der Umstand, dass Putin den Hunger gezielt als Waffe einsetzt, nur ein Teil einer umfassenden Ernährungskrise. Der Krieg verschärft eine ohnehin schon fragile Situation, die gleichfalls eine eindeutige Ursache hat: den Klimawandel. In gewissen Regionen der USA kämpfen die Bauern mittlerweile chronisch gegen Trockenheit. Wegen heftigen Regens während der Aussaat rechnet China heuer mit Ernteausfällen von über 20 Prozent. In Indien droht das Gleiche wegen der Rekordtemperaturen im April. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren war es dort zu dieser Zeit so heiss.
China ist der grösste, Indien der zweitgrösste Weizenproduzent der Welt. Nun aber horten beide Länder ihre Schätze. Und nicht nur sie: Seit Februar haben mindestens 20 Staaten weitgehende Ausfuhrbeschränkungen für pflanzliche Rohstoffe verhängt. Ein Fünftel der Kalorien, die ursprünglich für den Welthandel bestimmt waren, ist diesem Markt damit entzogen.
Wir stehen vor einer Ernährungskrise von historischen Dimensionen. Wann, wenn nicht heute, sollten wir grundsätzlich über Produktion und Konsum unserer Lebensmittel nachdenken? Jährlich landen hierzulande 2,8 Millionen Tonnen davon im Abfall, das sind etwa 330 Kilo pro Person. Der Fleischkonsum ist in der Tendenz zwar seit längerem rückläufig. 2020 verspeisten Herr und Frau Schweizer freilich immer noch im Durchschnitt 47,3 Kilo – vermutlich mehr, als gesund ist. Im selben Jahr importierte die Schweiz 460'000 Tonnen Getreide allein für die Fütterung von Nutztieren. Genug, um grob gerechnet, 1,5 Millionen Menschen ein Jahr lang zu ernähren.
Hansjörg Küster, Professor für Pflanzenökologie an der Universität Hannover (D), schlug diese Woche in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» vor, dass «Getreide wieder als das geschätzt wird, was es ist: das wichtigste Nahrungsmittel der Menschheit». Für die europäische Landwirtschaft empfiehlt Küster deshalb: Man könnte wieder die traditionelle Einteilung in Acker- und Grünland als Richtschnur nehmen, wie sie bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts über viele Generationen hinweg Gültigkeit hatte. Das würde bedeuten: «Steinige und feuchte Flächen werden zur Tierhaltung genutzt. Das muss ausreichen. Das traditionelle Ackerland aber sollte für den Anbau von Getreide und anderen Kulturpflanzen zur Verfügung stehen.» Der Geobotaniker betont: Niemand müsse zum Vegetarier werden, um die drängenden Probleme der Welternährung zu lösen. Doch sollten wir uns fragen, wie der wertvolle Boden am besten genutzt werden soll.
In der reichen Schweiz tun wir derzeit so, als ginge uns das alles gar nichts an. Dabei dürften die Folgen der gestiegenen Lebensmittelpreise und der sozialen Unruhen in Nordafrika über kurz oder lang auch bei uns zu spüren sein. In den letzten Tagen ist die Zahl der Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa gelangen wollen, sprunghaft angestiegen. Natürlich könnte es sich um die übliche saisonale Migration handeln. Es könnte sich allerdings auch eine grössere Flüchtlingsbewegung anbahnen.
Zahlen der Vereinten Nationen machen jedenfalls klar: Vermutlich zum ersten Mal überhaupt stammen die meisten Menschen, die von Afrika nach Europa übersetzen, aus Ägypten. Dort war das Brot bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs um 50 Prozent teurer geworden. Schreibt SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty in seinem Editorial.
Ich will jetzt nicht den ganzen, etwas alarmistischen Artikel von SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty zerfleddern, weil er ja grundsätzlich in vielem recht hat. Wie etwa die grössere Flüchtlingsbewegung, die sich durch die Hungerkrise anbahnen könnte.
Ursache und Wirkung fehlen mehr oder weniger in diesem Editorial. Wie beispielsweise die Tatsache, dass der hehre Westen seit der Kolonialisierung Afrikas bis zum heutigen Tag die afrikanischen Länder und deren Bevölkerung aus rein kommerziellen Gründen vom Anbau ihrer traditionellen Lebensmittel mit Druck auf westliche Ernährungsgewohnheiten umfunktioniert hat.
Irgendwo muss ja Deutschland (nur als Beispiel) seine Überproduktion von Yoghurt verkaufen. Oder der Schweizer Multi Nestlé unvorstellbare Mengen von Mineralwasser, abgefüllt in Plastikflaschen. Wo, wenn nicht in Afrika?
Das sind nun mal die unangenehmen Begleiterscheinungen einer entfesselten Globalisierung.
Dabei gäbe es genügend fruchtbare Länder auf dem afrikanischen Kontinent mit dem Potenzial, den ganzen Kontinent mit entsprechenden Lebensmitteln versorgen zu können, wie globale Forschungsanstalten und deren Forscherinnen und Forscher längst festgestellt haben.
Wäre dem nicht so, würden kaum chinesische Unternehmen in Afrika Kautschuk, Sisal oder Palmöl für den Export in alle Welt erzeugen. Und dies auf Flächen, die öfters grösser sind als diejenigen etlicher Kantone der Schweiz.
Ja, die Schweiz ist ein reiches Land. Doch wer reich ist, kann auch arm werden. Das geht manchmal schneller als man denkt.
-
4.6.2022 - Tag der 200 Gesundheitspiloten im Schweizer Parlament
Alain Berset: «Die Gesundheitskosten dürfen nicht explodieren»
Auch die dritte Auflage einer neuen Tarifstruktur für ärztliche ambulante Leistungen hat beim Bundesrat keine Gnade gefunden. Er fordert die Tarifpartner auf, bis Ende 2023 den sogenannten «Tardoc» weiter zu verbessern.
Insbesondere sollen die beteiligten Organisationen wie die Ärzteschaft und der Krankenkassenverband Curafutura belegen, dass die neue Tarifstruktur nicht zu höheren Gesamtkosten führt. Tardoc soll das heutige Tarifsystem Tarmed ablösen, das moderne medizinische Leistungen ungenügend abbildet. Gesundheitsminister Alain Berset erklärt, warum er diesmal auf einen Erfolg hofft.
SRF News: Der Bundesrat hat «Tardoc» in der jetzigen Form abgelehnt. Warum sollte uns Versicherte das interessieren?
Alain Berset: Es geht um viel, auch für die Versicherten. Es geht um die Art und Weise, wie man die Tarife organisiert, letztlich um die Abrechnungen für die Patientinnen und Patienten. Das ist wichtig für alle, die einen Zugang zu einem guten Gesundheitssystem wollen.
Und was nützt das vorläufige Nein des Bundesrats?
Nicht viel, das muss ich gestehen. Und wir wären auch sehr froh gewesen, wenn wir festgestellt hätten, dass die heutige Fassung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Leider war dies noch nicht der Fall. Das ist keine einfache Situation. Wir müssen nun an die Tarifpartner appellieren. Sie haben gute Arbeit und Fortschritte gemacht. Aber der Bundesrat braucht noch einen Schritt mehr, um das genehmigen zu können. Das ist in nicht allzu viel Zeit machbar.
Warum sollte es im vierten Anlauf plötzlich klappen?
Der Bundesrat hat diesmal klar gesagt, was wir noch brauchen, um den Tarif genehmigen zu können. Bis jetzt haben wir immer gesagt: Es ist noch nicht reif, bitte arbeitet weiter, um etwas Gesetzeskonformes zu erreichen. Diesmal sind wir wohl präziser, was unsere Erwartungen betrifft. Ich hoffe, dass das hilft. Zudem gibt es jetzt eine Tariforganisation, die eine grosse Rolle spielen könnte.
Es gibt also immer noch keine Lösung, weil der Bundesrat vorher zu wenig präzis war?
Wir werden sehen, was die Präzision bringt, die wir jetzt an den Tag legen. Ich hoffe, dass es hilft. Darum habe ich das auch so gemacht.
Über diese Tarifstruktur werden 12 Milliarden Franken jährlich gesteuert. Ist es vielleicht einfach zu viel Geld, als dass man erwarten könnte, dass sich die verschiedenen Partner einigen?
Wir haben in der Schweiz ein gutes Gesundheitssystem, zugänglich für die Leute, mit guten Behandlungen, sehr hohen professionellen Werten und guten Personen, die da arbeiten. Aber klar, es kostet viel. 12 Milliarden, das erklärt auch, wieso der Bundesrat sagen muss, dass die Kostenneutralität wichtig ist. Wir machen alles, um einen guten Zugang zu gewährleisten, aber die Kosten dürfen nicht explodieren. Das gilt in allen Bereichen, auch im ambulanten Bereich.
Die nationalrätliche Gesundheitskommission fordert, Sie sollten aktuelle Tarife senken, um Druck aufzusetzen. Das machen Sie aber nicht. Warum?
Es wäre eine Möglichkeit, wenn das Parlament das will. Aber wir sind ziemlich skeptisch. Denn es wurden grosse Fortschritte gemacht. Wir brauchen jetzt alle Organisationen. Die Zusammenarbeit ist eine grosse Verantwortung für diese privaten Organisationen, die Ärzte, Spitäler und Krankenversicherungen. Es ist eine grosse Verantwortung, eine gute Lösung zu finden. Und wir versuchen, die zu stützen. Aber schon klar, man spürt jetzt: Wenn es nicht gut geht, dann wächst der Wille im Parlament, zu intervenieren – und das könnte viel schlimmer werden. Versuchen wir, das zu verhindern. Wir zählen auf die privaten Akteure.
Ist das eine «bad guy, good guy»-Strategie? Die Kommission droht ein bisschen, und Sie sind vorläufig nett und machen nichts?
Nein, da ist keine Strategie dahinter. Aber mir hat schon Eindruck gemacht, was das Parlament da gesagt hat. Ich hätte das nicht so erwartet. Und es zeigt: Der Unmut im Parlament über diese Entwicklung ist am Steigen. Das ist vielleicht auch nochmals ein Appell an die Tarifpartner, sich zu einigen und konstruktiv noch mehr zu arbeiten für einen genehmigungsfähigen Tarif.
Das Gezerre um diese Tarife dauert nun schon viele Jahre. Wie viele Kopfschmerzen hatten Sie schon deswegen?
Kopfschmerzen ist vielleicht etwas viel gesagt. Ab und zu braucht man viel Leidenschaft, um sich weiter zu engagieren. Aber die Hauptarbeit liegt im Moment bei den Tarifpartnern. Und wir müssen die unterstützen und sie ermutigen, noch Fortschritte zu machen.
Gibt es für diese Art von Kopfschmerzen eigentlich eine Tarifposition?
(Lacht) Ich glaube nicht.
Das Gespräch führte Nathalie Christen.Schreibt SRF.
Frei nach Johann Wolfgang von Goethes Faust: «Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.»
Eine lächerlichere Aussage als «Die Gesundheitskosten dürfen nicht explodieren» von Bundesrat Alain Berset muss man erst mal finden: Die Schweizer Gesundheitskosten sind längst explodiert!!! Wovon redet dieser Mann eigentlich? Hat der Comedian sie noch alle oder lebt er dank seinem bundesrätlichen Gehalt in einer Scheinwelt auf einem anderen Planet?
Die Schweizer «Gesundheitsindustrie» hat sich zu einem Monster entwickelt, das nicht mehr zu zähmen ist. Auch nicht mit der «Pflästerlipolitik» unserer Polit-Granden.
Das weiss das Heer der korrumpierten Gesundheitsexperten im Parlament zu verhindern. Ein «Pöstchen-Jäger» wie der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller oder die Aargauer Mitte-«Gesundheitsexpertin vom Dienst» und Nationalrätin Ruth Humbel – um nur zwei dieser verwerflichen Gesundheitsexperten*innen mit dem «hohlen Hänchen» zu nennen – sind nicht Teil der Lösung sondern Teil des Problems.
Die Gesundheitsindustrie steckt nicht umsonst so viel Geld in ihre parlamentarischen Laufbuben und Laufmädchen. Geld, das nota bene mit Ihrer Prämie bezahlt wird. Sowas müsste eigentlich in einer wahrhaften Demokratie strikt untersagt sein. So schlecht ist die Bezahlung der Mitglieder*innen des Hohen Hauses von und zu Bern ja nicht wirklich: 152’054 Franken bekommt jedes Ratsmitglied im Schnitt vergütet. Pfingstfrage: Verdienen Sie 152'000 Franken im Jahr?
Bundesrat Ueli Maurer drückte es vor Jahren im Zusammenhang mit parlamentarischen Reformen im Gesundheitswesen wie folgt aus: «Ein Flugzeug mit 200 Piloten lässt sich nun mal nicht steuern.»
200 Piloten? Das trifft ja exakt auf die Anzahl der Nationalräte*innen zu.
Maurer vergass dabei allerdings zu erwähnen, dass seine SVP mit derzeit 65 Piloten die absolute Mehrheit im Schweizer Nationalrat darstellt.
Frohe Pfingsten! Geniessen Sie die Sonne und verzichten Sie einfach für ein paar Tage darauf, über die Schockwirkung der kommenden Prämienerhöhung für Ihre Krankenkasse nachzudenken.
Es kommt sowieso alles so wie es kommen muss. 200 von Ihnen gewählte Piloten und Pilotinnen machen es möglich, die - bei den National- und Ständeratswahlen – im kommenden Jahr allerdings an der Urne abgewählt werden könnten. Just do it!

-
3.6.2022 - Tag der Ukrainekrieg-Liveticker
100 Tage Krieg: Die Lage in der Ukraine – die Übersicht
Seit nunmehr 100 Tagen tobt der von Russland entfesselte Angriffskrieg in der Ukraine.
Die Bilanz zum 100. Kriegstag aus ukrainischer Sicht
Die russischen Truppen seien seit Beginn des Krieges am 24. Februar in 3620 Ortschaften der Ukraine einmarschiert, 1017 davon seien wieder befreit worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. «Weitere 2603 werden noch befreit werden.» Russland habe über 30'000 Soldaten verloren, behauptete Selenski. Auch westliche Experten vermuten zwar schwere russische Verluste, halten die Kiewer Zahlen aber für zu hoch.
«Unser Widerstand ist nach all den Monaten ungebrochen. Der Feind hat seine selbstgesteckten Ziele nicht erreicht», sagte die Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar. «Wir sind bereit für einen Langzeitkrieg.» Sie lobte, dass die «Dynamik der Waffenlieferungen» aus dem Westen an Fahrt aufnehme.
Selenski teilte in einer Videobotschaft mit, dass die russischen Streitkräfte derzeit etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums kontrollierten. Vor dem Einmarsch der russischen Armee hatte Russland laut Selenski etwa sechs Prozent der Ukraine besetzt. Die Frontlinie sei inzwischen 1000 Kilometer lang. Selenski dankte ausländischen Partnern ausserdem für Waffenlieferungen.
Militärische Aktionen
Das ukrainische Militär hält nach eigenen Angaben weiter Stellungen in der schwer umkämpften Grossstadt Sjewjerodonezk, dem Verwaltungszentrum der Region Luhansk im Osten der Ukraine. «Im Zentrum von Sjewjerodonezk halten die Kämpfe an», teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Freitag mit. Der Feind beschiesse die ukrainischen Stellungen in der Stadt, in den Vororten Boriwsk und Ustyniwka sowie in der Zwillingsstadt Lyssytschansk, die mit Sjewjerodonezk einen Ballungsraum bildet. Sjewjerodonezk gilt als letzte grosse ukrainische Hochburg in der Region Luhansk.
Nach Berichten beider Seiten haben sich Zivilisten in Bunkern unter der Chemiefabrik Asot (Stickstoff) in der Stadt versteckt, der ukrainische Verwaltungschef von Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von etwa 800 Menschen. «Das sind Einheimische, die gebeten wurden, die Stadt zu verlassen, die sich aber geweigert haben. Auch Kinder sind dort, aber nicht sehr viele», sagte er dem US-Sender CNN.
Zudem berichtete der ukrainische Generalstab von Luftangriffen auf die Ortschaft Myrna Dolyna und erfolglosen Erstürmungsversuchen der städtischen Siedlungen Metjolkine und Bilohoriwka in unmittelbarer Nähe von Sjewjerodonezk. Auch der Versuch, durch Angriffe im Raum Bachmut den Ballungsraum weiter westlich von den Versorgungslinien abzuschneiden, ist nach Angaben aus Kiew bislang gescheitert.
In Richtung Slowjansk, Teil eines Ballungsraums im Gebiet Donezk mit etwa einer halben Million Einwohner, kommen die russischen Angriffe ebenfalls nur langsam voran.
Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums hat Russland seine ursprünglichen Ziele im Ukraine-Krieg – nämlich die Einnahme Kiews und ukrainischer Regierungszentren – verfehlt, kommt aber im Donbass voran. «Gemessen am ursprünglichen Plan Russlands wurden keine der strategischen Ziele erreicht», schreibt das Ministerium auf Twitter.
Im Donbass im Osten der Ukraine seien aber taktische Erfolge erzielt worden. Die Region Luhansk werde inzwischen zu mehr als 90 Prozent von Russland kontrolliert und es sei wahrscheinlich, dass die vollständige Kontrolle in den kommenden zwei Wochen übernommen werde. Der Donbass umfasst die beiden Regionen Luhansk und Donezk.
Verhandlungen und Diplomatie
Drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird die Verständigung auf weitere Sanktionen des Westens gegen Moskau immer schwieriger. Am Donnerstag erreichte Ungarn mit einer zeitweisen Blockade des nächsten EU-Sanktionspakets, dass keine Strafmassnahmen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt, Patriarch Kirill, eingeführt werden. Wichtigster Teil des mittlerweile sechsten Sanktionspakets ist ein Embargo gegen den Import russischen Öls. Es wurde am Donnerstag von Vertretern der EU-Staaten gebilligt. Die EU will am 100. Kriegstag ihr sechstes Sanktionspaket gegen Russland mit einem Öl-Embargo förmlich beschliessen.
Die US-Regierung verhängt weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen und Regierungsbeamte. Das Finanzministerium und das Aussenministerium in Washington verkündeten am Donnerstag eine Reihe von Strafmassnahmen gegen Personen mit engen Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin.
Etwaige Vermögenswerte der Betroffenen in den USA werden eingefroren. Geschäfte mit ihnen werden für US-Bürger untersagt. Die Regierung in Washington nahm auch erneut mehrere Luxus-Yachten ins Visier, die nach US-Angaben in Verbindung zu Putin stehen und die der Kremlchef mehrfach genutzt hat. Auch mehrere Unternehmen landeten auf der Sanktionsliste der Amerikaner.
Eine diplomatische Lösung zwischen Russland und der Ukraine ist nicht in Sicht. Verhandelt wird zwischen Moskau und Kiew derzeit nicht. Staatschef Selenski wirft Russland eine Politik des Terrors vor, während Russland der Ukraine die Schuld dafür gibt, dass die Gespräche auf Eis liegen.
Kriegsopfer
Armeeangehörige: Ein genaues Bild über Todesopfer – sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite – gibt es nicht. Die Angaben und Schätzungen gehen weit auseinander. Die Nato geht davon aus, dass mittlerweile zwischen 7000 und 15'000 russische Armeeangehörige ihr Leben verloren haben. Die Ukraine gibt die Zahl deutlich höher an, nämlich rund 30'850 getötete russische Soldaten (Stand 2.6.) – was westliche Experten anzweifeln. Von russischer Seite gibt es dazu keine Angaben mehr; die letzte Zahl, die Ende März genannt wurde, waren rund 1300 getötete Soldaten.
Der ukrainische Präsident Selenski hatte zuletzt Mitte April die eigenen Verluste offengelegt. Damals sprach er von insgesamt etwa 3000 ukrainischen Soldaten, die seit dem russischen Angriff am 24. Februar gestorben seien. Am Donnerstag sagte Selenski, dass jeden Tag im Krieg 100 Menschen getötet und 400 bis 500 verletzt würden.
Zivile Opfer: Laut dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte haben Beobachter bislang 4113 getötete Zivilisten verifiziert (Stand 30. Mai), davon 264 Kinder. Man gehe jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien.
Flüchtende: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als 6.8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflüchtet. Innerhalb der Ukraine befanden sich zudem mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Zusammen sind das mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Selenski sprach am Donnerstag von 12 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die innerhalb des Landes auf der Flucht seien.
In der Schweiz haben bis Donnerstag 55’194 Flüchtlinge aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) per Twitter bekannt gab. 52’298 Ukraine-Flüchtlinge haben gemäss den Angaben bisher den Schutzstatus S erhalten. Schreibt SRF.
Alles interessant, was SRF in seiner Zusammenfassung über die «100 Tage Ukraine-Krieg» festhält. Auch wenn einige Detailangaben nicht verifiziert werden können. Das haben Kriege nun mal an sich: Gelogen wird auf beiden Seiten.
Viel interessanter finde ich jedoch die Tatsache, dass der Live-Ticker über den Ukraine-Krieg bei SRF (jedenfalls heute) von der Frontseite des Internet-Portals verschwunden ist. Was ist denn an dieser (heutigen) Tatsache so interessant?
So wie ich auf dem AVZ-Portal kontrollieren kann, welche Artikel die höchsten Klickzahlen erreichen, kann das auch SRF. So wie jedes andere Internetportal. SRF hat somit festgestellt, dass das Interesse der Portal-Besucher*innen bezüglich Ukraine-Krieg nachlässt und hat entsprechend reagiert. Wie auch beinahe alle anderen Medienportale.
Der depperte Bullshit-Artikel über das Ergebnis von Johnny Depps Scheidung war gestern auf jedem einschlägigen Portal auf der Frontseite an erster Stelle zu finden. Auch bei den sogenannten Qualitäts-Medien bis hin zur NZZ oder DER SPIEGEL. Das sagt viel über Qualitätsmedien, Gesellschaft und Medienverhalten aus. Denn wie gesagt: Die Klickzahlen sind kontrollierbar.
Life-TV-Übertragungen aus einem US-Gerichtssaal mit ekelhaften Details einer wirklich belanglosen und widerwärtigen Scheidung eines verkommenen, drogensüchtigen Hollywoodstars sind uns wichtiger als die Berichterstattung über 55'000 Flüchtlinge aus der Ukraine, die inzwischen in der Schweiz angekommen sind. Zum Vergleich: Biel belegt mit rund 53'000 Bewohnern*innen im Ranking der grössten Schweizer Städte den zehnten Platz.
Über die Folgen dieser wohl massivsten Bevölkerungszunahme innert 100 Tagen in der Schweizer Geschichte wird kaum berichtet. Und wenn, dann höchstens im Kleingedruckten. Die vertieften Diskussionen werden mit all den zu erwartenden Schuldzuweisungen erst bei den National- und Ständeratswahlen 2023 stattfinden. Wetten, dass die SVP bereits die Messer schleift?
Aber so ist das beim Medienkonsum und bei Wahlen: Wer sich nur für Bullshit interessiert, der bekommt auch Bullshit geliefert. Das gehört nun mal zum verheerenden American way of life, den wir von Coca Cola über McDonald's bis hin zur Suchmaschine von Google und deren Datenkleptomanie bedenkenlos übernommen haben. Der Lockheed Martin F-35-Tarnkappenbomber kommt demnächst noch hinzu.
Was soll's? Die Boeing F/A-18 C/D Hornet war ja nicht schlecht. Und mit dem Soldatenmesser von Victorinox gibt es immerhin noch sowas wie Swissness.
-
2.6.2022 - Tag der Anthroposophen und Esoterikern
Daniele Ganser tritt an Rudolf-Steiner-Schule als Ukrainekrieg-Experte auf
Der umstrittene Historiker trat am Mittwochmorgen in Basel an der Rudolf-Steiner-Schule auf. Die Veranstaltung fand während der Unterrichtszeit statt. Eltern reagieren empört.
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Schülerinnen und Schüler an der Rudolf-Steiner-Schule in Basel. Der Wunsch nach Aufklärung ist gross. Deshalb organisierte die Schulleitung am Mittwochmorgen einen Vortrag zum Thema Ukraine-Krieg. Die Wahl des Redners ist jedoch brisant: Es ist der umstrittene Basler Historiker Daniele Ganser. Einst als Vorzeigeprofessor an diversen Schweizer Universitäten gefeiert, schimpfen ihn nun viele einen Verschwörungstheoretiker.
Der 49-Jährige tritt seit Jahren als Wissenschaftler auf, als Historiker, der Licht ins Dunkel von Machtstrukturen bringt, komplexe Weltpolitik aus allen erdenklichen Winkeln beleuchtet. Daniele Ganser polarisiert. An diversen Schweizer Universitäten und Hochschulen darf er keine Vorlesungen mehr halten, da er nicht nach wissenschaftlichem Standard arbeite.
Die Veranstaltung am Mittwochmorgen fand vor 150 Schülerinnen und Schülern der Oberstufe statt, also neuntes bis zwölftes Schuljahr. Regelrecht schockiert reagiert der Vater einer Schülerin: «Ich finde es wirklich sehr befremdlich, dass die Rudolf-Steiner-Schule einen solchen Anlass während der Unterrichtszeit veranstaltet.»
Kritik: Ganser verbreitet Kreml-Thesen
Grund für die Aufregung sind Daniele Gansers Thesen zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Zwar verurteilt er den Angriffskrieg von Russland, vertritt aber auch die Position, dass die USA der tatsächliche Aggressor sei. Ganser ist der festen Überzeugung, dass die Proteste auf dem Maidan in den Jahren 2013 und 2014 von den USA inszeniert wurden. Ganser spricht von einem Putsch – organisiert von der CIA.
Eine völlig unhaltbare These sei das, so Ulrich Schmid, Professor für russische Kultur und Gesellschaft an der Universität St. Gallen. Dabei handle es sich um russische Staatspropaganda. «Das ist eine These, die schon seit längerem vom Kreml verbreitet wird. Es war zwar tatsächlich so, dass viele amerikanische NGOs Geld gegeben haben, um die zivile Gesellschaft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder aufzubauen. Aber davon zu sprechen, dass die Ereignisse auf dem Maidan ein von Amerika orchestrierter Putsch gewesen seien, das ist falsch.»
Schülerschaft soll sich selbst eine Meinung bilden
Die Schule selbst hielt sich im Vorfeld der Veranstaltung bedeckt. Weder auf der Website der Basler Rudolf-Steiner-Schule noch auf jener von Daniele Ganser war der Auftritt zu finden. Gegenüber Radio SRF wollte die Schulleitung nur schriftlich Stellung nehmen. Daniele Gansers Vortrag sei Teil einer ganzen Vortragsreihe zum Ukraine-Krieg. Und weiter: Man sei sich darüber im Klaren, dass Gansers Thesen kontrovers diskutiert würden. Man wolle die Schülerschaft dazu anregen, sich auch umstrittene Thesen anzuhören und sich selbst ein Bild zu machen. Daniele Ganser reagierte auf Anfrage von Radio SRF nicht. Schreibt SRF.
Daniele Ganser referiert an einer Rudolf-Steiner-Schule. Und? Wo ist das Problem? Da kommt doch nur zusammen, was ohnehin zusammen gehört. Zwei Spinner und Sektierer mit Doktortiteln und kruden Ansichten: Ganser, der Weltverschwörer vom Dienst und Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie.
Wer das esoterische und anthroposophische Gesülze der von diesen «Ideologien» durch und durch verseuchten SVP und ihrem Wurmfortsatz der Trychler aushält, erträgt auch noch ein paar weitere Trottel, die unglücklicherweise von den dahinsiechenden «Qualitätsmedien» mit Gratis-Reklame hochgejazzt werden.
Denn Hand aufs Herz: 98,734 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben keine Ahnung, wer dieser Ganser ist. Ab heute sind es vielleicht 98,784 Prozent. Die Anzahl der Rudolf-Steiner-Schulen hält sich in der Schweiz ebenfalls in überschaubaren Grenzen.
Wieder einmal viel Lärm um nichts. Aber das sind wir uns ja inzwischen gewohnt. Loud come, easy go.
Nur so nebenbei: Kreml-Thesen verbreiten auch Putin-Versteher wie der Luzerner Nationalrat Franz Grüter, the sexiest man alive im Ranking der Unsympathen Roger Köppel und - etwas dezenter - sogar der Heilige vom Herrliberg.
Vielleicht könnte man Ganser ja mal am «Martinstag» an die «Gansabhauet» nach Sursee einladen. Wäre zu schön, wenn da die paar Tausend Besucher*innen den traditionellen Gansabhauet-Song leicht abgewandelt aus allen Kehlen singen würden:
«Houet dem Ganser de Schwanz ab, aber houet ehm net de ganz ab. Lönd ehm no es Stömpli stoh, damet är chan a d'Lozärner Chelbi go».
-
1.6.2022 - Tag der unappetitlichen Werbung des Putin-Verstehers Franz Grüter
Schliesst sich die Schweiz dem EU-Ölembargo an? «Wollen nicht russische Kriegskasse füllen»
Im Bundeshaus ist man sich nicht einig, ob die Schweiz dem europäischen Ölembargo gegen Russland anschliessen soll. Dieses sei wirkungslos, sagt SVP-Nationalrat Franz Grüter. Die Grünen sind da anderer Meinung.
Die EU hat die nächsten Sanktionen gegen Russland ergriffen. Am Montag einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf ein Verbot über die Einfuhr von russischem Öl, das über den Seeweg in die EU gelangt. Länder wie Ungarn, Tschechien und die Slowakei dürfen aber weiterhin Öl aus der Druschba-Pipeline beziehen. Damit würden dann noch 10 Prozent russisches Öl in die EU importiert, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (63).
Die Schweiz entscheidet selbstständig darüber, ob sie sich den neusten Sanktionen der EU anschliessen wird. Es besteht diesbezüglich kein Automatismus, und im Parlament ist man sich in der Frage nicht einig. Geht es nach den Grünen, solle der Bundesrat möglichst schnell diese neusten Sanktionen übernehmen, fordert Nationalrätin Sibel Arslan (41). «Wenn wir nicht die russische Kriegskasse füllen wollen, müssen wir das Embargo übernehmen.»
Ganz anderer Meinung ist man bei der SVP: «Das Embargo wird wirkungslos sein, ausser dass es die Öl- und Treibstoffpreise weiter anhebt», sagt Franz Grüter (58), Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates. Zudem helfe diese Massnahme keineswegs, den Ukraine-Krieg zu beruhigen, sagt er: «Im Gegenteil, Russland nimmt heute dreimal mehr Geld ein als vor dem Krieg.»
Vor allem eine symbolische Sanktion
GLP-Nationalrätin Tiana Angelina Moser (43) sagt zu Blick, sie würde es begrüssen, wenn die Schweiz sich den EU-Sanktionen anschliesse. Aber sie hält nicht hinter dem Berg, dass dies wohl mit einem Anstieg der Preise verbunden wäre: «Die Schweiz muss darum nun prüfen, mit welchen Massnahmen darauf regiert werden kann.»
Dabei wäre eine Übernahme der neusten Sanktionen vor allem ein symbolischer Akt. Die Schweiz bezieht kein Rohöl direkt aus Russland, bestätigt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).
Fast drei Viertel des hierzulande verkauften Öls importiert die Schweiz aus der EU. Die meisten EU-Länder aber importieren ihr Öl wiederum aus Russland. «Wenn russisches Rohöl und russische Rohölprodukte in Europa fehlen, wird das auch die Schweiz zu spüren bekommen», so Seco-Sprecherin Livia Willi.
Wie sich das Embargo längerfristig auf die Situation in der Schweiz auswirke, sei schwierig zu beurteilen, heisst es beim Seco. Dies ist von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter dem Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Embargos, den Transportkapazitäten, der Erhöhung der Rohölförderung durch andere Länder. Käme es aufgrund des EU-Embargos zu einem Öl-Engpass, wäre die Schweiz vorbereitet. Sie verfügt über ein Mineralöl-Pflichtlager. Schreibt Blick.
Der Luzerner Nationalrat und Putin-Versteher Franz Grüter erinnert einen mit seiner plötzlichen und täglichen Medienpräsenz je länger je mehr an die populäre Uralt-Werbung von Ragusa: «Ein Tag ohne Grüter ist wie ein Tag ohne Grüter». Was bei Camille Bloch pfiffiges Marketing für einen köstlichen Schoggistengel mit Nüssen namens Ragusa war, wirkt bei Grüter eher unappetitlich.
Aber der Kanton Luzern hat nebst Unappetitlichem auch Gutes zu bieten. Vor allem für Euch Umweltsünder, die Ihr täglich die Atmosphäre mit unendlich viel C02 aus den Auspuffrohren Eurer Protzschlitten füttert: Das Mineralöl-Pflichtlager von Rothenburg (Kanton Luzern) schützt Euch Unseligen bei Schweizer Erdöl-Engpässen davor, mit Velo und Veloanhänger Eure Mobilität ausleben zu müssen.
Es ist halt wirklich so, wie ein berühmter Philosoph sagte, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen weil Giuseppe di Malaparte ja noch lebt: «Luzern ist der Menschheit immer einen Schritt voraus».
Was allerdings nicht auf Franz Grüter zutrifft. Der hechelt politisch stets den aktuellen Weisungen und Trends von Herrliberg, Trychler-Garde und ANUS hinterher.

-
31.5.2022 - Tag der wohlfeilen Sprüche und Durchhalteparolen der westlichen Politelite an die Ukraine
Jan Fleischhauer: «Der Befehl, nichts zu liefern, muss von ganz oben kommen»
Für Kolumnist Jan Fleischhauer ist von der versprochenen Zeitenwende „nicht viel zu halten“. Er weiß nicht, worauf Kanzler Scholz Rücksicht nimmt. Fleischhauer fragt sich vor allem, worüber Scholz und Macron 80 Minuten am Telefon mit Putin redeten. Video by DIE WELT.
Ein grosser Redner war der populäre deutsche Journalist und Kolumnist Jan Fleischhauer noch nie und wird auch nie einer werden. Doch was er in seinem Videogestammel rauslässt, ist nicht von der Hand zu weisen.
Wesentlich interessanter als das, was er in seiner schwammigen Expertise vorträgt, ist das, was Fleischhauer nicht sagt, aber versteckt andeutet.
Die geschlossene Einigkeit der «hehren westlichen Wertegemeinschaft» ist zusehends am Bröckeln und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Politgemeinschaft die Ukraine zum wirtschaftlichen Wohle ihrer eigenen Staaten fallen lässt.
Von den wohlfeilen Sprüchen und Zusagen der Business-as-usual-Politelite an die Ukraine wird nichts bleiben ausser den Millionen von ukrainischen Flüchtlingen, die den Westen noch mehr destabilisieren werden.
Machen wir uns ehrlich: Der hehre Westen hat Putin rein gar nichts entgegenzusetzen. Die schwammigen Sanktionen sind nur ein Beispiel dafür.
Könnten Sanktionen einen Krieg verhindern oder eine Wende zum Besseren bringen, wäre Nordkorea längst ein Musterknabe der UN-Vollversammlung und die muslimischen Pfaffen vom Iran würden den Friedensnobelpreis holen.
-
30.5.2022 - Tag der linken Zeitenwenden
Zeitenwende in Kolumbien?: Das Wahlresultat ist ein Schlag für die regierenden Konservativen
Der Linkskandidat Gustavo Petro gewinnt die erste Wahlrunde klar mit 40 Prozent der Stimmen. Der ehemalige Guerillakämpfer geht nun in die Stichwahl mit dem parteilosen Unternehmer Rodolfo Hernández. Petro ist überzeugt, dass er in drei Wochen die Stichwahl gewinnt und der erste linke Präsident seit 200 Jahren in Kolumbien wird. Am Abend sprach er in einem Hotel im Zentrum Bogotás zu seinen Anhängerinnen und Anhängern und sagte, das sei ein Tag des Triumphs.
Kolumbien ist eines der Länder weltweit, in denen der Reichtum am ungerechtesten verteilt ist. Petro will einen sozialen Wandel einleiten. Reiche will er stärker besteuern und ein Ende der Rohstoffausbeutung verspricht er.
Hernández: Ein Programm ohne Programm
In der Stichwahl trifft er auf den parteilosen Unternehmer Rodolfo Hernández. Dass es der 77-Jährige so weit geschafft hat, ist die grosse Überraschung dieser Wahl. Rodolfo Hernández wird von den Medien als Aussenseiter bezeichnet, er hat nur eine kurze politische Karriere als Bürgermeister einer Provinzstadt vorzuweisen. Sein Programm besteht aus einem einzigen Inhalt: Er wiederholt immer wieder, dass Kolumbien von korrupten Politikern ausgeblutet werde und er alle ins Gefängnis stecken wolle.
Zwei Anti-Establishment-Kandidaten erobern die beiden ersten Plätze bei den Präsidentschaftswahlen. Sie versetzten der dominierenden konservativen politischen Klasse Kolumbiens einen deutlichen Schlag. Kolumbien hat sich um jeden Preis für einen Wandel entschieden. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das Land den linken Wandel von Petro oder den noch Unbekannten von Hernández will. Schreibt SRF.
Das Problem der «linken» Zeitenwenden liegt darin, dass nicht die Korruption bekämpft wird, sondern dass die Korruption lediglich neue Bankkonten erhält. Zig Beispiele «linker» Zeitenwenden in Süd-Amerika, Asien und vor allem in Europa lassen grüssen.
Denn in Sachen persönlicher Bereicherung auf Staatskosten stehen die linken Politiker*innen den rechten in Nichts nach. Das ist sogar in der Schweiz sichtbar.
Lediglich die Wahrnehmung ist eine andere: Während bei den «Liberalen» (oder «Bürgerlichen») die Korruption quasi zum politischen Alltag gehört und mit einem Schulterzucken hingenommen wird, lösen Korruptions-Skandale und Pöstchenjägerei der Linken noch immer eigenartige Schockwellen aus, die aber keine Folgen haben, ausser, dass die Wahlbeteiligung stetig abnimmt und der Frustpegelsteigt.
-
29.5.2022 - Tag von Roger Köppel und DJ Bobo
Christoph Blocher: Immunität für die einen, nicht aber für seinen Vasallen Köppel
Parlare heisst lateinisch reden. Damit Parlamentarier das freie Wort führen können, wurde ihnen zum Schutze des freien Wortes vor rechtlicher Verfolgung die sogenannte parlamentarische Immunität gewährt. Wobei die Immunität selbstverständlich nicht bei Straftaten greift, die nichts mit dem Parlamentsmandat zu tun haben.
Früher wurde das ernst genommen. Heute missbraucht die Mehrheit im Parlament die Immunitätsaufhebung als Machtmittel. Sie will die Minderheit kriminalisieren und so zum Schweigen bringen.
Das sieht man deutlich am neuesten Beispiel von Nationalrat Roger Köppel. Dieser mutige und einflussreiche Kämpfer für die schweizerische Neutralität und gegen die EU-Anbindung wird von der Mehrheit, vom Establishment, mit einem Immunitätsverfahren eingedeckt. Der Grund besteht darin, dass Köppel öffentlich gemacht hat, wohin der Neutralitätsbruch durch den Bundesrat führte: zur Konfiszierung von wertvollen Schweizer Uhren durch den russischen Staat. Warum darf das nicht gesagt sein? Es sei eine Indiskretion.
Gleichzeitig hat dieses Establishment, die classe politique, nicht das Geringste unternommen gegen Hunderte von Indiskretionen von Bundesräten und Bundesverwaltung gegenüber den Medien während der Corona-Zeit. Wer gegen das Amtsgeheimnis verstösst, dem passiert nichts, wenn er zum Establishment gehört.
Auch die Journalisten betrachten Roger Köppel als eine Art Todfeind. Denn er hat als einziger Schweizer Journalist eine ausländische Tageszeitung als Chefredaktor geführt. Er hatte den Mut, die «Weltwoche» in der Verlustzone zu kaufen, und führt diese seither erfolgreich mit eigenem unternehmerischem Risiko. Jetzt moderiert er zusätzlich im Alleingang zwei Sendungen «Weltwoche daily» mit grossem Erfolg. Das gibt Neider. Doch merke: Wer Neider hat, hat Brot. Wer keine hat, hat Not. E gueti Wuche. Christoph Blocher. Schreibt Christoph Blocher in der «Verlegerkolumne» für seine Gratisblätter.
Es ehrt ja den Feldherrn vom Herrliberg, dass er sich für seinen treuesten Vasallen einsetzt. Und in der Tat war die groteske Parlaments-Show rund um die Aufhebung von Köppels Immunität eine Lachnummer sondergleichen. Mit Ruhm haben sich die Eliten mit der Spreizwürde der Etablierten vom Hohen Haus von und zu Bern jedenfalls nicht bekleckert.
Aber ebenso grotesk kommt Blochers Kolumne daher. Eine gewisse Paranoia kann man dem Gesalbten vom Herrliberg nicht absprechen, wenn ausgerechnet er einmal mehr über das politische Establishment, die «classe politique» wettert. Blocher und sein politisches Sprachrohr Köppel, das rhetorische Maschinengewehr des heiligen Christophorus, sind der Inbegriff des politischen Establishments und der sogenannten «classe politique».
Die Lobhudelei des grossen Zampanos auf seinen Zauberlehrling von der «Weltwoche» entbehrt jeglichen Tatsachen. Köppels zwei Jahre als Chefredaktor der am äussersten rechten Rand agierenden deutschen Tageszeitung «DIE WELT» waren alles andere als erfolgreich, verlor «DIE WELT» doch mehrere Hunderttausend Abonnenten*innen.
Fairerweise sei erwähnt, dass auch andere grosse Zeitschriften Deutschlands wie die «Bild»-Zeitung oder «DER SPIEGEL» in dieser Zeit vom gleichen Schicksal heimgesucht wurden.
Jedenfalls war man bei der Welt-Redaktion hinter vorgehaltener Hand nicht unglücklich über Köppels Abgang. Gewisse Welt-Redaktoren*innen behaupten noch heute, Köppel sei gegangen, bevor er «gegangen» wurde.
Peinlich wird Blochers Schmeichelei seinem getreuen Vasallen gegenüber mit den Behauptungen, Köppel habe die «WELTWOCHE» gekauft – ohne aber Köppels Geldgeber zu nennen – und wie erfolgreich sein Adlatus das Trychler-Blatt, vom Bund als «Regional- und Lokalpresse» benannt, führe.
Warum die so erfolgreiche «Weltwoche» als «Regional- und Lokalpresse» zwischen Oktober 2020 und September 2021 indirekte Presseförderung in der Grössenordnung von 360'000 Franken vom Bund, also ausgerechnet von der verachteten «classe politique», bekam, lässt Blocher offen. Ebenso die Corona-Nothilfe seit Juni 2020 in der Höhe von 178'556 Franken und 58 Rappen.
Erfolgreiche Unternehmen müssen sich nicht vom «verhassten Staat mit seiner classe politique» durchfüttern lassen. Soviel zur unerträglichen Bigotterie vom Herrliberg.
Erwähnt sei auch die «erfolgreiche» Auflage-Entwicklung der «Weltwoche» seit Köppels Übernahme: Die Auflage der «Weltwoche» stieg zunächst tatsächlich leicht an von 82'849 im Jahr 2006 auf 85'772 im folgenden Jahr, sank dann aber langsam auf 77'800 Exemplar im Jahr 2011. Dieser Leserschwund hat sich in den folgenden Jahren deutlich verstärkt, sodass die Auflage 2014 nur noch 58'410 Exemplare betrug. Bis 2018 sank sie weiter auf 40'924, womit die Weltwoche zwischen 2007 und 2018 über die Hälfte ihrer Auflage verlor. So viel Wahrheit sollte auch auf dem Herrliberg gelten.
Geradezu lächerlich ist Blochers Feststellung, dass Köppels YouTube-Gekreische «Weltwoche daily» erfolgreich sei. Schwankende Aufrufe im Schnitt von knapp 10'000 bis 30'000 Usern*innen, wovon nicht selten mehr als die Hälfte aus rechtsextremen Kreisen Deutschlands stammt, sind jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei bei YouTube.
DJ Bobo erreichte 2021 388,07 Millionen Views. Was wiederum einiges über die Qualität der Echokammer YouTube aussagt.
Vielleicht sollte Blocher seine Chips doch besser auf DJ Bobo anstatt auf Köppel setzen.
-
28.5.2022 - Tag der Menstruations-Shops
Hera Zimmermann lanciert Menstruationshop: Sie verliess SRF und widmet sich Perioden
Hera Zimmermann (28) eröffnet zum internationalen Tag der Menstruation einen Periodenshop. Wie es dazu gekommen ist, erzählt sie Blick.
Schluss mit fixem Einkommen und bezahlten Ferien: Hera Zimmermann reicht 2020 bei SRF ihre Kündigung ein und macht sich selbstständig. Dem Risiko sei sie sich bewusst. «Und trotzdem hat sich noch nie etwas so gut angefühlt», schreibt sie auf der Videoplattform TikTok, auf der sie ihren neuen Lebensweg dokumentiert.
Ihr sei es wichtig, dass sich Frauen auch im beruflichen Aspekt mehr trauen. «Ich verliess den sicheren Hafen bei SRF schweren Herzens.» Es sei sicher nicht der konventionellste Weg für eine Journalistin, aber sie liebe Herausforderungen, fährt sie fort.
Zum internationalen Tag der Menstruation eröffnet Zimmermann mit einem vierköpfigen Team heute ihren eigenen Periodenshop. Und damit hat sie so einiges vor: «Wir versuchen die Nummer eins fürs Thema Periode zu werden», so Zimmermann.
Alternativen zu herkömmlichen Tampons
Als Frau, die schon länger mit Periodenschmerzen kämpfte, testete sie diverse Produkte aus. «Irgendwann kam der Gedanke auf, dieses Wissen einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen.» Zusammen mit ihrem Team suchten sie über Monate die weltweit spannendsten Produkte im Periodenbereich. Nun können sie in ihrem Periodenshop alternative Produkte zu Tampons anbieten.
Das Ganze sei aber aufgrund des kleinen Markts gar nicht so leicht gewesen, sagt Zimmermann: «Die Menschheit fliegt mittlerweile auf fremde Planeten, aber wenn Leute menstruieren, dann verwendet der Grossteil immer noch herkömmliche Binden und Tampons. Das möchte ich ändern.»
Nachhaltig, ethisch und fair
Ein wichtiges Kriterium sei bei der Suche nach Produkten auch das Herstellerland gewesen. Die Produkte kommen zum grossen Teil aus Europa. Die Menstruationstassen werden in Deutschland hergestellt und die Periodenunterwäsche in Portugal genäht.
Auch was den Preis angeht, möchte Hera Zimmermann und ihr Team fair bleiben: «Die Menstruation, und die Beschwerden, kann man sich nicht aussuchen. Daher ist es uns wichtig, die Produkte für alle zugänglich zu machen.»
Doch das ist nicht alles. Ein weiteres Anliegen ist den Gründern des Periodenshops, dass auch Menstruierende in Drittweltländern Zugang zu nachhaltigen Produkten haben. «Aus diesem Grund spenden wir beim Kauf einer Menstruationstasse wiederum eine nach Südafrika», erklärt sie.
Von der Firstbleederin bis zur Meno-Pause
Wer so viele Ziele hat, braucht Verstärkung. Zusätzlich zu den drei Mitwirkenden werden daher externe Partner dazu geholt. «Am wichtigsten zu erwähnen sind aber unsere Testerinnen, die wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Social Media gesucht haben.»
Es wurde explizit darauf geachtet, dass alle Altersschichten vertreten sind. Also von der sogenannten Firstbleederin bis zu Frauen kurz vor der Meno-Pause. Die Produkte wurden ihnen dann kostenlos zur Verfügung gestellt und über mehrere Zyklen getestet. Nur jene Produkte, die gut bewertet wurden, sind jetzt im Periodenshop verfügbar. Schreibt Blick.
Wir sollten den kommenden Sommer nicht mit Defätismus beginnen, sondern dem neuen Geschäftsmodell von Hera Zimmermann Beifall klatschen. Machen wir uns ehrlich: Auf diesen Menstruationsshop, von der SVP als «Periodenshop» bezeichnet, haben die Schweizer Frauen schon lange gewartet. Die Tampon-Diskriminierung findet endlich ein Ende.
Böse Zungen der SVP behaupten allerdings, die ehemalige SRF-Angestellte Frau Zimmermann bringe absolut nichts Neues auf den Markt. Und weiter: Sie, die Frau Zimmermann, hätte ruhig bei SRF bleiben können. SRF sei auch nichts anderes als ein Periodenshop mit angehängtem Nachrichtenportal. Das würden die vielen Klagen der SVP gegen SRF eindeutig an den Tag legen. Man müsse sich nur mal die «Arena» mit den «furchtbaren Weibern» anschauen, die alle unter der Mens leiden würden.
Da vergisst die SVP allerdings, dass sich ausser der SVP-Kohorte plus Sympathisanten*innen und dem unsäglichen SVP-Anhängsel der «Trychler» kaum mehr vernünftige Schweizer*innen die Quatschsendung antun. Entsprechend ist denn auch die Quote der Sendung in den Keller gerutscht.
«Dummschwätzer*» und Präsident der Aargauer SVP Andy Glarner hat sich bis jetzt noch nicht zu Wort gemeldet. Ist vermutlich auch besser so. Denn er müsste sich einen Tag später doch nur für sein «Dummschwätzer»-Geschwätz entschuldigen. The same procedure as everytime.
-
27.5.2022 - Tag der ochestrierten Aktionen
Keine UNO-Reaktion auf die Provokation aus Nordkorea
Die Einigkeit im UNO-Sicherheitsrat beim Thema Nordkorea ist auf einmal dahin. China und Russland haben ihr Veto gegen neuerliche Strafmassnahmen nach den jüngsten Raketentests eingelegt.
Diktator Kim Jong-uns Antwort auf US-Präsident Joe Bidens Asienbesuch diese Woche war eine Salve von Raketen. Darunter möglicherweise auch Nordkoreas grösste Interkontinentalrakete Hwasong-17. Kim bekräftigte damit vor allem, dass er an baldigen Abrüstungsgesprächen nicht interessiert ist.
Eine ganze Serie von UNO-Resolutionen verbieten Pjöngjang sowohl Atom- als auch Raketentests. Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, sieht in den jüngsten Abschüssen eine Bedrohung für die ganze Welt.
Moskau und Peking geeint dagegen
Doch neue Sanktionen, die sich vor allem gegen nordkoreanische Hackergruppen, gegen Öl- und gegen Tabaklieferungen (Kim ist Kettenraucher) gerichtet hätten, muss das Regime nicht gewärtigen. Zwar stimmten 13 der 15 Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat dafür, doch Peking und Moskau legten ihr Veto ein.
Das Scheitern der jüngsten Resolution ist von grosser Tragweite. Bisher zogen Russen und Chinesen jeweils mit bei den Sanktionen, die Nordkorea von seinem Atombombenprogramm abbringen sollten. Nicht immer enthusiastisch, aber immerhin. Auch bei der Umsetzung zeigten sie bisweilen wenig Verve. Doch diesmal schiessen sie erstmals seit 2006 ganz offen quer.
Ihre Begründung ist, die Strafmassnahmen führten in eine Sackgasse. Sie seien ein primitives Mittel. Unter ihnen leide vor allem die Bevölkerung des Landes. Allerdings wurde beim Sanktionsregime stets darauf geachtet, die Auswirkungen auf das nordkoreanische Volk möglichst gering zu halten. Deshalb sind etwa Lebensmittel- oder Medikamentenlieferungen gar nicht betroffen.
Druckmittel für andere Anliegen
In Tat und Wahrheit geht es China und Russland wohl um etwas anderes. Mit ihrem plötzlichen Veto verschärfen sie in erster Linie ihren Konfrontationskurs gegenüber dem Westen, besonders zu den USA. Der Ukraine-Krieg und die neuerdings offenere amerikanische Unterstützung für Taiwan spielen da hinein. Das Ergebnis dieses Muskelspiels: Der UNO-Sicherheitsrat ist nun auch noch in der Nordkorea-Frage blockiert.
Stellvertretend für viele beklagt Frankreichs UNO-Botschafter Nicolas de Rivière diese Spaltung des einflussreichsten UNO-Organs. Dem Regime in Pjöngjang werde mit dem Nichtstun ein Persilschein ausgestellt. Es werde geradezu ermuntert, nun sehr bald wieder mit Atombombentests anzufangen. Tatsache ist: Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Schreibt SRF.
Die beiden Unrechtsstaaten China und Russland lassen ihre Masken fallen. Und der Westen wundert sich. Als ob der Krieg in der Ukraine keine orchestrierte Aktion zwischen Russland und China wäre.
Abgesehen von der Tatsache, dass Nordkorea kaum noch mehr sanktioniert werden kann als es schon ist und trotzdem seit vielen Jahren die Entwicklung von Atomwaffen ungeniert weiterführt.
China kann dies nur recht sein. Verhindern doch die Atomwaffen von «Rocket Man» eine Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea vermutlich für alle Zeiten.
-
26.5.2022 - Tag der untoten Mumien am WEF
Selenskyj attackiert Henry Kissinger – «Hat das Jahr 1938 im Kalender stehen»
Der ukrainische Präsident hat Ex-US-Außenminister mit süffisantem Unterton als „große weltpolitische Figur“ bezeichnet und scharf kritisiert.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist Vorschläge scharf zurück, die Regierung in Kiew solle zur Beendigung des Krieges Russland territoriale Zugeständnisse machen. „Was auch immer der russische Staat tut, es wird sich immer jemand finden, der sagt: Lasst uns seine Interessen berücksichtigen“, sagt Selenskyj in einer Videoansprache am späten Abend.
Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hatte diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgeschlagen, die Ukraine solle Russland die 2014 annektierte Krim überlassen. „Man hat den Eindruck, dass Herr Kissinger nicht das Jahr 2022 auf seinem Kalender stehen hat, sondern das Jahr 1938, und dass er glaubt, er spreche nicht in Davos, sondern in München zu einem Publikum von damals.“
1938 schlossen Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland in München einen Pakt, der Adolf Hitler Land in der damaligen Tschechoslowakei zusprach, um ihn zum Verzicht auf weitere Gebietserweiterungen zu bewegen. „Diejenigen, die der Ukraine raten, Russland etwas zu geben, diese ‚großen weltpolitischen Figuren‘, sehen nie die gewöhnlichen Menschen, die gewöhnlichen Ukrainer, die Millionen, die auf dem Gebiet leben, das sie für einen illusorischen Frieden eintauschen wollen.“
Wo der ukrainische Präsident Selenskyj recht hat hat er recht. Untote Mumien wie der eitle Henry Kissinger, an dessen Händen sehr viel Blut klebt, machen das WEF genau zu dem was es ist: Eine Quatschbude und Bühne für verkommene Eliten, die nicht Teil der Lösung für den derzeitigen «Zeitenwandel» sind, sondern Teil des Problems.
-
25.5.2022 - Tag der Oliogarchen aus Zug
Bestechung, Marktmanipulation: Glencore einigt sich auf Milliarden-Deal mit Behörden
Der Rohstoffgigant war Korruption und mehr beschuldigt worden. Nun sind die Vorwürfe vom Tisch – Glencore zahlt dafür 1,06 Milliarden Dollar.
Neben der Anklage in Grossbritannien wegen Korruption hat Glencore auch die Untersuchungen der Behörden in den USA und Brasilien wegen Bestechung und Marktmanipulation beigelegt. Insgesamt ist der Bergbaukonzern zu einer Strafe von 2,4 Milliarden Dollar verdonnert worden. Effektiv bezahlen muss er davon 1,06 Milliarden Dollar.
Der Löwenanteil davon wird in den USA fällig: Dort wird Glencore 700,7 Millionen Dollar an das US-Justizministerium DoJ zur Beilegung der Untersuchungen wegen Bestechung bezahlen und 485,6 Millionen Dollar an die Rohstoffmarkt-Aufsicht Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Marktmanipulation von Heizölpreisen in den USA, wie der Zuger Konzern am Dienstagabend mitteilte. Schreibt die Handelszeitung.
Es sind weder Weltverschwörungstheorien noch böse Gerüchte, wenn derzeit in Medien öfters behauptet wird, dass die extrem hohen Preise für Erdöl, Gas und viele weitere Produkte nicht nur aber auch und vor allem mit den entsprechenden Rohstoff- und anderen Börsen zusammenhängen.
Da hat sich die scheinbar alles regelnde Marktwirtschaft über Jahrzehnte Instrumente kreiert, die nicht mehr kontrollierbar sind. Und dies nicht erst seit heute.
Dass die 1,06 Milliarden (1060 Millionen) Dollar der Zuger Rohstoffhandelsfirma Glencore nicht weh tun, beweist der gewaltige Sprung der Glencore Aktie nach oben am 23.5.2022 an der Börse. Kein Schelm, wer Böses denkt.
Machen wir uns nichts vor: Oliogarchen sind nicht nur in Diktaturen wie Russland zu Hause. Auch die hehre westliche Wertegemeinschaft leistet sich diese perversen Schmarotzer.
Eine Mammutaufgabe für kommende junge Politiker*innen, wenn sie die westlichen Demokratien und damit die Marktwirtschaft in die Zukunft retten wollen.
Die Zeitenwende, von vielen Krise genannt, in der wir gerade stecken, wird definitiv nicht von denen gemeistert werden, die sie sehenden Auges verursacht haben.
Empfohlen sei zu diesem Thema der heutige Blick-Artikel: Star-Ökonom Stiglitz über Corona, Krieg, Inflation: «Jetzt muss für einmal auch die Schweiz zahlen!»
Und weil ich heute wieder mal so richtig gut drauf bin – ein kostenloser Tipp an alle Jungpolitiker*innen: Wesentliche Veränderungen in der Gesellschaft wurden seit Bestehen der Menschheit nur äusserst selten von den alten, auf den Status Quo fixierten Eliten herbeigeführt. Packt es an, es liegt in Euren Händen. Ihr werdet es schaffen. Es braucht allerdings den Mut, alte Denkschulen über Bord zu werfen.
Just do it.
-
24.5.2022 - Tag des Schlafwandels
Nach Recherche-Bericht – Austausch mit China: Schweizer Unis sollen vorsichtiger sein
Am Montag hat die «Neue Zürcher Zeitung» eine Recherche zu chinesischen Armeeforschern an der Schweizer Hochschule ETH veröffentlicht. Gegenüber China hatte sich bereits vor der Publikation ein allgemeines Misstrauen breitgemacht. Politikerinnen und Politiker fordern von den Schweizer Universitäten nun ein vorsichtigeres Vorgehen.
Die Schweizer Hochschulen pflegen einen intensiven Austausch mit China. Doch gewisse Kooperationen lösen nun Bedenken aus. Dabei geht es um 90 Projekte, bei denen chinesische Militärwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler an Schweizer Universitäten forschen.
Weil die Wissenschaft in China nicht unabhängig, sondern staatlich kontrolliert ist, sieht der Schweizer Nachrichtendienst die Gefahr, dass Ergebnisse von Schweizer Forschungsprojekten bei der chinesischen Armee landen könnten.
Mehr Vorsicht gegenüber China
Der Nachrichtendienst des Bundes betrachtet diese Zusammenarbeit deshalb besonders kritisch, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet. Und auch Schweizer Sicherheitspolitikerinnen wie die Luzerner Mitte-Nationalrätin Ida Glanzmann sehen darin ein Problem. «Man war sehr offen zu China. In der letzten Zeit merkt man, dass man etwas vorsichtiger damit umgehen muss. Zusammenarbeit: Ja, aber mit der nötigen Vorsicht.»
Glanzmann appelliert an die Schweizer Hochschulen: Diese müssten genau hinschauen, wen sie ins Land holten.
Diese Sicht vertritt auch Werner Salzmann, Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats. Nicht die Politik müsse handeln, sondern die Universitäten. «Nicht der Bund steht in der Pflicht, sondern die Forschungsanstalten, die diese Leute engagieren, sollten genau hinschauen. Sie sollten dem Bund einen Vorschlag machen, wie wir solche Vorkommnisse verhindern könnten.»
Es hat sich also gegenüber China ein allgemeines Misstrauen breit gemacht. Dies zeigt sich nicht nur bei der Wissenschaft, sondern auch bei der Wirtschaft, etwa beim Ausbau der 5G-Mobilfunktechnologie. Die grüne Sicherheitspolitikerin Marionna Schlatter fasst es folgendermassen zusammen: «Es ist nicht nur die Forschungszusammenarbeit, sondern auch die Abhängigkeit von chinesischen Technologien. Das macht mir grosse Sorgen und hier müssen wir in Zukunft besser hinschauen.»
Chinesische Militärforscher an Schweizer Hochschulen lösen Unbehagen aus. Die Schweizer Politik will das Thema deshalb enger verfolgen. Schreibt SRF.
Und wieder wandeln wir sehenden Auges in die nächste Abhängigkeitskrise. Nur mit dem Unterschied, dass China eine andere Hausnummer ist als Russland, auch wenn sich die beiden Unrechtsregimes in Sachen Totalitarismus in Nichts unterscheiden. Was dem einen das Uigurencamp ist, ist dem andern Novichok.
-
23.5.2022 - Tag der sinkenden Schiffe
Österreichische ex-Aussenministerin Kneissl hat Rosneft-Aufsichtsrat verlassen
Die frühere österreichische Außenministerin Karin Kneissl hat den Aufsichtsrat des russischen Mineralölkonzerns Rosneft verlassen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Kneissl, die in Frankreich lebt, schrieb auf Twitter, sie habe dem Konzern bereits im März mitgeteilt, nach dem Auslaufen ihres einjährigen Mandats nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das EU-Parlament hatte am Donnerstag für Sanktionen gegen Politiker gestimmt, die für russische Konzerne tätig sind.
Am Freitag war bekannt geworden, dass der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, ein persönlicher Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin, seinen Posten als Aufsichtsratschef von Rosneft verlässt. Ehemalige europäische Politiker, die für russische Unternehmen tätig sind, waren zuletzt unter immer stärkeren Druck geraten, ihre Mandate aufzugeben.
Twitter-Posting
Kneissl postete auf Twitter einen Screenshot einer Meldung der französischen Nachrichtenagentur AFP, die vergangenen Freitag mit ihr gesprochen hatte. Sie hatte der Agentur gesagt, dass sie im März 2021 für den Aufsichtsrat von Rosneft nominiert und im Juni desselben Jahres bestätigt worden sei. Im März dieses Jahres habe sie nicht zurücktreten wollen, "denn es ist nicht mein Stil, ein Schiff mitten im Sturm zu verlassen". Sie habe gleichzeitig Rosneft mitgeteilt, nicht mehr für ein weiteres Mandat zur Verfügung zu stehen. "Die Presseartikel, die sagen, dass ich mit Millionen Euro lebe, sind falsch und fügen sich in eine Reihe von systematischen Verunglimpfungen ein", formulierte sie gegenüber der Agentur.
Kneissl lebt nach eigenem Verständnis laut früheren Angaben als "politischer Flüchtling" in der Provence, da sie als Politik- und Energieexpertin in Österreich wegen ihrer Nähe zu Putin ein "De-facto-Arbeitsverbot" habe.
Erklärung von Rosneft
Rosneft selbst berichtete am Montag in einer Aussendung von Kneissls Rücktrittserklärung, die mit dem 20. Mai 2022, also dem vergangenen Freitag, in Kraft getreten sei. Kneissl habe im betreffenden Dokument zudem die Verlängerung ihrer Funktionsperiode als Aufsichtsrätin abgelehnt.
"Im Zusammenhang mit der Erklärung dankt die Gesellschaft (Rosneft, Anm.) für die gemeinsame Arbeit in diesen letzten zehn Monaten, die sich durch eine schwierige pandemische und internationale Rahmenbedingung ausgezeichnet haben", hieß es in der Aussendung. Rosneft zähle in Zukunft auf eine Zusammenarbeit mit Kneissl als wichtiger Vertreterin der internationalen Experten-Community, verlautbarte der Konzern.
RT-Kolumnistin
Kneissl war im Dezember 2017 von der FPÖ als Außenministerin nominiert worden. Ihre persönlichen Beziehungen zum russischen Präsidenten Putin sind durch dessen Auftritt auf ihrer Hochzeit im Jahr 2018 in der Steiermark bekannt. Die Regierung musste sie infolge des Misstrauensantrags gegen die Regierung Kurz nach der Ibiza-Affäre im Mai 2019 verlassen. Mittlerweile ist die ehemalige Außenministerin unter anderem als regelmäßige Kolumnistin für den staatsnahen russischen Sender RT tätig.
Das Europaparlament hatte am Donnerstag in einer Entschließung Sanktionen gegen ehemalige Politiker gefordert, die weiterhin für russische Konzerne tätig sind. Schröder und Kneissl wurden in dem Text auch namentlich genannt. Zuvor hatten bereits andere ehemalige Politiker, in Österreich etwa die Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) und Christian Kern (SPÖ), im Gefolge von Russlands Angriff auf die Ukraine ihre Aufsichtsratsposten bei russischen Unternehmen aufgegeben. Schüssel war beim Ölunternehmen Lukoil, Kern bei der russischen Staatsbahn RZD tätig gewesen. Schreibt DER STANDARD.
Was haben Ratten und Putinversteher*innen gemeinsam? Beide verlassen das Schiff erst, wenn es am Sinken ist.
-
22.5.2022 - Tag der neoliberalen Obsessionen
Christoph Blocher und die Atomwaffen
Die Vereinigten Staaten sind nicht bloss ein Mitglied der Nato – sie sind eigentlich die Nato. Die USA haben in der Vergangenheit die Kriege für die Nato praktisch alleine geführt. Die übrigen Nato-Staaten sind militärisch vergleichsweise schwach. Zwar besitzen England und Frankreich ebenfalls die Atomwaffe. Aber damit allein können keine Kriege geführt werden. Die US-Truppen mussten die Kriege in Korea, Vietnam oder Afghanistan auch mit Bodentruppen führen. Und sie haben alle diese Kriege nicht gewonnen.
Eine Atommacht, die heute eine Atombombe mit ihren schrecklichen Zerstörungsmöglichkeiten leichtfertig einsetzen würde, wäre enorm gestraft und verachtet von der ganzen Welt. Die Wirkung ist nicht zu vergleichen mit herkömmlichen Waffen, denn sie könnte ganze Städte und Landstriche auslöschen.
Konventionelle Bomben und Raketen hingegen werden gezielt eingesetzt und zerstören beispielsweise einzelne Gebäude. Die Atombombe ist ein mächtiges Kriegsmittel, auch wenn sie nicht eingesetzt wird.
Der Kalte Krieg wurde militärisch nur wegen dem «Gleichgewicht des Schreckens» beendet. Es standen sich in Ost und West Atommächte gegenüber, wobei jeder wusste: Wenn ich den andern angreife, kommt es zum Atomkrieg – mit unabwägbaren Risiken. Das hat beide Seiten zurückgehalten, allerdings mit dem Nachteil, dass in der sozialistischen Sowjetunion Gräueltaten geschahen, die denen des Nationalsozialismus bezüglich Todesopfer in nichts nachstanden.
Die Sowjetunion hat den Kalten Krieg gegen den Westen wirtschaftlich verloren, indem sie vor dem Bankrott stand. Russland wurde als Schwächerer nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch gedemütigt und musste seine «Vasallenstaaten» räumen. Darunter auch die 1991 selbständig gewordene Ukraine, die Russland Ende Februar angegriffen hat. Alles wie gehabt!
E gueti Wuche. Christoph Blocher. Schreibt Christoph Blocher in seiner Verlegerkolumne bei Swiss Regiomedia AG.
Was uns der Besser- und Alleswisser vom Herrliberg mit seiner Kolumne sagen will, ist eigentlich nichts anderes als in aller Kürze zusammengefaster, unsinniger Reflexmüll. Unstimmig. Unvollständig. Obsessiv.
So vergisst Blocher einige Kriege der USA (wie z.B. den Irak-Krieg) und verschweigt, dass der Korea-Krieg mit Truppen der Vereinten Nationen unter Führung der USA stattfand.
Dass die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR, je in der Realität ein «sozialistisches» Staatsgebilde gewesen sein soll, ist schlicht und einfach dumm, um nicht zu sagen bescheuert.
Die UdSSR war ein totalitäres, kommunistisches Gebilde mit Allmachtsanspruch, wie es auch die Volksrepublik China ist.
Der Begriff «sozialistisch» war in der UdSSR nichts anderes als eine Floskel frei nach Karl Marx für «eine dauerhaft sozial gerechte und freie Zukunftsgesellschaft», genannt «Kommunismus».
Die Gesellschaft der UdSSR war zu keinem Zeitpunkt sozial und frei schon gar nicht. Das gilt für das heutige Russland mit einer geradezu lächerlichen Scheindemokratie wie auch für China. Mit Sozialismus und Freiheit haben beide Staaten nichts am Hut, mit Kleptokratie einer Nomenklatura hingegen sehr viel.
Das Lächerliche an der Obsession aller abartig Neoliberalen und Ultrarechten gegenüber sozialistischen Parteien ist die Tatsache, dass auch bei denen das Wort «Sozialismus» längst zu einer Wahlkampf-Floskel verkommen ist. Vor «sozialen» Parteien wie der SP Schweiz muss sich nun wirklich kein Neoliberaler mehr fürchten.
Wäre dem nicht so, wäre die SVP nicht mit Abstand die wählerstärkste Partei der Schweiz, sondern immer noch die SP.
-
21.5.2022 - Tag der statistischen Warenkörbe
Sonderweg: Warum die Schweiz so eine niedrige Inflation hat
Gerade einmal 2,5 Prozent Inflation gibt es in der Schweiz. Was machen die Eidgenossen anders? Während Europa unter Teuerungsraten von sieben Prozent oder mehr ächzt, verzeichnet die Schweiz bisher bloß einen mäßigen Anstieg der Inflation: Im April wurde eine Jahresteuerung von 2,5 Prozent registriert. Die Schweiz erweist sich auch hier als Sonderfall mitten in Europa.
Die Inflation ist auch in der Schweiz zurück. Erstmals seit 2008 steigen die Preise wieder deutlich an. Die Ursachen sind dieselben wie anderswo: die hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und die Schwierigkeiten in den globalen Lieferketten, die sich mit der Corona-Pandemie deutlich verschärft haben. Eine Knappheit vieler Industrieprodukte und Konsumgüter war die Folge.
Dass die Teuerung in der Schweiz deutlich weniger stark steigt als in den umliegenden Ländern, ist nicht neu: So zeigt etwa der Vergleich mit Österreich, dass die Inflationsrate zwischen 2006 und 2021 im Jahresdurchschnitt in Österreich um zwei Prozent gestiegen ist, in der Schweiz aber nur um 0,2 Prozent.
"Dies ist großteils auf die starke langfristige Aufwertung des Schweizer Frankens zurückzuführen, die Preise für Importgüter deutlich günstiger macht", erklärt der Ökonom Alexander Rathke von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. "Jetzt ist die Inflationsdifferenz besonders ausgeprägt. Dies liegt vor allem an den Komponenten Energie und Nahrungsmittel; hier ist zum einen der Anstieg in der Schweiz weit geringer, und zum anderen ist ihr Gewicht im Warenkorb in der Schweiz kleiner", sagt der ETH-Ökonom.
Starker Franken
Während die Notenbanken weltweit die Zinsen anheben und geldpolitisch "die Zügel anziehen", bleibt die Schweizerische Nationalbank (SNB) bei ihrer expansiven Geldpolitik und belässt die Leitzinsen bei –0,75 Prozent. Damit leiste sie einen wichtigen Beitrag, um die Teuerung in der Schweiz niedrig zu halten, meint Ökonom Rathke. "Die SNB hat den Franken deutlich aufwerten lassen und auch kommuniziert, dass sie dies bewusst toleriert wegen des hohen Inflationsdifferenzials. Auf diese Weise hat sie die Geldpolitik schon angepasst an die hohe Inflation."
Mit andern Worten: Dank des starken Frankens "importiert" die Schweiz weniger Inflation als der Euroraum, wo die Gemeinschaftswährung tendenziell zur Schwäche neigt. Denn viele Waren wie etwa Rohöl werden am Weltmarkt in US-Dollar abgerechnet, wodurch Länder mit einer starken Währung letztlich weniger für solche Waren bezahlen müssen.
Erhöhung der Krankenkassenprämien
Und doch bereitet die Teuerung auch vielen Menschen in der Schweiz Sorgen. Bei der nationalen Delegiertenversammlung vor zwei Wochen forderte der Gewerkschaftsbund SGB rasche Maßnahmen, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu erhalten: Löhne und Renten müssten steigen, heißt es in einer Resolution des SGB.
Hinzu kommt noch ein Element, das in der Schweiz die ausgewiesene Teuerung unterschätzt: Die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung sind in der Schweiz nicht ans Einkommen gekoppelt, sondern sind für Arm und Reich gleich hoch. Und diese Prämien sind in der Schweiz nicht im Warenkorb für die Bemessung der Inflationsrate enthalten.
Jetzt steht aber eine massive Erhöhung dieser Krankenkassenprämien ins Haus: Für das kommende Jahr dürften diese im Schnitt um fünf Prozent und in einzelnen Regionen gar um bis zu zehn Prozent ansteigen, wie der Internetvergleichsdienst Comparis schätzt.
Weniger Konsum
"Nirgendwo in Europa ist das Gesundheitswesen so unsolidarisch finanziert. Dieser Prämienschock muss abgefedert werden", fordert der Gewerkschaftsbund. Der Staat müsse mehr Geld bereitstellen, um die unteren Einkommensklassen zu entlasten. Ansonsten drohe einem Durchschnittshaushalt ein Kaufkraftverlust von 1600 Franken jährlich. Und wenn die Kaufkraft sinke, dann würde dies auf den Konsum und auf das Wirtschaftswachstum durchschlagen. Allerdings würde dies auch dazu beitragen, die Inflation niedrig zu halten.
Die Konjunkturforscher der ETH sind weniger pessimistisch. "Viele Haushalte haben noch Polster vom ungewollten Sparen während der Corona-Pandemie, als sie viele Dienstleistungen nicht konsumieren konnten", sagt ETH-Experte Rathke. So rechnet die ETH Zürich nur mit einem weiteren leichten Anstieg der Teuerung im Jahresverlauf und für das kommende Jahr wieder mit einem deutlich geringeren Preisauftrieb. Schreibt Klaus Bonanomi aus Bern für DER STANDARD.
Dass der «Schweizer Warenkorb» zur Bemessung der statistischen Teuerung ab und zu wie ein Treppenwitz erscheint, wurde schon öfters von Schweizer Politiker*innen thematisiert. Das gilt für einige weitere Erhebungen des BFS (Bundesamt für Statistik). Wie zum Beispiel die monatlich erfasste Arbeitslosigkeit, in der laut dem Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter etliche Positionen (wie z.B. von der ALV Ausgesteuerte) nicht berücksichtigt werden sollen.
Wenn SVP-Grüter mit seiner Behauptung recht hat, darf man sich allerdings fragen, weshalb er, der doch im Hohen Haus von und zu Bern sitzt, nichts dagegen unternimmt. Mit einem «Postulat» oder einer «Motion» könnte er das Parlament bzw. den Bundesrat zwingen, dazu Stellung zu nehmen. Immer vorausgesetzt, seine Behauptung stimmt. Aber eben: Ist der Wahlkampf vorbei, sind auch die hehren Wahlkampfaussagen nur noch Schnee von Gestern.
Nicht ganz stimmig ist allerdings die Forderung vom Gewerkschaftsbund, die Prämienerhöhungen der Krankenkassen für untere Einkommensschichten abzufedern. Die geforderte «Abfederung» findet nämlich seit Bestehen der obligatorischen Krankenkassenversicherung mit dem gesetzlich verankerten Instrument der «Prämienverbilligung» bis zur vollständigen Übernahme der Krankenkassenprämien längst statt. Mutter Ruth Dreifuss sei Dank. So viel Wahrheit muss sein!
-
20.5.2022 - Tag der hehren Vorsätze
Erholung von Coronakrise: Richemont (und auch Ryanair) mit Umsatzrekord
Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat die Coronakrise abgeschüttelt und im Geschäftsjahr 2021/22 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Am Ende kletterte der Umsatz in dem im März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 46 Prozent auf 19.2 Milliarden Euro. Um Währungseffekte bereinigt legten die Verkäufe um 44 Prozent zu. Nach neun Monaten, also von April bis Dezember, hatte noch ein Wachstum von 50 Prozent resultiert.
Im Schlussquartal haben allerdings die Lockdowns im wichtigen chinesischen Markt, Lieferengpässe und die Folgen des Ukraine-Kriegs die Genfer etwas gebremst.
Die Luxusgütergruppe, zu der Marken wie Cartier, IWC oder Piaget zählen, übertraf mit dem Umsatz den Wert aus dem Jahr 2019/20 um deutliche 35 Prozent. Damals hatten die Corona-Folgen das Geschäft noch kaum belastet. Zudem liegen die Verkäufe über den Erwartungen der Analysten, die mit einem Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro rechneten.
Die kräftige Erholung im letzten Jahr wirkte sich auch positiv auf die Ergebnisseite aus: Der Betriebsgewinn rückte um 129 Prozent auf 3.39 Milliarden Euro vor, mit einer Marge von 17.7 Prozent (Vorjahr 11.2 Prozent). Und der Reingewinn stieg um 61 Prozent auf 2.08 Milliarden. Mit diesen Werten hat Richemont die Erwartungen der Analysten dennoch klar verfehlt.
Höhere Dividende
Die Gewinnsteigerung kommt auch den Aktionärinnen und Aktionären zugute. Der Verwaltungsrat schlägt die Ausschüttung einer Dividende von 2.25 Franken je Titel vor. Im letzten Jahr waren es 2.00 Franken.
Im Ausblick bleibt der Konzern mit Aussagen wie immer zurückhaltend. Das Umfeld bleibe unsicher, doch sei Richemont für künftiges Wachstum gut positioniert, wird Verwaltungsratspräsident Johan Rupert in der Mitteilung etwa zitiert. Schreibt SRF.
Geht's uns schlecht? Jedenfalls nicht allen.
Zu diesem Thema passt auch eine Pressemitteilung der Billig-Airline «Ryanair» vor wenigen Tagen: Der Buchungsstand für die Sommerflüge 2022 liege bereits über dem Rekordergebnis aus dem Sommer 2019 (vor der Corona-Pandemie). So richtig ernst scheinen die Klimaaktivisten bis hin zu «Fridays for Future» den Klimawandel nicht wirklich zu nehmen. Viel Lärm, aber wenn es um den eigenen Badestrand geht, sind die hehren Vorsätze nur noch Makulatur.
Früher bekannt unter der Floskel «Wasser predigen und selber Wein trinken».
Man darf jetzt schon gespannt sein, welche exotischen Viren für den kommenden Herbst diesmal eingeschleppt werden, die uns als Folge davon hurtigen Schenkels den Impfzentren zustreben lassen.
Die Pharmabranche reibt sich vermutlich jetzt schon die Hände.
Who cares? Happy Sommer!
-
19.5.2022 - Tag vin Uriella und Mike Shiva
Wer hat das Zeug zum Kreml-Chef?: Expertin sagt «Palast-Massaker» bei Putin-Nachfolge voraus
Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Putin schwer krank ist. Was blüht uns tatsächlich, wenn der Kreml-Chef morgen tot umfällt? Wer hat das Potenzial, nachzurücken und was würde das für den Westen bedeuten?
Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wird der Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) heiss diskutiert. Ob sein aufgedunsenes Gesicht, sein krampfhaftes Festhalten am Tisch oder Behauptungen bezüglich einer schweren Operation Putins nach dem Tag des Sieges – ein Gerücht jagt das nächste.
Mit den wilden Spekulationen tut sich natürlich auch die eine grosse Frage auf: Was geschieht, wenn Putin gestürzt wird oder gar stirbt? Wer würde als Kreml-Machthaber nachrücken? Wie «Focus» berichtet, könnte die Nachfolge Putins eine Art «Palast-Massaker» auslösen. Laut der deutschen Sicherheitsexpertin Marina Henke hätte jeder Nachfolger einen schweren Stand.
Wer nachrückt, muss kämpfen
Sicherheitsexpertin Henke zufolge gäbe es offiziell keinen klaren Nachfolger. «Das ganze System ist einzig und allein auf Putin ausgerichtet.» Und wer auch immer nachrücke, müsse um seine Position kämpfen. «Egal, wer nach Putin an die Macht kommt, höchstwahrscheinlich hat er nicht genug Rückhalt in den verschiedenen Sicherheitsbehörden, beim Militär und unter den Oligarchen», so Marina Henke zur Zeitung.
Würde jemand aus Putins innerem Kreis als Thronfolge erkoren, würde dies bestimmt Machtkämpfe zur Folge haben. «Dann würde es zu einer Art Palast-Massaker kommen.»
Formell hätte Putin einen kurzzeitigen Nachfolger. Der russischen Verfassung zufolge würde bei Putins Ableben der Premierminister die Regierungsgeschäfte übernehmen. Innerhalb von drei Monaten müsste dann ein neuer Präsident ernannt werden. Im vorliegenden Fall würde also Michail Mischustin (56) nachrutschen – ein Mann, dessen Name zumindest im Westen keine grosse Bekanntheit geniesst.
Mischustin ist ein alter Staatsbeamter. Vor seiner Ernennung als Premierminister 2020 leitete er zehn Jahre lang die russische Steuerbehörde. Trotz langjähriger Kreml-Erfahrung gilt er aber als eine von Putins Marionetten, die lediglich zur Sicherung seiner eigenen Macht auserkoren wurden. Doch wer hätte tatsächlich das Zeug dazu, der neue Kreml-Machthaber zu werden? «Focus» stellt fünf mögliche Kandidaten vor.
Wurde der gescheiterte Blitz-Krieg Schoigu zum Verhängnis?
Sergej Sobjanin (63), langjähriger Bürgermeister der russischen Hauptstadt Moskau, könnte nachrücken. Der Jurist hält zudem das Amt eines der Vize-Ministerpräsidenten Russlands inne. Gerhard Mangott (55), österreichischer Professor für internationale Beziehungen, bezweifelt aber seinen Aufstieg. Es sei fraglich, ob Sobjanin auch ausserhalb Moskaus viel Unterstützung erfährt. «Das wohlstandsverwöhnte Moskau wird in vielen Landesteilen gehasst.»
Hoch im Kurs steht auch der russische Verteidigungsminister und Armeegeneral Sergej Schoigu (66). Schoigu gilt als enger Vertrauter Putins – so zeigen Fotos die beiden auch in den gemeinsamen Ferien. Nach der Eroberung der Krim-Insel 2014, waren die Erwartungen an Schoigu hoch. Er sollte Russland einen schnellen Sieg einfahren. Putins erträumter Blitz-Krieg scheiterte aber kläglich – und könnte deshalb auch Schoigus Chancen aufs Präsidentenamt zerschlagen haben.
Als weiterer heisser Kandidat gilt Ex-Geheimdienstler Alexej Djumin (49). Der Gouverneur soll Putin nicht nur einst vor einem Bären gerettet haben, sondern wurde vom Machthaber höchstpersönlich mit dem Titel «Held Russlands» ausgezeichnet. Diese Ehre gebührte ihm in seiner Rolle als Leiter einer geheimen Spezialtruppe, die unter anderem die Annexion der Krim umsetzte.
Putin-Einflüsterer hat gute Chancen
Waleri Gerassimow (66), Chef des Generalstabes der Streitkräfte, hätte ebenfalls Potenzial, Putins Nachfolge anzutreten. Als General der Generäle gilt er nicht nur als Putins Top-Mann in der Armee, sondern auch als Schlüsselfigur in der Krim-Annexion 2014, bei der russischen Militärstrategie in Syrien sowie der Unterstützung der prorussischen Rebellen im Donbass. Gerüchten zufolge soll es sich Gerassimow jedoch wegen der stockenden Vorstösse mit Putin verscherzt haben – dies könnte seine Chancen auf den höchsten Kreml-Posten schmälern.
Spekulationen zufolge hätte auch der Hardliner Nikolaj Patruschew (70) das Zeug dazu, Putin zu ersetzen. Patruschew ist aktuell Sekretär des Sicherheitsrates – zuvor leitete er jahrelang den russischen Geheimdienst FSB. Eine von vielen Gemeinsamkeiten mit Kreml-Chef Putin. Seinem Ruf als Putin-Anhänger und gar dessen Einflüsterer wird er unter anderem wegen seines Hasses gegenüber dem Westen gerecht. Putins feindselige Haltung gegenüber dem Westen kommt also nicht von ungefähr.
Wer eines Tages Putins Platz einnimmt, wird sich zeigen. Ob sein Sturz für den Westen allerdings positive Konsequenzen hat, wagt Politikwissenschaftler Mangott zu bezweifeln. Dass Putins Nachfolger eine Öffnung zum Westen anstrebt, hält er für unwahrscheinlich. «Ein Abtritt Putins würde zwar einen aggressiven, autoritären und misstrauischen Präsidenten entfernen, aber wir können uns keineswegs sicher sein, dass ein verträglicher Nachfolger die Macht übernehmen wird.» Schreibt unser aller Bligg.
Nachdem die letzten zwei Jahre der Pandemie uns gelehrt haben, dass die Welt ausschliesslich und ohne jede Ausnahme nur noch aus Corona-Experten besteht, haben sich die Uriellas und Mike Shivas ein neues Betätigungsfeld gesucht und wurden – Putin sei Dank – auch fündig: Es wimmelt in den Qualitätsmedien inzwischen von Sicherheits-, Waffen-, Kriegs-, Pazifismus-, Russland-, Putin- und Sonnenblumenöl-Expertinnen und Experten.
Eine Gemeinsamkeit eint diese weltumspannende Glaskugel-Zunft: Im Konjunktiv erzählter Bullshit, den unsere «Qualitätsmedien» ebenso atemlos wie auch bedenkenlos in ihren Live-Ticker-Formaten im Viertelstundentakt präsentieren.
-
18.5.2022 - Tag der Hardliner der Schweizer Verfassung
APK des Ständerats: Dunkle Wolken über dem Verhältnis Schweiz – EU
Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU steckt in einer Sackgasse. Diesen Schluss lassen Äusserungen von Mitgliedern der Aussenpolitischen Kommission (APK) des Ständerats zu. Radio SRF hatte letzte Woche einen Brief der EU-Kommission an den Bundesrat publik gemacht.
Die Aussenpolitikerinnen und -politiker des Ständerats beschäftigten sich in ihrer Sitzung diese Woche intensiv mit dem Verhältnis der Schweiz zur EU. Die Schlussfolgerungen sind pessimistisch.
Mitte-Ständerat Pirmin Bischof ist der Präsident der Aussenpolitischen Kommission und hält fest, dass die Positionen der Schweiz und EU weiter auseinanderlägen als bisher angenommen.
Dabei diskutierte die Kommission mit Vertretern beider Seiten. Bundespräsident Ignazio Cassis war anwesend und zum ersten Mal auch der EU-Botschafter in Bern.
Bischof sieht vor allem ein zentrales Problemdossier: «Gegenwärtig ist eine Lösung bei der Personenfreizügigkeit nicht ersichtlich. Das ist der einzige Vertrag, bei dem die Positionen so weit voneinander entfernt sind, dass man die Lösungsmöglichkeiten nicht sehen kann.»
Die Positionen sind gleich weit voneinander entfernt wie eh und je. Glaubte man vielleicht etwas naiv, dass, wenn der Bundesrat das alte Rahmenabkommen beerdige, werde sich die EU schon bewegen?
Bischof sagt dazu: «Ich weiss nicht, ob wir naiv waren oder sind. Die Handlungsbreiten auf beiden Seiten sind nicht genügend, damit eine Lösung möglich wäre.»
Damit stellt sich eine letzte Frage: Muss sich die Schweiz langsam, aber sicher mit einem definitiven Scheitern auseinandersetzen? Läuft das ganze auf ein Fiasko hinaus?
Pirmin Bischof würde noch nicht von einem Fiasko sprechen. Wenn man taktische Positionen bezieht und äussert, sollten gewisse Kompromissmöglichkeiten ersichtlich sein. «Die Kommission hat den Eindruck, dass die Kompromissmöglichkeiten noch schlechter sind, als sie das vorher waren», sagt Bischof. Schreibt SRF.
Geht es nach den Hardlinern der SVP, wird die neutrale Schweiz im Sinne des Rütli-Schwurs und einer aus dem Norden Europas importierten Sagengestalt namens Wilhelm Tell irgendwann sowieso nur noch Handel mit Putins Russland und Xi Jinpings China betreiben. Wozu braucht man da noch die EU, die sowieso mehr auf die Schweiz angewiesen ist als umgekehrt.
In des Himmels lichten Räumen lässt sich froh und selig träumen! Leicht abgewandelt steht das so geschrieben im Schweizer Psalm. Und selbstverständlich auch im neuen Verfassungsorgan der Schweiz, der WELTWOCHE.
-
17.5.2022 - Tag des Moderna-Impfstoff-Marketings
Moderna-Chefarzt Paul Burton warnt die Schweiz vor dem Corona-Herbst: «Es braucht schon im Sommer einen Booster»
Die Schweiz hat gerade Pause von Corona. Doch die Pandemie dürfte im Herbst mit aller Kraft zurückkommen, warnt Moderna-Chefarzt Paul Burton im grossen Blick-Interview. Er spricht über den Omikron-Irrglauben, jährliche Booster-Impfungen und die Gefahren von Long Covid.
Laufen wir im Herbst in den Corona-Hammer? Diese Frage ist allgegenwärtig, obwohl die Pandemie in der Schweiz gerade weit weg ist. Seit April gibt es hierzulande keine Corona-Massnahmen mehr. Doch nach dem Sommer droht uns die nächste heftige Welle, warnt der Moderna-Chefarzt Paul Burton (53). Er ist gerade in seinem Homeoffice in der US-Stadt Cambridge, als er Blick ein virtuelles Interview gibt.
Blick: Die Pandemie ist gefühlt vorbei. Wenn wir einmal in den Geschichtsbüchern zurückblicken: War es die Omikron-Variante, die uns alle erlöst hat?
Paul Burton: Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Pandemie hält an, und ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit einen endemischen Zustand erreichen werden. Es wird noch viele weitere Varianten geben, vielleicht sogar noch schwerwiegendere. Und dass Omikron mild ist, ist eine Fehleinschätzung – das Gegenteil ist der Fall!
Wie bitte? Seit Omikron müssen doch viel weniger Menschen ins Spital eingeliefert werden.
Die weltweiten Daten sprechen eine andere Sprache. In Sachen Hospitalisierungen ist Omikron so schlimm wie die Delta-Variante. Der Irrglaube ist aber leider weitverbreitet. Wenn Sie heute Menschen auf der Strasse fragen, wie hoch das Risiko bei einer Covid-Erkrankung ist, ins Spital eingewiesen zu werden oder sogar zu sterben, hat kaum jemand eine Ahnung.
Wie kam es denn zu dieser Fehleinschätzung in der Öffentlichkeit?
Die Menschen sind mit Daten überhäuft worden. Wenn man sich im Internet bewegt, findet man überall neue Statistiken. Da müssen wir uns als Hersteller, aber auch die Behörden und die Regierungen selber an der Nase nehmen. Unsere Aufgabe ist es auch, der Bevölkerung die wichtigsten Daten übersichtlich aufzubereiten.
In der Schweiz und auch bei Ihnen in Amerika leben wir in einer anderen Realität. Der Alltag ist eingekehrt, die Pandemie ist zur Endemie geworden.
Menschen, die geimpft und geboostert sind, können tatsächlich in einer gewissen Normalität leben. Aber wer denkt, dass mit der endemischen Lage das Virus irgendwann verschwindet, liegt falsch. Es ist unwahrscheinlich, dass wir Sars-CoV-2 jemals loswerden. Das Virus mutiert ständig. Wir können aber einen endemischen Zustand erreichen, wenn wir drei Dinge tun.
Und die wären?
Hören wir endlich damit auf, das Tragen einer Maske und die Umsetzung von Hygieneregeln als Niederlage anzusehen. Wenn wir einen vollgepackten Event besuchen, sollten wir uns aus Eigenverantwortung und Solidarität schützen. Zweitens: Wir müssen zuverlässige Daten erhalten. Es ist den Leuten und Behörden teilweise nicht klar, ob man Fälle meldet, wie man Fälle meldet und wer die Fälle verfolgt. Wenn wir aber die Daten nicht kontinuierlich mit der Welt teilen, werden wir von der nächsten Welle überrumpelt sein.
Und drittens?
Boostern. Das ist die wichtigste Massnahme, um einen endemischen Zustand zu erreichen. Und das müssen wir Jahr für Jahr machen, denn das Virus verschwindet nicht. Wenn die Bevölkerung untergeimpft ist, bietet das Sars-CoV-2 Tür und Tor.
Also braucht es eine vierte Corona-Impfung im Herbst?
Eigentlich besteht jetzt schon Bedarf für einen Booster. Schauen Sie sich Südafrika an: Dort sind die Untervarianten von Omikron auf dem Vormarsch. Weltweit verzeichnen wir nach wie vor hohe Fallzahlen. Bis im November wird der Booster für die meisten Menschen elf bis acht Monate zurückliegen. Und ich rechne bis dahin auch mit weiteren Varianten des Virus. Also wenn nicht jetzt, dann gilt es allerspätestens im Herbst, als Vorbereitung für den Winter, die Bevölkerungen zu boostern.
Empfehlen Sie jedem – also auch den Jungen – einen Booster-Shot?
Auf jeden Fall. Die Chance, dass sich junge Menschen anstecken, ist hoch. Es starben zu Beginn der Pandemie auch viele Junge an Covid-19, das dürfen wir nicht vergessen. Aber klar: Das Risiko, ins Spital zu kommen, ist geringer, auch haben junge Erwachsene ein besseres Immunsystem. Der Fokus sollte bei den Ü50ern liegen. Die Daten zeigen, dass das Risiko frappant ansteigt, wenn das 50. Lebensjahr überschritten wird. Übrigens auch ohne Vorerkrankungen. Weiter sollten sich beispielsweise Berufstätige im Gesundheitsbereich oder Gefängnisinsassen unbedingt mit einem Booster schützen – sie sind einem noch höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt.
Sie haben als Medizin-Chef des börsenkotierten Unternehmens Moderna ein direktes finanzielles Interesse daran, dass sich die Menschen mit Ihrem Impfstoff regelmässig boostern lassen. Warum sollte man auf Sie hören?
Das verstehe ich. Ich bin voreingenommen, keine Frage. Ich bin aber voreingenommen, weil die Wissenschaft und die Zahlen eine deutliche Sprache sprechen. In Amerika sind mittlerweile eine Million Menschen an Covid-19 verstorben. Erinnern Sie sich, als wir im vergangenen November jeden Omikron-Fall einzeln vermeldet haben? Jeder US-Bundesstaat, jedes Land. Und dann ist das Ding einfach über die Welt hereingebrochen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir in einer Welt leben, in der so viele Menschen geimpft und geboostert sind und sich trotzdem irgendwann mit Omikron angesteckt haben. Ich bin verblüfft über die Fähigkeiten des Virus, das ständig mutiert und überall auf der Welt ein so hohes Mass an Krankheiten verursacht. Wir müssen konsequent bleiben und weiterhin alles tun, was wir können, um dieses Virus zu bekämpfen.
Dass der Impfstoff zu 95 Prozent vor einer Ansteckung schützt, beweisen die Daten. Aber ist es nicht enttäuschend, dass der Schutz kurzfristiger anhält als zu Beginn erhofft – und dass somit regelmässige Booster notwendig werden?
Nur eine einzige Impfung wäre ideal gewesen. Aber das war auch etwas illusorisch. Die meisten Impfstoffe müssen von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden. Und übrigens: Wenn man sich die Daten aus der Schweiz anschaut, dann ist der Schutz vor der Delta-Variante nach wie vor hoch. Leider hat das Virus erwartungsgemäss mutiert und wird weiter mutieren, das macht die Auffrischungsimpfungen, insbesondere gegen neue Varianten, unumgänglich.
Meine These: Moderna und die Regierungen werden grosse Probleme haben, weitreichende Teile der Bevölkerung zu einem weiteren Booster Anfang Herbst zu bewegen.
Die Corona-Müdigkeit ist real. Auch ich selbst spüre das. Deshalb hoffen wir alle, dass die Lage im Frühling und Sommer stabil bleibt und die Menschen ihre Batterien aufladen können. So sind wir im Herbst hoffentlich wieder bereit, die Herausforderungen zu meistern. Und dazu gehört auch das Boostern.
Ein weiteres Thema ist Long Covid. Wie sehr beschäftigt Sie das bereits?
Long Covid ist real und wirklich schlimm. Einer von drei Menschen leidet nach einer Erstinfektion daran. Die Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem werden sehr gross sein. Die Fälle von Diabetes, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. dürften zunehmen – auch bei Kindern. Es ist verständlich, dass sich die Welt zuerst mit der akuten Phase der Pandemie beschäftigt hat. Wir wussten über Long Covid schon länger Bescheid. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Langzeitfolgen der Krankheit hohe Aufmerksamkeit erhalten und auch sehr ernst genommen werden.
Fakt ist aber auch, dass Long Covid in den allermeisten Fällen mild verläuft und schnell vorüber ist. Wie schlimm ist es wirklich?
Stimmt schon, aber wenn Millionen Menschen daran erkranken, bleibt eine beträchtliche Summe übrig. Die Menge macht es also aus. Und letztlich wissen wir es einfach auch noch nicht, welche Auswirkungen eine Corona-Erkrankung in zehn Jahren auf unseren Körper hat. Nehmen wir das Epstein-Bar-Virus als Beispiel: Jüngste Daten deuten darauf hin, dass es eine wesentliche Ursache für Multiple Sklerose ist. Wer hätte sich das je vorstellen können?
Nach zwei Jahren Pandemie haben wir mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine die nächste Krise. Befürchten Sie, dass wir Corona bis im Herbst vergessen haben?
Der Krieg in der Ukraine steht zu Recht im Vordergrund unserer Gedanken. Gerade jetzt braucht diese Krise die volle Aufmerksamkeit, um zu versuchen, sie so schnell wie möglich zu beenden. Es liegt in unserer Natur, dass man sich nicht mit allen schrecklichen Dingen gleichzeitig auseinandersetzen kann. Wir sind alle auch nur Menschen. Schreibt Blick.
Wer sich jetzt über die etwas schwer verdaulichen Aussagen von Paul Burton wundert, sollte die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass es sich bei Doktor Burton um den Chefarzt des US-Impfstoffherstellers MODERNA handelt. Ein Schelm wer jetzt Böses denkt? Noch ist Marketing in eigener Sache kein relevanter Bestandteil des Strafrechts.
-
16.5.2022 - Tag der Gierigen
Pekings politischer Plan: Chinesische Firmen drängen an die Schweizer Börse
Chinesische Firmen, die im Ausland an die Börse gehen, kannte man bisher aus New York. Nun entdecken sie die Schweiz.
Die Namen sind hierzulande kaum bekannt. Doch es sind Milliardenkonzerne, die an die Schweizer Börse wollen: Sany, ein Baumaschinenhersteller, wird mit 22 Milliarden Dollar bewertet. Auch die beiden Batteriehersteller Ningbo Shanshan und Gotion und der Medizinprodukte-Hersteller Lepu sind milliardenschwer.
Sie sollen also neben den Börsen von Schanghai und Shenzhen auch an der Schweizer Börse gehandelt werden. Dieser Schritt folgt nicht einer Marktlogik, sondern dem politischen Willen Chinas. Das sagt Jacob Gunter, der beim Mercator Institut für Chinastudien die chinesisch-europäischen Wirtschaftsbeziehungen erforscht. «Wichtig ist, zu verstehen, dass chinesische Unternehmen nicht einfach den Kräften des freien Marktes folgen. Die Kommunistischen Partei und die Regierung beeinflussen ihre Geschäftsentscheide stark.»
Die Börsengänge seien Teil eines politischen Plans. «Wenn ich höre, dass mehrere chinesische Firmen an die Schweizer Börse gehen, so tönt das für mich nach einem Pilotprojekt der chinesischen Regierung», so Gunter. Das Ganze passe in einen grösseren Trend. «Nämlich Chinas Suche nach neuen Zugängen zu internationalem Kapital – ausserhalb der USA und der EU.»
Die Beziehungen China-EU und China-USA sind angespannt. Insbesondere im Finanzbereich. US-Behörden drohen dutzenden chinesischen Firmen, sie von den dortigen Börsen zu verbannen.
Grosse Börsen buhlen um chinesische Firmen
Bei der Schweizer Börse SIX sieht man das Interesse der chinesischen Unternehmen vor allem als Erfolg der eigenen Marketing-Bemühungen. Bereits vor Jahren wurde ein erstes entsprechendes Absichtspapier mit den chinesischen Börsen unterschrieben, gefolgt von Werbeveranstaltungen vor Ort, wie Mediensprecher Jürg Schneider sagt.
«Wir haben sehr intensiv mit den chinesischen Börsen von Shenzhen und Schanghai zusammengearbeitet.» So habe man etwa gemeinsame Workshops durchgeführt, um den chinesischen Teilnehmenden die Vorzüge der Schweizer Börse aufzuzeigen. «Das ist sicher ein Grund, warum sie sich jetzt allenfalls für die Schweiz entscheiden werden.»
Aber: Nicht nur die Schweizer Börse, auch die Frankfurter und Londoner Börse haben vor Ort um chinesische Unternehmen gebuhlt. Dass die Schweizer Börse nun politisch gewollt den Vorzug erhält, dazu will sich die SIX nicht äussern. «Eine Antwort zu dieser Frage wäre rein spekulativ», sagt Schneider. «Wir können nur für uns sprechen und sagen: Wir haben seit der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding sehr gut mit den chinesischen Behörden zusammengearbeitet und pflegen eine sehr offene und transparente Beziehung.»
Schweizer Finanzdepartement involviert
Die chinesischen Behörden sind entscheidend: Sie müssen jeden Börsengang von chinesischen Firmen im Ausland absegnen. Aber nicht nur die chinesische, auch die Schweizer Politik hatte die Finger im Spiel bei den geplanten Börsengängen. Bevor die SIX auf Werbetour in China ging, diente das Schweizer Finanzdepartement als Türöffner.
Auf einer Reise nach China im April 2019 hatte der damalige Bundespräsident und Finanzminister Ueli Maurer die Schweizer Börse SIX mitgenommen. Bei diesem Besuch wurden im Beisein Maurers die entsprechenden Grundlagenpapiere erneuert, unterzeichnet und damit der Weg für chinesische Firmen an die Schweizer Börse geebnet. Bis im Herbst sollen ihre Aktienkurse auf den hiesigen Börsentickern erscheinen. Schreibt SRF.
Man darf jetzt schon gespannt sein, wie sich die «neutrale» Schweiz dereinst verhalten wird, wenn vom alten Hegemon ennet dem Atlantik im Gleischschritt mit der «westlichen Wertegemeinschaft» Sanktionen gegen den neuen Hegemon aus Asien verordnet werden.
Wetten, dass wir dann mit Erstaunen feststellen, wie unendlich viele Xi Jinping-Versteher im Lande Wilhelm Tells «Ni Hao» schreien, die schon immer wussten, dass Taiwan nichts anderes als eine abtrünnige Provinz Chinas ist, die ins Reich des Lächelns zurückzuholen nichts anderes als Chinas gutes Recht ist.
Und wieder werden wir über unsere gekauften Politikker*innen und eine Wirtschaftselite staunen, die wider besseres Wissen vor lauter Gier sehenden Auges in den Schlamassel gestolpert sind.
-
15.5.2022 - Tag der G7-Floskeln
G7: «Werden von Russland erzwungene Grenzen niemals anerkennen»
Die G7-Staaten wollen den ukrainischen Streitkräften notfalls noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung für den Kampf gegen die Angreifer aus Russland liefern, wie es in der verabschiedeten Erklärung heisst. Die G7 würden zudem «Grenzveränderungen, die Russland mit militärischer Gewalt erzwingen will, niemals anerkennen». Die Staaten forderten Russland zudem auf, die Blockade ukrainischer Getreide-Exporte zu beenden.
«Wir werden unsere laufende Militär- und Verteidigungshilfe für die Ukraine so lange wie nötig fortsetzen», heisst es in einer von den Aussenministern der Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen (G7) verabschiedeten Erklärung. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock betonte zum Abschluss der Beratungen in Weissenhausen (D) auch die politische Unterstützung durch die G7-Staaten.
«Grenzveränderungen, die Russland mit militärischer Gewalt erzwingen will, werden wir niemals anerkennen», sagte sie. Den G7-Staaten falle eine zentrale Rolle dabei zu, «zu verhindern, dass die globalen Auswirkungen dieses Krieges die Welt in eine unkontrollierbare Krise stürzen». Der Runde gehören neben der Bundesrepublik die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Grossbritannien und Italien sowie Japan an. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der G7-Gruppe inne.
Keine Kampfjet-Zusage
Unerfüllt bleibt allerdings weiter der ukrainische Wunsch nach der Lieferung westlicher Kampfflugzeuge. Fragen zu weiteren Lieferungen müssten erst einmal «bis in jedes Detail» gemeinsam geklärt werden, sagte Baerbock und verwies auf eine grosse Verantwortung «in dieser absolut schwierigen Situation».
Baerbock machte der Ukraine auch keine Hoffnungen auf eine schnelle Weitergabe eingefrorener russischer Staatsgelder. «Ein Zugriff auf eingefrorenes Geld ist juristisch (...) alles andere als einfach», erklärte sie. Es gebe einige gute Gründe, diesen Weg zu beschreiten – Sanktionen und gerade ein solcher Schritt müssten aber auch vor dem deutschen Recht und dem Europäischen Gerichtshof Bestand haben.
Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hatte Deutschland und die anderen G7-Staaten bei dem Treffen in Schleswig-Holstein gebeten, Gesetze zu verabschieden, um Vermögenswerte des russischen Staates zu beschlagnahmen und der Ukraine für den Wiederaufbau des Landes zur Verfügung zu stellen.
Alternative Transportwege gesucht
Mit Blick auf die blockierten ukrainischen Häfen sagte Baerbock, man prüfe derzeit Alternativen zum Schiffstransport von Getreide aus der Ukraine, um die russische Blockade in diesem Bereich zu brechen. Nachdem es beim Schienentransport über Rumänien Probleme gebe, prüfe man etwa die Ausfuhr über die baltischen Häfen. Es müssten jedoch zunächst die Voraussetzungen geklärt werden, wie die dortigen Häfen erreicht werden könnten.
Normalerweise könnten über den Seeweg fünf bis sechs Millionen Tonnen Getreide pro Monat von der Ukraine ausgeliefert werden, sagte Baerbock. Bei einer Lieferung über die Schiene sei klar, dass man deutlich weniger Getreide bekomme. Bisher werde ein Bruchteil per Bahn vor allem über Rumänien exportiert. Der «Flaschenhals» sei, dass die Ukraine und Rumänien unterschiedliche Spurbreiten bei den Bahnen hätten. Dadurch gehe viel Zeit verloren. In den ukrainischen Häfen lagerten 25 Millionen Tonnen Getreide.
Getreide-Blockade verschärft Hunger
Moskau bereite mit der Blockade von Getreidelieferungen aus der Ukraine «den Nährboden für neue Krisen, um den internationalen Zusammenhalt gegen Russlands Krieg bewusst zu schwächen», sagte Aussenministerin Annalena Baerbock. Bis zu 50 Millionen Menschen vor allem in Afrika und im Nahen Osten seien zusätzlich von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen.
Begleitet werde die russische Strategie von einer «massiven Desinformationskampagne, die mit absurden Behauptungen versucht, Täter und Opfer umzukehren». Baerbock betonte: «Es gibt keine Sanktionen gegen Getreide, es gibt keine Sanktionen gegen Medikamente oder humanitäre Hilfe.» Die westlichen Sanktionen richteten sich «auf das Machtzentrum des russischen Regimes, damit dieser völkerrechtswidrige Krieg unterbunden wird». Schreibt SRF.
Tönt gut, ist aber auch nicht mehr als eine Floskel, die Putin kaum interessieren wird. Nicht die G7-Staaten bestimmen die Grenzen der Staaten, sondern Putin, der mit seinen Eroberungs-Feldzügen Fakten schafft.
-
14.5.2022 - Tag der Marktwirtschaft
Das Primat der Politik über den Markt
Wie war noch gleich das ständige Argument der Russland-Versteher in Österreichs Energiewirtschaft? "Die Russen haben immer geliefert, auch zu Zeiten des Kalten Krieges." Stimmt – bis sie jetzt eben nicht mehr lieferten, zu Zeiten von Wladimir Putins Krieg. Die Gazprom verweigert schon seit Monaten Aufstockungswünsche der österreichischen Abnehmer, offenbar als Vorbereitung von Putins Erpressungspotenzial für den längst geplanten Überfall auf die Ukraine. Aus diesem Grund ist ein wichtiger Gasspeicher im salzburgischen Haidach jetzt leer.
Haidach ist der zweitgrößte Gasspeicher Mitteleuropas und vor allem für das "Chemiedreieck" im benachbarten Bayern, aber auch für Westösterreich strategisch wichtig. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder hat denn auch schon den österreichischen Kanzler aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Gazprom den Speicher füllt: "In Deutschland können Enteignungen stattfinden. Österreich hat etwas Vergleichbares nicht."
Enteignungen? Durch einen Kanzler, dessen Partei immer auf Achtung des Privateigentums gesetzt hat? Abgesehen von rechtsstaatlicher Verträglichkeit – wer soll dann noch bei uns investieren, wenn man so einfach enteignen kann.
Faktum ist, dass die beiden Krisen – Corona und die Energiekrise im Gefolge von Putins Krieg – einen Paradigmenwechsel einleiten. Das Primat der Politik über den Markt: Der Staat muss regulieren, verordnen, notfalls eben die Verfügungsgewalt über wichtige Betriebe ergreifen. Prinzipiell heißt das "Kriegsrecht" oder "nationaler Notstand" oder "Ausnahmezustand". Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind (was sie in Österreich derzeit nicht oder sehr unvollständig sind), kann auch enteignet werden. Der Speicher Haidach gehört aber nicht nur der Gazprom alleine, sondern auch der im Besitz einiger Bundesländer befindlichen RAG (Rohölaufsuchungs AG) und der deutschen Wingas.
Zwangsverwaltung
Verstaatlichen muss nicht sein, Kanzler Nehammer drohte bereits mit Zwangsverwaltung von Haidach. Wenn Gazprom nicht liefere, könne man andere Gasfirmen zur Befüllung einladen: "Wenn er nicht gefüllt wird, sollen ihn andere Energieunternehmen nutzen." Ein Vorbild gibt es: Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat schon vor Wochen die "Gazprom Germania" unter Treuhandverwaltung gestellt. Allerdings müsste dazu auch in Österreich eine gesetzliche Regelung geschaffen werden.
Tatsächlich bricht die nationale Not auch bisher marktwirtschaftliches oder auch "neoliberales" Gebot. Nehammer ging sogar noch weiter und dachte Abschöpfung überdurchschnittlicher Gewinne bei den Energiefirmen an, um sie an die Konsumenten weiterzugeben. Er zweifelte sogar an, ob es klug war, Infrastrukturbetriebe wie den Verbund oder die OMV teilzuprivatisieren. Verfechter der reinen marktwirtschaftlichen Lehre erlitten Ohnmachtsanfälle.
Die Abschöpfung der Gewinne könnte durch eine Sonderdividende erfolgen, die der Aktionär Staat erzwingen (oder, mangels Mehrheit, "empfehlen") könnte. Nur zur Erinnerung: Ein Großteil der sogenannten Verstaatlichten Industrie wurde in den 80er-Jahren teilprivatisiert, weil sie damals pleite war.
Ob Nehammer nun ein "Herz-Jesu-Bolschewik" ist, weil er aus dem christlichen Arbeitnehmerflügel ÖAAB der Volkspartei kommt, ist eine Diskussion, für die jetzt aber die Zeit fehlt. Es geht um Sicherung der Energiezufuhr, und das verlangt in Krisen und Kriegszeiten auch rigide staatliche Eingriffe. Schreibt der von mir geschätzte Hans Rauscher in DER STANDARD.
Das Primat der Politik über den Markt gibt es ohne Ausnahme nur in Diktaturen; einer Herrschaftsform, die sich durch eine einzelne regierende Person, den Diktator, oder eine regierende Nomenklatura von Personen wie Partei, Militärjunta oder Familienclan mit weitreichender bis unbeschränkter politischer Macht auszeichnet. China, Russland, Saudi Arabien – um drei der übelsten Autokratien mit totalitären Regimes zu nennen.
Dass der von den westlichen Demokratien wie eine Monstranz vor sich hergetragene «Markt» eben nicht alles löst, decken Krisensituationen wie die Corona-Pandemie oder der derzeitige Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine mit erschreckender Brutalität auf.
Die Paradefloskel, dass der «Markt Wohlstand für alle» bringt, erweist sich in Krisenzeiten als Utopie. Was anfänglich nach dem Zweiten Weltkrieg durch «soziale Marktwirtschaften» in Europa – beispielsweise Deutschland – tatsächlich zutraf, hat sich durch abartige Varianten des ungezügelten Neoliberalismus fern jeder Moral oder Ethik zu einer Utopie entwickelt.
Das Primat der Politik über den Markt ist allerdings auch kein erstrebenswertes Ziel. Die Politik müsste sich nur endlich wieder bewusst werden, dass es systemrelevante, staatliche Kernaufgaben gibt, die keine vernünftige Demokratie dem Markt überlässt. Die Spaltung demokratischer Gesellschaften in Krisenzeiten fällt ja nicht vom Himmel.
Doch Krisenzeiten bieten auch Chancen. Vielleicht lernen wir wieder, darüber zu diskutieren «wofür» wir stehen und nicht nur endlos darüber zu schwadronieren, gegen «was alles» wir sind. Dann wird sich auch der Neoliberalismus wieder von seinen schlimmsten Verwerfungen erholen.
Halbleere Gläser lassen sich nämlich füllen. Man muss es nur tun.
-
13.5.2022 - Tag des Rocket Man aus Nordkorea
Nordkorea droht Corona-Kollaps: Gestern «erster Infizierter» – heute 350'000
Nordkorea hat einen «explosiven» Corona-Ausbruch gemeldet. Sechs Menschen sind tot, mehr als 350'000 Menschen sollen sich infiziert haben. Den ersten offiziellen Fall meldete man erst vor 24 Stunden.
Zwei Jahre lang behauptete Nordkorea nicht von der Corona-Pandemie betroffen sei. Am Mittwoch war erstmals einem Fall die Rede gewesen. Jetzt sollen es mehr als 350'000 sein.
Der Bericht über die Zahl der nun Infizierten erfolgte einen Tag, nachdem Machthaber Kim Jong Un (38) die Situation als «grossen nationalen Notfall» bezeichnet hatte.
Sechs Tote, einer auf Corona getestet
Allein am Donnerstag meldete Nordkorea 18'000 neue «Fälle eines unbekannten Fiebers». Dazu gab die staatliche Nachrichtenagentur KCNA bekannt, dass es sechs Todesfälle gab. Einer sei positiv auf die Untervariante BA.2 des Omicron-Virus getestet worden. Ob die anderen Toten getestet wurden, unklar.
Es heisst: «Ein Fieber, dessen Ursache nicht ermittelt werden konnte, breitete sich seit Ende April explosionsartig im ganzen Land aus.» In Isolation befänden sich 187'800 Menschen. Insgesamt spricht das Staatsmedium von um 350'000 des «Fiebers».
Keine Impfstoffe
Der Corona-Ausbruch könnte sich für Nordkorea als katastrophal erweisen. Es wird davon ausgegangen, dass das Gesundheitssystem marode ist. Zudem hat hat Nordkorea offenbar keinerlei Impfstoffe importiert. Auch gibt es keine Information darüber, dass ein eigener Impfstoff entwickelt wurde. Das Land hatte Impfangebote aus anderen Ländern abgelehnt.
Aus Nordkorea hiess es in den gesamten zwei Jahren Pandemie, dass es keinen Fall gäbe. Bis am Mittwoch. International glaubt kaum jemand, dass das Land mit seinen rund 25 Millionen Einwohnern von dem Virus verschont geblieben ist. Dennoch gab es auch keine offiziellen Berichte zu Toten. Bis jetzt.
Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un besuchte am Donnerstag das staatliche Hauptquartier für Seuchenprävention und räumte laut KCNA ein, dass der sich ausbreitende Ausbruch eine «Schwachstelle» im Seuchenpräventionssystem des Landes darstelle. Schreibt Blick.
Eigentlich ist die Nachricht aus Nordkorea keine einzige Zeile wert. Dass es im Lande von «Rocket-Man» (O-Ton Donald Trump) Kim Jung Un in den vergangenen zwei Jahren der weltweiten Pandemie keine Seuchenvögel mit dem Coronavirus gegeben haben soll, hat sowieso kein vernünftiger Mensch je geglaubt.
Die Kehrtwende von Rocket Man ist vermutlich vom grossen Nachbarn China veranlasst worden. Xi Jinping würde ja ziemlich dumm aussehen, wenn ausgerechnet der Dicke aus Nordkorea «Zero-Covid» schafft, was dem chinesischen Diktator bisher trotz wochenlanger Lockdowns von Millionenstädten nicht gelungen ist. Und, by the way, auch nie gelingen wird.
-
12.5.2022 - Tag der Opioiden
Alle fünf Minuten eine tödliche Überdosis in den USA
Die US-Behörden haben einen traurigen Höchststand vermeldet: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 107.000 Drogentote gezählt. Befeuert wird die Epidemie durch legale Opioide.
Die Zahl der Drogentoten in den USA ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von mehr als 107.000 gestiegen – das entspricht einer tödlichen Überdosis ungefähr alle fünf Minuten. Am Mittwoch veröffentlichte die Gesundheitsbehörde CDC vorläufige Daten, wonach sie 2021 von 107.622 Drogentoten in dem Land mit seinen gut 330 Millionen Einwohnern ausgeht. Diese Zahl nahm im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 Prozent zu.
Die Drogenepidemie in den USA wird seit Jahren durch Opioide befeuert. Der Direktor der Nationalen Drogenkontroll-Politik im Weißen Haus, Rahul Gupta, nannte die Todeszahlen »nicht hinnehmbar«.
Im vergangenen November hatte die CDC mitgeteilt, dass in den USA erstmals in einem Zwölf-Monats-Zeitraum die Marke von 100.000 Drogentoten überschritten wurde: Von Mai 2020 bis einschließlich April 2021 war die Behörde von 100.306 Überdosis-Toten ausgegangen.
Viele dieser Todesfälle nahmen ihren Anfang bei einem Arztbesuch: Mehr als 16.000 der Opfer aus dem Jahr 2020 starben laut Food and Drug Administration (FDA) an ärztlich verschriebenen Opioiden, mehr als auf dem Höhepunkt der Verschreibungen im Jahr 2012.
Dabei ist spätestens seit dem Urteil von 2007 juristisch bewiesen, dass Amerikas große Pharmaunternehmen mit ihren Opioiden aggressiv den Markt fluteten, wahrheitswidrig für ihre Produkte warben und damit Schuld an einer der größten medizinischen Krisen des Landes tragen.
Oxycontin und Fentanyl befeuern die Epidemie
Immer wieder kommt es in den USA zu Strafverfahren gegen die Konzerne, die sich diese ob ihrer fabelhaften Gewinne jedoch locker leisten können. Ein Beispiel ist die Familie Sackler. Diese ist unter anderem mit dem Verkauf des Schmerzmittels Oxycontin schwerreich geworden. Allerdings macht das Mittel auch schwerabhängig und gilt als einer der Hauptverursacher der Drogenepidemie. Auch nach einem Milliardenvergleich 2021 bleiben die Sacklers eine der wohlhabendsten Familien der USA.
Längst haben sich die Grenzen zwischen den Opioiden auf Rezept und illegalen Drogen aufgelöst. Besonders gefährlich ist dabei Fentanyl, ein synthetisch hergestelltes Schmerzmittel, das in hohen Dosen schnell zu Atemstillstand führt. Weil es mittlerweile auch Heroin, Kokain oder Cannabis beigemischt wird, sterben viele an Überdosen. Schreibt DER SPIEGEL.
Bei jedem anderen Land würden wir vermutlich von einem «failed state» sprechen. Doch bei einer Weltmacht mit einer zu 40 Prozent übergewichtigen Bevölkerung verbieten sich solch despektierliche Äussserungen von selbst.
Vor knapp 30 Jahren diskutierte ich mit Joseph Simmons, Mitglied der US-amerikanischen Hip-Hop- Band «Run D.M.C.», während einem Interview in Zürich über die Drogenflut in Amerika. Sein bemerkenswertes Statement blieb bis zum heutigen Tag in meinem Gedächtnis haften: «Wenn die USA keine Drogen wollten, hätten sie keine Drogen.»
«The world could be so simple», meine Joseph Simmons lakonisch. Zumindest was die Opioiden in den USA anbelangt, trifft dies zu. Denn die werden nicht in Guatemala von einem Drogenbaron hergestellt, sondern von hochangesehenen US-Pharmafirmen.
Bekannterweise hat die Pharmabranche global den stärksten, durchschlagkräftigsten und finanziell mit dem weltweit höchsten Budget gesegneten Lobbyismus. Ob Gesundheitskrise oder Drogen: Big Pharma gewinnt immer! Kollateralschäden gehören zum Business und werden in Kauf genommen.
«Covid-19 zeigt beispielhaft, wie problematisch das Geschäftsmodell der grossen Pharmakonzerne ist. In ihren Schönwetter-Visionen betonen die Konzerne ihren Einsatz für die Gesellschaft, in Tat und Wahrheit nutzen sie die Covid-19 Krise zu ihrem Vorteil aus. Public Eye präsentiert, wie die 10 Strategien von Big Pharma für grösstmöglichen Gewinn auf Kosten der Gesellschaft funktionieren.»
-
11.5.2022 - Tag der Kriegsgewinnler
Investoren im Agrarbereich: Spekulanten können Preise für Agrarrohstoffe in die Höhe treiben
Weizen, Mais und Pflanzenöle werden teurer, erst recht seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Vieles deutet nun darauf hin, dass auch Finanzinvestoren ihre Hände im Spiel haben.
Agrarökonom Lukas Kornherr hat schon früh Verdacht geschöpft: «Wir beobachten bereits seit Mitte 2021 eine erhöhte Beteiligung von Spekulanten am Handel mit Agrarrohstoffen an Warenterminmärkten.» Seit rund zehn Jahren erforscht der deutsche Wissenschaftler Preisschwankungen an den internationalen Nahrungsmittelmärkten.
Er weiss, wenn zu viele Spekulanten am Markt mitmischen, dann heizt das die zurzeit ohnehin hohen Preise für wichtige Agrarrohstoffe wie Weizen, Mais oder Soja noch weiter an. Es gibt klare Signale dafür. Marktstudien zeigen, dass allein in der ersten Märzwoche, also kurz nach Beginn des Ukrainekriegs, so viel Geld in Agrarfonds geflossen ist wie sonst in einem ganzen Monat.
Experten sind besorgt über das Mitmischen von Finanzinvestoren
«Spekulanten spielen auf jeden Fall eine grosse Rolle», sagt Kornherr. Und auch wenn noch nicht ganz klar sei, wie gross ihr Anteil an den aktuellen Preissteigerungen sei: «Wir sind sehr besorgt, dass die Krise innerhalb kürzester Zeit deutlich verstärkt werden kann.»
Auch der Berner Ökonom Gunter Stefan geht davon aus, dass nicht nur Krieg und Knappheit die Preise für Agrarrohstoffe im März auf Rekordniveau getrieben haben. «Man nimmt an, dass die Spekulanten bis zu 30 Prozent am Markt beteiligt sind und die Preise entsprechend hochtreiben.»
Steigende Preise lockten noch mehr Spekulanten auf den Plan, sagt Stefan. Gemeint sind Investoren, die nicht am Weizen oder Mais selbst, sondern nur am Profit aus dem Handel mit Agrarrohstoffen interessiert sind. «Die Geldwirtschaft löst sich ab von der Realwirtschaft. Das ist das grosse Problem. Dann wird es zum Casino.»
Die Casino-Mentalität werde die Preise weiter nach oben treiben, erwartet der Ökonom. Mit gravierenden Folgen, vor allem für arme Länder. Die Welternährungsorganisation warnt bereits, dass der Welt zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder eine Hungersnot drohen könnte. Schreibt SRF.
Wer hätte das gedacht? Der vielgelobte abartig neoliberale Markt regelt doch nicht alles! Was übrigens schon während den zwei Corona-Pandemie-Jahren in extremis aufgefallen ist.
Unappetitliche Kriegsgewinnler gab es schon immer und wird es immer geben. Diese widerlichen Spekulanten sind allerdings kein Naturgesetz, sondern Auswüchse eines falsch gedachten Neoliberalismus mit all seinen Lobbyisten und sonstigen Protagonisten in den Parlamenten.
Deshalb werden kommende Generationen in einer total vernetzten und globalisierten Welt nicht umhin kommen, sich auf die Kernaufgaben eines jeden Staates zurückzubesinnen.
-
10.5.2022 - Tag der Schröders in der westlichen Wertegemeinschaft
Die Zukunft der EU: Krieg und Krisen als Motor – Europa muss um die Zukunft bangen
Der 9. Mai ist im gemeinsamen Europa wie auch in Russland – bis 1991 in der Sowjetunion – seit jeher ein ganz besonderer Tag. Ein Feiertag. Aber er wurde 2022 in zwei Welten begangen, die unterschiedlicher und einander fremder kaum sein könnten. Mitten im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spiegelte sich das am Montag auf besonders drastische Weise wider. Europa muss um die Zukunft bangen.
In Moskau lässt Präsident Wladimir Putin den "Tag des Sieges" über Nazideutschland 1945 mit einer Militärparade abfeiern – Atomraketenschau inklusive. Er hielt eine Kriegsrede, rückwärtsgewandt. Von Frieden spricht er nicht. Sein Volk ist weit weg, kommt nicht zu Wort.
In den EU-Hauptstädten und in den EU-Institutionen ist der "Europatag" ein Fest von Aussöhnung, Frieden, Freiheit, Demokratie. Am 9. Mai 1950 hatte Frankreichs Außenminister Robert Schuman seine berühmte Erklärung abgegeben, Deutschland zur Kooperation in einer Montanunion eingeladen. Sie wurde zum Herzstück der Europäischen Union.
Um diesen "europäischen Geist" zu beschwören, lud das Europäische Parlament in Straßburg zur Präsentation der Ergebnisse eines "Zukunftskongresses" ein. Vor allem junge Leute hatten ein Jahr lang Ideen für EU-Reformen erarbeitet, die sie im Plenarsaal präsentierten – vor den Spitzen der EU-Institutionen. Ein engagierter, friedlicher Prozess.
Aber es ist nun nicht gerade die Zeit für gemächliche Reformvorhaben. "Der Krieg ist zurückgekehrt", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen dringend handeln, die Gemeinschaft stärken. In Zeiten von Krisen und Kriegen hat sich die Gemeinschaft oft bewährt. "Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen", sagte Schuman. Das gilt 2022 besonders. Schreibt Thomas Mayer in DER STANDARD.
Es gab noch nie einen Krieg, dem man etwas Gutes abgewinnen konnte. Selbst der Sieg über einen widerwärtigen Kontrahenten wie das Nazi-Regime Adolf Hitlers hat stets einen faden Beigeschmack: Die Zeche bezahlen die Toten. Dem Erdboden gleichgemachte Städte und Regionen kann man wieder aufbauen. Tote hingegen bleiben tot. Dennoch ist jede Krise auch eine Chance.
Der deutsche Bundeskanzler Olfa Scholz ist zwar vermutlich der falsche Mann, aber seine Deutung des 24. Februars 2022 mit dem Begriff «Zeitenwende» beschreibt den Zustand unserer «westlichen Gesellschaft» seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine richtig.
Der Westen – und mit ihm die EU und die USA – hat nun die Gelegenheit, die tatsächlichen Werte der «Wertegemeinschaft» politisch neu zu definieren. Der Probleme gibt es nebst dem Ukraine-Krieg viele wie beispielsweise Klimawandel und Artensterben, um nur zwei weitere Geisseln der Zukunft zu nennen.
Doch machen wir uns nichts vor: Die Zukunft einer gründlichen Aufarbeitung der Vergangenheit liegt nicht in den Händen der verkommenen Altpolitiker*innen und ihren ebenso verkommen Parteien. Die jungen Leute allein müssen selbstbewusst bestimmen, wie ihre Generation die Zukunft meistern will. Zukunft bedeutet letztendlich nichts anderes als das Gegenteil von Vergangenheit.
In diesem Gedanken steckt mehr Hoffnung als in den salbungsvollen Worthülsen der derzeitigen Politelite, die den Schlamassel des 24. Februars 2022 in einem Mix aus Dummheit, fehlender Moral und Ethik sowie finanzieller Gier erst möglich machte. Es gibt der Schröders viele, wohlverstanden!
-
9.5.2022 - Tag der Inselbegabungen
Ihren Alltag meistert die Zürcherin (23) trotzdem allein: «Hallo, ich bin Julia Meier und habe Asperger»
Zu viele Farben oder zu viele Geräusche überfordern sie – dafür haben Menschen mit dem Asperger-Syndrom Inselbegabungen. Wie es sich damit lebt, erzählt Julia Meier (23) aus Bonstetten ZH. Dank der «stillen Stunden» im Spar kann sie auch allein einkaufen gehen.
Jemandem in die Augen zu sehen, falle ihr schwer, erklärt die Zürcherin (23). «Ich bin Julia Meier und habe eine leichte Form des Asperger-Syndroms.» Diese Unterform des Autismus hatte etwa Albert Einstein, auch Greta Thunberg lebt damit. «Wir haben Inselbegabungen, bei mir sind es Daten und Mathematik», erzählt Meier. Sie brauche keine Agenda, könne sich alles merken – auch alle Details von Gesprächen und Ereignissen speichere sie in ihrem Langzeitgedächtnis.
Das Leben mit Asperger bringt aber auch einige Tücken mit sich. «Ich kann Sarkasmus und Zynismus nicht erkennen. Auch bin ich manchmal patzig, ohne dass es so gemeint ist.» Zudem falle es ihr manchmal schwer, sich zu konzentrieren. Zu grelle Farben triggern sie im Alltag, und Geräusche lenken sie stark ab. «Bei der Arbeit höre ich deshalb einfach für mich etwas Musik. Müsste ich ständig anderen Gesprächen lauschen, wäre das Horror.»
«Ich kann meinen Alltag meistern»
Seit über einem halben Jahr wohnt Julia Meier in einer eigenen Wohnung. Das ist für Autisten bei weitem keine Selbstverständlichkeit. «Aber ich kann meinen Alltag meistern», sagt die Metallbaukonstrukteurin. Spontaneität falle ihr dagegen schwer. «Es muss alles seinen Platz haben und alles nach Plan laufen – sonst bin ich überfordert.» Zum Putzen und Waschen hat sie einen Wochenplan, und sie halte sich strikt daran.
Einen grossen Teil vom Leben auf eigenen Beinen machen die Organisation des Haushalts und das Einkaufen aus. «Das ist gar nicht so einfach. Mir fällt es schwer, mich nicht von Geräuschen, Farben oder sinnlosen Anordnungen von Dingen im Laden ablenken zu lassen.» Auch eine Auswahl zu treffen zwischen ähnlichen Produkten, wird zur Herkulesaufgabe. Deshalb geht sie nur in Läden, die sie gut kennt, oder sie nimmt eine Begleitung mit.
Stille Stunden: Weniger Licht und Geräusche
Seit einiger Zeit haben ausgewählte Spar-Filialen in der Schweiz die stillen Stunden eingeführt – ein Angebot extra für Autisten. Die Filialen, die mitmachen, dimmen an einzelnen Wochentagen für ein paar Stunden das Licht, schalten die Musik ab und verzichten auf Lautsprecherdurchsagen. Weil das Personal in dieser Zeit keine Regale auffüllt, haben sie mehr Zeit für Kunden wie Julia Meier.
In Bonstetten ZH, wo Meier kürzlich hingezogen ist, gibt es diese stillen Stunden. «Ich bin sehr dankbar für das Angebot», sagt sie. «So kann ich mich darauf konzentrieren, was ich brauche, und habe den Einkauf schnell erledigt. Die Früchte werden nicht so grell angeleuchtet, und mich lenken keine Durchsagen ab. Es ist nicht so eine Reizüberflutung wie sonst in den grossen Läden – ich habe mehr Ruhe.»
Spontane Homepartys gibts bei Meier nicht
Spar will die stillen Stunden beibehalten und gar weiter ausbauen. Das Pilotprojekt war Ende 2021 abgeschlossen und hatte für viel positive Resonanz gesorgt. Meier: «Ich hoffe, dass auch andere Läden das einführen. Nicht nur für Autisten, sondern für alle, denen der Einkauf mit all der Reizüberflutung einfach etwas viel ist.»
Wo sie die Snacks für eine Party in ihrer neuen Wohnung kaufen würde, ist für Julia Meier klar: In «ihrem» kleinen Spar im Dorf. Aber spontan eine solche zu schmeissen, käme ihr nie in den Sinn. «So was müsste schon sehr gut geplant werden!» Schreibt Blick.
Hallo, ich bin der Webmaster vom Artillerie-Verein Zofingen und habe MG*.
Auch Udo Jürgens, mit dem ich vor gefühlt 200 Jahren im Zürcher Mascotte ein Interview führte, litt unter fürchterlichem MG. Ob auch Albert Einstein damit gesegnet war, ist nicht bekannt.
Als herausragende Inselbegabung wird mir «Velo-Weitsprung mit Anhänger» nachgesagt.
* MG = Mundgeruch
-
8.5.2022 - Tag der russischen Geschichtskleisterung
Am 9. Mai – Was in Putins Russland tabu ist
Am 9. Mai wird Putin die große Parade zum Sieg im "Großen Vaterländischen Krieg" gegen Nazideutschland abnehmen und dabei sicher auch etwas Entscheidendes zu Russlands Plänen für die Ukraine, Europa und die Welt sagen. Was immer es sein wird: Diejenigen, die glauben, wir sollten uns "nicht in den Krieg in der Ukraine ziehen lassen", vergessen, dass wir schon längst von Putin hineingezogen wurden. Er will Europa nach seinen Vorstellungen von einem mächtigen russischen Reich formen.
Aber noch ein Wort zum Sieg im Weltkrieg. Er ist die Legitimation für alle russischen Herrscher seither. Tatsächlich trug die Sowjetunion die übergroße Last des Krieges, mit 27 Millionen Toten, davon 17 Millionen Ziviltote. Nur muss man ein paar historische Fakten anmerken, die in Russland tabu sind: Stalin hat mit dem Hitler-Stalin-Pakt vom 24. August 1939 Hitler erst den Rücken für seinen Angriff auf Polen am 1. September 1939 und dann Frankreich freigehalten. Die unfassbare Zahl an Toten ist ganz überwiegend auf die monströsen Verbrechen der Nazis zurückzuführen, aber auch auf die anfangs hilflose, dann gegenüber den Eigenen rücksichtslose Kriegsführung Stalins. Er war zunächst völlig desorientiert, dann operierte er ohne Rücksicht auf Verluste.
All das wird am 9. Mai in einem aggressiven Triumphalismus untergehen, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Schreibt Hans Rauscher in DER STANDARD.
Der Hitler-Stalin-Pakt führte denn auch zur Aufteilung Polens zwischen Deutschland und Russland, was in den russischen Schulbüchern ebenfalls nicht erwähnt wird.
Wie auch die Tatsache der westlichen Waffenlieferungen an die Sowjetunion, wie Russland damals noch hiess: Von den USA wurden über 400.000 Jeeps und LKW, 13.000 Lokomotiven und Güterwagen, 90 Frachtschiffe, 4000 Bomber, 10.000 Jagdflugzeuge und über 7000 Panzer an ihre sowjetischen Alliierten geliefert. Die Briten und Kanadier lieferten weitere 5000 Panzer und 7000 Flugzeuge. Quelle: Wikipedia
Was übrigens auch unzählig viele Menschen – vor allem die Russland-Versteher – im Westen nicht wissen. Ohne Hilfe Amerikas und den russischen Winter wäre Russland inklusive Europa heute möglicherweise «arisch». Das sollte man beim Amerika-Bashing stets auch berücksichtigen.
Als Hegemon hat Amerika unendlich vieles falsch gemacht. Aber eben auch vieles richtig.
Happy Muttertag!
-
7.5.2022 - Tag des Lästerns über unsere Mütter
Mitten im Pendlerzug: Hoher Offizier lästert über Amherd
Mitten im vollen Pendlerzug plaudert ein hoher Offizier über die Einschätzung der Schweizer Armee zum Ukraine-Krieg und lästert über Verteidigungsministerin Viola Amherd. Nun droht sogar eine fristlose Kündigung.
Diese Zugfahrt könnte einen Offizier des Armeestabs teuer zu stehen kommen. Im vollen Pendlerzug von Bern nach Zürich soll er am Telefon nicht nur lautstark über Einschätzungen des Schweizer Militärs zum Ukraine-Krieg geplaudert haben. Er habe gleichzeitig auch über Verteidigungsministerin Viola Amherd (59) und Bundespräsident Ignazio Cassis (61) gelästert. Sein Pech: Neben ihm sass ein Journalist von CH Media, der sich für 19.50 Fr. einen Klassenwechsel für die 1. Klasse gönnte. Und der machte sich fleissig Notizen.
So soll der Offizier am Telefon erklärt haben, dass der russische Staatspräsident Wladimir Putin (69) aus Sicht der Schweizer Armee kein irrational handelnder Akteur sei. Mit der gescheiterten Strategie zum schnellen Sturz des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (44) sei er ein kalkuliertes Risiko eingegangen. Das habe sich zwar nicht ausgezahlt. Doch gemäss «unserer Einschätzung», zitiert CH Media den Offizier, sei Putin durchaus in der Lage, seine Strategie den veränderten Bedingungen anzupassen.
«Amherd und Cassis sind schwache Figuren»
Dann zieht der Mann über Verteidigungsministerin Amherd und Aussenminister Cassis vom Leder. Beide habe er gegenüber seinem Gesprächspartner als «schwache Figuren» bezeichnet, die sich in der Krise «in eine Schneekugel verkriechen würden» und nur ein «Küchenkabinett» um sich scharen und einzig auf dessen Mitglieder hören würden.
In einem zweiten Telefonat soll das Lästermaul ebenfalls offen aus der Schule geplaudert haben. So habe er von seinem Gespräch mit Christian Lanz, dem Schweizer Verteidigungsattaché in Stockholm, berichtet. Mit diesem habe er sich über die laufenden Debatten in Finnland und Schweden über einen Nato-Beitritt unterhalten. Daraus werde er einen Bericht für die oberste Sicherheitsberaterin des Bundes, Pälvi Pulli, erstellen.
«Intolerable Regelverstösse»
Bei der Armee kommt das gar nicht gut an. Immerhin gebe es klare Regeln für Mitarbeitende der Bundesverwaltung. «Sollte das geschilderte Verhalten zutreffen, so lägen diverse Regelverstösse vor, die intolerabel sind», wird Armeesprecher Daniel Reist zitiert. «Auch negative Äusserungen über Vorgesetzte in der Öffentlichkeit seitens Mitarbeitenden sind nicht zu akzeptieren.»
Es sei eine formelle Befragung des entsprechenden Offiziers eingeleitet worden. Darauf folge entweder eine Disziplinaruntersuchung oder es können personalrechtliche Massnahmen drohen – von einer Verwarnung bis hin zur fristlosen Kündigung.
Noch ist unklar, ob der Mitarbeitende des Armeestabs klassifizierte Informationen verraten habe, wird Armeesprecher Reist weiter zitiert. Die Bundespersonalverordnung verpflichte aber alle Bundesangestellten zur Verschwiegenheit «über berufliche und geschäftliche Angelegenheiten, die nach ihrer Natur oder aufgrund von Rechtsvorschriften oder Weisungen geheim zu halten sind».
Auch würden gerade Mitarbeitende der Armeeverwaltung regelmässig bezüglich Informations- und Datenschutz sensibilisiert. Dazu gehöre die Weisung, bei mündlicher Weitergabe geheimer Informationen «geeignete Massnahmen gegen das Abhören» zu treffen. Schreibt Blick.
Jetzt aber mal Hand aufs Herz kurz vor dem Muttertag: Wer hat nicht schon mal über angeblich «unfähige» Politikerinnen und Politiker gelästert? Oder frei nach der Bibel, leicht abgeändert: Wer frei ist von Lästern werfe den ersten Stein.
Ich habe beispielsweise die Aussage von Bundesrätin Amherd im Zusammenhang mit der Bundesgiesskanne während der Corona-Pandemie für Fussballvereine «Bei uns gibt es kaum Fussballmillionäre» öffentlich als «dümmstes Zitat des Coronajahres 2021» gebrandmarkt. Und dabei bleibe ich. Muttertag hin oder her.
-
6.5.2022 - Tag von Putins Huren in der Schweiz
Happige Vorwürfe: Wegen Bankgeheimnis: US-Behörde nennt Schweiz «Gehilfin Putins»
Darum geht es: Die sogenannte Helsinki Commission hat am Nachmittag ein Hearing abgehalten. Sie wirft der Schweiz vor, diese sei eine «Gehilfin Putins». Und weiter: Putin und die ihm nahe stehenden Oligarchen hätten die Schweizer Justiz korrumpiert. Die bereits im Vorfeld geäusserten Vorwürfe wurden an einer Online-Veranstaltung erläutert. Der Anlass war ein Experten-Briefing, und es nahm bloss ein Kommissionsmitglied teil, wie die US-Korrespondentin von SRF, Isabelle Jacobi, erklärt.
Wie lauten die Vorwürfe im Detail? Die Tonalität des Briefings war direkt, die Schweiz wurde dargestellt als Paradies für die Geldwäscherei. Besonders scharf äusserte sich einer der Teilnehmer, Financier und Aktivist Bill Browder. «Etwas ist faul in der Schweiz», sagte er und warf der Schweizer Bundesanwaltschaft vor, sich mit russischen Interessen gemein zu machen. Browder sagte, die Schweizer Justiz sei nicht vertrauenswürdig, und die USA sollten das im neuen Rechtshilfe-Abkommen mit der Schweiz berücksichtigen.
Was sagte der Schweizer Strafrechts- und Korruptionsexperte Mark Pieth? Er nannte die Schweiz einen der grössten Offshore-Hafen der Welt. Und er wies auf die Schlupflöcher im Geldwäschereigesetz hin – unter anderem die fehlende Sorgfaltspflicht für Anwälte. Pieth schlug vor, dass die US-Behörden direkt gegen Schweizer Anwälte vorgehen, falls Beweise vorlägen, dass diese im Auftrag ihrer russischen Klienten mit US-Sanktionen brechen. Pieth sieht also eine Rolle der USA, Druck auf die Schweiz auszuüben.
Was steckt hinter den Angriffen der Kommission? Die Schweiz wird in Washington derzeit oft positiv erwähnt. Sogar die neutrale Schweiz setze die Sanktionen um, lobte gar Präsident Joe Biden. Aber man darf laut Isabelle Jacobi nicht vergessen, dass Biden in seiner Antrittsrede die Schweiz als Offshore-Hafen für Steuerhinterzieher genannt hat. Bill Browder meinte im Briefing, es gäbe Stimmen in der US-Regierung, die derzeit nicht gegen die Schweiz vorgehen wollten, da sie eben die Sanktionen mittrage und Milliarden russischer Vermögen eingefroren habe. Browder sagte, er versuche der US-Regierung nahezulegen, dass es noch viel mehr zu holen gebe.
Was droht der Schweiz? Es ist laut der US-Korrespondentin zu früh, um das wirklich zu beurteilen. Mit dem Briefing wird das Thema russische Vermögen in der Schweiz aggressiv lanciert, aber ob dieser Aufruf von der Regierung oder dem US-Kongress gehört wird, ist nicht klar.
Natürlich würden Erinnerungen an frühere Streitigkeiten wach, an den Steuerhinterziehungsstreit oder die nachrichtenlosen jüdischen Vermögen, so Isabelle Jacobi. Werden die US-Behörden einmal auf Missstände aufmerksam, dann kann es für die Schweiz sehr schnell sehr unangenehm werden. Das heutige Briefing erregt in Washington laut Jacobi sicher keine grosse Aufmerksamkeit, aber es kann natürlich sein, dass nun Parlamentarier und Regierungsvertreter aufmerksam werden. Denn die Jagd auf russische Oligarchen-Vermögen geniesst in Washington hohe Priorität.
So reagiert die Schweiz: Der Bundesrat zeigte sich überrascht über die Vorwürfe. Bundespräsident Ignazio Cassis habe Aussenminister Anthony Blinken persönlich mitgeteilt, dass er die Formulierungen in der Einladung für die Online-Veranstaltung in aller Entschiedenheit zurückweise, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi bereits gestern vor den Medien in Bern.
U.S. Helsinki Commission – Eine unabhängige Behörde der US-Regierung
Die Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, auch bekannt als U.S. Helsinki Commission, ist eine unabhängige Kommission der US-Regierung. Seit über 45 Jahren überwacht die Kommission die Einhaltung der Helsinki-Vereinbarungen in der 57 Nationen umfassenden OSZE-Region.
Sie ist in den USA allerdings kaum bekannt, sagt Isabelle Jacobi. Auch hat sie keine grosse Bedeutung in der Tagespolitik der USA. Aber in der Kommission sitzen prominente Abgeordnete aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus sowie Regierungsvertreter.
Wer ist Bill Browder?
Bill Browder ist ein Financier und Aktivist, dessen Anwalt Sergei Magnitski 2009 im russischen Gefängnis umkam. Dies, weil er einen Betrug von russischen Beamten im Umfang von etwa 230 Millionen Dollar aufgedeckt habe, sagt Browder.
Browder versucht seither, das Geld wiederzufinden und sagt, die Spuren führen unter anderem in die Schweiz. Browder äusserte sich wütend, als die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen letzten Sommer einstellte. Nun taucht er an diesem Briefing der Helsinki Kommission wieder auf.
«Internationale Standards werden eingehalten»
In einer schriftlichen Stellungnahme weist Simonazzi heute zudem darauf hin, dass die Schweiz stets einen guten Austausch mit der Helsinki Commission pflegte. «Insbesondere während der Schweizer OSZE-Präsidentschaft 2014 war dieser intensiv und von Vertrauen geprägt. Die Schweiz ist daher äusserst unangenehm überrascht, dass ein solches Briefing stattfindet.»
Weiter steht in der offiziellen Stellungnahme der Schweiz:
«Die Schweiz setzt die internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Steuerhinterziehung um. Dies wird von der Financial Action Task Force (FATF/GAFI), dem Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes sowie der OECD anerkannt.»
Erich Maria Remarques Buchtitel leicht abgewandelt: «In der Schweiz nichts Neues». Das «neutrale» Land mitten in Europa, aufgebaut auf einer Sagengestalt, war schon immer in den Augen ausländischer Staaten die «Hure von Diktatoren, Kriegsverbrechern und mächtigen Kriminellen».
Dass ausgerechnet die «neutrale» und «freiheitsliebende» Alpenrepublik so viele Putin-Versteher aufzuweisen hat, sagt viel über den abartigen Kreis von willfährigen Politikern*innen, Wirtschaftsmogulen und mächtigen Durchlauferhitzern aus der Schweizer Presselandschaft aus. Die üblichen Verdächtigen von SVP, FDP, Mitte-Partei, Grün-Liberalen und deren Sprachrohr NZZ lassen grüssen.
Die Krux bei dieser von den Amerikanern gesteuerten Diskussion ist allerdings, dass die westliche «Wertegemeinschaft» durchs Band weg an diesem «Schweizer Huren-Syndrom» leidet. Allen voran die USA. Von Deutschland und seiner verheerenden Russland-Affinität ganz zu schweigen. Was die im Raum stehenden Vorwürfe gegen die Schweiz auch nicht besser macht.
Nebenbei sei erwähnt, dass sich die gleiche Diskussion, die jetzt über russische Oligarchengelder Schnappatmungen verursacht, auch über die in der Schweiz und im Westen gehorteten Milliarden von anderen Unrechtsstaaten wie beispielsweise Saudi Arabien führen liesse.
«The West Is The Best», wie die Doors in ihrem Hit «The End» vor vielen Jahrzehnten als Anklage gegen den Vietnam-Krieg sangen, war schon immer eine selbstgerechte Traumvorstellung.
-
5.5.2022 - Tag der Pöstchenjäger*innen aus dem Schweizer Gesundheitsbereich
Comparis warnt vor fünf Prozent Anstieg der Krankenkassen-Prämien: 2023 kommt der Prämienschock
Die Krankenkassen dürften gemäss Comparis-Prognosen im Jahr 2023 ihre Prämien durchschnittlich um fünf Prozent anheben. Dafür sei der politisch angeordnete Abbau ihrer Reserven verantwortlich.
Vielen Krankenkassen fehle das Reservepolster, um die aktuellen Kostenschwankungen abzufedern, schreibt der Onlinevergleichsdienst Comparis in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Mit ihren Reserven hätten die Krankenkassen bis 2021 an den Kapitalmärkten hohe Renditen erzielen können. Damit hätten sie sowohl die Defizite des Versicherungsgeschäfts decken als auch ihre Reserven weiter erhöhen können.
Reserven zu stark abgebaut
«Mit einer Verordnungsänderung hat der Bundesrat im letzten Jahr den Druck auf die Versicherer erhöht, Reserven abzubauen, obwohl sich eine aussergewöhnliche Kostensteigerung abzeichnete», schreibt Comparis. Viele Krankenkassen hätten diesem Druck nachgegeben; sie hätten ihre Prämien zu tief angesetzt und als Folge davon ihre Reserven zu stark abgebaut.
Zehn Prozent höhere Rechnungen
2023 dürften gemäss Comparis nun viele Versicherte in der Grundversicherung Rechnungen erhalten, die mehr als zehn Prozent höher ausfallen als im laufenden Jahr. Im Durchschnitt dürfte die nächste Prämienrunde laut des Onlinevergleichsdiensts mit einem Anstieg der Grundversicherungsprämien von fünf Prozent einhergehen.
Zwischen 2020 und 2022 schwankten die Kosten im Gesundheitswesen stark. Dies könne nur zum Teil mit der Covid-Pandemie und dem veränderten Angebots- und Nachfrageverhalten erklärt werden, heisst es in der Mitteilung.
Comparis geht davon aus, dass sich diese Schwankungen wieder beruhigen werden und sich das Kostenwachstum der medizinischen Leistungen zu Lasten der Grundversicherung in den nächsten Jahren im Bereich von zwei, drei Prozent einpendeln wird. Schreibt Blick.
The neverending Story – Gib uns unsere tägliche Schocknachricht, o Herr! Denn unsere Qualitäts-Journalismus-Medien leben nun mal nur noch von schlechten Live-Ticker-Nachrichten. Urteilen Sie selbst: Wann haben Sie den letzten Artikel über Mutter Theresa gelesen? Genau, Sie sagen es! Das Gute interessiert niemanden.
Nur Dummköpfe*innen haben die Prämienerhöhung der Krankenkassen nicht erwartet! Unsere Pöstchenjäger*innen vom Hohen Haus von und zu Bern querbeet durch alle Parteien wollen nach der Pandemie auch wieder mal kräftig zugreifen.
Das Wahlkampfmotto vom Luzerner Ständerat und Pöstchenjäger Damian «ich bin nicht schwul» Müller lautete ja nicht umsonst: «Packt an. Setzt um!»
Oder wie es die Aargauer Schrumpfhaube und Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel in der Arena noch dämlicher als der Luzerner Schönling aus dem Solarium formulierte: «Man verdient sich keine goldene Nase mit Mandaten im Gesundheitsbereich.» Kommt bei der «Gesundheitsexpertin» aus dem Aargau vermutlich auf den jeweiligen Goldpreis an...

-
4.5.2022 - Tag der ukrainischen Muslime
Ukrainische Muslime blicken mit Bitterkeit nach Russland
Anstatt als Fest der Freude begehen die ukrainischen Muslime und Musliminnen das Ende des Fastenmonats Ramadan dieses Jahr in Trauer und Ungewissheit. Mit der großen nichtmuslimischen Mehrheit der Bevölkerung teilen sie nicht nur das Leben in einem grausamen Krieg, sondern auch ein prinzipielles Problem der Religionsgemeinschaften, allen voran der christlichen Orthodoxie: Mit Entsetzen schauen sie auf ihre Glaubensgenossen in Russland, die zumindest nach außen der Propaganda von Wladimir Putin und seinen Ideologen völlig verfallen sind.
Das bekannteste Gesicht der islamischen Gemeinschaft ist Scheich Said Ismagilow. Er ist Mufti der "Religionsverwaltung der Muslime der Ukraine" und hat sich zumindest formal gleich zu Kriegsbeginn den "Territorialen Verteidigungskräften" in Kiew angeschlossen und sich für seinen Facebook-Auftritt eine Uniform angelegt.
Der Tatar, der 1978 – also noch zu Sowjetzeiten – in Donezk geboren wurde, geht mit den islamischen Behörden in Russland hart ins Gericht: Sie sollten besser ihren Turban in den Mist werfen, denn sie hätten kein Recht, sich als religiöse Führer zu bezeichnen, wurde er von Middle East Eye zitiert. Damit meint er vor allem den Großmufti von Russland, Talgat Tajuddin, der wie andere muslimische Führer die russischen Muslime aufgefordert hat, sich dem Kampf gegen die Ukraine anzuschließen. Manche sprechen sogar von einem "Jihad".
"Kriminelle Macht"
Ismagilow wirft ihnen vor, "auf der Seite einer kriminellen Macht" zu stehen. In einem Statement scheint er auch Muslime von außerhalb der Ukraine ansprechen zu wollen: Es gebe eine "koranische Rechtfertigung" dafür, wenn Muslime in die Ukraine kämen, um dort die "russischen Invasoren" zu bekämpfen.
Das könnte vor allem bei Syrern auf Resonanz stoßen, die Russland das Überleben des syrischen Regimes von Bashar al-Assad ankreiden. Dass ein Teil von ihnen islamisch radikalisiert ist, ist ein anderes Problem. Das gilt teilweise auch für jene Tschetschenen, die als Gegner Russlands in andere Staaten geflohen sind. Aber auch in der Ukraine gibt es antirussische Tschetschenen und Dagestaner, die im Krieg kämpfen.
Im internationalen öffentlichen Bewusstsein werden als "muslimische Kämpfer" jedoch vor allem die "Kadyrowzy" wahrgenommen, das vom tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow geführte Regiment der russischen Nationalgarde.
Ihre Propagandavideos aus dem Ukraine-Krieg, die ihnen den Spitznamen "Tiktok-Bataillone" eingebracht haben, richten nach Meinung Ismagilows nicht nur unter den Muslimen in Russland, sondern in der gesamten islamischen Welt großen Schaden an. Muslimische Soldaten als pro-Putinistische Helden, die mit dem Handy den Krieg filmen, in denen ihnen selbst nichts passiert. Vor allem in den arabischen Staaten gibt es allein schon wegen der antiamerikanischen Ressentiments viele Putin-Fans. Muslime, die auf der russischen Seite kämpfen, drohen den russischen Krieg gegen die Ukraine bei Uninformierten zu legitimieren.
Zwei Millionen Muslime
Er wird ja generell als eine Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland wahrgenommen, beklagt Ismagilow laut dem "Religiösen Informationsdienst der Ukraine". Das treibt manchmal seltsame Blüten. Manche Araber im Nahen Osten meinen sogar, Putin werde, wenn er mit der Ukraine – und indirekt mit den USA – fertig sei, Gerechtigkeit für die Palästinenser schaffen: Sie ignorieren, dass sich Israel bis zu den jüngsten antisemitischen Ausfällen von Russlands Außenminister Sergei Lawrow weitgehend neutral verhalten hat.
Laut Ismagilow gibt es in der Ukraine etwa eine Million Muslime und Musliminnen. Die meisten Schätzungen setzen die Zahl niedriger an, auf etwa ein Prozent der ukrainischen Bevölkerung von gut 44 Millionen. Die größte Gruppe sind die Krimtataren, die 1944 Opfer der Deportationspolitik Stalins wurden. Viele von ihnen sind 2014 von der Halbinsel Krim in andere Teile der Ukraine geflohen, wo es alte tatarische Gemeinden gibt. Daneben gibt es zahlreiche andere kaukasische muslimische Volksgruppen.
Alteingesessene Religion
Der Islam ist in der Ukraine eine alteingesessene Religion. Die ersten schriftlichen Zeugnisse, die eine dauerhafte Präsenz belegen, stammen aus dem 11. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert etablierte sich der Islam auf der Krim als Staatsreligion. Die Ukraine brachte im 19. Jahrhundert auch einen Vordenker für einen aufgeklärten modernen Islam hervor, Ismail Hasprinskyj. Und im ehemals habsburgischen Lemberg ist ein islamisches Zentrum nach Muhammad Asad benannt, dem dort 1900 als österreichischen Juden geborenen Leopold Weiss. Schreibt DER STANDARD.
«Die Muslime» – ein Verallgemeinerungsbegriff, den es so gar nicht geben dürfte. Die Glaubensgemeinschaft der Muslime splittet sich in derart viele Gruppen und Untergruppen auf, dass einem fast schwindlig wird.
Da wären einmal die Sunniten (Saudi Arabien) auf der einen Seite und die Schiiten (Iran) auf der andern als die zwei grössten Strömungen. Doch auch diese beiden muslimischen Glaubensrichtungen splitten sich in unendlich viele verschiedene Richtungen auf.
Doch eine Begabung scheint sowohl auf die Sunniten wie auch auf die Schiiten zuzutreffen: Sie schaffen es immer wieder, sich an der Seite von Diktatoren und faschistoiden Mächten zu positionieren. Hängt möglicherweise mit der faschistoiden Grundhaltung des «einzig wahren Gottes» aller monotheistischen Religionen zusammen.
Auch für Hitler kämpften Hunderttausende Muslime im zweiten Weltkrieg. Freiwillig, wohlverstanden. Hier einte vor allem der gemeinsame Hass gegen die Juden das faschistoide Bündnis. Der Grossmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, war jedenfalls ein beliebter Gast auf dem Berghof.
Die ukrainischen Muslime scheinen bezüglich ihrer Positionierung für einmal eine Ausnahme zu sein. Wer will denn schon ausser den unsäglichen Putin-Verstehern mit einem durchgeknallten Diktator an einem sechs Meter langen Tisch sitzen? Nicht mal die ukrainischen Muslime. Das sollte Roger Köppel & Co. zu denken geben, die ja mit ihrem Minarett- und Burka-Verständnis nicht unbedingt zu den Islam-Verstehern zu zählen sind.
-
3.5.2022 - Tag der bundesrätlichen Überraschungen
Bundesrat Guy Parmelin: «Wenn kein Gas mehr kommt, haben wir eine kritische Situation»
Seit letzter Woche liefert Russland kein Gas mehr an Polen und Bulgarien. Im Gespräch mit SRF sagt Guy Parmelin, der verantwortliche Bundesrat für die wirtschaftliche Landesversorgung, welche Notfallpläne die Schweiz im Falle einer weiteren Eskalation im Gasstreit bereithält. Ein Stopp der russischen Gaslieferungen im Zuge der Ukrainekrise würde auch die Schweiz treffen. Im Interview gib Bundesrat Guy Parmelin Auskunft, was das bedeuten würde. Das Gespräch führte Reto Lipp.
SRF: Was würde es für die Schweiz bedeuten, wenn Russland den Gashahn für ganz Europa zudrehen würde?
Guy Parmelin: Ein Totalabbruch wäre sehr schwierig – nicht nur für die Schweiz, sondern für ganz Europa. Das ist klar. Wir in der Schweiz haben keinen Gasspeicher.
Müssten wir einen haben?
Es gab eine Studie dazu im Oberwallis. In der Schweiz gibt es noch kein Gasversorgungsgesetz. Heute sind es private Organisationen, die Gas auf dem Markt kaufen und an Unternehmen und Kunden in der Schweiz verteilen.
Kann der Staat diese Aufgabe privaten Firmen überlassen? Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt: Energiepolitik ist heute eine Frage der nationalen Sicherheit. Müsste der Bund nicht beispielsweise eine Anschubfinanzierung ins Auge fassen?
Die Situation ist klar: Die Schweiz ist wie andere Länder total abhängig von Öl- und Gas-Importen. Das ist ein Fakt. Natürlich wollen wir diese Abhängigkeit schon lange minimieren. Etwa mit alternativen Energiequellen, also Solarenergie und so weiter. Aber das braucht Zeit.
Wir könnten die Bevölkerung darum bitten, im Winter ein oder zwei Grad weniger zu heizen. Bereits ein Grad weniger würde den Gasverbrauch um fünf bis sieben Prozent senken. Am Ende bleibt die Möglichkeit einer Kontingentierung. Aber das muss man mit der Wirtschaft organisieren.
Das heisst, Sie antizipieren das?
Wir sind aktuell in engem Kontakt mit der Wirtschaft. Wir kooperieren sehr eng mit dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) von Kollegin Simonetta Sommaruga. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, um zu sehen, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber natürlich: Wenn kein Gas mehr kommt, haben wir eine kritische Situation, wie in Deutschland.
300’000 Haushalte heizen in der Schweiz mit Gas. Was sagen Sie diesen?
Wir arbeiten sehr intensiv, um die Situation zu organisieren. Wir sind nicht allein, das ist ein europäisches Problem. Der Handel mit den Nachbarländern ist nicht einseitig. Man muss das koordinieren.
Der deutsche Wirtschaftsminister fliegt in der Weltgeschichte herum und versucht, Öl und Gas zu sichern. Müssen Sie hoffen, dass Herr Habeck erfolgreich ist, damit wir das Gas über Deutschland beziehen können?
Wir müssen uns selber damit beschäftigen. Bundesratskollege Ueli Maurer war dazu auch in Katar. Ausserdem muss man klären, wie sich die Abhängigkeit so rasch wie möglich vermindern lässt.
Man spricht jetzt auch über Gas-Terminals. Braucht Basel zum Beispiel ein solches Terminal?
Auch das muss koordiniert sein, das ist ein europäisches Problem. Aber wir dürfen nicht vergessen: Am Ende versuchen wir auch wegen des Klimawandels, die Abhängigkeit von fossiler Energie zu minimieren. Parallel dazu arbeiten der Bundesrat und das Parlament an neuen Unterstützungsmassnahmen, um zum Beispiel Wärmepumpen statt Öl-Heizungen zu fördern. Aber das braucht Zeit. Schreibt SRF.
Man braucht ja nicht unbedingt hellseherische Fähigkeiten, um selber auf Parmelins Worst-Case-Szenario zu kommen. Allerdings muss die Frage schon erlaubt sein, weshalb unsere Politikerinnen und Politiker bei ihrem (wahltechnisch bedingten) Aktionismus bezüglich Abschaltung der Atom-Kraftwerke und der Hinwendung zu erneuerbaren Energien alle Eventualitäten und die daraus resultierender Folgen nicht schon im Vorfeld für die Zukunft durchgespielt haben?
Das erstaunt uns Laien umso mehr, da unsere politische Elite ansonst in Talkshows und sonstigen «Hundsverlocheten» auf jede Frage stets wie aus der Pistole geschossen eine Antwort in petto hat. Und sei sie noch so dumm.
Die Tatsache, dass die Schweiz keine Gas-Speicher betreibt, scheint all diesen klugen Menschen aus Politik und Wirtschaft entgangen zu sein. Nicht existent. Steht vermutlich auch nicht im Handbuch proaktiver Krisenbewältigung.
So wird wohl im kommenden Winter nichts anderes übrig bleiben, als die Wohnungen mit ein paar Grad Wärme weniger zu «begasen». Was sowieso schon lange sinnvoll gewesen wäre. Niemand braucht 23 Grad Wohntemperatur. 19 Grad würden auch genügen.
Damit liessen sich vermutlich ein paar Milliarden kWh/m³ Gas einsparen. Und weiss der Putin wie viele Tonnen Erdöl! Was nützt den Mieterinnen und Mietern eine überheizte Wohnung, wenn sie danach an den Nebenkosten ersticken?
Also nichts wie los und ein entsprechendes Gesetz im Hohen Haus von und zu Bern schnüren, statt die Jammertante aus dem Welschland zu spielen. Just do it.
-
2.5.2022 - Tag der Unbelehrbaren
Konflikt mit pro-russischen Separatisten befeuert: Putin zündelt jetzt auch in Bosnien und Herzegowina
In Bosnien und Herzegowina befeuert Wladimir Putin den Konflikt mit pro-russischen Separatisten. Der Westen ist alarmiert.
Moskau befindet sich nach wie vor im Krieg mit der Ukraine. Doch gleichzeitig befeuert der Kreml-Chef Wladimir Putin (69) auch in Bosnien und Herzegowina den Konflikt mit pro-russischen Separatisten.
Spitzenpolitiker Milorad Dodik (63) macht aus seiner Nähe zum russischen Präsidenten Putin kein Geheimnis. Es gilt als sicher, dass Moskau ihm bei seinen separatistischen Plänen hilft. Nun warnen westliche Beobachter: Der mühsam errungene Frieden sei in Gefahr.
Stoltenberg sieht Bosnien als mögliches Ziel weiterer russischer Interventionen
Einer, der Alarm schlug, war der demokratische US-Senator Christ Murphy (48). «Wenn Putin in die Enge getrieben wird, wird er sich nach anderen Orten umsehen, an denen er Siege erringen kann», sagte er den US-Fernsehsender CNN. Und: «Einer davon könnte Bosnien sein.» Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (63) warnte bereits im März davor, dass Bosnien ein mögliches Ziel weiterer russischer Interventionen werden könnte.
Bei dem Krieg zwischen den Volksgruppen in Bosnien kamen von 1992 bis 1995 etwa 100’000 Menschen ums Leben. Seither ist das Land in eine kroatisch-muslimische Föderation und eine serbische Entität, die Republika Srpska (RS), geteilt, deren Mehrheit sich dem «grossen Bruder» Russland äusserst nahe fühlt. Das ist auch ein Grund, weshalb sich Bosnien nicht den westlichen Sanktionen gegen Russland anschloss.
Nato-Interventionen als Provokation für Kreml
Über Jahrhunderte pflegte Russland tiefe brüderliche Beziehungen zu den Serben auf dem Balkan – wegen des gemeinsamen slawischen und orthodoxen Erbes sowie ihrer Bündnisse während der Weltkriege.
Die Intervention der Nato auf dem Balkan in den 1990er Jahren – zunächst in Bosnien, später dann gegen Serbien während des Kosovo-Krieges – empfand der Kreml als demütigende Provokation. Seitdem versucht Moskau, seinen Einfluss auf die bosnischen Serben zu vergrössern. Schreibt Blick.
«Der Balkan ist mir nicht die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert.» Sagte schon Otto Fürst von Bismarck über das «ewige» Pulverfass Europas. Die EU sieht das etwas anders und setzt in ihrem Machtstreben alles daran, die Staaten aus dem Balkan in die EU aufnehmen.
Na denn! Ein Prosit auf das trojanische Pferd und viel Glück mit einer unbelehrbaren Bevölkerung inmitten der «europäischen Wertegemeinschaft». Ungarn lässt grüssen!
Dass sich die Integration von Kultur und Mentalität aus dem Balkan über Generationen hinwegzieht, ist beispielsweise in der Schweiz trefflich zu beobachten. Eine Jahrzehnte lang andauernde «Mission Impossible». Davon legen die Kriminal-Statistiken der Schweizer Polizeikorps bezüglich zweiter Generation der hiesigen Zuzügler*innen aus dem Balkan ein erschreckendes Zeugnis ab.
-
1.5.2022 - Tag der Wunderwaffen
US-Satelliten im Visier: Nachrichtendienst warnt vor Putins Wunderwaffe
Die russische Armee könnte mit einem Laser amerikanische Satelliten attackieren. Das geht aus einer vertraulichen Analyse des NDB hervor.
Der Krieg läuft nicht so, wie es sich Wladimir Putin (69) ausgemalt hat. Längst ist der Überfall auf die Ukraine ins Stocken geraten. Vor Kiew wurde die russische Armee besiegt, westliche Beobachter gehen von hohen Verlusten aus. 15'000 russische Soldaten seien seit Beginn der Invasion gefallen, sagte britische Verteidigungsminister Ben Wallace (51) Anfang Woche im Unterhaus. Weiter hätten die ukrainischen Streitkräfte 2000 gepanzerte Fahrzeuge zerstört oder erbeutet und 60 russische Flugzeuge und Helikopter abgeschossen.
Auch im Donbass, im Osten der Ukraine, versuchen sich die russischen Truppen bislang ohne durchschlagenden Erfolg an einer Offensive. Der Militärexperte Phillips O’Brien (58), der an der schottischen Universität St. Andrews lehrt und früh auf Schwierigkeiten von Putins Armee hinwies, schrieb gestern auf Twitter, es habe den Anschein, dass sich die Schlacht um den Donbass zum Abnutzungskrieg entwickle. Dabei hätten die Russen wenig Aussicht auf einen grösseren Erfolg, so O’Brien.
Derweil bekräftigen die Amerikaner ihren Willen, die Ukrainer weiter mit Waffen zu versorgen. Sogar der deutsche Bundestag rang sich am Donnerstag mit grosser Mehrheit dazu durch, schweres Gerät nach Osten zu schicken.
Putin unbeirrt
Der Angreifer gibt sich unbeeindruckt und droht: «Wenn jemand noch erwägt, sich von aussen einzumischen, und wenn dies für Russland zu strategisch betrachtet inakzeptablen Bedrohungen führt, dann werden wir blitzartig Vergeltungsschläge durchführen. Wir haben alle dafür notwendigen Instrumente», sagte Putin am Mittwoch in der Duma. Nun spekulieren Beobachter, welche «Instrumente» er meint.
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) schreibt in einer vertraulichen Analyse, die Aussagen würden als erneute Drohung mit Nuklearwaffen verstanden. Möglich sei aber auch der Einsatz einer hoch modernen Waffe: «Eine weitere plausible Erklärung könnte allerdings sein, dass Putin damit den Einsatz des Lasers Peresvet gemeint hat», so der NDB in seinem Papier. Der Laser gehöre «zu den sechs sogenannten Wunderwaffen Putins», heisst es weiter. Ein Prestigeprojekt der Russen also, auf das sich der Autokrat im Kreml einiges einbildet.
Viel ist nicht über den Peresvet bekannt, der nach einem russischen Kampfmönch aus dem 14. Jahrhundert benannt ist. Seit Putin vor vier Jahren die Indienststellung moderner Laserwaffen verkündete, rätseln Experten über ihre Verwendung. Vermutet wird, sie könnten Drohnen und Satelliten beschädigen oder gar zerstören. Dass es einen derartigen Einsatz bereits gegeben hätte, ist allerdings nicht bekannt.
US-Satelliten gefährdet
In erster Linie dürfte Peresvet dazu verwendet werden, die Position von Einheiten zu verschleiern. Man gehe davon aus, schreibt der NDB, dass der Laser primär dazu dient, «die Entdeckung mobiler Einheiten der strategischen Raketentruppen im Feld mittels Satelliten des Gegners zu unterbinden».
Das ist nicht zuletzt deshalb gefährlich, weil damit plötzlich US-Satelliten ins Fadenkreuz der Russen geraten, deren Aufnahmen die USA dem ukrainischen Militär zur Verfügung stellen.
«Ob Peresvet Sensoren von Satelliten nur temporär blenden oder gar beschädigen kann, ist unklar», heisst es im Bericht. «Im letzteren Fall könnten damit die weltraumgestützten Einsatzmittel der USA, die zur Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland eingesetzt werden, ‹blitzschnell› beeinträchtigt bzw. beschädigt werden.»
Sollten die Russen mit Peresvet tatsächlich Satelliten attackieren, nähmen die Spannungen zwischen den beiden Staaten nochmals zu. Schreibt So-Blick.
Nun denn: Einmal mehr werden im Konjunktiv von scheinbaren Experten Vermutungen angestellt, für die es keine verifizierbare Beweise gibt. Die Durchschlagskraft der russischen Armee wurde vor Beginn des Ukraine-Kriegs von den gleichen «Experten» ebenfalls falsch eingeschätzt. Man gab der ukrainischen Armee gerade mal eine Durchhaltefrist von zwei bis drei Tagen.
Wie sehr diese selbsternannten «Experten» die russische Armee und deren Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg überschätzten, muss heute, mehr als zwei Monate nach Beginn der russischen Invasion, wohl kaum mehr belegt werden.
Und mal so nebenbei: Es gab in der europäischen Kriegsgeschichte schon einmal einen Diktator, der von einer «Wunderwaffe» faselte und prahlerisch den «Endsieg» in Aussicht stellte. Der Diktator hiess Adolf Hitler und aus dem «Endsieg» wurde ein Selbstmord 30 Meter unter der Erde in einem Bunker in Berlin.
Unter dem Kreml in Moskau soll es mehr als nur einen Bunker geben. Just do it, Vladimir. Damit ersparst Du Dir Den Haag!
-
30.4.2022 - Tag der ungeklärten Fragen rund um das menschliche Leben
Gibt es Leben auf dem Mars?
Im Gastblog geht der Physiker Manuel Scherf einer der größten Fragen der Menschheit nach.
Wer kennt sie nicht, die berühmten „canali“ des italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli. Seine Zeichnungen möglicher Mars-Kanäle inspirierten Percival Lovell, ebenfalls Astronom und Gründervater des nach ihm benannten Observatoriums. An der Wende zum 20. Jahrhundert popularisierte Lovell die These, es könne sich bei den vermeintlichen Kanälen um ein Bewässerungssystem handeln; ein verzweifelter Versuch etwa, einen trocknenden und sterbenden Planeten am Leben zu erhalten. Der Autor H.G. Wells nahm daran Anleihen und schuf 1898 mit „Krieg der Welten“ einen der größten Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Nur drei Jahre später verlautbarte Nikola Tesla in einem Interview, er hätte Radiosignale empfangen, womöglich ein Kommunikationsversuch vom Mars.
Bei den „canali“ handelte es sich schließlich um optische Illusionen und die Signale Teslas waren wohl ebenso keiner Kommunikation geschuldet. Doch Leben auf dem Mars wurde dadurch vorerst nicht zu Grabe getragen. Aufgrund der Evidenz sei es sogar vernünftig, lebende Organismen anzunehmen, schlussfolgerte die amerikanische National Academy of Sciences noch 1965 in einem Report, nur drei Monate bevor Mariner 4 als erste Raumsonde am roten Planeten vorbeifliegen sollte. Die Enttäuschung war schließlich groß, als man auf den Nahaufnahmen eine von Kratern übersäte Landschaft erkennen musste, die frappant an die Oberfläche des Mondes erinnerte. Auch fand man weder ein globales Magnetfeld vor, noch eine dichte Atmosphäre. Es schien naheliegend, dass Mars weder geologisch aktiv sein, noch eine nennenswerte Biosphäre besitzen konnte. Und so brachte die "New York Times" das neue Paradigma wenig später unter der Headline „The Dead Planet“ auf den Punkt: „Mars, it now appears, is a desolate world.“
Doch ist und war unser Nachbar tatsächlich solch eine „trostlose“ Welt? Kalt, trocken und ohne jegliche Spur von Leben? Oder war das Résumé der "New York Times" vor beinah 50 Jahren dann doch zu voreilig? Seit dem Erhalt jener ersten verschwommenen Bilder hat sich unser Wissen um ein Vielfaches vergrößert. Ein einfaches "Ja" oder "Nein" wird diesen Fragen aber nicht gerecht. Es lohnt sich also, wenn wir uns damit etwas genauer beschäftigen. Beginnen wir mit der Gegenwart.
Extreme Bedingungen in der Gegenwart
Der Mars besitzt heute weder ein globales Magnetfeld noch flüssiges Wasser an seiner Oberfläche. Dort ist es aufgrund der größeren Entfernung zur Sonne nämlich nicht nur wesentlich kälter als hier im warmen Österreich, der Luftdruck ist zusätzlich mit rund fünf bis sechs Millibar auch so gering, dass wir uns nahe am Tripelpunkt des Wassers befinden – jener Temperatur und Druckbereich, bei dem alle drei Phasen des Wassers im Gleichgewicht stehen. Im flüssigen Zustand kann es an der Oberfläche also zumeist nicht existieren, es sublimiert stattdessen direkt von den gefrorenen in den gasförmigen Aggregatzustand. Leben hätte es also aus unterschiedlichen Gründen schwierig: Aufgrund der Trockenheit und Kälte fehlt es an einem Lösungsmittel, aufgrund des fehlenden Magnetfeldes und des geringen Drucks können hochenergetische Teilchen beinah ohne Hindernis den Boden bombardieren.
Kann man Leben also ausschließen? Nicht wirklich. Beobachtungen und Experimente auf und über der Erde haben nämlich gezeigt, dass Extremophile – Lebewesen, die per Wortlaut das Extreme lieben – unter ähnlichen oder gar schwierigeren Bedingungen überdauern können. Bärtierchen zum Beispiel überleben ohne Wasser, bei hoher Strahlung, im Vakuum und überstanden 2007 sogar zwölf Tage im Weltraum auf der Außenhaut einer Rakete. In einer Studie aus dem Jahr 2011 konnten auch marsähnliche Bedingungen den kleinen Tierchen über einen Zeitraum von 40 Tagen erstaunlich wenig anhaben. Sie könnten auf der Oberfläche des Mars also zumindest kurzfristig überleben, bräuchten aber Wasser, um sich fortpflanzen zu können. Es handelt sich dabei also tatsächlich eher um „Überleben“ als um „Leben“.
Wasser und Leben auf dem Mars heute
Damit Leben auf dem Mars gedeihen kann, benötigen wir also flüssiges Wasser. Und tatsächlich berichteten Studien aus den Jahren 2018 und 2020 von der Entdeckung unterirdischer Seen am Südpol. Sollten diese existieren – und daran gibt es Zweifel, wie ein aktueller Forschungsbericht ausführlich belegen kann – dürften sie jedoch sehr hohe Salzkonzentrationen aufweisen. Somit wäre extremophiles Leben dort zwar nicht gänzlich unmöglich. Dass sich in solchen Seen ein belebtes Habitat über einen längeren Zeitraum ausbreiten und halten könnte, scheint aber unwahrscheinlich. Gefunden hat man derweilen jedenfalls weder Hinweise auf vergangenes noch auf gegenwärtiges Leben.
Doch dazu ein interessantes Detail am Rande: Seit den Viking-Missionen 1976 suchte keine einzige Mission dort explizit nach Leben. Beide Lander hatten jeweils vier Experimente an Board, um mikrobielle Spuren zu entdecken und eines davon testete sogar positiv auf mögliche Stoffwechselreaktionen. Da jedoch keiner der anderen Tests organisches Material nachweisen konnte, galten die Viking-Ergebnisse bestenfalls als nicht schlüssig. Jedoch kamen seit damals Erklärungen auf, um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Das von der Phoenix-Mission im Boden entdeckte Perchlorat zum Beispiel könnte beim Erhitzen organisches Material zerstören und somit zu einem falsch-negativen Resultat führen.
Besagte Experimente bleiben also weiterhin spannend und die Frage nach Leben auf unserem Nachbarplaneten bleibt vorerst offen.
Vergangene Spuren von Wasser?
Doch widmen wir uns nun der Vergangenheit. Denn es gibt verschiedenste Hinweise, dass es am Mars tatsächlich Wasser auf der Oberfläche gegeben haben könnte. So fanden Forscher Ablagerungen in verschiedenen Kratern, die auf einstiges Oberflächen- und planetenweites Grundwasservorkommen hindeuten. Einige Rover entdeckten mögliche Spuren von Sedimentierung und Aufnahmen unterschiedlicher Orbiter erbrachten Zeugnisse längst ausgetrockneter Flussläufe. Schließlich deuten Strukturen im Jezero-Krater auf eine einstige Küstenlinie hin, ein Grund warum Nasas Perseverence-Rover gerade dort zur erfolgreichen Landung ansetzte - und das wohl nicht zu Unrecht. So fand man dort tatsächlich Hinweise einer früheren Seenlandschaft.
Viele dieser Anzeichen eines vormals wasserreichen und habitablen Mars werden jedoch heftig diskutiert und stammen aus einer fernen Vergangenheit. Sie reichen rund 3,5 bis 4 Milliarden Jahre zurück in die Zeitperiode des sogenannten Noachian. Das darauffolgende Hesperian zeugt von einer Übergangsphase, in der Spuren von Wasser und Vulkanismus seltener werden. Schließlich weist das bis heute andauernde Amazonian kaum noch Spuren fluvialer oder geologischer Aktivität mehr auf. Was sich vor dem Noachian so alles abspielte, bleibt wiederum fast zur Gänze im Verborgenen. So sind aus den ersten 500 Millionen Jahren praktisch keinerlei Oberflächenstrukturen vorhanden. Man ist hier zumeist auf theoretische Überlegungen angewiesen.
Kraterzählen und Atmosphärendruck
Um nun aber tatsächlich Wasser an der Oberfläche des Mars zu erlauben, müssen drei Punkte gegeben sein: Es benötigt einen höheren Atmosphärendruck, Temperaturen über dem Gefrierpunkt und natürlich das Wasser selbst. Widmen wir uns zuerst der Atmosphäre.
Zwei verschiedene wissenschaftliche Ansätze kamen bei der Erhebung des Luftdrucks im Noachian zu vergleichbaren Ergebnissen. Eine Forschungsgruppe zählte und vermaß die Verteilung der Einschlagskrater an der Oberfläche des Mars. Denn die Distribution der Kratergrößen wird auch durch den Luftdruck bestimmt. Je höher dieser ist, desto größer muss ein Meteorit sein, um nicht in der Atmosphäre zu verglühen und so ergeben sich unterschiedliche Verteilungen für unterschiedliche Drücke. Damit errechneten sie eine obere Grenze von 1,1 Bar für den Zeitpunkt vor 3,9 Milliarden Jahren. Ein Ergebnis, das recht gut mit anderen Studien übereinstimmt, die allesamt mit der zweiten Methodik durchgeführt wurden: durch die Rekonstruktion verschiedener Isotopenverhältnisse in der Atmosphäre des Mars.
Isotopenverhältnisse als weiterer Hinweis
Nehmen wir zur Veranschaulichung das Edelgas Neon. Jedes Neon-Atom besitzt zehn Protonen in seinem Kern. Außerdem unterscheiden wir bei diesem Element zwei für unsere Studien relevante Isotope, die sich durch die Anzahl der Neutronen im Atomkern unterscheiden: 20Ne und 22Ne mit je zehn und zwölf Neutronen im Kern. Je leichter ein Isotop nun aber ist, desto eher kann es in den Weltraum entfliehen. Denn die Energie, die benötigt wird, um es aus dem Gravitationspotential des Planeten zu befreien, ist geringer als beim schwereren Verwandten. Im Laufe der Zeit sollte sich nun immer mehr 22Ne im Vergleich zu 20Ne in der Atmosphäre anreichern. Da wir das heutige Isotopenverhältnis kennen und meinen zu wissen, welches anfangs vorgeherrscht haben sollte, können wir also mittels Simulationen den Verlust des Edelgases über die Zeit bestimmen. Selbiges gilt für Argon, Stickstoff oder Wasserstoff.
In der Realität entwickelt sich diese Rechnerei zu einem relativ komplexen Problem. So gibt es verschiedenste Prozesse, die unterschiedliche Isotope ins Weltall entfliehen lassen. Meteoriten wiederum transportieren verschiedene Elemente zurück zum Planeten. Vulkanismus pumpt unfraktionierte Gase aus dem Inneren in die Atmosphäre und Interaktionen mit der Oberfläche lagern das eine Isotop besser ab als das andere. Auch sind die ursprünglichen Verhältnisse nicht immer ganz so klar, wie wir das gerne hätten.
Doch das Problem lässt sich unter realistischen Annahmen und innerhalb eines gewissen Fehlerbereiches lösen. Dementsprechend errechneten verschiedene Forschungsarbeiten maximale Druckbereiche für das frühe Noachian, die mit der Kraterzählung recht gut im Einklang stehen. Vor rund vier Milliarden Jahren besaß unser Nachbar also einen Atmosphärendruck, der am ehesten irgendwo zwischen einem halben und einem Bar lag.
Der Verlust der Atmosphäre
Verantwortlich für den höheren Druck war vorwiegend Kohlendioxid, das in den darauffolgenden Jahrmillionen wieder aus der Atmosphäre verschwinden musste. Um das CO2 daraus abzubauen, gibt es zwei Möglichkeiten und beide spielten wohl eine Rolle: Ablagerungen in den Boden und Flucht in das Weltall.
Von Beobachtungen verschiedener Orbiter erahnen wir mittlerweile, dass im Laufe der Zeit relativ wenig CO2 entweder in Form von Karbonatgestein, Staub oder über das Trockeneis an den Polen abgebaut wurde. Die genaue Menge bleibt derzeit unklar, sollte sich aber irgendwo zwischen einigen zehn Millibar und einem Bar befinden, wobei der wahrscheinlichste Wert wohl etwa in der Mitte liegen dürfte. Der Rest musste ins Weltall entschwinden.
Im Rahmen einer Studie, die vor kurzem zur Publikation akzeptiert wurde, untersuchten wir hier am Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit finnischen Kollegen unterschiedliche Prozesse, die Kohlendioxid vom Mars ins Weltall entfernt haben könnten. Addieren wir diese auf und berücksichtigen die Fraktionierung besagter Argon-Isotope, kommen wir seit dem Noachian auf einen Maximalwert von rund 0,5 Bar. Und erneut: Zusammen mit Karbonat-Ablagerungen und dem CO2-Eis an den Polen ergibt dies einmal mehr einen Luftdruck von rund einem Bar. Nicht schlecht, oder?
Das Problem mit dem Klima
Doch hier laufen wir in ein Problem. Der Mars befindet sich am äußeren Rand der sogenannten Habitablen Zone, jenem Bereich, in dem flüssiges Wasser an der Oberfläche eines Planeten theoretisch existieren könnte. Und da wir uns ebendort befinden, benötigt es große Mengen an Treibhausgasen, um das Klima auch tatsächlich über den Gefrierpunkt zu bringen. Was erschwerend hinzu kommt: Die Sonne hatte anfangs nur etwa 70 Prozent ihrer heutigen Leuchtkraft und so stand weniger Energie zur Verfügung, um die Gesteinsplaneten des Sonnensystems ausreichend zu erwärmen. Bis vor einiger Zeit war selbst flüssiges Wasser auf der Erde des frühen Hadaikums kaum zu erklären. Und das, obwohl wir der Sonne wesentlich näher sind. Ein Problem, das als das Faint-Young-Sun-Paradox eine gewisse Berühmtheit erlangte.
Im Falle unseres Heimatplaneten lösten 3D-Klimamodelle das Paradoxon. Und im Falle des Mars? Keinesfalls. Selbst ein Bar CO2 reicht nämlich nicht, um konstante Temperaturen über null Grad Celsius zu gewährleisten. Auch mit zusätzlichen Treibhausgasen gestaltet sich die Sache schwierig. Vieles deutet also darauf hin, dass es selbst im Noachian maximal kurze Phasen flüssigen Wassers an der Oberfläche geben konnte. Und selbst diese wurden wohl nur durch verstärkten Vulkanismus oder den Einschlag größerer Asteroiden ausgelöst. Beide Erklärungen könnten zum abrupten Schmelzen großer Eismengen geführt haben, die in nur wenigen 100 Jahren viele der heute anzutreffenden Formationen erklären könnten. Auch Erosion durch Gletscher vermag einige vermeintlich durch Wasser geformte Oberflächenstrukturen zu erklären. Gemeinsam mit vormals existierendem Grundwasser benötigt es also keinen warmen, lebensfreundlichen Mars, um das Aussehen unseres Nachbarplaneten zufriedenstellend zu beschreiben.
Und vor dem Noachian?
Doch wie sah es nun eigentlich im Prä-Noachian aus? Hätte es während der ersten 500 Millionen Jahre eine dichtere Atmosphäre geben können, die über einen längeren Zeitraum habitable Oberflächenbedingungen ermöglichte? Auch hier lautet unsere Antwort wohl Nein. Denn damals war die Einstrahlung der Sonne im Röntgen- und extrem-ultravioletten Bereich so intensiv, dass die geringe Gravitation des Mars nicht in der Lage gewesen wäre, den Verlust der Atmosphäre zu verhindern.
In einem Artikel, den wir kürzlich publizierten, zeigten wir, dass selbst der stärkste für den Mars angenommene Vulkanismus den Verlust des Kohlendioxids in das All nicht hätte kompensieren können. Erst als sich die relevante Strahlung der Sonne vor etwas mehr als vier Milliarden Jahren signifikant verringerte, konnten die damals noch aktiven Vulkane den Verlust kompensieren und den Aufbau einer CO2-Atmosphäre ermöglichen. Doch auch deren Schicksal war nach einigen weiteren 100 Millionen Jahren besiegelt. Denn nachdem sich der Vulkanismus im Hesperian signifikant verringerte, gewann die Einstrahlung der Sonne ein letztes Mal die Oberhand.
Noch ein interessantes Detail am Rande: Könnte man die Polkappen schmelzen, den Vulkanismus reanimieren und so größere Mengen an CO2 in die Atmosphäre pumpen, würde sich eine dichtere Gashülle bilden, die heutzutage tatsächlich stabil wäre. Wäre es also aufgrund der höheren Leuchtkraft der Sonne möglich, Temperaturen über dem Gefrierpunkt zu erreichen und flüssiges Wasser auf der Oberfläche des Mars zu erlauben? Wohl kaum. Zur Erzeugung eines ausreichend großen Treibhauseffektes würde das zur Verfügung stehende CO2 auch heute nicht genügen. Terraforming – die Umwandlung des Planeten in eine für Menschen lebensfreundliche Umgebung – könnte also schwierig werden.
Ein weiterer interessanter Nebenaspekt und ein sich langsam wandelndes Paradigma: Über Jahrzehnte manifestierte sich die vorherrschende Meinung, dass die Erde aufgrund ihrer Magnetosphäre seine dichte Gashülle schützen konnte und Mars eben nicht. Doch wir wissen mittlerweile, dass das mit ziemlicher Sicherheit nicht der Wahrheit entspricht. Unsere Stickstoffatmosphäre würde heute wohl problemlos überleben, auch wenn es das Magnetfeld der Erde nicht gäbe. Das frühe Magnetfeld des Mars hingegen konnte eine Erosion der Atmosphäre in den ersten 500 Millionen Jahren aber nicht verhindern. Selbst die Wichtigkeit einer Magnetosphäre zur Abwehr hochenergetischer Teilchen und als Schutz für das Leben ist nicht mehr ganz eindeutig. Viel Forschung wird nötig sein, um die tatsächliche Rolle eines globalen Magnetfeldes richtig einschätzen zu können.
Die Entstehung des Lebens
Es bleibt die Frage zu klären, ob der Ursprung des Lebens auf dem Mars nicht dennoch stattfinden hätte können.
Zwar weiß man nicht, wie viel Zeit es benötigen würde, um Leben entstehen zu lassen. Sollten die feuchten Phasen dafür schlicht zu kurz gewesen sein, wäre die Sache aussichtslos. Andererseits könnte eine in den letzten Jahren aufgekommene Theorie Grund zur Hoffnung geben. Sollten hydrothermale Quellen und das Vorhandensein von Feucht- und Trockenperioden essenziell für die Entstehung des Lebens sein, dann wäre Mars (im Gegensatz zu den Unterwasserozeanen der Eismonde) im Sonnensystem wohl das lohnendste Ziele, um nach Leben abseits der Erde zu suchen. Doch auch für eine Entstehung des Lebens an unterseeischen hydrothermalen Quellen gäbe es Hoffnung. Denn so befand sich zumindest in der Eridania-Region vor rund 3,8 Milliarden Jahren wohl nicht nur flüssiges Wasser, sondern auch ein hydrothermales System. Und dieses könnte durch den Zerfall radioaktiver Elemente sogar über Jahrmillionen aktiv gewesen sein.
Doch am Ende ging auch das Wasser
Und wohin verschwand nun eigentlich das ganze H2O? Dafür spielt uns einmal mehr das Vorhandensein verschiedener Isotope in die Hände. Auf der Erde besitzt beinah jedes zehntausendste Wasserstoffatom neben einem Proton auch ein Neutron in seinem Kern. Dieser schwere Wasserstoff, auch Deuterium oder kurz D genannt, ist somit rund doppelt so schwer wie das neutronenlose H und kann dementsprechend schwerer ins Weltall entfliehen. Und genau das beobachten wir auf dem Mars. Dort ist D in Relation rund siebenmal häufiger als in den Ozeanen der Erde zu finden, ein Indiz, dass einiges an Wasserstoff entkommen musste. Und dieses H wiederum kam von jenem H2O, das sich einst an der Oberfläche des Mars befand, wo es einen globalen, zumindest 137 Meter tiefen Ozean füllen hätte können.
Während sich der Wasserstoff also vom Planeten verabschiedete, verband sich ein Teil des O, des Sauerstoffs, mit dem Eisen im Boden, bildete Rost und sorgte dafür, dass unser Nachbar jene blutrote Farbe erhielt, die Jahrmilliarden später antike Hochkulturen dazu veranlassen sollten, ihn nach ihrem Gott des Krieges zu benennen: Nergal, Ares oder eben Mars.
Und hoffentlich klären sich nun, Jahrtausende später, dann auch bald jene anfangs gestellten Fragen. Noch sind wir zwar nicht ganz dort. „Trostlos“ ist Mars - entgegen der Schlagzeile der "New York Times" - jedenfalls nicht.
Manuel Scherf studierte Physik an der Universität Graz und arbeitet seit 2009 mit Unterbrechungen am Institut für Weltraumforschung. Er engagierte sich jahrelang im Rahmen verschiedener EU-Projekte (Europlanet, IMPEx) für die Verbesserung der Forschungsstruktur in den Weltraumwissenschaften und koordinierte das Europlanet Telescope Network, ein Netzwerk aus 16 kleineren europäischen Sternwarten. Zusätzlich forscht er seit einigen Jahren über die Entstehung und Evolution erdähnlicher Atmosphären und die Entwicklung von Habitabilität. Schreibt Manuel Scherf in DER STANDARD.
«Je mehr ich weiss, um so mehr weiss ich, dass ich nicht(s) weiss.» Dieses Zitat wird öfters Albert Einstein zugerechnet, doch es findet sich keine seriöse Quelle, die Einsteins Urheberschaft bestätigt. In abgewandelter Form findet man das Zitat bei Aristoteles. Oder beim Webmaster vom Artillerie-Verein Zofingen.
Die Urheberschaft eines Zitates spielt aber bei diesem langen und anspruchsvollen Artikel aus der Wissenschaft keine Rolle. Spannende Lektüre fürs Wochenende stellt er so oder so dar.
Eine zentrale Frage aber bleibt nebst vielen anderen fraglichen Textstellen: Wie definieren wir «Leben»? Da dürfte das Universum für uns noch viele Überraschungen bieten.
In diesem Sinne ein frohes Weekend.
-
29.4.2022 - Tag der Freiheit in Shanghai
Für zwölf Millionen Menschen endet der Lockdown in Schanghai
Etwa die Hälfte der Bevölkerung der seit Wochen unter einen strengen Lockdown gesetzten Millionenmetropole Shanghai darf nun die Häuser wieder verlassen. Wie die Regierung mitteilte, befinden sich die 12,38 Millionen Menschen jetzt in Gebieten mit einem geringeren Risiko. Rund die Hälfte der Bevölkerung Schanghais ist laut Regierungsangaben nur mehr einem geringen Risiko ausgesetzt.
Die Stadt stuft jede Wohneinheit in drei Risikostufen ein. Wenn seit 14 Tagen kein positiver Coronavirus-Fall aufgetreten ist, dürfen die Bewohner zu "angemessenen" Aktivitäten nach draußen gehen.
Reisebeschränkungen in Italien bleiben
Rom – Italien verlängert die geltenden Regeln für Reisen von und in Richtung Ausland bis zum 31. Mai. So müssen Reisende nach Italien weiterhin eine Impfbescheinigung oder einen negativen Schnelltest vorlegen. Die Pflicht zum Ausfüllen des Europäischen Formulars für Reisende fällt hingegen mit 1. Mai. Die Maskenpflicht wurde indes verlängert. Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza kündigte am Donnerstag an, dass bis zum 15. Juni in öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch in Kinos, Theatern oder Sporthallen Masken getragen werden müssen. Andernorts, etwa in Restaurants oder auf der Arbeitsstelle, fällt die Maskenpflicht dagegen am 1. Mai weg.
Nachdem der Notstand Ende März ausgelaufen war, wird Ende April auch der Grüne Pass, also der Nachweis von 2G oder 3G, komplett wegfallen. Besucherinnen und Besucher von Restaurants, Bars, Kinos, Konzerten, Diskotheken oder Geschäften müssen dann kein Zertifikat mehr vorweisen. Einzig Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen verlangen bis Jahresende den Grünen Pass.
Südafrika steht möglicherweise vor der fünften Coronawelle
Südafrika steht möglicherweise eine fünfte Covid-19-Infektionswelle bevor. Nach einem anhaltenden Anstieg der Infektionen in den letzten 14 Tagen sagte Gesundheitsminister Joe Phaahla am Freitag, dass Todesfälle ansteigen würden. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen blieben allerdings stabil. Noch hätten südafrikanische Gesundheitsbehörden keine neue Variante entdeckt.
Südafrika hatte bisher die meisten Covid-Infektionen und Todesfälle im afrikanischen Kontinent zu verzeichnen. So verzeichnete das Land bisher mehr als 3,7 Millionen bestätigte Fälle und über 100.000 Todesfällen im Zusammenhang mit der Pandemie. Schreibt DER STANDARD.
Die kommunistische Partei Chinas und ihr Zero-Covid-Präsident Yi Jinping können Konfuzius dankbar sein, dass es im Land des Lächelns keine Trychler gibt. In Shanghai wären Demonstrationen mit dem Ruf «Freiheit» tatsächlich angebracht. Dass sie in der Schweiz völlig fehl am Platz waren, zeigt das Beispiel Shanghai. Ob die Trychler daraus allerdings die notwendigen Schlüsse ziehen, darf bezweifelt werden.
-
28.4.2022 - Tag der Rufer in der Wüste
Der mit dem Bären tanzt
"In meiner 20-jährigen Russland-Erfahrung habe ich eines gelernt: Man soll nur auf einer Hochzeit tanzen. Daher sind wir Gazprom und unserer Zusammenarbeit verpflichtet und schauen nicht zur Seite."
Also sprach der damalige OMV-Chef Rainer Seele im Jahr 2018 in London. Der Deutsche Seele bekräftigte damit den totalen Schwenk des teilstaatlichen Mineralölkonzerns OMV in Richtung Russland und Gazprom. Der Film hieß ab dann nur: "Der mit dem Bären tanzt."
Seele wurde 2015 an die Spitze der OMV berufen, als der Industrielle Sigi Wolf, ebenfalls massiv mit russischen Interessen verbunden, Aufsichtsratspräsident der staatlichen Beteiligungsholding ÖIAG, heute Öbag, war. Seele machte die Diversifizierung seiner Vorgänger rückgängig und versuchte sogar, eine Beteiligung an der Nordsee-Gasförderung an die Gazprom zu verklopfen. Die norwegische Regierung verhinderte das.
Heute zittert Österreich um sein russisches Gas. Hat das niemand gesehen? Doch, Claus Raidl, einst Präsident der Nationalbank, hatte damals laut der Rechercheplattform Addendum gewarnt: "Der Expansionsdrang des Kremls ist die Fortsetzung historischer Interessen, die sowohl in der Sowjetunion als auch zur Zeit der russischen Zaren erkennbar waren. Wir Österreicher unterschätzen die Strategien, die dabei zur Anwendung kommen, und freuen uns, wenn einige Brösel abfallen." Schreibt Hans Rauscher in DER STANDARD.
Tja, es gab der Warnungen vor dem russischen Bären viele. Doch leider verhallten sie alle in der Wüste der gierigen Putin-Versteher. Nicht nur in Österreich. Auch die Schweiz kann ein Lied davon singen. Wie so viele andere Staaten in Europa.
Wie schwer sich der Westen mit der Aufarbeitung der Jahrzehnte langen Appeasement-Politik gegenüber Russland zu Gunsten billiger Energie tut, sieht man in Deutschland bei den ebenso unappetitlichen wie auch zögerlichen Diskussionen rund um ex-Bundeskanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder und Konsorten.
Man fragt sich manchmal, was der umtriebige russische Geheimdienst so alles in den Händen hält gegenüber der westlichen Polit-Elite. Vermutlich einiges.
-
27.4.2022 - Tag der Kondompleite
Russland-Sanktionen haben Folgen: Grösster Kondom-Hersteller Europas macht schlapp
Auch Kondome fallen unter die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs. Das hat Folgen für einen deutschen Pariser-Hersteller.
Jetzt hat der Ukraine-Krieg Auswirkungen aufs Sexleben im Schlafzimmer. Kondome werden knapp! Denn Europas grösster Pariser-Hersteller aus dem deutschen Sarstedt ist pleite. Das berichtet die «Wirtschaftswoche». Über 200 Millionen Gummis hat die Firma bisher produziert.
Damit ist nun Schluss. Einen Grossteil der Kondome hat die CPR GmbH nach Russland exportiert. Jeder Vierte Pariser wurde dort verkauft. Das wurde dem Unternehmen nun offenbar zum Verhängnis. Die 1987 gegründete Firma wird ein Opfer der Sanktionen gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin (69).
Flaute in deutschen Betten
Der deutsche Kondomhersteller ist eine der ersten Firmen in Europa, die wegen der Sanktionen schliessen muss. Nicht nur die Kondome verschwinden damit vom Markt. Auch die speziellen Maschinen, die zur Produktion der «Verhüterli» eingesetzt werden, werden nicht mehr hergestellt.
Mit ein Grund der Pleite ist aber auch der schleppende Verkauf in Deutschland. Kondome werden im stationären Handel weniger gehandelt. Selbst der anonyme Onlineverkauf gerät ins Stocken, schreibt die «Wirtschaftswoche». In deutschen Betten scheint Flaute zu herrschen. Schreibt unser aller Blick.
Wenn eine Firma nach nur knapp zwei Monaten Krieg und den entsprechenden Sanktionen gegen den Kriegsverursacher Russland schlapp macht und pleitegeht, war die Kondomherstellerin a) mit einem unverantwortlichen Klumpenrisiko gesegnet und b) vermutlich schon seit längerer Zeit finanziell im maroden Bereich.
-
26.4.2022 - Tag des Verhinderismus
So könnte Europa seinen Mangel an Hightech-Metallen lindern
Hätte, hätte, Lieferkette – wegen der Klimakrise müssen Energiewirtschaft und andere Industrien umgebaut werden. Doch die dafür nötigen Materialien sind knapp. Wiederverwertung soll das Problem lösen.
Windkraftanlagen, Batterien, E-Autos – wer die Technik zum Kampf gegen die Klimakrise bauen will, braucht nicht zuletzt die richtigen Rohstoffe. Eine neue Studie der Katholischen Universität im belgischen Löwen im Auftrag eines Branchenverbandes zeigt nun, dass der Europäischen Union mittelfristig Engpässe bei der Versorgung mit Materialien wie Lithium drohen könnten. Lösen ließen sich die Probleme auch mit Recycling.
»Elektrofahrzeuge, Batterien, Fotovoltaikanlagen, Windräder und Wasserstofftechnologien benötigen alle wesentlich mehr Metalle als ihre herkömmlichen Alternativen«, so die Autorinnen und Autoren der Studie »Metals for Clean Energy«. Die globale Energiewende schreite schneller voran als die Zahl der Bergbauprojekte zur Gewinnung der nötigen Metalle, heißt es in der Untersuchung. Bei Kupfer, Kobalt, Lithium, Nickel und sogenannten seltenen Erden könne es deshalb ab 2030 globale Versorgungsengpässe geben.
Lithium wird zum Beispiel aus Südamerika importiert, dort hofft man auf einen weiteren Ausbau der Förderung. Im Grundsatz ist das Element aber nicht selten und kommt in vielen Regionen der Erde vor, darunter auch in Europa. Doch bisher wird es hier kaum gefördert. Die EU habe nur ein kleines Zeitfenster, um ihre heimische Produktion voranzutreiben, heißt es nun in der Studie. Zum Beispiel will das australische Start-up Vulcan Energy Lithium im Oberrheintal fördern. Andere Projekte erforschen die Gewinnung aus Bergbauabwässern im Ruhrgebiet.
Recycling hilft auch, CO2 einzusparen
Von 2040 an könne dann ein großer Teil des europäischen Metallbedarfs auch durch Wiederverwertung gedeckt werden, so die Studie. »Recycling ist Europas größte Möglichkeit, seine langfristige Selbstversorgung zu verbessern, und könnte bis 2050 45 bis 65 Prozent des Bedarfs an Basismetallen in Europa decken«, heißt es. Bei sogenannten seltenen Erden und Lithium bestehe das Potenzial, Quoten von mehr als 75 Prozent zu erreichen.
Mit deutlichem Abstand am stärksten steigt der Bedarf der Untersuchung zufolge bei Lithium. Die globale Nachfrage nach dem Metall als Übergangsrohstoff werde bis 2050 voraussichtlich mehr als 2000 Prozent der weltweiten Gesamtnachfrage von 2020 betragen. Aber auch bei seltenen Erden wie Dysprosium (plus 433 Prozent) oder dem Schwermetall Kobalt (plus 403 Prozent) ist den Angaben zufolge mit einer deutlich höheren Nachfrage zu rechnen. Mit Blick auf Europa rechnen die Forscherinnen und Forscher damit, dass 35-mal mehr Lithium, 7- bis 26-mal mehr Seltenerdmetalle und 3,5-mal mehr Kobalt benötigt wird, um nachhaltig Energie zu erzeugen und die EU bis 2050 klimaneutral zu gestalten.
Interessant dabei: Beim Recycling von Metallen werden im Durchschnitt zwischen 35 und 95 Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich zur Primärproduktion einspart.
»Ohne eine baldige Versorgung mit neuen Primärmetallen und ein besseres Recycling drohen kritische Engpässe, die Europas Ziel eines autonomeren, sauberen Energiesystems gefährden«, teilte die Katholische Universität Löwen mit. Die Untersuchung schränkt jedoch ein, dass technologische Entwicklungen und Verhaltensänderungen die Lage ebenfalls noch beeinflussen können, in der Studie aber nicht berücksichtigt wurden.
In Auftrag gegeben wurde das Papier vom europäischen Verband Eurometaux, in dem sich Nichteisenmetallerzeuger und -recycler zusammengeschlossen haben. Schreibt DER SPIEGEL.
Natürlich könnte man durch intelligentes Recycling unendlich viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Doch die Rohstoffbörsen werden dies zu verhindern wissen.
-
25.4.2022 - Tag der korrumpierten Politelite Deutschlands
Vitali Klitschko attackiert alt-Kanzler Gerhard Schröder: «Zieh doch nach Moskau» und NRW-Ministerpräsident verlangt nach «New York Times»-Interview Schröders Rauswurf aus der SPD
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder für dessen Haltung im Krieg gegen die Ukraine scharf attackiert und Sanktionen gegen den 78-Jährigen gefordert. Der Altkanzler solle "doch nach Moskau" ziehen, so Klitschko.
Der ehemalige Box-Weltmeister sagte gegenüber der „BILD“-Zeitung: „Wenn Gerhard Schröder weiterhin Millionen vom Kreml als Kriegsverbrecher-Lobbyist kassiert, sollte darüber nachgedacht werden, ob Schröders Konten eingefroren und er zum Beispiel für die USA auf eine No-Fly-List gesetzt werden kann.“ Außerdem legte Klitschko dem Ex-Bundeskanzler einen Wohnortwechsel nahe: „Angesichts seiner Propaganda für den Kreml fragt man sich, warum Schröder in Hannover wohnt und nicht in Moskau. Wenn er weiter für Mörder arbeitet, kann man nur sagen: Zieh doch nach Moskau!“
Schröder wirbt um Verständnis für Putin: "Nur die halbe Wahrheit"
Der Altkanzler steht seit Ausbruch des Krieges wegen seiner freundschaftlichen Beziehung zu Wladimir Putin massiv unter Druck. Schröder, der auch Lobbyist für den russischen Energieriesen Gazprom ist, hatte zudem immer wieder mit Aussagen irritiert, in denen er die russische Seite verteidigt hatte. So hatte er gegenüber der „New York Times“ gesagt, die Kriegsverbrechen in Butscha müssten noch untersucht werden. Er gehe davon aus, dass der Befehl hierzu von „unteren Rängen gekommen“ sei, also nicht von Putin angeordnet wurde. Außerdem sagte Schröder, das Bild, das die Menschen vom russischen Präsidenten hätten, sei „nur die halbe Wahrheit“. Schreibt FOCUS.
Nach »New York Times«-Interview
NRW-Ministerpräsident verlangt nach «New York Times»-Interview Schröders Rauswurf aus der SPD.
Nach dem Interview des Altkanzlers mit der »New York Times« wächst der Druck auf Gerhard Schröder. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat von der SPD-Führung nun die Einleitung eines Parteiausschluss-Verfahrens gefordert. »Das Interview in der ›New York Times‹ ist schon ziemlich verstörend und es muss Folgen haben«, sagte Wüst am Sonntagabend bei Bild TV. Er nannte Schröders Verhalten »schamlos«.
Die gesamte SPD-Führung habe gesagt: »Wenn Gerhard Schröder an seinen gut bezahlten Mandaten bei Putin festhält, kann er nicht mehr Mitglied der SPD sein.« Jetzt sage Schröder, dass er genau das vorhabe. »Deshalb ist die SPD jetzt aufgerufen, ihren Worten Taten folgen zu lassen«, forderte Wüst.
Als Konsequenz aus dem Fall forderte der NRW-Regierungschef eine Neuregelung der Bezüge: »Wir sollten klar festlegen, dass es die Versorgung für die Altkanzler und auch ehemalige Bundespräsidenten nur geben kann, wenn man nicht noch von anderen Staaten Geld bekommt.«
Schröder hatte sich in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der »New York Times« gegen ein deutsches Embargo auf Energielieferungen aus Russland ausgesprochen. Gleichzeitig nannte er Russlands Angriffskrieg in der Ukraine einen »Fehler«.
Es handelte sich um das erste Interview Schröders seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor zwei Monaten. Der Altkanzler steht wegen seiner freundschaftlichen Beziehung zu Putin und seiner Rolle beim Gaspipeline-Unternehmen Nord Stream AG massiv in der Kritik, auch in der eigenen Partei. In dem Interview wies er Kritik pauschal zurück: »Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa«, so Schröder: »Das ist nicht mein Ding.«
In der SPD läuft ein Parteiordnungsverfahren gegen Schröder. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte Schröder zur Niederlegung seiner Ämter bei staatlichen russischen Energieunternehmen auf.
Scharfe Kritik auch von Fachleuten
Schröder äußerte sich in dem Interview nicht zu dieser Forderung. Er sagte lediglich, dass er »zurücktreten« würde, wenn Russland von sich aus seine Energielieferungen an Deutschland einstellt. Der Altkanzler ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und auch Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft.
Vor Wüst hatten sich bereits andere Unionspolitiker zu Wort gemeldet. Marco Wanderwitz etwa, früherer Ostbeauftragter der Bundesregierung, bezeichnet Schröder als »Bundeskanzler der Schande«: Er mache sich »sehenden Auges nochmals gemein mit dem russischen Kriegsverbrecher«.
Deutliche Kritik an Schröder äußerten auch Fachleute. Jan Behrends, ein auf Osteuropa spezialisierter Geschichtsprofessor an der Universität in Frankfurt/Oder, zeigte sich auf Twitter fassungslos darüber, dass die SPD »so jemand noch in ihren Reihen dulden« könne.
Und die Historikerin Franziska Davies von der Universität München schreibt, Schröder sei »größenwahnsinnig, narzisstisch, empathielos, korrumpiert, gierig – nichts Neues«.
Unterstützung erhielt Schröder aus dem rechten Lager. Seine Äußerungen seien vernünftig und im deutschen Interesse, twitterte etwa der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Reichhardt aus Sachsen-Anhalt. »Nüchterne Interessenpolitik« sei »das Gebot der Stunde«. Schreibt DER SPIEGEL.
Ein Trauerspiel um Korruption, Staatsversagen und Heuchelei sondergleichen. Die deutsche Elite aus Politik und Wirtschaft gibt sich alle Mühe auf dem Weg zum «failed State», wie mein Freund und ehemaliger Clariant-VR Dolf Stockhausen befürchtet.
In der Tat: Das orchestrierte Drama der gesamten deutschen Politelite im Zusammenhang mit dem zweit-widerwärtigsten Kanzler, den Deutschland mit Gerhard Schröder je an die Macht wählte, ist nicht nur unappetitlich, sondern auch billig und durchschaubar.
Dass Schröder unter Billigung des gesamten Deutschen Bundestags Deutschland schon während seiner Amtszeit an Russland verkaufte, ist nicht nur dem unter ihm eingefädelten Nordstream-Deal zuzuschreiben.
Der neben Hitler wohl korrupteste Kanzler der deutschen Geschichte bereicherte sich nicht nur selbst, sondern erliess Russland unter seiner Kanzlerschaft auch Schulden in Milliardenhöhe! Wozu er allerdings auch die Zustimmung der Opposition benötigte. Wie auch für den Nordstream-Deal.
Doch erst jetzt, da in deutschen Bundesländern wie NRW (!) Landtagswahlen stattfinden, erinnern sich die parteilichen Kontrahenten der korrupten Geschichten rund um Schröder. Querbeet durch alle Parteien wird an Wahlkampfveranstaltungen Aufklärung verlangt. Genau wissend, dass es niemals eine Aufklärung geben wird. Weil nämlich alle deutschen Parteien in die Korruption mit Putin verbandelt sind, kann es sie gar nie geben.
Dass «niemals so viel gelogen wird wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd», soll schon dem deutschen Kanzler Otto von Bismarck bekannt gewesen sein. Allerdings stammt das Zitat vermutlich nicht von ihm. Trifft aber auf die deutsche Polit- und Wirtschaftselite dennoch absolut zu.
-
24.4.2022 - Tag der Nachrichten, die niemand braucht
Seitensprung hat krasse Folgen: Ex-Tennis-Star schockiert mit Affäre-Geständnis
Pam Shriver, die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin, warnt vor Trainer-Athletinnen-Beziehungen. Die Amerikanerin hat erlebt, was das mit einem Menschen anstellen kann.
«Als ich neun Jahre alt war, habe ich begonnen, mit meinem Tennislehrer Don Candy (91†) zu arbeiten», erzählt Pam Shriver (59) gegenüber dem «Daily Telegraph». Eine Zusammenarbeit, die sich trotz grossen Erfolgen als verheerend entpuppt.
Der australische Trainer hatte seine Athletin an die Weltspitze geführt. Im Alter von 16 Jahren stand die Amerikanerin bereits im US-Open-Final (1978). Ihren ersten Grand-Slam-Sieg im Doppel realisierte Shriver drei Jahre später auf dem heiligen Rasen in Wimbledon. Zu diesem Zeitpunkt war Candy bereits mehr als «nur» ihr Coach. «Als ich 17 Jahre alt war, erzählte ich dem dazumal 50-jährigen Candy, dass ich mich in ihn verliebt habe», sagt die 22-fache Grand-Slam-Siegerin im Doppel.
Die Folgen der Affäre
Ihre Zuneigung wurde erwidert: «Ja, er und ich liessen uns auf eine lange und unangemessene Affäre ein. Ja, er hat seine Frau betrogen. Aber vieles an ihm war ehrlich und authentisch. Und ich habe ihn geliebt.» Sexuell missbraucht wurde Shriver nie, wie sie betont.
Trotzdem habe sie schwerwiegende Folgen davongetragen. «Die Beziehung hat meine Fähigkeit, normale Beziehungen einzugehen, beeinträchtigt und bestimmte Muster festgelegt, die immer wieder auftraten: meine anhaltende Anziehung zu älteren Männern und meine Schwierigkeiten zu verstehen, wie man gesunde Grenzen einhält», gibt die Ex-Tennisspielerin zu. Nach fünf Jahren ging die Affäre zu Ende.
«Erziehung» als Lösung?
Ihre Geschichte ein Einzelfall? Shriver glaubt nicht daran: «Ich denke, dass missbräuchliche Trainerbeziehungen im Sport insgesamt erschreckend häufig vorkommen», sagt sie und führt aus: «Jedes Mal, wenn ich von einer Spielerin höre, die mit ihrem Trainer zusammen ist, oder wenn ich sehe, wie ein männlicher Physiotherapeut im Fitnessstudio an einem weiblichen Körper arbeitet, läuten bei mir die Alarmglocken.»
Wie soll man dagegen vorgehen? Shriver präsentiert einen Lösungsansatz: «Ich denke, dass es möglich ist, junge Sportler zu erziehen, aber man muss wahrscheinlich schon vor der Pubertät damit anfangen: vielleicht mit elf, zwölf oder dreizehn Jahren. Wenn sie auf die grosse Tennistour kommen, sind viele Muster bereits festgelegt.» Auch die Trainer müssen geschult werden, ist sie sich sicher: «Es muss ganz klar gesagt werden, dass diese Art von Beziehungen nicht angemessen sind und dass diejenigen, die diese Grenze überschreiten, mit Konsequenzen rechnen müssen.» Schreibt SonntagsBlick.
Der Palmares der amerikanischen Tennisspielerin Pam Shriver hält sich im Gegensatz zu ihrem Alter von beachtlichen 59 Jahren in Grenzen. Es ist anzunehmen, dass nur die wenigsten SonntagsBlick-Leser*innen die Sportlerin kennen.
Aber es ist immer gut, wenn wir mit Nachrichten gefüttert werden, die über Dekaden zurückliegen und die eigentlich niemand braucht.
-
23.4.2022 - Tag der boulevardesken Umweltsünden
Patient in Londoner Spital war 505 Tage lang Corona-positiv
Rund 16 Monate lang soll eine infizierte Person in England positiv getestet haben. Das Virus kann bei immungeschwächten Langzeit-Patienten im Körper mutieren, warnen Virologen.
In Grossbritannien ist ein Corona-Patient über einen Rekordzeitraum von 16 Monaten ununterbrochen mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Bei dem oder der Betroffenen seien 505 Tage lang bis zum Tod alle Tests positiv ausgefallen, berichtete ein britisches Forscherteam in einer neuen Studie, die am Samstag auf dem Europäischen Kongress für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten in Lissabon vorgestellt werden soll. Der bisherige Rekord lag bei 335 Tagen.
Wird der Rekord erneut gebrochen?
Für ihre Studie untersuchten Forscher vom King’s College London und des Londoner Krankenhauses Guy’s and St Thomas' zwischen März 2020 und Dezember 2021 die Fälle von neun Patienten, deren Immunsystem aufgrund von Organtransplantationen, HIV, Krebs oder anderen medikamentösen Behandlungen geschwächt war. Alle waren mindestens acht Wochen lang positiv, zwei sogar über ein Jahr.
Fünf der neun Patienten überlebten, zwei davon nach einer Antikörper- und antiviralen Therapie. Die fünfte Person war bei der letzten Nachuntersuchung Anfang 2022 immer noch infiziert und hatte somit 412 Tage lang Covid-19. Sollte sie bei ihrem nächsten Termin immer noch positiv getestet werden, würde sie laut den Forschern den Rekord von 505 Tagen überschreiten.
Virus mutierte im Körper der Infizierten
Das Team stellte fest, dass sich das Virus der neun Corona-Patienten in London im Laufe der Zeit veränderte. Fünf von ihnen entwickelten mindestens eine Mutante. Bei einem Patienten entdeckten sie zehn Mutationen, wie sie getrennt bei den Alpha-, Delta- und Omikron-Varianten auftraten. Die Forscher vermuten nun, dass immungeschwächte Patienten im Laufe ihrer anhaltenden Infektion Mutationen akkumulierten und dadurch neue Varianten entstehen können.
Die Situation zeige den dringenden Bedarf an neuen Corona-Behandlungen für immungeschwächte Patienten, sagte die Virologin und Mitautorin der Studie, Gaia Nebbia, am Freitag der Nachrichtenagentur «AFP». «Immunsupprimierte Patienten mit einer anhaltenden Infektion haben nur geringe Überlebenschancen, und neue Behandlungsstrategien sind dringend erforderlich, um ihre Infektion zu beenden.» Schreibt 20Minuten.
Jetzt einmal Hand aufs Herz: Braucht jemand diesen Artikel aus dem Haus Tamedia? Nachdem die Live-Ticker-Formate aus den zwei Jahren der Corona-Pandemie bei den meisten Online-Medienportalen in der Versenkung verschwunden sind, bemüht 20Minuten die Vergangenheit aus den Corona-Zeiten. Qualitätsjournalismus sieht anders aus.
Nur gut, dass die Schweizer Bürgerinnen und Bürger die Mediengelder aus der Bundes-Giesskanne an der Urne abgelehnt haben.
Jetzt müsste Tamedia nur noch die Papierausgabe von 20Minuten endlich einstellen. Die täglich ausgelieferten Gratisblättchen bleiben in den Bahnhofboxen liegen wie Blei in den Regalen.
Die Umwelt würde es den Verantwortlichen von Tamedia danken. Kein einziger Baum hat es verdient, für das Papier dieses Boulevard-Bullshits abgeholzt zu werden.
-
22.4.2022 - Tag der Freundschaftsbriefe
Nordkorea: Kim dankt scheidendem Moon für Bemühungen
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat in einem Briefwechsel dem scheidenden südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in für seine Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen gedankt. "Kim Jong-un würdigte die Mühen und Anstrengungen, die Moon Jae-in bis zu den letzten Tagen seiner Amtszeit für die große Aufgabe der Nation unternommen hat", berichtet die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Der Briefwechsel sei ein "Ausdruck ihres tiefen Vertrauens".
Freundschaftsbriefe
Moons Büro bestätigte, dass er "Freundschaftsbriefe" mit Kim ausgetauscht habe. Moon schickte nach Angaben der KCNA zufolge am Mittwoch einen Brief und versprach darin, trotz der "schwierigen Situation" weiterhin zu versuchen, eine Grundlage für die Wiedervereinigung zu schaffen, die auf gemeinsamen Erklärungen bei Gipfeltreffen im Jahr 2018 beruht. In Kims Antwort am Donnerstag hieß es, dass ihre "historischen" Gipfeltreffen den Menschen "Hoffnung für die Zukunft" gegeben hätten. Beide seien sich einig, dass sich die Beziehungen entwickeln würden, wenn beide Seiten "unermüdliche Anstrengungen mit Hoffnung unternehmen".
Der Briefwechsel erfolgte vor dem Hintergrund der seit 2019 verschärften Spannungen nach dem gescheiterten Gipfel zwischen Nordkorea und den USA und der ungewöhnlich vielen Raketentests immer leistungsfähigerer Flugkörper in diesem Jahr. Nordkorea sind Tests von Raketen und Atomwaffen nach einer Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen untersagt. Gespräche über einen Friedensprozess zwischen den beiden koreanischen Staaten und Verhandlungen mit den USA über eine atomare Abrüstung Nordkoreas liegen seit längerem auf Eis.
Neuer Präsident Südkoreas
Die Amtszeit von Südkoreas Präsident Moon endet im Mai. Bei den Wahlen im März konnte sich Oppositionspolitiker Yoon Suk-yeol zum Nachfolger küren. Er hatte eine härtere Gangart im Atomkonflikt mit Nordkorea angekündigt. Schreibt DER STANDARD.
Womit endlich geklärt ist, warum der Dicke aus Nordkorea in letzter Zeit wieder ein paar Raketen in den Himmel schoss: Das sind gar keine Drohgebärden, sondern Freundschaftsgrüsse. Knackige «Mon Chéri»-Pralinen mit köstlichem Kirschlikör kann er seinem Gegenüber in Südkorea infolge der westlichen Sanktionen ja keine schicken.
-
21.4.2022 - Der Tagvon Hopfen und Malz
Auswirkung des Ukraine-Krieges: Inflation gefährdet Bier-Produktion
Ein Feierabend-Bier nach des Tages Mühsal gehört für viele dazu. Aber auch das so mehrheitsfähige Gebräu, beziehungsweise deren Brauer, erleben die wirtschaftlichen Auswirkungen von Krieg und Pandemie: Die Rohstoff- und Energiepreise gehen durch die Decke, das Verpackungsmaterial wird teurer.
Steigende Rohstoff-, Energie- und Verpackungsmaterialpreise: All das sind Paradebeispiele für Teuerungen. Es bleibt nur eine Frage der Zeit, bis die Inflation auch bei den Bier-Konsumentinnen und -Konsumenten ankommt.
Glas-Beschaffung als Herausforderung
Die Beschaffung für Glasbehälter ist für Schweizer Traditionsunternehmen aktuell eine Herausforderung, so auch für die Brauerei Locher in Appenzell. Geschäftsführer Aurèle Meyer sagt gegenüber SRF News: «Im Moment bekommen wir noch Flaschen, wenn auch zu überhöhten Preisen. Aber immerhin bekommen wir noch welche. Man lebt einfach mit der latenten Angst, dass irgendwann die Lieferung ausbleibt.»
Damit das nicht passiert, hat Meyer zusätzliche Glasvorräte angelegt – auf dem Parkplatz vor der Brauerei. Das sei die eiserne Notreserve. Was in den Hallen keinen Platz hätte, würde auf den Parkplatz kommen. Damit hätte die Brauerei möglichst viel Puffer.
Höhere Preise für Gerste und Energie
Die Brauerei Locher setzt beim Rohstoff fürs Bier auf Schweizer Lieferanten. Wenn der Preis für Gerste auf dem Weltmarkt aber steigt, könnten auch die Preise in der Schweiz anziehen.
Die Energiepreise machen dem Geschäftsführer aber mehr Sorgen, denn die Gaskosten seien 250 Prozent höher als im Vorjahr. Auf die Kunden möchte er das zwar nicht abwählzen, aber wenn sich die Preissteigerung doch längerfristig festsetze, käme die Brauerei nicht darum herum, die Preise auch irgendwann an den Konsumenten weiterzugeben.
Letztlich sind auch die Mitarbeitenden der Locher Brauerei Konsumentinnen und Konsumenten. Geschäftsführer Meyer hat ihnen für das kommende Jahr an die Teuerung angepasste Löhne in Aussicht gestellt. Damit bleibt ihre Kaufkraft trotz höherer Preise erhalten. Schreibt SRF.
Nun denn: Die Tragödie hält sich in Grenzen. Noch sind Hopfen und Malz nicht verloren. Ein Bier weniger pro Tag und die Sache ist geschluckt.
-
20.4.2020 - Tag der russischen Idioten und Speichellecker
Russischer Oligarch Tinkow prangert «Massaker» in der Ukraine an
Oleg Tinkow ist einer der russischen Oligarchen, die wegen des Angriffskriegs mit Sanktionen belegt wurden. Nur eine Minderheit unterstütze die Invasion, sagte er nun. »Aber zehn Prozent jedes Landes sind Idioten.«
Der russische Milliardär Oleg Tinkow hat der russischen Armee vorgeworfen, »Massaker« in der Ukraine zu verüben. In einer Instagram-Botschaft forderte Tinkow ein Ende des »irrsinnigen Krieges« gegen das Nachbarland. »90 Prozent der Russen sind gegen diesen Krieg«, schrieb der im Ausland lebende Gründer der Tinkoff-Bank. Nur eine Minderheit unterstütze den Krieg. »Aber zehn Prozent jedes Landes sind Idioten.«
Tinkow gehört zu jenen russischen Oligarchen, die wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine mit westlichen Sanktionen belegt wurden. In seinem Instagram-Post ging er nun hart mit der russischen Armee und dem Führungszirkel um Kremlchef Wladimir Putin ins Gericht.
Die russischen Generäle hätten inzwischen erkannt, »dass sie eine Scheißarmee haben«, schrieb Tinkow. »Und wie sollte die Armee auch gut sein, wenn der ganze Rest des Landes beschissen ist und beschmutzt ist von Vetternwirtschaft, Speichelleckerei und Unterwürfigkeit?« Er selbst sehe »keinen einzigen Profiteur dieses irrsinnigen Krieges«, der nur dazu führe, dass »unschuldige Menschen und Soldaten sterben«.
Auf Englisch richtete sich Tinkow an den Westen: »Bitte zeigen Sie Herrn Putin einen klaren Ausweg, mit dem er sein Gesicht wahren kann und durch den dieses Massaker gestoppt wird. Bitte seien Sie rationaler und menschenfreundlicher.«
Laut Tinkow herrscht in der russischen Elite Unmut über die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Moskau. Kremlbeamte seien »schockiert« angesichts der Tatsache, dass sie und ihre Kinder nicht mehr ihren Sommerurlaub am Mittelmeer verbringen könnten. »Unternehmer versuchen, das zu retten, was von ihrem Eigentum noch übrig ist«, schrieb Tinkow.
So reagiert die Tinkoff-Bank
Die Tinkoff-Bank erklärte, sie werde die »private Meinung« Tinkows nicht kommentieren. Der Unternehmensgründer sei kein Mitarbeiter der Bank mehr und schon lange nicht mehr in Russland gewesen. Überdies habe er »in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen« zu tun gehabt.
Die russischen Behörden gehen massiv gegen Kritiker der Ukraine-Invasion vor. Auf Äußerungen, die von der Regierung als »Falschnachrichten« über die Armee eingestuft werden, stehen bis zu 15 Jahre Haft. Schreibt DER SPIEGEL.
Abgesehen davon, dass Tinkow selber zu den «10 Prozent Idioten» gehört, die er in allen Ländern gesichtet haben will, liegt er mit der Prozentzahl vermutlich weit daneben. Jedenfalls was Russland anbetrifft.
Peinlich wird das Posting des russischen Oligarchen aber mit der Aussage, dass Kremlbeamte schockiert sind über die Tatsache, ihren Sommerurlaub mit den Kindern nicht mehr am Mittelmeer verbringen zu können. Weitere 10 bis 20 Prozent russische Idioten, für die Tinkow Mitleid empfindet?
Die Ukrainerinnen und Ukrainer wären vermutlich froh, solche Sorgen wie die russischen Sesselkleber vom Kreml zu haben.
Die Bitte des ehemaligen Speichelleckers von Putin an den Westen, mit dem Neo-Zaren Russlands möglichst nett umzugehen um zum «business as usual» zurückkehren zu können, ist wohl ebenfalls nichts anderes als Wasser auf die eigene Mühle. Die westlichen Sanktionen scheinen Tinkow zu schmerzen. Einmal Oligarch, immer Oligarch.
-
19.4.2022 - Tag der Suchtkranken
Treibt Putins Krieg die Rohstoffpreise in die Höhe?
Noch hat der Ukraine-Krieg nicht in großem Maßstab zu Unterbrechungen der Versorgung mit Öl, Gas oder anderen wichtigen Rohstoffen geführt. Die Gründe für die hohen Kosten liegen woanders. Daniel Gros vom Centre for European Policy Studies schreibt in seinem Gastkommentar darüber, welche Gründe er für die hohen Energiepreise ausmacht.
Rohstoffpreise in astronomischer Höhe sorgen weltweit für Verunsicherung. Die Inflation hat sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa sieben Prozent und damit ein Niveau erreicht, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Die europäischen Verbraucher sehen sich mit vergleichbaren Kaufkraftverlusten konfrontiert, wie nach den Ölschocks der 1970er-Jahre. Die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie droht nun ins Stocken zu geraten, und das Gespenst der Stagflation geht um in den Industrieländern von der Europäischen Union bis Japan.
Man könnte annehmen, dass der Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine die Hauptursache für den Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise ist. Schließlich ist Russland der weltweit größte Exporteur von Erdöl und Erdölerzeugnissen und produziert, zusammen mit der Ukraine, ein Drittel der weltweiten Weizen- und Gerstenexporte. Es gibt jedoch zwei triftige Gründe, an dieser Erklärung zu zweifeln.
Erstens hat der Krieg nicht in großem Maßstab zu Unterbrechungen der Versorgung mit Öl, Gas oder anderen wichtigen Rohstoffen geführt – zumindest noch nicht. Natürlich kann die bloße Erwartung der Märkte, dass eine Verknappung unmittelbar bevorsteht, ausreichen, um die Preise in die Höhe zu treiben. Doch eine solche Erwartung scheint bisher kaum begründet zu sein.
Russlands Drohung
Ja, die Weizenlieferungen aus der Ukraine wurden gestoppt, und die diesjährige Ernte ist in Frage gestellt, weil die ukrainischen Landwirte ihre Felder nicht bestellen können. Aber die Ukraine produziert nur etwa drei Prozent des weltweiten Weizens. Russland hingegen produziert elf Prozent, und sowohl die Produktion als auch die Ausfuhren werden nach wie vor aufrechterhalten.
Außerdem hat Russland zwar gedroht, die Gaslieferungen an "unfreundliche Staaten" einzustellen, wenn diese nicht in Rubel zahlen – ein Ultimatum, das Europa bisher abgelehnt hat –, aber es gibt kaum Anzeichen dafür, dass russisches Öl oder andere Rohstoffe vom Markt genommen werden. Bei den meisten Rohstoffen dürfte der Krieg das Angebot nicht beeinträchtigen.
Ein zweiter Grund zu bezweifeln, dass der Krieg für die heutigen hohen Rohstoffpreise verantwortlich ist, besteht darin, dass der größte Teil des Preisanstiegs vor der Invasion stattfand. Der Rohstoffpreisindex des Internationalen Währungsfonds liegt nach wie vor unter seinem Höchststand von 2008 und bewegt sich in der Nähe des Niveaus von 2012/13. Und die Spotmarktpreise für Gas entsprechen ihrem "Vorkriegsniveau" von Ende letzten Jahres, als nur wenige mit einer großangelegten Invasion der Ukraine rechneten.
"Wenn der Krieg für die hohen Preise verantwortlich ist, wäre es politisch schwierig, Preisobergrenzen und großzügige Entschädigungen abzulehnen, um Verbrauchern und Unternehmen zu helfen, damit zurechtzukommen."
Die Ölpreise sind zwar seit Kriegsbeginn gestiegen, aber nur um moderate 20 Prozent. Obwohl die Erdgaspreise mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, da sie sich direkt auf die Heizkosten der Haushalte auswirken, sind die Ölpreise für Europa viel wichtiger, da der Wert seiner Ölimporte traditionell etwa fünfmal höher ist.
Wenn nicht der Krieg in der Ukraine für die hohen Energie- und Rohstoffpreise verantwortlich ist, was dann? Ein Faktor könnte das sein, was Ökonomen den "Schweinezyklus" nennen. Der Begriff geht auf ein Phänomen zurück, das in der dänischen Schweineindustrie beobachtet wurde: Wenn die Preise hoch waren, züchteten die Landwirte mehr Tiere, was zu einem Überangebot führte, das im folgenden Jahr die Preise senkte, so dass die Landwirte weniger Tiere züchteten, die dann zu höheren Preisen verkauft wurden.
Gleichermaßen besteht bei hohen Rohstoffpreisen ein größerer Anreiz, in Exploration und Abbau zu investieren. Wenn die Preise jedoch relativ niedrig sind – wie in den letzten Jahren – sinkt die Rentabilität solcher Investitionen, was zu einer geringeren Produktion und höheren Preisen in späteren Jahren führt. Und in der Tat hat die Internationale Energieagentur überzeugende Beweise dafür geliefert, dass jahrelange Unterinvestitionen in die Exploration die Produktionskapazität verringert haben.
Nicht genügend Reservekapazitäten
Der Nachfragerückgang im Jahr 2020, der durch die Covid-19-Rezession verursacht wurde, überdeckte diese Entwicklung. Doch als in Europa, Asien und in den USA eine kräftige Erholung einsetzte, gab es nicht genügend Reservekapazitäten, um die steigende Nachfrage zu decken. Dies führte zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise im Jahr 2021.
Ein weiterer Faktor, der zu den hohen Energie- und Rohstoffpreisen beigetragen haben könnte, sind steigende Investitionen in die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), die Anleger zunehmend veranlasst haben, eine Finanzierung der Exploration und Erschließung fossiler Brennstoffe abzulehnen. Sie hoffen, dass die Verweigerung von Kapital für die fossile Brennstoffindustrie die Produktion eindämmen und den Fortschritt hin zu einer grünen, kohlenstoffneutralen Wirtschaft ankurbeln wird.
Dieses Phänomen ist schwerpunktmäßig in westlichen Ländern zu finden. Während die Upstream-Investitionen der großen westlichen Öl- und Gasunternehmen zwischen 2015 und 2020 um fast die Hälfte zurückgingen, blieben diese Investitionen bei den Produzenten im Nahen Osten stabil und stiegen in China. Alle diese Produzenten haben die gleichen Preisanreize, aber die westlichen Unternehmen sind diejenigen, die den ESG-Richtlinien unterliegen.
Es ist notwendig zu verstehen, warum die Preise hoch sind, um die richtige politische Antwort zu entwickeln. Wenn der Krieg für die hohen Preise verantwortlich ist, wäre es politisch schwierig, Preisobergrenzen und großzügige Entschädigungen abzulehnen, um Verbrauchern und Unternehmen zu helfen, damit zurechtzukommen. Zudem könnte man hoffen, dass die Preise nach Beendigung des Krieges sinken werden.
Unbequeme Erklärung
Sind die hohen Rohstoffpreise jedoch das Ergebnis eines Schweinezyklus und der gestiegenen Verantwortung in Bezug auf ESG-Kriterien, senden sie ein angemessenes Signal an die Märkte; tatsächlich sollen die ESG-Regeln zu höheren Preisen führen. In diesem Fall muss sich die Wirtschaft an einen neuen Grad der Verknappung anpassen – und die Verbraucher sollten nicht für ihre verlorene Kaufkraft entschädigt werden.
Natürlich schließen sich diese Erklärungen nicht gegenseitig aus; alle drei Faktoren – der Schweinezyklus, die ESG-Standards und der Krieg – tragen wahrscheinlich zu höheren Rohstoffpreisen bei. Die Preistrends vor der Invasion deuten jedoch darauf hin, dass der Krieg ein untergeordneter Faktor ist.
Politisch ist diese Erklärung eher unbequem: Wenn der Krieg schuld ist, entbindet er Verbraucher und Staat von der Verantwortung, sich anzupassen, wobei Erstere eine Entschädigung erhalten und Letztere höhere Haushaltsdefizite aufweisen. Es ist allerdings die wirtschaftlich gesündere Erklärung und damit diejenige, die eine verantwortungsvolle politische Reaktion diktieren sollte, trotz der Schmerzen, die die Anpassung mit sich bringen könnte. Schreibt Daniel Gros vom Centre for European Policy Studies in seinem Gastkommentar im DER STANDARD.
So ist es! Alles hängt mit allem zusammen. Und am Schluss gelangen wir zum «Schweinezyklus», den Zyniker wohl etwas anders umschreiben würden, obschon die sachliche Erklärung von Daniel Gros zutrifft: Zu viele Schweine am Futtertrog fressen sich den Bauch voll. Die nimmersatten und dank ungezügeltem, politisch gewolltem Deregulierungswahn mit Narrenfreiheit gesegneten Rohstoffbörsen lassen grüssen.
Hallo Zug! Geht's Euch allen gut?
Um Ihnen den Start in die kurze Woche nach Ostern nicht ganz zu «versauen»: Es gibt auch hoffnungsvolle Erkenntnisse. Je schneller der Entzug von Öl und Gas vorangeht, umso besser für Klima und Wirtschaft.
Aber wie das mit Suchtkranken halt so ist: Sie halten an ihren Gewohnheiten fest, bis gar nichts mehr geht. Oder, wie aktuell geschehen, die Preise durch die Decke gehen.
-
18.4.2022 - Täter-Opfer-Umkehr bei der deutschen SPD
Melnyk legt sich jetzt auch mit Steinmeiers Nachfolger Gabriel an
Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) verteidigte seinen Amtsvorgänger und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gegen die harte Kritik des ukrainischen Botschafters. Die Reaktion Andrij Melnyks ließ nicht lange auf sich warten.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) habe als früherer Außenminister (2013-2017) gemeinsam mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „mehr als alle anderen in Europa“ dafür getan, die Ukraine zu unterstützen, schrieb Sigmar Gabriel (Bundesaußenminister von 2017-2018) in einem Gastbeitrag für den „Spiegel“ und griff dabei den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk scharf an.
Botschafter Melnyk hatte Steinmeier in einem Interview im „Tagesspiegel“ unter anderem vorgeworfen, „seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft“ zu haben. „Spinnennetze dienen bekanntlich dem Fang und der anschließenden Verwertung der Beute“, schrieb dazu Gabriel in dem am Sonntag veröffentlichten Beitrag. „Auf den Punkt gebracht insinuiert dieser Vergleich, dass der frühere Kanzleramts- und Außenminister die Interessenvertretung Russlands in Deutschland mitorganisiert habe. Das ist wahrheitswidrig und bösartig.“
Melnyk reagierte umgehend: Bösartig sei vor allem die „jahrelange Putin-freundliche Politik“ gewesen, die Gabriel und seine „SPD-Kumpane“ geführt hätten, schrieb er auf Twitter. Diese habe „den barbarischen Vernichtungskrieg“ gegen die Ukraine „erst herbeigeführt“, fügte „Melnyk hinzu. „Die Aufarbeitung kommt noch. Shame on you“ (deutsch: Schämen Sie sich).
Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung waren Pläne von Bundespräsident Steinmeier, gemeinsam mit seinen Kollegen aus Polen und den drei baltischen Staaten nach Kiew zu reisen. Am Dienstag erklärte er jedoch, die ukrainische Führung habe seinen Besuch abgelehnt.
Diese Absage „ist beispiellos und irritiert“, urteilte Gabriel. Es sei zwar verständlich, wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „seiner Wut und seinem Unverständnis gegenüber Politikern aus Deutschland und anderen EU-Staaten für ihre frühere Russland- und Energiepolitik Ausdruck verleihen wollte“. Hier müsse man Selenskyj „häufig sogar zustimmen“.
„Was wir allerdings nicht hinnehmen sollten, sind Verschwörungstheorien über die Politik unseres Landes und seine Verantwortungsträger“, fügte Gabriel hinzu. Melnyks „Spinnennetz“- Äußerung bezeichnete er als „gefährlichere Variante der Verschwörungstheorien“.
Der Ex-Minister verteidigte zugleich die derzeitige Haltung der Bundesregierung zum Thema Waffenlieferungen. „Führung in Europa heißt auch, sich die Konsequenzen einer Ausweitung dieses Krieges bewusst zu machen“, schrieb er. „Und deshalb ist es richtig, dass die deutsche Bundesregierung schwere Waffen - im Kern Panzer - nur in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika an die Ukraine liefern kann.“
Außenpolitik und Diplomatie könnten „nicht auf Dauer von Panzern und Raketen ersetzt werden“, betonte Gabriel. Außerdem müsse „man auf der Suche nach gewaltfreien Konfliktlösungen den sehr unbequemen und meist auch sehr unpopulären Schritt machen“, sich in „die Schuhe des Gegners zu stellen. Nicht um sich dessen Schuhe anzuziehen, aber um den Raum für denkbare Verständigungen zu vermessen.“
Steinmeier war von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramts unter Gerhard Schröder (SPD). Danach war er bis 2009 und erneut von 2013 bis 2017 Bundesaußenminister. Gabriel wiederum war von 2017 bis 2018 Außenminister und zuvor erst Umwelt- und später Wirtschaftsminister. Schreibt DIE WELT.
Wesentlich aussagekräftiger ist Melnyks erste Twitter-Antwort (siehe Bild) auf das widerwärtige Gesülze des ehemaligen deutschen Aussenministers und heutigen Pöstchenjägers Sigmar Gabriel: «Na, jetzt bekommen Sie (@sigmargabriel) sogar Beifall von den alten Vertrauten aus Moskau! Alle (russischen) Propaganda-Schleudern preisen Ihr Narrativ über (Ukraine) «Verschwöhrungstheorien» in den höchsten Tönen. Alte Freundschaft rostet nicht. Volltreffer zum Osterfest. Viel Glück noch.»
Der dicke Gabriel gehört zur Sorte der zwielichtigen und schmierigen Politiker, die ihr Amt später vergolden. Ohne Rücksicht auf Verluste oder Gewissen. Lenin nannte solche Leute vom Format Gabriels «nützliche Idioten». Im Kreml nennt man sie heute «Call Boys», weil sie beim ersten Anruf tätig werden. Schreibt Boris Reitschuster. Wo der als Journalist wegen seiner dämlichen Corona-Verschwörungstheorien umstrittene Journalist recht hat hat er recht. Er gilt ja nicht umsonst als Russland-Experte, war er doch von 1999 bis zum August 2015 Leiter des Moskauer Büros vom deutschen Nachrichtenmagazin Focus.
Reitschuster schreibt weiter über Gabriel: 'Gabriel selbst ist in seiner Amtszeit wie der gesamte Niedersachsen-Clan in der SPD durch besondere Nähe zum Kreml aufgefallen. Im Jahr 2000 war er Berater für die Tönnies Holding – deren Chef besonders dick im Russland-Geschäft und auch eng mit Putin und Schröder ist. Heute ist Gabriel als geopolitischer Berater bei der Brunswick Group tätig und soll Aufsichtsratsvorsitzender von Thyssenkrupp Steel Europe AG werden. Da vergoldet sich jemand seine Kontakte aus der Zeit in der Regierung. Legendär seine Beschimpfung von Andersdenkenden als «Pack» und sein Tweet zu schlimmsten Zeiten der Corona-Politik mit Bild seiner schmucken Villa: «Weihnachtsmarkt zuhause ist auch cool». Ja, unter Luxusbedingungen durchaus.'
In einer Analyse unter dem Titel «Putins Trojanische Pferde in Deutschland» schreiben Alina Polyakova, Marlene Laruelle, Stefan Meister und Neil Barnett 2016: «Gabriel unterstützte eine engere deutsch-russische Zusammenarbeit durch den Ausbau der Erdgaspipeline Nord Stream, genannt Nord Stream 2. Laut einer vom Kreml veröffentlichten Niederschrift des Treffens bot Gabriel an, die Genehmigung des Projekts in Deutschland unter Umgehung der EU sicherzustellen». Weiter heisst es da: «Darüber hinaus plädierte Gabriel mehrfach in offiziellen Reden für die Abschaffung von Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland.»
'Dass einer derjenigen, der massgeblich dazu beigetragen hat, das System Putin in Deutschland zu unterstützen, und mit seiner Bauchpinselei Putin zu seiner Aggressionspolitik ermutigte, jetzt über deren Opfer herzieht, ist an Zynismus und Dreistigkeit kaum zu überbieten.' Soweit Reitschuster.
Deutschland und seine gute alte Tante SPD täten gut daran, den Putin-Sumpf in ihrer Partei aufzuarbeiten. Nibelungentreue zu einem alt-Kanzler wie Gerhard Schröder und seinem Gefolge, zu dem auch Gabriel und die halbe Führungselite der SPD inklusive Kanzler Scholz gehören, ist spätestens seit der Ausrufung der «Zeitenwende» von Kanzler Scholz nicht mehr angebracht. Denn die Ukraine zahlt für die jahrzehntelang gepflegte Korruption der deutschen SPD-Politiker den höchsten Preis mit abertausenden von Toten und dem Erdboden gleichgemachte Städte für die schmutzigen Rubel, die Deutschlands politische Elite aus dem Kreml empfangen hat.
Zu erwähnen ist, dass sich auch andere deutsche Parteien wie die «Linke» und die «AfD» von Russland schmieren liessen. Wahrscheinlich finden sich auch etliche Putin-Versteher*innen bei der CDU/CSU.
Eine ketzerische Frage sei am Ostermontag erlaubt: Glaubt jemand in der Schweiz, dass Putin-Versteher vom Schlage eines Roger Köppels (SVP) und Konsorten ihren Bullshit wirklich ohne jede Gegenleistung aus Russland absondern?
Happy Ostermontag.
-
17.4.2022 - Tag der Narrative und unterschiedlichen Hausnummern
Putins Vernichtungsfeldzug und Schweizer Maulheldentum
In unserer grossen Meinungsumfrage spricht sich eine Mehrheit für eine engere Zusammenarbeit mit der Nato aus. Eine glaubwürdige Verteidigungskulisse kann allerdings nur ein Teil einer sehr viel umfassenderen Neupositionierung der Schweiz in der Welt sein.
Zeitenwende. In den Schweizer Medien tauchte dieses grosse Wort in den letzten zwei Monaten häufiger auf als in den zwei Jahren davor. Putins Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine scheint auch uns eine alte Denkweise von neuem aufzuzwingen. Schlagartig leben wir wieder in einer Ära von Aufrüstung und Abschreckung.
In unserer grossen Meinungsumfrage spricht sich eine Mehrheit – richtigerweise! – für die Lieferung von Schutzwesten an die Ukraine aus. Auch eine engere Zusammenarbeit mit der Nato ist für die meisten kein Tabu. Dahinter steckt die Logik: Offenheit und Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit lassen sich nur bewahren, wenn wir notfalls bereit sind, diese Grundwerte militärisch zu verteidigen. Glaubwürdig wirkt eine solche Ansage indessen erst im Verbund mit anderen.
Russlands Krieg gegen die Ukraine mag viele überrascht haben. Bloss: Über kurz oder lang wäre uns ein solch epochaler Schock ohnehin nicht erspart geblieben. Heute lässt Wladimir Putin Kriegsverbrechen begehen, weiter hinten am Horizont aber präsentiert bereits Xi Jinping das Gewehr. China hat seine Rüstungsausgaben in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent erhöht, das Land tritt immer unverhohlener in der Rolle einer globalen Militärmacht auf. Das lässt für die Zukunft wenig Gutes erhoffen.
Ja, wir müssen uns neu sortieren. Eine Entschlossenheit demonstrierende Verteidigungskulisse kann allerdings bloss Teil einer umfassenden Neupositionierung der Schweiz in der Welt sein. Sehr viel wichtiger als alles Militärische ist eine vertiefte politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem übrigen Europa, mithin ein rasches Herunterfahren unserer Abhängigkeit von Russland und China.
Um es in strategischen Begriffen zu sagen: Offenheit und Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind Europas Soft Power. Und diese Macht ist gewaltig – nichts fürchten Putin und Xi mehr. Freilich finden die beiden Diktatoren im Westen bis heute genügend Verbündete, die bereit sind, diese Soft Power aus Bequemlichkeit oder aus Profitstreben leichtfertig auszuhöhlen. China begeht Völkermord an den Uiguren, tritt die Menschenrechte ganz allgemein mit den Füssen und droht seinem Nachbarn Taiwan mit einer Invasion? Schweizer Industrieunternehmen hindert das nicht, ihre gesamte Produktion nach China auszulagern; die Politik unterstützt sie dabei sogar nach Kräften. Aus dieser geschäftsmässigen Schwäche des Westens beziehen Peking wie Moskau einen grossen Teil ihrer Stärke.
Diese Woche spottete Putins Lieblingszeitung «Komsomolskaja Prawda»: Selbstverständlich sei jedes Land frei in seinem Entscheid, den Bezug von russischem Gas einzustellen. Nur wäre es mit Europas schönem Leben dann halt vorbei. In der gleichen Zeitung ätzte ein Kolumnist: «Sie möchten kein Gas? Na dann, Holz hacken. Oder ab nach Afrika.»
Fast die Hälfte aller Energie in der Schweiz wird für Gebäude verbraucht, namentlich für Heizen und Warmwasser. Die politische Verantwortung liegt hier bei den Kantonen. Ende 2014 haben sich die 26 Energiedirektoren im Prinzip darauf verständigt, dass Öl- und Gasheizungen durch umweltfreundlichere Systeme ersetzt werden sollen. Festgehalten wird diese Absicht in den sogenannten MuKEn 2014, den Mustervorschriften für die Kantone im Energiebereich. Doch die MuKEn sind in Wirklichkeit äusserst lasch: Wer einen alten durch einen neuen Öl- oder Gasofen ersetzen will, kann dies im Jahr 2022 problemlos tun. So kommt es, dass in der Schweiz seit 2015 nicht weniger als 90'000 neue Gasheizungen eingebaut wurden.
Wer heute heroisch von «Zeitenwende» sprechen will, darf sich nicht scheuen, auch ein so wenig heroisch klingendes Wort wie MuKEn in den Mund zu nehmen. Die Energievorschriften der Kantone müssen sofort verschärft, Schlupflöcher gestopft werden. Erst wenn sich die Zeitenwende nicht allein im Militäretat bemerkbar macht, sondern ebenso in den Amtsstuben der Energiedirektoren, ist unsere Verteidigungskulisse mehr als bloss Maulheldentum. Schreibt SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty im SoBli.
Das Narrativ* «Zeitenwende» hat sich nach dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine zum kommunikativen Überflieger in den Medien und Talk-Shows entwickelt. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat es in seiner Rede an den deutschen Bundestag zwar hoffähig gemacht und in aller Munde gebracht, den Sinn des Wortes und die daraus folgenden Konsequenzen wie so viele bis heute aber nicht wirklich verstanden. Anders lässt sich sein dilettantisches Lavieren um deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine nicht erklären.
Am Artikel von SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty lässt sich nichts aussetzen. Er bringt viele Versäumnisse in der Schweiz auf den Punkt. Seine Aufforderungen an eine Zeitenwende im Schweizer Energiebereich sind ebenso unerlässlich wie stimmig, doch im Gesamtkontext etwas weiter gesponnen als nur mit Bezug auf den Energiekomplex des gesamten Westens – und nicht nur der Schweiz – wohl nichts anderes als ein nettes Gedankenspiel, das sich langfristig in Luft auflösen wird. Die westlichen Abhängigkeiten und wirtschaftlichen Verknüpfungen beschränken sich ja nicht nur auf die Energie und Russland. China ist da der viel grössere Player und Präsident Xi Jinping eine weitaus gefährlichere Hausnummer als Putin.
Dass alles mit allem zusammenhängt, wie Alexander von Humboldt in seinem Verständnis der Natur richtig bemerkte, trifft auch auf «Zeitenwenden» zu. Die Befürchtung steht im Raum, dass Egon Bahr, einer der entscheidenden Vordenker und führender Mitgestalter der von der Regierung unter Willy Brandt ab 1969 eingeleiteten Ost- und Deutschlandpolitik, schlussendlich recht behält: «Erstens: In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Zweitens: Für Deutschland ist Amerika unverzichtbar, aber Russland ist unverrückbar». Die Volksrepublik China war 1969 noch ein unterentwickeltes Armenhaus. Heute ist sie ebenso unverzichtbar und unverrückbar wie Russland. Nur in etwas anderen Dimensionen.
Oder wie König Artus** den Rittern der Tafelrunde die «Zeitenwende» verkündet haben soll: «Nichts bleibt wie es ist. Doch der Starke wird immer den Schwachen besiegen.»
Was zu befürchten ist.
Frohe Ostern.
* Narrativ ist eine Lehnübersetzung des englischen Worts narrative (in der Bedeutung: «Erzählung oder Darstellung, die benutzt wird, um eine Gesellschaft oder historische Periode zu erklären oder zu rechtfertigen»). Wikipedia
** Von vielen Forschern wird inzwischen bezweifelt, dass Artus jemals existiert hat.
-
16.4.2022 - Tag der unbedachten Worthülsen
Ukraine Krieg: Westliche Diplomatie am Ende
Durch das Denken Wladimir Putins dringt niemand durch. Der "Westen" muss feststellen, dass seine Reaktion auf den Ukraine-Krieg nicht global mitgetragen wird.
Mittlerweile gibt es keinen Mangel mehr an leicht zugänglichen Texten, die das Denken der russischen Führung und damit die Basis für den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar erschließen. Die programmatischen Schriften der Ideologen rund um den russischen Präsidenten Wladimir Putin liegen ja bereits seit Jahren vor, aber jene, die sie nicht nur lasen, sondern ernst nahmen, waren einsame Rufer in der Wüste.
Insofern ist die ukrainische Frustration, die sich zuletzt gegen den deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier entlud – so unklug und auch unfair sie Deutschland gegenüber ist –, sogar irgendwie nachvollziehbar.
Wieder einmal hätte man es wissen können, wenn man gewollt hätte. Auch wenn es viel mehr war, als von anderen europäischen Politikern kam, nahm die Ukraine Steinmeiers Entschuldigung nicht an. Immerhin war er vor seiner Präsidentschaft nicht nur Außenminister, sondern zuvor als Kanzleramtschef auch Beauftragter für die deutschen Nachrichtendienste. Er sollte gewohnt sein, das eigene Wunschdenken zu relativieren und nicht auf ein einziges Szenario zu setzen.
Europäisches Wunschdenken
Das europäische Wunschdenken, die Illusion über den Platz des Westens in der Welt, tut Sergej Karaganow in einem Interview mit La Repubblica, das weithin gelesen wurde, verächtlich ab: Das Ideal des "ewigen Friedens", sagt der noch immer einflussreiche frühere Berater Putins in einer Anspielung auf Emmanuel Kant, habe die Europäer in die Irre geführt.
Das Wort "selbstmörderisch" – für die Europäer – fällt mehr als einmal. Er droht mit Angriffen auf Ziele in Europa, sollte die Ukraine von Nato-Ländern weiter mit Waffen beliefert werden. Und er versucht, einen Keil zwischen die USA und die EU zu treiben.
Sein Argument, dass es ein europäischer Fehler war, sich so eng an Washington anzuschließen, dürfte bei einigen Menschen in Europa durchaus auf Resonanz stoßen. Was Karaganow damit impliziert, nämlich dass dafür die neue russische Ordnung akzeptiert werden müsste, blenden sie tunlichst aus.
Die Ideologie Putins
Eine der vielen schlechten Nachrichten im Interview ist, dass die für Russland militärisch unerwartet schwierigen ersten Wochen des Kriegs Putin eher bestärken werden – das gilt auch für das Ende des Schwarzmeer-Kriegsschiffs Moskwa.
Denn Russland findet sich aus eigener Sicht in einem ihm aufgezwungenen Überlebenskampf gegen die Nato, nicht nur in einem Krieg mit der "mit Nato-Waffen vollgepumpten" Ukraine. In einschlägigen Medien kann man ja auch lesen, dass die ganze Organisation der ukrainischen Armee in US-Hand sei.
Dieser Krieg hat schon viel früher begonnen, die neue Phase ist – in Karaganows Worten – "unvermeidlich" geworden. Russland werde siegen, die Fehler des Westens müssten "korrigiert" werden. In diesem existenziellen Krieg würden der "Krebs" und seine "Metastasen" ausgemerzt werden.
Unbequeme Tatsachen
Die russische Kombination des Nazi-Vorwurfs und eben jener Sprache, die man Nazis zuschreiben würde, macht schaudern. Die Ukraine werde entnazifiziert werden wie Deutschland – und Tschetschenien. Dieser Krieg hat aber auch, wie jeder ideologische Kampf, seine Folgen im Ausgangsland: Er werde "dazu dienen", sagt Karaganow, "die russische Elite und die russische Gesellschaft umzustrukturieren. Nichtpatriotische Elemente werden aus der Elite entfernt werden."
Und auch wenn die Russland vorgeworfenen Kriegsverbrechen allesamt "gefälscht" und "inszeniert" sind: Dass man sich die Hände schmutzig macht, konzediert Karaganow. Die Russen mögen nun "die moralische Überlegenheit verlieren", sagt er, aber damit begeben sie sich eben "auf das gleiche moralische Niveau wie der Westen".
Und genau hier schließt sich der Kreis zur unbequemen Tatsache, dass die Sicht "des Westens" auf den russischen Überfall auf die Ukraine – und vor allem die westlichen Konsequenzen daraus – keineswegs global akzeptiert sind.
Die "Vergewaltigung Serbiens" 1999 mit der anschließenden "traurigen und demütigenden Show" des Prozesses gegen Slobodan Milošević in Den Haag ist international nicht so ein großes Thema wie der US-geführte Irak-Krieg 2003 auf gefälschten Grundlagen. Karaganow betont, dass niemand dafür zur Verantwortung gezogen wurde. Er erwähnt auch Libyen, wo die Nato 2011 ihr Uno-Mandat überschritt und damit Muammar al-Gaddafi stürzte.
Die Diplomatie des Westens
Eine vergessene Episode: Ausgerechnet die später von Wladimir Putin mit Hochzeitsjuwelen im Wert von 50.000 Euro beschenkte österreichische Außenministerin Karin Kneissl erhielt im April 2018 eine unfreundliche Lektion zu Österreichs internationalem Gewicht. Kneissl war explizit mit dem Offert einer möglichen österreichischen Vermittlungsmission in Syrien nach Moskau gekommen. Er sehe dafür "keinen Spielraum", erteilte der grantige Außenminister Sergej Lawrow den Österreichern ganz undiplomatisch offen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz eine Abfuhr.
Dennoch, dem Argument, dass Tätigkeit besser sei als Untätigkeit, konnte man im Fall des Treffens von Bundeskanzler Karl Nehammer mit Putin am Montag in Moskau sehr wohl etwas abgewinnen. Von der Idee, dass eine österreichische Vermittlung akzeptiert werden könnte, distanzierte sich Nehammer jedoch allerspätestens nach dem Besuch. Beim Pressegespräch, in dem die "Risikomission" angekündigt wurde, waren die vielstrapazierten Begriffe "ehrlicher Makler" und "Brückenbauer" noch gefallen.
Ex-Kanzler Franz Vranitzky bringt es in einem Gespräch mit dem STANDARD diese Woche auf den Punkt: Den für eine solche Mission benötigten internationalen Stellenwert billige man Österreich derzeit ganz offenbar nicht zu.
Nicht ansprechbar
Nehammer war der erste Regierungschef aus dem Klub jener Staaten, die Sanktionen gegen Putin verhängt haben, der nach Kriegsbeginn nach Moskau reiste. Ob es Putin in irgendeiner Weise beeindruckte, dass ihm ein österreichischer Kanzler seine Kriegsverbrechen auf den Kopf zusagte, sei dahingestellt. Er wird zu antworten gewusst haben.
Als für Putin typisch wird der Hang zum Dozieren genannt: Wer ihm etwas sagt, muss sich dafür seine historischen und politischen Wahrheiten anhören. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der auch nach Kriegsbeginn noch stundenlang mit Putin telefonierte, deutete die Leidensfähigkeit an, die man für diese Kommunikation braucht: "Jede Diskussion ist von Zynismus geprägt, es ist nie ein Vergnügen." Und gerade das Beispiel des Präsidenten der einzigen Atommacht in der EU zeigt auch: Putin ist im Moment nicht ansprechbar, von niemandem.
So eindeutig sich der österreichische Bundeskanzler und andere EU-Politiker zur Lage in der Ukraine äußern, in der Schärfe der Wortwahl gibt es einen eindeutigen Meinungsführer: US-Präsident Joe Biden. Er nannte Putin schon früher einen "Killer", seitdem folgten die Begriffe "Schlächter", "Kriegsverbrecher" und die Qualifikation des russischen Kriegs als "Genozid". Und er stellte fest, dass Putin nicht an der Macht bleiben könne.
Auch wenn Letzteres, was die Formulierung betrifft, manchen sogar weniger krass erscheinen mag, so ist es wohl die brisanteste Aussage: Das Weiße Haus stellte danach klar, dass die USA in Russland keinen "regime change" anstreben – und das spricht dafür, dass Biden sich zuvor nicht mit seinen Beratern abgesprochen hatte. Man mag Biden inhaltlich applaudieren, er bestärkte aber das russische Narrativ, Russland habe die Ukraine im Kampf um das eigene Land überfallen.
Die Welt
In Putins Denken kann niemand eindringen. Eine andere bittere Erkenntnis ist jedoch, dass auch auf internationaler Ebene nur eine Minderheit von Staaten den westlichen Positionen und Aktionen folgt.
Darüber können auch die erfolgreichen Russland-kritischen Resolutionen in der Uno-Generalversammlung nicht hinwegtäuschen. Laut einer Aufstellung des Thinktanks ISPI in Mailand haben nur 19 Prozent der Staaten weltweit wegen des Überfalls auf die Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt. Allerdings vereinen diese 51 Prozent an Bruttoinlandsprodukten.
Also sind die Reichen auf westlicher Seite? Auch die nicht alle. Wichtige Partner der USA machen nicht oder nicht ganz mit, Israel oder arabische Verbündete wie etwa die Vereinigten Arabischen Emirate. Die VAE sind eines der wenigen Länder, mit denen Österreich eine "strategische Allianz" unterhält.
Wir haben es satt
Wie sie sich vom westlichen Anspruch auf moralische Überlegenheit distanzieren, zeigte sich zuletzt bei der Resolution zum Ausschluss Russlands aus dem Uno-Menschenrechtsrat. Zwar gab es dafür noch immer eine eindeutige Mehrheit, aber etliche Länder, die bei anderen Resolutionen gegen Russland gestimmt hatten, enthielten sich. Die Botschaft ist: Wir haben es satt, dass ihr bestimmen wollt, wer die Guten sind, die im Menschenrechtsrat sitzen dürfen.
Ein schlagendes Beispiel dafür ist Kuwait. Das Emirat, das 1990 von seinem Nachbarn Irak überfallen wurde, war am 25. Februar sogar der einzige Nahoststaat gewesen, der bei der – durch das russische Veto verhinderten – Uno-Sicherheitsratsresolution als Sponsor des Entwurfs aufgetreten war. Die USA hatten das auch von Israel erhofft und sich eine Absage geholt. Kuwait, selbst Aggressionsopfer, machte damals mit. Aber bei der Abstimmung zum Menschenrechtsrat in der Vollversammlung enthielt es sich der Stimme.
Mannigfaltige Gründe
Die Gründe dafür, dass Partner des Westens diesen im Regen stehen lassen, sind mannigfaltig. Sie können konkret realpolitisch sein, wie im Fall von Marokko, das allen Abstimmungen fernbleibt, um sich niemandes Sympathie – die es für die eigenen Ansprüche in der Westsahara braucht – zu verscherzen.
Es sind strategische Gründe, die den schwindenden Einfluss der USA und den wachsenden Russlands und Chinas im arabischen Raum und in Afrika nachvollziehen. Manchmal bilden sie aber auch einfach eine vor allem im Nahen Osten grassierende US-Aversion ab. Sie ist lagerübergreifend und reicht von radikalen Islamisten bis zu jenen, die sie jagen.
Es wird unterschätzt, dass in vielen Regionen der Welt jede demokratische Äußerung, die sich gegen herrschende Regime richtet, als Verschwörung von außen verortet wird: egal ob 2011 in Ägypten, 2004 und 2013/14 in der Ukraine oder 2020 in Belarus.
Die USA, mit den Europäern im Schlepptau, wollen der Welt ihre Ordnung aufzwingen. Aber sie haben übersehen, dass ihre Hegemonie nicht nur unerwünscht ist, sondern auch bröckelt. "Die Welt ändert sich, und der Westen sollte seinen Platz innerhalb der sich ändernden Realitäten neu bewerten", schreibt der russische Uno-Botschafter in Wien, Michail Uljanow. Schreibt DER STANDARD.
Die tägliche Aufarbeitung der über Jahrzehnte andauernden Appeasement-Politik gegenüber den russischen Diktatoren im Sinne der westlichen Konzernpolitik und der unendlichen Gier nach ewigem Wachstum deckt nicht die Schwächen von Demokratien auf, sondern in erster Linie die Verlogenheit demokratischer Politiker*innen.
Eine ähnliche Abrechnung, wie sie derzeit zwischen dem Westen und Russland stattfindet, steht uns mit China noch bevor. Die dürfte dann allerdings etwas heftiger ausfallen.
Demokratische Prozesse sind langfristig nicht kompatibel mit «Tugenden», die den Diktatoren vorbehalten sind. Gier, Allmachtsansprüche, Korruption und Käuflichkeit sollten in einer Demokratie eigentlich nichts zu suchen haben. Sie schaden ihr nur und beschädigen sie.
Dass die Ukraine den Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier brüsk ablehnte, ist bei der unseligen Vergangenheit Steinmeiers mehr als nur verständlich.
Weniger verständlich ist allerdings die Empörung vom deutschen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) über die Absage der Reise Steinmeiers in die Ukraine: «Der Bundespräsident ist Deutschland», sagte der Bundeswirtschaftsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Donnerstag. «Und deswegen ist seine Ausladung durch Präsident Selenskyj eine Ausladung Deutschlands.»
Eine äusserst unglückliche und gefährliche Formulierung von Habeck!
Am 10. September 1934 kündigte der stellvertretende Parteileiter der NSDAP, Rudolf Hess, anlässlich einer Rede von Adolf Hitler auf dem Reichsparteitag in Nürnberg den «grössten Führer aller Zeiten» wie folgt an: «Die Partei ist Hitler, Hitler ist Deutschland, und Deutschland ist Hitler! Sieg heil!»*
So wie Hitler nicht Deutschland war und Putin nicht Russland ist, verkörpert auch Steinmeier nicht Deutschland. Er repräsentiert Deutschland. Alles andere ist Pathos, verpackt in eine unbedachte Worthülse, die normalerweise nur von Diktatoren und deren Paladinen verwendet wird.
Nachsitzen!, Vizekanzler Robert Habeck.
* https://www.dailymotion.com/video/x3ccmrl
-
15.4.2022 - Tag des westlichen Umgangs mit dem Bösen
Russischer Ex-Aussenminister: «Sorgen Sie sich nicht um Putin, sondern lieber um Europa»
Der Krieg in der Ukraine dauert schon mehr als einen Monat an. Für den ehemaligen Aussenminister Andrei Kosyrew ist klar, dass der Westen jetzt Stärke zeigen muss, sonst wird Putin weitere Länder angreifen. Zum Beispiel Polen.
Der russische Präsident Wladimir Putin (69) plant offenbar eine grosse Oster-Offensive im Osten der Ukraine. Ein entsprechender Mega-Konvoi ist bereits unterwegs. Der Kreml-Chef ist weiterhin fest entschlossen, die Ukraine zu erobern. Um jeden Preis.
Die Gräueltaten der russischen Armee, wie das Massaker in Butscha, haben weltweit für Entsetzen gesorgt. US-Präsident Joe Biden (79) sprach das erste Mal von Völkermord. «Es wird immer klarer, dass Putin versucht, die blosse Vorstellung auszulöschen, ein Ukrainer sein zu können.»
Wie brutal Putins Truppen in der Ukraine wüten, hat sogar Andrei Kosyrew (70) überrascht. Er war von 1990 bis 1996 russischer Aussenminister unter Präsident Boris Jelzin (1931-2007). «Ich wusste, dass die Leute, die jetzt in Moskau sitzen, sehr aggressiv und repressiv sind, aber diese Skrupellosigkeit hat mich doch überrascht», sagt er zur «Welt».
«Absolute Kontrolle über die Propaganda-Maschinerie»
Genau deswegen müsse jetzt der Westen Stärke zeigen. Eine schwache Reaktion auf solche Gräueltaten würden den Kreml-Chef nur noch mehr ermutigen. Schliesslich habe er ja keine Konsequenzen zu befürchten.
Dass viele Russen zu Putin halten, und das trotz solcher Gräueltaten wie in Butscha, verwundert den Ex-Aussenminister nicht. Der Kreml-Chef «hat die absolute Kontrolle über die Propaganda-Maschinerie in Russland und kann in einer Sekunde eine völlig andere Geschichte erzählen. Das russische Volk, vor allem die Menschen, die sich nur über das Fernsehen informieren, haben keine Ahnung, was tatsächlich in der Ukraine passiert.»
Mega-Waffenlieferung für die Ukraine
Eine nukleare Eskalation fürchtet Kosyrew nicht. «Das Risiko, dass so etwas passiert, wäre dann grösser, wenn Putin glaubt, der Westen und die Nato hätten vor den Raketen mehr Angst als er selbst. Meiner Ansicht nach sollte die Antwort auf die Aggression jetzt sehr stark sein.»
Das bedeutet konkret: Jede Menge Waffen, die der Westen der Ukraine zur Verfügung stellt. Genau, das wurde gerade erst bekannt gegeben. Die USA und die EU haben eine grosse Waffenlieferung zugesichert. Im Wert von umgerechnet über einer Milliarde Franken. Darunter Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber.
Putin darf nicht mit diesem barbarischen Krieg durchkommen
Für den Ex-Aussenminister ist klar: Putin muss in seine Schranken gewiesen werden. Schon bei der Krim-Annexion sei man zu lasch gewesen. «Wenn er jetzt, mit diesem barbarischen Krieg, wieder durchkommt und die Sanktionen schnell aufgehoben würden, dann wäre die nächste Station ein Nato-Land, eines der baltischen Länder oder vielleicht Polen. Jetzt sollte man sich eher Gedanken darüber machen, ob der Westen seine Lektion gelernt hat.»
Der Westen habe zu lange versucht, Putin zu beschwichtigen. Gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Der Appell von Kosyrew lautet: «Sorgen Sie sich nicht um Putin, sondern lieber um Europa.»
Denn in den Augen des Kreml-Chefs habe der Kalte Krieg nie geendet. Die Fronten sind klar: der Westen gegen den Osten. Darum versucht der russische Präsident auch Schweden und Finnland davon abzuhalten, der Nato beizutreten. Bislang arbeiten die Länder zwar mit dem Verteidigungsbündnis eng zusammen, sind aber keine Mitglieder. Und damit das auch gar nicht so weit kommt, gab es schon erste Drohungen aus Moskau.
Bei einem möglichen Nato-Beitritt von Finnland oder Schweden erwägt Russland eine Aufstockung seines militärischen Arsenals, einschliesslich Atomwaffen, in der Nähe der Grenzen zu den skandinavischen Ländern. Im Falle eines Beitritts würden sich «die Grenzen des Bündnisses mit Russland mehr als verdoppeln», erklärte der russische Ex-Präsident und die derzeitige Nummer zwei des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew (56), im Messenger-Dienst Telegram am Donnerstag. «Und diese Grenzen müssten verteidigt werden.»
Er verwies auf die Verlegung von Infanterie und Luftabwehrsystemen in den Nordwesten Russlands sowie auf die Verlegung von Seestreitkräften in den Finnischen Meerbusen, der Teil der Ostsee ist. Mit Blick auf die finnische und schwedische Bevölkerung betonte er, dass «niemand, der bei klarem Verstand ist, eine Zunahme der Spannungen an seiner Grenze wünschen und neben seinem Haus Iskander-, Hyperschall-Raketen und Schiffe mit Atomwaffen haben möchte».
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (54) äusserte ebenfalls, dass «darüber schon oft gesprochen wurde» und dass Präsident Wladimir Putin angesichts des wachsenden militärischen Potenzials der Nato einen Befehl zur «Verstärkung unserer westlichen Flanke» erteilt habe. Auf die Frage, ob diese Verstärkung auch Atomwaffen umfassen würde, sagte Peskow: «Das kann ich nicht sagen. Es wird eine ganze Liste von Massnahmen und notwendigen Schritten geben. Darüber wird der Präsident in einer separaten Sitzung sprechen.» Schreibt Blick.
Frei nach Karl Valentin «Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen» hat sich nun auch noch der ehemalige Aussenminister Russlands unter dem notorischen Alkoholiker und Staatspräsidenten Boris Jelzin, Andrei Kosyrew, zu Wort gemeldet.
Man darf sich fragen, wo und unter welchen Umständen der 70-jährige Kosyrew die letzten zwei Jahrzehnte verbracht hat. Der Krieg gegen die Ukraine ist ja nicht Putins erster Krieg.
In den 22 Jahren seiner Herrschaft hat er diverse Waffengänge befehligt, in Russland – aber auch weltweit. Die Angriffskriege des neuen russischen Zaren begannen 1999 mit dem Tschetschenien-Feldzug, bei dem Grosny dem Erdboden gleichgemacht wurde und der bis zu 80'000 Todesopfer gefordert haben soll (laut deutschlandfunk.de).
Schon der Tschetschenienkrieg wurde von der russischen Propaganda nicht als «Krieg» bezeichnet, sondern als «Entwaffnung illegaler bewaffneter Banden» oder als «Wiederherstellung der verfassungsmässigen Ordnung», schreibt deutschlandfunk.de
2008 führte Putin in Georgien (Kriegsregion Südossetien) den ersten Krieg ausserhalb der russischen Landesgrenzen. 50'000 Menschen wurden vertrieben.
Im Februar 2014, gleichsam über Nacht, begannen russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, die ukrainischen Militärs auf der Halbinsel zu entwaffnen. Die Ukraine war zu dem Zeitpunkt nahezu unbewaffnet. Mit einem fingierten Referendum verleibte sich die Russische Föderation am 16. März dann die Krim ein. (Quelle: deutschlandfunk.de).
Seit 2015 greift Russland in einem offiziellen «Militäreinsatz»als Bündnispartner des syrischen Machthabers Assad vor allem mit Luftschlägen in den Bürgerkrieg in Syrien ein. Komplett zerstörte Städte wie Aleppo, unzählige Tote aus der Zivilbevölkerung und Millionen von Flüchtlingen zeugen von der grausamen Effizienz der russischen Flugwaffe und der hochmodernen Waffensysteme.
Putins Kriege folgen dem immergleichen System der «verbrannten Erde» und der geplanten Tötung von Personen aus der Zivilgesellschaft oder deren Vetreibung. Gefangene werden keine gemacht.
Das System Putin müsste auch Andrei Kosyrew bekannt sein. Jetzt von Putins Skrupellosigkeit überrascht zu sein, zeugt von Naivität, wenn nicht gar von grosser Dummheit. Da fallen einem unwillkürlich die drei Affen ein: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
Die «drei Affen» haben ihren Ursprung in einem japanischen Sprichwort und stehen dort für den Umgang mit Schlechtem, schreibt Wiki.
Aber Kosyrew ist ja damit in bester Gesellschaft mit vielen westlichen «Staatenlenkern», Politikern und sonstigen Parteibonzen und «Putin-Verstehern», wobei bei denen noch die Worte «Gier» und «Korruption» hinzuzufügen sind.
Dass Europa diesmal aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine die richtigen Lehren im zukünftigen Umgang mit der Paria-Atommacht Russland ziehen muss, ist unbestreitbar. Um das zu wissen braucht es keinen Andrei Kosyrew. Dass er den Verantwortlichen im Westen ins Gewissen redet, ist allerdings zu begrüssen.
Auch wenn die Befürchtung im Raum steht, dass sich einmal mehr die Wirtschaftskreise durchsetzen werden, die kein anderes Ziel verfolgen als die Rückkehr zum «Business as usual» mit Russland. Zu gross ist die Gier nach den verlockenden Gewinnen in Billionenhöhe, die im Zarenreich zu holen sind.
Dass bei den üblichen Verdächtigen aus der Zunft der abartig Neoliberalen und einer börsenorientierten Konzernpolitik die Moral plötzlich vor dem Fressen kommt, wage ich trotz meiner sprichwörtlichen Altersdemut in Anlehnung an Bertolt Brecht zu bezweifeln.
Anmerkung: Da ich weder ein Dieb noch ein Plagiator bin, sei hier erwähnt, dass ich für meinen Artikel Material von deutschlandfunk.de verwendet habe.
-
14.4.2022 - Tag der vielgescholtenen EU
Europa nach dem Krieg: Liberale Weltwirtschaftsordnung oder autonome EU?
Die globale Demokratisierung war ein Misserfolg. Wir exportieren nicht nur keine Demokratie, wir importieren obendrein autoritäres Gedankengut. Der Leitspruch "Wandel durch Handel" ist für die liberale Demokratie zum Bumerang geworden.
"Wandel durch Handel" lautete über Jahrzehnte die Zauberformel der europäischen Außenpolitik. Hinter dem Konzept steckt die Idee, gemeinsamer Handel vermindere das Risiko gewaltsamer Konflikte. Überdies gab es historisch noch keine Demokratie ohne Marktwirtschaft, insofern unterstütze die Ausdehnung der liberalen Weltwirtschaftsordnung die Demokratisierung. Wohlstand, Demokratie und Frieden waren die zentralen Versprechen der jüngsten Globalisierung, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion volle Fahrt aufnahm.
Wohlstand
Ein Blick auf die neuen EU-Mitgliedsländer sowie nach Süd- und Ostasien zeigt, es gibt tatsächlich ganze Weltregionen, wo Millionen von Menschen im Rahmen der jüngsten Globalisierung der Armut entkamen. Mexiko, Russland, Japan, Südafrika oder Italien sind hingegen Beispiele dafür, dass viele Staaten seit 1990 wirtschaftlich zurückgefallen sind.
Aber nicht nur zwischen den Nationen gibt es Verliererinnen und Verlierer, auch innerhalb vieler Staaten ist die Ungleichheit angestiegen. Unter den Bedingungen des Standortwettbewerbs konnten und wollten die Regierungen dem wenig entgegensetzen. Das politische Gewicht hat sich von den nationalen Demokratien in Richtung der global tätigen Konzerne verschoben. Sowohl die sozialen Probleme als auch die Begrenzung politischer Spielräume durch "Sachzwänge der Globalisierung", bereiteten den Boden für Nationalismus und Rechtspopulismus. Die liberale Demokratie zersetzte sich von innen – Stichworte Trump, Brexit, Orbán. Der globale Handel hat Erfolge hervorgebracht, der damit verbundene Wandel aber auch viele Probleme.
Demokratie
Die globale Demokratisierung war kein Erfolg. Es stimmt zwar, dass es noch nie eine Demokratie ohne Marktwirtschaft gab, aber umgekehrt kann die Marktwirtschaft sehr gut ohne Demokratie. Der Kapitalismus funktioniert sogar mit einer "kommunistischen" Ein-Parteien-Regierung wie in China exzellent. Im Westen dachte man, wir exportieren die Demokratie gemeinsam mit unserem Kapital. Wir haben zwar Kapital und Technologie exportiert, aber nicht Rechtsstaat, Demokratie und Gewaltenteilung. In Russland, Brasilien, der Türkei und auf den Philippinen ist die Demokratie längst auf dem Rückzug. In China konnte sie gar nicht erst entstehen oder wird, wie in Hongkong, rückgebaut. Wir exportieren nicht nur keine Demokratie, wir importieren obendrein autoritäres Gedankengut. Davon entsteht bei uns auch so genug, aber die ideologischen Importe aus den russischen Trollfabriken gießen noch mal Öl ins Feuer. "Wandel durch Handel" wurde für die liberale Demokratie zum Bumerang.
Frieden
Eine enge wirtschaftliche Verflechtung wirkt nicht konflikthemmend. Der politisch laut ausgetragene Handelsstreit zwischen der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und Peking entstand nicht trotz, sondern wegen des enormen Handelsvolumens zwischen den USA und China. Der aktuelle Krieg in der Ukraine, in dem die EU faktisch Partei ist, erfolgte, obwohl die Union Russlands größer Handelspartner ist. Auch unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg erreichte die globale Handelsverflechtung ein Rekordniveau. "Wandel durch Handel" trifft in Bezug auf den Weltfrieden nicht zu.
Integration in westliche Hemisphäre …
Putins Aggressionskrieg führt zu seltener transatlantischer Einigkeit. Die meisten Europäerinnen und Europäer werden froh sein, wenn die USA ihr hohes Engagement beibehalten, solange der Krieg noch wütet. Im schlimmsten Fall kann es noch Jahre dauern. Das soll nicht daran hindern, sich Gedanken über das "Danach" zu machen. "Die westliche Hemisphäre muss zu einem großen Freihandelsraum umgebaut werden", heißt es dazu im "Handelsblatt", und für den deutschen Finanzminister ist es an der Zeit, die transatlantischen Beziehungen durch ein Freihandelsabkommen zu vertiefen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie möchte mehr Freihandel mit Südamerika und ein Signal für "Marktöffnungen und Multilateralismus" senden. Es geht also darum, Freihandelsabkommen, wie sie die EU mit Kanada und Japan bereits realisiert hat, nun mit den USA, Großbritannien und Südamerika abzuschließen.
Aber genau diese liberale Weltwirtschaftsordnung führte dazu, dass wir bei Erdöl auf Despoten-Staaten angewiesen sind und obendrein an Wladimir Putins Gashahn hängen. Die 80-prozentige Abhängigkeit Österreichs ist das Resultat einer schon kriminellen Fahrlässigkeit. Während der Pandemie zeigte sich, dass die EU bei Penicillin auf Indien und bei Schutzbekleidung auf China angewiesen war. Eine engere wirtschaftliche Anbindung an Jair Bolsonaros Brasilien oder an eine USA, deren nächster Präsident wieder Donald Trump heißen könnte, ist nicht mehr als das geringere Übel. Wer ein Zurück zur liberalen Weltwirtschaftsordnung möchte, hat den Knall nicht gehört. Eine Wiederauflage der 1990er-Jahre wäre ein fataler Fehler, der alle Erfahrungen der letzten 30 Jahre ignoriert.
… oder autonome EU
Was wir im 21. Jahrhundert wirklich brauchen, ist eine autonome EU. Voraussetzungen dafür sind (regionale) Ernährungssouveränität und europäische Energieautarkie. Wir brauchen eine europäische Industriepolitik, um die Ökologisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Der Kampf gegen den Klimawandel muss natürlich global geführt werden. Doch anstatt sich auf andere auszureden, soll die EU selbst ein Beispiel für Best Practice werden. Wir brauchen Lieferkettengesetze, die den Handel ethischen Standards unterwerfen – das wäre die Bändigung der Globalisierung nach außen. Nach innen brauchen wir EU-Standards in den Bereichen Löhnen, Umwelt und Steuern, um den ruinösen Standortwettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten zu unterbinden. So wäre Augenhöhe zwischen Demokratie und Kapital wiederhergestellt. Die EU muss dafür sorgen, dass im Verhältnis zwischen Politik und Konzernen der Hund mit dem Schwanz wedelt und nicht umgekehrt.
In einer solchen Spielanordnung hätte es für EU-Bürgerinnen und -Bürger viel geringere Auswirkungen, was Russland, Saudi-Arabien, China aber auch die USA wirtschaftlich machen. Und wem die sozialen, ökologischen und demokratischen Gründe nicht ausreichen, der schenkt vielleicht den aktuellen geopolitischen Argumenten Gehör: Wie sich eine wirtschaftlich autonome EU außenpolitisch verhält, könnte sie nämlich nach rein politischen Gesichtspunkten entscheiden. Sie wäre in ihrer Außenpolitik von wirtschaftlichen Erwägungen unabhängig. Schreibt Nikolaus Kowall* in DER STANDARD.
Es gibt ihn schon noch, den vielzitierten «Qualitäts-Journalismus». Man muss ihn nur finden, lesen und verstehen.
*Nikolaus Kowall hat eine Stiftungsprofessur für internationale Makroökonomie an der Fachhochschule des BFI (Berufsförderungsinstitut Wien) inne.
-
13.4.2022 - Tag des Velofahrens ohne Sattel
Velostadt Luzern: Velofahrende erhalten am Luzernerhof früher grün
Künftig schaltet die Lichtsignalanlage für Velofahrende in der Haldenstrasse einige Sekunden früher auf grün. Das sogenannte Vorlaufgrün erhöht die Verkehrssicherheit am Luzernerhof.
Autofahrende, die von der Haldenstrasse Richtung Löwenplatz fahren, müssen nach der Lichtsignalanlage den Velostreifen auf dem Luzernerhof überqueren. Das führt immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Lichtsignalanlage wurde deshalb so angepasst, dass die Velos einige Sekunden früher losfahren können. Dank dem sogenannten Vorlaufgrün ist dafür gesorgt, dass die meisten Velofahrenden bereits aus dem Konfliktbereich sind, wenn der motorisierte Verkehr Grün erhält.
Erfahrungen an anderen Stellen, wie zum Beispiel an der Kreuzung Zentralstrasse/Bahnhofplatz zeigen, dass dadurch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht werden kann. Auch schweizweit hat sich das Vorlaufgrün mittlerweile bewährt. Schreibt die Stadt Luzern in ihrem Newsletter.
Im offiziellen Sprachjargon der Rot-Grünen-Stadtregierung (plus einem FDP-MitGlied) wird die Stadt Luzern nicht mehr Stadt Luzern genannt sondern VELOSTADT LUZERN. Das tönt futuristisch, doch die Roten und grünen Grüninnen tun mit ihrer kreativen Kraft wirklich alles, um dieses hehre Ziel als einzige und wahrhaftige VELOSTADT der Schweiz auch zu erreichen.
Das beweist die Lichtsignalanlage an der Haldenstrasse. Ein paar Sekunden machen eben den Unterschied zwischen einer Autoposerstadt und einer VELOSTADT.
Nun soll laut unbestätigten Gerüchten ein Luzerner Ständerat, dessen Namen wir hier nicht nennen, weil Damian Müller ja noch immer politisch aktiv ist, eine Motion im Ständerat eingebracht haben, die ihm die nächste Wiederwahl sichern soll.
Sinn der Motion sei es, wie gut unterrichtete Kreise munkeln, in Zukunft das Velofahren auch ohne Sattel straffrei zu erlauben. Laut ebendiesem Ständerat soll dies das Vergnügen beim Velofahren deutlich steigern. Und zwar nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern.
Es sei hier ausdrücklich nochmals darauf verwiesen, dass es sich bei diesem angeblich politischen Vorstoss wirklich nur um ein Gerücht handelt, dessen Wahrheitsgehalt wegen dem Osterstau und anderen Kalamitäten wie Pandemie und Ukraine-Krieg noch nicht verifiziert werden konnte.
Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tschau bis Ostern.

-
12.4.2022 - Tag der Schwangerschaft von Brittney Spears
Keine Tariferhöhung: Reisen im ÖV wird im Jahr 2023 nicht teurer
Das Reisen im öffentlichen Verkehr wird 2023 nicht teurer – trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten. Zum sechsten Mal in Folge verzichten Tarif- und Verkehrsbünde der Alliance Swiss Pass auf eine allgemeine Tariferhöhung. Damit soll die Nachfrage nach Reisen im ÖV angekurbelt werden.
Die ÖV-Branche wolle nach der Pandemie verlorene Kundinnen und Kunden zurückgewinnen, so die Alliance Swiss Pass. Man habe diesen Entscheid trotz wirtschaftlich schwierigen Zeiten beschlossen.
Helfen beim Ankurbeln der ÖV-Nachfrage soll eine breit angelegte Freizeitkampagne. «Neue, attraktive Angebote» wie die «Spar-Kleingruppe» würden zudem eingeführt, schreibt der Tarifverbund weiter.
Auch reisen Kinder bis zum sechsten Geburtstag seit dem letzten Fahrplanwechsel immer gratis. Gleichzeitig sei der Swiss Travel Pass bis zu 21 Prozent günstiger geworden. Zudem sei die Spartageskarte ab 29 Franken und der Sparklassenwechsel im Angebot ergänzt worden.
Wirtschaftliche Herausforderungen
Die Covid-19-Pandemie habe auch bei den Transportunternehmen und Verbünden Spuren hinterlassen. Zudem belasteten der gestiegene Ölpreis den Strassen-ÖV mit zusätzlichen Kosten. Auch seien die Konsumentenpreise in der Schweiz seit 2016 um 1.7 Prozent gestiegen und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erwarte für 2022 eine weitere Teuerung um 1.1 Prozent, so Alliance Swiss Pass. Schreibt SRF.
Man muss in Zeiten wie diesen lange scrollen, bis in den «Qualitätsmedien» ein Artikel mit einem positiven Inhalt jenseits des Konjunktivs der Liveticker-Formate oder Brittney Spears Schwangerschaft (DAS Tages-Thema schlechthin!, obschon wohl 90 Prozent der Menschheit keine Ahnung haben, wer Brittney Spears ist) auftaucht.
Die heutige Suche war erfolgreich: Keine Tariferhöhungen im öffentlichen Verkehr auch im Jahr 2023. Wem das keinen Jauchzer oder zumindest einen inneren Trychle-Klang auslöst, dem ist entweder nicht zu helfen oder er/sie/es bevorzugt andere Transportmittel, um von A nach B zu gelangen.
Ein Hoch auf die Alliance Swiss Pass.
-
11.4.2022 - Tag der österreichischen Kanzler
Ukraine kritisiert den österreichischen Kanzler Nehammer wegen Reise zu Putin: «Selbstüberschätzung»
Kurz nachdem Kanzler Karl Nehammer am Sonntag angekündigt hatte, zu Russlands Präsident Wladimir Putin zu reisen, kamen erste kritische Stimmen aus der Ukraine. Ein namentlich nicht genannter ukrainischer Diplomat sagte, dass es sich um eine „Selbstüberschätzung des österreichischen Kanzlers“ handle. Auch der Vize-Bürgermeister von Mariupol, Sergej Orlow, reagierte erbost auf Nehammers Pläne.
„Das gehört sich nicht zur heutigen Zeit. Die Kriegsverbrechen, die Russland gerade auf dem ukrainischen Boden begeht, finden weiterhin statt“, betonte Orlow gegenüber „Bild“.
Verweis auf Butscha
Und er fügte hinzu: „Das, was wir in Butscha gesehen haben - das ist möglicherweise in Mariupol noch schlimmer gewesen, auch wenn die russische Armee sich bemüht, die Verbrechen zu verschleiern. Ich verstehe nicht, wie in dieser Zeit ein Gespräch mit Putin geführt werden kann, wie mit ihm Geschäfte geführt werden können.“
Auch in einigen anderen europäischen Ländern wie Polen oder den baltischen Staaten dürfte die Reise wohl auch kritisch gesehen werden.
Meinl-Reisinger: „Nicht den gemeinsamen europäischen Weg verlassen“
Der Besuch Nehammers beim russischen Präsidenten Putin dürfe nicht dazu führen, dass Österreich den gemeinsamen europäischen Weg verlässt, kommentierte am Abend die NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger in einer Aussendung. „Insgesamt besteht die Sorge, dass das Treffen Putin letztlich mehr nutzt als der Ukraine. Schließlich kam es schon vor, dass sich Österreichs Politiker vor den russischen Propaganda-Karren spannen ließen“, erklärte sie.
Russland-Experte übt harsche Kritik an Nehammer-Visite in Moskau
Der Russland-Experte Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck übte harsche Kritik an der Visite Nehammers in Moskau. „Ich halte diesen Besuch für keine kluge Entscheidung“, sagte er in der „ZiB 2 am Sonntag“. Auf einen Brückenbauer habe in der EU keiner gewartet, die Osteuropäer kritisierten diesen Schritt bereits scharf, so Mangott.
Russlands Präsident Putin habe die Macht über die Bilder dieses Besuches und werde diese zu nutzen wissen, warnte er. Nehammer werde Putin Bilder verschaffen, die sagen: „Ich bin nicht isoliert, es gibt Länder im Westen, die mit uns kooperieren.“ Schreibt die Kronenzeitung.
Es ist nicht nur Putin, der die Bilder für seine eigene Werbung nutzen wird, sondern auch Nehammer.
Der österreichische Kanzler, ein intimer Vertrauter und Mitläufer von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, mit dem er eigenen Aussagen zufolge wöchentlich telefoniert, braucht diese Bilder vermutlich sogar noch dringender als Putin.
Seine Partei (ÖVP) steht derzeit wegen Korruption in einem Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments schwer unter Beschuss. Laut Umfragen («Sonntagsfrage») ist sie, je nach Umfrageinstitut, deutlich hinter die SPÖ zurückgefallen.
Ob demütigende Bilder als «neutraler» österreichischer Kanzler und «Weltenlenker» an Putins sechs-Meter-Tisch für das Umfrage-Ranking allerdings hilfreich sind, darf bezweifelt werden.
Es ist der Welt noch nie gut bekommen, wenn österreichische Kanzler sich als Weltenlenker betätigt haben.
-
10.4.2022 - Tag der SVP-Dummschwätzer
Alte Freunde in der Aargauer SVP wenden sich ab: «Glarner ist nicht mehr tragbar»
In der Aargauer SVP werden zunehmend kritische Stimmen gegen Parteipräsident und Nationalrat Andreas Glarner laut. Dessen Haltung zum Krieg in der Ukraine überspannt den Bogen selbst für loyale Weggefährten.
Der Haussegen in der Aargauer SVP-Sektion hängt schon länger schief. Grund ist der umtriebige Parteipräsident Andreas Glarner (59). Der Nationalrat war noch nie um markige Worte verlegen. Doch mit einem Meinungsbeitrag in der «Schweizerzeit» hat er offenbar auch für viele im eigenen Lager den Bogen überspannt.
Glarner hatte dem Westen eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine gegeben und letztere aufgefordert, die Bedingungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) für einen Frieden zu akzeptieren.
Glarners Provokationen hatten schon in der Corona-Krise für interne Kritik gesorgt. Mit dem Beitrag hat er es sich aber offenbar auch mit den treuesten Weggefährten verscherzt. Wie die Zeitungen der «CH Media» berichten, ist der ehemalige Grossrat Bruno Bertschi (77) einer davon. Letzterer sass 15 Jahre lang im Wohlener Einwohnerrat, war einst ein enger Freund Glarners und gehörte laut Bericht zur sogenannten «Stahlhelm-Fraktion» in der SVP, die stramm hinter Glarner steht.
«Was in der Ukraine passiert, ist einfach nur schrecklich»
Tempi passati. «Mit solch idiotischen Aussagen von Andy Glarner verliert die SVP laufend Mitglieder, irgendwann auch mich», schreibt Bertschi auf Facebook. Er kenne die Ukraine sehr gut und stehe täglich in Kontakt mit Freunden. Und was dort passiere, sei «einfach nur schrecklich.»
Bertschi selbst hat unter anderem Hilfskonvois in die Ukraine gefahren. Wegen seiner Aussagen sei Glarner «als Kantonalpräsident der SVP Aargau nicht mehr tragbar», so der inzwischen im Tessin lebende Bertschi gegenüber der Zeitung. Er höre zudem vermehrt, dass langjährige SVP-Mitglieder wegen des Präsidenten aus der Partei austreten würden oder sich das zumindest überlegten. «Auch ich habe schon daran gedacht, denn das ist nicht mehr die SVP, für die ich politisiert und mich eingesetzt habe.»
Nächster Krach kommt wohl schon bald
Es ist bereits das zweite Mal, dass Glarners russlandfreundliche Haltung parteiintern Wellen wirft. Der Aargauer SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (55) soll sich gemeinsam mit SVP-Landammann Alex Hürzeler (56) Glarner am Rande einer SVP-Fraktionssitzung zur Brust genommen haben: Glarner sei nicht nur ein «Putin-Versteher, sondern ein Putin-Verehrer».
Es dürften noch weitere Debatten folgen: Kommende Woche wird sich die SVP Aargau zum Parteitag treffen. Der Einladung an die SVP-Mitglieder war auch in gekürzter Form erneut Glarners «Schweizerzeit»-Beitrag beigelegt. Gut möglich, dass Glarners Russland-Sympathien erneut zu reden geben werden. Schreibt Blick.
War denn der Aargauer SVP-Plauderi Andreas Glarner, den man laut Gerichtsurteil einen «dummen Mensch», einen «infantilen Dummschwätzer» und einen «üblen, verlogenen Profiteur» nennen darf, je tragbar?
Eine etwas späte Einsicht der Aargauer SVP.
Allerdings auch etwas scheinheilig. Denn der unappetitliche Zürcher SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Herausgeber Roger Köppel steht Glarner in Bezug auf den russischen Massenmörder und Kriegsverbrecher als «Putin-Verehrer» in Nichts nach. Dies allerdings auf einem etwas höheren intellektuellen Level als beim «Dummschwätzer». Was die Angelegenheit auch nicht besser macht.
-
9.4.2022 - Tag der Blut-, Tränen und Schweiss-Rede
Polens Regierungschef Morawiecki : «Gespräche verleihen Putin Glaubwürdigkeit» und «Sanktionen funktionieren nicht»
Polens Regierungschef Morawiecki hatte Frankreichs Präsident Macron für seine Telefonate mit Kreml-Chef Putin kritisiert. Macron reagierte daraufhin wenig diplomatisch. In den tagesthemen wiederholte Morawiecki nun seine Vorwürfe.Seit der russischen Invasion in die Ukraine hat die Europäische Union demonstrative Geschlossenheit gezeigt. Doch zumindest zwischen Frankreich und Polen ist es damit vorläufig vorbei.Auslöser ist die Kritik des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki an den Gesprächen zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Kreml-Chef Wladimir Putin. "Wie oft haben Sie mit Putin verhandelt und was haben Sie erreicht? Man debattiert und verhandelt nicht mit Kriminellen. Kriminelle müssen bekämpft werden", hatte Morawiecki bereits am vergangenen Montag gesagt. Es habe auch niemand mit Adolf Hitler verhandelt. Macron wies die Kritik zurück. Er habe "Stunden" in Gesprächen mit dem russischen Staatschef verbracht, sagte Macron am Donnerstag den Lesern von "Le Parisien". "Jede Diskussion ist von Zynismus geprägt, es ist nie ein Vergnügen." Es sei aber seine "Pflicht", den Dialog mit Putin aufrechtzuerhalten. Macron nennt Morawiecki "rechtsextremen Antisemiten
"Zudem ging Macron den polnischen Regierungschef in einem Interview mit der Zeitung "Le Parisien" scharf an. Der französische Präsident nannte ihn einen "rechtsextremen Antisemiten, der LGBT verbietet". Macron beschuldigte Morawiecki außerdem, sich in den französischen Wahlkampf einzumischen, und wies auf dessen Nähe zu seiner rechtspopulistischen Rivalin bei den Präsidentschaftswahlen, Marine Le Pen, hin.
"Gespräche verleihen Putin mehr Glaubwürdigkeit"
Im tagesthemen-Interview (siehe Video) verteidigte Morawiecki nun seinen Standpunkt. Mit Putin zu sprechen helfe nicht, im Gegenteil: "Wenn man mit Putin spricht, verleiht man ihm damit nur mehr Glaubwürdigkeit. Ich denke, er hat jegliche Glaubwürdigkeit verspielt." Putin stehe an der Spitze dieser "Kriegsmaschinerie". Er sei persönlich verantwortlich für "all die Kriegsverbrechen und für den Völkermord, der aktuell in der ganzen Ukraine geschieht", sagte Polens Regierungschef und spielte zugleich auf die seiner Meinung nach ungenügenden Sanktionen gegen Russland an: "Wenn ich durch meine Worte einen Beitrag zu stärkeren, wirkungsvolleren Sanktionen leisten kann, dann hätte ich mein Hauptziel erreicht. Denn das Hauptziel besteht darin, der Ukraine zu helfen, dass sie ihre Souveränität verteidigen kann".
Sanktionen funktionieren nicht
Dieser Krieg werde entweder militärisch gewonnen, "und das versucht die Ukraine verzweifelt, oder wir gewinnen den Krieg in wirtschaftlicher Hinsicht". Man hätte bis jetzt aber "nichts Bedeutendes erreicht". Es gelte die Öffentlichkeit aufzurütteln und "weg von den interessengeleiteten politischen Ansätzen" zu kommen, "hin zu einer Politik des Gewissens". Gespräche mit Putin würden den Krieg jedenfalls nicht beenden. In Moskau gäbe es diesbezüglich nicht den "notwendigen Willen" für eine friedliche Lösung. Die Verhandlungen seien Teil einer "Aufschiebetaktik". "Hier werden zwar Verhandlungen geführt, doch sie sind künstlicher Natur. Und diese verbrecherischen Völkermordtaten der Russen gehen weiter, auch während die Verhandlungen laufen." Schreibt die ARD-Tagesschau.
Es täte uns in Zeiten wie diesen gut, vielleicht wieder einmal die Geschichtsbücher aus den Jahren 1933 (Hitlers Ernennung zum deutschen Reichskanzler) bis 1945 (Ende des Zweiten Weltkriegs) hervorzuholen.
Wenn jemand berechtigt ist, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Vergleiche zwischen Putin und Hitler zu ziehen, ist es der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Vergleichen heisst nicht gleichsetzen. Dennoch sind die Analogien zwischen dem Angriffskrieg Hitlers gegen Polen und dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine erschreckend.
So wie sich Hitler den Rücken durch einen verbrecherischen «Nichtangriffspakt» mit Russlands Diktator Stalin freihielt, was letztendlich nichts anderes als die Aufteilung Polens zwischen dem Deutschen Reich und Russland und damit die Auslöschung Polens bedeutete, schloss Putin in weiser Voraussicht mit Chinas Präsident Xi Jinping schon frühzeitig einen «Freundschaftsvertrag», der beim Treffen an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking von den beiden Diktatoren nochmals bekräftigt wurde.
Damit hat Putin freie Hand, mit seinem Überfall auf die Ukraine auch den gesamten Westen zu destabilisieren. Sei es durch die unverzichtbaren Lieferungen von Rohstoffen wie Gas, Erdöl und Kohle oder durch den grössten Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg Richtung europäischer Staaten.
Dass die von Putin als «Spezial-Operation zur Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine» befohlene Zerstörung und Auslöschung der Ukraine als freier Staat eine orchestrierte Aktion zwischen Russland und China darstellt, ist nicht von der Hand zu weisen. Nur scheut sich der Westen, dies auszusprechen. Denn die westliche Abhängigkeit von China ist inzwischen weit grösser als diejenige gegenüber Russland.
Dass die Livestream-Telefonate der europäischen Staatenlenker mit einem «Kriminellen», wie der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Putin in seinem Interview mit der ARD bezeichnet, dem Zar von Moskau nur «mehr Glaubwürdigkeit» verschaffen, ist längst eine Tatsache. Macron, Scholz & Co. machen sich zu willfährigen Helfern des russischen Despoten.
So werden Ausschnitte aus den Livestreams dieser Gespräche stante Pedes im Russischen Staatsfernsehen veröffentlicht, was eigentlich auch der europäischen Führung bekannt sein sollte.
«Seht her, so kriechen und betteln sie vor uns, die europäischen Demokraten». In etwa so tönte schon einmal ein Kommentar des russischen TV-Moderators. Das ist Balsam für die russischen Seelen. Kein Wunder steht das russische Volk wie eine Wand hinter dem «Kriegsverbrecher», wie US-Präsident Biden den russischen Killer nennt.
Politisch Andersdenkende der Lächerlichkeit und Verachtung preiszugeben, war schon seit jeher der Markenkern von Populisten. So sprach denn auch der «grösste Führer aller Zeiten», Adolf Hitler, vor seinem Scheinparlament von den «feigen Demokratien».
Etwas abgeschwächter erleben wir in der kleinen Schweiz diesen Speak auch und vor allem durch die SVP, deren Wahlplakate nicht selten «an Kampagnen aus der NS-Zeit erinnern», wie der Aargauer Nationalrat Beat Flach in der Aargauer Zeitung feststellte. Ganz zu schweigen von den Putin-Verstehern aus ebendieser Partei, allen voran Köppel und seine «Weltwoche». IM «DER STANDARD» war kürzlich ein Artikel zu lesen, «warum Putin Rechte und Esoteriker so sehr betört». https://www.derstandard.at/story/2000134145803/warum-putin-rechte-und-esoteriker-so-sehr-betoert
Dass die nach dem System «Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass» verfügten westlichen Sanktionen nicht funktionieren, erstaunt eigentlich niemanden. Wenn der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis das Kriegsverbrechen der russischen Arme in der ukrainischen Stadt Butscha partout nicht als «Kriegsverbrechen» bezeichnen will, weil dies der «diplomatischen Sprache» widerspreche, sagt dies eigentlich alles aus über die kriecherische Doppelmoral von vielen westlichen Politikern und Politikerinnen.
Machen wir uns nichts vor: Ein Grossteil von den Cassis und wie sie alle heissen, stehen Gewehr bei Fuss, um endlich wieder einträgliche Geschäfte im Sinne des neoliberalen Business as usual der abartigen Art tätigen zu können. Entsprechend zögerlich werden denn auch die Sanktionen der Schweiz gegen Russland ausgeführt.
Nun, ein Staat, der sich nicht zu schade war, Hitlers «Zahngold» und Kunstschätze der ermordeten Juden zu versilbern, scheint aus der Vergangenheit nichts gelernt zu haben. Jedenfalls einige seiner hohen Repräsentanten. Während in der Ukraine ein mutiges Volk auch um unsere europäische Freiheit kämpft, werden hierzulande immergleiche, salbungsvolle Worte abgesondert, die an Peinlichkeit kaum mehr zu überbieten sind.
Man wagt nicht daran zu denken, was passiert, wenn erst die Weltmacht aus Asien dem Rest der demokratischen Welt die Systemfrage stellt. Dieser Tag wird kommen. Früher oder später. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Angriffskrieg Putins gegen den Westen, gegen die EU, gegen die NATO und insbesonders gegen Amerika, stellt für China eine wertvolle Pilotstudie dar.
Es gibt allerdings europäische Politiker und Politikerinnen, die in dieser «Zeitenwende» an Statur gewonnen haben. Wie zum Beispiel Ursula von der Leyen, die vielgeschmähte Präsidentin der Europäischen Kommission, oder Robert Habeck, der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gehört ebenfalls dazu. Er weiss aus der historischen Erfahrung seines eigenen Landes, wohin Appeasement-Politik führt.
Erinnern wir uns in Auszügen kurz der Blut-, Tränen und Schweiss-Rede von Churchill am Pfingstmontag, 13. Mai 1940, vor dem britischen Parlament: «Ich habe nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiss. Es ist Krieg zu führen, zu Wasser, zu Land und in der Luft, mit all unserer Macht und mit all der Kraft, die Gott uns geben kann, und Krieg zu führen gegen eine ungeheuerliche Gewaltherrschaft, die nie übertroffen worden ist in der dunklen, beklagenswerten Liste menschlichen Verbrechens. Sie fragen, was unser Ziel ist: ich kann in einem Worte erwidern: es ist der Sieg – Sieg um jeden Preis – Sieg trotz aller Schrecken, Sieg, wie lang und hart auch immer der Weg sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Überleben.»
Es müsste eigentlich allen Akteuren der westlichen Politik klar sein, dass es ein «Business as usual» mit Putin niemals mehr geben kann. Geben darf. Ein Pakt mit dem Teufel ist noch nie gut ausgegangen. Das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Mephisto aus «Faust» lässt grüssen.
-
8.4.2022 - Tag der vielen Wahrheiten
Die Pandemie liess nicht nur Covid-Kranke sterben
Geht es allein nach den Todeszahlen, dann hat Österreich im Pandemiemanagement wenig Fortschritte gemacht. Im ersten Corona-Jahr 2020 starben hierzulande deutlich mehr Menschen als in gewöhnlichen Zeiten, und auch im Jahr darauf war das – wiewohl auf niedrigerem Niveau – nicht anders. Im Vergleich zur Prä-Covid-Periode 2016 bis 2019 betrug die Übersterblichkeit 2021 laut Berechnung der Austrian Health Academy 6,8 Prozent.
Besonders bemerkenswert ist dabei aber: Der hohe Todeszoll lässt sich keinesfalls allein mit jenen Infizierten erklären, die das Virus dahingerafft hat – im Gegenteil. "Der Großteil der Übersterblichkeit ist auf Menschen zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Todes gar nicht an Covid erkrankt waren", sagt Maria M. Hofmarcher, Co-Autorin der Studie: "Die Pandemie hat das Sterberisiko für alle erhöht." Gerade einmal acht Prozent der Todesfälle über das gewöhnliche Maß hinaus entfallen auf Corona-Kranke.
Warum das so ist? Hieb- und stichfeste Erklärungen sind schwierig, zumal den Forschern der Einblick in die Diagnosen der Non-Covid-Toten fehlt. Doch manche Annahmen liegen nahe.
Möglichst nicht ins Spital
Für das erste Jahr der Pandemie sei es logisch, dass viele Nichtinfizierte starben, sagt der ebenfalls an der Studie beteiligte Arzt Ludwig Kaspar. Möglichst nicht ins Spital fahren, habe die Botschaft im ersten strengen Lockdown gelautet, wenn jemand die Gesundheitshotline 1450 anrief. Das hätten manche zu sehr beherzigt – und seien zu Hause an Herzinfarkten oder anderen Komplikationen gestorben.
Doch erschreckend findet der Arzt, dass das Phänomen auch im zweiten Jahr nicht verpufft ist. Obwohl die Lockdowns allgemein immer lockerer genommen wurden, habe an den Spitälern offenbar weiterhin ein restriktives Klima geherrscht: "Die Menschen fühlten sich eher abgelehnt als empfangen."
Die Verschiebung vermeintlich nicht lebensnotwendiger Operationen, etwa von Eingriffen am Herzen, ist eine andere Erklärung. Hofmarcher verweist überdies darauf, dass die Personalausstattung der Spitäler schon vor der Pandemie nicht mit dem wachsenden Patientenandrang Schritt gehalten habe: Die zusätzliche Überlastung durch Corona könnte die Qualität der Versorgung beeinträchtigt haben.
Zu wenig Alternative für Kranke
Wenn die Spitäler keine adäquate Versorgung mehr bieten, müssten andere Ambulanzen oder niedergelassene Ärzten einspringen, sagt die Expertin – doch genau das sei ungenügend passiert. Einmal mehr habe es im kompetenzmäßig zwischen Bund und Ländern zersplitterten Gesundheitssystem an Kooperation gefehlt. Unverständlich sei es, dass die nun zentralisierte Gesundheitskasse keine tragende Rolle gespielt habe. Kaspar fügt an: "Dass Föderalismus für eine Pandemie schlecht ist, haben wir alle gesehen."
Ebenfalls kein erfreuliches Zeugnis stellt ein internationaler Vergleich mit weiteren neun EU-Staaten aus. In puncto Übersterblichkeit liegt Österreich 2021 weiter vorn als noch im Jahr davor. Länder wie Belgien mögen mittlerweile nicht zuletzt deshalb weniger Tote verzeichnen, weil die Situation im ersten Jahr umso dramatischer war – angeschlagene, ältere Menschen sind sozusagen früher weggestorben als hierzulande. Doch die Forscher lesen aus den Daten auch spezielle heimische Probleme heraus.
Das Hin und Her bei den Corona-Maßnahmen sei in anderen Ländern weniger ausgeprägt als in Österreich, sagt Hofmarcher: Der schwer verständliche Zickzackkurs habe die Moral bei der Einhaltung der Regeln untergraben – und in der Folge zu mehr Infektionen, Spitalpatienten und Todesfällen geführt.
Gamechanger nicht genutzt
Vor allem aber sei es nicht gelungen, die Impfung ausreichend als "Gamechanger" zu nutzen. Der statistische Vergleich zeige klar: je höher die Immunisierungsrate, desto geringer die Belegung der Intensivstationen mit Covid-Kranken – was auch zu weniger Todesfällen bei den Nichtinfizierten führe.
Jüngste Daten weisen auch für die Gegenwart keinen erfreulichen Trend aus: Laut Mortalitätsmonitoring der Stadt Wien zeigte sich bei den über 65-Jährigen in der letzten Woche erstmals im laufenden Jahr wieder eine eindeutige Übersterblichkeit in Österreich. Schreibt DER STANDARD.
Wer vor etwa drei Jahrzehnten auf der Autobahn A1 von der Westschweiz her kommend Richtung Bern fuhr, konnte irgendwo zwischen Payerne und der Stadt Bern an einer Autobahnüberführung die in riesengrossen Lettern gesprayte Botschaft lesen: «Es gibt der Wahrheiten viele. Wohlverstanden!»
Die Zeit wird kommen, in welcher die Corona-Pandemie politisch aufgearbeitet werden muss. Dass daraus unappetitliche, parteipolitische Hickhacks entstehen werden, die nicht unbedingt der Wahrheit, dafür aber der Parteiprofilierung verpflichtet sind, dürfte jetzt schon klar sein.
Bei all dem zu erwartendem Gewürge sollten wir dann, wenn das parteipolitische Gesülze über uns wie eine Lawine aus zusammengestanzten Worthülsen hereinbricht, die philosophische Weisheit des Sprayers von der Autobahn A1 in unseren persönlichen Bewertungen und Schnappatmungen nicht vergessen: «Es gibt der Wahrheiten viele. Wohlverstanden!»
PS: Ein paar Autobahnüberführungen weiter war eine weitere Botschaft, diesmal in Frageform, des vermutlich gleichen Sprayers zu lesen: «Besch ou älei?» (Bist du auch allein?)
Waren das noch Zeiten, als man bei der Fahrt auf der Autobahn mit philosophischen Weisheiten statt mit Sorgen über hohe Benzinpreise beglückt wurde!
-
7.4.2022 - Tag der Kriegsgewinnler
So verdienen Mineralölkonzerne Milliarden am Spritpreisanstieg
Diesel und Benzin haben sich seit Russlands Überfall auf die Ukraine erheblich verteuert. Laut einer neuen Greenpeace-Studie hat die Mineralölwirtschaft ihre Margen massiv ausgeweitet.
Europas Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber erwirtschaften laut einer Greenpeace-Studie Zusatzprofite in Milliardenhöhe durch den drastischen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise. Demnach hat die Branche ihre Margen im Windschatten des russischen Krieges erheblich erhöht. Besonders hoch sind diese Einnahmen in Deutschland.
Der Untersuchung zufolge hat die Mineralölbranche seit Russlands Invasion in der Ukraine zusätzliche Roherträge – also höhere Erlöse für Kraftstoff abzüglich der gestiegenen Kosten für Rohöl – von insgesamt etwa 3,3 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Dies entspreche einem sogenannten Krisenprofit von durchschnittlich 107 Millionen Euro pro Tag, heißt es in der bislang unveröffentlichten Studie. Sie wurde von dem Hamburger Energieexperten Steffen Bukold für Greenpeace erstellt und lag dem SPIEGEL vorab vor.
Am höchsten sind diese »Krisenprofite« laut der Studie in der Bundesrepublik: mit durchschnittlich 38,2 Millionen Euro pro Tag. Dahinter folgen Frankreich (13,3 Millionen Euro), Italien (12,5 Millionen Euro), Spanien (7,6 Millionen Euro) und Österreich (4,3 Millionen Euro).
Dabei füllen vor allem die sprunghaft stark gestiegenen Einnahmen aus dem Verkauf von Diesel die Kassen der europäischen Mineralölwirtschaft. In Deutschland ist dieser Kraftstoff neuerdings teurer als Super E10. Auf Diesel entfällt Greenpeace zufolge ein durchschnittlicher »Krisenprofit« von 94 Millionen Euro pro Tag, bei Ottokraftstoff sind es 13 Millionen.
Zugrunde liegt all diesen Zahlen ein Vergleich von Rohöl-, Raffinerie- und Tankstellenpreisen:
• Laut Studie verteuerte sich Rohöl der Nordsee-Referenzsorte Brent bis zum 22. März im Schnitt um 19,4 Cent je Liter.
• Der Raffineriepreis für Diesel hingegen stieg um mehr als 30 Cent – und an der Tankstelle wurden für den Liter im Mittel sogar 36,5 Cent mehr verlangt, vor Steuern wohlgemerkt.
• Benzin verteuerte sich ab Raffinerie um 20,5 Cent und an der Zapfsäule um durchschnittlich 26,7 Cent pro Liter.
• Die zusätzlichen Margen wurden mit den verkauften Mengen des jeweiligen Sprits multipliziert.
Die zusätzlichen Roherträge von 3,3 Milliarden Euro werden sich laut Studie auch in ähnlich hohen Gewinnsteigerungen für die Unternehmen niederschlagen.
Zwar müssten die Raffinerien höhere Kosten für von ihnen verbrauchtes Erdgas tragen, heißt es in der Studie. Im Gegenzug aber seien die Ausgaben für russisches Rohöl erheblich niedriger als die für das den Berechnungen zugrunde gelegte Nordseeöl Brent. Russisches Öl wird zurzeit mit deutlichen Preisabschlägen gegenüber Brent gehandelt.
Auch die von der Bundesregierung geplante vorübergehende Steuersenkung in Höhe von 14 Cent je Liter Diesel und 30 Cent je Liter Benzin würde die Profite der Mineralölwirtschaft nicht schmälern. Im Gegenteil: Es könnte sogar passieren, dass die Preise an der Zapfsäule nicht entsprechend stark fallen – und sich im Gegenzug die Margen erhöhen.
»Die Ölindustrie bereichert sich seit Jahrzehnten auf Kosten des Klimas und unser aller Zukunft. Nun zeigt sich, dass uns die Ölkonzerne mitten in einem furchtbaren Krieg auch noch schamlos über den Tisch ziehen«, sagte Martin Kaiser, der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, dem SPIEGEL.
Greenpeace fordert, dass Europas Regierungen kurzfristig durch eine neue Steuer die Krisenprofite der Konzerne abschöpfen und das Geld verwenden sollen, um sozial schwache Haushalte für ihre steigenden Energiekosten zu kompensieren.
Zugleich müsse die EU-Kommission die Dekarbonisierung des EU-Verkehrssektors beschleunigen. Ziel müsse sein, dass schon von 2028 ab keine Autos mit Verbrennungsmotors mehr neu verkauft werden dürften. Bislang ist dieses Zulassungsverbot für 2035 geplant. Schreibt DER SPIEGEL.
Also sowas Ungeheuerliches hätte wirklich niemand gedacht. Halt! Da war doch was?
Sind nicht seit Bestehen der Mineralölindustrie die Preise stets an Ostern an den Zapfsäulen gestiegen?
So kommt es halt, wenn der Staat Kernaufgaben dem «Markt» und damit der Wirtschaft überträgt. Kriegsgewinnler brauchen gar keinen Krieg oder Notlagen. Kriegsgewinnler gewinnen immer.
Wie das Beispiel «Osterverkehr» zeigt, genügt schon der Verdacht auf ein «mutmasslich» höheres Verkehrsaufkommen, um die Taschen der Gierhälse zu füllen.
Die «heilige Kuh» und das «goldene Kalb» des Marktes richten eben wirklich alles, solange es um Gewinne geht. Nur die Verluste werden sozialisiert und süffisant dem Staat vor die Hütte gekippt.
Frohe Ostern!
-
6.4.2022 - Tag der grössten Umweltsünder
Boomende Sonnenenergie: Wie sich die Schweizer Solarindustrie von China befreien will
Solarenergie anstatt Öl und Gas. Doch auch bei der Photovoltaik ist der Westen abhängig: von China. Die meisten Solar-Module und -zellen stammen von dort. Schweizer Unternehmen wollen die Solarindustrie zurück nach Europa holen.
Solarmonteure haben viel zu tun auf Schweizer Dächern. Sonnenenergie ist gefragter denn je. Die Nachfrage übersteigt das Angebot – bei Solarmodulen aus China.
Kunden müssen bis zu einem halben Jahr warten, sagt Lukas Meister. Seine Firma Clevergie ist auf Produkte für erneuerbare Energien spezialisiert. «Es kann auch sein, dass überhaupt kein Liefertermin genannt wird, weil die Situation zu unsicher ist». Unsicher, weil die Lieferketten wegen der Corona-Situation in China noch immer unterbrochen sind. Zudem benötigt China die Module selbst in grossen Mengen. Das Land setzt auch zunehmend auf die Sonne als Energielieferanten.
China als Klumpenrisiko
Schweizer Solarprodukt-Hersteller produzieren zwar hochwertige Solarmodule in der Schweiz. Doch ohne China ginge nichts. Fast alle Solarzellen und auch der Rohstoff Silizium, den man für dafür benötigt, stammen aus China.
Zudem gab es Kritik an der Solarindustrie in der Region Xinjiang, wegen Zwangsarbeit bei der Gewinnung der Rohstoffe und der Herstellung des Polysiliziums für die Zellen.
«Ich erachte die Abhängigkeit von China als kritisch», sagt Lukas Meister. «Die Abhängigkeit von Solarmodulen aus Asien ist fast höher als bei Erdölprodukten in anderen Ländern.»
Auch die Firma 3S in Thun ist abhängig von China. Das Unternehmen produziert individualisierte Solarmodule, die – ins Hausdach integriert – auch als Ziegel dienen. Die Module werden im eigenen Werk hergestellt. Die Produktion wachse jährlich um 30 Prozent. Doch die Zellen stammen auch aus China.
«Wenn wir aus irgendeinem Grund keine chinesischen Waren mehr haben und die Industrie in Europa noch nicht aufgebaut ist, können wir keine weiteren Solarprodukte herstellen», sagt Patrick Hofer-Noser, Geschäftsführer von 3S.
Eine Frage der Grösse
Die Firma Megasol Energie aus Deitingen SO erwähnt gerne ihre Leuchtturm-Projekte in Basel: Beim Amt für Energie und Umwelt oder bei Coop, wo ganze Fassaden mit Solarmodulen verbaut wurden, die als solche optisch kaum erkennbar sind. Doch auch dieses Unternehmen stünde ohne China still. Megasol produziert Standardmodule ebenfalls in China, im eigenen Werk.
Man könne die Solarindustrie, die nach 2010 von Europa nach China abgewandert ist, wieder zurückholen, meint Megasol-Mitgründer Daniel Sägesser. Doch es wäre eine Herausforderung, eine grosse Industrie neu anzusiedeln. «Das wäre in den ersten Jahren mit massiven Investitionen verbunden, die man nicht am Markt amortisieren kann», meint Sägesser.
Meyer Burger will Produktion zurückholen
Das Schweizer Solar-Unternehmen Meyer Burger schreibt seit 10 Jahren rote Zahlen. Die Produktion von Solarmodul-Maschinen hat das Unternehmen aufgegeben, nun will man den Kampf gegen die Solarmacht China aufnehmen.
Seit 2021 produziert Meyer Burger Solarmodule und -zellen in Deutschland. Noch nicht in grossen Mengen, doch das soll sich bald ändern. Unterstützt mit Fördergeldern der EU. Auch das Silizium stammt aus Europa.
Die chinesische Solarindustrie habe den Vorteil eines geschlossenen Ökosystems von Zulieferern, sagt Gunter Erfurt, Geschäftsführer von Meyer Burger. «Das ist in Europa noch nicht der Fall.» Sein Unternehmen habe aber grosse Pläne, es will zum «Gigawatt-Spieler» werden. Dafür müssten in Europa auch die Lieferketten aufgebaut werden. «Es ist alles noch vorhanden, die Wurzeln sind noch da, und man muss jetzt die Pflänzchen giessen, damit sie wieder schön und gross werden», sagt Erfurt.
Schweizer Solarindustrie will Standortförderung
3S-Geschäftsführer Patrick Hofer-Noser begrüsst solche Pläne. «Die Frage wird sein, was die Schweiz macht?». Der Standort Schweiz könne mit Forschung an ihren Hochschulen punkten und auch mit innovativen Solar-Startups.
Doch es brauche noch mehr, sagt David Stickelberger, Geschäftsführer von Swissolar. Industriepolitik sei notwendig, also Standortförderung, damit sich mehr Solarunternehmen in der Schweiz ansiedeln.
Eine umstrittene Forderung, vor allem in bürgerlichen Kreisen. Der Weg zu einer konkurrenzfähigen europäischen Solarindustrie steht noch am Anfang. Schreibt SRF.
Zu welchen Verwerfungen Abhängigkeiten von anderen Staaten führen, deckt nicht erst der Ukraine-Krieg mit aller Brutalität auf. Schon die Corona-Pandemie zeigte in erschreckender Art und Weise, dass die Schweiz nicht einmal mehr in der Lage war, einen simplen Stoff-Fetzen als Schutz vor dem Virus für die Bevölkerung zu produzieren.
Aber es sind nicht nur Kriege und Pandemien, die unsere verhängnisvolle Globalisierungspolitik als das entlarven, was sie letztendlich ist: Eine der grössten Gefahren nicht nur für die Menschheit, sondern für die Erde insgesamt. Der Klimawandel lässt grüssen! Billigstprodukte und Bestandteile für unsere hiesigen industriellen «Just-in-Time»-Produktionen umrunden den halben, wenn nicht gar den ganzen Erdball, bevor sie bei uns eintreffen. Das hinterlässt eindeutige Spuren. Weltweit. Denn eine globalisierte Exportwirtschaft führt auch zur Globalisierung der Umweltprobleme.
Langfristig wird für die auf Dienstleistungen umgemodelten Staaten ein weiteres Problem hinzukommen: Wie sollen die Millionen von Menschen aus dem Niedrigstlohnsektor beschäftigt werden? Auf diese Frage hat nicht einmal Amerika eine Antwort, auch wenn Donald Trump unter vielen anderen Versprechen mit dem Slogan «I'll bring back the jobs from China to the USA» die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Dass er keinen einzigen Job aus China in die USA zurückbrachte, ist eine andere Geschichte.
Wenn die Schweizer Solarindustrie (wieder) konkurrenzfähig werden will, wird die Politik nicht umhin kommen, auf ein altes Instrument aus der Mottenkiste der Steuerung nationaler Interessen zurückgreifen müssen: Die Zölle. Der Begriff «Einfuhrsteuern» wird zwar von den Hardcore-Neoliberalen und Apologeten der Konzernpolitik als Teufelszeug verflucht, ist aber trotzdem nichts anderes als ein wirksames Element zur Steuerung einer vernünftigen Industrie- und Klimapolitik. Mit Abschottung hat er rein gar nichts zu tun. Mit Verantwortlichkeit gegenüber dem eigenen Land und dem Erdklima jedoch sehr viel.
Die vielgescholtene EU hat dies im Ansatz bereits begriffen. Sie muss die hehren Absichten nur noch umsetzen.
-
5.4.2022 - Tag der Träume an das Gute im Menschen
530 Firmen zahlten Dividenden – trotz Corona-Hilfen
Viele Unternehmen in der Schweiz haben unter der Coronakrise gelitten. Ohne finanzielle Unterstützung hätten sie die Pandemie wohl nicht überstanden. Das sagt ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK). Der Bericht hält fest: Selbst mit Krediten, für die der Bund bürgte, gerieten viele Unternehmen während der Pandemie in Schieflage. Trotz eines Verbots hätten 530 Firmen aber auch Gewinne ausgeschüttet, in Form von Dividenden. Das würde gegen das Dividendenausschüttungsverbot verstossen.
Diese Unternehmen hatten ein Bürgschaftsvolumen von 158 Millionen Franken, wie die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in einem am Montag veröffentlichten Bericht festhält. An Dividenden wollten sie insgesamt 209 Millionen Franken ausschütten.
Bis Ende September des Vorjahrs gab es insgesamt 2151 mutmassliche Verstösse gegen das Dividenden- oder Kapitalaufstockungsverbot. 258 waren noch in Abklärung. In 242 Fällen bestätigte sich der Missbrauchsverdacht nicht.
1627 Fälle kamen nicht zur Anzeige
Weitere 1627 Fälle korrigierte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ohne Anzeige. Strafanzeigen reichte es in 24 Fällen mit einem Kreditvolumen von 5.2 Millionen Franken ein. Insgesamt sah sich das Seco bis zum Ende des dritten Quartals 2021 mit 8739 Verdachtsfällen von möglichen Missbräuchen konfrontiert.
71 Prozent davon hatte die EFK gemeldet. Mehr als 5000 Fälle waren bis Ende des dritten Quartals 2021 abgeschlossen. In 84 Prozent dieser Fälle erwies sich der Missbrauchsverdacht als gerechtfertigt. Das führte zu Korrekturen oder/und Strafanzeigen. Schreibt SRF.
Wer etwas anderes erwartet hat, ist entweder ein/e Narr / Närrin oder ein/e unverbesserliche/r Träumer / Träumerin mit dem Glauben an das Gute.
-
4.4.2022 - Was im Krieg zuerst stirbt und was überhaupt nicht sterben kann
Russische Kriegsverbrechen: David Nauer – «Diese Bilder werden den Gang des Kriegs verändern»
Nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist das Ausmass der Gräueltaten an der Zivilbevölkerung sichtbar geworden. Vor allem die Bilder der vielen getöteten Zivilisten in Butscha lösten international Entsetzen aus. Auslandredaktor David Nauer war diese Woche in der Ukraine. Er hat sich die Fotos genauer angeschaut.
SRF News: Die Fotos vermitteln den Eindruck, dass das russische Militär ukrainische Zivilisten hingerichtet oder wahllos erschossen hat. Wie glaubwürdig sind diese Fotos?
David Nauer: Sie sind glaubwürdig. Westliche Journalisten, die ich zum Teil persönliche kenne, sind vor Ort und bestätigen, was auf den Fotos zu sehen ist. In Butscha liegen zahlreiche Leichen von Zivilisten auf den Strassen; einige mit auf den Rücken gebundenen Händen oder jemand der auf seinem Fahrrad erschossen wurde, die Einkäufe liegen neben ihm. Es gibt Zeugenaussagen, dass es russische Soldaten waren, die Zivilsten exekutiert haben. Wenn man alles zusammen nimmt, hat die russische Armee im Umland von Kiew schwere Kriegsverbrechen begangen.
Zivilisten im Krieg gezielt zu töten, gilt gemäss der Genfer Konvention als Kriegsverbrechen. Ist das ein neues Ausmass an Grausamkeit in diesem Krieg?
Dieser Krieg war von allem Anfang an grausam. Die Russen schiessen seit Wochen die Stadt Mariupol in Schutt und Asche, eine Stadt mit Hunderttausenden Einwohnern. Aber diese Verbrechen wie in Butscha sind monströser und brutaler. Die Leichen mit Schusswunden, mit auf den Rücken gebundenen Händen, das sind Bilder, die in der Ukraine, aber auch im Westen wahnsinnig viel auslösen. Empörung und Wut sind zu spüren und auch politisch lösen diese Bilder etwas aus. Ich glaube, dass diese Bilder den Gang des Krieges verändern.
Sie sprechen damit auch die Friedensverhandlungen an?
Ja, denn die Friedensverhandlungen sind viel schwieriger geworden. Wie soll die Ukraine nun einem Kompromiss mit Russland zustimmen und vielleicht sogar Gebiete abtreten? Mit einem Land, dessen Soldaten mutmasslich Zivilisten gezielt ermorden? Diese Verbrechen haben einen baldigen Friedensschluss sehr viel schwieriger und unwahrscheinlicher gemacht.
Für den Westen ist klar, Russland muss für die Kriegsverbrechen bestraft werden und will die Sanktionen massiv verschärfen. Wie scharf müssen sie sein, damit Russland sich zurücknimmt?
Von Sanktionen kann kein Kriegsende erwartet werden. Russland ist schon jetzt weitgehend vom internationalen Finanzmarkt und auch zu einem guten Teil von westlichen Waren und Dienstleistungen abgeschnitten – trotzdem führt Putin den Krieg weiter. Die Wirtschaft scheint ihn im Moment nicht zu interessieren. Deswegen denke ich, dass Sanktionen höchstens langfristig etwas bewirken können, indem sie Russland schwächen. Das vor allem, wenn sie hart sind, etwa der Boykott von russischem Gas und Öl, was immer wieder gefordert wird. Allerdings würde so eine Massnahme auch für den Westen sehr teuer. Die westlichen Gesellschaften müssen bereit sein, einen hohen Preis zu bezahlen, um die russische Aggression zu stoppen.
Aus der Region um Kiew haben sich die russischen Truppen nun zurückgezogen. Muss nun befürchtet werden, dass nach diesem Rückzug Kiew später doch wieder angegriffen wird?
Kurzfristig ist Kiew sicherer geworden. Die ukrainische Armee hat die Russen vor der Hauptstadt gestoppt und schwer in Bedrängnis gebracht, deswegen sind die Russen nun abgezogen. Aber es wohl nur ein taktischer Rückzug, denn die Truppen dürften nun einfach in den Osten verlegt werden – der Kreml will den Donbas erobern und er braucht dort mehr Feuerkraft. Das heisst, die relative Ruhe für Kiew bedeutet mehr Gewalt im Osten. Das Gespräch führte Roger Brändlin. Schreibt SRF.
Ja, es sind verstörende Bilder, die uns durch Mark und Bein gehen und uns auf schockierende Art und Weise zeigen, auf welcher Brutalitätsstufe der russische Angriffskrieg in der Ukraine stattfindet.
Die Empörung in den westlichen Staaten ist gross und selbst die Schweizer Putinversteher schweigen für einmal. Jedenfalls bis jetzt.
Und ja, anders als schwerste Kriegsverbrechen kann man die Greueltaten der russischen Armee in Butscha und Mariupol nicht bezeichnen. Allerdings waren sie das auch in Tschetschenien, Georgien, in der Ostukraine und in Syrien.
Russlands Armee unter dem Oberbefehl von Putin folgt der immergleichen Blaupause. Nur haben uns die Kriegsverbrechen an den vorgenannten Schauplätzen damals nicht wirklich interessiert. Es wurden von unseren Qualitätsmedien auch keine Live-Ticker eingerichtet. Die westlichen Sanktionen fanden entweder überhaupt nicht statt oder waren so zahm, dass sie niemandem weh taten.
Ich befürchte, dass sich etliche westliche Politiker*innen heimlich händeringend danach sehen, endlich wieder befreit von Sanktionen mit dem Schlächter von Moskau einträgliche Geschäfte abschliessen zu können.
Laut einer derzeit viel zitierten Floskel stirbt in jedem Krieg die Wahrheit zuerst. Ganz im Gegensatz zur Moral. Was nie vorhanden war, kann auch nicht sterben. Denn wäre die Moral auch nur im Ansatz vorhanden, gäbe es in unserer aufgeklärten Welt längst keine Kriege mehr.
Die menschliche Gier, gepaart mit Naivität und Dummheit, lässt Moral nicht zu. Auch nicht in der «hehren Wertegemeinschaft des Westens».
Die «westlichen» Kriege seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren auch nichts anderes als Kriegsverbrechen. Was die russischen Angriffskriege dennoch in keiner Art und Weise rechtfertigt.
PS: Warum «Moral», wie wir sie uns vorstellen, in der menschlichen DNA nicht stattfinden kann, erklärt Ihnen Wikipedia.
-
3.4.2022 - Tag der gerubelten Politiker
Die absurde Mär von den zwei Putins - die Wahrheit ist: Deutschland wurde verraten
Deutschland braucht einen Untersuchungsausschuss, um zu klären, wie es geschehen konnte, dass das Land von Putin abhängig gemacht und so die nationale Sicherheit aufs Spiel gesetzt wurde. Wer waren die Profiteure?
Zu den schärfsten Waffen des Parlaments gehört die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Sobald ein Viertel der Abgeordneten beschließt, dass bei Politikern oder Regierungsmitgliedern ein Fehlverhalten vorliegt, das der Aufklärung bedarf, muss der Bundestag entsprechend handeln.
Der Untersuchungsausschuss hat weitgehende Beweiserhebungsrechte, das macht ihn zu einem gefürchteten Instrument. Er kann nach Belieben Sachverständige benennen und Zeugen vorladen. Er darf sogar Zeugen in Haft nehmen lassen, wenn diese nicht aussagen wollen. Das Einzige, was ihn von einem normalen Prozess unterscheidet: Niemand wandert nach dem Abschlussbericht ins Gefängnis. Das zu entscheiden, bleibt einem ordentlichen Gericht vorbehalten. Dafür tagt der Ausschuss öffentlich, sodass sich jeder ein Bild vom Stand der Untersuchung machen kann.
Warum ich das schreibe? Weil ich glaube, dass wir dringend einen Untersuchungsausschuss brauchen, der die Frage klärt, wie es geschehen konnte, dass sich Deutschland von seinem ärgsten Feind abhängig gemacht hat. „The Plot Against America“ hat Philip Roth einen berühmten Roman genannt. „The Plot Against Germany“ könnte man den Untersuchungsauftrag in Anlehnung an Roth nennen. Wer hat die Sicherheitsinteressen unseres Landes verraten und warum?
Staatsanwälten wird geraten: Folgt der Spur des Geldes
Nach Zeugen der Anklage muss man nicht lange suchen. Man braucht nur den Bundeskanzler vorladen. Am Sonntag war Olaf Scholz bei „Anne Will“ zu Gast, wo er noch einmal ausführte, warum ihm keine andere Wahl bleibe, als aus Russland weiter Gas und Öl zu beziehen.
Wir befinden uns in der sechsten Kriegswoche. Jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten über russische Kriegsverbrechen. Das Bundeskabinett debattiert über einen Raketenschirm, der uns vor Angriffen aus dem Osten schützen soll. Und dennoch überweisen wir weiterhin Millionen nach Moskau, weil andernfalls die Bänder stillstünden und das Land in eine schwere Rezession taumeln würde. Braucht es eines weiteren Beweises, dass die Sicherheit Deutschlands auf sträfliche Weise untergraben wurde? Ich denke, das würde vor jedem Gericht der Welt als Anfangsverdacht durchgehen.
Was war das Motiv: Dummheit? Berechnung? Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass es nicht besonders schlau ist, sich bei lebenswichtigen Gütern auf einen Lieferanten zu konzentrieren. Statt das Risiko zu streuen, also nicht die Eier alle in einen Korb zu legen, wie die schöne englische Redewendung lautet, haben die Verantwortlichen genau das getan. Wer Einwände äußerte oder zur Vorsicht riet, wurde abgebürstet.
Folgt der Spur des Geldes, ist eine Anweisung, die Staatsanwälten an die Hand gegeben wird, wenn sie Mafiastrukturen durchleuchten sollen. Das wäre auch in diesem Fall der erste Aufklärungsauftrag: Wo sitzen die Profiteure dieser selbstmörderischen Energiepolitik? Wer hielt Kontakt in den Verwaltungsapparat und in die Parteizentralen? Über wen liefen die Drähte nach Moskau?
Zu den Zeugen sollten auch Gerhard Schröder und Lars Klingbeil gehören
Alle schauen auf Gerhard Schröder, den deutschen Statthalter des Kreml-Herrschers. Aber kein Capo agiert allein. Hinter jedem Mafia-Boss stehen Helfer und Unterbosse. Einige Namen sind bekannt. Ganz oben auf die Zeugenliste gehört der ehemalige Daimler-Manager Klaus Mangold, der als Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft Jahre lang das Geschäft Putins in Deutschland besorgte.
Bis heute sitzt Herr Mangold in diversen Beiräten, wo man seine Beziehungen schätzt. Hat er selbst profitiert? Hat er andere profitieren lassen? Geld war immer in Hülle und Fülle da, das machte ja einen Teil der russischen Verführungskraft aus. Die Russen sind keine Knauser, wenn es darum geht, die Dinge in ihrem Sinne zu bewegen. Millionen flossen über Jahre in die politische Landschaftspflege. Von den Empfängen in der Botschaft schwärmen Gäste noch heute.
SPD: Diverse Verbindungen nach Russland und zu Putin
Die Verbindungen in die SPD wären einen eigenen Ermittlungsschwerpunkt wert. Da ist Heino Wiese, ehemaliger Landesgeschäftsführer der SPD Niedersachsen und einer der umtriebigsten Kontaktanbahner im deutschen Putin-Reich. Auch Lars Klingbeil, lange Jahre Generalsekretär der SPD und heute Parteichef, wäre sicher ein lohnender Zeuge.
Die Ausschussmitglieder könnten ihn zum Beispiel zu seinem Engagement in dem Verein „Deutschland Russland – Die neue Generation“ befragen, einem dieser Netzwerkverbünde, die sich als „non profit“ und unabhängig bezeichnen. Im Kuratorium neben Klingbeil: Maria Kotenewa, Gattin des früheren russischen Botschafters in Berlin, sowie das Gazprom-Aufsichtsratsmitglied Viktor Martynow. Unter den Sponsoren: Staatsunternehmen wie Gazprom Germania oder der Stahlkonzern Severstal.
Grosny, Georgien, die Krim und Bombenhilfe für Assad – und dann Nord Stream 2
Die Russlandfreunde verbreiten nun, Putin habe sich radikal gewandelt. Es gäbe einen Putin 1 und einen Putin 2. Putin 1 sei der Deutschlandfreund, der davon geträumt habe, Russland einen geachteten Platz im Kreis der Völkergemeinschaft zu verschaffen. Das sei der Putin, auf den man bis zum Schluss gesetzt habe. Putin 2 ist der ruchlose Diktator, der sich fremde Länder nimmt wie andere Leute Glaskugeln.
Der Schönheitsfehler an dieser Erzählung ist, dass Putin 1, wenn es ihn denn je gegeben haben sollte, schon ziemlich lange von der Bildfläche verschwunden ist. Die Bilder des zerstörten Mariupol gleichen auf gespenstische Weise denen aus dem zerbombten Grosny, und dessen Zerstörung liegt jetzt auch schon fast 30 Jahre zurück.
Nach der Bombardierung Grosnys folgte der Einmarsch in Georgien, die Annexion der Krim, die Infiltration der Südukraine, die Bombenhilfe für Assad – ohne dass dies die Front der Russlandfreunde nennenswert beeindruckt hätte. Im Gegenteil: Jede Aggression wurde mit dem Argument beantwortet, jetzt müsse man erst recht im Gespräch bleiben. Es ist zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geraten, aber der Vertrag zum Bau von Nord Stream 2 wurde erst nach dem Griff Putins nach der Krim abgeschlossen, nicht vorher.
Schwesigs Tarnorganisation – dagegen stinkt sogar die Spendenaffäre der CDU ab
Es gibt auch ein paar interessante Nebenaspekte. Die Abgeordneten könnten sich die Entscheidung näher ansehen, selbst die Kontrolle über den größten deutschen Gasspeicher an Gazprom zu übertragen. Wie wir heute wissen, liegt der Füllstand seit Anfang 2021 weit unter dem Normalpegel. Hat da niemand im Wirtschaftsministerium hingeschaut? Oder war es den Verantwortlichen egal?
Und wie verhält es sich mit der Tarnorganisation, die Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ins Leben gerufen hat? Was als Umweltstiftung firmierte, war in Wahrheit nichts anderes als ein Vehikel zur Durchsetzung russischer Interessen in Deutschland. 20 Millionen Euro kamen direkt von Gazprom. Dagegen stinkt sogar die Spendenaffäre der CDU ab.
Melnyk kontert Steinmeiers Geschichtsklitterung zu Nord Stream 2
Jeder Untersuchungsausschuss strebt einem Höhepunkt zu. Wenn es einen Architekten der deutschen Russlandpolitik gibt, dann den heutigen Bundespräsidenten. Es war Frank-Walter Steinmeier, der erst als Kanzleramtschef unter Schröder und dann als zweimaliger Außenminister unter Angela Merkel die Abhängigkeit von russischer Energie als Projekt zur Friedenssicherung verstand und vorantrieb.
Noch vor einem Jahr setzte Steinmeier sich für die neue Gaspipeline ein, dieses Mal mit dem Argument, dass Deutschland Russland aufgrund seiner Geschichte den Bau schulden würde. Die historische Verantwortung gebiete die Fertigstellung des Vorhabens, erklärte er in einem Interview.
Es blieb dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk vorbehalten, dieses historisch waghalsige Argument als Geschichtsklitterung zurückzuweisen. Deutsche Truppen waren 1941 ja nicht nur in Russland, sondern auch in die Ukraine eingefallen – ein Umstand, der Steinmeier offensichtlich entfallen war. Vielleicht war es ihm auch egal, weil er die Ukraine ohnehin längst dem russischen Imperium zurechnete.
Damals machte der Protest des Botschafters im Bundespräsidialamt nicht viel Eindruck. Wer war schon Andrij Melnyk? Ein Mann, den man nicht weiter ernst nehmen musste.
Auch Melnyk könnte einiges erzählen, man müsste ihn nur einladen. Schreibt Jan Fleischhauer in FOCUS.
Der ehemalige SPIEGEL-Kolumnist Jan Fleischhauer («Der schwarze Kanal») gehört noch immer zu den Besten und Meistgelesenen seines Fachs in Deutschland. Seine mit scharfer Klinge und in hervorragendem Deutsch geschriebenen Kolumnen zu kommentieren hiesse Eulen nach Athen zu tragen.
Fleischhauers Kolumne über Ex-Kanzler Gerhard Schröder und die deutsche Russland-Connection ist auch für Schweizer Leser*innen interessant: «Folge der Spur des Geldes»! Man muss kein esoterischer SVP-Verschwörungstheoretiker sein, um Fleischhauers Empfehlung auch auf die Schweiz zu übertragen.
Es darf angenommen werden, dass einige Schweizer Putin-Versteher*innen ebenfalls «gerubelt» worden sind. Einem Roger Köppel ist das durchaus zuzutrauen, bei Franz Grüter und Peter Spuhler (Stadler Rail) dürften es eher wirtschaftliche Verstrickungen sein.
Es gilt selbstverständlich für alle Genannten und die gesamte unappetitliche SVP-Esoteriker-Verschwörungs-Clique die Unschuldsvermutung.
-
2.4.2022 - Tag der ungehemmten Globalisierung
21,8 Millionen Franken zum Schutz von Kindern und Jugendlichen auf der west- und nordafrikanischen Migrationsroute
Jedes Jahr begeben sich 5 Millionen Kinder und Jugendliche von West- und Nordafrika aus auf Migrationsrouten. Oft sind sie unbegleitet und damit grossen Risiken ausgesetzt. Der Bundesrat hat deshalb an seiner Sitzung vom 30. März entschieden, für die kommenden vier Jahre rund 21,8 Millionen Franken zu ihrem Schutz und zur Förderung ihrer Zukunftsperspektiven vor Ort zur Verfügung zu stellen.
Im Rahmen ihrer Migrationsaussenpolitik unterstützt die Schweiz Herkunfts- und Transitländer, um den Schutz und die Integration von Migrantinnen und Migranten vor Ort zu verbessern und gleichzeitig längerfristig auf die vielschichtigen Ursachen irregulärer Migration und Flucht einzuwirken. Nord-, Zentral- und Westafrika gehören neben dem Mittleren Osten, dem Westbalkan und dem Horn von Afrika zu den Schwerpunkten der migrationsaussenpolitischen Aktivitäten der Schweiz.
Die innerafrikanische Migration ist in West- und Nordafrika ein bedeutendes Phänomen. Armut, fehlende wirtschaftliche Perspektiven, bewaffnete Konflikte, Klimawandel, aber auch die insbesondere für Mädchen rigiden Traditionen und sozialen Gepflogenheiten sind häufige Gründe, die Heimat zu verlassen. Die Covid-19 Pandemie und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen haben den Migrationsdruck in der Region zusätzlich erhöht und die Migrationsrouten noch gefährlicher gemacht. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen leben über 45 Millionen Menschen ausserhalb ihres Ursprungslandes. Davon sind über 5 Millionen teilweise unbegleitete Kinder und Jugendliche. Fast 50 % davon sind Mädchen und junge Frauen. Oft riskieren sie, Opfer von Menschenhandel zu werden, in die Fänge von Drogenhändlern und anderen kriminellen Organisationen zu geraten oder von extremistischen, terrornahen Organisationen angeworben zu werden.
Verbesserung der Perspektiven von migrierenden Kindern und Jugendlichen
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und das Staatssekretariat für Migration (SEM) lancieren deshalb ein gemeinsames Projekt zur Verbesserung der Lebensperspektiven von Kindern und Jugendlichen. Es setzt sich insbesondere für den Schutz ihrer Rechte ein, schützt sie vor Missbrauch und ermöglicht ihnen den Zugang zu einer Grundausbildung. Gleichzeitig schafft es Optionen, damit sich die Kinder und Jugendlichen in ihren Ursprungsländern und -regionen besser integrieren können und sich nicht auf die gefährliche Weiterreise über das Mittelmeer nach Europa begeben.
In einer ersten Phase konzentriert sich das Projekt auf Tunesien, Marokko, Guinea, Mali und Niger. Der Grossteil der Mittel ist für die Betreuung und Integration der Kinder und Jugendlichen in der Region vorgesehen. Rund 26% werden in Marokko und Tunesien umgesetzt – Länder, von denen aus Minderjährige regelmässig irregulär nach Europa ausreisen.
Das Vorhaben entspricht dem thematischen Schwerpunkt «Migration» der Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 und ergänzt ein Schwesterprojekt entlang der Ostafrikanischen Migrationsroute, das bereits von der Schweiz finanziert wird. Quelle: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA.
Bundesrat Alain Berset präsentierte an der Konferenz die Massnahmen der Schweiz zur Finanzierung von Projekten zum Schutz der gefährdeten ukrainischen Kulturgüter in der Höhe von 750'000 Franken und 100'000 Franken für den Notfonds zum Schutze des Kulturerbes der UNESCO sowie eine ausserordentliche Unterstützung der Stiftung Bibliomedia Schweiz zum Aufbau einer Sammlung von Büchern in ukrainischer Sprache. Ausserdem kündigte er für 2023 ein zweites Treffen der europäischen Kulturministerinnen und -minister in Davos zum Thema hohe Baukultur an, das an die von der Schweiz 2018 organisierte erste Konferenz anknüpfen wird. Quelle: Bundesamt für Kultur BAK.
«Wir müssen wissen, dass unsere weltweiten, wirtschaftlichen Verflechtungen auch ihre Kehrseite haben. Einmal sind wir für viele mitverantwortlich geworden, was in den Ländern geschieht, mit denen wir Handel treiben, Bankgeschäfte abschliessen und an denen wir Geld verdienen. Und wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen.» Sagte Bundespräsident Willi Ritschard am 1. August 1978 in seiner Rede zum Schweizer Nationalfeiertag.
Ritschard sah zwar voraus, wohin die ungezügelte Globalisierung und die Umwandlung der Schweiz in eine Dienstleistungsgesellschaft letztendlich führen würde. Welche dramatischen Klima-Folgen durch die Globalisierung entstehen würden, waren damals noch kein Thema.
Doch seinen mahnenden Worten folgten keine Taten. Dazu waren er und seine SP schon damals viel zu schwach gegen den monolithischen Block der «bürgerlichen» Neoliberalen.
Die aufgeführten Artikel aus einer einzigen Woche von (nur) zwei Bundesämtern – und das sind noch nicht mal alle – lassen keinen Zweifel an Ritschards Befürchtungen. Im Gegenteil: Sie bestätigen sie. In der gleichen Woche wurden ebenfalls an einer Geberkonferenz 20 Millionen Schweizer Franken zu Gunsten der UNO für die Afghanistan-Hilfe gesprochen. Die Liste liesse sich noch weiterführen.
Ein hoher Preis in einer einzigen Woche, um zu den «Guten» der westlichen «Wertegemeinschaft» zu gehören.
Der Tag wird kommen, an dem die Vertreter*innen der «bürgerlichen» Parteien FDP, SVP, GLP und Mitte Mühe bekunden werden, dem Schweizer Volk glaubhaft zu erklären, dass sich beispielsweise die AHV-Revision nur mit einer Erhöhung des Eintrittsalters in die Pension lösen lasse.
-
1.4.2022 - Tag der intelligenten Vierbeiner
Daran erkennst du, ob dein Hund intelligent ist
Sieht schon niedlich aus, wenn Hunde ihren Kopf nach links oder rechts neigen, wenn sie gerufen werden oder auf ein Kommando hören sollen. Doch hinter der Kopfbewegung könnte viel mehr stecken, wie Forscher nun herausgefunden haben.
Manch ein Frauchen und Herrchen würden ohne zu zögern behaupten, dass sie sich mit ihrem Haustier blind verstehen. Doch jedes noch so eingespielte Team kommt nicht ganz ohne Sprache aus. Wenn es darum geht zu entschlüsseln, wie viel Hunde von den Kommandos wie „Sitz“, „Platz“ oder „Komm“ tatsächlich verstehen, hat die Wissenschaft bereits einige erstaunliche Erkenntnisse präsentiert.
So fand ein Forscherteam der ungarischen Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) in Budapest heraus, dass die Vierbeiner Sprache ähnlich wie wir Menschen verarbeiten. In einer weiterführenden experimentellen Studie unter dem Titel „Genius Dog Challenge“ entdeckten die Verhaltensforscher sogar, dass sehr intelligente Hunde sich die Namen von bis zu zwölf Spielsachen merken können. Das Experiment dauerte insgesamt 24 Monate lang.
Klingt unglaublich, oder? Das ist aber nicht die einzige Erkenntnis, die aus der „Genius Dog Challenge“ mit insgesamt 40 Hunden gewonnen werden konnte. Wie die Forscher in einem weiteren Beitrag im Fachmagazin „Animal Cognition“ nun bekannt machten, hatten die besonders intelligenten Hunde eine ganz bestimmte Sache gemeinsam.
Hunde, die ihren Kopf häufiger neigen, sind scheinbar intelligenter
Ja, du hast richtig gelesen. Die Geste spiegelt offenbar eine erhöhte Aufmerksamkeit des Tieres wider. Je nachdem, ob dein Hund eher die rechte oder linke Pfote bevorzugt, neigt er auch seinen Kopf in die entsprechende Richtung. Das haben die ungarischen Ethologen zumindest in ihrem Experiment beobachten können.
Die sieben Border Collies der „Genius Dog Challenge“, die sich mit zwölf Spielzeugnamen mit Abstand am meisten merken konnten, neigten ihr Haupt wesentlich häufiger als ihre weniger begabten Studienteilnehmer, wenn ein bestimmtes Spielzeug per Kommando apportieren sollten. Die Seite, zu der sie ihren Kopf hinneigten, änderte sich dabei während des gesamten Versuches nicht.
Insgesamt wurden 40 Hunde unterschiedlicher Rassen getestet. Davon stellten sich sieben Border Collies als besonders Sprach-affin heraus. Besonders auffällig: Diese sieben Border Collies neigten in 43 Prozent der Fälle ihren Kopf zur Seite, sobald sie ein Kommando hörten. Dieses Verhalten legten die 33 anderen Hunde in nur zwei Prozent der Fälle an den Tag. Zugegeben: Mit gerade einmal sieben Hunden, die vermehrt das Kopf-neige-Verhalten an den Tag legen, ist die spezielle Tiergruppe nicht besonders groß und außerdem besteht sie nur aus einer Hunderasse.
Aber die Studienergebnisse der ungarischen Forscher liefern einen eindeutigen Hinweis darauf, dass die zunächst niedlich aussehende Kopfbewegung der Fellnasen in Zusammenhang mit ihrer Konzentration- und Aufnahmefähigkeit steht. Diese These soll in weiteren Studien mit verschiedenen Hunderassen weiter überprüft werden. Denn auch im ganz normalen Alltag und der Interaktion mit ihren Besitzern neigen manche Hunde häufiger als andere den Kopf. Inwiefern sich dieses Verhalten deuten lässt, wollen die Ethologen nun herausfinden. Fabuliert DIE WELT.
Sollten Sie trotz diesem fundierten WELT-Artikel auf höchstem wissenschaftlichen Level immer noch nicht erkennen, ob Ihr Hund intelligent ist oder einfach nur dumm, liegt es an Ihnen.
Eines aber ist gewiss: Ihr Hund kennt Ihren Geisteszustand ganz genau.
Vielleicht besser, Sie fragen ihn nicht danach.
-
31.3.2022 - Tag der üblichen Problemlösungen im Hohen Haus von Bern
Bundesrat fällt Richtungsentscheide für bessere Versorgungssicherheit in der Schweiz
Die Wirtschaftliche Landesversorgung (WL) beruht in der Schweiz auf einer engen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat. Dieses System hat sich bewährt und soll gestärkt werden. Die COVID-19-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Komplexität sowie die Verletzlichkeit der Versorgungssysteme haben offensichtlich gemacht, dass die WL reformiert werden muss. Ein Ausbau und eine Optimierung der Organisation erweisen sich als unerlässlich. Der Bundesrat hat am 30. März 2022 beschlossen, die Führungsstruktur der WL anzupassen und die personellen Ressourcen aufzustocken.
Die Grundkonstruktion des Landesversorgungsgesetzes soll beibehalten werden. Nur durch die aktive Mitwirkung von Wirtschaft, Bund und Kantonen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft kann die Widerstandsfähigkeit der Schweiz gestärkt werden. Der Projektschlussbericht «Reform wirtschaftliche Landesversorgung 2021» stützt diese Erkenntnis, legt aber dar, dass die Führungs- und Organisationsstruktur der WL und die Unterstützung der Fachbereiche bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt.
Gegenwärtig wird die WL-Organisation vom Delegierten für wirtschaftliche Landesversorgung (DWL) in einem Nebenamt von 40% geleitet. Die Praxis hat gezeigt, dass das nicht ausreichend ist, um selbst in «normalen Zeiten» die Leitung der WL sicherzustellen und dem Anspruch an die Verfügbarkeit der Führungsperson gerecht zu werden.
Die Stelle der oder des Delegierten soll deshalb so schnell wie möglich in einem Vollzeitpensum besetzt werden. Die oder der Delegierte soll auch in Zukunft über eine ausgewiesene Wirtschaftskompetenz verfügen und in Wirtschaft und Politik gut vernetzt sein. Entsprechend werden auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft eng in das Auswahlverfahren bei der Stellenbesetzung einbezogen werden.
Unter der neuen Leitung soll auch die personelle Situation im BWL verbessert werden, was vor allem auch die Arbeit der Miliz in den Fachbereichen erleichtert. Zudem sollen die Kantone vermehrt einbezogen, die Kommunikation und Information intern und extern verstärkt sowie das Controlling und Risikomanagement verbessert werden. Nach dem Fall der Berliner Mauer und der Beendigung des Kalten Krieges wurde der Personalbestand im BWL von rund 50 Vollzeitstellen sukzessive auf heute knapp 32 Vollzeitstellen abgebaut. Anfänglich bestätigte sich die Einschätzung, dass sich die Risiken für die Versorgung des Landes vermindern würden. Sie musste aber aufgrund von Veränderungen in den Wirtschaftsstrukturen revidiert werden. Insbesondere die COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Komplexität und die Verletzlichkeit der globalen Versorgungssysteme aufgezeigt. Der Bundesrat hat im Grundsatz einer substantiellen personellen Verstärkung des BWL zugestimmt.
Um die Organisation und Funktionsweise der WL dauerhaft an die aktuellen Anforderungen anzupassen, ist eine Teilrevision des Landesversorgungsgesetzes notwendig. Die Vernehmlassung soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.
Der Auftrag der WL lautet, die Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen, die für das Funktionieren des Landes unentbehrlich sind. Dazu gehören Grundnahrungsmittel, Energieträger und Heilmittel, aber auch Versorgungsinfrastrukturen wie Transportlogistik, Energienetze oder Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Aus Milizpersonal zusammengesetzte Fachbereiche definieren die Massnahmen zur Vorbereitung einer Versorgungskrise. Administrativ und rechtlich unterstützt werden diese vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL), das die WL-Organisation auch beaufsichtigt.
Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hat im Juni 2021 ein Projekt zur Reform der wirtschaftlichen Landesversorgung gestartet. Der Schlussbericht wurde im Dezember 2021 fertiggestellt. Darin wird aufgezeigt, wie die zuvor geäusserten Empfehlungen von den Geschäftsprüfungskommissionen (GPK), der Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte (FinDel) sowie einer Administrativuntersuchung zum BWL umgesetzt werden können. Der Bundesrat stützt seinen Beschluss auf diesen Umsetzungsplan ab. Schreibt das Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF.
Versorgungssicherheit der Bevölkerung ist nicht erst seit dem Ukrainekrieg ein Gebot der Stunde, sondern seit jeher ein gesetzlicher Auftrag. Kluge und voraussehende Politik hätte sich spätestens 2014 nach der Annektierung der Krim durch Russland Gedanken über allfällige Szenarien der Versorgungssicherheit gemacht und einen langfristigen Plan entwickelt. Doch weit gefehlt.
Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete es kürzlich in einer Rede als «dumm» und «naiv», dass die deutsche Politik sich in der Vergangenheit derart abhängig von einem Land wie Russland gemacht habe.
Das gilt auch für die Schweizer Politik mit ihren unsäglichen Putin-Verstehern im Bundeshaus, von denen mit grösster Wahrscheinlichkeit einige vom Autokraten aus Moskau «gekauft» worden sind. Das lassen jedenfalls jetzt bekannt gewordene Beispiele aus unseren europäischen Nachbarstaaten vermuten.
Dass der Bundesrat die Führungsstruktur der wirtschaftlichen Landesversorgung anpassen und mehr Personal einstellen will, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, ehrt ihn. Ob das Problem allerdings mit zusätzlichem Personal gelöst wird, ist eher fraglich. Gehört aber leider zur üblichen Feigenblatt-DNA der Problemlösungen im Hohen Haus von und zu Bern.
-
30.3.2022 - Tag der russischen Bomben
Schweiz setzt sich aktiv mit 750'000 Franken für den Erhalt des gefährdeten kulturellen Erbes in der Ukraine ein
Das Bundesamt für Kultur (BAK) ergreift ab sofort Massnahmen zum Schutz des kulturellen Erbes der Ukraine. Es stellt dafür Finanzhilfen in der Höhe von 750'000 Franken zur Verfügung. Gesuche für entsprechende Projekte können ab heute eingereicht werden.
Mit den Finanzhilfen unterstützt das BAK Schweizer Museen und ähnliche Institutionen dabei, gefährdete Kulturgüter aus der Ukraine vorübergehend in der Schweiz in Sicherheit zu bringen und sie hier konservatorisch zu betreuen. Zudem unterstützt das BAK internationale Organisationen, Institutionen oder Private bei Bestrebungen, die Zerstörung oder den Diebstahl von beweglichen Kulturgütern in der Ukraine zu verhindern. Bereits jetzt finanziert das BAK mit 50'000 Franken Projekte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Bereich des Grenzschutzes und der Bekämpfung des illegalen Handels von Kulturgütern. Das BAK stellt zusätzlich der UNESCO 100'000 Franken für den Notfonds zum Schutze des Kulturerbes zur Verfügung.
Diese Sofortmassnahmen werden gemeinsam mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) eingeleitet. Darüber hinaus verfügt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) über einen internationalen Bergungsort (Safe Haven) für bedrohte Kulturgüter, der auf Ersuchen der ukrainischen Regierung beansprucht werden könnte.
Das BAK unterstützt im Weiteren den Verband der Schweizer Museen (VMS) bei der Begleitung von Schweizer Museen, die Massnahmen zugunsten der Ukraine ergreifen werden. Der VMS arbeitet zu diesem Zweck auch mit dem nationalen Komitee des Internationalen Museumsrats (ICOM) zusammen. Ebenfalls vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine hat das BAK schliesslich der Stiftung Bibliomedia, die sich für Leseförderung und Bibliotheksentwicklung einsetzt, eine ausserordentliche Finanzhilfe in der Höhe von 140'000 Franken für den Aufbau eines Buchbestands in ukrainischer Sprache zugesprochen.
Die Massnahmen stehen im Einklang mit der Strategie des Bundesrates zum Schutz des gefährdeten Kulturerbes (2019-2023), die vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) und EDA gemeinsam umgesetzt werden. Diese Strategie zielt darauf ab, ein Angebot an Expertise und Unterstützung der Schweiz zu entwickeln.
In Anwendung des Kulturgütertransfergesetzes ist die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von gestohlenen oder geplünderten Kulturgütern aus der Ukraine in die Schweiz verboten. Das BAK steht diesbezüglich mit dem zuständigen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in regelmässigem Kontakt und Austausch. Weitere Massnahmen sind in Prüfung. Finanzhilfen Ukraine. Schreibt das Bundesamt für Kultur
Putin bombt die Ukraine in Schutt und Asche und die Schweiz bezahlt.

-
29.3.2022 - Tag des obersten Kleptokrates aus Moskau
Putin beschlagnahmt West-Jets im Wert von über zehn Milliarden
Die Reaktion des Kremls auf westliche Sanktionen wird vermutlich zum grössten Flugzeugdiebstahl der Geschichte.
Mehr als 400 Passagierflugzeuge enteigneter westlicher Leasing-Firmen sind derzeit in Russland blockiert. Es geht um einen Wert von über zehn Milliarden Franken. «Die russische Regierung hat die Rückgabe der Flugzeuge an den Westen untersagt», sagt Laurent Chassot, Experte für Luftfahrt und Versicherungsrecht bei der Anwaltskanzlei gbf in Genf. Die Chancen seien gering, die Jets jetzt noch in den Westen zurückholen zu können.
Russland reagiert somit auf die vor einem Monat beschlossenen Sanktionen gegen die russische Luftfahrt, die heute definitiv in Kraft treten. Die Leasing-Firmen hätten zwar die Möglichkeit internationale Schiedsgerichte anzurufen, doch die Urteile würden in Russland nicht akzeptiert, so Chassot.
Versicherungen gefordert
Es bleibt somit ein Schaden von etlichen Milliarden für Firmen wie Air Cap und SMBC. Beides Flugzeug-Leasing-Firmen aus Irland. Sie müssen einen Teil des Geldes abschreiben und gelangen nun an ihre Versicherungen. Führend ist in diesem Geschäft Lloyds in London.
Die blockierten Flugzeuge waren bisher in unterschiedlichen Ländern immatrikuliert, vor allem in Irland und den Bermuda-Inseln. Russland hat nun begonnen, die Immatrikulationen aufs eigene Land umzuschreiben. «Eine doppelte Immatrikulierung ist verboten und stellt einen Bruch von internationalem Recht dar», erklärt Chassot.
Russland blockiert zwar etliche Flugzeuge, doch diese können derzeit vor allem nur für den innerrussischen Luftraum eingesetzt werden. Die russischen Airlines ihrerseits leiden unter den zahlreichen Sanktionen des Westens. Chassot betont: «Die Sanktionen bedeuten praktisch das Todesurteil für die russische Zivilluftfahrt» – keine Leasing-Verträge und damit keine Ersatzteile und Dienstleistungen und keine Versicherungen.
Letzteres wiege besonders schwer, so Chassot. Denn ohne entsprechende Versicherung bekomme ein Flugzeug keine Zulassung für den internationalen Luftraum. Zudem seien die meisten Fluggesellschaften auf Ersatzteile aus dem Westen angewiesen. Schreibt SRF.
«Wie du mir, so ich dir» lautet eine uralte Lebensweisheit. Die Putin-Versteher zwischen Schrattenfluh und dem Balkan werden sich auf die Schenkel klopfen und dem Kriegsverbrecher aus Moskau zujubeln: «Gut gemacht, Vladimir».
Doch um den möglichen Äusserungen einiger Schweizer Nationalräte wie Thomas Aeschi (SVP, Zug), Franz Grüter (SVP, Luzern) und Roger Köppel (SVP, Zürich) den Wind aus den Segeln zu nehmen:
Es gibt schon noch gravierende Unterschiede zwischen den westlichen Demokratien und einer Diktatur. Während der Westen Geldmengen in Milliardenhöhe, Jachten, Flugzeuge und Supervillen lediglich blockiert, beschlagnahmt der oberste Kleptokrat aus Moskau alles, was ihm lieb und teuer ist, ihm aber trotzdem nicht gehört. Kleptokratien funktionieren nun mal nach diesem System.
Logisch, dass dies die obgenannten Putin-Vasallen von der SVP diametral anders sehen.
-
28.3.2022 - Tag der lebenden Mumien
Seniorenwohngruppen bieten kleine Wohnungen und viel Gemeinschaft
Ob die Entscheidung ein großer Blödsinn war, hat sich Freya Brandl bisher nicht gefragt. Sie sitzt im Gemeinschaftsraum ihrer Wohngruppe im Sonnwendviertel hinter dem Wiener Hauptbahnhof. Ihre Zweizimmerwohnung mit 54 Quadratmetern ist nur wenige Schritte entfernt.
Vor gut zwei Jahren hat die pensionierte Architektin noch in einem Haus mit Garten im 23. Wiener Gemeindebezirk gewohnt. Nachdem die Kinder ausgezogen waren und ihr Mann verstorben war, wurden die vielen Quadratmeter zur Belastung. Um nicht zu vereinsamen, hat sie sich mit ihrem Kollegen Peter Bleier auf die Suche nach Gleichgesinnten gemacht und 2013 den Verein Kolokation – gemeinsam urban wohnen gegründet.
Eigene Wohnung, geteiltes Stockwerk
Ihre Vision: Wohnraum für Menschen ab 50 Jahren schaffen, in dem sie gemeinsam und trotzdem allein leben können; jeder in einer eigenen Wohnung, aber in einem gemeinsamen Bauteil, der auch Gemeinschaftsräume und Gästezimmer umfasst.
Als Brandl und Bleier begannen, ins Café Resselpark zum Kolokation-Stammtisch zu laden, "war der Ansturm enorm". Kein Wunder, immerhin seien 50 Prozent der Wienerinnen und Wiener alleinstehend. Wiederum die Hälfte davon ältere Singles – "viele auf der Suche nach Gemeinschaft".
Als es schließlich ernst wurde und die Suche nach einem Bauprojekt begann, sprangen zwar einige der Interessierten wieder ab. Schlussendlich haben sich aber 17 Personen, darunter zwei Paare, dazu entschieden, "das Wagnis" einzugehen und ins zweite Geschoß des zehnstöckigen Baus der Wohnbaugenossenschaft EGW Heimstätte einzuziehen.
Diskutieren statt streiten
"Das Neubaugebiet Sonnwendviertel war nicht sehr verlockend", sagt Brandl. Trotzdem ist sie froh, den Schritt gegangen zu sein. Eine Glastür trennt die 15 Kolokation-Wohnungen vom restlichen Bau. "Wir leben gemeinsam mit Abstand. Man hilft und unterhält sich gegenseitig", sagt sie. Ihre Nachbarinnen und Nachbarn sind zwischen 50 und "70 plus".
Sie selbst zählt zur Altersgruppe 70 plus. Damit das Zusammenleben funktioniert, haben sie sich auf einen soziokratischen Entscheidungsprozess geeinigt. "Wir streiten nicht. Alles – jedes noch so kleine Fitzelchen – wird ausdiskutiert. Dann fassen wir einen Beschluss", sagt die Architektin.
Expansion in die Seestadt
Brandls Bilanz nach zwei Jahren: Es braucht mehr solcher Projekte. Eines davon, "Kolokation am Seebogen", haben Brandl und Bleier zusammen mit einem Team bereits entwickelt. Im Gegensatz zum Sonnwendviertel bezieht das Konzept in der Seestadt Aspern auch Alleinerziehende und Studierende mit ein.
Insgesamt sind 41 Wohneinheiten entstanden, 24 davon für Kolokation, die restlichen 17 werden vom Wohnservice Wien vergeben. "In der Seestadt war die Kennenlernphase mehr ein Gehen als ein Kommen, weil einige doch nicht so weit draußen wohnen wollten." Schlussendlich habe sich aber eine gute Gruppe gefunden, die bereits eingezogen ist.
Kolokation im Village
Währenddessen hat der Entwicklungsprozess für ein weiteres Projekt namens "Kolokation im Village" im dritten Bezirk bereits begonnen. Die Wohngruppen "Kolokation" und "Freundeskreis" haben sich zusammengetan und ein Konzept erarbeitet, in dem die Bedürfnisse junger und alter Bewohner ineinandergreifen. Sieger des Architekturwettbewerbs ist das Büro Nonconform. Der Baubeginn ist für 2023 geplant. Schreibt DER STANDARD.
Ob «Kolokation» begrifflich der richtige Aufhänger für dieses interessante Projekt ist, sei dahingestellt. Ausser uns Lateinern*innen wird wohl kaum jemand dieses Wort begrifflich kennen.
Das schmälert aber nicht die Richtigkeit des Konzepts. Statt die Alten aus ihren überdimensionierten 5-Zimmer-Wohnungen der politisch dominierten Altersheim-Industrie zwecks Gewinnmaximierung zum Frasse vorzuwerfen, würden unsere Immobilien-Mogule besser ab und zu ein Wohnprojekt auf dieser Konzeptbasis entwickeln. Eine seriöse Non-Profit-Organisation zwecks Handling von Finanzierung und Verwaltung dürfte sich dafür sicher finden lassen.
Liebe junge Politikerinnen und Politiker denkt einmal darüber nach, statt stets das hohle Händchen bei Verwaltungsratssitzungen zu machen. Lasst die Alten in Würde ihren Lebensabend verbringen und lasst sie auch in Würde sterben, ohne sie jahrelang in Heimen unter längst explodierten Kosten und Hightech-Medizin als lebende Mumien dahinsiechen zu lassen.
Letztendlich dient die künstliche Verlängerung des Lebens nebst einer überbordenden Gesundheitsindustrie lediglich dem Bundesamt für Statistik, was die Lebenserwartung anbelangt. Dieses unselige Landes-Ranking dient der politischen Selbstbeweihräucherung und der Legalisierung ausufernden und aus dem Ruder gelaufenen Kosten.
Haben wir das nicht zur Genüge während den letzten zwei Jahren der Corona-Pandemie erlebt? Um den deutschen Politiker der Grünen, Boris Palmer, zu zitieren: «Wir retten 90-jährige Menschen, die drei Monate später ohnehin gestorben wären.» Zynisch, aber dennoch wahr.
-
27.3.2022 - Tag des Frank A. «Geiers»
Die Würde der Schweiz
Am Samstag vor einer Woche nahm Ignazio Cassis an einer grossen Ukraine-Kundgebung in Bern teil. Ja, der schweizerische Aussenminister solidarisierte sich mit den Demonstranten auf dem Bundesplatz – und bekundete so seine Solidarität mit dem Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion.
Über Bildschirm und Lautsprecher war Kiews Regierungschef Wolodimir Selenski zugeschaltet. Auch mit ihm persönlich solidarisierte sich Ignazio Cassis. Er sprach ihn, Kopf und Herz des Widerstandes gegen Putins verbrecherischen Überfall, mit brüderlichem Du an. Der amtierende Bundespräsident sagte zum Kämpfer für die Freiheit der Ukraine: «Lieber Wolodimir, wir sind beeindruckt, wie ihr Grundwerte der freien Welt verteidigt, die auch unsere Grundwerte sind.»
Der Mann aus Montagnola war ganz und gar bei sich – ganz und gar Tessiner.
Mit seinem aussergewöhnlichen Auftritt in aussergewöhnlicher Stunde rettete Cassis die demokratische Statur der Schweiz, die sie durch ihr peinliches Zögern aufs Spiel gesetzt hatte, als es um die Übernahme der westlichen Sanktionen gegen Russland ging.
Ignazio Cassis verkörperte auf dem Bundesplatz vor aller Weltöffentlichkeit die Würde der Schweiz.
Die SVP «schäumt wegen Cassis’ Auftritt in Bern», wie die «Neue Zürcher Zeitung» zu berichten wusste. Der Präsident der Populisten-Partei belehrte den Bundesrat: «Diplomatie, die etwas bewegen soll, findet nicht öffentlich auf dem Bundesplatz statt.» Der Satz ist richtig und falsch zugleich: Diplomatie gehört in der Tat ins Hinterzimmer – der Auftritt des Aussenministers aber war kein Akt der Diplomatie.
Ignazio Cassis machte auf dem Bundesplatz Politik.
Mit diplomatischen Ausreden hatte die Landesregierung zuvor versucht, den internationalen Russland-Sanktionen auszuweichen. Das Diplomaten-Gerede von den guten Diensten, die Schweizer Tradition seien und tätige Parteinahme für die Ukraine leider, leider ausschliessen, brachte die Schweiz international in Misskredit – von Brüssel bis Washington.
Ignazio Cassis reparierte den Schaden.
Krieg ist keine Zeit für Diplomatie. Krieg ist Zeit für Politik. Und Politik heisst in diesem Fall: tätige Solidarität – mit klarem Bekenntnis, mit wirtschaftlichen Sanktionen, mit Waffenlieferungen, mit Sicherstellung von Oligarchenvermögen, mit Aufnahme von Flüchtlingen.
Einst hiess das schweizerische Aussenministerium. «Eidgenössisches Politisches Departement», EPD. Der Umgang der Schweiz mit der Welt war Politik. Mittlerweile haben die Diplomaten das Departement gekapert. Sie geben den Aussenministern vor, was sie zu sagen haben und wie sie es zu sagen haben. Das EPD heisst jetzt «Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten», EDA. Die Politik ist gestrichen. Ersetzt durch das nichtssagende, nichts meinende Allerweltswort «Angelegenheiten».
Putins Krieg aber ist keine Angelegenheit. Er ist, folgt man dem preussischen Militärdenker Carl von Clausewitz (1780–1831), die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Der russische Führer betreibt, wie einst Hitler, Weltpolitik – durch einen Krieg mitten in Europa. Die Antwort kann nur eine politische sein, keine diplomatische. Auch für die Schweiz. Die Diplomatie ist dieser Politik nachgeordnet – untergeordnet.
Ignazio Cassis hat auf dem Bundesplatz Politik gemacht. Im Lichte der helvetischen Scheu vor Aussenpolitik darf sogar gesagt werden:
Ignazio Cassis hat Politik – gewagt.
Schreibt SonntagsBlick-Kolumnist Frank A. Meyer.
Frank A. Meyer. Die ehemals graue Eminenz beim Boulevard-Blatt von der Zürcher Dufourstrasse wurde nicht ganz zu Unrecht hinter vorgehaltener Hand «Frank A. Geier» genannt. Mit seiner cholerischen Besserwisserei war er nicht nur für grosse Erfolge beim Ringier-Verlag über viele Jahre hinweg verantwortlich, sondern auch für ein paar gewaltige Mega-Flops.
Sei's drum. In seinen Sonntags-Kolumnen verzapft er meistens ultra-konservativen Sondermüll, den zu lesen sich wohl nur die Wenigsten antun. Irgendwie ist Frank A. «Geier» längst aus der Zeit gefallen. Da hilft es dem gelernten Drucker und heutigen «Journalisten» auch nicht unbedingt weiter, fehlenden Intellekt durch historische Zitate kaschieren zu wollen.
Weil aber auch blinde Hühner ab und zu ein Korn finden, muss man seiner heutigen Sonntagskolumne vollumfänglich zustimmen. Auch wenn sie eine gewaltige Wendehals-Übung darstellt.
Denn wir sollten nicht vergessen, dass unser aller Frank A. «Geier» ein Spezi der besonderen Art des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers und Putin-Freundes Gerhard Schröder ist. Frank A. Meyer war es, der den unseligen Schröder auf die Paywall von Ringier holte. Nicht ganz ohne Eigennutz. Erst Schröder machte Meyer in der Berliner Politszene hoffähig.
Wenn Ignazio Cassis laut Meyer die Würde der Schweiz auf dem Bundesplatz in Bern verkörperte, vertritt Frank A. «Geier» in einer Art von Vasallentreue die unwürdige Haltung des Ex-Kanzlers und Putin-Freundes Schröder.
Auch wenn der habgierige Ex-Kanzler inzwischen von der Paywall des Ringier-Konzerns verschwunden ist, weht der stinkende Geruch eines von Putin gekauften Politikers noch immer durch Frank A. Meyers Berliner Welt.
-
26.3.2022 - Tag der bestätigten Vorurteile
Autoversicherungsprämien für Ausländer machen Luzerner SP-Kantonsrat hässig
Wusstest du, dass Ausländerinnen in der Schweiz eine komplett andere Autoversicherungsprämie haben? Der Luzerner Kantonsrat Hasan Candan findet: dies gehört verboten.
Du kommst aus dem Balkan oder der Türkei und willst eine Autoversicherung abschliessen? Dann hast du Pech! Denn laut Onlinevergleichsdienst Comparis kassierst du einen durchschnittlichen Prämienzuschlag von rund 60 Prozent.
Der Vergleichsdienst schreibt, wen es am stärksten trifft. «Kosovaren trifft es am härtesten. Sie bezahlen für eine Vollkaskoversicherung durchschnittlich 61 Prozent höhere Prämien als Schweizer. Albaner und Serben sind mit rund 60 Prozent und Türken mit 57 Prozent Prämienzuschlag ähnlich stark betroffen.»
Luzerner Kantonsrat reicht Motion ein
SP-Kantonsrat Hasan Candan setzt sich schon länger dafür ein, dass im Kanton Luzern Menschen die gleichen Rechte haben. Die Ungleichbehandlung bei der Autoversicherung ist ihm ein Dorn im Auge. «Die Höhe der Autoversicherungspolice aufgrund des Herkunftslandes festzusetzen ist eine sehr augenscheinliche Diskriminierung und praktisch allen bekannt», schreibt Candan.
Auf die Thematik sei er gestossen, als er überprüfen wollte, ob diese Ungleichbehandlung bei den Versicherungen auch im Jahr 2022 noch existiere. «Es ist absurd: Menschen, welche hier geboren sind, seit über 18 Jahre hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, werden ungerechtfertigt zur Kasse gebeten.»
Wird «Schutz vor Diskriminierung» in Luzern klein geschrieben?
Hasan Candan verweist auf die Bundesverfassung, in welcher der Schutz vor Diskriminierung verankert ist. Trotz dieses Artikels existiert seit Jahren in der Versicherungsbranche diese Ungleichbehandlung. «Wieso die Regierung des Kantons Luzern bisher nichts dagegen unternommen hat, weiss ich auch nicht. Das müssen Sie die Herren Regierungsräte fragen», meint Candan.
Der Wunsch nach Gleichberechtigung im Versicherungsbereich ist nicht neu. 2011 reicht Nationalrat Ricardo Lumengo (SP) ein Postulat in Bundesbern ein. Der Bundesrat beantragt damals die Ablehnung. Die Begründung lautete, dass die Finma die Versicherer kurz zuvor überprüft habe.
«Diese Untersuchung hat im Weiteren gezeigt, dass bei keinem in der Schweiz zugelassenen Motorfahrzeugversicherer die Rasse seiner Kunden erhoben oder gespeichert oder im Zusammenhang mit der Prämien- und Vertragsgestaltung in irgendeiner Form eine Rolle spielt», schrieb damals der Bundesrat.
Kanton Luzern soll nun Diskriminierung bekämpfen
Was Bundesbern nicht richten konnte, soll nun der Kanton Luzern schaffen. Hasan Candan wünscht sich, dass sich mit dieser Motion etwas ändert. «Es ist die Aufgabe der Regierung, einzugreifen, wenn Menschen abgezockt werden. Die Regierung muss eingreifen und diese Abzocke unterbinden.»
Die Versicherer sollen sich bei der Risikobeurteilung auf andere Kriterien stützen. «Diskriminierende, hohe Autoversicherungsprämien pauschal aufgrund der Herkunft festzusetzen gehört verboten», sagt Candan. Der SP-Kantonsrat möchte, dass der Kanton Luzern dies in seiner Gesetzgebung festhält. Schreibt ZentralPlus.
Sippenhaftung ist in der Tat verabscheuungswürdig. Doch zur Ehrrettung der Versicherungsbranche sei erwähnt, dass die Statistiken der Versicherer (und der Polizeikorps) ein entsprechendes Bild ergeben. Versicherungen sind nun mal ein knallhartes Business mit Risikoabwägungen. Ausbezahlt wird in der Regel nach dem Verursacherprinzip.
Die Schweizer Community aus dem Balkan tut aber auch wirklich alles, um sämtliche Vorurteile zu bestätigen. Nicht nur in den Statistiken, sondern auch im täglichen Leben.
Wer in einer Schweizer Stadt wohnt, weiss, wovon hier gesprochen wird.
-
25.3.2022 - Tag der Abhängigkeiten
Flüssiggas gegen die Abhängigkeit von Russland
Die Abhängigkeit Europas vom russischen Gas ist der Schwachpunkt der westlichen Sanktionspolitik gegen Moskau und den zu entschärfen eines der wichtigsten Ziele des EU-Gipfels in Brüssel, an dem auch US-Präsident Joe Biden teilnimmt. Die USA dürften auch eine Schlüsselrolle bei der Suche nach Alternativen für die Energieversorgung spielen. Ursula von der Leyen und Biden wollen am Freitag eine Energiepartnerschaft zwischen der EU und den USA verkünden, gab die EU-Kommissionspräsidentin bekannt und sprach von einem "wichtigen Schritt nach vorn".
Geplant sind große Lieferungen von Flüssiggas (LNG) nach Europa, das russisches Erdgas ersetzen soll. Die "Financial Times" berichtet von einem Plan, bis Ende 2022 bis zu 15 Milliarden zusätzliche Kubikmeter Flüssiggas zu liefern. Das Gas solle zunächst vom amerikanischen Baltimore nach Großbritannien und dann auf den europäischen Kontinent verschifft werden, sagt Großbritanniens Botschafterin in den USA, Karen Pierce, dem US-Sender MSNBC. Dies sei mit dem Hafen von Baltimore vereinbart worden.
Sorge vor dem Ende der Gaslieferungen
Das deutsche Handelsblatt schreibt von einem erheblichen Liefervolumen, gestreckt auf mehrere Jahre. In Deutschland sollen mit Unterstützung der Bundesregierung zwei Terminals an der Nordsee errichtet werden, um den Import von LNG über Tanker zu erleichtern. Rund 40 Prozent des Gases in der Union wird aus Russland importiert. Für alternative Lieferungen ist die EU auch mit anderen Ländern wie Katar, Aserbaidschan, Japan und Südkorea in Kontakt.
Hintergrund ist die Sorge, dass Russland den Gashahn zudrehen könnte. "Wir überprüfen Szenarien für eine teilweise und volle Unterbrechung von Gasflüssen aus Russland nächsten Winter", sagte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis im EU-Parlament. Das solle EU-Ländern helfen, ihre Gas-Notfallpläne zu überarbeiten. Am Mittwoch hatte die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag für verpflichtende Gasreserven sowie Vorschläge für gemeinsame Gaseinkäufe vorgelegt.
Dass die EU von sich aus auf russisches Gas verzichtet, wie es etwa Polen verlangt, stößt auf viel Widerstand, vor allem vonseiten Österreichs und Deutschlands. Beobachter berichteten von heftigen Diskussionen auf dem EU-Gipfel über einen möglichen europäischen Energieboykott gegen Russland. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) lehnte dies in einer öffentlichen Stellungnahme dezidiert ab. Schreibt DER STANDARD.
Wasser auf die Mühlen der Esoteriker und Weltverschwörer: Endlich kann Amerika sein Fracking-Gas nach Europa liefern. Ausgerechnet Fracking-Gas, das bisher von den Apologeten der Grünen Weltenretter*innen als Teufelszeug verdammt wurde.
Tja, so ist das mit den Abhängigkeiten. Man kann halt nicht einfach die Atom- und Kohlenkraftwerke aus ideologischen und wahltaktischen Gründen mir nichts dir nichts abschalten, ohne einen Plan für deren Ersatz zu haben. Umso mehr, wenn unsere Gesellschaft auch in Zukunft nicht weniger sondern viel mehr Energie als bis anhin verbrauchen wird.
Oder wie meine wunderbare chinesische Freundin Mama Li vom ehemaligen «Chang Cheng» in Luzern so treffend sagte: «Weist du Tso, muss man immer einen Plan haben!» Könnte auch von Konfuzius stammen...
-
24.3.2022 - Tag der unausgegorenen Regime-Change-Träumereien
Nicht (nur) Putin, auch Russland ist das Problem
Die monumentalen Auswirkungen dieses Krieges in Europa sind noch gar nicht richtig abzusehen. Vielleicht hilft es, den großen historischen Blick zu versuchen. Ein wichtiger Beitrag dazu ist das Gespräch, das der Chefredakteur des New Yorker, David Remnick, mit dem Historiker und Stalin-Biografen Stephen Kotkin (Princeton) führte.
Kotkin entgegnet dem auch bei uns recht beliebten Pseudoargument, die Nato/USA hätten Russland/Putin halt nicht so reizen dürfen, mit einem unwiderlegbaren historischen Faktum: "Lange bevor die Nato existierte – nämlich im 19. Jahrhundert –, sah Russland so aus: Es hatte einen Autokraten. Es hatte Repression. Es hatte Militarismus. Es hatte Misstrauen gegenüber Fremden und dem Westen. Das ist das Russland, das wir kennen, und es ist nicht das Russland, das gestern angekommen ist oder in den 1990ern. Es ist nicht eine Reaktion auf Aktionen des Westens."
Eine solche unaufgeklärte, auf Gewalt basierende Gesellschaft bringt auch immer wieder Ein-Mann-Herrschaften hervor. Niemand wird leugnen können, dass es in Russland – außer ganz kurzen Phasen – nichts gab, was irgendwie als halbwegs demokratisches, rechtsstaatliches System hätte bezeichnet werden können. Seit Stalin hat Russland keinen so absoluten Herrscher mehr gesehen wie Wladimir Putin.
Großmacht
Das wirklich Erschreckende an der langfristigen Entwicklung Russlands ist aber das, was man als "imperiale Überhebung" bezeichnen könnte. "Russland ist eine beachtliche Zivilisation", sagt Kotkin. Aber "zur gleichen Zeit glaubt Russland, dass es einen ‚speziellen Platz‘ in der Welt hat, eine spezielle Mission. Es ist östlich-orthodox, nicht westlich. Und es will als eine Großmacht hervorstechen." Wer die letzten Reden Putins und/oder seinen Aufsatz über die Einheit Russlands und der Ukraine gesehen hat, kann keinen Zweifel an diesen imperialen, missionarischen Ambitionen hegen. Aber: Russlands Problem, so Kotkin, sei "nicht dieses Selbstgefühl oder diese Identität, sondern das Faktum, dass seine Fähigkeiten nie seinen Ansprüchen entsprochen haben. Es ist immer in einem Kampf, diese Ansprüche zu erfüllen, aber es kann nicht, weil der Westen immer mächtiger gewesen ist."
"Russland ist eine Großmacht, aber nicht die Großmacht" (Kotkin). Daher greift es zum Mittel des Zwanges, nach innen und nach außen. Das funktioniert manchmal und in begrenzter Zeit, aber am Ende hat der Westen "die Technologie, das Wirtschaftswachstum und das stärkere Militär" (Kotkin). Ein Riesenland mit lediglich dem dreieinhalbfachen Bruttonationalprodukt von Österreich – und ein übersteigerter imperialer Anspruch; das geht nicht zusammen.
Was ist die Konsequenz für den Westen? Kotkin hält die jetzige Mischung aus anhaltendem Druck (Sanktionen, Waffenlieferungen für die Ukraine) und der Suche nach diplomatischen Lösungen für richtig, warnt aber vor einem "Maximalismus", der einen in die Enge gedrängten Putin zu Verzweiflungshandlungen bringen könnte. Längerfristig wird man aber wohl ausloten müssen, was Russland helfen kann, sich aus seiner imperialistischen, autokratischen Isolation und seiner Anfälligkeit für Despoten zu lösen. Schreibt Hans Rauscher in DER STANDARD.
Wo Hans Rauscher – den ich, nebenbei erwähnt, dank seiner historischen Kenntnisse sehr schätze – recht hat hat er recht. Die teilweise im Westen vorhandenen Gelüste nach einem Regime-Change in Russland sind nichts anderes als unausgegorene und geschichtsfremde Träumereien.
Es ist ja legitim zu fordern «Putin muss weg». Nur stellt sich dann automatisch die Frage, wer kommt nach Putin?
Zur Erinnerung: Auf Gorbatschow folgte Jelzin. Ein peinlicher Alkoholiker, dem wir im Grunde genommen Putin verdanken.
-
23.3.2022 - Tag der Skipetarinnen
Entführt, geschlagen, mit einem Dildo sexuell genötigt: Vier Kosovarinnen quälten Kollegin brutal – nun wehren sie sich vor Obergericht gegen Strafe
Aus Rache entführten vier Kosovarinnen in Kloten ZH ihre damals 21-jährige Kollegin und quälten sie stundenlang – sie sollen sie geschlagen, zu sexuellen Handlungen mit einem Dildo gezwungen und ihr die Extensions abgeschnitten haben. Nun ist der Fall vor Obergericht.
Mit brutalen Foltermethoden sollen sich vier Kosovarinnen im März 2019 an ihrer Freundin in Kloten ZH gerächt haben: Gemäss Anklage haben sie die damals 21-jährige Mira A.* entführt und die Nacht über festgehalten. Derweil sollen sie ihre Kollegin unter anderem mit einem Dildo gequält haben.
Nachdem sie vom Bezirksgericht Bülach ZH allesamt zu Haftstrafen und zwei Angeklagte zusätzlich zu einem Landesverweis verurteilt wurden, haben drei von ihnen das Urteil ans Obergericht weitergezogen. Sie wollen mildere Strafen und streiten unter anderem ab, sich mit dem Sexspielzeug an ihrer Kollegin vergangen zu haben – sie habe dieses freiwillig benutzt. Der Staatsanwalt wiederum hat Anschlussberufung erklärt und fordert härtere Strafen.
Mit dem Tode bedroht
Das filmreife Drama hat seinen Ursprung offenbar schon im Herbst 2019: Damals soll Mira A. ihre Kollegin Lara O.* (27) bei den Behörden wegen Kindesvernachlässigung angeschwärzt haben. Die IV-Rentnerin wollte sich dafür bei ihr rächen und heckte einen Plan aus, der am 10. März 2019 laut Anklageschrift auch in die Tat umgesetzt wurde.
Zusammen mit den Schwestern Svea K.* (27) und Dinora K.* (31) sowie der befreundeten Alba Z.* (25) passte Lara O. die junge Frau nachts auf einem Parkplatz in Kloten ab. Die vier Beschuldigten hätten Mira A. unter Gewaltandrohung ins Auto gezerrt und seien mit ihr in den Wald, zum Tankstellen-Shop und später wieder in den Wald gefahren. Unterwegs hätte Svea K. dem Opfer mit der Faust kräftig ins Gesicht geschlagen und ihr gedroht, sie zu erstechen.
Mit dem Dildo gequält
Das Ganze gipfelte gemäss Anklage in der Wohnung einer Beschuldigten damit, dass Mira A. gezwungen wurde, sich einen Dildo einzuführen. Anschliessend habe Svea K. ihr das Sexspielzeug mehrere Male in den Anus gestossen. Die Geschädigte habe grosse Schmerzen gelitten und gebettelt, dass die Pflegeassistentin aufhöre. Doch die Peinigerinnen sollen sie weitergequält haben. Am Ende habe man ihr zudem die Haar-Extensions abgetrennt und herausgerissen.
Kurz nach halb 8 Uhr morgens hatte die Tortur für Mira A. gemäss Anklageschrift endlich ein Ende: Die Beschuldigten setzten sie auf einem Parkplatz in Oberglatt ZH aus, ihr Handy sowie das Portemonnaie mit 350 Franken sollen sie jedoch eingesackt haben.
Das Urteil des Zürcher Obergerichts wird voraussichtlich am Donnerstag erwartet. * Namen geändert. Schreibt Blick.
Wie die Väter, so nicht nur die Söhne, sondern auch einige der Töchter aus dem Land der Skipetaren.
-
22.3.2022 - Tag der Wirtschaft und der Gier
Chinas Firmenjäger übernehmen wieder mehr Unternehmen in Europa
2021 hat sich die Zahl der Firmenübernahmen durch chinesische Investoren wieder erhöht. Allerdings zeigen auch die höheren Hürden in sensiblen Branchen ihre Wirkung.
Nach dem pandemiebedingten Einbruch bei den chinesischen Firmenübernahmen in Europa im Jahr 2020 hat sich die Zahl der Transaktionen im Jahr 2021 wieder deutlich erhöht – von 132 auf 155. Auch das Transaktionsvolumen ist deutlich gestiegen: Der Wert der Beteiligungen und Übernahmen hat sich auf 12,4 Milliarden US-Dollar mehr als verachtfacht. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY.
Auch in Deutschland traten chinesische Investoren wieder häufiger in Erscheinung. Nachdem 2020 nur 28 Transaktionen gezählt worden waren, gab es im vergangenen Jahr 35 Beteiligungen oder Übernahmen.
"Chinesische Unternehmen bleiben bei ihren Investitionen in Europa insgesamt noch zurückhaltend", beobachtet Yi Sun (47), Partnerin und Leiterin der China Business Services in der Region Europe West bei EY. Dazu trage zum einen nach wie vor die Pandemie bei, die auch 2021 noch zu Beeinträchtigungen geführt habe. Die meisten chinesischen Unternehmen, die schon im Ausland Firmen übernommen haben, haben sich laut Sun in den letzten Jahren eher damit beschäftigt, die Restrukturierung in Europa voranzutreiben als weiter zu expandieren – besonders in den Sektoren Automobilzulieferer und Maschinenbau.
Steigende Preise und Hürden der Regulatoren
Ebenfalls dämpfend wirkten sich die inzwischen hohen Hürden für ausländische Beteiligungen gerade in bestimmten kritischen Branchen sowie die zunehmende Konkurrenz durch kapitalstarke Finanzinvestoren aus. Die Kaufpreise auf dem M&A-Markt seien zuletzt stark gestiegen – in einigen Fällen wollten die chinesischen Interessenten da nicht mehr mitgehen. "Besonders die börsennotierten chinesischen Unternehmen fürchten, mit teuren Zukäufen den eigenen Aktienkurs unter Druck zu setzen", so Sun. "
Interesse an deutschen Zulieferern und Maschinenbauern
Nach wie vor entfallen auf klassische Industrieunternehmen die meisten Deals – gerade in Deutschland: 12 der 35 Transaktionen in Deutschland und 30 der 155 Transaktionen in Europa fanden im Industriesektor statt.
Allerdings ist deren Zahl rückläufig: 2020 waren europaweit noch 36 Industrietransaktionen gezählt worden. Nach wie vor besteht laut der Studie bei chinesischen Investoren Interesse an europäischen Automobilzulieferern oder Maschinenbauern – allerdings inzwischen eher in den Subsektoren Elektromobilität, autonomes Fahren und High Tech-Materialien.
Hohe Investitionen in Start-ups
Ein deutlich gestiegenes Interesse gibt es aber an anderer Stelle: Chinesische Private Equity Fonds und Risikokapitalgeber werden immer aktiver. Gerade in Deutschland habe es – so Sun – im vergangenen Jahr einige sehr große Investitionen in Start-ups, an denen chinesische Investoren maßgeblich beteiligt waren, gegeben.
Auf High-Tech und Softwareunternehmen entfielen im vergangenen Jahr europaweit 27 Transaktionen. Im Vorjahr waren es noch 20. Gerade der aktivste chinesische Investor vergangenen Jahr, Tencent, hat sich nach Angaben der Studie zuletzt in diesem Segment stark engagiert.
Gestiegen ist auch die Zahl der Übernahmen und Beteiligungen im Bereich Gesundheit: von 16 auf 26 Transaktionen. "Der Gesundheitssektor – ob Pharma, Biotech oder Medizintechnik – wird zunehmend zu einem der wichtigsten Zielsektoren chinesischer Unternehmen", sagt Sun. In diesem Sektor gebe es einen großen Nachholbedarf in China, insbesondere bei der Forschung und Entwicklung.
36 Übernahmen in Großbritannien
Die meisten Transaktionen wurden im vergangenen Jahr in Großbritannien verzeichnet. Mit 36 Übernahmen und Beteiligungen liegt Großbritannien knapp vor Deutschland, die 35 Transaktionen verzeichnen und deutlich vor den drittplatzierten Niederlanden (13). Im Vorjahr besetzte Deutschland noch die Spitze.
Sun ist allerdings überzeugt, dass Deutschland für chinesische Investoren ein attraktiver Markt bleibt: "Viele chinesische Unternehmen haben gute Erfahrungen mit ihren Investitionen gerade in Deutschland gemacht."
Die europaweit größte Investition war im vergangenen Jahr der Verkauf der Haushaltsgeräte-Sparte von Philips an die Investmentfirma Hillhouse Capital mit Sitz in Hong Kong für 4,4 Milliarden US-Dollar. Die zweitgrößte Transaktion war die Übernahme des britischen Entwicklerstudios Sumo Digital durch Tencent für 1,1 Milliarden US-Dollar, gefolgt von der Übernahme des dänischen Kühlcontainer-Herstellers Maersk Container Industry durch China International Marine Containers für ebenfalls 1,1 Milliarden US-Dollar. Schreibt das Manager Magazin.
Frei nach Erich Maria Remarques Buch über die Schrecken des ersten Weltkrieges: «Im Westen nichts Neues»!
Es war gestern Morgen, als eine Expertin, deren Namen ich leider vergessen habe, auf Radio SRF 3 zum ersten Mal (!) darüber sinnierte, dass wir (der Westen) uns inzwischen in einer weit höheren Abhängigkeit von China befinden als mit Russland. Als ob es ein Tabu wäre, wird diese Tatsache von den meisten Medien nicht thematisiert. Quasi verschwiegen.
Der ukrainische Präsident Selenski prangerte in seiner Rede an das deutsche Parlament an, wie lange Deutschland bereit war, mit Russland zusammenzuarbeiten, und dass es das weiter ist. Und dass man wegsah, bis es nicht mehr anders ging. «Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft» sei alles gewesen, was er von den Deutschen gehört habe. Der ukrainische Präsident warf Deutschland vor, an der neuen Mauer zwischen Freiheit und Unfreiheit, die Russland in Europa errichte, beteiligt zu sein.
Selenski hielt damit den Deutschen – und damit dem gesamten Westen – einen Spiegel bezüglich Heuchlerei vor die Augen. Seiner Rede ist nichts hinzuzufügen, ausser dem Wort «Gier, Gier, Gier!»
Was wir derzeit mit Putin erleben, ist lediglich ein Vorgeschmack dessen, was uns mit China erwartet. Dabei hat uns doch die Corona-Pandemie bereits mit aller Brutalität vor Augen geführt, in welch verheerender Abhängigkeit wir gegenüber dem «Land des Lächelns» längst stecken.
Aber Wirtschaft, Wirtschat, Wirtschaft und Gier, Gier, Gier sind im Westen tatsächlich nichts Neues.
-
21.3.2022 - Tag der Prognosen über die russische Armee
US-General prognostiziert Wende: Bricht Putins Armee innert einer Woche zusammen?
Russlands Armee kommt in der Ukraine kaum noch vorwärts. Nun sagt US-Generalleutnant Ben Hodges, dass es im Krieg bald zu einem Wendepunkt kommen könnte. Der russischen Armee droht demnach der Zusammenbruch.
Schon fast vier Wochen dauert der Krieg in der Ukraine. Das Land, das Russlands Präsident Wladimir Putin (69) in einer Blitz-Aktion erobern wollte, wehrt sich weiterhin standhaft. Mittlerweile sind die Fronten gemäss Experten-Einschätzungen praktisch eingefroren.
Für die Russen geht es also kaum noch vorwärts. Putin soll deswegen vor Wut schäumen. Auch mehrere Top-Generäle haben bereits ihren Job verloren oder wurden gar verhaftet. Und die Verluste in den eigenen Reihen steigen stetig an.
«Die Russen stecken in Schwierigkeiten. Und sie wissen es», zitiert die «Frankfurter Rundschau» einen Bericht des US-Generalleutnants Ben Hodges, der bis 2017 die amerikanischen Landstreitkräfte in Europa kommandierte.
Eroberung könnte bald scheitern
Die Eroberung der Ukraine laufe für die Russen überhaupt nicht nach Plan, so Hodges. Das habe auch Auswirkungen auf die Moral der Truppen. Täglich würden Hunderte russische Soldaten sterben. Zudem würden Panzer und Helikopter zerstört. Das ursprüngliche Ziel, die ukrainische Hauptstadt Kiew in wenigen Tagen zu erobern, sei längst verfehlt worden.
Hodges kommt in seiner Analyse daher zum Schluss: «Die russische Eroberung könnte in den nächsten sieben, acht Tagen ihren Kulminationspunkt erreichen.» Das heisst: Im Krieg würde ein Wendepunkt erreicht. Moral und Material der russischen Truppen wären erschöpft. Ab dann drohen heftige Rückschläge. Die russische Armee würde schrittweise zusammenbrechen – und die Eroberung der Ukraine schliesslich scheitern.
Auch Selenski weist auf Verluste hin
Für diese Theorie spricht laut Hodges auch, dass die Russen offenbar unter Munitions-Problemen leiden. So verhandelte der Kreml bereits mit China über Waffenlieferungen. Auch gab es bereits Gerüchte, dass Russlands Verbündeter Belarus in den Krieg eingreifen könnte – das ist aber bislang nicht passiert. Zudem zeige das Anwerben von syrischen Söldnern für den Krieg, dass Russland selbst nicht mehr genügend Truppen habe, so Hodges.
Auch Ukraines Präsident Wolodimir Selenski (44) hatte in den vergangenen Tagen immer wieder auf die «schweren Verluste» der Russen hingewiesen. Bereits hätten über 14'000 der «feindlichen Invasoren» ihr Leben auf ukrainischem Terrain verloren. «Das sind 14'000 Mütter und 14'000 Väter. Es sind Ehefrauen, Kinder, Verwandte und Freunde. Und es wird nur noch mehr Opfer geben, solange der Krieg weitergeht. Euer Krieg gegen uns, Russland gegen die Ukraine. Auf unserem Land.» Schreibt Blick.
Da dürfte wohl die Hoffnung Vater des im Konjunktiv geäusserten Gedankens sein. Dem US-Generalleutnant Ben Hodges sei empfohlen, Clausewitz zu lesen: Die russische Armee ist nicht so stark wie angenommen, aber auch nicht so schwach wie viele denken.
So oder ähnlich äusserte sich der preussische Generalmajor Carl Philipp Gottlieb Clauswitz (später Clausewitz), der auch in der russischen Armee diente, über Napoleons Russlandfeldzug und die russische Armee.
Was aber jetzt schon sicher ist – unabhängig der Meinungen oder Prognosen von Clausewitz oder Generalleutnant Ben Hodges: Putins Armee wird in der Ukraine dem Erdboden gleichgemachte Städte hinterlassen. Grosny und die syrischen Städte lassen grüssen.
Für den Wiederaufbau der Städte und die Millionen von Vertriebenen ist – wie immer bei Putins Kriegen – der Westen zuständig. Das war schon in Tschetschenien und Syrien der Fall und wiederholt sich jetzt in der Ukraine.
Gehört scheinbar zur DNA der teuflischen Destabilisierungs-Strategie des russischen Diktators.
-
20.3.2022 - Tag der Inkontinenzen
SVP kämpft gegen Stromlücke: Blocher und der Geistergast
In einem Interview berichtet der alt Bundesrat über einen Auftritt des Präsidenten der Elektrizitätskommission bei der SVP. Ein Auftritt, der gar nicht stattgefunden hat.
Der Kampf gegen die drohende Stromlücke treibt die SVP um. So verlangte die Rechtspartei jüngst die Ernennung eines «Stromgenerals», der mit harter Hand die drohende Energiekrise abwenden soll.
Der Feldherr der SVP, alt Bundesrat Christoph Blocher (81), kümmert sich selbstredend auch um das Dossier. In der «NZZ» sprach er vergangene Woche über die Tagung in Bad Horn TG, an der die SVP jeweils im Januar das politische Jahr einläutet. Thema war auch dort: die Energiesicherheit. Mehrere Experten des Bundes seien eingeladen worden, berichtet Blocher im Interview. «Die Chefin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz war da, der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung und der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom ebenfalls.» Allerdings hätten diese drei nicht sagen können, wer die Lösung dieses gravierenden Problems verantworte. «Sie haben sich angeschaut. Sie taten mir leid, denn es war nicht ihr Fehler», so Blocher.
Bloss: Auf Anfrage sagt der Präsident der Elcom, alt Ständerat Werner Luginbühl (64), dass er gar nicht an der Bad-Horn-Tagung teilgenommen habe. Niemand von der Elcom sei eingeladen gewesen. Christoph Blocher sprach gestern gegenüber SonntagsBlick von einer Verwechslung.
Eine Verwechslung. Und definitiv ein Fall für den Stromgeneral. Schreibt SonntagsBlick.
Ab einem gewissen Alter kommen gewisse Veränderungen schleichend: Sie beginnen meistens mit Erinnerungslücken und hören bei der geistigen und körperlichen Inkontinenz auf.
-
19.3.2022 - Tag der geplatzten Träume
Epidemiologe Didier Trono erklärt die hohen Corona-Zahlen: «Traum von Herdenimmunität durch Massenansteckung ist geplatzt»
Die Corona-Zahlen steigen seit Tagen stark an. Zwar kommt kaum jemand auf die Intensivstation, trotzdem ist Vorsicht angebracht. Der Virologe Didier Trono fand heraus, dass Omikron kaum vor Neuansteckungen schützt. Das muss in der Pandemie-Strategie bedacht werden.
Vor einem Monat verkündete Alain Berset (49): «Die Pandemie hat ihren Schrecken verloren.» Die Fallzahlen sanken, immer weniger Personen landeten im Spital. Per 17. Februar 2022 hob der Bundesrat die meisten Corona-Massnahmen auf. Die Schweiz atmete zwei Jahre nach den ersten Covid-Fällen endlich wieder auf.
Doch die Omikron-Variante zirkulierte weiter. Nun ist eingetroffen, was erwartet wurde: Die Infektionen nehmen stark zu. Vom 1. bis 17. März wurden in der Schweiz 436'740 Corona-Fälle registriert. 17 Tagen vorher waren es 330'843. Eine Erhöhung von über 30 Prozent!
«Die Zahlen steigen sehr schnell», sagt Tim Julian (40) vom Eawag. Er analysiert mit seinem Team das Abwasser von Schweizer Kläranlagen. Dort lassen sich Corona-Viren nachweisen. «Unsere Daten stimmten bisher gut mit den bestätigten Corona-Fällen überein, auch wenn es ein paar Tage Unterschied geben kann.»
Das gleiche Bild in den Spitälern: Bis zum 26. Februar sank die Zahl der Corona-Patienten, seither stieg die Kurve wieder an. Seit dem 1. März werden fast täglich mehr als 100 neu Hospitalisierte gemeldet.
Omikron schützt kaum vor Neu-Infektion
Blick-Recherchen zeigen: Nebst den Lockerungen gibt es zwei weitere Gründe, warum die Zahlen steigen. Ungefähr gleichzeitig mit der Lockerung der Massnahmen wurde eine neue Omikron-Variante dominant: BA.2 löste BA.1 als am weitesten verbreitete Virusart ab. Das zeigt sich in der Sequenzierung der vom Eawag und ETH Zürich erhobenen Abwasserdaten.
Den zweiten Grund liefert Didier Trono (65): «Eine Infektion mit Omikron scheint nur einen geringen Schutz gegen eine erneute Omikron-Infektion zu bringen – und erst recht nicht gegen andere Varianten!» Der Virologe der ETH Lausanne erklärt: Da Omikron weniger Symptome hervorrufe, produziere der Körper weniger Antikörper. Dazu hat Omikron nur wenige Ähnlichkeiten mit den anderen Varianten. Dadurch würden die gebildeten Antikörper die anderen Varianten schlecht erkennen. In Kürze will er eine Studie dazu veröffentlichen. Trono: «Der Traum von einer Herdenimmunität durch Massenansteckung ist geplatzt.»
Vierte Impfung frühestens im Herbst
Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Zumal Impfchef Christoph Berger diese Woche im Blick sagte, dass eine vierte Impfung frühestens im Herbst empfohlen wird? Trono verneint dies, da BA.2 nicht gefährlicher sei als BA.1, und Omikron weniger gefährlich sei als seine Vorgänger. Das wird auch von den Zahlen aus den Intensivstationen gestützt. Dort liegt derzeit ungefähr jeder sechste Patient wegen Corona. Vor der Aufhebung der Massnahmen war es fast jeder dritte.
Doch Vorsicht: Bei so viel mehr Fällen reicht auch ein geringer Prozentsatz aus, um das Gesundheitssystem zu belasten. Ein Rechenbeispiel: Wenn von zehn Delta-Patienten einer mit Corona und von hundert Omikron-Patienten ebenfalls einer ins Krankenhaus eingeliefert wird, muss Omikron zehnmal ansteckender sein, damit die Situation die Gleiche ist wie bei Delta. «Ein solches Szenario ist durchaus realistisch», so Trono.
Strategie des Bundesrats geht bisher auf
Doch der Vergleich mit Dänemark macht Hoffnung: Dort begann die BA.2-Welle etwa einen Monat früher als bei uns. Die Fallzahlen stiegen stark an, auf den Intensivstationen blieb es aber verhältnismässig ruhig.
«Möglich, dass die Situation in der Schweiz ähnlich ist», sagt Trono. In diesem Fall hätte der Bundesrat recht. Denn für ihn ist die Anzahl der Patienten auf der Intensivstation seit langem der wichtigste Parameter im Kampf gegen die Pandemie. Aber ist das auch vernünftig? Das sei die von den Politikern gewählte Haltung, meint Trono. «Uns fehlen Daten, um die Auswirkung dieser grossen Anzahl von Infektionen vorherzusagen.» Etwa, was dies für Long Covid bedeuten könne. Schreibt Blick.
Tja, Träume sind wie Luftballone: Irgendwann platzen sie.
Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, braucht's eigentlich keinen Experten. Um ein Boulevardblättli mit einem reisserischen Artikel zu füllen hingegen schon. Clickbaiting at its best!
-
18.3.2022 - Tag der menschlichen Gier
EU-Länder lieferten trotz Embargo Waffen an Moskau
Russland ist wegen des Einmarschs in die Ukraine im Westen geächtet, bis vor Kurzem haben aber noch viele EU-Staaten Waffen an Putins Staat geliefert. Trotz des Embargos, das 2014 wegen der Annexion der Krim verhängt wurde, exportierten zehn europäische Länder - darunter auch Österreich - bis 2020 Rüstungsgüter im Wert von 346 Millionen Euro nach Russland. Gelieferte Ausrüstung wird jetzt auch gegen die Ukraine eingesetzt.
Bis vor Kurzem waren Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Streitkräfte noch willkommene Abnehmer europäischer Militärgüter, wie eine Datenanalyse der Recherche-Website „Investigate Europe“ zeigt. Beim Durchforsten der offiziellen Rüstungsexportregister stellte sich heraus, dass zwischen 2015 und 2020 mindestens zehn EU-Mitgliedsstaaten Rüstungsgüter - darunter fallen neben Geschossen, Bomben oder Gewehren auch Landfahrzeuge und Schiffe - im Wert von 346 Millionen Euro an Russland verkauft haben. Darunter sind die großen EU-Staaten Frankreich, Deutschland und Italien und neben weiteren Ländern auch Österreich.
Möglich durch juristisches Schlupfloch
Wie kann das sein, wenn es seit 2014, als Russland die Krim annektierte und die Separatistenrepubliken im Donbass ausgerufen wurden, einen EU-Beschluss gibt, der den Verkauf von „Rüstungsgütern und zugehörigen Gütern aller Art“ untersagt? Der Grund dafür ist ein juristisches Schlupfloch. Ausgenommen vom EU-Waffenembargo sind Verträge, die vor dem 1. August 2014 geschlossen wurden. Auch ergänzende Verträge fallen unter die Ausnahme.
Auf der Basis solcher vergangener Verträge hat etwa Frankreich seit 2015 Rüstungsgüter im Wert von 152 Millionen Euro an Russland verkauft, wie das französische Medium „Disclose“ berichtete. Darunter waren neben Bomben, Raketen und Torpedos auch Wärmebildkameras für mehr als 1000 russische Panzer sowie Infrarot-Detektoren für Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Ausrüstung, die jetzt in der Ukraine zum Einsatz kommt.
Güter für zivile und miltärische Zwecke
Deutschland hat bis 2020 Rüstungsgüter für 122 Millionen Euro an die russische Regierung geliefert. Hauptsächlich waren es Eisbrecher, aber auch Gewehre und „Sonderschutzfahrzeuge“. Formell stellen diese keinen Bruch des Embargos dar, weil sie als „dual use“ bezeichnet wurden - sie sind sowohl für zivile als auch militärische Zwecke einsetzbar.
Weit geringer ist das Volumen der italienischen Exporte an Russland: Sie machen rund 23 Millionen Euro aus. Verkauft wurden unter anderem Kampffahrzeuge der italienischen Firma Iveco. Solche Fahrzeuge wurden Anfang März an der ukrainischen Front entdeckt, berichtet „Investigate Europe“.
Waffen und Munition aus Österreich
Den Daten der EU-Arbeitsgruppe COARM zufolge exportierte auch Österreich nach 2014 weiterhin Rüstungsgüter nach Russland. Im Zeitraum bis 2020 wurden „Waffen mit glattem Lauf mit weniger als 20-mm-Kalibern, andere Waffen und automatische Waffen mit 12,7-mm-Kaliber“ exportiert, sowie „Munition und Zünderstellvorrichtungen und speziell entwickelte Bestandteile“. Alles zusammen hatte ein Exportvolumen von fast 19 Millionen Euro. Schreibt die Kronenzeitung.
Machen wir es kurz: Embargos finden immer ein Schlupfloch. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Die menschliche Gier ist einfach zu gross.
Wer glaubt, dass die jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gegen Russland und seinen Vasallen Belarus verhängten Sanktionen und Embargos lückenlos eingehalten werden, ist ein/e unverbesserliche/r Träumer*in.
-
17.3.2022 - Tag der eingeschränkten Festessen auf der Autobahn
Oberwalliser-Pannen-Autobahn wurde 50 Zentimeter zu schmal gebaut – A9-Chef ist verärgert: «Es wäre nicht verkehrt gewesen, mal einen Meter in die Hand zu nehmen»
Beim Ausbau der Strasse auf dem Teilstück der Autobahn A9 zwischen Raron VS und Gampel VS wurde das Bankett vergessen. Jetzt muss nachgebessert werden. Das Beheben des Fehlers wird mehrere 10’000 Franken kosten.
Die unendliche Geschichte um den Ausbau der Autobahn A9 im Oberwallis ist um ein Kapitel reicher. Beim Autobahnteilstück zwischen Gampel VS und Raron VS ging auf einer Länge von 500 Metern nämlich ein 50 Zentimeter breites Stück vergessen. Ein Teil der Strasse ist einfach nicht vorhanden – die Autobahn ist dort zu schmal.
Bemerkt wurde der Fehler erst, als die Leitplanken montiert wurden. Auf diesem Abschnitt fehlt nun nämlich das sogenannte Bankett. Das ist dazu da, um das Oberflächenwasser zu den seitlich gelegenen Mulden ableiten zu können. Auf dem Bankett stehen auch die Verkehrssignale.
«Ein ärgerlicher Fehler»
Martin Hutter (56), Chef der Dienststelle für Nationalstrassenbau, sagt zu Blick: «Das ist ein ärgerlicher und nicht alltäglicher Fehler, der so nicht passieren dürfte.» Wie und warum das Malheur genau passieren konnte, werde derzeit abgeklärt. Hutter: «Es wäre aber sicher nicht verkehrt gewesen, wenn jemand mal einen Meter in die Hand genommen hätte.»
«Zeitlich hat der Fehler aber keine Konsequenzen auf den Bauverlauf, denn die Arbeiten befinden sich noch in der Ausführung», beschwichtigt Hutter. Aber: Jetzt müsse das Unternehmen, das die Arbeiten ausführt, noch einmal nachbessern kommen. «Es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn die ganze Fläche aufs Mal hätte gebaut werden können», sagt Hutter.
Finanzielle Konsequenzen hingegen wird das Missgeschick haben: Baustellen-Chef Hutter geht davon aus, dass das Beheben des Fehlers mehrere 10'000 Franken kosten wird. Abgesehen von diesem Rückschlag gingen die Arbeiten aber planmässig voran. Das Autobahnteilstück dürfte im Laufe des kommenden Jahres fertiggestellt werden, sagt Hutter.
Nicht der erste Rückschlag
Der Ausbau der A9 im Oberwallis wurde in den 1970er-Jahren beschlossen. Die 32 Kilometer lange Autobahn wird gebaut, um zwischen Siders und Brig die Lücke zwischen der A9 im Unterwallis und der Autostrasse über den Simplon zu schliessen. Doch immer wieder kam es zu Baustopps und Verzögerungen: wegen Streit um die Linienführung oder der Geologie, die Bauarbeiten verunmöglichten. Wie etwa beim Riedbergtunnel in Gampel.
Der Tunnel befindet sich seit 2004 im Bau. Er hat zwei Röhren à je etwas über 500 Meter Länge und wird in einen Rutschhang gebaut. Die Tücken der Natur liessen die Kosten explodieren – und die Bauarbeiten immer wieder verzögern. Anfänglich auf 54 Millionen Franken budgetiert, wird der Bau des Riedbergtunnels – Stand heute — bei seiner Fertigstellung 2025/26 220 Millionen Franken gekostet haben. Pro Meter wären das dann 220'000 Franken. Schreibt Blick.
Das Bankett vergessen geht nun gar nicht. Wo kommen wir da hin, wenn auf einer Autobahn nicht mal mehr Platz für ein Festessen (Bankett) vorhanden ist?
-
16.3.2022 - Tag der westlichen Oligarchen
Korrupte Eliten: Russische Oligarchen sollten nur der Anfang sein
Der Westen reagiert auf den russischen Angriffskrieg mit harten Sanktionen. Doch es geht längst nicht nur um die Kreml-Moguln. Wir müssen gegen die westlichen Handlanger korrupter Eliten aus aller Welt vorgehen.
Im Hamburger Hafen liegen laut Recherchen des »Handelsblatts« drei Megajachten, die Oligarchen mit Kreml-Verbindungen gehören und die jetzt im Zuge der Sanktionen gegen Putins Machtclique beschlagnahmt werden sollen. Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hatte seit Langem gefordert, gegen die Kleptokratenelite, die im Westen ungehindert ihr Vermögen anlegen und Einfluss ausüben konnte, vorzugehen. Doch erst nach Putins Invasion der Ukraine konnten sich die EU, Großbritannien und die USA zu ersten entschiedenen Schritten durchringen, Vermögenswerte zu beschlagnahmen.
Wir zeigen gern auf »Londongrad«, dem bevorzugten Nest von Putins Oligarchen. Doch London ist überall. Auch in Deutschland und dem Rest Europas fanden korrupte Eliten aus Russland bislang weit offene Türen. Sie werden unterstützt von einer Armada aus Handlangern, die beim Nestbau allzu gern helfen, solange der Rubel rollt: Anwälte, PR-Berater, Lobbyisten, Finanzdienstleister, Notare, Makler, Kulturpromoter. Und es geht auch nicht nur um Russland. Die Kleptokratie-Dienstleister bedienen Kunden vieler autoritär-korrupter Staaten aus der ganzen Welt. Wir müssen das Momentum gegen russische Oligarchen nutzen, um die gesamte Industrie trockenzulegen, die autoritär-korruptes Geld im Westen annimmt und in legale Besitztümer, Einfluss und Respektabilität umwandelt.
Dazu ist ein umfassendes Maßnahmenpaket notwendig, das weit über die Problematik russischer Oligarchen hinausgeht.
Natürlich kommt wenig an die Art und Weise heran, auf die London den korrupten Kremleliten den roten Teppich ausgerollt hat. Britische Oligarchendienstleister nutzten die zahlreichen vom Vereinigten Königreich kontrollierten Steueroasen, um korruptes Geld reinzuwaschen und dazu zu nutzen, sich dann in die britische Oberschicht einzukaufen. Oligarchen wurden zu respektablen Mitgliedern der High Society, solange sie Geld auf den Tisch legten. Sie kauften sich damit bei Museen, Fußballklubs, Universitäten, Thinktanks und nicht zuletzt bei Parteien ein. Die Konservativen haben Millionen Pfund angenommen von russischen Oligarchen. Gerade wurde bekannt, dass Premier Boris Johnson dafür gesorgt hat, dass Evgeny Lebedev zum Mitglied des House of Lords wurde, obwohl die britischen Sicherheitsdienste Bedenken geäußert hatten. Praktischerweise ist Ben Elliot, Co-Vorsitzender von Johnsons konservativer Partei, Mitgründer einer Firma, die sich bis vor Kurzem damit rühmte, 15 Jahre Erfahrung zu haben, »Russlands Elite einen Luxus-Lifestyle-Management-Service anzubieten«.
Damit kann Deutschland nicht ganz mithalten. Doch auch hierzulande haben Makler, Finanzjongleure, Anwälte und andere dienstbare Geister Oligarchen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion allzu gern ein warmes Nest gebaut. Eine der in Hamburg festgesetzten Megajachten soll Alischer Usmanow gehören, der offenbar am Tegernsee eine Villa und weitere Häuser besitzen soll. Formell liefen die Hauskäufe legal über eine auf der britischen Isle of Man angemeldete Briefkastenfirma. Deutsche Anwälte und Notare haben zur Abwicklung dankbar die Hand aufgehalten. Zudem haben sich deutsche Eliten zur Legitimierung von Prestigeprojekten von Kreml-Oligarchen hergegeben. Kreml-Intimus Wladimir Jakunin etwa meinte, sich einen eigenen Thinktank in Berlin gönnen zu müssen und gründete das »Dialogue of Civilizations Research Institute«. Respektabilität versuchte Jakunins Team dadurch aufzubauen, dass man möglichst viele deutsche Eliten für eine Teilnahme an Veranstaltungen gewann. So war sich etwa Claus Offe, eine der Ikonen der kritischen Politikwissenschaft, nicht zu schade, 2018 bei einem Seminar des Jakunin-Instituts aufzutreten. Damit legitimierte auch Offe dieses Sammelbecken von Pro-Kreml-Stimmen in Berlin. Das Institut ist mittlerweile abgewickelt, aber der Reputationsschaden bleibt.
Das Problem geht weit über russische Oligarchen hinaus. Es zieht sich durch die Beziehungen westlicher Metropolen und Finanzzentren mit vielen autoritären und ressourcenreichen Staaten weltweit.
Besonders eindrückliche Beispiele lassen sich in unseren Beziehungen zum afrikanischen Kontinent finden. Offiziell haben sich Deutschland und Europa der Unterstützung guter Regierungsführung verschrieben. Tatsächlich erlauben wir unseren professionellen Dienstleistern, kleptokratische Systeme zu ölen und korrupten Eliten zu dienen. Britische Anwälte halfen dabei, korruptes nigerianisches Geld in Londoner Immobilien zu verwandeln. Die frühere PR-Firma Bell Pottinger agierte als Spindoctor im Namen von Klienten wie der korrupten südafrikanischen Gupta-Familie. McKinsey, die Boston Consulting Group und PricewaterhouseCoopers hatten, wie die »New York Times« aufgrund von geleakten Dokumenten beschreibt, enge Beziehungen sowohl zum angolanischen Staat als auch zu den persönlichen Interessen der Tochter des Expräsidenten, Isabel dos Santos. Credit Suisse spielte laut »Guardian« bei einem der größten Korruptionsskandale in Mosambik eine zentrale Rolle. Die Pariser PR- und Medienszene dient sich den Herrscherfamilien Kongo-Brazzavilles und Gabuns an.
Das Muster ist dabei immer gleich: Erst helfen die verschiedenen Handlanger dabei, gestohlenes Geld zu waschen. Dann waschen sie den Ruf korrupter Herrschereliten rein, während deren Familien die gesamten Möglichkeiten rechtssicherer demokratischer Systeme für sich zu nutzen wissen, um ihre Besitztümer zu schützen und einen sorglosen Lebenswandel zu führen. Sie bauen dabei starke Netzwerke zu europäischen und auch US-amerikanischen Eliten auf, welche die Regime daheim stärken helfen. Das zeigt klar, dass Korruption ein grenzüberschreitendes und kollaboratives Phänomen ist und keinesfalls nur ein internes Problem der betroffenen Länder, wie oft allzu selbstgefällig behauptet wird. All das wäre ohne die Armada der Handlanger, die keine halbseidenen Nischenanbieter sind, sondern meist zu den etabliertesten Vertretern ihrer Branche gehören, unmöglich.
Rechtliche Schlupflöcher beseitigen
Wir sollten umfassende Maßnahmen ergreifen, um diesen Handlangern das Handwerk zu legen. Dazu gilt es zunächst einmal, die rechtlichen Schlupflöcher zu beseitigen, die Kleptokratie-Dienstleistern in die Hände spielen. Es gibt keinen Grund, warum es etwa möglich sein sollte, Immobilien mit Briefkastenfirmen zu erwerben. Die Empfehlungen einer jüngsten Studie von Chatham House zum Kleptokratie-Problem Großbritanniens geben weitere auch auf andere Länder anwendbare konkrete Empfehlungen, wie sich dem Geschäftsgebaren vieler Handlanger ein Riegel vorschieben lässt. Aber viele Praktiken werden immer noch legal sein. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass sie für die willfährigen Dienstleister korrupter Eliten mit Kosten verbunden sind – sowohl mit Blick auf die Reputation als auch die Profitabilität. Dazu muss es verpflichtende Transparenzerfordernisse geben, die Dienstleister dazu zwingen, ihre Klientenlisten offenzulegen. Nur so können Medien und Aktivistinnen die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit darauf lenken und skandalisieren, wenn sich vermeintlich honorige Mitglieder der Bürgerschaft für korrupte und autoritäre Klienten verdingen. Und der Staat kann dafür sorgen, dass bei öffentlichen Aufträgen all diejenigen ausgeschlossen oder zumindest mit einem Malus in der Bewertung versehen werden, die Dienstleistungen für korrupte Eliten erbringen.
Eine schwierige Grauzone ist dabei die Rolle von Anwälten. Der Mandantenschutz ist wichtig, aber er wird leider auch allzu oft als Schutzschild missbraucht von Anwälten, die kleptokratiefreundliche Dienstleistungen erbringen. Gleichzeitig sollte man es korrupten Eliten, die ihre Gelder im Westen reinwaschen, schwieriger machen, ihre Reputation durch vermeintlich großzügige Philanthropie aufzuhübschen. Universitäten, Thinktanks, Sportvereine sowie kulturelle Institutionen sollten eine Selbstverpflichtung unterzeichnen, keine Gelder anzunehmen, die direkt oder indirekt aus autoritären Staaten stammen.
Dass sich mittlerweile auch Finanzzentren außerhalb des Westens als Dienstleister für korrupte Eliten etabliert haben und diese dorthin ausweichen können, kann kein Argument sein, dass wir nicht erst einmal vor unserer eigenen Türe kehren. Dann haben wir die Glaubwürdigkeit, um Dubai, Hongkong, Mauritius und Singapur unter Druck zu setzen, es uns gleichzutun. Der »Summit for Democracy«-Prozess des US-Präsidenten Biden stellt aus gutem Grund den Kampf gegen Korruption und Kleptokratie in den Mittelpunkt.
Wir helfen damit den Bevölkerungen vieler armer Staaten, deren Eliten Gelder außer Landes schaffen, die dann für öffentliche Güter fehlen. Vor allem aber helfen wir uns selbst. Die Kleptokraten halten uns den Spiegel vor. Teile unserer eigenen Eliten sind allzu leicht korrumpierbar. Für Putin und die Seinen war es immer eine Freude, uns zu signalisieren: »Ihr tut immer so tugendhaft, seid am Ende aber genauso käuflich wie wir.« Gerhard Schröder diente Putin dafür als effektivstes Demonstrationsobjekt. Wir haben zu viele kleine Schröders, die ihre Dienste willfährig jedem anbieten, der zahlt. Das zersetzt Demokratie von innen und unterminiert die Glaubwürdigkeit demokratischer Eliten, sehr zur Freude antidemokratischer Populisten. Wir haben es in der Hand, den willfährigen Helfern korrupter Eliten die Geschäftsgrundlage zu entziehen.
Wir brauchen diese Selbstreinigung, damit wir wieder in den Spiegel schauen können. Schreiben Thorsten Benner und Ricardo Soares de Oliveira in einem Gastbeitrag im SPIEGEL.
Thorsten Benner und Ricardo Soares de Oliveira zeichnen mit ihrem Gastbeitrag ein ebenso stimmiges und zutreffendes wie auch entlarvendes Sittengemälde, das uns allen, egal ob westliche Demokratien oder östliche Diktaturen, den Spiegel vorhält.
Die kommenden Generationen werden nicht umhin kommen, die unsägliche Korruption, die im Kleinen bei schäbigen Pöstchenjägern* anfängt und im Grossen bei den «Oligarchen» des Westens aufhört, mit aller Vehemenz zu bekämpfen, wollen sie die Demokratien retten.
Denn letztendlich geht es, zumindest im Westen, um nichts weniger als die Freiheit. Diejenigen, die heutzutage im Trychlergewand und mit der finanziellen und geistigen Unterstützung der esoterisch verseuchten SVP angeblich für die Freiheit auf die Strasse gehen, sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
* https://www.blick.ch/politik/damian-mueller-sichert-sich-lobby-mandate-freisinniger-poestchen-jaeger-id15717324.html
-
15.3.2022 - Tag des russischen Oligarchs Androssovs vom Luzerner Gütsch
Soll Putins KGB-Kumpel gehören: Nächste Oligarchen-Yacht festgesetzt – diesmal in Spanien
Zum ersten Mal wurde eine Oligarchen-Yacht in Spanien festgesetzt. Sie soll Sergei Tschemesow, dem Chef des staatlichen russischen Rüstungskonzerns Rostec – und ehemaligem KGB-Kumpel von Putin gehören.
Spanische Behörden haben erstmals eine Yacht festgesetzt, sie soll einem von EU-Sanktionen betroffenen russischen Oligarchen gehören. Das berichteten die Zeitung «El País» und andere spanische Medien am Montagabend.
Es werde geprüft, ob die Luxusyacht «Valerie» im Hafen von Barcelona, deren Wert mit 135 Millionen Euro angegeben wurde, tatsächlich dem Chef des staatlichen russischen Rüstungskonzerns Rostec, Sergej Tschemesow (69), gehöre, schrieb die Zeitung unter Berufung auf die Generaldirektion der spanischen Handelsmarine.
Tschemesow ist alter Freund von Putin
Tschemesow steht wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf der Sanktionsliste der EU. Er ist ein alter Bekannter des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69). Beide dienten einst gemeinsam beim sowjetischen Geheimdienst KGB in Dresden.
Als Eigentümerin der 85 Meter langen «Valerie» unter der Flagge des kleinen Karibik-Staates St. Vincent und die Grenadinen sei eine Briefkastenfirma eingetragen. Dass das 2011 von der Bremer Lürssen-Werft gebaute Schiff möglicherweise tatsächlich Tschemesow gehöre, ergebe sich aus den im vergangenen Jahr veröffentlichten Pandora Papers, schrieb die Zeitung.
Nach den Recherchen eines internationalen Journalistennetzwerks, dem auch «El País» angehörte, bestehe zwischen dem Oligarchen und dem Schiff ein kompliziertes Netzwerk von Firmen in Steueroasen. Die spanischen Behörden hätten in diesem Zusammenhang auf die grossen Schwierigkeiten hingewiesen, die Eigentumsverhältnisse zweifelsfrei festzustellen. Schreibt Blick.
Seien wir mal ehrlich: Die Festsetzung (nicht Beschlagnahmung!) dieses Schiffchens ist eine Lachnummer. Tönt zwar gut in den Ukraine-Livetickern der Medien, tut aber keinem russischen Oligarchen richtig weh. Eine Beschlagnahmung würde mit grösster Wahrscheinlichkeit der Rechtsprechung westlicher Gerichte nicht standhalten.
Theoretisch wäre auch das Château Gütsch ein Fall für eine Beschlagnahmung. Gehört inzwischen dem Russen Kirill Androssov, der es vom russischen Oligarchen und Vorbesitzer des Châteaus Gütsch, Lebedev, gekauft hat.
Androssov tauchte ebenfalls in den Pandora Papers auf.
Ausserdem war Androssow von 1997 bis 1999 Leiter des Management Teams für Investitionsprojekte und anschliessend Direktor der Wirtschaftsabteilung im Komitee für Immobilienverwaltung der Putin-Stadt St. Petersburg (sic!).
Androssow war ausserdem von 2004 bis 2008 Direktor der Abteilung für Tarifregulierung und Infrastrukturreform und anschliessend stellvertretender Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Russischen Föderation.
Von 2008 bis 2010 war er stellvertretender Stabschef im Büro des russischen Premierministers und Putins Marionette Dmitrij Medvedev.
Hat also recht viel Dreck am Stecken, der gute Kirill Androssov mit seinen skurrilen Geschäftsmodellen.
Und wie wär's, wenn die Schweizer Finanzindustrie die noch immer bestehenden Schlupflöcher für die russischen Oligarchen schliessen würde, bevor es Amerika tut?
-
14.3.2022 - Tag der sexuellen Weicheier
Viermal Sex pro Monat: Paar regelt Beziehung mit Vertrag – «In Bezug auf die Liebe habe ich nichts gelernt»
Als Kunstexperiment sollten Jeanne und Mike 365 Tage lang zusammen sein. Ihr Alltag war zum Grossteil vertraglich geregelt. Nun, nach Ende des Projekts, ziehen die beiden Bilanz.
Jeanne und Mike waren fast ein Jahr zusammen – ohne Schmetterlinge im Bauch. Grund dafür ist ein Experiment namens «relation amoureuse de qualité», das als Kunstprojekt von Jeanne gedacht war. Demnach schloss das Paar einen Vertrag, laut welchem die Genferin und der Berner in den folgenden 365 Tagen monatlich mindestens 32 Stunden miteinander verbringen und viermal miteinander schlafen sollten.
Die Idee kam Jeanne, als sie sich Gedanken über die kapitalistische Arbeitswelt machte. «Bei der Arbeit erwartet man etwas für seine Leistungen. Ist das in der Liebe nicht auch so? Wir erwarten schliesslich eine Gegenleistung, wenn wir etwas für unsere Partnerin oder unseren Partner machen», sagte sie zum «Blick». «In einem ersten Schritt dachte ich mir lediglich, dass es echt witzig wäre, alles vertraglich festgehalten zu haben. Ziel war es, die Absurdität der sozialen Normen aufzuzeigen, wie zum Beispiel, dass Pärchen in der Öffentlichkeit Händchen halten sollten. Schliesslich wollte ich herausfinden, ob Gefühle aus einer so kalten und trockenen Sache entstehen könnten.»
Kennengelernt haben sich Jeanne und Mike über Tinder. Bereits beim dritten Treffen führten sie eine Zeremonie durch, in welcher ihr gemeinsam aufgesetzter Vertrag unterschrieben wurde. «Unser erstes Mal war ziemlich speziell. Dadurch, dass wir uns nicht von Grund auf zueinander hingezogen fühlten, mussten wir diese Anziehung erst erzeugen. Dadurch suchten wir spezifisch nach Eigenschaften bei der anderen Person, die uns gefielen, um diese Lust zu schaffen. Das fand ich äusserst interessant», so Jeanne.
«In Bezug auf die Liebe habe ich in dieser Performance nichts gelernt»
Das Paar habe sehr bald realisiert, dass der Geschlechtsverkehr im Vertrag problematisch sein würde. Der Druck, viermal im Monat miteinander zu schlafen, habe sich angefühlt wie Sex ohne Konsens. «Aber andererseits war es somit ähnlich wie bei Paaren, die seit langer Zeit zusammen sind und sich einreden, dass man so und so viel Mal wöchentlich Geschlechtsverkehr haben muss und sonst etwas nicht stimmt», sagt die Künstlerin.
Nach 317 Tagen brach Mike schliesslich das Experiment ab. Zur «bärner studizytig» sagt er: «Ich war sehr frustriert mit dieser unnatürlichen Beziehung.» Es habe oft Meinungsverschiedenheiten gegeben. «Mir wurde klar, dass ich mit einer Person mit solchen Ansichten keine Zeit verbringen will.» Jeanne ist enttäuscht darüber, die Performance nicht zu Ende gebracht zu haben und bedauert, Mike in diese Situation gebracht zu haben.
«In Bezug auf die Liebe habe ich in dieser Performance nichts gelernt», sagt Mike. Auch Jeanne meint, sie habe jetzt noch mehr Fragen zum Thema Liebe als vor dem Experiment. Beide wollen nie wieder eine derartige Beziehung eingehen. Heute haben die beiden keinen Kontakt mehr. Schreibt 20Minuten.
Wofür die beiden Weicheier einen Monat benötigen, schafft unsereiner trotz Gicht und eingewachsenen Zehennägeln noch immer locker an einem Tag.
Happy Montag.
-
13.3.2022 - Tag des Fastens
Fastenurlaub im Kloster – ein Selbstversuch
Sehnen Sie sich auch manchmal nach einer Auszeit vom Alltag? Wer sich mal eine Weile vom Rest der Welt abschotten will, kann es mit einem Fastenurlaub im Kloster versuchen. Unsere Autorin hat das, trotz vieler Bedenken, im Salzburger Land ausprobiert.
Kirchenläuten. Kuhglocken. Klospülung. Und das Rotorengeräusch des Rettungshubschraubers. Das sind die wenigen Geräusche, die die Stille im Johannes-Schlößl der Pallottiner in Salzburg durchbrechen. Dorthin hat es mich für eine Woche verschlagen, um abzuschalten.
Denn Arbeit, Stress, das Virus und das Essen – all das war zuletzt zu viel. Ich sehnte mich nach Ruhe. Abgeschottet von der Welt, nichts hören und nichts sehen. Abstand gewinnen, um mir selbst näher zu sein. Das mit dem Fasten hat sich dann so ergeben. Genauso wie der Ort.
Das Kloster liegt versteckt im Grünen auf dem Mönchsberg – und zu seinem Fuße das Krankenhaus. Für einen Fastenneuling wie mich irgendwie beruhigend. Denn vor meinem Trip höre ich viele Schauermärchen übers Fasten. Erbrechen, Nervenzusammenbrüche, Schwindel – all das hält mich nicht davon ab, einzuchecken.
Das Fasten beginnt bereits vor dem Urlaub
Ein paar Tage vor dem Fasten kommt eine ausführliche E-Mail. Einfach hinfahren und loslegen ist nicht. Man solle doch schon vor der Anreise beginnen, auf Kaffee zu verzichten. Ich bin motiviert und steige um auf Tee. Die Packliste für den Aufenthalt ist lang: Wanderstöcke, Wärmflasche, Trinkflasche, Thermoskanne. Ich schleppe so viel Zeug mit, dass damit locker drei Wochen Survival-Training im Dschungel drin gewesen wären.
Bei der Anreise bin ich die Erste. Ich nutze den Vorsprung und erkunde die Umgebung. Ohne Plan, komplett unvorbereitet und hungrig. Seit den frühen Morgenstunden knurrt der Magen. Und im Wochenplan ist kein Abendessen vorgesehen. Das löst ein wenig Unbehagen aus. Unterwegs habe ich mir nicht einmal etwas zu trinken gekauft, und mein Zimmer, in dem ich mich vor den Verlockungen der Welt verstecken kann, ist erst später bezugsfertig.
Ich streife durch den Wald, in der Hoffnung, irgendwo ein Gasthaus zu finden. Schließlich lande ich vor dem Museum der Moderne. Urplötzlich scheint die Kraft zurück in den Körper zu kehren. Denn die logische Schlussfolgerung: wo ein Museum, da auch ein Shop. Und richtig: Es gibt ein Terrassencafé.
Die Sonne scheint, die Aussicht ist grandios. Unter mir breitet sich die Salzburger Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen aus, daneben scheint die ehrwürdige Festung zum Greifen nahe. Wie gerne hätte ich jetzt etwas zwischen den Zähnen. Aber ich wage mich nicht ins Café. Stattdessen schlendere ich durch den Shop. Ein Getränk tut es auch. In der Auslage: Postkarten, Kunstdrucke und hübsche Notizblöcke. Aber nichts, um meinen Magen zu beruhigen. Ich kaufe eine Eintrittskarte fürs Museum.
Erster Stock: Frida Kahlo und Marilyn Monroe beschäftigen mich. Es geht um Spuren. Welche möchte ich hinterlassen? Wann ist der entscheidende Augenblick? Etwa jetzt? Gibt es schöne Fehler? Ich gehe weiter und sehe ein Foto von einer Kuh – sofort schießt mir ein knuspriges Schnitzel in den Sinn. Zweiter Stock: Hier geht es zum Café, vor dem ich bereits stand. Dritter Stock: Ich bin begeistert von der multimedialen Ausstellung.
Aber die Begeisterung nährt eben nur die Sinne, nicht meinen knurrenden Magen. Also sitze ich zwei Stunden später dann doch auf der Terrasse und bestelle Saft und klare Suppe.
Verzicht wird im Kloster großgeschrieben
Zurück im Kloster: Die Zimmer des Gästehauses sind schlicht, ohne TV, dafür groß, mit eigenem Bad und Blick in den Garten. Meines wird für mich schnell zum privaten Rückzugsgebiet. Ich packe meinen Koffer aus und lege meine Notfallkekse auf den Schreibtisch.
Der Hälfte der inzwischen vollständigen Reisegruppe war nicht bewusst, dass sie ein Fastenseminar gebucht hat. Auch mir nicht. Das dichte Wochenprogramm überrascht. Es lässt kaum Freiraum. Nach dem obligatorischen Kennenlernen geht es zum gemeinsamen Saft löffeln. Das Abendessen ist ein Glas gepresster Apfel mit Karotte und Rübe. Ich bin froh, am ersten Tag überhaupt etwas zu bekommen und löffle mehr als 20 Minuten an meinem Saft.
„Der Trick ist die Langsamkeit“, sagt der Fastenleiter und Qigong-Lehrer Alexander Steinberger. Jeder Löffel wird bewusst und achtsam geschlürft. Es gilt, aus dem Wenigen so viel wie möglich herauszuholen. Dann die große Entscheidung: Wer nimmt am Hardcore-Fasten mit Saft und Suppe nach Otto Buchinger teil? Wer wählt die leichtere Basenfasten-Variante? Ich oute mich als Weichei und entscheide mich für das Basenfasten.
Längst hat sich dichter Nebel über meine Gedanken gelegt und der Kopf pocht. Ich schütte eine Tasse Wermut-Tee in mich hinein und lege mich ins Bett. In der Nacht träume ich so intensiv wie lange nicht. Am Morgen habe ich das Gefühl, neben mir zu stehen.
Sightseeing beim Wandern rund um Salzburg
Das Frühstück ist ein Lichtblick und wirkt wie Völlerei: Apfel, Banane, Tomaten, Gurken. Dazu ein süßes Mus aus Pflaumen, Datteln und Rosinen. Noch eine Tasse Tee, dann geht es zum Wandern – mehrere Stunden, jeden Vormittag. Die Ziele sind Sehenswürdigkeiten in oder rund um Salzburg: Schloss Leopoldskron, Schloss Hellbrunn, die Wallfahrtskirche Maria Plain oder der Kapuzinerberg. Fasten mit Sightseeing sozusagen.
Bewegung lenkt ab. Doch in der Gruppe finde ich meinen Rhythmus nicht. Deshalb laufe ich die Tage darauf auf eigene Faust los. Das funktioniert. Alleine bin ich mehr bei mir. Ich kann das Gehörte und Gefühlte so besser einordnen. Andere brauchen die Unterhaltung und die Gesellschaft. Schließlich spielt die Gruppendynamik beim Fasten eine wichtige Rolle. Das Wir und der Austausch tragen über schwere Stunden hinweg.
Der erste Fastentag ist für mich eine Achterbahnfahrt: Stündlich fühle ich mich anders. Überwiegend aber nicht gut. Ich bin ausgelaugt und erschöpft. Bei der Mittagsruhe schlafe ich sofort ein – mit dem ersten Leberwickel meines Lebens. Ob er hilft? Keine Ahnung. Daheim ist ein Nachmittagsschläfchen unvorstellbar. Im Kloster falle ich in den Tiefschlaf.
Mit dem Pater Gespräche über Gott und die Welt
Am zweiten Tag fühlt es sich an, als wäre ich bereits drei Wochen hier. Nachmittags suche ich den spirituellen Impuls mit Pater Rüdiger Kiefer. Seine Worte berühren. Alle sind da, weil sie etwas verloren haben, etwas loswerden, etwas suchen oder etwas finden wollen. Manchmal geht es ums Gewicht, in Wahrheit aber um viel mehr. Der Pater nimmt sich Zeit für ein Gespräch über Gott und die Welt.
Der Kopfschmerz ist weg. Ich freue mich aufs Mittagessen, die Sonne und den Garten. Die Klostermauern geben Halt. Der Fastennebel lichtet sich. Ich höre auf meinen Körper und meine Seele. Der Hunger? Der ist da. Aber nicht so aufdringlich wie befürchtet. Ein halber Apfel und ich bin satt. Es fühlt sich nicht an wie Verzicht, weil ich meinen Fokus auf das lenke, was da ist und nicht auf das, was fehlt.
Während wir Rote-Bete-Suppe löffeln, bekommen die anderen Hausgäste Sachertorte serviert. Ein Pater kommentiert das lächelnd als Übung in Askese. Wäre niemand im Raum, hätten sich zwei Fastende längst auf den schokoladigen Genuss gestürzt. Mir macht der Anblick nichts. Ich freue mich über unseren großen Teller mit Gemüse.
Es schmeckt himmlisch. Die Gespräche am Tisch drehen sich immer ums Essen. Ich hätte nicht gedacht, dass es übers Fasten so viel zu sagen gibt. Die Hardcore-Fastenden sehen inzwischen nicht mehr so fit aus. Sie haben Glaubersalz getrunken, um den Darm von Giftstoffen zu befreien. Das ist beim Basenfasten nicht notwendig.
Yoga bringt den Kreislauf wieder in Schwung
Am dritten Tag schreibe ich alles nieder, was mich bewegt. Endlich darf auch raus, was im Kopf ist: giftige Erinnerungen und Gedanken, die nicht mehr gebraucht werden. Das beruhigt den Geist. Schließlich geht es beim Fasten ums Loslassen und neu Ordnen. Abends heißt es: Suppe löffeln, Dachterrasse besichtigen, Spaziergang im Finsteren und Vortrag.
Die Stimmung bei den Fastenteilnehmern nach Buchinger scheint am Boden zu sein. Typisch. Es ist der dritte Tag. Da ist es am schlimmsten. Ich ergreife die Flucht. Nach 20 Uhr bin ich weder aufnahmefähig noch gruppenkompatibel.
Der Hunger wird weggetrunken. Drei bis vier Liter Wasser und Tee über den Tag verteilt – eine unglaubliche Menge für mich. Inzwischen habe ich meinen Rhythmus gefunden. Beim Mittagstisch werden euphorisch Pläne geschmiedet. Die Stimmung steigt, die Teilnehmerzahl bei Gruppenaktivitäten sinkt. Ich bin nicht mehr die Einzige, die ihren eigenen Weg gehen will.
Ich ziehe Tag für Tag meine Runde im Wald und mache Yoga im Zimmer. Das bringt den Kreislauf nach dem Leberwickel in Schwung. Die Energie kommt zurück. So halte ich durch. Am Abreisetag liegen die Notfallkekse noch immer ungeöffnet auf meinem Schreibtisch. Ich werde sie nicht mehr brauchen. So schlimm ist Fasten doch nicht. Auskunft: salzburg.info; Johannes-Schlößl: johannes-schloessl.at; Fasten mit Alexander Steinberger: fastenapfel.de.Schreibt die Welt.
Ich habe es versucht und – sie da! – es ist mir gelungen, einen Presseartikel jenseits der Ukraine-Liveticker-Formate und der unseligen «Putin,- Kriegs-, Russland-, Ukraine- und Konjunktiv-Experten» aufzustöbern. Die Suche war mühselig. Aber sie hat sich gelohnt.
Eine wunderbare Story über einen Fastenurlaub in einem österreichischen Kloster. Für einmal nicht verborgen hinter einer Bezahlbarriere.
Fasten wäre derzeit sowieso angesagt. Nicht nur bezüglich Übergewicht und sonstiger Wehwehchen. Wir sollten versuchen, auch unsere Hirnstube zu entschlacken. Weg vom überflüssigen Medienkonsum und weg von den unsäglichen Push-Nachrichten. Es kommt sowieso alles wie's kommen muss.
Ihre Möglichkeiten, gewisse Ereignisse ausserhalb Ihres persönlichen Bereichs beeinflussen zu können, sind, gelinde ausgedrückt, sowieso limitiert.
Draussen scheint die Sonne. Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite. Geniessen Sie diese wunderbaren Augenblicke.
Happy Sonntag!
-
12.3.2022 - Tag des SVP-Messias vom Herrliberg
Zur Neutralität der Schweiz: Blocher kündigt Volksinitiative an
SVP-Übervater Christoph Blocher prüft die Lancierung einer Volksinitiative. Es soll um den Schutz der Schweizer Neutralität gehen.
Alt Bundesrat Christoph Blocher (81) ist überzeugt: Es braucht einen Artikel in der Bundesverfassung, der die Schweizer Neutralität schützt. Wirtschaftliche Sanktionen der Schweiz wie jene gegen Russland sollen demnach nicht mehr möglich sein. Dies sagte der SVP-Politiker in der am Freitag veröffentlichten neuesten Folge seiner Gesprächssendung «Teleblocher». «Ich bin der Meinung, dafür muss nun gesorgt werden».
Aktueller Anlass ist die Übernahme der EU-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine durch die Schweiz. Die SVP kritisiert diesen Schritt als Aufgabe der Schweizer Neutralität. Die Partei stellt sich zudem gegen die Kandidatur der Schweiz für einen Sitz im Uno-Sicherheitsrat in den Jahren 2023 bis 2024.
«Wirtschaftssanktionen sind ein Kriegsmittel»
Wirtschaftssanktionen seien ein Kriegsmittel, so Blocher. Bereits am Montag hatte Blocher der «Neuen Zürcher Zeitung» gesagt, wer bei wirtschaftlichen Sanktionen mitmache, sei Kriegspartei. Damit habe die Schweiz leichtsinnig die Chance vertan, als neutrales Land einen Beitrag für eine Friedenslösung zu leisten.
Man sei «in der Prüfung» eines Volksbegehrens. Auf parlamentarischem Wege lasse sich keine Änderung erreichen, da ausser der SVP «die ganze Horde im Parlament» der Meinung sei, man solle die integrale Neutralität fallen lassen.
Cassis sieht Neutralität als nicht tangiert
Aussenminister Ignazio Cassis (60) hatte diesem Verständnis von Neutralität gleichentags in der Fragestunde des Nationalrats widersprochen. «Die Schweiz ist nicht im Krieg mit Russland», sagte er. Sanktionen seien keine militärische Gewalt. Der Bundesrat habe die Neutralitätsfrage geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass diese durch die Übernahme der Sanktionen nicht tangiert sei.
«Einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral», hatte Cassis bereits eine Woche zuvor gesagt, als der Bundesrat die Übernahme der Sanktionen an einer Sondersitzung beschlossen hatte. Die Schweiz sei den humanitären Geboten verpflichtet und dürfe nicht zusehen, wie diese mit Füssen getreten würden. Schreibt Blick.
Das kommt eigentlich nicht unerwartet: Der Alte vom Herrliberg spuckt Gift und Galle gegen die Schweizer Sanktionsmassnahmen gegen Russland. Das ist er dem schäbigen SVP-Flügel der unzähligen Trychler und Putin-Verstehern schlicht und einfach schuldig.
Die alte Mär, dass die Schweiz ein neutraler Staat sei, ist nichts anderes als kitschiger Unsinn und wird auch durch stetiges Wiederholen nicht wahrer. Die Schweiz war noch nie neutral und wird es auch nie sein.
«Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein». Dieses Zitat stammt übrigens nicht von Tucholsky, wie fälschlicherweise immer wieder behauptet wird. Beim SVP-Messias vom Herrliberg mit seinem vorsintflutlichen Gedankengut aus der Märchenstube von Schillers «Wilhelm Tell» trifft es allerdings den Nagel auf den Kopf.
Inkontinenz macht ab einem gewissen Alter eben vor niemandem Halt und beginnt nicht selten tröpfchenweise in irgendwelchen Windungen des Gehirns.
-
11.3.2022 - Tag der Putin-, Russland-, Militär- und Kriegsexperten*innen
Russland-Experte Kofman über die Nachschub-Probleme: «Russland ist in drei oder vier Wochen kampfunfähig»
Putins Traum einer schnellen Invasion ist geplatzt. Der Widerstand der Ukrainer ist grösser als erwartet, es fehlt an Nachschub und die Stimmung unter den Soldaten ist extrem schlecht. Es sieht schlecht aus für die Russen.
Putins Armee hat sich auf einen schnellen Krieg mit einem baldigen Regimewechsel in der Ukraine eingestellt. Ein Trugschluss. Die Ukrainer leisten Widerstand – und wie. Da die russischen Streitkräfte nicht auf einen langfristigen Krieg vorbereitet waren, machen sich nun die ersten grösseren Probleme bemerkbar.
Nicht einmal Nachschublinien hat das russische Militär aufgebaut, weil sie dachten, dass der Krieg innert weniger Tage vorbei wäre. Jetzt fehlt es den Truppen an Benzin, Nahrung und Munition. Bei den russischen Soldaten macht sich deswegen jetzt eine schlechte Stimmung breit.
Für Michael Kofman, Direktor des Forschungsprogramms für Russlandstudien, ist klar: Die Russen «haben die anfängliche Invasion verpfuscht.» Das sagt der Experte im Interview mit dem «Spiegel».
Russen werden mehr Luftangriffe fliegen
Zu Beginn hätten die Russen sehr irrational gehandelt. «Nun beobachten wir, wie sie sich auf einen viel hässlicheren und schwierigeren Krieg einstellen.» Und genau darum ist Putin im Zugzwang. Er muss etwas ändern. Kofman geht davon aus, dass der Kremlchef vermehrt auf Luftangriffe setzen wird.
Der Grund: Die Armee hat nicht genug Kapazitäten für Stadtkämpfe in ukrainischen Grossstädten wie Kiew oder Charkiw. «Ein wichtiger Punkt des ursprünglichen Plans war es, Krieg in den Städten zu vermeiden», erklärt der Russland-Experte. Durch die Luftangriffe werde es allerdings vermehrt zivile Opfer geben, da solche Angriffe oft grossflächig und auch eher ungenau erfolgen.
Truppen könnten sich zurückziehen
Aufgrund der aktuellen Verlustrate und dem fehlenden Nachschub könnten die Russen allerdings zeitnah nicht mehr genügend für den Krieg ausgerüstet sein. Bald könnten sie nämlich zu viel Personal und Material verloren haben. Und da sie keine Nachschublinien aufgebaut haben, wären sie dann nicht mehr fähig, ihre Kriegsoperationen aufrechtzuerhalten.
Dieser Fall könnte laut Kofman demnächst eintreten. «Ich denke, dass es wahrscheinlich drei oder vier Wochen dauern wird, bis sie weitgehend kampfunfähig werden», schätzt der Experte. Ihm zufolge müssten sich die Truppen dann zurückziehen und neu organisieren oder die Operation ganz abbrechen.
Dennoch: Die Russen dürfte man auch nicht unterschätzen. «Es ist wichtig, dass wir nicht von einer Überschätzung der russischen militärischen Fähigkeiten direkt zu einer enormen Unterschätzung auf der Grundlage dieses schlechten Auftritts übergehen.» Schreibt Blick.
Nachdem wir zwei Jahre mit 8,637 Millionen Corona-Experten*innen hinter uns haben, beglücken uns seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nun 8,637 Millionen Putin-, Russland-, Militär- und Kriegsexperten*innen mit hanebüchenem Unsinn.
Der Konjunktiv, unter dessen Deckmantel so ziemlich jeder Depp so ziemlich alles behaupten kann ohne je dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, feiert Hochkonjunktur: Hätte, wäre, könnte.
Wäre Hans Erni nicht gestorben, würde er noch leben.
-
10.3.2022 - Tag des ersten Opfers eines jeden Kriegs
USA warnen vor russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen
Die US-Regierung bezeichnet die Vorwürfe Russlands, wonach in der Ukraine Bio-Labore im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums nukleare und biologische Waffen entwickeln sollen, als Falschinformation.
Es sei aber möglich, dass Russland in der Ukraine bald selbst chemische oder biologische Waffen einsetze, wie die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt. Moskau wolle mit den Falschinformationen den Weg ebnen, um den Krieg gegen die Ukraine weiter zur rechtfertigen. Schreibt SRF im Ukraine-Krieg-Liveticker.
Es ist ja nicht so, dass wir Putin den Einsatz von Massenvernichtungswaffen nicht zutrauen würden. Im Gegenteil: Der russische Diktator ist wohl für jede kriegerische Schandtat zu haben.
Doch wenn die USA vor Massenvernichtungswaffen waren, ist seit dem Irak-Krieg eine gewisse Skepsis durchaus auch angebracht.
Erinnern wir uns: 4-Sterne-General und Vietnam-Veteran Colin Powell († 18. Oktober 2021) war der erste schwarze Aussenminister der USA. Er verkaufte der Welt vor der versammelten UNO die Lüge über Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein, um damit die Irak-Invasion der USA zu rechtfertigen.
Powell wurde das Gesicht einer Lüge und eines Einmarsches, den eine «Koalition der Willigen» unterstützte und von der die USA behaupteten, sie sei durch die UN-Resolution 1441 gedeckt gewesen, in der der Irak aufgefordert wird, seinen Abrüstungsverpflichtungen nachzukommen. Doch Belege für diese Massenvernichtungswaffen blieb die Regierung schuldig. Powells Aussagen vor der UNO waren falsch. Schrieb DIE ZEIT.
«Natürlich habe ich die öffentliche Meinung beeinflusst», sagte Powell in einem Interview mit Larry King beim Fernsehsender CNN im Jahr 2010. Er habe einen entscheidenden Unterschied gemacht. «Das war es, was der Präsident von mir wollte und das war meine Aufgabe.» Die Mission erfüllen.
Doch es war eine Mission, die Powell später bereute. Das sagte er nicht nur Larry King, sondern in unzähligen Interviews. Kein Verstecken. In einem ABC-Interview mit Barbara Walters sagte er, es sei ein «Schandfleck» seiner Karriere und «bis heute schmerzhaft».
Es ist eine alte Weisheit, dass im Krieg die Wahrheit immer als erstes Opfer zuerst stirbt.
-
9.3.2022 - Tag der Schweine von der Darmstrasse Luzern
Die Schweine von der Darmstrasse: Sauberkeit statt Sauerei an den Sammelstellen in der Stadt Luzern
In der Stadt Luzern stehen 28 Separatsammelstellen für die Aufnahme von diversen Abfällen zur Verfügung. Die meisten Benützerinnen und Benützer halten sich beim Entsorgen ihrer Abfälle an die geltenden Vorschriften, leider jedoch noch nicht ganz alle.
Fast die Hälfte aller Abfälle aus der Stadt werden getrennt gesammelt und wiederverwertet. An 28 Separatsammelstellen in der Stadt Luzern können Glas, Aludosen und Weissblechbüchsen sowie Batterien entsorgt werden, bei den meisten zudem noch Textilien und Schuhe und bei elf Sammelstellen auch Altöl. Im Jahr 2020 wurden beachtliche 2'395 Tonnen Glas und 155 Tonnen Alu und Weissblech eingeworfen. Zusätzlich sind im Gebiet des Gemeindeverbandes REAL (Recycling, Entsorgung, Abwasser Luzern) elf bediente Ökihöfe mit einem umfangreichen Sammelangebot vorhanden. Die meisten Abfallarten können dort kostenlos abgegeben werden. Ausführliche Informationen zu «was wann und wo» richtig entsorgt werden kann erfahren Sie in der Sammelkalender-App sowie im städtischen Abfallkalender.
Nur zulässige Materialien
Je mehr gesammelt wird, desto wichtiger ist das sortenreine Trennen der Separatabfälle und ein korrektes Verhalten. Die Sammelstellen sind ausschliesslich für jene Abfallarten vorgesehen, für die ein entsprechender Sammelbehälter bereitsteht. Falls Abfälle zu gross für die Einwurföffnung sind, darf man sie nicht einfach bei den Sammelbehältern stehen lassen. Wenn sich also ein 10-Liter-Party-Bierfass aus Aluminium oder die 5-Liter-Weinflasche wegen ihrer Grösse nicht einwerfen lassen, müssen sie wieder mitgenommen und in einem Ökihof richtig entsorgt werden.
Ordnung an den Sammelstellen
Alle weiteren Abfallarten und Fremdstoffe haben an den städtischen Sammelstellen nichts zu suchen: Abfälle, für deren Aufnahme die Sammelstellen nicht ausgerüstet sind, dürfen dort auch nicht zurückgelassen werden. Separatabfälle werden in die entsprechenden Sammelbehälter eingeworfen und nicht einfach in der Tragetasche bei der Sammelstelle zurückgelassen. Leere Papiertragetaschen und Kartonschachteln entsorgt man zu Hause mit der Kartonsammlung. Das Deponieren von sämtlichen unzulässigen Abfällen an den Sammelstellen ist strafbar, wird entsprechend geahndet und kostet die Fehlbaren mindestens 150 Franken.
Keine PET-Flaschen!
Getränkeflaschen aus PET dürfen an den städtischen Sammelstellen nicht entsorgt werden. Das Einsammeln und Recyceln von PET wird von der privatwirtschaftlichen Organisation PET-Recycling Schweiz (www.petrecycling.ch) durchgeführt: Sie unterhält ein schweizweites Netz mit über 56'000 Sammelstellen. So können PET-Flaschen einfach und kostenlos im Detailhandel in die blau-gelben Sammelcontainer eingeworfen und damit in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden.
Öffnungszeiten einhalten
Die Zeiten für die Benützung der Sammelstellen sind bewusst grosszügig ausgelegt: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr, ausser an Sonn- und Feiertagen. In der Regel sind die Sammelstellen also an sechs Wochentagen jeweils 13 Stunden lang zugänglich. Damit haben auch Berufstätige – selbst bei unregelmässigen Arbeitszeiten – die Möglichkeit, ihre Abfälle während der geltenden Öffnungszeiten zu entsorgen. Entsorgungen zu Unzeiten – also nach 20 Uhr, vor 7 Uhr früh oder gar an Sonn- und Feiertagen – stören aber die Ruhe der Anwohnerschaft und werden nicht toleriert.
Ihre Stadt, Ihr Quartier und Ihre Mitmenschen danken allen, die ihren Abfall richtig entsorgen und damit für Sauberkeit sorgen. Alle anderen bitten wir, Sauereien zukünftig zu vermeiden, sich an den Sammelstellen vorbildlich zu verhalten und die geltenden Vorschriften künftig zu befolgen. Unzulässige Materialien verteuern die Entsorgung und das Recycling und verursachen einen erhöhten Reinigungsaufwand. Schreibt die Stadt Luzern in ihrer Medienmitteilung.
Zum Plakat der unsäglich gedankenlosen «Sensibilisierungskampagne» der Rot/Grünen Stadtregierung Luzerns bezüglich Abfallentsorgung: Die Schweine haben es nicht verdient, mit den Güselgrüseln der Darmstrasse in Luzern auch nur im Geringsten verglichen zu werden.
Das Plakat ist eine Frechheit gegenüber diesen wunderbaren Tieren und sollte auf der Stelle entfernt werden. Falls es der Rot/Grünen Stadtregierung an Kreativität fehlt, stelle ich gerne mein grafisches Talent kostenlos zur Verfügung.
Wenn Schweine genügend Platz zur Verfügung haben, sind die Tiere sehr darauf bedacht, sich nicht dort zu entleeren, wo sie schlafen oder essen. Ähnlich wie wir Menschen teilen sie ihr Zuhause normalerweise in Funktionsbereiche auf und haben zum Beispiel eine Ecke, die sie als Toilette nutzen. Schweine «schwitzen nicht wie Schweine» – die Tiere sind gar nicht imstande zu schwitzen. Schweine lieben es, im Wasser oder Schlamm zu baden, um sich abzukühlen. https://www.peta.de/themen/schweine/

-
8.3.2022 - Tag der russischen Drohungen
Russland droht mit Gaslieferstopp durch Nord Stream 1
Westliche Staaten bringen angesichts des Ukrainekriegs einen Boykott von russischem Gas und Öl ins Spiel. Darauf reagiert nun der Vizeregierungschef in Moskau – mit einer unverhohlenen Warnung.
Russland hat nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine erstmals offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 gedroht. »Wir haben das volle Recht, eine ›spiegelgerechte‹ Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist.«
Das sagte der russische Vize-Regierungschef Alexander Nowak in einer am Montagabend ausgestrahlten Rede im Staatsfernsehen. Er äußerte sich mit Blick auf die gestoppte Leitung Nord Stream 2, deren Inbetriebnahme Russland anstrebt.
»Aber noch treffen wir diese Entscheidung nicht. Niemand gewinnt dabei«, sagte Nowak. Allerdings sehe sich Russland inzwischen durch die europäischen Politiker und ihre Anschuldigungen in diese Richtung gestoßen.
Die Bundesregierung hatte die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 gestoppt, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am 22. Februar die abtrünnigen »Volksrepubliken« im Donbass anerkannt hatte. Nord Stream 1 ist seit etwa einem Jahrzehnt ein wichtiger Strang für die deutsche Gasversorgung. Die Pipeline lauft von Russland aus durch die Ostsee bis Mecklenburg-Vorpommern.
Russland verfolge die Äußerungen westlicher Politiker, die sich von russischem Gas und Öl lösen wollten, sagte Nowak. Die EU-Politiker würden durch ihre Handlungen die Energiepreise inzwischen überhitzen.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wegen der fortgesetzten russischen Angriffe auf sein Land weitere und schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Nötig sei ein Boykott russischer Exporte und damit auch der Verzicht auf Erdöl und Erdgas aus Russland. Ende Februar hatte der polnische Ministerpräsident gefordert, auch Nord Stream 1 stillzulegen.
Mehr als 300 US-Dollar für ein Barrel Öl?
Russland gilt als größter Öllieferant in Europa – mit 30 Prozent des jährlichen Verbrauchs von 500 Millionen Tonnen. »Es ist völlig offensichtlich, dass der Verzicht auf russisches Öl zu katastrophalen Folgen auf dem Weltmarkt führt«, erklärte Nowak – und sagte Preise von rund 300 US-Dollar je Barrel Öl voraus.
»Die europäischen Politiker sollten ihre Bürger und Verbraucher ehrlich davor warnen, dass die Preise dann fürs Tanken, für Strom und für das Heizen in die Höhe schießen.« Die Rohstoffmacht sei vorbereitet und werde andere Absatzmärkte als Europa und die USA finden, sagte Nowak.
»Europa verbraucht heute 500 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr, 40 Prozent davon sichert Russland«, sagte der Politiker. Allein über Nord Stream 1 liefen 60 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Über alle Krisen hinweg habe das Land stets zuverlässig geliefert und leite zudem weiter Gas durch die Ukraine und über andere Wege nach Europa.
In seiner Rede warnte Nowak auch, die Nationalisten könnten bei den Kämpfen in der Ukraine einen Anschlag auf das Durchleitungssystem verüben. Russland werde alles tun, um eine Eskalation zu verhindern. Schreibt DER SPIEGEL.
Das Imperium des grossen Diktators schlägt zurück. Dass ein russisches Gas- (und auch Erdöl-) Embargo gegen den Westen die Energiepreise in unvorstellbare Höhen treiben würde, ist anzunehmen. Die Parasiten und ewigen Kriegsgewinnler der entsprechenden Branchen warten nur darauf.
Mit einer Prophezeiung schiesst der gute Vize-Regierungschef Alexander Nowak aber über das Ziel hinaus: Logisch findet Russland ausserhalb Europas und den USA andere Abnehmer für russisches Gas und Erdöl. Keine Frage. China und ein paar andere aus der Gilde der üblichen Verdächtigen stehen längst Gewehr bei Fuss.
Doch so sicher wie das Amen in der Kirche ist die Tatsache, dass diese Abnehmer, allen voran China, niemals die Preise des Westens und der USA bezahlen. Das wiederum dürfte ein grosses Loch in der russischen Staatskasse hinterlassen. Laut Wikipedia und nach Angaben der russischen Zentralbank sollen sich die Einnahmen aus Gas und Erdöl auf rund 63 % der gesamten Staatseinnahmen belaufen.
Daran dürften weder der russische Diktator noch die Oligarchen Freude haben.
-
7.3.2022 - Tag der Ratten, die das sinkende Schiff verlassen
Stadler verlagert Teile der Produktion weg von Belarus
Laut Peter Spuhler, Chef von Stadler Rail, hat der Zugbauer begonnen, Teile der Produktion aus dem weissrussischen Werk an Standorte in der EU, vor allem ins polnische Werk Siedlce, und auch in die Schweiz zu verlagern. «Wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine wirtschaftliche Integration solcher Staaten mithilft, den Demokratisierungsprozess voranzutreiben. Dazu haben wir mit unserer Investition beigetragen», sagte Spuhler gegenüber der Zeitung «Schweiz am Wochenende» (Samstagsausgabe).
Er ergänzte: «Leider wurde mit der manipulierten Wahl in Weissrussland sowie dem russischen Einmarsch in die Ukraine die rote Linie überschritten. Daher befürwortet Stadler massive Sanktionen.» Schreibt SRF im Ukraine-Liveticker.
Als Unternehmer verdient der ehemalige SVP-Nationalrat Peter Spuhler Respekt. Im Umgang mit Autokraten und Diktatoren darf man beim Chef der Stadler Rail bezüglich seiner moralischen und ethischen Kompetenz allerdings ein Fragezeichen setzen.
Seine Ausflüchte bezüglich der «roten Linie» der manipulierten Wahl in Belarus entsprechen dem typischen SVP-Speak. Oder wie Bertolt Brecht sagen würde: «Erst kommt das Fressen, dann die Moral». Ob Spuhlers Investitionen tatsächlich dem Demokratisierungsprozess in Belarus geholfen haben, darf bezweifelt werden.
Nachdem die Farce um die Präsidentschaftswahl 2020 in Belarus am 9. August 2020 endete, war für Spuhler immer noch «Alles im grünen Bereich» in Belarus, wie er in einem Interview mit der Handelszeitung beteuerte. Die Sanktionen gegen die dortige Regierung und die manipulierten Wahlen bereiteten ihm überhaupt keine Probleme.
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/stadler-rail-alles-im-grunen-bereich-in-belarus
Von wegen «roten Linien»!
Spuhler wäre mit seinem Unternehmen nicht dort wo er inzwischen angelangt ist, würde er auch nur einen einzigen Augenblick «rote Linien» setzen im Umgang mit Despoten, Diktatoren, Kriegstreibern und Unrechtsstaaten. Die «roten Linien» setzen ihm einzig und allein die westlichen Sanktionen, die seine derzeitige Handlungsweise bestimmen.
Es ist eine alte Tatsache aus der Tierwelt, dass Ratten das Schiff erst verlassen, wenn es sinkt. Vorher fressen sie sich noch den Bauch voll.
Das ist bei den meisten Playern aus Wirtschaft und Big Business nicht anders. Vor allem, wenn sie der Schweizerischen «Volchspartei» SVP angehören. Der Luzerner SVP-Nationalrat und Putinversteher Franz Grüter lässt grüssen!
-
6.3.2022 - Tag des tonnenschweren Sonnenkalenders
Stonehenge wurde als neolithischer Sonnenkalender genutzt
Der berühmteste neolithische Steinkreis der Welt, gilt sicherlich auch als einer der am besten untersuchten. Obwohl sich die Schleier der Vergangenheit da und dort lichten, sind viele Fragen rund um das viereinhalbtausend Jahre alte Monument auf der Hochebene von Salisbury in Südengland immer noch offen. Aus archäologischer Sicht ist die Legenden-umrankte urzeitliche Stätte ein Sorgenkind: Millionen Besucher verwischten in den vergangenen Jahrhunderten kostbare historische Spuren, die viel über Ursprung und Verwendungszweck des Bauwerks verraten hätten.
Sonnenanbeter und moderne Druiden
Obwohl man sich seit 1901 nur mehr gegen Eintrittsgeld dem Steinkreis nähren darf, dauerte es bis 1978, ehe zusätzliche Zäune verhinderten, dass zu viele Besucher zwischen den Monolithen gleichzeitig umherspazierten. Dennoch durfte man bis in die 1980er-Jahre gegen Bargeld ungehindert bis ins Allerheiligste vordringen – mit den entsprechenden schädlichen Folgen für das Bauwerk. Solche Massenaufläufe beschränken sich mittlerweile auf die Wintersonnenwende. Dutzende Sonnenanbeter, moderne Druiden und Schaulustige versammeln sich am 22. Dezember zu Sonnenaufgang mit dem Segen der English Heritage im Schatten der gewaltigen Steine.
Dass ihre Errichtung tatsächlich mit dem Lauf der Sonne zu tun haben könnte und als eine Art Kalender fungiert hat, wird schon seit längerem angenommen. Eine nun im Fachjournal "Antiquity" vorgestellte Studie liefert plausible Anhaltspunkte, wie der Kalender funktioniert haben könnte.
Wechselhafte Geschichte
Bisherige Ausgrabungen legen nahe, dass der Ort, an dem heute Stonehenge steht, bereits vor 11.000 Jahren eine rituelle Bedeutung für die damaligen Menschen besessen hat. Die ältesten, zu Beginn noch einfacheren Strukturen aus einem kreisrunden Erdwall mehreren Graben werden von der Forschung auf etwa 3100 bis 2900 vor unsere Zeitrechnung datiert. Zu dem megalithischen Monument, das wir heute kennen, wurde Stonehenge ab 2400 vor unserer Zeit, wobei es im Laufe der Jahrhunderte zu häufigen radikale Umgestaltungen kam.
"Die klare Ausrichtung zur Sonnenwende hat schon früh zur Vermutung geführt, dass die Stätte eine Art Kalender enthielt", sagt Timothy Darvill von der Bournemouth University. Nun zeige sich, dass der Kalender auf einem tropischen Sonnenjahr von 365,25 Tagen basiert. Die entscheidende Information lieferten die riesigen Sandsteinblöcken, die sogenannten Sarsen, die während derselben Bauphase errichtet wurden und aus demselben Gebiet bezogen wurden. Dies deute laut Darvill darauf hin, dass sie als eine Einheit gearbeitet haben.
10-Tage-Wochen
Aus diesem Grund konzentrierte sich der Wissenschafter vor allem auf diese Steine und verglich sie mit anderen kalendarischen Steinfomationen aus dieser Zeit. Dabei zeichnete sich ein System ab, das den früheren Einwohnern von Wiltshire dabei geholfen haben könnte, die Tage, Wochen und Monate im Blick zu behalten. "Unser vorgeschlagener Kalender funktioniert sehr einfach: Jeder der 30 Steine im Sarsen-Kreis repräsentiert einen Tag innerhalb eines Monats, der wiederum in drei Wochen mit jeweils 10 Tagen unterteilt ist", erklärt Darvill.
Zusätzlich wurden ein Schaltmonat von fünf Tagen und ein Schalttag alle vier Jahre benötigt, um dem Sonnenjahr zu entsprechen. "Der Schaltmonat, der wahrscheinlich den Gottheiten des Ortes gewidmet war, wird durch die fünf Trilithe, torähnliche Konstruktionen aus drei Steinen, im Zentrum der Stätte repräsentiert", meint Darvill. Aus diesem Grund würden die Winter- und Sommersonnenwende alljährlich Jahr von denselben Steinpaaren eingerahmt. Diese Ausrichtung hilft auch bei der Kalibrierung des Kalenders: Fehler beim Zählen der Tage wären leicht erkennbar, da die Sonne zur Sonnenwende am falschen Ort stehen würde.
Import aus dem Osten
Kalender mit 10-Tage-Wochen und zusätzlichen Monaten mag heute ungewöhnlich erscheinen, war aber bei vielen Kulturen in Verwendung. "Ein solcher Sonnenkalender wurde im östlichen Mittelmeerraum bereits vor 5.000 entwickelt", so Darvill. Möglicherweise sei der in Stonehenge verwendete Kalender von einer anderen Kultur übernommen worden, vermutet der Wissenschafter. Zumindest lassen einige Funde aus der Umgebung der Anlage von Stonehenge auf entsprechende kulturelle Verbindungen schließen. Schreibt DER STANDARD.
Gut, dass diese Frage, die uns alle bisher rund um die Uhr beschäftigt hat, endlich geklärt ist.
Die Esoteriker*innen und Trychler*innen, also somit etwa die Hälfte der SVP-Mitglieder*innen, werden dadurch allerdings um eines ihrer Mysterien beraubt.
-
5.3.2022 - Tag der Demokratie-Schmarotzer
Arbeiten keine Lobbyisten für Peking und Moskau?
Im neuen Lobbyregister hat sich bisher kein Lobbyist dazu bekannt, für umstrittene Regime wie die aus China oder Saudi-Arabien zu arbeiten. Dabei wurden solche Lobbydeals in der Vergangenheit immer wieder ruchbar.
Vom Flugzeugbauer Airbus bis zum Bundesverband Deutscher Ziegenzüchter – tausende Unternehmen und Verbände haben sich bereits in das neue Lobbyregister des Bundestags eingetragen, in dem sich aktive Lobbyisten registrieren müssen. Eigentlich lief die Frist dafür am 28. Februar ab, derzeit trudeln aber immer noch neue Einträge ein. Auffällig ist nach Recherchen von WELT AM SONNTAG, dass eine ganze Gruppe von Auftraggebern im Lobbygeschäft bisher praktisch weitgehend fehlt: ausländische Staaten.
Das verwundert, wurden doch im politischen Berlin immer wieder Fälle bekannt, in denen Lobbyisten von ausländischen Regierungen als Einflussagenten bezahlt wurden – und das gerade aus Ländern mit verbesserungsfähigem Image wie Saudi-Arabien.
Dabei ist nach Ansicht der Bundestagsverwaltung, die das Register betreibt, die Rechtslage klar: Lobbyisten, die im Auftrag fremder Staaten Einfluss auf die Bundespolitik nehmen wollen, sind nun auch in Deutschland zur Offenlegung verpflichtet. „Ausnahmen von der Pflicht zur Angabe von Auftraggeberinnen und Auftraggeber von Interessenvertretung“ sehe „das Gesetz nicht vor“, so ein Sprecher des Bundestages. Lediglich staatliche Amts- und Mandatsträger selbst sind von der Pflicht zur Eintragung befreit.
Unter den Lobbyagenturen gibt es eine, die in der Vergangenheit besonders aktiv ihre Kompetenz beim sogenannten Nation Branding, also der PR für fremde Staaten, bewarb: die Firma WMP Eurocom des früheren „Bild“-Chefredakteurs Hans-Hermann Tiedje. Die Berliner Agentur hat sich jedoch bisher gar nicht ins Lobbyregister eintragen lassen. „Wir sind kein Lobbyunternehmen, sondern ein Kommunikationsunternehmen“ erklärt die Firma auf Anfrage.
Dabei hatte WMP im Jahr 2017 in einer Präsentation für ihren zeitweiligen Kunden Saudi-Arabien unter anderem damit geworben, sie biete „Zugang“ zur Politik und kenne „Beeinflusser“ („Influencer“) sowie „Entscheider“. Tiedje selbst begleitete ebenfalls 2017 den Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, zu einem Lobbytermin mit dem damaligen Außenminister Sigmar Gabriel. Zu den Kunden von WMP gehörten in der Vergangenheit auch Katar, Serbien und die Türkei – heute offenbar nicht mehr.
Eine andere große Agentur, deren Namen schon mal im Zusammenhang mit Aktivitäten fremder Staaten fiel, ist die Firma CNC. In Juni vergangenen Jahres hatte WELT AM SONNTAG China-Beziehungen des früheren ZDF-Journalisten Udo van Kampen enthüllt, der nach eigenen Angaben auch für CNC tätig ist. Laut ihren Angaben im Register macht sie aktuell aber nur für Firmen wie den Netzbetreiber Amprion und Thyssengas Lobbyarbeit. Sowohl CNC wie van Kampen versicherten jetzt gleichlautend, sie hätten „zu keiner Zeit“ für chinesische staatliche Akteure gearbeitet.
„Wenn Staaten Auftraggeber sind, müssen die Lobbyagenturen sie angeben“, betont Timo Lange von der Organisation Lobbycontrol: „Es ist politisch wichtig zu wissen, wenn ausländische Regierungen auf diesem Weg versuchen Einfluss zu nehmen.“
Auch der Vize-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Konstantin von Notz, forderte mit Blick auf Nachschärfungen beim Lobbyregister „Agenturen und Akteure, die die Interessen anderer Staaten vertreten, sehr viel stärker in den Fokus zu nehmen, damit auch derartige Einflussnahmen auf politische Entscheidungsprozesse noch transparenter werden“. Wie wichtig das sei, zeigten nicht zuletzt aktuelle Diskussionen um Nord Stream 2.
Russische Gas- und Ölkonzerne fehlen im Register
In der Tat fehlen im Lobbyregister bislang wichtige russische Gas- und Ölkonzerne als Auftraggeber. Das mag überraschen, denn sowohl der halbstaatliche Gazprom-Konzern wie dessen Pipelinetochter Nord Stream 2 und auch der deutsche Ableger des Ölgiganten Rosneft sind seit geraumer Zeit im EU-Lobbyregister in Brüssel eingetragen. Vertreter der Nord Stream 2 AG, die eine umstrittene neue Gasröhre durch die Ostsee verlegen wollten, trafen seit 2016 immerhin 17 mal führende Repräsentanten der EU-Kommission.
Zugleich ist es gut möglich, dass diese Unternehmen auf mittlere Sicht in Berlin und Brüssel auf weniger offene Türen treffen werden – auch wenn ihre Gas- und Öllieferungen nach Deutschland weiterlaufen. Immer noch sowohl als Aufsichtsratschef bei Rosneft wie als Verwaltungsratspräsident bei der Nord Stream 2 AG in Zug in der Schweiz eingetragen ist aber Altkanzler Gerhard Schröder – der in den vergangenen Jahren offenkundig auch Lobbyaktivitäten etwa für Nord Stream 2 entfaltete.
Zuletzt traf der Altkanzler am 6. Oktober 2021 den damaligen Finanzminister und heutigen Kanzler Olaf Scholz zu einem Gespräch. Das ergab eine Anfrage des früheren Linken-Abgeordneten Fabio De Masi. Der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer fragte im Februar die Bundesregierung auch nach den Themen dieser jüngsten Gespräche zwischen Schröder und Scholz, erhielt darauf aber keine Antwort. „Gesprächsinhalte“ würden „nicht protokolliert“, teilte ihm Staatsministerin Sarah Ryglewski vom Bundeskanzleramt knapp mit.
Im Lobbyregister des Bundestages findet man Schröder in seiner Funktion als Gaslobbyist nicht - aber bis vor kurzem stand sein Name dort in zwei anderen Funktionen. Zum einen war er als Vorstandsmitglied des Lobbyverbands BVUK eingetragen. Das steht für Betriebliche Versorgungswerke für Unternehmen und Kommunen. Zweitens nannte ihn der Nah- und Mittelost-Verein (Numov) als Ehrenvorsitzenden. Beide Organisationen entfernten jetzt den Namen Schröder aus ihren Einträgen, am Dienstag erst Numov, am Mittwoch dann BVUK. Zuvor hatte CDU-Mann Hauer am Dienstag beiden Vereinen Mails geschrieben. Aus seiner Sicht sei der Altkanzler „als Aushängeschild“ nicht mehr geeignet.
Bei Numov sprach man von einem „Eintragungsfehler“. Schröder habe sein dortiges „Ehrenmandat“ bereits Ende des Jahres 2021 aus Zeitgründen niedergelegt. Auch ein BVUK-Sprecher versicherte, dass Schröder seinen dortigen Posten unabhängig von der Hauer-Anfrage niedergelegt hatte. Eine Anfrage von WELT AM SONNTAG ließ der Altkanzler bisher unbeantwortet.
Ein paar wenige Einträge zu staatlicher Interessenvertretung finden sich immerhin im neuen Register, und zwar von Auftraggebern aus anderen Ländern: So findet man jetzt die staatliche türkische Tourismusagentur als Auftraggeber bei der Agentur PKS Kommunikations- und Strategieberatung des früheren Regierungssprechers Friedhelm Ost.
Auch die staatliche Fluggesellschaft Emirates aus Dubai hat sich als Auftraggeber registriert. Sie verweigert dort aber die Angabe über die Höhe ihrer Lobbyaufwendungen. Begründung: Angesichts ihrer weltweiten Aktivitäten sei es „schlichtweg unmöglich, die Kosten für unsere Lobbyarbeit in Deutschland nach den Vorgaben des Lobbyregisters korrekt zu berechnen“.
Mehr Transparenz zeigte der - nach eigenen Angaben private - chinesische Telekomriese Huawei. Er gab demnach im vergangenen Jahr in Deutschland fast 2,3 Millionen Euro für die Interessenvertretung aus. Auch die großen Lobbyagenturen Eutop und Finsbury Glover Hering sind für Huawei tätig. Schreibt DIE WELT.
Man hört in den letzten Tagen öfters einen Seufzer mit dem Hinweis auf den Ukraine-Krieg «wenigstens etwas Gutes bewirkt dieser Krieg...».
Menschenverachtender Zynismus pur.
Kein Krieg, egal wo und unter welcher Flagge auch immer er stattfindet, hat etwas Gutes an sich. Wer mit solchen Argumenten unterwegs ist, blendet vermutlich die Bilder der unschuldigen Opfer eines jeden Krieges aus: Tote Kinder, tote Zivilisten und, ja, tote Soldaten. Ganz zu schweigen von Städten, die in Schutt und Asche gebombt wurden.
Richtig ist hingegen, dass der Ukraine-Krieg etliche Schwachstellen der westlichen Demokratie brutalstmöglich offenlegt. Dazu gehört unter anderen auch die Lobbyismus-Arbeit gekaufter Handlanger.
Ob es sich bei den Auftraggebern um «westliche» oder «östliche» Oligarchen handelt, spielt dabei keine Rolle. Nur von chinesischen oder russischen Einflussnahmen zu sprechen, wird dem Problem nicht gerecht. Der «Deep State» der USA und die Billiardäre der Techbranche und der Wallstreet sind letztlich auch nichts anderes als Oligarchen.
Noch ist es nicht zu spät, die Verfassungen der westlichen Demokratien entsprechend anzupassen. Ich vertraue auf die Jugend. Inzwischen hat selbst die «Friday for Future»-Bewegung erkannt, dass ihre hehren Ziele von geld- und machtgeilen Politikern*innen übernommen und damit bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt werden.
Die kleine Schweiz hat 2013 bei den National- und Ständeratswahlen die Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen.
Denn aus der deutschen Bundestagswahl 2021 wissen wir aus seriösen Umfragen, dass die «politische Korruption» die jungen Menschen als eines der Hauptthemen sehr wohl beschäftigt. Wir müssen jetzt nur noch den Mut haben, die «politische Korruption» zum Wahlkampfthema zu machen und die Namen dieser Demokratie-Schmarotzer*innen zu nennen, um unsere Demokratie wieder sattelfest zu machen.
Putin-Vasallen wie die SVP-Nationalräte Roger Köppel, Franz Grüter und Yvonne Estermann, um nur einige dieser widerlichen Gilde der Putin-Versteher zu nennen, können nämlich abgewählt werden.
Und dies ist einer der grössten Vorteile der Demokratie gegenüber Diktaturen wie Russland, China und Saudi Arabien.
Ein Putin oder Xi Jinping können nämlich nicht abgewählt werden. Köppel, Grüter und Estermann hingegen schon.
Wir müssen es nur tun!
-
4.3.2022 - Tag der Schweizer Faschismus-Kohorten
Will Putin das Stromnetz lahmlegen?
Russische Streitkräfte sollen in der Nacht das grösste Atomkraftwerk in Europa angegriffen haben. Jetzt brennt auf dem Gelände des AKW Saporischschja im Süden der Ukraine offenbar ein Nebengebäude. Die Lage beobachtet auch Fredy Gsteiger, bei SRF spezialisiert auf Diplomatie. Er sagt: Derzeit ist die Situation unter Kontrolle.
SRF News: Für wie gefährlich halten Sie die Situation beim Atomkraftwerk Saporischschja?
Fredy Gsteiger: Grundsätzlich besteht im Krieg für AKWs eine sehr grosse Gefahr – deshalb hielt die Internationale Atomenergiebehörde IAEA diese Woche eine Sondersitzung ab. Sie rief dazu auf, kriegerische Handlungen rund um AKWs in der Ukraine zu verhindern.
Vergleiche mit der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 sind allerdings problematisch: Heutige AKWs – auch in der Ukraine – sind viel besser geschützt als damals. Wenn allerdings die Schutzhüllen des Reaktors durch Beschuss durchbrochen werden sollten, besteht ein enormes Risiko, dass ein riesiges Gebiet verstrahlt wird.
Die IAEA sagt, es sei keine erhöhte Strahlung messbar. Ist das also ein Zeichen der Entwarnung?
Im Moment ja. Offenbar geriet durch die Kämpfe ein Nebengebäude des AKW in Brand. Er scheint weitgehend gelöscht, die Reaktoren werden heruntergefahren.
Offenbar wurden auch die Kämpfe rund um die Atomanlage zumindest vorübergehend eingestellt. Trotzdem drückte die IAEA ihre Besorgnis aus und löste den 24-Stunden-Krisenmodus aus. Allerdings kann die Behörde bloss beratend tätig sein.
Wieso greifen russische Truppen überhaupt ein AKW an?
Dazu gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Es könnte sich um einen Präzisionsangriff der Russen handeln, bei dem bewusst nicht der Reaktor getroffen werden sollte, das AKW aber trotzdem heruntergefahren werden muss. Schliesslich produziert das AKW Saporischschja bis zu einem Viertel des in der Ukraine verbrauchten Stroms.
Möglich ist auch, dass das AKW-Gelände unabsichtlich getroffen wurde – schliesslich hat man in den letzten Tagen in der russischen Kriegsführung zahlreiche Fehler und Pannen festgestellt. Nicht völlig unmöglich ist auch die wohl irritierendste Möglichkeit: In Moskau gibt es überhaupt keine Skrupel mehr und man riskiert im Krieg in der Ukraine auch katastrophale Kollateralschäden. Das Gespräch führte Salvador Atasoy. Schreibt SRF.
Die Frage von SRF an den Experten ist eigentlich vernachlässigbar. Sie ist längst beantwortet, weil wir aus der langen Regierungszeit von Putin sein Vorgehen in den bisherigen Angriffskriegen kennen. Es waren immer Angriffskriege, auch wenn die von Putin gekauften Handlanger im Westen eine ganz andere Sicht der Dinge haben.
Anders lassen sich seine Militäreinsätze bis heute nicht bezeichnen. Auch nicht derjenige in Syrien, der von Putin und seinen westlichen Apologeten als «Hilfs-Operation» bezeichnet wird.
Damit es auch die vielen Schweizer Putin-Versteher wie Köppel, Grüter, Estermann & Konsorten aus der SVP mit einem Hang zum Faschismus* begreifen: Putin ist ein kühl planender, faschistoider Kriegsverbrecher, der bisher gnadenlos noch jede Stadt in den angegriffenen Ländern in Schutt und Asche gebombt hat.
Um nur zwei Beispiele zu nennen: Wer sich an die Bilder von Grosny (Tschetschenienkrieg) und die syrischen Städte erinnert, weiss, dass Putins Krieger weder vor Spitälern noch vor einem Atomkraftwerk Halt machen.
Kollateralschäden gehören zu Putins Handwerk. Es ist seine Strategie. Tote Kinder und verstümmelte Menschen haben Diktatoren noch nie interessiert. Für die Folgen haftet ja schliesslich der Westen. Und so wird Putin auch die Ukraine in ein Syrien 2.0 verwandeln.
So viel zur geistigen Nähe des Trump-, Bannon-, HC Strache- und Putin-Verstehers und SVP-Nationalrats Köppel zu Faschisten. Um nur einen aus dieser ausser Rand und Band geratenen Partei zu nennen, die sich langsam aber sicher zu einer Schande für die Schweiz entwickelt.
* Definition von Faschismus: https://de.wikipedia.org/wiki/Faschismus
-
3.3.2022 - Tag der russischen Bomben und der Krisenküche
Kochen ohne Kohle: Wenn alles egal ist: Tortellini mit Käsesoße für 1,25 Euro
Dieses einfache 20-Minuten-Gericht hat einen Nährwert wie ein Backstein und Kalorien aus der Hölle. Daher ist es reserviert für die schlimmsten Tage – von denen es aktuell zu viele gibt.
In meiner Kolumne vor zwei Wochen war mein größtes Problem, dass ich kurz vor dem Urlaub Stress hatte. Heute ist die Welt eine andere. Plötzlich google ich die Heeresgrößen der Nato-Staaten und studiere Truppenbewegungskarten, die man in einem Geschichtsbuch erwarten würde. Alles nur, weil ein Mann mit albern langen Konferenztischen einen Angriffskrieg gegen seine Nachbar:innen anzettelt und mit Nuklearwaffen droht. Was für ein Wahnsinn.
Es fällt schwer, in so einer Zeit nicht zynisch zu wirken. Denn in der Ukraine ist wohl niemandem damit geholfen, wenn ich aus Solidarität ein Gericht in den Farben der blaugelben Flagge koche und sie mit ein paar Wortspielen à la »Keep calm and curry on« oder »Autokratenbraten« garniere – während dort in Bierbrauereien Molotowcocktails befüllt werden. Trotz (oder wegen) dieser Situation sind Sie, liebe Leser:innen, hierhergekommen, um etwas Ablenkung und ein günstiges Rezept zu bekommen. Heute fällt das leider etwas kürzer aus – ich muss vorher nämlich noch Dampf ablassen.
Es macht mich wütend, dass es so weit kommen musste, bis in Deutschland wirklich über die wirtschaftliche Abhängigkeit von einem menschenfeindlichen Machthaber wie Putin nachgedacht wird. Und über die Gefahr, die von ihm ausgeht. Seit Jahrzehnten sind wir angewiesen auf fossile Brennstoffe aus Russland – und finanzieren so mit unserem Geld ein Regime, das Menschenrechte und das Völkerrecht mit Füßen tritt. Wir könnten heute energetisch deutlich autarker sein, wenn wir – wie von Teilen der Klimaschutzbewegung gefordert – vor Jahrzehnten eine richtige Energiewende gewagt hätten.
Und während in der Ukraine ein absolut sinnloser Krieg über die Bevölkerung hereinbricht, meldet der Weltklimarat IPCC am Montag, dass das Fenster zur erfolgreichen Abwendung eines katastrophalen Klimawandels immer kleiner werde. Und 3,6 Milliarden Menschen nun als »extrem verwundbar« eingestuft würden.
Die Zusammenarbeit mit Autokraten, das Verheizen von Öl, Gas und Kohle – dahinter stehen menschliche Entscheidungen. Man muss das nicht tun, man kann sich für einen anderen Weg entscheiden, auch wenn der vielleicht manchmal beschwerlicher ist. Hat man viel zu lange aber nicht getan. Da kann man schon mal etwas Weltschmerz verspüren. Und Wut.
Pasta statt Wut im Bauch
Auch ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, das konnte man vielleicht zwischen den Zeilen subtil versteckt herauslesen. Wenn die Schwermut mich packt, haue ich mir gern ein selbstzerstörerisches Abendessen rein, das man bei aller Liebe kaum als kulinarisch hochwertig bezeichnen kann: Tortellini mit Schmelzkäsesoße. Das Gericht ist seit Jahren ein schambeladener Ausnahmegenuss in meinem Rezeptkatalog. Es hat einen Nährwert wie ein Backstein und Kalorien aus der Hölle.
Wahrscheinlich ist eine Packung Zigaretten gesünder, daher sind diese Torturlini reserviert für die schlimmsten »Nun-ist-es-auch-egal-Tage«. Wie heute, gestern und wahrscheinlich morgen.
Das benötigt man für vier Portionen:
• 800 g Tortellini aus dem Kühlschrank
• 300 g Schmelzkäse
• 300 ml Gemüsebrühe
• Optional: ein Paket TK-Buttergemüse
Was kostet das?
• 1,25 Euro pro Portion
Wie lange dauert das?
• 20 Minuten, man muss alles nur warm machen
Wie macht man Tortellini mit Käsesoße?
• Die Pasta nach Packungsanleitung kochen, abgießen und beiseitestellen.
• Das optionale Buttergemüse im selben Topf erwärmen.
• Den Schmelzkäse und die Brühe hinzugeben und unter Rühren in wenigen Minuten zu einer käsigen Sünde schmelzen lassen. Einmal aufkochen lassen, dann abstellen.
• Am Ende die Nudeln zur Soße geben, alles gemeinsam warm werden lassen – fertig.
Wie gesagt, ich hab heute keine Energie zum Kochen. Ich muss mich noch etwas aufregen. Und dann überlegen, was ich spenden kann, um mich nicht mehr so hilflos zu fühlen.
Friedliche Grüße und guten Appetit! Schreibt Sebastian Maas in seiner SPIEGEL-Kolumne.
Ja, Zeiten wie diese halten uns Saturierten einen Spiegel vor die Augen. SPIEGEL-Kolumnist Sebastian Maas macht dies auf witzige, aber dennoch intelligente Art und Weise.
Ich, als Versteher der Schweizer Putin-Versteher, der ich mit einigen dieser Gestalten ab und zu im Schweizerhof Luzern Esoteriker-Tee trinke bis es mir kommt, fühle mich auch verpflichtet, meinem geneigten* Publikum krisenfeste Kochrezepte vorzustellen, sollte der Verrückte in Moskau doch noch auf den roten Knopf drücken. Oder sei es auch nur als Hilfe für die preiswerte Bewältigung des seit gestern begonnen Ramadans für Christologen und andere Sektierer.
Die Vergangenheit, die mich auf einige Jahrzehnte zurückblicken lässt, warnt mich einmal mehr: Man weiss ja wirklich nie, was da alles noch auf einen zukommt.
So höre ich derzeit von all meinen wirklich geschätzten Altersgenossinnen und Altersgenossen der Stützstrumpf- und Rollator-Gilde stets einen stereotypen Seufzer zum Krieg in der Ukraine: «Dass ich sowas wie einen Krieg in meinem Alter noch erleben muss, hätte ich nie gedacht.»
Ganz abgesehen davon, dass in erster Linie das ukrainische Volk den Krieg in der Ukraine erleben muss, juckt es mich dann stets zu fragen: «Du Dummerchen, wo warst Du denn, als der Vietnamkrieg, der Biafra-Krieg, der Sechstage-Krieg, der Kambodschanische Bürgerkrieg, der Jom-Kippur-Krieg, der Chinesische-Vietnamesische Krieg, der Sowjetische-Afghanische Krieg, der erste Golfkrieg, der Falkland-Krieg, der Libanonkrieg, die US-Invasion in Grenada, der Somalische Bürgerkrieg, die Invasion der USA in Panama, der Zweite Golfkrieg, die Jugoslawienkriege und der vom Westen angeführte Afghanistan-Krieg stattfanden?» Die Liste ist nicht einmal vollständig.
Doch gestellt habe ich diese Frage noch nie.
* Seit meiner Geburt frage ich mich, weshalb das Publikum, oder in diesem Fall Leserinnen und Leser, stets als «geneigt» adressiert werden. Die Antwort auf diese Frage, die uns alle bewegt, habe ich bis heute nicht gefunden. Ob mir das wandelnde Lexikon vom Artillerie-Verein Zofingen, Res Kaderli, eine vernünftige Erklärung für dieses Phänomen liefert?
-
2.3.2022 - Tag der russischen Bomben in der Ukraine
Geburtenhaus in der Ukraine von Raketen getroffen und totale Zerstörung in Irpin
Bei den schweren Angriffen auf Schytomyr ist offenbar auch ein Geburtenhaus getroffen worden. Das berichtet das ukrainische Aussenministerium. «Wenn das kein Genozid ist, was ist es dann?», fragt das Aussenministerium in seinem Tweet. Wie viele Personen bei dem Angriff getötet wurden und ob auch Kinder unter den Opfern sind, ist bislang noch unklar. Auch lassen sich die Angaben bislang nicht unabhängig überprüfen.
Totale Zerstörung in Irpin
In der Stadt Irpin vor Kiew haben die Kämpfe der vergangenen Nacht Spuren hinterlassen. Wie der ukrainische Journalist Illia Ponomarenko auf Twitter zeigt, sind Häuser und Strassen völlig zerstört. Autos stehen ausgebrannt auf den Strassen, Hausdächer sind heruntergefallen. Schreibt Blick im Liveticker.
Unabhängig vom aktuellen Wahrheitsgehalt der Kriegsnachrichten aus der Ukraine: Am Schluss werden die umkämpften Städte in der Ukraine so aussehen wie diejenigen in Syrien nach den russischen Bombardements.
Auch in Syrien schreckte die russische Luftwaffe nicht davor zurück, Spitäler in Schutt und Asche zu zerbomben. Wieso sollte sie sich in der Ukraine anders verhalten?
Moral und Ethik haben noch nie eine Rolle gespielt, wenn es um Krieg geht. Nur die Mittel der Zerstörung haben sich geändert. Ein einziger Knopfdruck genügt und der Bombenschacht öffnet sich.
Ob da nun ein Spital oder eine Geburtsstätte bis auf die Grundmauern zerstört wird, kümmert die Bombe nicht. Sie tut nur das, was ihr die von Menschenhänden eingegebenen Codes vorgeben.
-
1.3.2022 - Tag des Wehrmutpfropfens der SP Schweiz
«Wir haben uns getäuscht»: SP will Armee plötzlich doch nicht mehr abrüsten
Die SP will bei ihrer Sicherheitspolitik über die Bücher. Die russische Invasion in der Ukraine bringt die Sozialdemokraten zum Umdenken. Abrüstung ist nun doch keine Option mehr – mit einer Ausnahme.
Die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth (55) zeigt sich entwaffnend offen. «Ich gebe zu: Wir haben uns getäuscht, als wir behauptet haben, dass territoriale Angriffskriege kein realistisches Szenario seien», räumt sie gegenüber dem «Nebelspalter» (Bezahlartikel) ein. «Die Realität sieht leider anders aus», sagt Roth mit Verweis auf die russische Invasion in die Ukraine.
Die SP-Sicherheitspolitiker würden sich am 9. März beraten, wie in den kommenden Sitzungen der sicherheitspolitischen Kommission (SiK) der Armeeauftrag künftig anzupassen sei. Das Ziel: Das Szenario des «territorialen Angriffskrieges» sei wieder stärker zu gewichten. Panzer, Schützenpanzer und Artillerie dürften nicht abgerüstet werden.
Abrüstung sei keine Option mehr
«Ich bin zum Schluss gekommen, dass die Abrüstung der konventionellen militärischen Kampfmittel wie Artillerie und Panzer momentan keine Option mehr darstellt», so Roth weiter. Das sei mit den anderen SiK-Mitgliedern der SP abgesprochen. «Wir werden den sicherheitspolitischen Bericht anpassen müssen.»
Noch bis vor kurzem hatte Links-Grün regelmässig betont: «Wir werden die 438 Millionen Franken für die Schützenpanzer 2000 ablehnen. Für den Werterhalt einer so grossen Anzahl Schützenpanzer gibt es keine plausiblen Szenarien. Die Zeit von Panzerschlachten und Bewegungskriegen ist vorbei.» Doch der Krieg in der Ukraine beweist nun das Gegenteil.
Noch wichtiger aber seien Sanktionen
Gleichzeitig dürften jedoch Szenarien wie Cyber-Angriffe oder Terrorismus nicht vernachlässigt werden. «Aber solange irgendwelche Diktatoren tatsächlich ihre Mittel benutzen, um konventionelle Angriffskriege in Europa zu führen, wäre es ein falsches Zeichen, unsere Kampfmittel abzurüsten», so Roth weiter.
Noch wichtiger sei derzeit aber, dass der Bundesrat die Sanktionen der EU gegenüber Russland vollständig übernehme. «Denn man muss sich auch vor Augen halten, dass das Sperren der Bankkonten und Einfrieren der Vermögenswerte, zehn Mal mehr zur Sicherheit der Schweiz und Europas beiträgt, als am Rhein mit Schützenpanzern auf russische Angriffe zu warten.»
Immer noch gegen US-Kampfjet
Auf ihren Kampf gegen den neuen Schweizer Kampfjet aber wollen die Sozialdemokraten dennoch nicht verzichten. Die Initiative «Stop F-35» werde weiter unterstützt. Ich bin überzeugt, dass die Luftwaffe neue Kampfjets braucht. Aber der amerikanische F-35 ist definitiv das falsche Flugzeug», begründet Roth. Es sei nicht Aufgabe der Schweiz, die Nato-Aussengrenzen zu verteidigen.
Zu ganz anderen Schlüssen kommt FDP-Präsident Thierry Burkart (46). Via Twitter fordert er die Initianten auf, die Unterschriftensammlung für die Stop-F-35-Initiative abzubrechen. «Die Argumentation, es gäbe keinen konventionellen Krieg mehr in Europa, ist offensichtlich falsch», argumentiert er. «Die Schweiz braucht mehr Sicherheit, nicht weniger!» Schreibt Blick.
Dass sich die Schweizer SP seit knapp zwei Jahrzehnten in der Beurteilung politischer Positionen quasi nur noch täuscht, ist inzwischen in ihre DNA eingezogen.
Was sich aber in der DNA einer Partei festsetzt, bringt man so schnell nicht wieder weg. Und das ist der springende Wehrmutspfropfen für die SP.
-
28.2.2022 - Tag des Cyberkriegs gegen Putin
Freude herrscht! Wie du mir, so ich dir, Vladimir!
Anonymous palavert nicht nur, sondern handelt: Websites von Gazprom und Verteidigungsministerium Russland gehackt.
Nach dem Ukraine-Angriff hat die Hackergruppe Anonymous, ein Web-Kollektiv, das für ein freies Internet kämpft, Moskau den Cyberkrieg erklärt. Erste Websites der russischen Regierung fallen kurzzeitig immer wieder aus. Weitere könnten folgen.
www.gazprom.de und www.gazprom.com sind derzeit nicht erreichbar, wie meine Nachprüfung gestern ergab. Heute dasselbe Bild. «Hmmm... diese Seite ist leider nicht erreichbar».
Die Website vom russischen Verteidigungsministerium funktioniert mal, mal funktioniert sie nicht. Putins Cyberkrieger scheinen arg zu schwitzen.
The european power strikes back! Auch der Westen kann Cyberwar.
Gut gemacht Anonymus. Jetzt noch die Facebook-Site vom ebenso unappetitlichen wie widerwärtigen Putin-Versteher und SVP-Nationalrat Roger Köppel schreddern und ich zünde jeden Tag eine Kerze für Euch an.
-
27.2.2022 - Tag des skrupellosen Boulevard-Bullshits
Hat Long Covid damit zu tun?: Politiker behaupten: Putin ist «verrückt» geworden
Politiker aus aller Welt bezeichnen Putin aufgrund des Einmarsches in die Ukraine als «verrückt». Britische Mediziner sind sich nun sicher: Sein Verhalten hängt mit Long Covid zusammen, eine Corona-Infektion des russischen Präsidenten ist allerdings nicht bestätigt.
Das russische Militär hat auf Geheiss des Präsidenten Wladimir Putin (69) mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen, seit drei Tagen herrscht Krieg in dem russischen Nachbarland. Der Grund: Putin hat am Montagabend die beiden Separatistengebiete Luhansk und Donezk anerkannt. Einige hochrangige europäische Politiker vermuten allerdings noch einen zweiten Grund: Putin soll «verrückt» geworden sein.
Politiker bezeichnen Putin als «Verrückten»
So behauptet beispielsweise der französische EU-Abgeordnete Bernard Guetta (71), Putin scheine «paranoid» geworden zu sein und fügte hinzu: «Ich glaube, dieser Mann verliert den Sinn für die Realität, um es höflich auszudrücken». Auf die Frage, ob das bedeute, dass er glaube, Putin sei verrückt geworden, antwortete er «ja».
Sogar der tschechische Präsident Milos Zeman (77), ein langjähriger Unterstützer Putins und zuvor vehementer Gegner von EU-Sanktionen gegen Russland, nannte ihn nach dem Einmarsch in die Ukraine einen «Verrückten». Auch aus dem eigenen Land werden kritische Stimmen laut. So bezeichnete der russische Politiker Wladimir Aschurkow, ein Verbündeter des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, die jüngsten Aktionen des russischen Präsidenten als «wirklich bizarr». Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace bezeichnete Putins Verhalten als «zutiefst irrational» und fügte hinzu, er sei «nicht bei Verstand».
Long Covid kann Entscheidungen beeinflussen
Insider vermuten: Die Waghalsigkeit Putins wurde durch Long Covid ausgelöst, auch wenn eine Erkrankung des Präsidenten nicht offiziell bestätigt wurde. Die Nachwehen einer Corona-Infektion sollen «Hirnnebel» verursachen, welcher die Schuld an den Aktionen des russischen Präsidenten tragen soll. Der britische Apotheker Hussain Abdeh sagte gegenüber «Mail Online», dass das Coronavirus durchaus den «geistigen Zustand» einer Person verändern könne.
«Bei Untersuchungen zu Beginn der Pandemie wurde festgestellt, dass bei einer kleinen Anzahl von Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, plötzliche Verhaltensänderungen wie Delirium, Verwirrung und Unruhe auftraten», so Abdeh. «Die Veränderungen können sich durch übermässiges Selbstvertrauen, Rücksichtslosigkeit und Verachtung für andere ausdrücken». Auch der britische Arzt Paul Ettlinger, der in der Londoner «General Practice» praktiziert, gibt dem Apotheker recht. «Long Covid kann die psychische Gesundheit beeinflussen. Es kann dazu führen, dass man nicht mehr in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen». Schreibt Blick.
«Insider vermuten: Die Waghalsigkeit Putins wurde durch Long Covid ausgelöst, auch wenn eine Erkrankung des Präsidenten nicht offiziell bestätigt wurde.» Schreibt Blick.
Man ist sich ja von Blick einiges an Primitiv-Stories gewöhnt. Doch dieser Artikel ist eine Schande für das Boulevardblatt von der Zürcher Dufourstrasse und hat mit Journalismus rein gar nichts mehr zu tun. Er ist nicht einmal eine «Fake News», sondern nur noch hirnloser Bullshit für ebenso hirnlose Blick-Leserinnen und Blick-Leser.
Da hilft es auch nicht, einen britischen Apotheker zur Bestätigung der idiotischen These herbeizuziehen.
Erinnern wir uns: Im Jahr 2014 annektierte Putin die Krim und schuf damit eine Blaupause für die längst geplante Invasion in der Ukraine. Ein Test, um die Reaktionen des Westens abzutasten, die ja, gelinde ausgedrückt, damals nur «lauwarm» ausfielen. Die «grünen Männchen», die sich später als russische Soldaten entpuppten, was Putin nicht einmal bestritt, sondern auf die Frage eines Journalisten mit einem Lächeln bejahend quittierte, machten dies erst möglich.
Doch 2014 gab es keine Corona-Pandemie. Dafür aber am Donnerstag, 24.2.2022 einen militärischen Überfall auf die Ukraine. Diesmal allerdings mit regulären russischen Truppen, die nicht mehr als «grüne Männchen» verkleidet sind.
Man kann Corona für vieles verantwortlich machen. Aber sicher nicht für den Grössenwahn eines tollwütigen Diktators wie Putin.
-
26.2.2022 - Tag der seidenen Sanktions-Handschuhen
Sie haben hier nichts zu befürchten, aber ... Darum ist für Oligarchen die Schweiz der Himmel auf Erden
Jeder dritte Dollar von russischen Privatpersonen und Unternehmen liegt in der Schweiz. Die Oligarchen haben hierzulande auch nach der Invasion Putins in die Ukraine wenig zu befürchten. Privatbanken profitieren – der Schweizer Finanzplatz gerät in Verruf.
Reiche Russen lieben die Schweiz! Wegen St. Moritz? Ja, auch. Aber viel mehr noch wegen unseres Finanzplatzes. Wenn der Westen Russland mit Sanktionen überzieht und die Gelder von dessen Oligarchen einfrieren lässt, zieht die Schweiz nicht mit. So war es 2014 bei der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, so ist es auch jetzt nach der Invasion Russlands in die Ukraine.
Knapp 37 Milliarden Dollar haben russische Staatsbürger und Unternehmen laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich im Ausland deponiert, 11 Milliarden Dollar davon in der Schweiz. Bedeutet: Fast jeder dritte Dollar, den russische Privatpersonen und Unternehmen ins Ausland bringen, liegt in den Tresoren und auf Konten in der Schweiz. Laut Insidern dürfte die Dunkelziffer aufgrund von komplizierten Offshore-Geschäften sogar noch wesentlich höher sein.
Der bekannteste russische Oligarch im Land ist Viktor Vekselberg (64), der seit 17 Jahren in der Schweiz wohnt. Sein Vermögen soll sich auf über 9 Milliarden Dollar belaufen. Vekselberg ist an Konzernen wie OC Oerlikon und Sulzer AG beteiligt.
Aber auch Wladimir Putins (69) Jugendfreund Gennadi Timtschenko (69) und Suleiman Kerimow (55) schätzen die Zurückhaltung der Schweiz. Ersterer hielt bis zur ersten amerikanischen Sanktionsrunde im Jahr 2014 grosse Anteile am Genfer Rohstoffhändler Gunvor. Seit dieser Woche steht Timtschenko nun auch auf der britischen Sanktionsliste. Kerimow unterhält enge Beziehungen zu Luzern und geriet vor einigen Jahren wegen fragwürdiger Immobiliendeals in die Schlagzeilen.
SVP macht es dem Bundesrat schwer
Vekselberg und Co. müssen sich, anders als ihre Kollegen im Ausland, derzeit keine Sorgen machen. Der Entscheid des Bundesrats sorgte international für Kritik. Die Schweiz wird in ausländischen Medien bereits seit Beginn des Konflikts in der Ostukraine 2014 als Paradies für Oligarchen bezeichnet. «Der Bundesrat versucht, die neutrale Position der Schweiz in den Mittelpunkt zu rücken», kommentiert Ökonom Klaus Wellershoff (58) den Entscheid gegenüber Blick.
Aussenpolitisch will man sich so für allfällige diplomatische Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Position bringen. Aber der Entscheid sei auch innenpolitisch begründet. «In der Schweiz gibt es keinen moralischen Konsens in Bezug auf die Sanktionen», sagt Wellershoff. «In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich wiederholt Vertreter der SVP klar gegen eine Übernahme der EU-Sanktionen positioniert. Das macht es dem Bundesrat schwer, eine klare Haltung zu zeigen.»
Imageschaden für Schweizer Finanzplatz
In der Kritik stehen für einmal nicht Credit Suisse und UBS. Als global tätige Grossbanken setzen sie die US- und EU-Sanktionen um, wie beide Banken auf Blick-Nachfrage versichern. Sichere Häfen für russische Oligarchen sind hingegen kleine Schweizer Privatbanken, die nicht im Scheinwerferlicht stehen. Diese Institutionen können dank des Schweizer Sonderwegs russische Gelder annehmen – und bringen damit den gesamten Finanzplatz in Verruf.
Auf diesen Punkt angesprochen, geht die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) wie alle anderen angefragten Banken in Deckung. Russland sei kein prioritärer Markt aus Gesamtbranchensicht, lässt die SBVg ausrichten. «Fragen zur Geschäftstätigkeit sind geschäftspolitische Entscheide der Banken, die wir als Verband nicht kommentieren.»
Der Schaden für den Finanzplatz ist mit den internationalen Schlagzeilen angerichtet, das letzte Wort aber wohl noch nicht gesprochen. Aus Bundesbern ist zu vernehmen, dass die Schweiz dem wachsendem Druck des Westens doch noch klein beigeben könnte. Das Oligarchen-Paradies Schweiz ist durch die russische Invasion aber vorderhand unberührt geblieben. Schreibt Blick.
Ob das Verhalten von Schweizer Privatbanken wirklich ein Imageschaden für den Finanzplatz Schweiz bedeutet, dem man ohnehin seit jeher so ziemlich jede Schweinerei zutraut, kommt auf die Sichtweise der jeweiligen Betrachter an. SVP, Roger Köppel, Diktatoren, russische Oligarchen, Kleptokraten, Drogenbosse und sonstige dunkle Gestalten aus der Unterwelt organisierter Kriminalität werden das wohl anders sehen.
Hat es dem Image des wesentlich einflussreicheren Finanzplatzes London geschadet, dass sich unendlich viele Immobilien der britischen Hauptstadt in den Händen von Russen, Arabern und sonstigen finanziellen Weltenbummlern befinden? Oder dass renommierte britische Fussballklubs von russischen Oligarchen und arabischen Milliardären übernommen wurden?
Artikel-Autorin Nicole Imfeld sollte sich mal kundig machen, wie die britische Regierung, von der etliche Mitglieder querbeet aus allen Parteien über Jahrzehnte mit Rubel-Beträgen in Millionenhöhe geschmiert worden sind, die Finanz-Sanktionen der hehren westlichen Wertegemeinschaft umsetzt. Um es vorwegzunehmen: In etwa nach dem gleichen Muster wie die Schweiz. Nur mit dem Unterschied, dass die Handschuhe in London noch etwas seidener sind als in der Schweiz. Und das will was heissen!
Geld kümmerte sich noch nie um Moral und Ethik und hat sich seit jeher einen sicheren Hafen gesucht. Ob das nun Zürich, London, New York oder die Kaiman-Inseln sind. Was allerdings das Verhalten der Schweiz auch nicht besser macht.
Es geht in der Schweiz bezüglich Sanktionsregimes längst nicht mehr um Neutralität. Das ist eine reine Farce. Es ist leider nicht einmal Naivität, sondern nichts anderes als pure Gier.
-
25.2.2022 - Tag der Heuchlerei um Sanktionen gegen Russland
Schweiz will russische Konten nicht einfrieren
Viele westliche Staaten blockieren jetzt russische Vermögen, als Reaktion auf den Ukrainekrieg. Die Schweiz aber hält sich mit Sanktionen zurück und könnte ein wichtiger Handelsplatz für Putins Geschäfte bleiben.
Die Schweiz gefällt sich seit jeher in ihrer Rolle als neutraler Vermittler und will davon auch angesichts der jüngsten kriegerischen Eskalation durch Russland offenbar nicht abweichen. So sollen keine Konten von russischen Amtsträgern eingefroren werden, auch wenn diese in der EU mit Sanktionen belegt worden sind. Das hat die Schweizer Regierung am Donnerstag beschlossen.
Bundespräsident und Außenminister Ignazio Cassis verwies zur Erklärung auf die Neutralität der Schweiz. Sein Land werde aber Maßnahmen verschärfen, damit die Schweiz nicht als Umgehungsplattform für die von der EU erlassenen Sanktionen benutzt werden kann, sagte er – und verurteilte den russischen Einmarsch in der Ukraine gleichzeitig »aufs Schärfste«.
Beamte erläuterten anschließend, dass russische Staatsbürger mit Konten in der Schweiz, deren Gelder in der EU eingefroren sind, über ihr Geld in der Schweiz frei verfügen und es abziehen können. Geprüft werde nur, ob Richtlinien so verschärft werden, dass betroffene Personen keine neuen Gelder auf ihre Schweizer Konten überweisen können.
Schweiz wichtig für russischen Rohstoffhandel
Grüne und Sozialdemokraten in der Schweiz hatten zuvor ins Spiel gebracht, dass auch ihr Land bei den Sanktionen des Westens mitziehen könne. Grünen-Generalsekretär Florian Irminger forderte laut »20 Minuten« bereits vor Tagen: »Besonders wirkungsvoll wäre es, die Vermögen von Personen aus Putins Umfeld einzufrieren.« Mehr als 50 Prozent von Russlands Finanzvermögen sei schließlich im Ausland angelegt.
Um den Zugriff hierauf zumindest in bestimmten Bereichen einzuschränken, haben etwa die EU sowie die Regierungen in Großbritannien oder den USA weitreichende Sanktionen angekündigt. Washington verlangte zuletzt etwa, US-Banken müssten innerhalb von 30 Tagen jegliche Konten der Sberbank schließen, die bislang Geschäfte in US-Dollar ermöglichten. Die russische Bank ist größtenteils in Staatsbesitz und gilt als größter Gläubiger der russischen Wirtschaft. Die EU-Staats- und Regierungschefs wiederum planen Finanzsanktionen gegen Moskau, die auf 70 Prozent des russischen Bankenmarkts abzielen.
In der Schweizer Regierung zeigt man sich hiervon offenbar unbeeindruckt. Die Neutralität bedeutet nach Angaben des Außenministeriums unter anderem, dass die Schweiz nicht an Kriegen teilnimmt und alle Kriegsparteien im Hinblick auf den Export von Rüstungsgütern gleich behandelt. Die Zurückhaltung der Eidgenossen könnte jedoch auch damit zusammenhängen, dass in dem Land zahlreiche Rohstoffkonzerne ihren Sitz haben, die Geschäft mit russischem Öl und Gas machen.
Die öffentlich-rechtliche Nachrichtenplattform Swissinfo berichtete unter Berufung auf Moskaus Botschaft in der Schweiz, dass 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels über die Schweiz erfolgten. Die Schweiz sei zudem die bei Weitem größte Empfängerin von russischem Privatkapital – jährlich flössen fünf bis zehn Milliarden Dollar hierhin, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf die russische Zentralbank.
Ukrainische Zentralbank verbietet Zahlungsverkehr nach Russland
Besonders angesichts dessen ist fraglich, ob der Schweiz der Spagat gelingt einerseits weiterhin russische Geschäfte zuzulassen – und andererseits eine Umgehung der im Ausland sanktionierten Geschäft zu unterbinden. Ein Experte der NGO Public Eye wies laut Sender SRF darauf hin, dass auch in den vergangenen Jahren, als die Sanktionen wegen der Besetzung der Krim galten, die Geschäfte zwischen den Rohstoffhändlern und Russland weiter floriert hätten.
Die russische Seite selbst macht jedenfalls keine Anstalten wegen des Krieges oder Sanktionen die internationalen Finanzgeschäfte einzuschränken. Die Zentralbank hat den von westlichen Sanktionen betroffenen Banken vielmehr all ihre Geschäfte in Rubel wie in ausländischen Währungen garantiert. Alle Bankgeschäfte mit den Kunden in Rubel würden wie gewohnt weiterlaufen. Auch die Auszahlung von Guthaben in ausländischen Währungen werde garantiert.
Die ukrainische Zentralbank dagegen hat den Zahlungsverkehr an Einrichtungen in Russland und Belarus untersagt. Transaktionen mit den Währungen beider Länder hat Kiew verboten. Schreibt DER SPIEGEL.
Na ja, die Schweiz hat nun mal ihre Banken und den gigantischen Rohstoffhandel in Zug, während Deutschland mit Gerhard Schröder einen ex-Kanzler mit einer fetten Rente alimentiert und ihm im deutschen Bundestag ein Büro mit fünf Mitarbeitern*innen auf Lebzeiten zur Verfügung stellt. Russisches Geld in Millionen- und Milliardenhöhe nehmen die Schweizer Banken, die Zuger Rohstoffhändler und der deutsche ex-Kanzler noch so gerne in Empfang. Egal, wieviel Blut am Rubel klebt.
Betrachtet man die deutschen Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind die auch darauf ausgerichtet, der deutschen Exportwirtschaft möglichst wenig zu schaden. Die Germanen versuchen, dem russischen Bär den Pelz zu waschen, ohne ihn nass zu machen.
Die deutsche Politik hat nicht umsonst zwei Sprachregelungen im Zusammenhang mit den deutschen Sanktionen gegen Russland: Während Kanzler Scholz gebetsmühlenartig verbreitet, Putin bezahle durch die deutschen Sanktionen einen hohen Preis für seine Invasion in die Ukraine, beruhigt Aussenministerin Baerbock die Gemüter ihrer eher pazifistisch getrimmten Partei mit der Floskel: «Deutschland ist bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, den die Sanktionen gegen Russland auslösen.»
In etwa das gleiche Spiel, wie es auch die Schweiz betreibt. Deutsche Empörung ist für einmal fehl am Platz. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es nun mal das Gleiche. Abartiger Neoliberalismus, wie ihn der Westen pflegt, funktioniert nur so und nicht anders.
Darauf kann sich Putin seit jeher verlassen. Und das weiss der Diktator aus dem Kreml, der ja dieses Spiel nicht zum ersten Mal betreibt. Die Annektierung der Krim, orchestriert von Putin und seinen «grünen Männchen, die sich im Nachhinein als russische Soldaten entpuppten, war nur ein Vorgeschmack dessen, was heute stattfindet.
Was nun? Wer bezahlt nun wirklich? Es ist die Ukraine! Sie bezahlt den höchsten Preis.
-
24.2.2022 - Tag der pro aktiven Verteigungsstrategien unserer Politker*innen
Das sagen Schweizer Politiker zur Entwicklung in der Ostukraine: «Sanktionen zwingen Russland nicht in die Knie»
Das russische Vorgehen in der Ostukraine sorgt für scharfe Reaktionen. Viele Politiker hoffen auf eine Verhandlungslösung. Was Sanktionen betrifft, sind sie sich aber uneinig.
Im Ukraine-Konflikt droht die Eskalation. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin (69) die beiden Separatistengebiete anerkannt hat, hagelt es weltweit Kritik. Auch das Aussendepartement in Bern verurteilt die Anerkennung der ukrainischen Regionen in Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten durch Russland. Sie sei ein Angriff auf die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine und des Minsker Abkommens, schreibt das EDA auf Twitter. Die Schweiz ruft Russland dazu auf, die internationalen Verpflichtungen einzuhalten und ihren Entscheid zu revidieren.
Ein Wunsch, den Putin kaum erfüllen wird. «Im Moment sind keine Entspannungssignale erkennbar. Ich erachte das Risiko eines Einmarsches als enorm hoch», sagt SVP-Nationalrat Franz Grüter (58, LU) zu Blick. Der Präsident der aussenpolitischen Kommission sieht nur eine Möglichkeit, den Konflikt zu entschärfen. «Russland muss von den USA und der Nato die Garantie erhalten, dass die Ukraine nicht Nato-Mitglied wird. Das ist das Minimum», sagt er.
«Die Amerikaner hätten auch ein Problem, wenn sich Mexiko oder Kanada einem russischen Bündnis anschliessen würden.» Die Ukraine sei für Russland eine Pufferzone. Auch andere Grossmächte würden auf solche Sicherheitsgarantien bestehen. «Ich bin kein Putin-Versteher», betont Grüter, «aber ohne diese Konzession wird ein Konflikt nicht zu verhindern sein.»
SVP-Grüter warnt vor Sanktionen
Der SVP-Aussenpolitiker glaubt nicht, dass sich Russland mit Sanktionen von seinem Weg abbringen lässt. «Die Russen sind sich Sanktionen gewohnt. Auch wenn sie schmerzen, wird sich Russland mit Sanktionen nicht in die Knie zwingen lassen.» Kommt hinzu, dass sich Europa – etwa bei den Gaslieferungen – ins eigene Fleisch schneiden könnte. «Zudem würden viele ukrainische Flüchtlinge nach Europa strömen.»
Bei allfälligen Sanktionen müsse die Schweiz zurückhaltend sein, so Grüter. «Wir sind ein neutraler Kleinstaat und sollten uns viel mehr als Vermittlerin um eine friedliche Konfliktlösung bemühen.» Der französische Präsident Emmanuel Macron (44) habe sich enorm ins Zeug gelegt. «Eine Rolle, die Bundespräsident Ignazio Cassis hätte übernehmen müssen», findet Grüter. «Wir müssen unsere Guten Dienste nun viel aktiver anbieten, statt mit Twitter-Diplomatie zu agieren!»
Linke fordern Sanktionen
Nicht nur das EDA, auch viele Politiker reagieren auf Twitter auf die Entwicklung. «Um eine weitere Eskalation zu verhindern, muss die Schweiz zusammen mit der EU bereit sein, harte wirtschaftliche und diplomatische Sanktionen umzusetzen», twittert Grünen-Präsident Balthasar Glättli (50). Als Standort der Nord Stream AG und der Nord Stream 2 AG mit Sitz in Zug stehe die Schweiz in einer besonderen Verantwortung.
«Der Bruch des Minsker Abkommens und der russische Einmarsch in die Ostukraine sind durch nichts zu rechtfertigen», schreibt SP-Nationalrat Fabian Molina (31, ZH). Den Frieden in Europa sieht er in grösster Gefahr. Und: «Nur eine europäische Antwort kann jetzt noch Schlimmeres verhindern. Krieg darf kein Mittel der Politik sein!» Schreibt Blick.
Für seine unternehmerischen Leistungen verdient der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter Respekt. Für seine politischen Äusserungen zur Entwicklung der Verhältnisse in der Ukraine allerdings nicht unbedingt.
Es mag ja zutreffen, dass gewisse Sanktionen Putin nicht wirklich jucken. Oder wie es sein Botschafter in Schweden, Viktor Tatarinzew, formulierte: «Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber wir scheissen auf ihre ganzen Sanktionen.» https://www.spiegel.de/ausland/russischer-botschafter-zum-konflikt-mit-dem-westen-wir-scheissen-auf-ihre-ganzen-sanktionen-a-4de26456-c10e-4bbb-87f9-ad8bc62b440e
Allerdings wäre festzuhalten, dass es schon westliche Sanktionen geben würde, die den russischen Diktator massiv treffen würden. Das Problem ist aber, dass diese auch den Westen und damit vor allem die westliche Wirtschaft massiv beeinträchtigen würden.
Bizarr ist aber Grüters Aussage «Ich bin kein Putin-Versteher». Eine solch dümmliche Bemerkung wird seiner durchaus vorhandenen Intelligenz nicht gerecht. Er müsste eigentlich als gewiefter Politiker ganz genau wissen, dass solche verbalen Schüsse stets hinten raus gehen.
Wer in vorauseilender, pro aktiver Verteidigung etwas bestreiten will, was ihm vorgeworfen wird, hat bereits verloren. Diese alte Weisheit müsste auch Grüter geläufig sein. Dass er jetzt erst recht als «Putinversteher» gesehen wird, ist die Folge seiner unglücklichen Verteidigungsstrategie.
Erinnert stark an den Luzerner Ständerat Damian Müller, der im Wahlkampf 2019 ebenfalls ungefragt in jedem Interview pro aktiv beteuerte: «Ich bin nicht schwul». Ganz abgesehen davon, dass das heutzutage ausser ein paar Bauern rund um die Miststöcke im Entlebuch ohnehin niemanden mehr interessiert, hat er damit die Gerüchte nur noch mehr befeuert und damit quasi ein Outing vollzogen über etwas, was im Hohen Haus von Bern laut Insidern hinter vorgehaltener Hand ohnehin schon längst Tatsache sein soll.
-
23.2.2022 - Tag der blonden Witzfiguren
Trump nennt Putins Vorgehen «genial» und «schlau»
Für die EU und die USA ist das Vorgehen Putins rund um die Ukraine rücksichtslos und aggressiv, Ex-US-Präsident Donald Trump hat es hingegen als „genial“ und „schlau“ bezeichnet. Trump sagte am Dienstag in einer konservativen Radio-Talk-Sendung zu den jüngsten Entscheidungen des russischen Staatsoberhaupts: „Das ist genial.“ Der Kremlchef erkläre einen großen Teil der Ukraine für unabhängig und schicke „Friedenstruppen“ dorthin. „Wie schlau ist das denn?“
Mit Blick auf Putin sagte Trump weiter: „Das ist ein Mann, der sehr klug ist. Ich kenne ihn sehr gut.“ Gleichzeitig behauptete der Republikaner, mit ihm als Präsidenten wäre es nicht dazu gekommen: „Das wäre mit uns nie passiert.“ Mit ihm im Amt wäre das undenkbar gewesen, sagte Trump. Seinem Amtsnachfolger Joe Biden warf er vor, im Umgang mit Russland zu versagen.
„Nehmen keine Ratschläge an“
Angesprochen auf Trumps Kommentar sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Dienstagabend: „Wir versuchen grundsätzlich, keine Ratschläge von jemandem anzunehmen, der Präsident Putin und dessen Militärstrategie lobt.“
Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Der Kremlchef ordnete eine Entsendung russischer Soldaten an. Er plant damit zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine. Der Westen wirft ihm vor, damit gegen das Völkerrecht zu verstoßen.
Trump für Kuschelkurs mit Putin kritisiert
Trump hatte bereits zuvor Bidens Kurs in der Ukraine-Krise kritisiert und behauptet, wäre er Präsident, wären die Spannungen mit Russland nie derart eskaliert: Niemand sei jemals härter zu Russland gewesen, und Putin und er hätten einander respektiert. Kritiker hatten dagegen Trump in seiner Amtszeit vorgeworfen, den Kremlchef mit Samthandschuhen anzufassen. US-Ermittlungsbehörden zufolge hatte sich die russische Regierung „in umfassender und systematischer Weise“ in die US-Präsidentenwahl 2016 eingemischt, aus der Trump damals als Sieger hervorging. Schreibt die Kronenzeitung.
Was soll denn The Donald, der Mann von der 5th Avenue mit dem blonden Toupet, das einer Landepiste für verirrte Vögel ähnelt, denn anderes sagen? Immerhin war es der «schlaue» Putin, der das Trump-Imperium zwei Mal vor dem finanziellen Kollaps rettete.
-
22.2.2022 - Tag der Ersatzbank-Fussballspieler
«Will nicht wissen, was die Leute über einen China-Wechsel gesagt hätten»: Im grossen Interview mit 20 Minuten spricht Nati-Star Xherdan Shaqiri über seinen Transfer nach Chicago, die Probleme in Lyon und die WM in Katar.
Xherdan Shaqiri, Sie strahlen ja richtiggehend! Wie glücklich sind Sie über Ihren Wechsel nach Chicago?
Ich freue mich, hier zu sein und etwas Neues kennenlernen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Es ist etwas ganz anderes als in Europa mit der Stimmung und den Stadien hier in den USA.
Nehmen Sie uns mit. Wie kam der Wechsel zu Chicago in den vergangenen Wochen zustande?
Ich wollte weg aus Frankreich. Als das Angebot kam, habe ich lange überlegt. Die MLS hat mich immer interessiert und mit Sportchef Georg Heitz hatte ich in den vergangenen Jahren immer Kontakt. Am Ende wollte ich sportlich noch einmal etwas Neues erleben. Dies, solange ich noch in Top-Form bin und nicht erst mit 35 Jahren.
Trotzdem wechseln Sie aus einer Top-5-Liga in die amerikanische MLS, wo andere Stars Ihre Karriere ausklingen lassen. Was sagen Sie Ihren Kritikern?
Jeder darf seine Meinung äussern. Ich weiss, was ich in meiner Karriere bislang erlebt und geleistet habe. Da steckt vielleicht teilweise auch etwas Neid dahinter. Man wird es nie jedem recht machen können. Ich will mir gar nicht vorstellen, was geredet worden wäre, wenn ich nach Katar oder China gewechselt wäre.
Wäre Katar oder China denn auch eine Option für Sie?
Nein, überhaupt nicht. Dahingehend hab ich mir nie Gedanken gemacht. Ausser vielleicht ich hätte gar keine anderen Optionen mehr.
Gab es in diesem Winter noch andere Interessenten als Chicago?
Ja, es lagen einige Angebote auf dem Tisch. Chicago hat mich aber am meisten überzeugt.
Wie sieht es finanziell mit Ihrem Wechsel aus?
Finanziell passt es für mich hier. Es war aber sicher nicht der ausschlaggebende Grund für den Wechsel.
Vergangene Woche waren Sie mit dem Team im Trainingslager in Texas. Seit zwei Tagen sind Sie nun hier in Chicago. Ihre ersten Eindrücke?
Es ist richtig kalt, wenn die Sonne nicht gerade scheint. Ich habe nicht gedacht, dass es hier noch kälter ist als in der Schweiz. Leider hatte ich noch keine Zeit, die Stadt zu erkunden. Ich bin sehr neugierig. Am Schluss bin ich aber nicht hier, um Ferien zu machen, sondern um zu arbeiten.
Waren Sie schon vorher einmal in den USA?
Ja, während der Ferien war ich schon einmal in New York und in Boston. Mir gefallen solche grossen Städte. Generell mag ich die USA sehr. Die Leute hier denken etwas grösser.
In Europa werden Sie nach guten Leistungen gefeiert, nach weniger überzeugenden Auftritten hart kritisiert. In denn USA sind Sie nun etwas weiter weg vom Fussball-Rampenlicht.
Ich habe nichts dagegen, wenn es hier etwas ruhiger um mich wird - egal, ob sportlich oder privat. So kann ich mich voll auf meine Leistungen im Club konzentrieren.
Chicago hat im Schnitt nur rund 10’000 Zuschauer im Stadion. Ungewohnt für Sie?
Es gibt auch Stadien, die mit 50’000 bis 60’000 Zuschauern gefüllt sind. Das ist doch immer so im Fussball: Wenn du erfolgreich bist und Spiele gewinnst, kommen die Fans. Ich möchte den Fussball in Chicago nach vorne bringen, damit auch hier in Zukunft mehr Zuschauer ins Stadion kommen.
Welche Ziele haben Sie sonst mit Chicago?
Ich will den Erfolg zurück nach Chicago bringen. Das grosse Ziel sind sicher die Playoffs. Am Ende spielt man aber vor allem Fussball, um Pokale zu gewinnen.
Welche Rolle haben Sie im Team?
Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern – auf und auch neben dem Feld. Ich möchte, dass sie jeden Tag besser werden und will ihnen meine Erfahrung weitergeben.
In Chicago dürften Sie deutlich mehr Spiele bestreiten als in den vergangenen Jahren. Wie wichtig ist das im Hinblick auf die WM in Katar?
Murat Yakin möchte natürlich, dass ich fit bin und viele Spiele mache. Meine Rolle in der Nati wird sich durch meinen Wechsel nicht verändern. Ich durfte bis jetzt 100 Länderspiele bestreiten. Das macht mich sehr stolz und ich hoffe, dass noch viele dazukommen werden.
Nach nur einem halben Jahr haben Sie Lyon wieder verlassen. Wie blicken Sie auf die vergangenen Monate zurück?
Ich hab immerhin elf Spiele und fünf Scorerpunkte auf meinem Konto. Ganz so schlimm, wie alle meinen, war es dann schon nicht. Nur hatte ich zuletzt Probleme mit dem Trainer (Peter Bosz, Anm. d. Red.), es gab zu viele Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und mir. Darum wollte ich auch nicht mehr dort bleiben.
Was waren das für Meinungsverschiedenheiten?
Einige Dinge. Taktisch, aber auch menschlich gab es Differenzen.
In der MLS wird viel auf Kunstrasen gespielt. Bereitet Ihnen das mit Ihrer langen Verletzungshistorie etwas Sorgen?
Eigentlich überhaupt nicht. Ich kam eigentlich immer sehr gut mit Kunstrasen zurecht. Zudem sind diese hier in den USA qualitativ in einem sehr guten Zustand. Natürlich ist es aber schon etwas anderes als die Naturrasen-Plätze in England, wo jeder einem Golfplatz ähnelt.
Am Sonntag beginnt die neue MLS-Saison. Können Sie das Niveau der Liga vor Ihrem ersten Spiel bereits einigermassen einschätzen?
Schwierig, ich habe auch erst einige wenige Trainingseinheiten mit dem Team in den Beinen. Es sind einige neue Spieler gekommen, auch aus der Bundesliga. Das Niveau wird schon nicht so schlecht sein, wie alle meinen.
Christian Constantin erzählte Anfang Februar, kurz vor Ihrem Wechsel nach Chicago, gegenüber «Rhône FM», Sie seien beim FC Sion ein Thema gewesen. Was ist da dran?
Ich weiss nicht, woher das kommt. Ich habe noch nie mit Christian Constantin gesprochen. Dafür erwarte ich eigentlich noch eine Entschuldigung von ihm (lacht).
Statt Sion könnten Sie aber ja vielleicht demnächst für Lugano auflaufen, den Partner-Club von Chicago.
Natürlich weiss ich, dass beide Clubs den gleichen Besitzer haben. Lugano ist ein spannendes Projekt, Georg und sein Team machen dort einen guten Job. Jetzt bin ich aber erst einmal hier in Chicago. In ein paar Jahren können wir ja vielleicht nochmals über Lugano reden. Schreibt 20Minuten.
Dass Xherdan Shaqiri nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist, hat er schon öfters bewiesen. Nur: Das muss er auch nicht sein. Er verdient sein Geld ja schliesslich als Ersatzbank-Fussballer. In diesem Gewerbe sind nun mal andere Qualitäten gefragt als intellektuelle Brillanz.
Seine etwas übertriebene Vorstellung, dass er auch in China hätte landen können, entbehrt jedoch jeglicher Realität. Nicht weil China keine Ersatzbänke in den Fussballstadien hätte. Ein bekennender Muslim, der wie Shaqiri beste Beziehungen zum salafistischen Hardcore-Imam von Pristina pflegt, landet im Land des Lächelns im Umerziehungs-Camp bei den Uiguren. Und nicht auf einer Wohlfühl-Ersatzbank für abgehalfterte Fussballspieler.
Putzig wird es allerdings bei der Diskussion um die Besucherzahlen in den US-Football-Stadien. Das kann doch Shaqiri völlig egal sein. Er sieht die Zuschauer ja ohnehin nur von der Ersatzbank aus.
-
21.2.2022 - Tag der Schrumpfhauben und Gesundheitsexperten aus dem Bundeshaus
Über ein Dutzend politische Auswertungen zur Pandemie in Arbeit
Noch ist die Corona-Pandemie nicht vorbei, neue Varianten des Virus könnten Massnahmen erneut notwendig machen.
Dennoch hat die Politik in der Schweiz auf allen Ebenen damit begonnen, die Corona-Krise aufzuarbeiten. Insgesamt seien über ein Dutzend Evaluationen zur Corona-Pandemie in Arbeit, wie die «SonntagsZeitung» schreibt.
Manche Politikerin, mancher Politiker befürchtet, dass aber fast ein bisschen zuviel gemacht wird. So sagt Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel, sie hoffe, dass man den Überblick und den Fokus nicht verliere. Und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi fordert eine unabhängige Aufarbeitung der Corona-Krise – weil er befürchtet, dass die Untersuchungen von Bund und Kantonen nicht unabhängig sein werden. Schreibt SRF im Corona-Liveticker.
Dass sich die alte Schrumpfhaube aus dem Aargau, Mitte-Nationalrätin und oberste Gesundheits-Lobbyistin im Schweizer Parlament Ruth Humbel, mit Händen und Füssen gegen einen Untersuchungsausschuss wehrt, ist aus ihrem Blickwinkel auf das persönliche Konto absolut verständlich.
Doch die Schweizer Bürgerinnen und Bürger sollten eine der widerwärtigsten Aktionen aus der Pandemie nicht vergessen und - unabhängig aller Untersuchungen – an der Wahlurne in Zukunft ihre Konsequenzen aus dieser verabscheuungswürdigen Aktion persönlicher Gier unserer gewählten Parlamentarier*innen ziehen.
Ich wiederhole mich, um unser aller Erinnerungsvermögen zu trainieren:
Dass ausgerechnet die Parlamentarier*innen mit einem Gekreische und Gewürge sondergleichen die Sitzungsgelder aus dem ersten ersten Lockdown 2020 für sich reklamierten, hinterliess einen mehr als nur faden Beigeschmack. Sitzungen notabene, die anlässlich des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 nie stattgefunden haben. Das Parlament war nämlich mehr oder weniger geschlossen.
Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen: Unsere politische Elite lässt sich unter fadenscheinigen Begründungen für Leistungen bezahlen, die sie nie vollbracht haben.
Welchen Eindruck dies bei Menschen hinterlässt, die während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie auf 20 Prozent ihres Lohnes verzichten mussten, während die Parlamentsgehälter stets zu 100 Prozent ausbezahlt wurden, kann man sich leicht vorstellen. Dazu braucht es nicht mal einen Politikwissenschaftler.
Es gibt Gründe dafür, warum die bis anhin vorbildliche Schweiz im kürzlich veröffentlichten Korruptions-Ranking aller Staaten weltweit um einige Plätze zurückgefallen ist. Wie übrigens auch Österreich. Was wir bisher bei unseren Parlamentarierinnen und Parlamentariern als «Pöstchenjägerei*» und «Lobbyismus**» noch achselzuckend zur Kenntnis genommen haben, wird inzwischen kritisch hinterfragt.
Korruption gab es schon immer, seit die Menschheit von den Bäumen heruntergeklettert ist. Dass die Korruption zwecks persönlicher Bereicherung inzwischen aber derart massiv in die Parlamente der hehren westlichen Wertegemeinschaft inklusive Schweiz eingezogen ist, macht sich weltweit bei den Wahlen in «demokratischen» Staaten bemerkbar.
Ein Donald Trump ist nicht vom Himmel gefallen. Die «Trychler» und ähnliche Formationen in der Schweiz sind nur ein Vorgeschmack dessen, was uns in Sachen Populismus in Zukunft erwartet. Dagegen wird selbst die SVP nur noch ein laues Lüftchen sein.
Dass politische Korruption und Dekadenz noch jede Demokratie zu Fall gebracht haben, ist eine alte Historiker-Weisheit.
* https://www.blick.ch/politik/damian-mueller-sichert-sich-lobby-mandate-freisinniger-poestchen-jaeger-id15717324.html?fbclid=IwAR3fAYcA_isoisuzz1VGmuvEwpRpgehRMb5UamiDYZncWGhTap3Ry4zBG0s
** https://www.srf.ch/news/schweiz/wahlen-2019/wahl-arena-gesundheitspolitk-rezepte-gegen-kostenexplosion-vor-nebenwirkungen-wird-gewarnt?fbclid=IwAR1GiRgYh-nHMFqOQPkROI51FyFrFUjZIuhvwvha939UuyaAwCyoA_0uvac

-
20.2.2022 - Sonntag der schwulen Päpste
Nach Missbrauchsgutachten: Kirchenaustritte explodieren in Bayern
Die Zahl der Kirchenaustritte in bayerischen Städten ist nach der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens vor einem Monat drastisch gestiegen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Städten in dem deutschen Bundesland.
In München verdoppelte sich die Zahl der Kirchenaustritte, wie ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferates (KVR) mitteilte. Andere Städte in Bayern bestätigen den Trend. «In der ersten Januarhälfte, also vor dem Gutachten, hatten wir in München pro Arbeitstag in etwa 80 Kirchenaustritte. Seit dem 20. Januar, also seit dem Gutachten, sind es um die 150 bis 160 Kirchenaustritte pro Arbeitstag», sagte der Sprecher.
Und es könnten sogar noch mehr sein. Denn die Nachfrage sei dreimal so hoch wie Anfang des Jahres. Doch die sei nicht zu bewältigen: «Das Limit ist hier unsere Kapazitätsgrenze, vor allem beim Personal.» Dabei habe das KVR die Öffnungszeiten verlängert und mehr Leute eingesetzt. «Trotz erweiterter Öffnungszeiten und Umschichtungen beim Personal werde es wegen der sehr hohen Nachfrage wohl nicht möglich sein, alle Austrittswünsche zeitnah zu bedienen», so der Sprecher weiter.
Schwere Vorwürfe gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI.
Das am 20. Januar vorgestellte und vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebene Gutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl war zum Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren.
Die Gutachter gehen von mindestens 497 Opfern und 235 mutmasslichen Tätern, zugleich aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Sie erhoben schwere Vorwürfe unter anderem gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI., dem sie vierfaches Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Zeit als Münchner Erzbischof vorwerfen. Schreibt Blick.
Da hilft nur noch eine einzige Massnahme: Ein schwuler Papst muss her!
«Aber davon hatten wir vermutlich schon einige», werden Sie jetzt wohl hinter vorgehaltener Hand flüstern.
Das ist anzunehmen. Wenn es schwule Ständeräte gibt, wird es sicherlich auch schwule Päpste gegeben haben. Also gehet hin in Frieden, Ihr Unseligen, und sündigt weiter. Amen.
-
19.2.2022 - Tag der Drogenbosse aus dem Balkan
Dank FBI-Technik: Europas Koks-Boss geschnappt – Luxus-Villa durchsucht
An rund 80 Orten in Europa wurden diese Woche Razzien durchgeführt. Dabei konnte eines der aktivsten Koks-Netzwerke zerschlagen und der Kopf der Bande geschnappt werden. Möglich wurde dies unter anderem dank modernster FBI-Überwachungstechnik.
Auf dem Foto sieht er aus wie ein netter Mann, der in die Kamera lächelt. Doch in Wahrheit zeigt das Bild einen Drogen-Boss. Konkret: Bashkim O.* (55). Er gilt als einer der Köpfe eines gigantischen Drogen-Netzwerkes in Europa. Man konnte ihn kurz nach der Grenze auf dem Weg von Italien nach Kroatien festnehmen. Auch 45 weitere Tatverdächtige wurden geschnappt. Dafür brauchte es einen gross angelegten, länderübergreifenden Einsatz.
Rund 600 Beamte aus Belgien, Deutschland, Kroatien und Spanien waren bei dem Einsatz beteiligt.
Während bei O. die Handschellen klickten, wurde sein Luxus-Anwesen auf Mallorca durchsucht. Die Razzia wurde von der spanischen Polizei auf Video dokumentiert. Die Beamten konfiszierten Bargeld, Waffen, Cannabispflanzen und Edelkarossen. Und sie entdeckten einen Safe. Fünf Stunden dauerte es, um den Tresor zu knacken. Darin: Noch mehr Bargeld und jede Menge Luxus-Uhren.
Auch die Wohnungen in Hamburg von O.s Schwiegervater und seinem Schwager blieben nicht unverschont. Ob dabei etwas gefunden wurde, ist unklar. Ausserdem durchsuchten die Ermittler auf Mallorca das Edel-Restaurant Ritzi, dessen Geschäftsführer ebenfalls festgenommen wurde.
Drogenbaron dank FBI-Technik aufgespürt
Die Behörden stiessen erstmals 2020 auf die Bande, als die belgische Polizei riesige Mengen an Drogen und Chemikalien beschlagnahmte. Aufgespürt werden konnte Drogen-Boss O. unter anderem dank des FBI.
Denn bei der Verfolgung wurde eine moderne Satelliten-Überwachungstechnik des FBI verwendet. So konnte der Hauptverdächtige von London über Italien verfolgt und schliesslich in Kroatien festgenommen werden. * Name bekannt.Schreibt Blick.
Ob wirklich das FBI führender Kopf bei der Aufspürung des albanischen Drogenbosses Bashkim O. gewesen ist sei dahingestellt. Tönt zwar gut, aber in der Regel werden die Köpfe der Drogenmafia durch gezielte Hinweise der Drogenkonkurrenz erwischt, die einen lästigen Konkurrenten in diesem knallharten Business loswerden will.
Die Drogenszene wird durch die jeweils in der Presse lautstark abgefeierten Verhaftungen eines Drogenhäuptlings überhaupt nicht geschwächt. Denn wie bei der altgriechischen Sagenfigur Hydra, der stets zwei Köpfe nachwuchsen, wenn man ihr einen abschlug, verhält es sich im Billionen-Business der Drogen. Auf einen inhaftierten Drogenboss folgen zwei neue.
Um diesen Kampf gegen Windmühlen zu gewinnen, müssten vermutlich tausende von Bewohnern aus dem Balkan hinter Schloss und Riegel gebracht werden werden. In Albanien und im Kosovo schätzungsweise etwa ein Drittel der männlichen Bevölkerung, wenn man auch die unteren Chargen des Drogenhandels aus dem Verkehr ziehen möchte.
Ob das von unseren (westlichen) Gesellschaften überhaupt gewünscht wäre, muss bezweifelt werden. Der geniale US-Rapper Darryl McDaniels von Run-DMC sagte einmal in einem Interview mit dem «Höhli» (Interview geführt vom grossartigen Carlo Pozzi) in den 90er Jahren: «Wenn die USA keine Drogen wollten, hätten die USA auch keine Drogen.»
So ist es! Lakonisch formuliert, aber auf den Punkt gebracht. Alles klar?
-
18.2.2022 - Tag der wandelnden Schminkkoffer aus dem Bundeshaus
Kollegen geben der Führung eine Mitverantwortung: Zwei Suizide erschüttern die Polizei Winterthur
Zwei Suizide innerhalb eines halben Jahres erschüttern die Stadtpolizei Winterthur. Ein Quartierpolizist setzt letzten Sommer seinem Leben ein Ende, ein zweiter macht dasselbe am Freitag auf dem Posten. Polizeikollegen sagen, Führungsversagen habe sie so weit getrieben.
Die zwei gestandenen Quartierpolizisten hätten nur noch wenige Jahre bis zur Pensionierung gehabt. Dennoch entschieden sie sich für den Freitod – weil es ihnen bei der Stadtpolizei Winterthur so schlecht ging, wie beide in ihren Abschiedsbriefen angegeben haben sollen. Dies laut einer Polizeiquelle gegenüber Blick.
Zum ersten Suizid kam es im Juli 2021. Der Mann ging wandern – und kehrte nicht mehr heim, wurde eine Woche lang vermisst. Dann wurde der Polizist im Gebirge tot aufgefunden. Er hatte sein Leben selber beendet. Zum nächsten Suizid kam es letzten Freitag. Auf dem Polizeiposten in der Altstadt von Winterthur setzte ein zweiter Quartierpolizist bei Dienstantritt seinem Leben ein Ende.
Der Mediendienst der Stadtpolizei bestätigt: «Am Freitag hat sich ein Mitarbeiter von uns das Leben genommen. Der Tod unseres langjährigen Mitarbeiters schockiert uns als Korps und als Menschen zutiefst.» Es werde eine Untersuchung eingeleitet.
«Schuld in der Führungskultur»
Viele aus dem Polizeikorps sind nicht nur traurig, sondern auch verärgert. Denn die Polizeikollegen von der Basis haben die angeblich Schuldigen für die beiden Freitode bereits ausgemacht: die Führungsetage.
Der Polizeibeamtenverband Winterthur (PBV) schreibt in einem internen Brief, der Blick vorliegt: «Der PBV hat heute einen Forderungskatalog an die Departementsvorsteherin Katrin Cometta und die Bereichsleitung der Stadtpolizei übergeben. Darin sprechen wir von Schock, Trauer, aber auch von Wut.» Und weiter: «Wir haben darin zum Ausdruck gebracht, dass viele Kolleginnen und Kollegen die Schuld in der Führungskultur und im Verhalten einzelner Personen sehen. Wir möchten, dass jetzt Verantwortung übernommen wird.» Führungsfehler müssten identifiziert, benannt und beseitigt werden, so die Forderung. «Eine solche Tragödie darf sich nicht wiederholen.»
«Er wurde drangsaliert»
Doch woher kam der Leidensdruck der beiden Männer? Im Sommer 2021 wurde die Quartierpolizei umstrukturiert. «Allen Quartierpolizisten wurde ein Mann vor die Nase gesetzt, den niemand für tragbar hielt», sagt ein Insider. Jener Polizist, der sich in den Bergen das Leben nahm, musste sich sein Gebiet mit dem unliebsamen neuen Chef teilen. «Sie hatten das Heu überhaupt nicht auf der gleichen Bühne», so der Insider. Zwei Wochen später wählte er den Freitod.
Die zurückgebliebenen Kollegen gelangten im August eine Führungsebene höher an den nächsten Vorgesetzten und verlangten Veränderungen. «Doch ihre Forderungen wurden kaum richtig angehört. Man sagte jeweils: ‹Nächste Frage›, ohne Antworten gegeben zu haben», so der Insider.
Der zweite Polizist, der sich am Freitag das Leben nahm, habe nach dem Vorfall resigniert. Er liess sich in den Innendienst versetzen, weil er mit der neuen Führung genauso wenig klarkam. «Er wurde drangsaliert», heisst es gegenüber Blick laut einer anderen Quelle. «Er war ständiger Kritik ausgesetzt, und man sagte ihm, der Fehler liege bei ihm. Mit über 60 Jahren sollte er sich komplett ändern, weil offenbar nichts gut genug war.» Der Mann bekam ein Burnout – und blieb dem Dienst bis zu seinem geplanten Neuanfang letzten Freitag fern.
Kommando anerkennt Zusammenhang zwischen beiden Todesfällen
Laut Blick-Informationen weilt der Kommandant der Stadtpolizei derzeit in den Ferien und wird sie nicht abbrechen. Sein Stellvertreter, der das Kommando ohnehin ab Mai übernimmt, musste nun zu Gesprächen antreten. In internen Schriftwechseln wird er aber als «Teil des Problems» bezeichnet. Gesprochen wird von «falschen» und nach dem ersten Suizid «unterlassenen Führungsentscheiden».
Bei den Gesprächen gestand der stellvertretende Kommandant ein, dass zwischen den beiden Todesfällen ein Zusammenhang bestehe. Sofern der Stadtrat zusage, würden externe Berater zur Aufarbeitung beigezogen.
Stadträtin: «Weiteres Leid muss jetzt verhindert werden»
Und wie reagiert die Politik? Gegenüber Blick wollte sich die zuständige Stadträtin Katrin Cometta (GLP) aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äussern. Den Stadtpolizisten kondolierte sie am Montag schriftlich. «Das ganze Wochenende habe ich trotz Wahlen kaum an etwas anderes gedacht als an den Suizid Ihres Kollegen», schreibt sie. Cometta habe den Mann persönlich gekannt und als beliebten und hilfsbereiten Quartierpolizisten erlebt. «Mich hat sein Tod bestürzt und aufgewühlt. Wie ungleich schwerer muss die Last für Sie sein. Sie haben einen Ihnen lieben Kollegen verloren, mit dem Sie teilweise über Jahrzehnte zusammengearbeitet haben.»
Sie spüre die Wut und beteuert, genau hinschauen zu wollen. «Aber wir sollten uns nicht verleiten lassen, vorschnelle Schlüsse zu ziehen», so Cometta. «Es soll auch niemand vorverurteilt werden. Weiteres Leid von weiteren Mitarbeitenden muss jetzt unbedingt verhindert werden.» Schreibt Blick.
Wenn sich zwei gestandene Polizisten wenige Jahre vor der Pensionierung für einen Suizid entscheiden, ist das nicht nur eine unfassbare Tragödie, sondern basiert auf handfesten Gründen und eklatantem Führungsversagen.
Das ist bei den Kantonalen Polizeikorps leider häufig der Fall, da Führungskräfte bei der Polizei öfters nicht nach ihrer Befähigung für das vorgesehene Amt ausgesucht werden, sondern nach dem Parteibuch.
Ausgerechnet Quartierpolizisten, die in den Schweizer Städten einen unsagbar wertvollen Beitrag für die Beruhigung in den Problemquartieren und No-Go-Areas leisten, werden nicht selten von ihrer Führung sträflich im Stich gelassen. Nicht ernst genommen.
Es spricht Bände, dass die Führung der Luzerner Polizei im Gleichschritt mit unfähigen Politikern*innen die Stadtluzerner Quartierpolizisten abschaffen wollte.
Es gilt für die Polisten*innen nur noch die von der Politik verordnete Maxime der Erfüllung der – ebenfalls von der Politik erstellten und vorgegebenen – Bussen-Budgets.
Dass unter dem unseligen Druck dieser politischen Vorgaben viele ehrliche und anständige Mitarbeiter*innen der Schweizer Polizeikorps dem Frust anheimfallen, ist nachvollziehbar.
Gesetzeshüter*innen werden denn auch in der heutigen Gesellschaft – vor allem in den grün/rot-regierten Städten – eher als Feind denn als Freund wahrgenommen. Eine gefährliche Entwicklung, mit der keine Gesellschaft auf die Dauer funktionieren wird.
Die für die Schweizer Polizei zuständige Schminktante aus dem Bundeshaus, Frau Bundesrätin Keller Sutter, schlägt an ihren Pressekonferenzen mit markigen Law & Order-Floskeln um sich, um die sie niemand gebeten hat und die für unser Land auch nicht notwendig sind. Die Unterstützung der Polizei bei der Durchsetzung von Recht und Gesetz würde schon genügen.
Doch die Sorgen und Nöte von frustrierten Polizisten*innen scheinen der FDP-Politikerin verborgen zu bleiben. Vor lauter Staatsbesuchen und Konferenzen bezüglich dem Rohrkrepierer «Schengenraum» scheint sie den Überblick gänzlich verloren zu haben.
Kein Wunder. Durch die etwas zu üppig geschminkten Augenlider des wandelnden Schminkkoffers aus dem Bundeshaus wird die Sicht nun mal stark beeinträchtigt. Da hilft nicht einmal das Goldührli am Handgelenk der modebewussten FDP-Dame weiter. Auch wenn das Ticken der Uhr ihr unmissverständlich verkünden sollte, dass ihre Zeit abgelaufen ist.
Der Fisch stinkt laut einer alten Redensart bekannterweise vom Kopf.
-
17.2.2022 - Tag der Luzerner Polit-Dynastien Borgula und Roth
Luzerner Fasnacht findet ohne Einschränkungen aber mit ungeleerten Güselkübeln statt
Nach den neusten Lockerungsmassnahmen von Bund und Kanton kann die Luzerner Fasnacht im gewohnten Rahmen stattfinden. Grossanlässe wie Umzüge, Tagwache und das Aufstellen von Guuggerbühnen sind möglich. Die Strassenfasnacht und die Beizenfasnacht finden ebenfalls praktisch ohne Einschränkungen statt.
Gleichwohl mahnt die Stadt Luzern zur Vorsicht, denn das Virus ist noch da. Wichtig ist zudem der Schutz des städtischen Personals und der Polizei, aus gesundheitlichen Überlegungen und zur Sicherstellung der Dienstleistungen.
Der Bundesrat hat heute beschlossen, dass ab morgen Donnerstag, 17. Februar 2022, praktisch sämtliche Covid-Massnahmen in einem einzigen Schritt aufgehoben werden. Infolgedessen hat der Kanton Luzern festgehalten, dass Grossanlässe wie die Luzerner Fasnacht im Zusammenhang mit Corona keine kantonale Bewilligung mehr benötigen. Dies bedeutet, dass die Grossanlässe an der Stadtluzerner Fasnacht nur noch eine Bewilligung der Stadt Luzern zur Nutzung des öffentlichen Grundes benötigen – so wie üblich vor der Pandemie. «Wir freuen uns, dass nun trotz Corona die Luzerner Fasnacht möglich ist», sagt Stadtrat Adrian Borgula.
Umzüge können stattfinden
Organisierte Strassenumzüge oder Grossveranstaltungen während den Fasnachtstagen können aufgrund der angepassten Gesetzesregelungen des Bundes stattfinden. Dies betrifft insbesondere den Urknall mit der Fritschi-Tagwache und den Fritschiumzug am SchmuDo, 24.2.2022, den Fasnachtssonntag im Stadtteil Littau am 27.2.2022, die Wey-Tagwache und den Weyumzug am Güdismäntig, 28.2.2022, sowie Chendermonster und den Monstercorso am Güdisdienstag, 1.3.2022. Die Bewilligungen der Stadt Luzern zur Nutzung des öffentlichen Grundes werden nun ausgestellt – mit den üblichen Auflagen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit.
Vorbereitungen für Strassenfasnacht laufen
Aufgrund der Entscheide des Bundes kann auch die Strassenfasnacht wie üblich stattfinden. Auf den sich abzeichnenden Entscheid hat sich das städtische Strasseninspektorat vorbereitet. Ab sofort kann deshalb mit dem Aufbau der nötigen fasnächtlichen Infrastruktur, der definitiven Einsatzplanung für die Reinigung und die Bereitstellung der temporären Signalisationen begonnen werden.
Beizenfasnacht möglich
Dass eine Beizenfasnacht möglich ist, haben Stadt und Kanton bereits am 25. Januar 2022 kommuniziert. Neu gilt für kleine Veranstaltungen in Innenräumen sowie in Restaurants keine Zertifikatspflicht mehr. Auch die Sitzpflicht sowie die Schutzmaskentragpflicht sind aufgehoben.
Schutz des städtischen Personals
Trotz der gelockerten Massnahmen ist festzuhalten, dass das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus noch gross ist, gerade während des fasnächtlichen Treibens bzw. in Menschenansammlungen. Deshalb ist der Stadt Luzern wichtig, dass sich die Bevölkerung und auch das städtische Personal bestmöglich schützen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie zum Beispiel die Reinigungskräfte werden mit FFP2-Masken ausgerüstet, falls sie sich für die Ausübung ihrer Tätigkeiten in die Menschenmengen begeben müssen.
Zudem wurden sie angewiesen, dies bestmöglich nicht in den Hochfrequenzzeiten zu tun. Neben dem Gesundheitsschutz der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt es zu verhindern, dass diese in Isolation müssen und somit für die notwendigen Einsätze nicht zur Verfügung stehen. Stadtrat Adrian Borgula mahnt deshalb zur Rücksicht: «Wir bitten die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, unserem Personal den nötigen Respekt entgegenzubringen und ihnen genügend Abstand zur Ausübung ihrer Tätigkeiten zu gewähren. Und wir bitten um Verständnis, wenn mal ein Abfallkübel nicht innert kürzester Frist geleert ist». Schreibt die Stadt Luzern in ihrer Medienmitteilung.
Luzerner Fasnacht kann ohne Einschränkungen stattfinden. Und das ist gut so! Endlich gibt es für die Trychler keinen Grund mehr für einfältige Demos mit unsäglichem Gekrächze über die FREIHEIT FÜR DEPPEN in der Stadt Luzern.
Die abartigen «Freiheitskämpfer*innen» können nun zurück ins Körbli zu Mutter SVP und dort zusammen mit dem heiligen Christophorus und Vereinsaktuar / Kassier Ueli auf dem Herrliberg den Rütlischwur herunterleiern bis es ihnen kommt.
Putzig finde ich allerdings die prophylaktische Entschuldigung von Stadtrat Adrian Borgula aus der sogenannten «Borgula-Dynastie» in Luzern, in der Regierungsmandate ähnlich wie bei der Luzerner Familie Roth innerhalb der Familie weitervererbt werden: «Wir bitten um Verständnis, wenn mal ein Abfallkübel nicht innert kürzester Frist geleert ist».
Lieber Stadtrat Adrian Borgula: Die Stadt Luzern ist auch ohne Fasnacht ein einziger, permanent gefüllter Güselkübel rund um die Uhr. Egal, wie viel Mühe sich die Reinigungsequipen geben.
Ihr Nobelquartier, in dem Sie wohnen - wie es sich für stramme und dynastische SP-Politiker gehört - ist selbstverständlich von dieser Zumüllung nicht betroffen. Deswegen sei Ihnen auch verziehen, dass Sie nicht wissen, wie es in der Stadt Luzern in Bezug auf Müllhalden wirklich aussieht.

-
16.2.2022 - Tag der menschlichen Tragödien
Berner Schülerin starb an Sevre-Long-Überdosis: Ihr Vater fand Kate (†16) tot im Bett
Sie wollte Chirurgin werden und immer allen helfen. Doch für Kate (†16) selbst kam jede Hilfe zu spät. Die Schülerin starb nach der Einnahme von rezeptpflichtigen Medikamenten. Nun wollen ihre Eltern verhindern, dass sich die Tragödie wiederholt, und warnen.
Als ihr Vater am 11. September 2021 in seiner Wohnung in Bern ankam, lag sein einziges Kind Kate T.* (†16) leblos im Bett. «Ich konnte nichts mehr für sie tun, sie war schon tot», sagt Ivan T.* (47) zu Blick. Er weint, als er sich an den schrecklichen Moment zurückerinnert. «Seither bin ich halb lebendig, halb tot. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben.»
Die anschliessende Obduktion ergab, dass die Schülerin an Drogen gestorben war: Gemäss Bericht haben die Rechtsmediziner bei ihr das rezeptpflichtige Medikament Sevre-Long in toxischer Konzentration festgestellt. Das Schmerzmittel enthält Morphin und wird normalerweise – ähnlich wie Methadon – von Fachpersonen als Substitut an Opioid-Abhängige abgegeben. Auch Spuren des Psychopharmakons Xanax wurden bei der 16-Jährigen gefunden.
Sie war ein talentiertes Mädchen
«Ich hätte mir nie erträumt, dass Kate Drogen nimmt», sagt Mutter Tiffany Williams (41) zu Blick. Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit wollen die Eltern die Bevölkerung dafür sensibilisieren, genau hinzuschauen und zu hinterfragen. «Ich mache mir grosse Vorwürfe und fühle mich schuldig», so die gebürtige Amerikanerin. «Uns hätte auffallen sollen, dass mit Kate etwas nicht stimmt. Jetzt fühlt es sich an, als wäre es nicht richtig, dass ich noch lebe und sie tot ist. Es ist einfach nicht fair.»
Die grosse Herausforderung bei der Erziehung der gemeinsamen Tochter: Die Eltern von Kate sind wahre Weltenbummler. Nach der Trennung zog Vater Ivan von Rom in die Schweiz, wo der Sportlehrer mit bulgarischen Wurzeln bei einer internationalen Schule in Bern eine Anstellung fand. Die gemeinsame Tochter lebte bei ihm und besuchte die Schule, an der ihr Vater unterrichtete. Die Mutter hatte unterdessen ein neues Leben in Frankreich angefangen, zunächst auf dem Festland und später auf der Insel Korsika. Wegen Covid konnte die Teenagerin ihre Mutter in der Zeit vor ihrem Tod aber nur noch selten besuchen.
«Wir sind mit Kate schon immer viel gereist», erinnert sich die 41-Jährige, die mit einem neuen Partner noch Kates Halbschwester (7) grosszieht. «Sie hat fünf Sprachen fliessend gesprochen: Englisch, Französisch, Bulgarisch, Deutsch und Italienisch.» Ihre Tochter sei unglaublich talentiert gewesen, bis ins Teenager-Alter habe sie wettkampfmässig Ballett und rhythmische Sportgymnastik gemacht. «Das hat sie dann aber aufgegeben, weil ihr durch das viele Training nicht genügend Zeit für die Schule blieb», erklärt die Mutter weiter. «Sie war auch sehr gut in der Schule und wollte später Chirurgin werden.» Kate sei eine «sprudelnde» Persönlichkeit gewesen, fröhlich und aufgestellt. «Und sie wollte immer allen helfen. Sie hatte zum Beispiel viele wohltätige Ideen, die sie umsetzen wollte», so die Trauernde. «Sie hat sich immer gegen Rassismus und Sexismus gestellt und sich für Rechte von Frauen und Homosexuellen ausgesprochen.»
Wegen Freundeskreis auf die schiefe Bahn geraten?
Dementsprechend gross war der Schock, als sie das Telefon mit der Nachricht von Kates Tod erhalten habe. «Ich habe geschrien und bin zusammengebrochen», sagt Tiffany Williams. Sofort sei sie in die Schweiz gereist. Beide Elternteile hätten nichts davon geahnt, dass das Mädchen offenbar auf die schiefe Bahn geraten war. Vater Ivan T. zu Blick: «Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht bemerkt habe, dass sie Drogen nahm.» Zwar habe er schon bemerkt, dass sich ihr Freundeskreis verändert hatte – doch man habe ihm jeweils versichert, es handle sich bei den neuen Freunden um «good kids». Einen Suizid schliessen beide Eltern definitiv aus, die Überdosis müsse ein Unfall gewesen sein.
Nach Kates Tod meldete sich allerdings eine Schulkollegin bei den Eltern: Die Mitschülerin berichtete, sie habe sich etwa eine Woche vor der Tragödie an eine psychologische Betreuerin der Schule gewandt. Blick liegt das E-Mail vor, darin steht: «Ich sorge mich um meine Freundin Kate. Sie isst nicht genug und ich glaube, sie braucht Hilfe.» Sie und ihre Gspänli hätten beobachtet, dass Kate Gewicht verloren habe und nicht gesund aussehe.
Die Eltern wollen wachrütteln
«Warum wurde ich von der Schule nicht kontaktiert?», fragt sich der Vater wütend. «Ich kann es kaum glauben, dass diese psychologische Betreuerin nicht auf mich zugekommen ist und mich informiert hat. Ich habe ja sogar an dieser Schule gearbeitet!» Nach Kates Tod habe die kontaktierte Lehrperson ihm ins Gesicht gelogen und abgestritten, informiert worden zu sein. Daher habe er es nicht mehr verkraftet, dort zu arbeiten. Er habe gekündigt und sei in die USA gezogen. «In Bern haben alle gewusst, was passiert war. Und ich habe mich unendlich dafür geschämt, dass wir alle ihr nicht helfen konnten – darum musste ich weg.» Die Bildungsinstitution wollte auf Anfrage nicht Stellung zum Drama nehmen.
Doch die Erziehungsberechtigten machen nicht nur sich selbst und der Schule Vorwürfe: Auch dass die Jugendliche überhaupt an die rezeptpflichtigen Medikamente gelangt ist, macht sie sprachlos. «Diese Medikamente werden an Drogenabgabestellen ausgegeben, aber die Süchtigen verkaufen die dann einfach weiter, wie ich gehört habe», sagt die Mutter fassungslos. «Ich gehe davon aus, dass Kate die Pillen von ihren neuen ‹Freunden› bekommen hat und gar nicht genau wusste, was sie da einnimmt.»
Sie fordert strengere Drogenkontrollen durch die Polizei, etwa auf der Grossen Schanze in Bern, wo Kate gemäss ihrer Mutter überhaupt erst mit Drogen in Kontakt gekommen sei. Zudem will sie härtere Strafen und strengere Gesetze für den Drogenhandel – und möchte Teenie-Eltern dazu wachrütteln, bei ihren Kindern genau hinzuschauen: «So etwas darf nie wieder passieren!»
Ihre Asche soll am Strand verstreut werden
Derzeit sind gemäss Kantonspolizei Bern die Ermittlungen zum Fall immer noch im Gange. «Sie haben auch noch ihr Telefon», bestätigt Tiffany Williams. Die Beerdigung von Kate stehe noch aus, meint die Mutter traurig. «Es ging alles sehr schnell und kam so unerwartet, daher haben wir sie jetzt mal kremieren lassen und werden ihre Asche irgendwann auf Korsika am Meer verstreuen. Sie hat es dort geliebt.» Ihre quirlige Kate werden die Eltern nie vergessen – und sich ihren Tod wohl nie ganz verzeihen. * Namen bekannt.Schreibt Blick.
Dass Blick diese menschliche Tragödie ausschlachtet, gehört nun mal zur DNA eines Boulevardblattes. Man könnte aber auch anders argumentieren: Möglicherweise wecken tragische Artikel dieser Dimension eine Gesellschaft endlich auf, über die Entwicklung des Drogenkonsums nachzudenken.
Dass harte Drogen inzwischen in der Mitte der Schweizer Gesellschaft bis hinauf in höchste Kreise angekommen sind, bestreiten auch die Schweizer Polizeikorps seit langem nicht mehr. Es soll ja auch Polizisten geben, die sich ab und zu ein «Jöintchen» oder einen «Sniff» gönnen.
Ein ehemaliger Chef der Zofinger Polizei, der laut Blick «dealte und drögelte», lässt grüssen.
Es spricht für sich, dass ein besorgter Bürger in der Stadt Luzern von einer unbedarften Polizistin am Telefon mit dem Laissez-faire-Karma der Luzerner Polizei «Drogen gehören halt zu einer Stadt» abgewimmelt wurde. Er wollte eigentlich nichts anderes als die Übergabe von harten Drogen an Jugendliche melden.
Auf solche Missstände in der Drogenbekämpfung angesprochen, verstecken sich höhere Polizeikader gerne hinter der Floskel, dass sie von der Politik in dieser Angelegenheit keine Unterstützung erhalten würden.
Diese Ausrede spricht eher gegen die Polizei als die Politik. Noch sind nicht sämtliche Schweizer Politiker*innen mit Drogen zugedröhnt. Auch wenn viele Apologeten aus Politik und Gesellschaft der Legalisierung von Drogen, auch harten Drogen, nicht abgeneigt sind.
Vermutlich erhoffen sich die Parteigrössen mit dieser widerwärtigen Anbiederung Wählerstimmen beim jüngeren Publikum. Dass dieser Schuss hinten raus gehen wird, kann jetzt schon prophezeit werden: Zugedröhnte gehen in der Regel nicht wählen!
Dass bisher weltweit alle, aber auch wirklich alle Versuche gescheitert sind, die Drogenproblematik mit Legalisierung in den Griff zu bekommen, wird nonchalant verschwiegen.
Ausgerechnet Portugal, das sämtliche Drogen legalisiert hat, wird als Vorzeigestaat genannt. Dass der Crack-Konsum unter den Jugendlichen seit der Legalisierung in Portugal in einem verheerenden Ausmass zugenommen hat, ist kein Thema. Auch nicht die Zunahme junger Menschen, die von den Sozialämtern Portugals alimentiert und betreut werden müssen.
Mit der unsäglichen Floskel «Wer Drogen nimmt, ist nicht kriminell, sondern krank» wird beschönigt, was sich beispielsweise in den USA längst zu einer der grössten sozialen Herausforderungen entwickelt hat.
Selbst Holland mit der liberalsten Drogenpolitik Europas will das Rad der Zeit zurückdrehen und eine schärfere Gangart in Sachen Drogenbekämpfung einleiten. Hört man jedenfalls von holländischen Politikern*innen, wenn sie vor lauter Betroffenheit kaum mehr husten können, wenn wieder mal ein Journalist oder ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft von der holländischen Drogenmafia mitten in Amsterdam auf offener Strasse erschossen wird.
Doch wie das bei Politkern*innen so üblich ist: Der gekünstelten Betroffenheit folgen keine Taten. Das wird auch in der Schweiz nach einer allfälligen Legalisierung der Drogen kaum anders sein.
-
15.2.2022 - Tag der Korruption im Schweizer Parlament
Abstimmungen in der Schweiz: Warum scheitern Behördenvorlagen immer häufiger?
Die Ablehnungen von Behördenvorlagen häufen sich. Gelingt es Bundesrat und Parlament nicht mehr, Abstimmungsvorlagen so zu vermitteln, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Behördenempfehlung folgen? Oder wird gar vermehrt am Volk vorbei politisiert?
Früher war der Fall bei Initiativen und Referenden ziemlich klar: In aller Regel konnte davon ausgegangen werden, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Empfehlung von Regierung und Parlament folgen werden. Dies hat sich in der laufenden Legislatur stark verändert.
Häufung der Ablehnung von Behördenvorlagen – ein neues Phänomen?
Wieso folgt das Stimmvolk vermehrt nicht mehr den Empfehlungen aus Bern? Politikwissenschaftler Hans-Peter Schaub sieht den Hauptgrund für die gestiegene Zahl abgelehnter Behördenvorlagen in der Veränderung der Stimmbürgerschaft. Viele Leute seien durch die Pandemie politisiert worden, die vorher nicht regelmässig an Abstimmungen teilgenommen hatten. Diese würden sich ihre Meinung relativ unabhängig von Behörden und Parteien bilden und seien so auch eher bereit, gegen deren Empfehlung zu stimmen.
Schaub relativiert jedoch: Noch immer werde gegen einen nur sehr kleinen Teil der Parlamentsbeschlüsse überhaupt das Referendum ergriffen. Die meisten Beschlüsse kommen gar nie vors Volk. Und schliesslich sei diese Entwicklung, so Schaub, auch nicht neu:
Gab früher auch schon Phasen, wo die Behörden oft verloren haben.
Autor: Hans-Peter Schaub, Politikwissenschaftler
«Das ist nicht das erste Mal in der Abstimmungsgeschichte der Schweiz, wo wir so eine Phase haben. Es gab früher auch schon zwei- oder dreijährige Phasen, wo die Behörden ebenso oft oder sogar noch häufiger verloren haben.»
Problematisch ist nicht unbedingt die Zahl der Ablehnungen, sondern die Komplexität der Vorlagen. Denn grundsätzlich gilt: Je komplexer die Vorlagen, desto schwieriger ist es für Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu verstehen, um was es geht. Und im Zweifelsfall stimmen die Leute dann für den Status quo.
Grundvertrauen bleibt hoch – Parteien bleiben gelassen
Könnte die Häufung der Ablehnung zum Problem für das Funktionieren des schweizerischen politischen Systems werden? Eher nicht, meint Politikwissenschaftler Hans-Peter Schaub: «Grundsätzlich ist das kein Problem. Es gehört eben dazu, dass das Volk bei einzelnen Vorlagen, wenn es mit dem Parlament nicht einverstanden ist, Nein sagen kann. Ein Problem hätten wir dann, wenn dauerhaft keine Reformen zustande kommen.»
Ein Problem hätten wir dann, wenn dauerhaft keine Reformen zustande kommen.
Autor: Hans-Peter Schaub, Politikwissenschaftler
Beispiele für Reformen, mit denen die Behörden seit Jahren zu kämpfen hätten, sind die Altersvorsorge oder die E-ID. Hier könne durchaus von einem Reformstau gesprochen werden. Schlussendlich bleibt das Vertrauen in Bundesrat und Parlament, trotz teils lauter Kritik, intakt. Laut CS Sorgenbarometer sei der Bundesrat auch heute noch ein «Vertrauensfaktor der Schweizer Politik».
Und grundsätzlich, so waren sich auch die Parteispitzen am Abstimmungssonntag einig, sei ein aktives Volk, welches als Korrektiv wirke, eigentlich durchaus positiv. Es brauche eine Instanz, die dem Bundesrat und Parlament ab und zu auf die Finger klopfe. Schreibt SRF.
Die Wahrnehmung unserer politischen Eliten hat sich beim gemeinen Wahlvolk innerhalb von geschätzten zwei Jahrzehnten extrem verändert. Es ist ja längst nicht mehr so, dass wir den Gesalbten aus dem Hohen Haus mit dem lächerlich zur Schau getragenen Habitus der Etablierten nichts zutrauen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir trauen ihnen inzwischen so ziemlich alles zu.
Es gibt Gründe dafür, warum die bis anhin vorbildliche Schweiz im kürzlich veröffentlichten Korruptions-Ranking aller Staaten weltweit um einige Plätze zurückgefallen ist. Wie übrigens auch Österreich. Was wir bisher bei unseren Parlamentarierinnen und Parlamentariern als «Pöstchenjägerei*» und «Lobbyismus**» noch achselzuckend zur Kenntnis genommen haben, wird inzwischen kritisch hinterfragt.
Die Corona-Pandemie hat ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen. Dass ausgerechnet die Parlamentarier*innen mit einem Gekreische und Gewürge sondergleichen die Sitzungsgelder für sich reklamierten, hinterliess einen mehr als nur faden Beigeschmack. Sitzungen notabene, die anlässlich des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 nie stattgefunden haben.
Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen: Unsere politische Elite lässt sich unter fadenscheinigen Begründungen für Leistungen bezahlen, die sie nie vollbracht haben.
Welchen Eindruck dies bei Menschen hinterlässt, die während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie auf 20 Prozent ihres Lohnes verzichten mussten, während die Parlamentsgehälter stets zu 100 Prozent ausbezahlt wurden, kann man sich leicht vorstellen. Dazu braucht es nicht mal einen Politikwissenschaftler.
Korruption gab es schon immer, seit die Menschheit von den Bäumen heruntergeklettert ist. Dass die Korruption zwecks persönlicher Bereicherung inzwischen aber derart massiv in die Parlamente der hehren westlichen Wertegemeinschaft inklusive Schweiz eingezogen ist, macht sich weltweit bei den Wahlen in «demokratischen» Staaten bemerkbar.
Ein Donald Trump ist nicht vom Himmel gefallen. Die «Trychler» und ähnliche Formationen in der Schweiz sind nur ein Vorgeschmack dessen, was uns in Sachen Populismus in Zukunft erwartet. Dagegen wird selbst die SVP nur noch ein laues Lüftchen sein.
Dass politische Korruption und Dekadenz noch jede Demokratie zu Fall gebracht haben, ist eine alte Historiker-Weisheit.
* https://www.blick.ch/politik/damian-mueller-sichert-sich-lobby-mandate-freisinniger-poestchen-jaeger-id15717324.html)
** Aargauer Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel: »Man verdient sich keine goldene Nase mit Mandaten im Gesundheitsbereich.» https://www.srf.ch/news/schweiz/wahlen-2019/wahl-arena-gesundheitspolitk-rezepte-gegen-kostenexplosion-vor-nebenwirkungen-wird-gewarnt)
-
14.2.2022 - Tag des ungarischen Despoten Orban
Ungarns Premier Orbán deutet in Rede möglichen "Huxit" an
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat in einer Rede erstmals die Möglichkeit eines EU-Austritts seines Landes angedeutet. Setze die EU ihren "Rechtsstaats-Jihad" gegen Ungarn fort, werde es künftig nicht möglich sein, einen gemeinsamen Weg zu gehen, sagte der Rechtspopulist am Samstag vor handverlesenem Publikum in Budapest.
Am Mittwoch wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg darüber befinden, ob der von der EU im Dezember 2020 beschlossene Rechtsstaatsmechanismus mit dem EU-Recht vereinbar ist.
Der Mechanismus sieht vor, dass jenen Mitgliedsstaaten, die gegen die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstoßen, die EU-Förderungen gekürzt werden können. Ungarn und Polen – zwei notorische Rechtsstaatssünder – hatten gegen den Beschluss geklagt. Die EU-Kommission will den neuen Mechanismus erst nach einem EuGH-Urteil anwenden, das die Vereinbarkeit mit dem EU-Recht bestätigt. Ein solches wird nun erwartet.
Großes Risiko
Es könnte Orbán empfindlich treffen. Die Ausstaffierung seiner Oligarchen und diverse Wahlgeschenke für die Bevölkerung sind nur dank großzügiger EU-Förderungen möglich. Die Aussicht auf deren Verlust verleitete ihn zu einer Attacke gegen "Brüssel": Dieses führe "einen heiligen Krieg, einen Rechtsstaats-Jihad" gegen sein Land. Der Rechtsstaat sei "ein Mittel, mit dessen Hilfe sie uns zu etwas kneten wollen, was ihnen ähnelt".
Ungarn, das Orbáns Verfassung aus dem Jahr 2012 als völkisch-klerikalen Staat von Gnaden der mittelalterlichen Stephanskrone definiert, wolle aber "nicht so werden wie sie". Umgekehrt verlangt Orbán aber auch nicht, dass der Westen so wird wie Ungarn.
Orbáns "Toleranzangebote"
"Deshalb haben wir schon des Öfteren Brüssel und auch Berlin Toleranzangebote unterbreitet", weihte er seine Zuhörerschaft in einen bisher nicht bekannten Schachzug seiner Diplomatie ein. Und wenn dem Ungarn Orbáns keine "Toleranz" in Hinblick auf die Rechtsstaatsverstöße zuteilwird? Dann trennen sich offenbar die Wege.
Bisher hat sich Orbán mit Huxit-Drohungen zurückgehalten. Der Tag seiner Rede fiel mit dem offiziellen Start des Wahlkampfs für die Parlamentswahl am 3. April zusammen. Erstmals fordert ihn ein geeintes Oppositionsbündnis heraus, das linke, rechte und grüne Parteien einschließt. Seine Wiederwahl gilt deshalb nicht als gesichert. Schreibt DER STANDARD.
Das übliche Wahlkampfgeschwätz von Despoten, die an der Macht kleben. Ernst zu nehmen sind solche Drohgebärden jedenfalls nicht. Schon gar nicht von Orban, dessen Oligarchen (zu denen er selbst gehört) am finanziellen Futtertrog von Brüssel hängen.
So viel Geld wie Brüssel an den von einem «Rechtsstaat-Jihad» verfolgten Unrechtsstaat bezahlt, wird Moskau niemals überweisen. Deshalb wird es auch keinen Huxit geben. Ob das nun für die EU gut oder schlecht ist, sei dahingestellt.
-
13.2.2022 - Tag der Zwangsgebühren
SVP-Initiative will Radio- und TV-Gebühren halbieren: Nun folgt das Ringen um die SRG
Eine SVP-Initiative will de Radio- und Fernsehgebühr halbieren. Die Bürgerlichen könnten die SRG bereits im Parlament zwingen, den Gürtel enger zu schnallen.
Die SVP steht in den Startlöchern. Wann genau die Partei ihre Initiative zur Halbierung der Radio- und Fernsehgebühren lanciert, behält sie für sich.
Dass sie aber bald mit der Unterschriftensammlung beginnt, darüber bestehen kaum Zweifel. Den Schwung, den sich die SVP als Kämpferin gegen das Medienpaket geholt hat, wird sie nicht verpuffen lassen.
Halbierungs-Initiative hat gute Chancen
Die Halbierungs-Initiative hat Chancen. Ihre Aussichten stehen um Längen besser als die ungleich radikalere No-Billag-Vorlage, die das Stimmvolk vor vier Jahren noch wuchtig verwarf.
Support dürfte die SVP etwa aus dem Gewerbeverband erhalten. Und sie wird auch davon profitieren, dass viele Bürgerliche derzeit offen mit der SRG hadern.
Goodwill für die SRG bei manchen Parteien aufgebraucht
Für FDP-Parteipräsident Thierry Burkart (46, AG) ist es «unbestritten, dass SRF Schweizer Kulturgut in unsere Wohnzimmer bringt». Und auch die News-Sendungen seien oft von guter Qualität. «Hingegen gibt es immer wieder Berichte, die politisch unausgewogen sind. Damit schadet sich das SRF.» Kürzlich beanstandete die Allianz Sicherheit Schweiz, die Burkart präsidiert, einen Beitrag der «Rundschau» über den Kampfjet F-35. Auch Mitte-Präsident Gerhard Pfister griff das SRF in der Folge an. Vom viel beschriebenen Goodwill, von dem die SRG nach der No-Billag-Abstimmung zehrte, ist in manchen Parteien tatsächlich wenig übrig geblieben.
Wie sich der Freisinn positionieren wird, lässt Burkart betont offen. «Die Initiative der SVP wird im Freisinn sicher diskutiert werden. Am Ende entscheiden wie immer unsere Delegierten.» Eigentlich sei das Vorgehen der SVP verkehrt. «Zuerst sollte das Parlament den Auftrag der SRG festlegen und anschliessend die zur Auftragserfüllung notwendigen finanziellen Mittel.» Ein Bekenntnis zum Status quo von SRF tönt anders.
Halbierungs-Initiative «verglichen mit der No-Billag-Vorlage zahm und ausgewogen»
FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen (40, BE) ist einer der pointiertesten SRG-Kritiker seiner Partei. Er nennt die Halbierungs-Initiative «verglichen mit der No-Billag-Vorlage zahm und ausgewogen». Sie geniesse «in Gewerbekreisen und sicher auch im Freisinn» Sympathien. Entscheidend werde sein, wie sich das Parlament verhalte, sagt Wasserfallen. Er drängt darauf, KMU von der Radio- und Fernsehgebühr auszunehmen. Eine entsprechende parlamentarische Initiative von Gewerbeverbandspräsident Fabio Regazzi (59, Mitte) ist hängig. Stimme das Parlament nicht zu, so Wasserfallen, «dann bleibt die Halbierungs-Initiative die einzige Handhabe, um echte Veränderungen anzustossen».
SP-Nationalrätin warnt
Genau das ist die Sorge der erklärten Gegner der Initiative. SP-Nationalrätin Min Li Marti (47, ZH) warnt davor, «in vorauseilendem Gehorsam» Kürzungen zu beschliessen.
«Die Initiative der SVP geht sehr weit. Ich glaube daher nicht, dass dieser Angriff auf die SRG eine Mehrheit findet, auch wenn die Medien weniger Ansehen geniessen als früher und die SRG viel von ihrer Rolle als ‹Lagerfeuer der Nation› verloren hat.»
Nach der heutigen Abstimmung wird sich bald zeigen, wie stark die Flamme noch lodert. Schreibt SRF.
Wieder mal eine typisch «halbe Sache», die «Halbierungs-Initiative» der SVP. Wenn schon dann schon ganz weg mit den Zwangsgebühren.
Einerseits.
Andererseits strategisch klug. Eine Preissenkung der Zwangsgebühren um immerhin 50 Prozent könnte beim «Wahlvolch»(O-ton SVP-Messias Blocher) sehr gut ankommen.
Der Weg zur gänzlichen Abschaffung der Zwangsgebühren ist anschliessend unter Berücksichtigung einer gewissen Zeitachse nur noch halb so weit.
Clever!
-
12.2.2022 - Tag der Psychopathen und Kirschblüten-Gemeinschaft
Berner Psychiatrie hat sektennahe Psychiaterinnen angestellt
Vertreterinnen der Kirschblütengemeinschaft waren in Münsingen BE tätig. Beim Kanton ist eine Beschwerde eingegangen.
Diese Enthüllung bringt eine der grössten Psychiatriekliniken des Kantons Bern in Erklärungsnot: Während mehrerer Jahre arbeiteten im Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) zwei Psychiaterinnen, die der umstrittenen, sektenähnlichen Kirschblüten-Gemeinschaft angehören. Dies zeigen Recherchen des Magazins «Beobachter». Auch die Tochter des Gründers der Gruppierung, Samuel Widmer, war dort als Psychologin tätig.
Therapeuten und Psychiaterinnen der Kirschblüten-Gemeinschaft vertreten die sogenannte «Echte Psychotherapie». Tragende Elemente sind dabei Tantra-Sexualpraktiken und die Psycholyse, bei der auch illegale Drogen wie LSD und MDMA verabreicht werden. Der Bund anerkennt die Therapiemethoden der Kirschblüten-Gemeinschaft nicht.
Der Dachverband der psychiatrischen Kliniken und Dienste, Swiss Mental Healthcare (SMHC), distanziert sich deutlich von der Gruppierung: «Die Behandlungsmethoden sind inakzeptabel. Inzestuöse Handlungen sowie sexuelle Kontakte zwischen Therapeutinnen und Patienten werden nicht ausgeschlossen», sagt SMHC-Präsident Erich Seifritz. Die Vorkommnisse beträfen den Kern der psychiatrischen Behandlung, die sich nachteilig auf die Patientinnen auswirken könnten. «Es stehen Praktiken zur Diskussion, die ganz klar Standards überschreiten», so Seifritz.
Klinik-Chef stellte Psychiaterinnen ein
Wie kam es dazu, dass Mitglieder der Kirschblüten-Gemeinschaft in einem angesehenen Psychiatriezentrum arbeiten konnten? Der ärztliche Direktor des PZM soll die Psychiaterinnen persönlich eingestellt haben. Dies mit Wissen der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats. Er pflegte laut dem «Beobachter» zudem eine «private Beziehung» zu einer Person in Lüsslingen-Nennigkofen.
Was sagt das Psychiatriezentrum Münsingen selbst zu den Enthüllungen? «Meine Haltung zur Kirschblüten-Gemeinschaft ist dieselbe, wie die des gesamten Psychiatriezentrums – und sie ist glasklar: Wir distanzieren uns vollumfänglich von diesen pseudowissenschaftlichen Therapien, die von der Kirschblüten-Gemeinschaft praktiziert werden», sagt Verwaltungsratspräsident Jean-Marc Lüthi.
Weniger einfach zu beantworten sei die Frage, ob eine Person, die Teil der Kirschblüten-Gemeinschaft ist, im Psychiatriezentrum arbeiten dürfe, sagt Lüthi weiter: «Einerseits lehnen wir die Ideologie klar ab und dementsprechend müsste die Antwort ‹Nein› sein. Andererseits leben wir eine diskriminierungsfreie Anstellungspraxis. Und dazu kommt, dass es aktuell einen ausgeprägten Fachkräftemangel gibt, der in der Psychiatrie besonders spürbar ist. Das schränkt unsere Rekrutierung jeweils stark ein.»
Kanton prüft Schritte gegen Klinik
Nun beschäftigen sich auch die Kantonsbehörden mit den Vorkommnissen in Münsingen. Laut Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion, ist bereits eine aufsichtsrechtliche Beschwerde eingegangen. Man werde «bei Bedarf weitere Schritte unternehmen», so Giebel.
Weitere Kritik kommt von der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie (SGPP). Für sie ist die Kirschblüten-Gemeinschaft eine «gefährliche Bewegung mit totalitärem Anspruch, die Menschen mit Heilsversprechen ködert.» Jegliche ideologische Nähe oder Anhängerschaft sei nicht vereinbar mit den Standesregeln der SGPP. Für Psychiaterinnen und Psychiater, die sich nicht an diese Regeln hielten, gelte eine «Nulltoleranz», heisst es in einer Mitteilung.
Was ist die Kirschblüten-Gemeinschaft?
Die Kirschblüten-Gemeinschaft wurde 1996 gegründet. In der Solothurner Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen leben laut eigenen Angaben rund 200 Personen, die sich zur Gemeinschaft zählen. Dies ist rund ein Fünftel der Dorfbevölkerung.
Im Dorf ist die Gemeinschaft nicht unumstritten. Für Sektenexpertinnen wie Susanne Schaaf von Infosekta gilt die Lüsslinger Gemeinschaft als «sektenhafte Gruppierung».
Gründer der Kirschblüten-Gemeinschaft war der 2017 verstorbene Psychiater Samuel Widmer. Die Gruppe lebt nach eigenen Regeln. In der Gemeinschaft gehe es laut eigenen Angaben um Selbsterkenntnis zu den Fragen, wie jeder einzelne Mensch wirklich leben möchte und darum, «das Thema Sex, das für viele psychische Krankheiten verantwortlich ist, zu thematisieren und zu enttabuisieren, zum Beispiel mit der Tantrischen Therapie.»
Sie propagiert beispielsweise freie Liebe und praktiziert Therapien mit Sex und Drogen. Der verstorbene Gründer Samuel Widmer hatte zwei Frauen und elf Kinder, und schrieb in seinen Büchern unter anderem gegen das Tabu des Inzests an. Die Kirschblüten-Gemeinschaft beschäftigte auch die Behörden. So wurde gegen Psychiater Samuel Widmer ermittelt, weil er bei Therapiesitzungen illegale Substanzen eingesetzt haben soll.Schreibt SRF.
Erinnert mich an ein Interview vor vielen Jahren mit V.O. Pulver, dem genialen Sänger der legendären Band «Poltergeist»: «Sie sind überall!», flüsterte er mir im Brustton der Überzeugung ins Ohr.
Er meinte damit Aliens und war, je nachdem was er gerade geraucht hatte, felsenfest davon überzeugt, dass diese Wesen aus dem All mitten unter uns seien. Und zwar überall.
30 Jahre später muss ich dem guten V.O. recht geben. Er hatte sich damals lediglich in der Spezies geirrt: Grenzwertige Psychiater*innen, die man ohne Wimpernzucken der Gruppe der Psychopathen zuordnen darf und die eher Teil des Problems statt der Lösung sind, findet man tatsächlich überall. Google hilft mit dem Suchbegriff «Kritik an Psychiatrie» weiter.
Dass selbst der allseits verehrte Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, mit vielen seiner Thesen öfters mehr daneben lag als mittendrin, ist inzwischen unbestritten. Ebenso die Tatsache, dass mit den «Psycho-Pharmakas» eine Industrie entstanden ist, die mehr Unheil und irreparable Schäden anrichtet als uns lieb ist.
Psychiatrie: Die Menschenversuche von Münsterlingen
LUZERN: Expertin kritisiert Psychiatrie hart
Um nur zwei Müsterchen zu nennen...
-
11.2.2022 - Tag der kriminellen Rapper und Rapperinnen aus dem Kosovo
Zum zweiten Mal ausgeschaffter Räuber-Rapper: Besko war lieber im Schweizer Knast als frei im Kosovo
Der Rapper Besko wurde ausgeschafft. Zwei Mal. Ein SRF-Langzeitporträt zeigt seinen Weg zum wohl bekanntesten Ausgeschafften der Schweiz. Nun liegen 10 Jahre Landesverweis vor ihm.
Räuber-Rapper Besko (35) wurde am 18. Dezember letzten Jahres ausgeschafft. Schon wieder. In der Schweiz sass er seine Haftstrafe für einen Raubüberfall in Dübendorf ZH ab. Jetzt blickt ein SRF-Dokfilm auf das Leben des Räuber-Rappers zurück. Über fast 20 Jahre wurde Besko begleitet. Mit 16, zu Beginn seiner kriminellen Karriere, spricht er erstmals mit dem Filmemacher.
Das Langzeitporträt zeigt vor allem: Besko sitzt lieber in der Schweiz im Knast ein, als in Kosovo ein Leben in Freiheit zu führen. So sagt er: «Die richtige Bestrafung begann mit der Ausschaffung.» Die erste erfolgte 2016.
Lieber Schweizer Knast als Freiheit im Kosovo
Als er darauf im Kosovo vom Filmemacher getroffen wird, sagt Besko: «Im Gefängnis habe ich Empathie gelernt.» Und trotzdem behauptet er, nichts zu bereuen, «ausser das Leid, was ich den Opfern angetan habe. Und meiner Familie.» Das war rund zwei Jahre vor dem Postraub in Dübendorf ZH. Dieser fand während eines Schweizbesuchs mit Spezialbewilligung statt. Besko hätte seinen heute sechsjährigen Sohn besuchen sollen.
Im Kosovo, etwa im Jahr 2016, sagt er: «Ich bin über fünf Jahre in der Schweiz im Gefängnis gesessen. Am Anfang war es hier im Kosovo aber fast schwerer für mich als in Haft. Im Gefängnis hast du deine Zelle, deine Mahlzeiten, deinen Job. Hast gewusst, du bist in der Schweiz. Hier hast du keinen Job, kein Geld, nichts.»
Er sagt auch: «Das klingt jetzt krass: Lieber bin ich geschlossen in der Schweiz und fühle mich irgendwie daheim – statt hier zu sein und jeder Tag ist ein Kampf.»
2021 hätte er in die Schweiz zurückkehren können
2019 kehrt er in die Schweiz zurück. Offenbar mehrmals. Schon vor dem Überfall reiste Besko monatelang in der Schweiz umher. Er arbeitete zwei Monate schwarz in einer Bar, hing mit Kollegen ab. Von einem Mittelsmann hatte er in Italien einen Schweizer Pass bekommen, dessen echter Besitzer dem Rapper ähnlich sah.
Dann überfiel er die Postfiliale. Wäre er 2019 nicht wieder kriminell geworden, hätte er 2021 in die Schweiz zurückkehren können. Die mögliche Konsequenz, Haft in der Schweiz, so lässt er durchblicken, habe er beim Raubüberfall bewusst in Kauf genommen.
Besko will nie wieder in die Schweiz
Im SRF-Dok gibt der Rapper denselben Grund für seine Straftat an wie auch vor Gericht. Er sei im Kosovo in einen Konflikt mit einem Clan geraten, habe Schulden gehabt, sei in eine Schiesserei geraten. Vor Gericht nützten ihm diese schwer überprüfbaren Aussagen nichts. Zusätzlich zur mittlerweile abgesessen Zeit im Knast heisst es: 10 Jahre Landesverweis.
Zum «Tagesanzeiger» sagt der Rapper, der nun in Albanien leben soll: «Ich habe diesmal ganz abgeschlossen mit der Schweiz.» Zurückkehren in die Schweiz, in das Land, in dem er aufwuchs, in dem sein Sohn aufwächst, werde er auch nach den zehn Jahren nicht mehr. Schreibt Blick.
Der Begriff «Rapper» / «Rapperin» verkommt durch kosovarische Möchtegern-Künstler*innen, die mehr den kriminellen Intuitionen von Raub und Betrug als der musikalischen Begabung folgen, zum Unwort.
Räuber-Rapper Besko und die Luzerner «Rapperin» Loredana sind nur zwei der «prominenten» Aushängeschilder für diese importierte Verkommenheit und kriminelle Energie aus dem Balkan.
Dass der Kosovare Besko nicht mehr in die Schweiz zurückkehren will, ist ein guter Entscheid und sicher kein Verlust für die Schweiz. Es bleibt zu hoffen, dass er bei diesem Entschluss bleibt.
Dass SRF über einen kriminellen Kosovaren eine aufwändige und teure Doku dreht, spricht nicht für den Räuber-Rapper, dafür aber umso mehr gegen SRF.
-
10.2.2022 - Tag des Schweizer Mundart-Gangsta-Raps
Immer mehr Schweizer Kinder können nur ungenügend Deutsch
Im Kanton Baselland sollen auch Kinder von Schweizer Eltern zur sprachlichen Frühförderung verpflichtet werden können. Das wäre ein Schweizer Novum. Experten begrüssen diesen Schritt.
Ein Satz aus der Mitteilung zur Vernehmlassung eines neuen Gesetzes über die sprachliche Frühförderung im Kanton Baselland lässt aufhorchen. «In den letzten Jahren hat die Anzahl der Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen stark zugenommen, sowohl unter Kindern fremdsprachiger Herkunft als auch unter Schweizer Kindern.» Nach der Einschulung benötigen inzwischen rund 20 Prozent der Kinder Förderunterricht in «Deutsch als Zweitsprache». Ein steigender Anteil der Kinder dieses Förderangebots hat aber Deutsch als Muttersprache. Das zeigen Daten des Statistischen Amts Baselland.
«Sprachliche Frühförderung ist kein reines Migrationsthema», sagt Thomas Nigl, der zuständige Projektleiter für die frühe Sprachförderung bei der Baselbieter Sicherheitsdirektion. Das sei bis jetzt wohl unterschätzt worden. So ist die Sprachstanderhebung im Kanton Basel-Stadt, wo die sprachliche Frühförderung seit 2013 obligatorisch ist, allerdings nur für fremdsprachige Eltern verpflichtend. Kinder aus deutschsprachigen Haushalten fallen dabei durch die Maschen. Was der Kanton Baselland plant, ist darum ein Novum in der Schweiz.
Das Gesetz sieht vor, dass Gemeinden Eltern verpflichten können, dass ihre Kleinkinder unmittelbar vor dem Kindergarten einen erweiterten Grundwortschatz lernen. Die Kosten für die obligatorische Sprachförderung tragen die Gemeinden. Allerdings sollen diese autonom entscheiden können, ob und wie sie die frühe Sprachförderung umsetzen wollen.
Behindern Handys und Tablets die sprachliche Entwicklung?
Der Schweizer Lehrerverband begrüsst den Baselbieter Ansatz. «Die frühe Sprachförderung ist ein zentraler Aspekt einer ganzheitlichen frühen Förderung. Sie ist für alle Kinder wichtig – nicht nur für fremdsprachige», sagt LCH Zentralsekretärin Franziska Peterhans. Die zunehmenden sprachlichen Defizite bei Kindern führt sie auch auf den immer früheren Kontakt mit digitalen Medien zurück. «Kinder verbringen zunehmend viel zu viel Zeit vor Tablets und anderen digitalen Medien», sagt sie. «Für die Sprachentwicklung brauchen Babys und kleine Kinder, aber Menschen, die mit ihnen sprechen und denen sie etwas erzählen können.» Die Sprache zu hören, reiche nicht.
Auch Experten und Expertinnen finden das sinnvoll. Soziale Unterschiede sollte man möglichst früh angehen, sagt Hansjakob Schneider, Professor für Deutschdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. «Sonst ist die Idee der Chancengleichheit nur auf dem Papier da.» Die vorschulischen Bildungserfahrungen seien entscheidend, sagt Dieter Isler, Professor für Erziehungswissenschaften und Deutsch an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Es gehe weniger um das fehlende Deutsch, sondern um die Gesprächs- und Bildungskultur im Alltag. «Darum muss sprachliche Frühförderung unbedingt alle erreichen», unterstreicht er.
«Es wurde höchste Zeit, dass etwas passiert», sagt die Baselbieter SP-Präsidentin Miriam Locher. Die Kindergartenlehrkraft kämpft schon seit fast zehn Jahren für dieses Anliegen. Sie kennt die Problematik aus der Praxis. «Ich konnte im Verlauf der letzten 15 Jahre beobachten, dass immer mehr Kinder in der Kommunikation auffällig sind. Oft herrschen Sprachauffälligkeiten, sei es in Bezug auf Probleme beim Sprachverständnis, beim Wortschatz, der Aussprache oder der Grammatik», sagt sie. «Und das betrifft nicht nur Kinder mit einem Migrationshintergrund.»
Wohnort darf nicht entscheidend sein
In Baselland soll die Frühförderung freiwillig sein. Gemeinden sollen aber Obligatorien einführen können, müssen aber nicht einmal ein Angebot bereitstellen. Das könne nicht sein, findet Landrätin Locher. «Einmal mehr ist so der Wohnort ausschlaggebend für die Bildungschancen von Kindern, das ist nicht tragbar», sagt sie. Der Wohnort ist schon jetzt ein Grund für ungenügende Deutschkenntnisse. Bildungsferne Familien seien schon jetzt oft räumlich abgetrennt, sagt Hansjakob Schneider. «In diesem Umfeld fehlt Kindern der Kontakt zu einem bildungssprachlich anregenden Spielumfeld.» Schreibt 20Minuten.
Es ist eigentlich ganz normal, dass auch Sprachen dem Wandel der Zeit unterworfen sind. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Naturgesetze funktionieren nun mal so. Lesen Sie ein paar Originaltexte von Goethe, Schiller oder Curzio Malaparte und Sie wissen, wovon wir hier sprechen.
Kein Drama. Interessant zu beobachten ist lediglich die Richtung, in welche sich Sprachen unter verschiedenen Einflüssen entwickeln.
Auch die Weltsprache «US-Englisch» hat sich innerhalb der letzten 50 Jahren stark verändert. Da mag der «American Way Of Life» mit bildungsfernem Non-Stop-TV-Konsum seinen Teil dazu beigetragen haben. Aber auch neue Sprachwendungen, vor allem aus der Rap- und Hip Hop-Musik sowie die Digitalisierung leisteten da sicherlich ihren Beitrag.
Auch beim Schweizer Mundart-Dialekt hat sich unter dem Einfluss der gewaltigen Zuwanderung aus dem Balkan in die deutschsprachigen Länder Europas ein furchtbarer Bronx-Slang, oder, wie Harald Schmidt zu sagen pflegte, «Unterschichten-Slang» entwickelt. Eine Mischung aus Gangstarap, Proleten-Deutsch und (vorwiegend) Albanisch mit gutturalen, verschluckten Kehllauten. Grauenhaft.
Irgendwie aber auch verständlich. Immerhin stellt der Kosovo sowas wie den 27. Kanton der Schweiz dar.
Kein Wunder schicken vermögende Eltern ihre Kinder inzwischen in Privatschulen, um ihre kleinen Scheisserchen und künftigen Mitglieder der Oberschicht vor dieser abstossenden Sprachentwicklung zu beschützen.
«Yo Män, figg di in Arsch» tönt ja wirklich nicht so toll in den höheren Kreisen zwischen Bundeshaus und obersten Konzernetagen.
In Fussballkreisen und an der MIGROS- oder ALDI-Kasse spielt die Kombination von Schweizerdeutsch und albanischem Hooligandialekt eher eine untergeordnete Rolle. Und dort landen vermutlich sowieso die meisten der «Unterschichten-Slang»-Kids. Mit etwas Glück werden Sie wie Xherdan Shaqiri trotz mangelnder Durchsetzungsfähigkeit von Chicago Fire engagiert.
Such is Life.
-
9.2.2022 - Tag der unbedarften Skirennfahrerin Gisin
«Keine Horror-Geschichten»: Gisin stört sich an den vielen negativen Medienberichten
Die Kritik an den Olympischen Winterspielen in China ist gross. Michelle Gisin (28) kann sie in ihrer Masse nur teilweise verstehen.
Ob Sommer- oder Winterspiele, Michelle Gisin (28) liebt Olympia. Das war schon immer so. «Ich muss aufpassen, dass ich mich dem Ganzen nicht zu sehr hergebe, um die Emotionen unter Kontrolle zu haben», sagt sie denn auch. Umso mehr machte es ihr zu schaffen, dass in den Zeitungen und auf Onlineportalen vor allem im Vorfeld der Spiele in Peking viel Negatives stand.
«Es hat sehr viele Nebenschauplätze gegeben. Ich verstehe das einerseits. Anderseits ist es Olympia. Wir sind hier, alle Athleten haben mega hart trainiert und freuen sich.» Es sei schade, dass so viel darüber diskutiert werde, was alles schlecht sei. «Das hat mich ein wenig genervt. Man könnte auch sagen, wie cool es ist, dass wir zu Pandemie-Zeiten überhaupt Winterspiele haben», so die Engelbergerin.
Keine Horror-Geschichten
Gisin hofft, dass nun der Fokus mehr auf den Sport gelegt werde. «Beat und Lara haben die Initialzündung dafür gegeben. Was sie gezeigt haben, ist genial», so die Kombi-Olympiasiegerin von 2018.
Etwas will Gisin dann auch noch loswerden: «Vieles läuft hier besser als die Horror-Geschichten, die man uns im Vorfeld erzählt hat und die in den Medien standen. Auch die Corona-Tests sind kein Problem. Klar, man hofft immer, dass man negativ ist. Aber alle sind sich bewusst, dass es keine Garantien gibt.» Schreibt Blick.
«Dumm ist der, der Dummes tut». So das legendäre Zitat aus dem Hollywood-Blockbuster «Forrest Gump».
Um Dummheiten im Blick abzusondern, muss man nicht unbedingt dumm sein. Es genügt auch, die Welt, in diesem Fall den Unrechtsstaat China, mit dem begrenzten Tunnelblick einer Skirennfahrerin zu betrachten.
Es mag ja sein, dass für Frau Gisin an der Winterolympiade in China alles in Butter ist. Ausschliesslich künstliche Schneepisten, Halfpipes und Rodelbahnen inmitten einer grau/braunen Landschaft, die normalerweise mit maximal zwei Zentimetern Schnee bedeckt ist, wenn überhaupt, stören kein unbedarftes Sportler- und Sportlerinnenherz.
Möge das Klima und ein extra für die Olympiade gerodetes Naturschutzgebiet durch gigantische Umweltvergehen vor die Hunde gehen, who cares? The show must go on.
Dass in China so vieles viel besser läuft als in den laut der Skirennfahrerin von der Presse verbreiteten «Horror-Geschichten», sehen die in Umerziehungslagern eingesperrten Uiguren wohl etwas anders als Frau Gisin.
-
8.2.2022 - Tag der Gastro-Hierarchie
Gas-Pipeline Nord Stream 2: Biden geht langsam die Geduld mit Berlin aus
Der Auftritt im Weissen Haus war betont freundschaftlich: Joe und Olaf gaben sich das Du. Und Bundeskanzler Olaf Scholz tat alles rhetorisch Mögliche, um jüngste Zweifel an der deutschen Loyalität gegenüber den USA und der NATO zu zerstreuen.
«Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren», sagt Scholz dazu. Deutschland sei total verlässlich, sagte Präsident Joe Biden. Daran habe er keine Zweifel.
Biden droht mit Ende der Gas-Pipeline
In Bezug auf die Grundstrategie in der Ukraine-Krise sind sich Berlin und Washington einig: Den Dialog mit Moskau weiterführen und gleichzeitig mit harten Massnahmen drohen.
Doch im «Pas de deux» von Biden und Scholz gab es einen Stolperer. Der deutsche Bundeskanzler wollte die Gas-Pipeline Nord Stream 2 partout nicht erwähnen. Derweil erklärte der US-Präsident bereitwillig, bei einem russischen Einmarsch würden die USA die Gas-Pipeline nach Deutschland stoppen.
Angeknackste Harmonie
Und als eine Journalistin fragte, wie er denn ein deutsch-russisches Projekt stoppen würde, doppelt Biden nach, dass die USA es definitiv durchziehen würde.
Präsident Biden markierte damit klar, dass ihm punkto Gas-Pipeline die Geduld mit Berlin langsam ausgeht. Seine Regierung steht innenpolitisch in der Kritik, zu lange zu viel Rücksicht auf die deutschen Energieinteressen genommen zu haben. Und das ist die weniger harmonische Botschaft an den deutschen Gast. Schreibt SRF.
Der Hegemon zeigt seinem Vasallen einmal mehr, wer Koch und wer Kellner im Gasthaus zur «hehren westlichen Wertegemeinschaft» ist.
-
7.2.2022 - Tag des Zombie-Journalismus
Die Queen, das Messer und ein ziemlich guter Witz
Bei einem Empfang zu ihrem Platinjubiläum hat die britische Königin Elizabeth II. für einen kurzen Schreckmoment gesorgt – dem alsbald erleichtertes Lachen folgte.
Seit 70 Jahren sitzt Elizabeth II. auf dem britischen Thron. Das Platinjubiläum hat die Queen bereits am Vorabend, dem Samstag, auf ihrem Landsitz Sandringham gefeiert – und eine große Portion Humor bewiesen.
Zu dem Empfang waren Menschen aus der Region geladen, die sich in Wohltätigkeitsorganisationen engagieren. Einen äußerst amüsanten Moment erlebte die Runde, als die 95-jährige Monarchin den Kuchen anschneiden sollte.
Die Queen nahm das große, silberne Messer in die Hand und stach es von oben in die Mitte des Kuchens, beinahe im Stil eines Messermörders. »Ich denke, ich stecke nur das Messer rein«, sagte Elizabeth – und tat genau das. Jemand anderes könne den Rest machen, sagte sie lächelnd. So ist es auf einem Video zu sehen, das die Royal Family auf Twitter gepostet hat.
Auf anderen Fotos in den sozialen Netzwerken ist auch die Frau neben der Königin zu sehen, die mit einem verwunderten Gesichtsausdruck die Szene mit dem Messer verfolgt.
Offiziell feiert die Queen ihr 70-jähriges Jubiläum auf dem Thron an diesem Sonntag. Es ist das erste Mal, dass die Monarchin den Jahrestag ohne ihren im vergangenen Jahr verstorbenen Mann Prinz Philip begehen muss.
Elizabeths Vater Georg VI. war am 6. Februar 1952 gestorben. Dadurch wurde seine älteste Tochter zur Königin. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Schreibt DER SPIEGEL.
Witz komm raus! In Zeiten der atemlosen kriegslüsternen Berichterstattung unserer Qualitäts-Medien tut einem so ein nichtssagender Zombie-Artikel aus dem Zombie-Königreich mit einer Zombie-Queen und einem Zombie-Premierminister richtig gut.
Es lebe der Zombie-Journalismus, den zwar niemand ausser den Coiffeurstuben braucht, der aber auch niemandem weh tut.
-
6.2.2022 - Tag der pästlichen Fleischhauer
Papst Franziskus wollte als Kind Fleischhauer werden
Papst Franziskus hat als exklusiver Gast in der von "Rai 3" gesendeten Talkshow "Che tempo che fa" auf einige persönliche Fragen des Moderators Fabio Fazio geantwortet. Auf die Frage, ob er sich einsam fühle und ob er Freunde habe, antwortete Franziskus: "Ich brauche Freunde. Das ist ein Grund, der mich bewogen hat, nicht im Apostolischen Palast zu leben. Das ist ein einfacheres Leben für mich. Freunde geben mir Kraft. Ich habe wenige, aber echte Freunde."
Der Papst sprach auch von seiner Liebe für Musik. Er liebe Klassiker und Tango. Er bestätigte, dass er als Jugendlicher auch Tango getanzt habe. Man sei kein Bewohner Buenos Aires', wenn man nicht Tango tanze, scherzte der Papst. In den vergangenen Wochen hatte Franziskus ein Plattengeschäft im Zentrum von Rom besucht. Er habe das renovierte Geschäft in Besitz von guten Bekannten gesegnet. Er hatte diesen Besuch privat halten wollen, doch ein Journalist, der vor dem Geschäft auf ein Taxi wartete, habe ihn erkannt und gefilmt, berichtete Franziskus.
Berufswunsch Fleischhauer
Als Kind wollte er Fleischhauer werden. Mit seiner Großmutter sei er oft zum Markt gegangen. Der Fleischhauer habe stets Geld in eine Tasche gesteckt, daher wollte er Fleischhauer werden, scherzte Franziskus. Später habe er sich intensiv mit Chemie befasst und auch in einem Labor gearbeitet. "Ich hatte mich auf das Medizinstudium vorbereitet, doch mit 19 Jahren kam die Berufung und ich bin einem Seminar beigetreten", betonte Franziskus im Interview, das etwa 50 Minuten dauerte.
Auf die Frage, wie er sich die Kirche der Zukunft vorstelle, antwortete der Papst, er denke an eine "Kirche auf dem Pilgerweg". "Das Übel der Kirche ist die Weltlichkeit. Klerikalismus ist die Perversion der Kirche. Die spirituelle Weltlichkeit schafft Klerikalismus, die zu ideologischer Starrheit führt. Ideologie ersetzt dann das Evangelium", erklärte der Pontifex.
Interview mit populärem Journalismus
Der Heilige Vater hatte kürzlich in einem Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" bekanntgegeben, dass ihn ein Artikel Fazios beeindruckt habe. Darin hatte der Journalist zusammengefasst, was er in dieser Pandemie-Zeit gelernt habe. Daraufhin hatte sich der Papst mit Fazio in Verbindung gesetzt und das Interview organisiert. Franziskus hatte Fazio bereits im September 2019 in der Stadt Frosinone südlich von Rom getroffen, als er den Sitz der katholischen Bewegung "Nuovi orizzonti" besucht hatte. Fazio ist seit langem ein Mitglied dieser Bewegung.
Fazio dankte dem Papst. "Ich kann nicht beschreiben wie ich mich fühle und werde es auch gar nicht versuchen", sagte der 57-jährige Fazio. "Die Tatsache, dass er sich bereit erklärt hat, sich an einer Show zu beteiligen, bezeugt wieder einmal, wie sehr er mit den Menschen kommunizieren will", sagte der Moderator, der zu Italiens populärsten TV-Journalisten zählt. Seit Jahren moderiert Fazio die von ihm produzierte Talkshow "Che tempo che fa", die seit jeher der RAI am Sonntag hohe Einschaltquoten beschert. In den vergangenen Monaten hatte Fazio Stargäste wie Bill Gates und Lady Gaga interviewt.
Medienwirksamster Papst
Aktuell ist Franziskus der medienwirksamste Papst in der Geschichte der Kirche. Im Jänner 2021 hatte der Papst Canale 5, dem stärksten italienischen Privatsender im Besitz von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi, ein exklusives Interview gegeben. Dabei hatte er unter anderem die Gläubigen aufgefordert, sich impfen zu lassen. Das Interview war von 5,4 Millionen Zuschauern gesehen worden.
Die Liste der schriftlichen, Audio- und Fernsehinterviews des Papstes ist sehr lang. Hinzu kommen die Bücher, die er geschrieben hat, oft im Frage-Antwort-Format. Dann gibt es noch die Vorworte zu Büchern, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen befassen. Schreibt DER STANDARD.
Herrlich! Der Fleischhauer habe stets Geld in eine Tasche gesteckt, daher wollte er Fleischhauer werden, scherzte Franziskus.
Dieses Ziel, das laut Franziskus so erstrebenswert ist, hat er auch als Oberhaupt der katholischen Kirche definitiv erreicht. Allerdings mit etwas anderen Dimensionen.
-
5.2.2022 - Tag der Putinversteher
Ukraine-Krise und Europa: Bundespräsident Cassis erhält Post aus Russland
Moskau will von den OSZE-Ländern wissen, wo sie stehen – dazu gehört auch die Schweiz. Das EDA trifft Abklärungen, setzt für Gespräche aber auf die OSZE.
Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat Bundespräsident Ignazio Cassis einen Brief geschickt, wie ein EDA-Sprecher einen Bericht des «Tages-Anzeigers» bestätigt.
Darin habe Lawrow die russischen Vorstellungen einer europäischen Sicherheitsordnung erklärt. Zudem wolle Russland wissen, wie die Schweiz zur Sicherheit in Europa und zur Nato-Osterweiterung stehe.
Verzicht auf Nato-Erweiterung gefordert
Russland veröffentlichte am Freitag zusammen mit China eine Erklärung, in welcher die Länder ein Ende der Osterweiterung und damit einen Verzicht auf Aufnahme der Ukraine ins Militärbündnis fordern.
Lawrow hatte daraufhin den Aussenministern der Mitgliedsländer der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einen Brief geschickt.
Im Brief fordert Lawrow die Aussenminister auf, Antworten auf Moskaus Fragen zur Sicherheit in Europa zu geben. Insbesondere sollten sie erklären, wie das Prinzip der «unteilbaren Sicherheit» in Europa gewährleistet werden solle. Gemeint ist damit, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der Interessen eines anderen Staates gewährleistet werden dürfe.
EDA nimmt Rücksprache mit OSZE
Das EDA habe die Sichtweise im Brief zur Kenntnis genommen und werde Abklärungen vornehmen, teilt der EDA-Sprecher mit. In der Regel würden Schreiben an den Bundespräsidenten individuell beantwortet.
Im Brief gehe es aber um Beschlüsse der OSZE. Die OSZE sei daher die geeignete Plattform, um die russischen Anliegen zu besprechen.
Gemäss EDA will der polnische OSZE-Vorsitz nächste Woche einen Dialogprozess beginnen. Die Schweiz unterstütze dieses Vorgehen.
Russland hatte zuvor einen Forderungskatalog an die Nato und die USA gerichtet. Diese lehnen die Kernanliegen Russlands ab, haben aber in schriftlichen Antworten einen Dialog angeboten. Darauf wiederum stehe die russische Antwort noch aus, wie der Kreml klargestellt hatte.
Zehntausende Soldaten aufmarschiert
Angesichts westlicher Berichte über einen Aufmarsch von mehr als 100'000 russischen Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Moskau bestreitet das.
Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. Schreibt SRF.
Putin führt einen Check durch, wo all die «Putinversteher» zu finden sind. Der russische Diktator will Klarheit. Frei nach dem Motto «Wer nicht für mich ist, ist gegen mich».
Man darf sich jetzt schon auf das schriftliche Geiere und Geschleime von Bundespräsident Cassis freuen und rätseln, wie er den Schweizer Eiertanz auf allen Hochzeiten salbungsvoll kreieren wird, um ja niemandem zu nahe zu treten.
Wie sagte der am 1. Februar verstorbene Endo Anaconda von «Stiller Has» so schön wie auch treffend: «Man muss nicht reich und berühmt sein. Es genügt, wenn man intelligent ist.»
Berühmt ist Cassis schon. Ob er auch intelligent ist, muss er erst noch beweisen. Um bei der FDP ein hohes Amt zu ergattern, muss man ja nicht zwangsweise intelligent sein.
Rosarote oder Regenbogenfarbige Fogal-Strümpfe reichen zur Not auch, wie die Luzerner Bevölkerung bei den Ständeratswahlen 2019 feststellen konnte.
-
4.2.2022 - Tag der Olympischen Ringe, an denen so viel Blut klebt
Die Kommerz- und Entertainmentmaschinerie des Olympischen Komitees läuft auf Hochtouren. China eröffnet heute offiziell die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird sich im «Vogelnest», dem von den Schweizer Architekten Herzog und de Meuron (Basel) erstellten «Nationalstadion Peking», mit einer glühenden Rede und dem Beifall des Olympischen Komites in Szene setzen.
Ausgeschlossen sind eine Million im «Umerziehungs-Camp» eingesperrte Uiguren. Vielleicht auch zwei Millionen, so genau weiss das im Überwachungsstaat China niemand und diejenigen die es wissen, sagen es nicht.
Was wir heute salopp «Camp» nennen, hiess unter Hitler noch «Konzentrationslager», in denen nach Beginn des Zweiten Weltkriegs mehr als sechs Millionen Frauen, Männer und Kinder jüdischen Glaubens in Gaskammern hingerichtet wurden.
Und so wie damals unsere Vorfahren aus vorwiegend kommerziellen Gründen mit einer Appeasement-Politik den Anfängen im nationalsozialistischen Unrechtsstaat nicht Einhalt geboten, schaut die hehre westliche Wertegemeinschaft auch diesmal aus rein wirtschaftlichen Gründen zu. Genozide wie der Holocaust an den Juden kommen nicht über Nacht. Die werden mit langer Hand vorbereitet. Was mit Zwangsarbeit und Umerziehung in Lagern beginnt, endet in Verbrennungsöfen.
Auch Hitler liess sich an den Olympischen Spielen (Winterspiele 1936 in Garmisch Partenkirchen, Sommerspiele 1936 in Berlin) bombastisch abfeiern. Unzählige Videos auf YouTube legen Zeugnis ab, wie die Bilder von damals den heutigen gleichen. So wie Hitler von der Einheitspartei NSDAP ist auch der chinesische Diktator Xi Jinping von der kommunistischen Einheitspartei Chinas auf Lebzeiten gewählt.
Hitler brachte rund fünf Millionen Arbeitslose innerhalb vier Jahren zurück in bezahlte Arbeitsverhältnisse, Xi Jinping befreite ein paar Hundert Millionen Chinesen aus der Armut. In beiden Diktaturen bezahlten Millionen von Menschen einen sehr hohen Preis dafür.
Amerika wollte seinerzeit die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin und damit die Selbstinszenierung und Imagepflege des NS-Regimes boykottieren. Doch gegen das Olympische Komitee war selbst die US-Regierung machtlos. (Kann man nachlesen; Google hilft weiter.)
Vergleichen heisst nicht gleichsetzen, auch wenn die Gemeinsamkeiten der deutschen Diktatur mit derjenigen der Chinesen erschreckend sind. Dennoch hätten wir uns schon ein paar Gedanken jenseits von Wirtschafts- und Entertainmentinteressen machen dürfen, ob uns ein paar beschissene Medaillen tatsächlich wichtiger sind als das Leid und Brainwashing einer ganzen Volksgruppe, die unter anderem auch wegen ihres muslimischen Glaubens verfolgt wird.
Die kanadische Regierung spricht längst von einem Genozid, der vor unseren Augen im Land des Lächelns stattfindet. Den Uiguren ist das Lächeln allerdings längst vergangen.
Eines ist jetzt schon gewiss: Historiker werden in ein paar Jahrzehnten ein vernichtendes Urteil über die Politiker*innen der hehren westlichen Wertegemeinschaft abgeben.
-
3.2.2022 - Tag der weissen Socken aus dem Aargau
Rätselhaftes Lebenszeichen aus Karibik: Aargauer seit 18 Jahren verschwunden – meldet sich und verschwindet wieder
2003 meldete sich Damian R. an seinem Wohnort ab. 18 Jahre lang fehlt danach jede Spur von ihm – auch seine Familie weiss nicht, was passierte. Vergangenen Sommer plötzlich dann ein Lebenszeichen, doch als dem nachgegangen wird, taucht der Aargauer wieder ab.
Vor 18 Jahren verschwand Damian R.* (55) spurlos. Ohne Frau oder Sohn darüber zu informieren. Im Sommer 2003 liess er sich einen neuen Pass ausstellen, meldete sich an seinem Aargauer Wohnort ab und tauchte unter. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».
Es wurde eine Vermisstmeldung herausgegeben, die Polizei suchte nach ihm. Auch international wurde nach dem Schweizer gefahndet. Vergeblich. Die Familie wusste nicht einmal, ob er noch lebte.
2010, sieben Jahre nach seinem Verschwinden, reichten die Zurückgelassenen eine Verschollenerklärung ein, weil sie nur so Anrecht auf das Erbe des kurz zuvor gestorbenen Vaters von Damian R. hatten. Niemand wusste, wo er abgeblieben war. Und ob er überhaupt noch am Leben war. Und so wurde R. im Sommer 2013 als verschollen erklärt.
Eine Verschollenklärung ersetzt im Prinzip die Feststellung des Todes einer Person. Man geht dann davon aus, dass eine Person gestorben ist, der Leichnam aber nicht gefunden wird. Der bekannte Schweizer Umweltaktivist Bruno Manser etwa gilt seit 2005 als verschollen.
Plötzlich ist er wieder da – oder doch nicht?
Doch im Gegensatz zum Umweltaktivisten tauchte Damian R. plötzlich wieder auf. Jedenfalls amtlich. Im Juli 2021 wurde ein Antrag auf Aufhebung der Verschollenenerklärung gestellt und im Amtsblatt publiziert. Der Antragsteller: Damian R.!
Als Adresse wurde die Schweizerische Botschaft in der Dominikanischen Republik genannt. Wo der Aargauer wohnte, gab er allerdings nicht an. Doch als ihn das Gericht erreichen wollte, war R. wieder verschwunden. Er meldete sich laut «Aargauer Zeitung» nicht mehr – trotz mehrer Aufforderungen.
Das Bezirksgericht Baden entschied vor wenigen Wochen, die Verschollenerklärung nicht aufzuheben. Auch, weil Damian R. einen Kostenvorschuss hätte bezahlen müssen, was er nicht tat.
Bedeutet: Der Aargauer gilt offiziell weiter als verschollen. Und weiterhin wird gerätselt, was mit ihm passiert ist. Und wieso er im Sommer 2003 plötzlich verschwand. Schreibt Blick.
Als rechte Hand von Inspektor Columbus («Eine Frage hätt' ich noch, Sir») vermute ich, dass Bill Gates hinter dem Verschwinden des Aargauers steckt. Alles halb so wild. Untote mit weissen Socken sind im Aargau ohnehin keine Seltenheit. In der Karibik allerdings schon.
Für die «weissen Socken» werde ich von meinem lieben Freund Res sicher gemassregelt, so wie er mir zu meinen Bemerkungen zur Abstimmung über die Medien-Bundesgiesskanne die Leviten gelesen hat.
Aber die Medien-Giesskanne ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich Euch, liebe Liebende, dann morgen.
Das ist doch mal ein Cliffhanger, wie wir Schriftgelehrten und Drehbuchautorenam Sunset Boulevard in Hollywood zu sagen pflegen.
Finden Sie auch, dass ich manchmal, aber wirklich nur manchmal, einen leichten Hang zum Übertreiben habe? Sagen Sie es mir ruhig. Ich bin hart im Nehmen.
Spürt Ihr, wie gut ich heute drauf bin? Das muss die Sonne sein, die derzeit in der schönsten Schweizer Stadt – kann ja nur Luzern sein, oder? – scheint, als ob die Stadt der Dichter, Denker und Leuchten ein Teil der Insel Madeira wär', die übrigens nicht zu Malaga gehört, wie mich gestern das wandelnde Lexikon Res belehrt hat.
-
2.2.2022 - Tag der Historiker und Hysteriker
Brisante VBS-Dokumente: Bomben auf Tschechien: die Kriegsszenarien der Luftwaffe
Ein Angriff auf die Schweiz steht unmittelbar bevor. Um die Attacke zu verhindern, steigen schwer bewaffnete Schweizer Kampfjets in den Himmel. Sie sollen gegnerische Ziele im Ausland bombardieren: Etwa eine Brücke und einen Flugplatz.
Diese fiktiven Kriegs-Missionen sind in internen Dokumenten der Rüstungsbehörde Armasuisse beschrieben. Es sind Aufgaben, die die Kampfjet-Hersteller im Auswahlverfahren bewältigen mussten. Laut Dokumenten, um die Waffensysteme und Missionstauglichkeit der Flieger zu testen.
Fiktive Angriffe auf Nachbarstaaten
Vier Szenarien mussten die Kampfjet-Hersteller technisch beschreiben und im Simulator fliegen: «Konferenzschutz», «Luftverteidigung», «Luftaufklärung» sowie «Bekämpfung von Bodenzielen».
Die Aufgaben enthalten gerundete Koordinaten. «SRF Investigativ» hat sie ausgewertet. Die letzten zwei Szenarios führen ins Ausland; nach Süddeutschland, Österreich und Tschechien. Um einen Krieg zu verhindern, so die Aufgabe, müssen die Kampfjets Informationen über militärische Ziele sammeln und präventiv angreifen.
Das weiteste Ziel liegt 370 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt in Tschechien. Dort sollen die Kampfjets einen Flughafen und den gegnerischen Kommandanten-Konvoi bombardieren.
«Das ist ausserordentlich heikel, weil wir ins Licht eines Angreifers kommen.»
Roland Beck, Militärhistoriker
Die Armee will künftig wieder Bodenziele aus der Luft bekämpfen können. In Zeiten von Krieg sollen damit die Bodentruppen unterstützt werden. Im Strategiepapier «Luftverteidigung der Zukunft» steht zwar, der neue Kampfjet diene dazu, Ziele in der Tiefe des gegnerischen Raums anzugreifen. Dass aber auch Präventivschläge denkbar sind, wird erst mit den internen Szenarien deutlich.
Roland Beck, Oberst im Generalstab a.D. und Militärhistoriker sagt dazu mit Blick auf die neutrale Rolle der Schweiz: «Das ist ausserordentlich heikel meiner Meinung nach, weil wir ins Licht eines Angreifers kommen und unsere Grundphilosophie ist: Wir verteidigen.»
Präventivschläge im Ausland hält Peter Hug, ehemaliger sicherheitspolitischer Berater der SP, für «bizarr». Und: «Man bekäme im Stimmvolk nie eine Mehrheit für einen Kampfjet, wenn man offen deklarieren würde, dass man weit ausserhalb der Schweiz Bodenziele bombardieren will.»
Präventivschlag zur Landesverteidigung?
Im Bundeshaus lösen die Szenarien unterschiedliche Reaktionen aus: Für FDP-Präsident Thierry Burkart gibt es im Kriegsfall keine Neutralität mehr: «Dann muss man alle möglichen Missionen durchführen, die dem Schutz des Landes dienen. Dazu gehören auch Präventivschläge, wenn damit Schläge gegen die Schweiz verhindert werden können.»
SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf hingegen hatte «immer Angst, dass es im VBS tatsächlich solche Vorstellungen geben könnte». Sie sei schockiert, denn: «Wir haben eine Armee für den Verteidigungsfall, keine Angriffsarmee.»
Mit den Recherchen von «SRF Investigativ» konfrontiert erklärt das VBS, die Szenarien entsprächen den vier Einsatzarten, welche das neue Kampfflugzeug gemäss Anforderungen abdecken soll. Aber: «Die Szenarien haben nichts mit der realen sicherheitspolitischen Lage und Entwicklung zu tun.» Es handle sich um eine rein technische Betrachtung der Fähigkeiten. «Zweck dieser fiktiven Szenarien war es, den Herstellern die Gelegenheit zu geben, die gesamte Leistungsfähigkeit ihrer Kampfflugzeuge aufzeigen zu können.»
«Die Szenarien haben nichts mit der realen sicherheitspolitischen Lage zu tun.»
Kommunikation VBS
Dies sei auch der Grund, warum das VBS die Szenarien nicht publiziere: «Szenarien bergen immer die Gefahr, missverstanden zu werden.» Das VBS informiere seit Jahren transparent darüber, wofür die Kampfflugzeuge eingesetzt werden sollen. Schreibt SRF.
«SRF Investigativ» tönt gut, ist aber in diesem konkreten Fall eine aufgebauschte Label-Lachnummer mit Blick auf die «neutrale» Reduit-Strategie vergangener Zeiten und maximal tauglich als Kanonenfutter für die GSOA und den üblichen Verdächtigen.
Über die Kontroverse, ob sich die Schweiz eine Armee leisten soll oder nicht, wurde am 26.11.1989 anlässlich der Volksabstimmung «Schweiz ohne Armee» an der Urne ein eindeutiges Votum der Schweizer Bevölkerung abgegeben: 64,4 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für eine Armee, 35,6 Prozent lehnten sie ab.
Dass sich die SP empört, war anzunehmen. Viel mehr als Empörungsgejodel ist von dieser lächerlichen Partei ohnehin nicht zu erwarten. Dass aber der Militärhistoriker und ehemalige Generalstabsoffizier Roland Beck ins gleiche Horn wie die SP bläst, lässt vermuten, dass er seinen Titel «Militärhistoriker» wohl in einem M-Budget-Kurs in der MIGROS erworben hat. Oder der ehemalige Herr Oberst iGst ist fälschlicherweise im Kurs der Hysteriker gelandet.
Würde unsere Luftwaffe für den Ernstfall einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht alle möglichen Szenarien durchdenken und die verfügbaren Optionen prüfen, könnte man sie wirklich abschaffen. Und dass die Schweiz an der Seite ihrer Verbündeten im Kriegsfall die Neutralität aufgeben muss, ist mehr als nur logisch. Wo der FDP-Präsident Thierry Burkart recht hat, hat er recht.
Nochmals die Bank für ein Unrechtsregime zu spielen, um vom Kriegsgeschehen verschont zu bleiben wie im zweiten Weltkrieg, dürfte im 21. Jahrhundert wohl kaum mehr möglich sein.
-
1.2.2022 - Tag der Kriegstreiber
Warnung aus den USA: Russland schickt laut Pentagon weitere Truppen an die ukrainische Grenze
Zehntausende russische Einheiten stehen schon nahe der Ukraine bereit – und am Wochenende sind laut US-Angaben noch weitere hinzugekommen. Auch auf See verstärkt der Kreml demnach seine Präsenz.
Die Lage an der Grenze zur Ukraine ist seit Wochen höchst angespannt – und die nun gemeldeten Truppenbewegungen dürften wenig dazu beitragen, die Situation zu beruhigen.
Russland hat nach Angaben der US-Regierung seine Präsenz in der Krisenregion weiter verstärkt. »Im Laufe des Wochenendes sind weitere russische Bodentruppen in Belarus und an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert«, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag in Washington.
Außerdem beobachte man zunehmende Aktivitäten der Marine im Mittelmeer und im Atlantik. Es handle sich um »nichts Feindliches«, so Kirby. »Aber sie haben mehr Schiffe, sie üben auf See, sie erhöhen eindeutig die Fähigkeiten, die sie auf See haben, wenn sie sie brauchen.«
Mit Blick auf US-Präsident Joe Bidens Ankündigung, wegen der Ukraine-Krise bald zusätzliche US-Truppen in die osteuropäischen Nato-Staaten zu verlegen, sagte Kirby: »Eine Option, die uns zur Verfügung steht, ist der Einsatz von US-Streitkräften, die sich bereits in Europa aufhalten. Man muss nicht unbedingt Truppen aus den USA oder aus anderen Orten einfliegen lassen.«
In Europa sind regulär auch außerhalb von Krisenzeiten Zehntausende US-Soldaten stationiert, darunter rund 35.000 in Deutschland.
Auf Bidens Anordnung hin waren am Montag 8500 Soldaten in den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf eine schnelle Verlegung zu ermöglichen. Kirby betonte, dass es sich dabei um zusätzliche Truppen handele. Der Pentagon-Sprecher machte keine Angaben, wann oder wie viele US-Soldaten wohin verlegt werden sollen. Er betonte aber noch einmal, dass keine US-Soldaten in die Ukraine geschickt würden.
Angesichts eines Aufmarschs von mehr als 100.000 Soldaten in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in die ehemalige Sowjetrepublik plant.
Für möglich wird allerdings auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. Moskau dementiert Pläne zu einem angeblichen Einmarsch.
Schreiben aus dem Kreml an die USA
Die diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise erweisen sich derweil als äußerst zäh. Immerhin haben die USA zuletzt laut eigenen Angaben eine neue schriftliche Antwort der russischen Regierung im Briefwechsel zur Ukraine-Krise erhalten. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte den Erhalt des Schreibens am Montag, ohne näher auf den Inhalt einzugehen. »Wir glauben, dass es nicht produktiv wäre, in der Öffentlichkeit zu verhandeln, daher werden wir es Russland überlassen, über seine Antwort zu sprechen, wenn es das möchte«, erklärte er.
Bei einem neuen Telefonat zu dem Konflikt haben zudem Russlands Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron die Möglichkeit eines persönlichen Treffens ausgelotet. An einer solchen Begegnung werde neben den telefonischen Kontakten gearbeitet, teilte der Kreml am Montagabend in Moskau mit.
SPD ist uneins – und dann ist da noch die Waffenfrage
Macron und Putin hatten erst am Freitag länger miteinander telefoniert. In Paris verlautete dazu aus dem Élysée-Palast, beide Staatschefs hielten am Willen zu einer Deeskalation fest.
Auch in Deutschland sorgen die russischen Aktivitäten für erhebliche Unruhe. Besonders die SPD ringt weiter um einen klaren Kurs in der Russlandfrage.
Außerdem zieht die Bundesregierung in der Debatte über Waffenexporte an die Ukraine einigen Unmut auf sich. Bisher hat Berlin die Lieferung von 5000 Militärhelmen zugesagt – mehr Material soll das Land, trotz der Gefahr einer möglichen russischen Invasion, aus Deutschland vorerst nicht erhalten. Die Kritik aus dem Ausland ist deutlich. Schreibt DER SPIEGEL.
Frei nach Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues!
April 2021 (sic!): «Dass Russland die Fähigkeit besitzt, konventionelle Streitkräfte rasch einzusetzen, hat es zuletzt im Frühjahr dieses Jahres (Anm. 2021!) durch die Verlegung zahlreicher Truppenverbände an seine Westgrenze (Ukraine) demonstriert. Und seine Befähigung zur Cyber-Kriegsführung scheint zuletzt schon mehr als eine permanente Drohgebärde zu sein. Dadurch stellt Russland für den Westen und insbesondere Europa aktuell und in absehbarer Zukunft eine permanente Bedrohung dar.»
Das schrieb nicht etwa DER SPIEGEL, sondern – man höre und staune – das österreichische Bundesheer. Allerdings im Frühjahr 2021!
Nein, Sie sind kein Schelm, wenn Sie über das historisch immer gleiche Spiel der Kriegstreiberei der letzten 100 Jahre nachdenken.
Wieso etwas, was im Frühjahr 2021 längst Tatsache (Anm. mit damals geschätzter Truppenstärke von 170'000 bis 180'000 teilnehmenden Soldaten – je nach Quelle!) war, 2022 zur drohenden Kriegsgefahr hochgeschaukelt wird, wissen wahrscheinlich nur Putin und der «deep state» der vereinigten US-Waffenschmieden.
Anmerkung: Österreich ist nicht NATO-Mitglied. Pflegt aber eine enge Zusammenarbeit mit der NATO im Rahmen der Sicherheitspolitik: Politischer Dialog, militärische und zivile Zusammenarbeit im Bereich friedensunterstützender Massnahmen im Rahmen der Partnerschaften «Partnership for Peace (PfP)» und «Euro-Atlantische Partnerschaftsrat (EAPC)». Quelle: Österreichisches Bundeskanzleramt
-
31.1.2022 - Tag des Alkoholspiegels von Werner Kogler
KOPFTUCHVERBOT-DEAL IM ÖSTERREICHISCHEN PARLAMENT: Kogler spricht von «psychologischen Gründen»
Während die grüne Basis über die geheimen Posten-Abmachungen zwischen der ÖVP und ihrer Bundespartei im Rahmen der Regierungsbildung empört ist, rückt Vizekanzler Werner Kogler nicht von seiner Verteidigungsstrategie ab: Das sei eine übliche Vorgangsweise unter Koalitionspartnern. In diesen Zusatzpapieren stünden neben Arbeitsweisen bei Personalentscheidungen auch noch nicht ganz ausgereifte Projekte. „Wir Grüne waren neu, aber sicher nicht naiv“, meinte Kogler am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“. Zum Kopftuchverbot merkte der Grünen-Chef an: „Der Satz hat keine Auswirkung. Das kommt sowieso nicht.“
Warum dieses eigentlich „wegverhandelte“ Thema dennoch im Zusatzdokument steht? Auf diese Frage von Moderatorin Claudia Reiterer antwortete Kogler, die ÖVP habe ein gesetzliches Kopftuchverbot für Lehrer gewollt, seine Partei aber nicht. Es sei lange verhandelt worden, bis es aus dem offiziellen Teil verschwand. Im „Sideletter“ sei dann ebendiese wieder „aus psychologischen Gründen“ aufgetaucht. „Der Satz hat keine Auswirkung. Das ist ein Nullum“, versicherte der Grünen-Bundessprecher.
Gleichzeitig forderte er die ORF-Moderatorin auf, Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) oder dessen Vorgänger Heinz Faßmann zu fragen, ob denn etwas „in diese Richtung“ unternommen worden sei. „Es wird nicht dazu kommen“, wiederholte Kogler.
Kam „Sideletter“-Leak aus Umfeld von Kurz?
Zu den Absprachen bei Posten im staatsnahen Wirtschaftsbereich und in der Verwaltung meinte Kogler, dass es sich um einen „Vertrag zur Arbeitsweise“ gehandelt habe. Auch als Opposition sei bei den Grünen anerkannt gewesen, „dass immer wer Entscheidungen treffen muss“. Übrigens stehe er zu diesen.
Die „Sideletter“-Causa hat birgt nicht nur das Potenzial für innerparteiliche Turbulenzen, sondern könnte auch für ziemlich dicke Luft in der türkis-grünen Koalition sorgen. Denn Kogler und Co. vermuten, dass das Papier aus dem Umfeld von Altkanzler Sebastian Kurz mit für die Grünen ungünstigem „Spin“ an die Öffentlichkeit gebracht wurde.
Hafenecker verteidigt FPÖ-Vereinbarungen
Der FPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, verteidigte in der „ZiB 2“ wiederum den ebenfalls geleakten „Sideletter“ der türkis-blauen Regierung. Das sei Vorgabe der ÖVP gewesen und die ÖVP mache das offenbar „standardmäßig“ in allen Regierungen. Und außerdem müsse man mit der ÖVP Zusagen schriftlich festhalten, weil man sonst befürchten müsse, dass diese nicht eingehalten würden. Das sei mit der ÖVP offenbar "nicht anders möglich“.
Teuerungsausgleich für hohe Energiekosten
Angesprochen auf die zuletzt rasant angestiegenen Energiekosten, erklärte Kogler zudem, dass auch Anpassungen der Sozialhilfen im Gespräch seien. Es gebe dazu zudem den Klimabonus, „damit es nicht gegen die soziale Verträglichkeit aufschlägt.“ Die Politik werde jedenfalls auf die steigenden Preise hinschauen müssen, man beobachte das genau. Schreibt DIE KRONE.
Bei Äusserungen vom österreichischen Grünen-Boss Werner Kogler sollte man stets Vorsicht walten lassen. Man weiss bei ihm nie, wie hoch gerade sein Alkoholspiegel ist. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Einige der obskursten Versprecher des österreichischen Vizekanzlers könnten aber auch mit dem Klimawandel zusammenhängen. Trockene Luft soll das Lallen fördern.
Beim Vorgänger von Kogler, Vizekanzler HC Strache, musste man sich stets fragen, was der Mann geraucht hat. Das gilt inzwischen allerdings auch für etliche Parlamentarier*innen aus dem Schweizer Parlament. Gällid!
-
30.1.2022 - Tag der SVP-Initiativen
Christoph Blocher: Stoppt das Schweizer Berufsparlament!
Um auch in Zukunft als eigenständiges, erfolgreiches Land zu bestehen, müssen wir es besser machen als die andern. Doch unser Parlament produziert immer mehr Bürokratie, immer höhere Ausgaben, immer weltfremdere Beschlüsse.
Die Parlamentarier haben viel zu viel Zeit für immer neue Gesetze, Vorschriften und Verbote. Diese müssen beraten und an vielen Sitzungen beschlossen werden. Das gibt immer mehr Sitzungsgeld. Jede parlamentarische Initiative, die in einer Kommission diskutiert wird, spült dem betreffenden Parlamentarier ein Taggeld in die Kasse, sofern er der Kommission nicht ohnehin angehört. Seither ist die Zahl der parlamentarischen Initiativen explodiert.
Wenn einem Nationalrat 140'000 Franken und einem Ständerat 160'000 Franken bezahlt werden, kann man nicht mehr im Ernst von einem Milizparlament reden.
Es wäre Zeit für eine Volks- initiative mit dem Titel «Schluss mit dem Berufsparlament». Das Parlament wäre so zu organisieren, dass ein Parlamentarier höchstens ein Drittel der jährlichen Arbeitszeit für die parlamentarische Tätigkeit verwenden muss. Entsprechend müsste die Parlamentarierentschädigung auf total ein Drittel eines durchschnittlichen Schweizer Jahreslohns festgesetzt werden.
Wenn nur ein Drittel der Arbeitszeit aufgewendet werden müsste, würden wieder mehr fähige Leute, vor allem mehr Unternehmer, Gewerbetreibende und Selbständigerwerbende, ins Parlament gehen.
Als Berufspolitiker kann man sich in Verwaltungsräten und Verbänden, die im Zusammenhang mit dem politischen Mandat stehen, beschäftigen. Damit haben wir immer mehr verkappte Berufspolitiker. Das sollten wir mit einer Volks- initiative ändern, am besten auf überparteilicher Basis. Wir hätten dann ein besseres, effizienteres Parlament und für das Volk weniger einschränkende, freiheitsfeindliche Gesetze. Schreibt Christoph Blocher in der wöchentlichen Verlegerkolumne seiner Gratiszeitungen (die, das sei festgehalten, keine finanziellen Subventionen aus der Medien-Giesskanne des Bundes erhalten).
In Bezug auf die im Hohen Haus von und zu Bern für die Parlamentarier*innen üppig sprudelnden Sitzungsgelder muss man dem Zampano vom Herrliberg sicher recht geben.
Viele Schweizer Bürgerinnen und Bürger erinnern sich noch an das schäbige Gewürge des Parlaments um die Auszahlung der Sitzungsgelder für Sitzungen, die während dem ersten Lockdown 2020 nie stattgefunden haben. Die Damen und Herren von National- und Ständerat aller Parteien (!) setzten sich durch. Die Sitzungsgelder für Sitzungen, die NIE stattgefunden haben, wurden unter Berufung auf die abstrusesten Argumente ausbezahlt. Wäre das in Italien passiert, würden wir hierzulande von «mafiösen» Zuständen sprechen.
Doch bezüglich Initiativen, die das Arbeitsvolumen im Parlament angeblich deutlich erhöhen, muss man dem grossen Strategen von der SVP die Leviten lesen: Es ist seine, von ihm himself gegründete «Volchspartei» SVP, die das Parlament mit unsinnigen Volksinitiativen zumüllt, die kein Mensch in der Schweiz benötigt.
«Ausschaffung krimineller Ausländer», vom Wahlvolk zwar angenommen, entwickelte sich zum Rohrkrepierer. Bis zum heutigen Tag wurde kein einziger «krimineller Ausländer» mehr ausgeschafft als in den Zeiten vor der SVP-Initiative.
Der Grund ist ebenso trivial wie einfach: Die auch vor der Initiative bereits bestehenden Gesetze regeln bis zum heutigen Tag die Ausschaffung krimineller Ausländer. Man müsste sie nur anwenden. Dazu braucht es aber definitiv keine Volksinitiative.
Von den lächerlichen Abstimmungen zum Verbot von Minaretten in der Schweiz und dem Tragen von Burkas ganz zu schweigen: Für beide gilt das Gleiche wie bei der Ausschaffungsinitiative: Die vor den Volksabstimmungen längst gültigen Gesetze hätten jeden Minarettbau verhindert und mit den an zwei Händen abzuzählenden Schweizer Damen in Vollverschleierung wurde ein nicht existierender Popanz aufgebaut.
Wenn Blocher mit seinem Hexenbesen im Schweizer Parlament aufwischen will, sollte er vor der eigen Parteitüre beginnen und diesen Hühnerstall ausmisten. Denn dort werden die meisten Initiativen von seinen Legehennen ausgebrütet. Und dies nicht, weil die SVP noch immer die stärkste Partei im Parlament ist, sondern weil sie mit ihrem Unsinn lediglich die eigenen Stammwähler bei Laune hält.
Wie alle anderen Parteien ist die SVP in Bezug auf Sitzungsgelder nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Auch Blochers rhetorisches Maschinengewehr Roger Köppel war sich nicht zu schade, trickreich Sitzungsgelder für Sitzungen zu beziehen, die er geschwänzt hat.
-
29.1.2022 - Tag der sinnlosen Arena-Sendungen
«Abstimmungs-Arena»: Rauchende Köpfe in der Debatte über das Tabakwerbeverbot
Dass Rauchen schädlich ist, hat in der Abstimmungssendung zur Initiative «Kinder ohne Tabak» niemand bestritten. Für teilweise hitzige Wortduelle sorgte jedoch die Frage, ob Initiative oder indirekter Gegenvorschlag zu einem besseren Jugendschutz führen.
Ärztinnen und Apotheker, Krebs- und Lungenliga befürworten die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung». Nicht aber Gesundheitsminister Alain Berset. In der «Abstimmungs-Arena» vom Freitag warb der Bundesrat um Stimmen gegen die Vorlage. Das mag etwas erstaunen.
Ist der Staat nicht in der Pflicht, alle Massnahmen zu ergreifen, um junge Menschen davon abzuhalten, auch wegen Tabakwerbung zur Zigarette zu greifen? «Rauchen ist unbestrittenermassen schädlich», sagte dazu Berset. Aber das Rauchen sei nicht verboten und wenn ein Produkt legal verkauft werde, solle auch Werbung dafür gemacht werden können. Ausschliesslich um die Werbung gehe es in dieser Abstimmung. Er vertrat in der «Arena» die Meinung von Bundesrat und Parlament.
Umstrittener Weg zu mehr Jugendschutz
Grundsätzlich unterstrichen in der Sendung beide Seiten, die Initianten des Tabakwerbungsverbots sowie die Gegnerinnen, Jugendliche und Kinder vom Rauchen abhalten zu wollen. Doch der Weg zu mehr Jugendschutz, der hier zur Diskussion stand, ist stark umstritten.
Die Initiative will überall dort, wo Minderjährige sich aufhalten, Werbung konsequent verbieten. Bundesrat und Parlament hingegen haben einen Gegenvorschlag parat: Das neue Tabakproduktegesetz, das unabhängig vom Abstimmungsausgang in Kraft treten wird. Dieses sieht ein schweizweites Verkaufsverbot von Tabakprodukten an unter 18-Jährige vor, aber weniger weitreichende Massnahmen hinsichtlich der Werbung.
Bundesrat Berset stand in der Sendung offen Rede und Antwort. Er hätte sich mehr vom Gegenvorschlag erhofft. Seit 2004 will der Bundesrat das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs ratifizieren. Der Gegenvorschlag sei ein Kompromiss, aber dennoch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sagte Berset.
In der «Arena» stand sodann die Frage im Zentrum, was nun zu besserem Jugendschutz führt: die Initiative oder der Gegenvorschlag.
Thomas Cerny, Präsident Krebsforschung, befürwortet die Initiative klar. Der frühere Chefarzt der Onkologie sagt, die Nikotinsucht sei vergleichbar mit der Sucht nach Heroin und Kokain: «Unser Hirn reagiert genau gleich auf diese Substanzen.» Er habe Tausende Patienten innerhalb seiner vierzigjährigen Tätigkeit als Arzt begleitet. Viele davon hätten es bedauert, geraucht zu haben. «Diese Werbediskussion ist absurd», sagte Cerny. In jeder Zigarette habe es 80 Substanzen, die direkt krebsfördernd seien. Es sei deshalb nicht angezeigt, dass man Tabak, ein stark süchtig machendes Produkt, wie etwa Turnschuhe bewerbe.
«Wir sind für den konsequenten Jugendschutz», sagte Hans Stöckli, SP-Ständerat SP und Präsident Initiative. Die Initiative sei eine Ergänzung zum Gegenvorschlag, sie berücksichtige insbesondere die Kinder und Jugendlichen. Dabei geht es den Befürworterinnen und Befürwortern vor allem auch um Werbekanäle, die gezielt, aber eher subtil, Jugendliche erreichen. So etwa die sozialen Medien oder Internetplattformen, aber auch bestimmte Orte wie Festivals.
Im Gegenvorschlag sei bereits alles umgesetzt, was die Initianten forderten, argumentierte FDP-Ständerat Ruedi Noser dagegen. Wenn man die Jugend schützen wolle, erfordere das zwei Bedingungen: Tabak darf nicht an Minderjährige verkauft und nicht dort beworben werden, wo Minderjährige sich aufhalten. «Beides ist im Gegenvorschlag umgesetzt», sagte Noser. Für FMH-Präsidentin Yvonne Gilli hingegen ist dieser eine Alibi-Übung. Sie fordert eine «wirksame Einschränkung der Werbung, die sich an Jugendliche richtet».
Die Initiative sei «völlig obsolet», stimmte Mike Egger, SVP-Nationalrat aus St. Gallen und Co-Präsident des Nein-Komitees, wiederum dem Argument von Noser zu. Ihm geht es aber auch um die freie Meinungsbildung. Die schädliche Wirkung von Tabakprodukten auf die Gesundheit sei jedem bekannt. «Ich traue unseren Bürgerinnen und Bürgern zu, dass sie eigenständig darüber entscheiden können, ob sie solche Produkte konsumieren möchten oder nicht», sagte Egger. Die links-grüne Politik wolle hier einmal mehr die Bevölkerung bevormunden.
Beide Seiten werfen sich Unehrlichkeit vor
Die Gemüter erhitzten sich auch bei der Frage, welchen Einfluss die Tabakwerbung denn überhaupt auf Jugendliche hat. «Es ist ein Irrglaube zu denken, dass das Problem des Rauchens mit einer Werbeverbotsinitiative entschärft wird», sagte Egger. Schliesslich warf der SVP-Politiker den Befürwortern der Initiative gar Unehrlichkeit vor. «Wenn es Ihnen wirklich um die Gesundheit der Bevölkerung ginge, dann würden Sie eine Tabakprodukteverbotsinitative lancieren», sagte Egger. Mit einem Werbeverbot allein werde nur ein sehr marginaler positiver Effekt erreicht.
Brenda Ponsignon, die im Vorstand des Branchenverband Swiss Cigarette ist, sagte, die Tabakwerbung werde erst gar nicht für Minderjährige gemacht, sondern für Erwachsene, die bereits rauchten, um ihnen etwa eine neue Marke vorzustellen. Werbung sei nicht als Treiber da, um jemanden zum Rauchen zu animieren. «Die Zielgruppe sind nicht Minderjährige. Wir machen doch nicht Werbung für jemanden, der das Produkt nicht kaufen kann.»
Tabak und Cervelat «im gleichen Korb»
Hans Stöckli widersprach. Es sei scheinheilig zu sagen, die Werbung richte sich nur an erwachsene Rauchende. Das Risiko zu rauchen hänge massiv davon ab, in welchem Werbeumfeld man sei. So werde die Werbung im Internet etwa gar nicht kontrolliert, Jugendliche könnten diese jederzeit einsehen und dadurch in ihren Entscheidungen beeinflusst werden. «Die Prävention steht bei dieser Initiative an vorderster Stelle und die Werbung schafft schlechte Voraussetzungen für die Prävention.»
Die Gegner der Initiative machen derzeit mit Plakaten auf ihr Anliegen aufmerksam, auf denen steht «Heute Tabak? Morgen Cervelat?». Sie befürchten, eine Verbotslawine würde mit dieser Initiative ausgelöst, das Tabakwerbeverbot sei erst der Anfang. Das Wort Cervelat fiel in der Sendung damit nicht nur einmal. Hans Stöckli war zumindest etwas darüber beleidigt, dass seine Lieblingswurst «im gleichen Korb wie die Droge Tabak» besprochen wurde. Schreibt SRF.
Warum sich ein stotternder Nationalrat im Duett mit einem lispelnden Bundesrat, kreischende Polit- und Marketing-Vogelscheuchen sowie sonstige Hobby-Comedians überhaupt mit diesem Thema beschäftigen, sich gegenseitig ins Wort fallen und mit clownesker Mimik und einer Lächerlichkeit sondergleichen bis zur Erschöpfung echauffieren, ist wohl nur mit dem Herdentrieb mediengeiler Selbstdarsteller *innen und ihrem unerschöpflichen Empörungspotenzial zu erklären.
Denn dass das Tabakwerbeverbot an der Urne vom «Wahlvolch» (O-Ton Christus Blocher) angenommen wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Warum, werden Sie sich jetzt fragen?
Im Jahr 2017 rauchten in der Schweiz laut BAG 27,1% der Bevölkerung. Das heisst, 72,9 Prozent der Schweizer Bevölkerung rauchen nicht. Eine überwältigende Mehrheit. Selbst wenn sich möglicherweise die Zahlen vom BAG seit dem Jahr 2017 durch die Jung-Kifferlinge um ein paar Prozentpunkte verschoben haben sollten.
Deswegen ist bisher noch jede Volksinitiative gegen das Rauchen vom Stimmvolk angenommen worden. Darauf dürfen Sie auch bei der jetzt anstehenden Abstimmung definitiv einen fahren lassen.
Die vor sich hin serbelnde Arena-Sendung, die gegen stetig fallende Quotenzahlen ankämpft, verbreitete einmal mehr trotz illustren Studiogästen nichts anders als Schall und Rauch. Man darf sich schon fragen, welche Masochisten sich solch eine Sendung um eine Volksabstimmung antun, deren Ausgang zum vornherein zu 100 Prozent feststeht.
Ganz abgesehen davon, dass dieses Werbeverbot, über das wir an der Urne abstimmen, REIN GAR NICHTS in Sachen Prävention bringen wird. Auch darauf können Sie wetten. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und wird auch dieses Mal nicht funktionieren.
-
28.1.2022 - Tag der Köche und Kellner
US-Regierung: Einmarsch in Ukraine bedeutet Aus für Nord Stream 2
Die US-Regierung hat ihre Forderung nach einem Aus für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 im Falle eines russischen Einmarschs in die Ukraine bekräftigt. "Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren (...), wird Nord Stream 2 nicht weitergeführt", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Donnerstag im Gespräch mit dem Sender CNN. In diesem Fall werde man mit Deutschland zusammenarbeiten, um einen Stopp der Pipeline sicherzustellen.
"Sie haben Erklärungen unserer deutschen Verbündeten gehört (...), in denen sie auf die starken Maßnahmen hingewiesen haben, die die deutsche Regierung bereit und willens ist, zu ergreifen", versicherte Price.
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat für den Fall einer russischen Invasion der Ukraine betont, dass ein Ausschluss Russlands vom Zahlungsverkehrssystem Swift sowie ein Ende der Gaspipeline Nord Stream 2 möglich seien. "Nichts ist vom Tisch", sagte sie am Donnerstagabend auf Fragen zu entsprechenden Sanktionen in einem CNN-Interview. Zudem betonte sie, dass man versuche, eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden, sich jedoch auch auf das Schlimmste vorbereite.
Unterstützung für Ukraine
Die deutsche Bundesregierung hat für den Fall eines russischen Angriffs alle Optionen auf den Tisch gelegt und dabei auch deutlich gemacht, dass der Stopp von Nord Stream 2 eine Option sein kann. In den vergangenen Jahren hatte die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zwischen Deutschland und den USA für Spannungen gesorgt.
Auch US-Präsident Joe Biden lehnt die Pipeline ab. Um den Streit mit Washington zu entschärfen, hatte Deutschland im Juli in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA eine stärkere Unterstützung der Ukraine zugesagt.
Diese Unterstützung bekräftigte Biden in einem Telefonat mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend. Die Vereinigten Staaten seien der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine verpflichtet, sagte Biden nach einer Mitteilung des Weißen Hauses. Die US-Regierung prüfe auch zusätzliche Finanzhilfen für Kiew. Biden habe betont, die USA und ihre Verbündeten seien bereit, entschlossen zu antworten, falls Russland die Ukraine angreifen sollte, hieß es. Zugleich betonte der US-Präsident auch seine Unterstützung für die Gespräche im Normandie-Format, dem neben der Ukraine und Russland auch Vermittler aus Frankreich und Deutschland angehören.
Macron will Deeskalationsweg vorschlagen
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinem russischen Kollegen Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation im Konflikt vorschlagen. Am Freitag wollen die beiden Staatschefs dazu telefonieren. Aus Élysée-Kreisen hieß es, Macron wolle noch einmal betonen, dass ein Einmarsch russischer Truppen ins Nachbarland Ukraine schwere Konsequenzen hätte.
Auf Antrag der USA wird sich erstmals auch der UN-Sicherheitsrat mit der aktuellen Krise befassen. Die Vereinigten Staaten beantragten am Donnerstag ein Treffen des mächtigsten UN-Gremiums für Montag, wie die US-Mission mittelte. Die Beratungen in New York sollen öffentlich abgehalten werden, vermutlich um 16.00 Uhr MEZ. "Während wir unser unermüdliches Streben nach Diplomatie fortsetzen, um die Spannungen angesichts dieser ernsthaften Bedrohung des europäischen und globalen Friedens und der Sicherheit zu deeskalieren, ist der UN-Sicherheitsrat ein entscheidender Ort für die Diplomatie", teilte die US-Vertretung mit. Schreibt DER STANDARD.
Der Welt-Hegemon Amerika zeigt den Deutschen – und damit auch der EU – einmal mehr, wer im Verhältnis zwischen den USA und Deutschland / Europa Koch und Kellner ist und wer Sanktionen diktiert.
Das amerikanische Fracking-Gas muss ja schliesslich auch verkauft werden.
-
27.1.2022 - Tag der Wischi-Waschi-Aktionen unseres Bundesrates
Bundesrat verzichtet aufgrund der Pandemie auf Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022
Angesichts der unsicheren Pandemie-Situation in der Schweiz und da infolge der Bekämpfung der Corona-Pandemie in China keine substantiellen bilateralen Treffen und keine Kontakte mit Athletinnen und Athleten stattfinden können hat der Bundesrat entschieden, auf eine Teilnahme an den Olympischen und Paralympischen Winterspielen 2022 in Beijing zu verzichten.
Vom 4. Februar bis zum 13. März 2022 finden in China die 24. Olympischen und Paralympischen Winterspiele statt. Unter Berücksichtigung der weiterhin angespannten Pandemie-Situation in der Schweiz und da in China während der Spiele wegen gesundheitsbedingter Einschränkungen keine substantiellen bilateralen Treffen oder Kontakte mit Schweizer Athletinnen und Athleten möglich wären hat der Bundesrat am 26.01.2022 entschieden, auf eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Beijing zu verzichten. Der Bundesrat wird die schweizerischen Athletinnen und Athleten von zu Hause aus anfeuern.
Schreibt das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA in seiner Medienmitteilung.
Was ist denn das für eine verkorkste Begründung für den Verzicht unseres Bundesrates an den Olympischen Winterspielen in China? Frei nach dem Motto «Ich wasche dir den Pelz, aber ich mache dich nicht nass».
Die Schweiz marschiert hier im Gleichklang mit etlichen EU-Staaten, deren Regierungsmitglieder auf Wunsch der EU-Fürstin die Olympiade in China «boykottieren». Begründet wird dieser Schritt seitens der EU mit den fehlenden Menschenrechten in China und dem Uiguren-Camp, neben dem (die von Hitler gegründete) Volkswagen AG (VW) in guter nachbarschaftlicher Nähe ohne jegliche moralische Empörung ein riesiges Automobilwerk betreibt.
Einmal mehr eine verlogene «Boykott»-Aktion der hehren westlichen Wertegemeinschaft mit reinem Symbolgehalt. Oder glaubt wirklich jemand, die chinesische Nomenklatura unter der Fuchtel von Xi Jinping würde sich auch nur einen Deut darum scheren, ob da ein paar Narren und Närrinen aus der europäischen Politikergilde den Olympischen Spielen fernbleiben? Das ist den Mächtigen im Land des Lächelns nicht mal eine Pressemeldung wert.
Wer die Olympischen Winterspiele in China wirklich boykottieren will, schickt schlicht und einfach keine Sportlerinnen und Sportler nach Beijing. Nur das würde den Chinesen Eindruck machen und wäre auch vor dem chinesischen Fussvolk nicht zu verheimlichen.
Die Schweizer Regierung, bussinessmässig seit jeher offen nach allen Seiten, will die Handelsbeziehungen mit keinem der mächtigen Handelspartnern aufs Spiel setzen und verzichtet in ihrer Begründung der Absage wenigstens auf die verlogene Moralkeule und den Klamauk der EU. Und das ist gut so.
Besser wird die Schweizer Begründung dadurch allerdings auch nicht. Oder glaubt wirklich jemand, die Chinesen wären nicht in der Lage, Schweizer Regierungsdelegationen bei einem Besuch der Olympiade in China vor Corona zu schützen? Wenn dem so wäre, dürfte kein verantwortungsvoller Staat seine Sportlerinnen und Sportler nach China schicken.
«Wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein», soll Kurt Tucholsky gesagt haben. In Tucholskys Schriften ist dieses Zitat allerdings nicht zu finden. Egal, auf die Haltung der Schweizer Regierung bezüglich anderen Staaten trifft es ohnehin nicht zu. Im Gegenteil: Als kleines und neutrales (!) Land ist die Schweiz geradezu zur Offenheit verpflichtet, sollte sich aber aus den Scharmützeln und Wischi-Waschi-Aktionen wie der vor beschriebenen der grossen Player heraushalten.
Unsere Mächtigen und weniger Mächtigen aus der Schweiz sind offiziell schon in ganz andere Länder gereist, die die Menschenrechte ebenso wie China mit den Füssen treten. Saudi Arabien ist nur ein Beispiel von vielen. Da hätte ein Besuch von Bundesrätin Amherd an den Winterspielen in China das internationale Image der Schweiz auch nicht wesentlich verändert.
Immerhin hat die Schweiz in weiser Voraussicht als einer der ersten westlichen Staaten am 17. Januar 1950 die Volksrepublik China anerkannt und beendete damit ihre Anerkennung der Republik China (Taiwan).
Ausserdem ist seit 1.7.2014 ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China in Kraft, das übrigens (ich erwähne das nur im Flüsterton) auch von der deutschen Industrie rege genutzt wird. Vorausgesetzt, man hat eine Produktionsstätte in der Schweiz. Oder man exportiert produzierte Erzeugnisse in das jeweils andere Abkommensland (China oder die Schweiz).
-
26.1.2022 - Tag der Rssismuskeule
Bruder von Evelyn Wilhelm (46) wurde in Morges VD von Polizei erschossen – sogar Uno geht Fall nach: «Wäre er weiss, würde er jetzt noch leben!»
Vor einem halben Jahr wurde Roger «Nzoy» Wilhelm (†37) von einem Beamten der Kantonspolizei Waadt erschossen. Für seine Schwester ein Vorfall mit rassistischem Hintergrund, der kein Einzelfall ist. Eine Uno-Delegation hat sich diesem und weiteren Fällen nun gewidmet.
Es war der 30. August 2021, als der Zürcher Roger «Nzoy» Wilhelm (†37) sich mit dem Zug auf den Weg von Zürich nach Genf machte und nicht mehr nach Hause zurückkehrte. Er wurde am Bahnhof in Morges VD von einem Polizisten der Kantonspolizei Waadt niedergeschossen, nachdem er auf den Beamten und seinen Kollegen zugerannt war – er soll mit einem 26 Zentimeter langen Messer bewaffnet gewesen sein. Dreimal drückte der Polizist ab, Nzoy blieb am Boden liegen.
Videos dokumentieren den tödlichen Vorfall. Und zeigen auch die Momente nach den Schüssen: Während vier Minuten wird der angeschossene Mann nicht reanimiert, ihm werden Handschellen angelegt. Nzoy erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen.
«Racial Profiling» auch in der Schweiz ein Problem
Der Fall löst eine Rassismus-Debatte in der Schweiz aus. Denn: Nzoy war ein schwarzer Mann. Wurde er ein Opfer von «Racial Profiling»? Mit dieser und weiteren Fragen haben sich in den vergangenen zehn Tagen Expertinnen und Experten des Uno-Menschenrechtsrates (The UN Working Group of Experts on People of African Descent) befasst. Vom 17. bis zum 26. Januar 2022 waren sie in der Schweiz zu Gast, um die Menschenrechtslage von afrikanischstämmigen Personen in der Schweiz zu untersuchen.
Am Mittwoch werden sie die Resultate ihrer Untersuchungen vorstellen und der Schweizer Politik Vorschläge zur Verbesserung der Situation von afrikanischstämmigen Menschen unterbreiten. Sprechen werden die US-Amerikanerin Dominique Day, die Vorsitzende der UN-Delegation und Catherine S. Namakula, Professorin für Menschenrechte und Strafrechtspflege an der Universität von Bloemfontein in Südafrika. Sie und weitere Abgeordnete der Delegation trafen sich während zehn Tagen mit Schweizer Behörden, Politikerinnen und Politikern sowie Polizeibehörden und Aktivistinnen und Aktivisten.
Auch Evelyn Wilhelm (46), die Schwester von Nzoy, traf sich mit den Vertretern der Uno, um über den Fall ihres Bruders zu sprechen. Blick hat sie auf ihrer Zugreise nach Genf, wo sie vor der Delegation sprach, begleitet. Für sie war das letzte halbe Jahr ein Kampf, fassen kann sie es noch immer kaum.
«Wäre er weiss gewesen, wäre es nicht so eskaliert. Er wäre noch am Leben», ist Wilhelm überzeugt. Denn: Nach Angaben mehrerer Zeugen betete Nzoy, ein gläubiger Christ, auf den Bahnsteigen in Morges. Er war Minuten vor seinem Tod sichtlich aufgebracht, wollte sich durch das Gebet offensichtlich beruhigen. Für die Schwester ist klar: «Es war von Anfang an das perfekte Beispiel von Racial Profiling. Wenn man einen schwarzen Mann sieht, der betet, denkt man sich sofort: Das ist ein Terrorist!»
«Kleiner Trost, dass Mutter und Sohn wieder vereint sind»
Ihr Bruder Nzoy sei bereits vor dem Vorfall in Morges «immer und immer wieder» von Polizisten kontrolliert worden, «ohne ersichtlichen Grund». Deshalb habe er laut seiner Schwester auch immer seinen Schweizer Pass in seiner Hosentasche getragen, damit er sich so schnell wie möglich ausweisen konnte. Dazu ist es Ende August 2021 nicht gekommen. Ein Detail lässt Wilhelm nicht los: «Als die Polizei in der Notrufzentrale anrief, betonten sie, dass es sich bei meinem Bruder um einen schwarzen Mann handelt. Dabei hätte es so viel wichtigere Details gegeben, die man hätte erwähnen können.»
Gegenüber dem Online-Magazin «Republik» bestritt die Kantonspolizei Waadt, dass die Hautfarbe von Nzoy eine Rolle gespielt habe. Auf eine aktuelle Anfrage von Blick will sich die Polizei nicht zum Fall äussern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Der Schütze, so bestätigt die Kantonspolizei aber, arbeite weiterhin als Regionalpolizist in Morges.
Für Wilhelm ist es ein schmerzlicher Verlust. Ihr Bruder war in der reformierten Kirche Streetchurch in Zürich aktiv, machte gerne mit Freunden Musik, hätte im November des letzten Jahres einen neuen Job als Altenpfleger begonnen. «Nzoy war ein Mann, der sein Herz am richtigen Fleck hatte. Meine Mutter starb vor acht Jahren an Krebs, er war es auch, der sie zuletzt zu Hause betreute. Jeden Samstag ist er zu ihr gegangen, um mit ihr einzukaufen», sagt sie. «Es wäre schrecklich gewesen, wenn sie das hätte miterleben müssen! Er liebte sie sehr, und jetzt sind sie wieder vereint.» Schreibt Blick.
Dass es auch in der Schweizer Gesellschaft Vollpfosten mit ekelhaft rassistischem Gedankengut gibt, wird wohl niemand bestreiten. Vor solchen Menschen sind auch die Schweizer Polizeikorps nicht gefeit, auch wenn es sich vermutlich wirklich nur um Einzelfälle handelt.
Aber nun gleich die Rassismuskeule zu schwingen, ist etwas kurz gesprungen.
Die Frage an alle Apologeten der Vorurteile auf beiden Seiten: Was würden Sie denn in Sekundenschnelle unternehmen, wenn ein kräftiger junger Mann, egal welcher Hautfarbe, mit einem gezückten Messer auf Sie zu rennt?
Es gibt auch im Leben eines Polizisten Momente, in denen die Zeit für Deeskalierungsmassnahmen schlicht und einfach nicht mehr vorhanden ist.
-
25.1.2022 - Tag des US-Films «Zurück in die Zukunft»
Ukrainekonflikt: USA versetzen 8500 Soldaten in «erhöhte Alarmbereitschaft»
Die USA bereiten die Verlegung von Truppen nach Europa vor – als Signal an Wladimir Putin. Zum weiteren Vorgehen im Ukrainekonflikt sollen Gespräche im sogenannten Normandie-Format geführt werden.
Wegen der Ukrainekrise hat die US-Regierung nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 8500 Soldaten in den Vereinigten Staaten in »erhöhte Alarmbereitschaft« versetzt. Pentagon-Sprecher John Kirby betonte zwar, eine Entscheidung über eine Verlegung dieser Truppen nach Europa sei noch nicht getroffen. Die entsprechenden Einheiten seien auf Anweisung von US-Präsident Joe Biden und nach Empfehlung von Verteidigungsminister Lloyd Austin jedoch in erhöhte Bereitschaft versetzt worden.
Die Soldaten könnten im Falle eines russischen Angriffs auf das Nachbarland im Rahmen der schnellen Eingreiftruppe der Nato eingesetzt werden, sagte Kirby. Die »New York Times« hatte zuvor berichtet, Biden erwäge, Kriegsschiffe und Flugzeuge zu Nato-Verbündeten im Baltikum und in Osteuropa zu verlegen sowie mehrere tausend US-Soldaten zu entsenden. Die USA haben in Europa auch außerhalb von Krisenzeiten Zehntausende Soldaten stationiert.
Olaf Scholz warnt Russland vor einer Verletzung europäischer Grenzen
Im Rahmen der Spannungen und den Befürchtungen eines Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine tauschten sich am Montagabend US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen europäischen Verbündeten in einem Videotelefonat aus. Scholz sagte, das Gespräch sei »ein gutes Zeichen für die enge Zusammenarbeit«. Es sei wichtig, geschlossen zu handeln. Dazu gehöre es, darauf zu pochen, dass Grenzen in Europa nicht verletzt werden dürften. »Wir werden das auch nicht hinnehmen. (...) Das würde hohe Kosten haben.«
An der Schaltkonferenz nahmen auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der italienische Regierungschef Mario Draghi, der polnische Präsident Andrzej Duda, der britische Premierminister Boris Johnson, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teil. Sie forderten Russland gemeinsam zu sichtbaren Schritten der Deeskalation im Ukrainekonflikt auf.
Am Mittwoch sollen weitere Gespräche im sogenannten Normandie-Format zwischen Beratern von Frankreich, Deutschland, der Ukraine und Russland stattfinden, wie es aus dem Pariser Élysée-Palast hieß. Das bislang letzte Gipfeltreffen im Normandie-Format hatte 2019 stattgefunden. Vor dem Hintergrund steigenden Spannungen wurden die Forderungen der Europäer nach einer Erneuerung dieser Gespräche wieder lauter.
Boris Johnson warnt Russland
Johnson wandte sich mit einem eindringlichen Appell an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. »Den Plan für einen Blitzkrieg, der Kiew ausschalten könnte, kann jeder sehen«, sagte der britische Premier. »Wir müssen es dem Kreml, Russland, sehr klar machen, dass es ein desaströser Schritt wäre.« Auch aus russischer Perspektive wäre dies eine »schmerzhafte, gewaltsame und blutige Angelegenheit«, sagte Johnson.
London hatte Panzerabwehrwaffen in die Ukraine geflogen und wie auch die USA Beschäftigte aus seiner Botschaft in Kiew abgezogen. Man sei außerdem dabei, wirtschaftliche Sanktionen vorzubereiten. Das plant nach SPIEGEL-Informationen auch die Europäische Union, noch wegen der Annexion der Krim.
Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in das Nachbarland plant – was Moskau dementiert. Für möglich wird auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. Russlands will, dass die Nato auf eine weitere Osterweiterung verzichtet und ihre Streitkräfte aus östlichen Bündnisstaaten abzieht. Schreibt DER SPIEGEL.
Es hat sich verdammt wenig verändert seit 1985: Ideologien und Religionen, die auch nichts anderes als Ideologien sind, prägen noch immer die Auseinandersetzungen zwischen den Völkern, die in blutigen Scharmützeln oder gar lokalen Kriegen enden. Und über der Menschheit schwebt als finale Bedrohung noch immer Oppenheimers Spielzeug, die Atombombe.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg als globales Friedensinstrument ins Leben gerufene UNO ist inzwischen zu einem Debattierklub der Unfähigen und Etablierten und zu einer Massengeldvernichtungsmaschinerie verkommen.
Sting - «Russians» (1985)
In Europe and America there's a growing feeling of hysteria
Conditioned to respond to all the threats
In the rhetorical speeches of the Soviets
Mister Krushchev said, "We will bury you"
I don't subscribe to this point of view
It'd be such an ignorant thing to do
If the Russians love their children too
How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy?
There is no monopoly on common sense
On either side of the political fence
We share the same biology, regardless of ideology
Believe me when I say to you
I hope the Russians love their children too
-
24.1.2022 - Tag der Schlafwandler
Rüstung für Ukraine? «Deutschland sollte strikte Anti-Haltung aufgeben»
Nach dem Eklat um Marine-Chef Schönbach und großem Ärger auf ukrainischer Seite werden Forderungen an die Bundesregierung lauter, Kiew mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Doch die Ampel-Koalition hadert – während Berichte über eine von Russland geplante Eskalation kursieren.
Es war ein seltener Moment des schnellen und entschlossenen Handels der Bundesregierung in der Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze: Der deutsche Marine-Chef, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, reichte nach einem Eklat um seine Äußerungen zum Ukraine-Konflikt seinen Rücktritt ein – und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nahm diesen gleich am Samstagabend noch an.
Doch der Fall Schönbach zieht weitere Kreise und lässt neue Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine aufkommen.
Schönbach hatte sich am Freitag bei einem Besuch in Indien zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geäußert. Den von westlichen Staaten befürchteten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine bezeichnete er dabei als „Nonsens“, wie aus einem im Internet veröffentlichten Video hervorging.
Was Russlands Präsident Wladimir Putin wirklich wolle, sei „Respekt auf Augenhöhe“, sagte der Vizeadmiral. „Es ist leicht, ihm den Respekt zu geben, den er will – und den er wahrscheinlich auch verdient.“ Zudem äußerte Schönbach sich zu der im Jahr 2014 von Russland annektierten ukrainischen Krim: „Die Krim-Halbinsel ist verloren, sie wird niemals zurückkehren.“
Daraufhin verlangte der ukrainische Botschafter in Deutschland weiterreichende Schritte als den Rückzug Schönbachs. Der Eklat hinterlasse „einen Scherbenhaufen“ und stelle die internationale Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit Deutschlands „massiv infrage“, sagte Andrij Melnyk WELT. Die Aussagen Schönbachs hätten „die gesamte ukrainische Öffentlichkeit in tiefen Schock versetzt“.
Der designierte Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour zeigte Verständnis für die Reaktion des Botschafters: „Dass die Äußerungen Herrn Schönbachs in der Ukraine Irritationen ausgelöst haben, ist verständlich. Ich verstehe auch den Unmut des Botschafters“, sagte der Außenpolitiker WELT. „Und ich finde den aufrechten Gang des Marine-Chefs aus seinem Amt nach einem großen Fehler sehr respektabel.“ Die SPD-Fraktion wollte keine Einschätzung zu dem Fall abgeben.
Unionsfraktion fordert Kurswechsel der Bundesregierung
Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), unterstrich, dass Schönbachs Äußerungen „in keiner Weise der Haltung der Politik der demokratischen Parteien im Bundestag“ entsprächen. „Für sie gibt es keinen Rückhalt in der deutschen Politik“, so Hardt. „Die Krim ist Teil der Ukraine.“
Der CDU-Außenpolitiker richtete aber zugleich die Forderung nach einem Kurswechsel an die Bundesregierung: „An einem anderen Punkt, nämlich Rüstungsunterstützung für die Ukraine, sollte Deutschland seine strikte Anti-Haltung aufgeben. Ich finde, die Nachfrage nach defensiven Waffen seitens der Ukraine in Deutschland sollte geprüft und in bestimmten Fällen auch positiv beschieden werden.“
Es gebe Waffen, die von Russland nicht ernsthaft als Bedrohung empfunden werden können. „Panzer- und Flugabwehrraketen gehören dazu. Die Bevormundung unserer baltischen Nato-Partner geht gar nicht.“ Hardt bezog sich damit auf einen Bericht der US-Zeitung „Wall Street Journal“, wonach Deutschland die Lieferung deutscher Waffen durch Estland an die Ukraine blockiert.
Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte die Weigerung der Bundesregierung kritisiert, Waffen an sein Land zu liefern. „Wir sind enttäuscht über Deutschlands anhaltende Weigerung, die Lieferung defensiver Waffen in die Ukraine zu genehmigen, besonders in der derzeitigen Situation“, sagte Kuleba WELT AM SONNTAG. „Wir wären noch enttäuschter, wenn Deutschland nicht nur ablehnte, uns defensive Waffen zu liefern, sondern auch noch andere daran hindern würde, dies zu tun.“
In der Ampel-Koalition in Berlin ringen FDP und Grüne intern, ob die Ukraine mit Waffen aus Deutschland beliefert werden soll oder nicht. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich gegen Lieferungen ausgesprochen. Experten wie der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, kritisieren, Deutschland stehe zusehends isoliert da und schwäche die Position der EU in der aktuellen Lage – zugleich suchten die östlichen Partnerstaaten Rückhalt bei der Nato und den USA.
Der Linke-Außenpolitiker Gregor Gysi hingegen hält Schönbachs Einschätzung zur Krim für richtig: „Es ist verständlich, dass das ukrainische Außenministerium sich erregt, weil es davon ausgeht, dass die Krim zur Ukraine gehört. Trotzdem hat der Admiral natürlich Recht, dass die Krim nicht zurückkehren wird“, so Gysi. „Der Rücktritt des Admirals reicht mehr als aus. Er hätte es nichtöffentlich erklären dürfen, aber eben noch nicht öffentlich. Er soll ja keine Politik betreiben.“
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte, die territoriale Integrität der Ukraine müsse respektiert werden. „Aber immer härtere Sanktionen gegen Russland können allein nicht die Lösung sein. Die Mehrzahl der Deutschen wünscht sich ein stabiles und friedliches Verhältnis zu Russland.“
Russland hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Großangriff auf das Nachbarland. Moskau dementiert jegliche Invasionspläne.
Das britische Außenministerium teilte am Samstagabend mit, der Regierung in London lägen Informationen vor, „die darauf hindeuten, dass die russische Regierung versucht, eine pro-russische Führung in Kiew zu etablieren, während sie erwägt, ob sie in die Ukraine einmarschieren und sie besetzen soll“. Moskau warf London daraufhin „Desinformation“ vor. Schreibt DIE WELT.
Kriege haben immer ihre Vorgeschichten. Die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen, heisst nicht, sie gleichzusetzen. Dennoch scheint es gewisse «Naturgesetze» zu geben, die sich wie ein roter Faden durch die Entstehungsgeschichten epochaler Kriege ziehen.
Trotz einiger Mängel und Missachtung historischer Fakten aus wesentlichen Dokumenten der damals handelnden Akteure sei hier das Buch «The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914» («Die Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog») des australischen Historikers Christopher Clark aus dem Jahr 2012 empfohlen.
Wer immer es gelesen hat – ich gehöre dazu – wird den Eindruck nicht los, dass sich Geschichte immer wieder wiederholt, auch wenn sich Umfeld, Wissen, Technik und Gesellschaften über Generationen hinweg gewandelt haben: Am Schluss aller Geplänkel steht früher oder später stets nur noch die Option der ultima Ratio zur Verfügung: Krieg!
Das Herbeischreiben (oder herbeireden) der ultima Ratio scheint eines dieser Naturgesetze zu sein, das besonders die Deutschen scheinbar schon immer besonders gut beherrscht haben.
Sei es als Sprachrohr und Trommler eines grössenwahnsinnigen Kaisers, eines psychopathischen Diktators und Judenhassers oder gegenwärtig als Vasall des derzeitigen Hegemons USA und der nach neuen kriegerischen Auseinandersetzungen lechzenden Waffenindustrien.
-
23.1.2022 - Tag des gefallenen Engels aus dem Bündnerland
Sonntagsreden an der GV, gute Laune an Cüpli-Events, Geheimdeals im Stripclub: Das unglaubliche Doppelleben des Pierin V. im Protokoll
Pierin Vincenz werden Betrug und Veruntreuung zur Last gelegt. Viele Vorwürfe beziehen sich auf das Jahr 2014. SonntagsBlick protokolliert das Schicksalsjahr des ehemaligen Raiffeisen-Chefs im Detail. Die fast schon minutiös aufgelisteten Details lesen Sie im SonntagsBlick-Artikel.
Und täglich grüsst das Murmeltier: Nachdem Blick den Live-Ticker zur Causa Djokovic geschlossen hat, folgt seit mehr als einer Woche der tägliche Frontseiten-Aufmacher über die Vergehen des einstigen Star-Bankers Pierin Vincenz.
Auch Frontseiten-Aufmacher über Wochen hinweg sind sowas wie ein Live-Ticker.
Langsam ist's genug. Während Blick über jeden Puffbesuch inklusive Zücken der Raiffeisen-Kreditkarte des gefallenen Engels aus dem Bündnerland «breathless» berichtet, wie die Amis sagen würden, schweigen die Schweizer Politiker querbeet durch alle Parteien.
Kein Wunder. Sie wurden ja auch alle damals vom guten Pierin und «seiner» Raiffeisenbank tüchtig geschmiert. Wie auch von vielen anderen Banken und Unternehmen bis hin zur «Mobiliar».
Daran sollten Sie denken, wenn Sie das nächste Mal Ihre Versicherungsprämie an die «Mobs» bezahlen. Es ist Ihr Geld, mit dem Banken und Unternehmen die Politiker*innen und Parteien korrumpieren.
Während sich Politik und Unternehmertum in den Blütezeiten von Vincenz um ein Bildchen zusammen mit Superstar Pierin in der Presse gegenseitig die Klinken in die Hand drückten, recherchiert das Boulevard-Klo an der Dufourstrasse in Zürich vermutlich derzeit den nächsten Knüller für den täglichen Frontseiten-Aufmacher:
Welche Scheisshäuser hat der Bündner Bankster bei seinen Stuhlgängen benutzt? Hat er beim Kacken womöglich noch gefurzt?
Wetten, dass sich Blick dafür nicht zu schade ist?
-
22.1.2022 - Tag der serbischen Pilze
Umami aus Serbien: Getrocknete Steinpilze
Das Wiener Unternehmen Biobalkan vertreibt Delikatessen vom Balkan, die in Kooperation mit regionalen Sozialunternehmen hergestellt werden.
Neu im Sortiment sind getrocknete Steinpilze aus der Region Bosilegrad. Das Social Business "Optimist" beschäftigt dort Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Für das Sammeln gibt es eine offizielle Genehmigung der serbischen Forstverwaltung, und das Waldgebiet wurde bio-zertifiziert. Schreibt DER STANDARD.
Als Ernährungsberater des Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli muss ich vom Verzehr dieser getrockneten Steinpilze aus Serbien dringendst warnen: Die sind nicht geimpft!
-
21.1.2022 - Tag der todgeweihten Medien
Ueli Maurer kritisiert «Verschärfungshype» durch Mediendruck
Bundesrat Ueli Maurer kritisiert die Berichterstattung der Medien während der Pandemie. Der Druck aus den Medien habe in der Schweiz dazu geführt, dass Massnahmen in einem vielleicht unnötigen Ausmass verschärft wurden, sagte er in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung». So sei auch beim Bundesrat ein «Verschärfungshype» entstanden.
Im Nachhinein könne man sich fragen, ob man zu lange mit der Normalisierung gewartet habe, so der Zürcher Departementsvorsteher weiter. «Für mich beruhte die Politik immer auf drei Säulen: Gesundheit schützen, wirtschaftliche Folgen abfedern, Gesellschaft am Leben erhalten.» Anfänglich sei es fast nur um die Gesundheit gegangen, inzwischen würden andere Fakten mitberücksichtigt.
Maurer reagiert kritisch auf den Hinweis, dass sich die Warnung des BAG, dass gleichzeitig bis 10 bis 15 Prozent der Arbeitskräfte infiziert sein könnten, nicht zu erfüllen scheine. «Wenn die Experten solche Szenarien entwerfen, wird in den Medien oft nur der schlimmstmögliche Fall dargestellt. Das ergibt ein zu einseitiges Bild. Aber die Medien brauchen halt jeden Tag eine Schlagzeile.»
Die Medien hätten leider sehr zu dieser Misere beigetragen, weil sie nur das Schlimmste pflegten. Dieser Schaden sei nicht zu unterschätzen. Schreibt SRF im Live-Ticker.
Wo unser aller Bundesrat und Trychler-Hömmli-Träger Ueli Maurer recht hat, hat er recht. Die Medien haben in den Pandemiejahren in der Tat eine verwerflich perverse Strategie zum Wohle ihres gottverdammten Clickbaiting verfolgt.
Nur ist diese widerwärtige Hinwendung sämtlicher Medien zum alles dominierenden Boulevard nicht erst seit der Pandemie feststellbar. Krankhaft wird schon seit langer Zeit versucht, längst überholte Geschäftsmodelle in der Medienbranche künstlich am Leben zu erhalten. Normalerweise würden die Think Tanks der Schweizer Wirtschaft das als Konkursverschleppung bezeichnen.
Daran sollten Sie denken, wenn Sie den Stimmzettel für die Volksabstimmung vom 13. Februar 2022 ausfüllen. Unter Punkt 4 stimmen Sie über das Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien ab, das die Schweizer Steuerzahler*innen nach der Ausschüttung durch die Bundesgiesskanne im Jahr 2020 nochmals 150 Millionen Franken kosten wird.
Sie allein entscheiden, ob wir weiterhin Hunderte von Millionen Franken an Verleger-Familien bezahlen, die ihrerseits als Multi-Millionäre unglaubliche Vermögen horten anstatt sie in «Qualitätsjournalismus» zu investieren.
Sie allein entscheiden, ob Ihnen die täglichen Bullshit-Artikel weltweiter Agenturen die Riesensummen aus der Bundesgiesskanne das wirklich wert sind. Sie allein müssen sich fragen, ob mit solcher Berichterstattung nicht eher die Einfalt als die vielgepriesene Vielfalt gefördert wird.
Um allfällige Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: Die Gratis-Blättli des Multi-Milliardärs Blocher sind von der Bundes-Giesskanne ausgeschlossen. Dass der Feldherr vom Herrliberg strikte gegen die Medienförderung durch den Bund poltert, ist deshalb mehr als verständlich.
Dass er urplötzlich doch noch die Auszahlung seiner Pensionsansprüche als Bundesrat forderte, auf die er Jahre zuvor grosssprecherisch verzichtet hatte, könnte sogar damit zusammenhängen. Ein Schelm wer Böses denkt.
-
20.1.2022 - Tag der Sirenenklänge
Schweizer Sirenentest 2022
Am Mittwochnachmittag, 2. Februar 2022, findet von 13.30 bis 14.00 Uhr in der ganzen Schweiz die jährliche Kontrolle der Alarmsirenen statt. Dabei sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen.
Bei der Sirenenkontrolle wird die Funktionstüchtigkeit der stationären und mobilen Sirenen getestet, mit denen die Einwohner bei Katastrophen- und Notlagen oder im Falle eines be-waffneten Konfliktes alarmiert werden. Ausgelöst wird das Zeichen "Allgemeiner Alarm": Ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Wenn das Zeichen "All-gemeiner Alarm" jedoch ausserhalb des angekündigten Sirenentests ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufge-fordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren.
Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie auf Seite 680 und 681 im Teletext sowie im Internet unter www.sirenentest.ch.
Der Sirenentest dient neben der technischen Funktionskontrolle der Sireneninfrastruktur auch der Information und Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich Verhalten bei einem Sirenenalarm.
Die Bevölkerung wird um Verständnis für die mit der Sirenenkontrolle verbundenen Unannehmlichkeiten gebeten. Schreibt die Stadt Brugg in ihrer Medienmitteilung.
Liebe Weisse-Socken-Träger und Trägerinnen: Wenn am Mittwochnachmittag, 2. Februar 2022, schweizweit die Sirenen erklingen, steht nicht Putin mit seiner Armee am Zollamt in Basel, auch wenn Joe Biden einen Einmarsch der Russen in die Ukraine als realistisch erachtet. https://www.srf.ch/.../bidens-bilanz-nach-einem-jahr...
Nein, liebe Schweizerinnen und Schweizer mit oder ohne Weisse Socken, fürchtet Euch nicht ob der Sirenenklänge. Ich, Euer gebenedeiter Webmaster, bin bei Euch. Egal, wer da gerade mit verhärmten Gesichtern bei uns einmarschiert und bewaffnet mit Trycheln und Hellebarden fahnenschwingend durch die Schweizer Städte marodiert, um uns endlich die Freiheit zu bringen.
Am Mittwochnachmittag, 2. Februar 2022, findet von 13.30 bis 14.00 Uhr lediglich in der ganzen Schweiz die jährliche Kontrolle der Alarmsirenen statt. Dabei sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen.
Es wird so oder so niemals ein Diktator in die Schweiz einmarschieren. Denn sämtliche Diktatoren dieser Welt von Peking über Kasachstan bis Moskau und Belarus brauchen eine funktionstüchtige Bank. Und das ist nun mal die Schweiz.
Auch der gute Vladimir aus Moskau soll ja einige Hundert Millionen Rubel, Franken und Dollar bei Schweizer Banken parkiert haben.
Oder glaubt immer noch jemand an die Mär, Hitler sei wegen der Schweizer Armee nicht ins Land der Eidgenossen und Trychler einmarschiert? Selbst der GRÖFAZ (Grösster Führer aller Zeiten) brauchte eine funktionierende Bank. Wer ausser den Schweizer Banken hätte ihm denn sonst das Zahngold der ermordeten Juden in Devisen umgewandelt?
Ich gebe zu: Klingt etwas hart. Aber da müssen Sie leider durch. Die Schweiz ist nun mal kein Land. Sie ist eine Bank mit einem angeschlossenen Land. So wie die SWISSAIR zu ihren besten Zeiten eine fliegende Bank mit angeschlossener Airline war. Sie wurde nicht von einmarschierenden Invasoren zerstört, sondern durch ihre eigenen CEOs und Verwaltungsräte.
-
19.1.2022 - Tag der Bündner Blender
Raiffeisen-Affäre: Umfeld von Vincenz' Anwalt soll Sponsoring erhalten haben
Kurz vor Prozessbeginn rund um Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz kommt eine umstrittene Verstrickung zutage. Eine SRF-Recherche zeigt, dass das familiäre Umfeld des Anwalts, über den die Zahlungen der Spesen der Chefetage liefen, von einem Sponsoring profitierte.
Nächste Woche beginnt der Prozess im Wirtschaftskrimi rund um den Fall Pierin Vincenz und die Raiffeisenbank. Ein Punkt der Anklage sind die privaten Spesen, die sich der ehemalige Chef von der Bank auszahlen liess.
Für die Kontrolle der Spesen, Boni und Löhne der ehemaligen Geschäftsleitung in den Jahren 2001 bis 2017 war Eugen Mätzler, ein externer Anwalt, zuständig. Der Anwalt gehörte zu den ganz wenigen Personen, die einen Überblick über die umstrittenen Spesenabrechnungen bei der Raiffeisenbank hatte.
Möglicherweise heikle Verbindung
Nun zeigt sich, dass die Familie dieses externen Anwalts von einem Sponsoring der Bank profitierte. Raiffeisen bezahlte der Nichte von Eugen Mätzler, einer Golfspielerin, in den Jahren 2011 bis 2016 Sponsoringgelder von mutmasslich über 200'000 Franken.
Raiffeisen bestätigt das Sponsoring, will sich aber zur Höhe der Summe und den Details nicht äussern. Die Zahlungen ins familiäre Umfeld des Anwalts sind zwar legal, werfen aber Fragen zur Corporate Governance auf.
«Das erachte ich als eine gefährliche und eigentlich unangemessene Konstellation», kritisiert Rechtsprofessorin Monika Roth. Gefährlich, weil das Sponsoringgeld ins familiäre Umfeld jenes Mannes floss, der die Zahlungen ans Management kontrollierte.
Auch Urs Klingler, Experte für Vergütungen und Corporate Governance, ist skeptisch: «Es ist zwar üblich, dass viele Firmen ihre Zahlungen für die Geschäftsleitung auslagern. Wenn dann zwischen diesen Partner aber noch ein Sponsoring im Spiel ist, wirft das Fragen auf. Ich würde das als heikel bezeichnen.»
Anwalt: «Geld nicht auf meinem Konto»
Der Auftrag für das Sponsoring sei von Pierin Vincenz erteilt worden, wie ein Insider sagt. Die Zahlungen seien speziell gewesen, weil Golf damals nicht zu den unterstützten Sportarten von Raiffeisen zählte.
Die Zahlungen an die Nichte von Eugen Mätzler wurden bankintern als überrissen beurteilt, weil die Nachwuchssportlerin in der Öffentlichkeit unbekannt war. Mätzler wiederum sagt auf Anfrage von SRF, er habe mit dem Sponsoring nichts zu tun gehabt. Der Betrag sei nicht auf sein Konto geflossen. Schreibt SRF.
«Es gibt Blender, die sind so gut, dass sie sich sogar selber blenden», sagte die deutsche Lyrikerin Rose von der Au. Dass trifft beim extrovertierten und (ehemals) medienverliebten Pierin Vincenz den Nagel auf den Kopf. Heute wär' der gute Pierin wohl froh, wenn nicht so viele Artikel über ihn in der Presse erscheinen würden.
Tja, die Geister, die man ruft, wird man nicht mehr los. Das wusste schon Goethes «Zauberlehrling».
Obwohl man Kinder nicht für die Missetaten ihrer Eltern verurteilen und in Sippenhaft nehmen sollte, bringt einen ein kurzer Blick in die Vita von Gion Clau Vincenz, dem Vater von Pierin Vincenz, seines Zeichens Ständerat und ebenfalls Präsident der Raiffeisen-Gruppe von 1984 bis 1992, zur Erkenntnis, dass der Apfel manchmal, aber wirklich nur manchmal, tatsächlich nicht weit vom Stamm fällt.
-
18.1.2022 - Tag der Untoten und Vogelscheuchen
Nach Comeback-Erfolg von «Wetten, dass..?» Auch «Benissimo» kommt wieder zurück
2022 wird zum grossen Nostalgie-Fest. Nicht nur «Wetten, dass..?» kehrt noch einmal auf die Bildschirme zurück – auch der Schweizer Klassiker «Benissimo» feiert ein Comeback.
Das macht Freude! Nicht nur «Wetten, dass..?» kommt wieder. Auch der ehemalige Schweizer Strassenfeger «Benissimo» mit Beni Thurnheer (72) erlebt im Herbst ein Revival. Reto Peritz, Leiter Unterhaltung beim SRF, bestätigt gegenüber Blick: «Wir freuen uns auf ‹Benissimo› mit Beni als Moderator im Herbst als einmaligen Event zum 30-Jahr-Jubiläum. Neben einem Wiedersehen mit Beni werden auch die farbigen Kugeln, die Friends und tolle Showacts zu sehen sein.»
Blick hatte schon im vergangenen Jahr berichtet, dass beim SRF diskutiert wird, dass der Show-Hit «Benissmimo» (1992–2012) ein Comeback feiern soll. Beni Thurnheer (72) hatte zuvor im SonntagsBlick gemeint: «Ich würde das sofort und gern machen.»
Probleme vor Dreh
Allerdings schilderte er auch die Probleme einer Wiederaufnahme: «Die Redaktion wurde aufgelöst, und vom Studio sind nur noch die acht Kugeln der Millionenziehung und ein grosser Schriftzug übrig.» Zudem sei es schwierig, grosse Namen ins Studio zu bekommen. Die Stars würden keine CDs mehr verkaufen und seien nicht mehr auf Auftritte angewiesen. «Und natürlich müsste Swisslos wieder mit an Bord sein, um die Million zur Verfügung zu stellen», so die TV-Legende. Swisslos zieht sich aber diesen Frühling etwa auch aus der SRF-Sendung «Happy Day» zurück.
Nun sieht es danach aus, dass man diese Probleme lösen will. Es soll wieder getanzt werden, Sketchs wird es vermutlich auch wieder geben. Dass wieder Kugeln im Spiel sind, deutet darauf hin, dass auch wieder um Geld gespielt werden könnte. Das tönt doch benissimo! Schreibt Blick.
Das Revival der Untoten folgt einer uralten Marketingstrategie der Unterhaltungsindustrie: Tote bringen Quote.
Oder anders ausgedrückt: Wem nichts mehr einfällt, holt die alten Vogelscheuchen ins Rampenlicht zurück.
-
17.1.2022 - Tag der psychisch Kranken
Texas-Geiselnehmer laut Familie «psychisch krank»
Nach der gewaltsam beendeten Geiselnahme in einer Synagoge in den USA hat die Polizei den ums Leben gekommenen Tatverdächtigen als britischen Staatsbürger identifiziert. Es handle sich um einen 44-Jährigen mit dem Namen Malik Faisal Akram, teilte das FBI am Sonntag mit. Der bewaffnete Mann war tot geborgen worden, nachdem eine Spezialeinheit des FBI die Synagoge in Colleyville bei Dallas-Fort Worth in Texas am Samstag gestürmt hatte. Laut seiner Familie litt er an „psychischen Erkrankungen“.
Die vier Geiseln, die der Mann während eines Gottesdienstes genommen hatte, kamen unverletzt frei. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Geiselnahme als einen „Akt des Terrors“. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Täter nach seiner Ankunft im Land Waffen gekauft und seine erste Nacht in einer Unterkunft für Obdachlose verbracht, sagte Biden am Sonntag. Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris riefen die Bevölkerung zur Bekämpfung von Antisemitismus und Hass auf.
Familie meldete sich zu Wort
In Großbritannien meldete sich ein Bruder des Mannes zu Wort. Die Familie distanziere sich von der Tat und bitte die Betroffenen um Entschuldigung, schrieb der Bruder auf der Facebook-Seite der muslimischen Gemeinde der nordenglischen Stadt Blackburn.
Der Geiselnehmer sei psychisch krank gewesen. Während der Geiselnahme habe die Familie im Polizeirevier von Blackburn verweilt. Dort sei sie im Kontakt mit dem FBI und dem Geiselnehmer gewesen, habe ihn jedoch von seiner Tat nicht abbringen können.
Versuch, verurteilte Terroristin freizupressen
Ein mit dem Vorgang vertrauter Behördenvertreter hatte dem Sender ABC gesagt, der Geiselnehmer habe die Freilassung der in den USA inhaftierten pakistanischen Neurowissenschaftlerin Aafia Siddiqui verlangt. Sie war 2010 schuldig gesprochen worden, auf Soldaten und FBI-Beamte geschossen zu haben, und verbüßt in der Nähe von Fort Worth eine auf 86 Jahre angesetzte Gefängnisstrafe.
Ein Anwalt Siddiquis sagte dem Sender CNN, die Familie der Frau verurteile die Tat. Er widersprach der Behauptung des Geiselnehmers, er sei Siddiquis Bruder. Schreibt die Kronenzeitung.
Es fällt auf, dass bei den meisten Terroranschlägen eine «psychische» Erkrankung geltend gemacht wird.
Diese Krankheitsdiagnose wird wohl zutreffen. Nicht nur auf die Muslime. Solch blindwütiger und kompromissloser Fanatismus muss ja irgendwo seine Ursachen haben.
Für die einen ist es vermutlich die neue christliche Bibel der Esoterik, die sie die Trychlen schwingen lässt. Für die andern der Koran, der mit Jungfrauen lockt, wenn man einen Andersgläubigen tötet.
Soweit sind die Trychler allerdings (noch) nicht. Die sind erst bei der Stürmung des Bundeshauses angekommen, die aber glücklicherweise kläglich scheiterte.
-
16.1.2021 - Tag der Balkantrychler
Novak Djokovic muss Australien verlassen
Novak Djokovic darf nicht an den Australian Open teilnehmen und muss ausreisen. Wie das Bundesgericht in Australien am Sonntag entschied, wurde der Einspruch des serbischen Tennisprofis gegen seine verweigerte Einreise und die Annullierung des Visums abgelehnt. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, hieß es in der Bekanntgabe der drei Richter. Die Begründung solle frühestens am Montag erfolgen.
Gegen das Urteil können beide Seiten vor dem Bundesgericht keine Rechtsmittel einlegen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur AAP zufolge ist eine Berufung vor dem High Court, dem höchsten Gericht Australiens, möglich. "Ich respektiere die Entscheidung des Gerichts und werde mit den zuständigen Behörden in Bezug auf meine Ausreise kooperieren", schrieb Djokovic in einem Statement.
Damit kann der 34 Jahre alte Djokovic seinen Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne nicht verteidigen. Sein Ziel war, mit dem 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier alleiniger Rekordhalter vor Roger Federer und Rafael Nadal zu werden. "Es ist mir unangenehm, dass der Fokus in den letzten Wochen auf mir lag, und ich hoffe, dass wir uns jetzt alle auf das Spiel und das Turnier konzentrieren können, das ich liebe", sagte Djokovic.
Lange Sitzung
Die Sitzung hatte gegen 9.30 Uhr (Ortszeit) begonnen. Um kurz vor 18.00 Uhr Ortszeit wurde die Entscheidung bekannt. Wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete, hatte Djokovic die Sitzung aus dem Büro seiner Anwälte in Melbourne verfolgt. Die Nacht vor der Verhandlung beim Bundesgericht hatte der Rekordsieger der Australian Open in einem Abschiebehotel verbracht.
Der abschließenden Verhandlung war eine tagelange Hängepartie vorausgegangen. Am Freitag war sein Visum in einer persönlichen Entscheidung von Einwanderungsminister Alex Hawke ein zweites Mal für ungültig erklärt worden. Der Weltranglisten-Erste ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und deswegen eine umstrittene Person in dem Land, das seit Beginn der Pandemie harte Regeln aufgestellt hat.
Als ihm die Behörden in der vorigen Woche die Einreise verweigert hatten, war er vorübergehend in ein Abschiebehotel gebracht worden. Eine erste Gerichtsentscheidung am Montag war zu seinen Gunsten ausgefallen, Djokovic hatte daraufhin die Vorbereitung auf die Australian Open fortgesetzt. "Ich werde mir jetzt etwas Zeit nehmen, um mich auszuruhen und zu erholen, bevor ich weitere Kommentare abgebe. Ich bin sehr enttäuscht über die Entscheidung des Gerichts und dass mein Visum annuliert bleibt", sagte Djokovic. Schreibt DER STANDARD.
Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen aus Serbien erfahren haben, wird No-Vac Djoko-Vir Australien auf dem Seeweg verlassen: Er wandert wie weiland der Jesus aus Nazarethzu Fuss über den Ozean zurück nach Monaco, wo er wohnt, weil's dort halt doch etwas schöner, angenehmer und ruhiger ist als auf dem Balkan.
Ob der neu erkorene serbische Jesus vor seiner Abreise im Immigrantenhotel von Melbourne für die dortigen Insassen*innen eine Badewanne voll Wasser in Wein verwandeln wird, weiss auch unser Whistleblower aus Belgrad nicht.
Drei Erkenntnisse aber sind gewiss: Blick und alle anderen grossartigen «Qualitäsmedien» können ab sofort den Liverticker in Sachen Djoko-Vir abschalten, die Trychler können No-Vac definitiv als Ehrenmitglied in ihrem Verein aufnehmen und Federer wäre das nicht passiert. Er ist nämlich geimpft.
-
15.1.2022 - Tag des serbischen Lügendetektors
Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte. Das ist bei diesem SPIEGEL-Cartoon der Fall.
https://www.spiegel.de/fotostrecke/cartoon-des-tages-fotostrecke-142907.html
-
14.1.2022 - Tag des Königs Lauwiner von Burgdorf
Der Zuger Automatiker Jonas Lauwiner hat ein Wappen, seine eigene Währung und ein Schloss: «Ich bin der König von Burgdorf»
Schon als Kind träumte Jonas Lauwiner davon, ein richtiges Imperium zu besitzen. Anstatt am Computer Strategie-Spiele zu spielen, erobert er Land im echten Leben. Heute hat er ein eigenes Reich.
Eine prunkvolle Krone, ein glänzender Säbel, eine alte Kanone und eine Uniform, die nur ein Staatsmann trägt. So inszeniert sich Jonas Lauwiner (27) aus Zug. Er liebt die absolutistische Zeit und will sich sein eigenes kleines Imperium erschaffen – das Imperium Seiner Königlichen Hoheit, des Königs und Kaisers des Lauwiner Empire, Jonas I. von Lauwiner. So nennt sich der gelernte Automatiker auf seiner eigenen Website.
Ein kleines Stück Land war der Anfang seines Imperiums. Das hatte Lauwiner von seinem Vater zum 20. Geburtstag geschenkt bekommen. «Es war ein unbeschreibliches Gefühl, ein Stück Land zu besitzen», sagt er. Seine Familie habe vor 200 Jahren viel besessen, doch im Laufe der Zeit seien die Grundstücke durch Verkauf und Erbschaften verloren gegangen.
65'000 Quadratmeter Land
«So kam auch die Idee, mehr Land zu ‹erobern›», sagt Lauwiner. Was er damit meint: Er sucht herrenlose Gebäude, Privatstrassen und Wälder – und erwirbt diese für wenig Geld bei den jeweiligen Gemeinden. Heute besitzt er nach eigenen Angaben bereits rund 65'000 Quadratmeter. Seine neuste Eroberung: ein 5800 Quadratmeter grosses Industrieareal in Burgdorf BE.
«Da mich Königreiche faszinieren, benutze ich die Begriffe aus dieser Zeit wie zum Beispiel ‹erobern›», sagt er. Was bei einem König nicht fehlen darf, ist das passende Outfit: «Raiffeisen hat die roten Krawatten, ich habe meine Uniform als Markenzeichen.» Dazu besitzt er einen Degen, eine Kanone und wurde sogar gekrönt. Die Zeremonie in der Nydeggkirche in Bern fand 2019 statt. Als Zeichen für die Nachwelt: «Ich möchte nicht als Geschäftsmann vergessen werden. Ich will als König in Erinnerung bleiben», sagt Seine Hoheit.
«Die ganze Zeremonie musste genau geplant werden. Ich musste ja auch die Kirche mieten», erklärt Lauwiner. Die Personen bei der Krönung seien Bekannte und Schauspieler gewesen. Er betont aber: «Ich bin nun König über meine Ländereien, trotzdem bin ich stolzer Schweizer Bürger, befolge alle Regeln und Gesetze, zahle meine Steuern.»
«Viele Leute glauben, ich sei rechtsradikal»
Doch dabei bleibt es nicht: «Ein richtiges Imperium hat auch eine eigene Währung. Die habe ich auch», sagt er. Den «Empire Vellar» ziert selbstverständlich sein Antlitz, eine Münze hat den Wert von rund 23 Franken. Sogar ein Wappen und einen Familienstammbaum, der weit ins 17. Jahrhundert zurückreicht, zeigt er auf seiner Website. Die Lauwiner Empire Legion soll das Bild vervollständigen. Jedes Königreich habe schliesslich eine Legion.
«Viele Leute glauben, ich sei rechtsradikal. Das liegt an der Kanone, die vor meinem Sitz steht», sagt Lauwiner. Dem sei aber nicht so. «Ich bin ein Schweizer, ich mag die militärische Struktur und Ordnung, aber ich möchte keiner Menschenseele etwas Böses.»
Lauwiner erklärt weiter: «Einige glauben, ich wolle die Schweiz einnehmen oder eine eigene, unabhängige Nation gründen.» Auch das sei falsch. Er finde lediglich Gefallen an dem Gedanken, eine Immobiliendynastie in der Art einer Monarchie aufzubauen, damit er der Nachwelt etwas hinterlassen könne. «Dieses Imperium einmal zu vererben, ist mein grösstes Ziel», sagt der König von Burgdorf. Schreibt Blick.
«Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt». In Anlehnung an dieses berühmte Zitat von Napoleon Bonaparte, der sich ja auch selbst zum Kaiser von Frankreich krönte, sei festgehalten, dass es vom Schloss in Burgdorf bis zur Klapsmühle St. Urban auch nicht sehr weit ist. Da bleibt am Schluss von einem Lauwiner dann wirklich nur noch der Schlawiner übrig.
Und möglicherweise ein paar Betrugsanzeigen.
-
13.1.2021 - Tag der Uriellas aus den Schweizer Qualitäsmedien
Schweizer Immobilienmarkt: Hypothekarzinsen auf langjährige Kredite steigen wieder
In der Schweiz werden derzeit die Hypotheken etwas teurer. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage. Die Hypothekarzinsen für langjährige Kredite sind auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. In der Zeit der Pandemie war die Nachfrage nach Eigenheimen besonders gross.
Wer sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, braucht in der Regel Geld. Zum Beispiel von der Bank eine Hypothek. Diese Hypotheken waren in den vergangenen Jahren so billig wie noch nie. Doch nun kommt allmählich Bewegung in den Markt.
Laut einer aktuellen Umfrage der Zeitung «Finanz und Wirtschaft» ist der Hypothekarzins im Durchschnitt um rund 0.25 Prozentpunkte gestiegen – innerhalb eines Monats. Für zehnjährige Hypotheken zum Beispiel verlangen die Banken inzwischen bis zu 1.6 Prozent Zins.
Die Banken sind vorsichtiger geworden. Aufgrund der steigenden Inflation werden auf dem Kapitalmarkt höhere Zinsen verlangt als auch schon. Dies schlägt auf die Hypotheken durch.
Pandemie steigert Nachfrage nach Eigenheim
Das Geschäft mit den Hypotheken ist in der Schweiz in den vergangenen Jahren markant gewachsen. Viele haben Schulden gemacht, um sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen zu können. In der Zeit der Pandemie war die Nachfrage nach Eigenheimen besonders gross.
Die Hypothekenkredite haben in den letzten zehn Jahren bei den Banken um 43 Prozent zugenommen, auf inzwischen 1100 Milliarden Franken, wie aktuelle Zahlen zeigen.
Kaum Auswirkungen auf Immobilienmarkt
Die etwas teureren Hypotheken hätten derzeit nur wenig Auswirkungen auf den Kauf von Eigenheimen, ist Claudio Saputelli überzeugt. Er leitet bei der UBS den Bereich Immobilien-Research. «Die Banken wenden bei der Hypothekenvergabe sowieso den kalkulatorischen Zins von 4.5 bis 5 Prozent an.» Deshalb ändere sich bei der Tragbarkeit einer Hypothek eigentlich nichts.
Und auch die Nachfrage nach Wohneigentum werde durch den leichten Zinsanstieg kaum gebremst: «Dafür müsste der Zinsanstieg deutlich stärker sein.» Für die nächsten Monate geht Saputelli nicht davon aus, dass die Tiefzinsphase rasch beendet wird: «Wir sehen deshalb keinen Grund zur Panik für die Eigenheimbesitzer.» Schreibt SRF.
Alles halb so schlimm. Auch wenn einige Uriellas der Schweizer «Qualitätsjournalismus»-Medien schon wieder das Platzen der Immobilienblase herbei schreiben.
Ballone platzen nicht mit Ansage. Sie platzen einfach. Von einer Sekunde auf die andere.
Die Weltfinanzkrise mit Beginn im Jahr 2007 kam schliesslich auch über Nacht. Ausser ein paar Warnern in der Wüste, die niemand wirklich erst nahm, wurde sie von kaum einem dieser «Qualitäsjournalismus»-Medien im Vorfeld erkannt.
-
12.1.2022 - Tag der Schweineherzen
Erstmals einem Patienten erfolgreich Schweineherz eingesetzt
Ein Transplantationsteam in den USA hat nach eigenen Angaben erstmals ein genetisch modifiziertes Schweineherz an einen menschlichen Patienten angeschlossen. Das Organ sei einem 57-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit in einer Klinik in Baltimore (Maryland) eingesetzt worden, teilte das Krankenhaus am Montag mit. Die Operation dauerte laut US-Medien acht Stunden, das transplantierte Herz habe seitdem seine Arbeit aufgenommen, dem Patienten gehe es gut.
«Diese Organtransplantation zeigt erstmals, dass ein genetisch verändertes Tierherz wie ein menschliches Herz funktionieren kann, ohne dass es der Körper sofort abstösst», teilte das University of Maryland Medical Center mit. Der Patient – der für ein menschliches Spenderherz als nicht geeignet eingestuft wurde – werde die kommenden Wochen weiter genau beobachtet.
Patienten geht es gut
«Dies war eine bahnbrechende Operation und bringt uns der Lösung der Knappheit bei Organen einen Schritt näher», wurde der durchführende Arzt Bartley Griffith zitiert.
Der Patient sagte der Mitteilung zufolge, dass es Entscheidung über Leben und Tod war: «Ich weiss, es ist ein Schuss ins Dunkel, aber es ist meine letzte Chance». Er freue sich darauf, zu genesen und wieder aus dem Bett aufstehen zu können.
Die aufsehenerregende Transplantation könnte Hoffnung für Tausende Menschen allein in den USA nähren, die auf Spenderorgane angewiesen sind. Wissenschaftler versuchen seit geraumer Zeit, Organe in Schweinen zu züchten, die für Menschen nutzbar sind – neben Herzen auch Nieren oder Lungen.
Noch am Anfang
Bei dem nun gemeldeten medizinischen Durchbruch bleiben zunächst aber noch viele Fragen offen, vor allem die nach der Langlebigkeit des Organs. Die Erkenntnisse sind zudem noch in keinem Fachmagazin veröffentlicht worden.
Die Geschichte der Entwicklung von Xenotransplantationen, also der Übertragung von Zellen oder Organen von einer Spezies auf eine andere, ist lang und von Niederschlägen gekennzeichnet. Spektakulär war vor allem der Fall von Baby Fae, das 1984 in Kalifornien ein Pavianherz bekam. Es starb drei Wochen nach der Operation. Schreibt SRF.
Frei nach Willy Brandt: «Endlich kommt zusammen, was zusammen gehört.»
-
11.1.2022 - Tag der ideenlosen Coiffeure
Omikron legt KMU lahm – Coiffeur Nino Colonna (49) fordert nun Hilfe vom Staat: «Mein Lebenswerk geht flöten»
Blumenläden, Coiffeursalons und anderen KMU fehlt massenhaft Personal. Ihre Angestellten sitzen in Isolation und Quarantäne. Das bringt die Betriebe ins Schlingern. Umsatzentschädigung? Fehlanzeige.
Die Schaufenster bleiben dunkel: «Wegen Krankheit geschlossen», prangt an der Tür eines Pflanzen- und Blumengeschäfts in der Stadt Zürich. «Die Hälfte meiner Angestellten steckt in Isolation. Es ging einfach nicht mehr anders», bestätigt die Inhaberin und Geschäftsführerin auf Anfrage von Blick.
Sie will anonym bleiben, wie viele andere Kleinbetriebe, die aus Personalmangel zwangsweise schliessen müssen. Die Thematik um Omikron-bedingte Personalausfälle ist heikel, politisch aufgeladen, so die Blumenladeninhaberin stellvertretend. Weit über 100'000 Menschen harren derzeit in Isolation aus. Und es werden jeden Tag mehr. Die Omikron-Welle beschert der Schweiz täglich über 30'000 Neuansteckungen.
Das schlägt vor allem auf die KMU durch. Bisher waren vor allem Restaurants und Hotels in den Bergen von Schliessungen betroffen. Nun weitet sich das Problem auch auf andere Branchen aus. «Je kleiner der Betrieb, desto dramatischer», sagt Roland M. Rupp (55), Präsident des Schweizerischen KMU Verbands. «Bei einem Drei-Mann-Betrieb reicht schon ein einziger Ausfall, um alles ins Schlingern zu bringen.» Rupp kommen täglich Fälle zu Ohren. Im Baugewerbe und in der Maschinenindustrie etwa müssen Aufträge nach hinten verschoben werden, das zieht teilweise Konventionalstrafen nach sich. Offen darüber sprechen wolle allerdings kaum jemand. «Die Betriebe haben Angst, dass die Kunden verunsichert werden und sie abspringen.»
«Wir Arbeitgeber müssen die Bilder aus Adelboden ausbaden»
Nino Colonna (49) allerdings steht zu seinen Personalproblemen. Er führt mit seinem Coiffeurgeschäft Glanz & Gloria fünf Filialen im Kanton Bern. Sechs seiner 17 Angestellten fallen derzeit aus. «Wenn es so weitergeht, sitzen bald alle meine Mitarbeiter mit einem positiven Test zu Hause. In manchen Filialen habe ich nur noch eine Person im Einsatz», erzählt Colonna. «Die färbt Haare und muss gleichzeitig neue Termine annehmen und bestehende verschieben.» Ob seine Kundschaft ihm treu bleibt, ist fraglich. Wer will schon wochenlang auf den Haarschnitt warten? «Ich habe Angst, wegen des ganzen Chaos Kunden zu verlieren», sagt Colonna.
In einer Woche sollte sich die Personalsituation in Colonnas Läden verbessern – sofern bis dann nicht weitere Mitarbeitende ausfallen. Wer aktuell noch arbeitet, hat einen negativen Test. Im Betrieb gibt es Schutzkonzepte, die Coiffeure und Coiffeusen tragen stets Masken. «Es macht mich hässig», stellt der Unternehmer klar. «Ich sehe die Bilder aus Adelboden. Und wir als Arbeitgeber müssen das dann ausbaden?» In Adelboden BE haben am Wochenende Zehntausende die Skirennen und den Sieg von Marco Odermatt am Chuenisbärgli gefeiert. Die Bilder Tausender Skifans ohne Masken sorgten für Stirnrunzeln.
«Wir Arbeitgeber müssen die Bilder aus Adelboden ausbaden»
Der Gewerbeverband unter Direktor Hans-Ulrich Bigler (63) will die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen – oder gleich ganz abschaffen, um Gewerblern wie Colonna zu helfen. «Aber was wirklich möglich ist, müssen letztlich die Gesundheitsexperten beurteilen», schränkt Bigler ein. Er betont ausserdem: «Die KMU halten ihre Arbeit so lange aufrecht wie irgendwie möglich. Sie jammern nicht rum, sondern suchen nach Lösungen.»
Wie Colonna, dessen Coiffeurbusiness trotz Personalengpass weiterläuft – wenn auch auf Sparflamme. Er hat auch gar nicht viel Spielraum, denn die drohenden Umsatzausfälle sind happig. Schon eine einwöchige Schliessung würde ihn mehrere Zehntausend Franken kosten. «Wer ersetzt mir das?», ärgert er sich. Er fordert vom Staat, Geld locker zu machen. «Ich war seit zehn Jahren nicht in den Ferien, habe alles in mein Geschäft investiert. Das ist mein Lebenswerk – und jetzt geht alles flöten! Das macht mir Angst und bereitet mir schlaflose Nächte.»
Besonders um seine Angestellten ist Colonna besorgt. «Sie sind für mich wie eine Familie. Sie haben angeboten, auf 50 Prozent ihres Lohns zu verzichten. Aber das kann doch nicht die Lösung sein!» Ob die Lösung für Colonna und andere KMU eine verkürzte Quarantänedauer ist, zeigt sich am Mittwoch. Dann trifft sich der Bundesrat zu seiner nächsten Sitzung und berät auch über eine mögliche Verkürzung von Isolation und Quarantäne. Schreibt Blick.
Das süsse Gift der finanziellen Corona-Hilfsmassnahmen der Bundes-Giesskanne aus den letzten zwei Jahren hinterlässt Spuren. Ein Anspruchsdenken macht sich breit, das in etlichen Fällen mehr mit Raubrittertum als mit echter Not zu tun hat. Die Schweizer Kantone untersuchen ja nicht umsonst tausende von mutmasslichen Betrugsfällen im Zusammenhang mit der Corona-Hilfe.
2020 veröffentlichte das Luzerner Online-Portal Zentralplus eine Fotoreportage über 24 (in Worten: vierundzwanzig) Läden in der Luzerner Altstadt, die infolge der Corona-Pandemie geschlossen waren und nach neuen Mietern suchten.
Schon damals war klar, dass die meisten dieser Geschäfte auch ohne Corona früher oder später hätten aufgeben müssen. Überholte Geschäftsmodelle haben nun mal keine echte Zukunft vor sich.
Kommt hinzu, dass Klumpenrisiken wie die ausschliessliche Konzentration auf die asiatischen Gäste, die Luzern über ein Jahrzehnt fluteten, seit jeher ein «Risky Business» darstellen.
Auch wenn der Direktor des Gewerbeverbandes, Hans-Ulrich Bigler, das anders sieht: Die Äusserungen des Berner Coiffeurs sind nichts anderes als Jammern auf hohem Niveau und die Suche, besser gesagt die Forderung nach Lösungen des geringsten Widerstands, sprich der Ruf nach der staatlichen Giesskanne.
Smarte Ideen wie beispielsweise der Einsatz von Temporärkräften werden gar nicht diskutiert. Sätze wie «Wer ersetzt mir das?» und «er (Anm. der Coiffeur) fordert vom Staat, Geld locker zu machen» sind zu einfach. Zu simpel. Zu egoistisch.
Ein Rundgang vor knapp drei Wochen durch die Luzerner Altstadt auf der Suche nach den 2020 «wegen Corona» geschlossenen Läden zeigte, dass alle, aber auch wirklich alle Lokale wieder vermietet sind. Allerdings an Geschäfte und Unternehmen mit neuen, hippen Geschäftsmodellen.
Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das hat mit Corona nichts zu tun. Ausser mit der Tatsache, dass Corona nur beschleunigt, was in unserer kurzlebigen Zeit ohnehin nicht aufzuhalten ist.
Die unsägliche SRF-Sendung «Glanz und Gloria» ist ja inzwischen auch dorthin verschwunden, wo sie hingehört: In den Orkus. Ob das für den Berner Coiffeur ein schlechtes Omen ist, sei dahingestellt. Das wissen nur die Götter aus dem Reich der Untoten. Und die sagen es nicht.
-
10.1.2022 - Tag der Alarmismus-Schwurbelei
Das kostet viel Geld: Der Schweiz gehen die Arbeitskräfte aus
Der Fachkräftemangel ist viel dramatischer als bisher angenommen. Exklusive Zahlen zeigen, dass bereits in vier Jahren in der Schweiz an die 365'000 qualifizierte Fachkräfte fehlen. Es droht deshalb ein Wohlstandsverlust.
Omikron bietet einen Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Jahren für die Schweizer Wirtschaft zu einem Riesenproblem werden wird: Personalnot! Dabei ist der aktuelle Mangel in der Pandemie das bedeutend kleinere Problem.
Das Reservoir an qualifizierten Fachkräften droht in der Schweiz zu versiegen. Das sind Arbeitnehmende, die über einen Berufs- oder einen Hochschulabschluss verfügen. Hierzulande sind das über 80 Prozent aller Arbeitskräfte.
Was noch schlimmer wiegt: Es tut sich eine Lücke auf zwischen der Nachfrage der Wirtschaft, die laufend neue Stellen schafft, und dem immer knapperen Angebot auf dem Arbeitsmarkt. Die Schweiz droht Opfer ihres eigenen wirtschaftlichen Erfolgs zu werden.
Bedrohung für den Wohlstand
«Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden enorm sein», sagt Tino Senoner (62), Geschäftsführer von Dynajobs. Der Arbeitsmarktexperte hat für den Verband Angestellte Schweiz das Ausmass der Lücke berechnet. Die Zahlen liegen Blick exklusiv vor.
Bis ins Jahr 2025 fehlen in der Schweiz an die 365'000 Fachkräfte. Der Grund ist klar: Es gehen mehr Leute in Pension, als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Dieser Trend setzt sich fort und verschärft sich. Im Jahr 2035 fehlen sogar über 1,2 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte.
Das ist einschneidend und bedroht den Wohlstand in der Schweiz: «Dieser Mangel an Personal kostet die Wirtschaft alleine bis ins Jahr 2025 an die 60 Milliarden Franken an Wertschöpfung», befürchtet Senoner. Das heisst, mit mehr Personal könnte die Schweizer Wirtschaft stärker wachsen.
Der Grund: «Ohne genügend Fachkräfte bleibt zu wenig Zeit für Ideen und neue Produkte. Darunter leidet die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz», sagt Alexander Bélaz (46), Präsident von Angestellte Schweiz.
In der rohstoffarmen Schweiz gehören gut ausgebildete Arbeitskräfte zu den wichtigsten Ressourcen der Wirtschaft. «Diese Ressourcenknappheit ist eines der bedeutendsten Geschäftsrisiken in der Industrie und mittelfristig eine Gefahr für den Innovationsstandort Schweiz», ergänzt Bélaz.
Bisherige Rezepte greifen nicht
Die Lage ist so ernst, dass sich die Sozialpartner für einmal nicht widersprechen. «Dieser bereits bestehende und sich zunehmend akzentuierende Mangel ist für die Schweizer Wirtschaft einschneidend», sagt Simon Wey (45), Chefökonom des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes. «Fehlen zukünftig Arbeitskräfte, so verliert der Wirtschaftsstandort Schweiz einen wichtigen Wettbewerbsvorteil zur Schaffung von Wohlstand.»
Das grosse Problem: Die bisherigen Rezepte gegen den Fachkräftemangel – Zuwanderung und Produktivitätssteigerung – greifen nicht mehr. Denn die Schweiz ist mit diesem Mangel nicht alleine, qualifizierte Arbeitskräfte werden global knapp.
«Im gesamten deutschsprachigen Raum fehlen bis in vier Jahren an die zwei Millionen Fachkräfte», sagt Senoner. Und selbst wenn die Arbeitskräfte in der Schweiz immer effizienter und produktiver werden, das Fehlen neuer Kolleginnen und Kollegen können sie dadurch nicht überbrücken.
Senoner hat fünf Schlüsselbranchen ausgemacht, die für rund die Hälfte der gesuchten Fachkräfte stehen. Dazu gehört der ganze Informatikbereich: «Jedes Unternehmen will und muss automatisieren und digitalisieren, das schafft eine enorme Nachfrage nach Leuten mit vertieften IT-Kenntnissen», so Senoner. Aber auch im Gesundheitswesen wird die Lücke immer grösser oder in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.
Selbst Detailhandel und Logistik suchen händeringend nach erfahrenen Einkäufern, Chauffeuren oder Expertinnen für moderne Lagerbewirtschaftung.
Es müssen neue Lösungen her, dafür braucht es ein Umdenken. «Die Unternehmen müssen nun in die Weiterbildung der eigenen Angestellten investieren. Dazu gehört vor allem auch die Weiterentwicklung und Umschulung älterer Arbeitnehmer», sagt Bélaz vom Angestelltenverband. «Prioritär aus Sicht der Arbeitgeber ist die Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials», ergänzt Arbeitgeber-Chefökonom Wey.
Er denkt dabei auch an die Älteren: «Der Arbeitgeberverband will die Generationen-Zusammenarbeit fördern und stärkere Anreize für eine Arbeit übers Pensionsalter hinaus schaffen.» Zudem soll mithilfe der Politik das Angebot an Kitas und ähnlichen familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten ausgebaut werden.
Denn auch bei Frauen liegt noch viel Potenzial brach. Darauf kann die Wirtschaft je länger je weniger verzichten. Schreibt Blick.
Richtig peinlich wird der ohnehin schon peinliche Artikel mit dem Hinweis auf Omikron. Eine temporäre Erscheinung am Virushimmel wird für die unsägliche Alarmismus-Schwurbelei gleich mit verbraten. Ein Schelm wer Böses denkt. Ich gebe zu, ein Schelm zu sein.
Frei nach Inspektor Colombo: Eine Frage hätt' ich noch: Sind denn die Tausenden von Migranten*innen, die monatlich die Schweiz erreichen, gar keine Akademiker oder Flugzeug- und Raumfahrttechniker, wie uns die einschlägigen Apologeten der grenzenlosen Schweizer Migrationspolitik stets weiszumachen versuchen?
-
9.1.2021 - Tag des serbischen Messias
Der Trotzkopf aus Serbien: Warum Novak Djokovic so oft und heftig aneckt
Der jüngste Fettnapf, in den der in Australien gestrandete Novak Djokovic (34) getrampelt ist, ist nur einer von vielen. Warum immer er? Ein Versuch, den serbischen Tennisstar zu erklären.
Die Geschichte des Novak Djokovic – sie beginnt wie eine männliche Version des Aschenputtel-Märchens. Oder des Froschkönigs. Es war einmal ein armer serbischer Junge, der im vom Krieg zerbombten Dorf Kopaonik an der serbisch-kosovarischen Grenze und bei seinem Grossvater in Belgrad aufwuchs. Der für Brot, Milch und Wasser Schlange stehen musste, aus Zeitvertreib Tennisbälle an eine mit Schusslöchern versehrte Steinwand schlug. Und dabei so viel Talent bewies, dass er eines Tages auszog, die Tenniswelt das Fürchten zu lehren.
Die Eltern, die in einer Pizzeria arbeiteten, opferten den letzten Heller für den Ältesten ihrer drei Söhne, stellten die Wünsche der beiden jüngeren Marko und Djordje hintan, weil schlicht nicht mehr möglich war. Sie verschuldeten sich auf der Suche nach mehr Geld für ihren «Nole» bei mafiösen Kriminellen, versetzten sich und die ganze Familie damit in Gefahr.
Der serbische Junge aber verfolgte unbeirrt sein Ziel. Feilte allein in fremden Ländern an seiner Tenniskunst, mit zwölf Jahren bei Nikola Pilic in Deutschland, debütierte 2003 als Profi. Zwei Dekaden später ist er der mit über 150 Millionen Dollar Rekordpreisgeld belohnte Tenniskönig der Welt. Ist seit 354 Wochen die Nummer 1. Vielleicht sogar der beste Spieler der Geschichte.
Ersehnte Liebe bleibt verwehrt
Mehr Märchenpotenzial geht nicht. Wären da nicht immer wieder diese seltsamen Nebenschauplätze in der Djokovic-Story. Im Kampf gegen die Stiefmutter leidet jeder mit Aschenputtel. Und ein glücklicher Froschkönig geniesst alle Sympathien – selbst wenn der keine Prinzessinnen, sondern Pokale küsst. Aber dieser Märchenprinz scheint nicht rundum glücklich. Weil ihm schlicht die globale Liebe verwehrt bleibt, die er sich so sehr wünscht.
Er kann siegen, so viel er will, immer wieder versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, grosszügig für wohltätige Zwecke spenden, seinen Status für Verbesserungen im gebeutelten Heimatland oder auf der Tennis-Tour nutzen – das alles tut er, keine Frage. Aber es nützt nichts. Beim mittellosen Jungen aus Kopaonik, der Wunder vollbracht hat und dafür grossen Respekt verdient, bleiben die Gefühle vieler Menschen zwiespältig.
In seiner Heimat ist er für sein Schaffen zwar ein Held, geradezu ein Heiland. Aber seine fanatisch anmutende Anhängerschaft in den Balkanländern schlägt obendrein wie ein Bumerang beim Rest der Welt ein. Je vehementer das serbische Volk Diskriminierung moniert, je pathetischer ihm der umstrittene Präsident Aleksandar Vucic huldigt, desto weniger Anerkennung erntet der tragische Held weltweit. Je göttlicher ihn seine gläubige Familie darstellt (Mutter Dijana hält ihren Sohn für «von Gott auserwählt») und je mehr sie die Konkurrenz beleidigt (Vater Srdjan über Federer: «Komm schon, erzieh deine Kinder, mach was anderes, geh Ski fahren»), desto mehr Schatten fällt über den Stammhalter.
Gerecht oder ungerecht? Schwierige Frage. Tatsache ist: Nicht nur seine Herkunft ist dafür verantwortlich, dass die Djokovic-Geschichte eher Drama statt Märchen, bestenfalls Tragikomödie ist. Auch dieser Mann ist seines eigenen Glückes Schmied. Dass er dabei nicht immer ein glückliches Händchen hat, bahnte sich schon mit den ersten Grosserfolgen an.
Asket mit Schokolade
Kaum wurde Djokovic als ernsthafte Gefahr und Herausforderer für die beliebten Rekordsammler Roger Federer und Rafael Nadal ernst genommen, verscherzte er es sich, indem er sich als Komiker ausgab und Spielerkollegen imitierte. Dies durchaus gelungen – aber nicht alle seine «Opfer» fanden es lustig, manche warfen ihm sogar Respektlosigkeit vor. So war es kaum gemeint. Aber der Serbe wird eben oft missverstanden.
So landeten auch seine häufigen Aufgaben von Matches bei vielen im falschen Hals. Verletzungen, Atemlosigkeit – auch alles nur Imitation? Täuscht er seine Leiden nur vor, wenn ihm der Spielstand zu brisant wird – oder um seine Gegner aus dem Takt zu bringen? Nach zahlreichen Untersuchen entdeckte ein Arzt 2012 eine Glutenintoleranz, die der Ursprung von Djokovics Anfälligkeit sein soll. Der Verzicht auf Gluten, Laktose und letztlich die Umstellung auf vegane Ernährung wirkten tatsächlich Wunder. Der Tennisasket wurde immer stabiler und eroberte die Weltrangliste kontinuierlich.
Und dann sein Umgang mit den Medien. Bei den internationalen Journalisten gilt er als wort- und sprachgewandt, intelligent, humorvoll und galant. Zunehmend jedoch auch als etwas anbiedernd. Vor allem wenn er seinen grossen Respekt für Federer und Nadal in geradezu unterwürfiger Lobhudelei ausspricht oder in Medienkonferenzen zur Feier eines siegreichen Tages Schokolade verteilt. Eigentlich ja nett – aber mit der Zeit wurde sein übertriebener Charme immer unglaubwürdiger.
Denn er passt so gar nicht zu seinem kämpferischen, martialischen Auftreten auf dem Court. Dort zerreisst sich der «Djoker» im Siegesrausch seine T-Shirts, um sich wie King Kong auf seine nackte Brust zu klopfen. Von dem hat er vielleicht auch seine furchteinflössenden, affenartigen Urschreie, die er in Momenten höchster Anspannung ablässt. Läufts ihm nicht, zertrümmert oder schleudert er in blinder Wut seine Rackets fort oder tritt heftig in die Banden. Aber Achtung: Hat er die Menge erst einmal gegen sich – vielleicht auch, weil er gegen einen Publikumsliebling wie Federer spielt –, und signalisiert seine Leidensmiene unter Buhrufen grösste Verzweiflung, dann ist er am gefährlichsten!
Allein gegen den Rest der Welt
In der Rolle des «Spielverderbers» scheint sich der Familienvater, der mit seiner Jugendliebe Jelena die zwei Kinder Stefan (7) und Tara (4) grosszieht, am wohlsten zu fühlen. Das zeigt sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Alleine gegen den Rest der Welt – das zieht sich bei Novak seit der Kindheit durch. Dazu gehört auch die Gründung der «Professional Tennis Players Association» (PTPA), die der Allmacht der Spielervereinigung ATP entgegenwirken und den Spielern zu mehr Einfluss und Entscheidungsgewalt verhelfen soll.
Seine Revolutionsattacke lancierte der PTPA-Präsident kurz vor den US Open 2020. Just als nach Monaten des pandemischen Ausnahmezustands endlich wieder etwas Normalität in die Tour kommen sollte. Er spaltet seitdem die Tennisszene in zwei Lager – zur Opposition gehören auch die eher konservativen Traditionalisten Federer und Nadal.
Nein, ein Traditionalist ist Djokovic nicht. Eher ein Spiritualist, was er in immer extremeren Masse zur Schau trägt und ihn immer unfassbarer macht. Mit dem spanischen Ex-Profi und heutigen Guru Pepe Imaz predigte er Frieden und Liebe. Imaz half Novaks Bruder Marko 2013 aus einer Depression, deshalb setzte auch der Tennis-Superstar auf dessen Hilfe. Er war so begeistert von der Wirkung der Meditation und langen Umarmungen, dass er sich 2016 urplötzlich von Erfolgscoach Boris Becker und dem restlichen Betreuerstab trennte. Erst zwei Jahre später – nach einer erfolglosen Periode mit dem Guru-Coach – kehrte der Serbe zu Stammtrainer Marian Vajda zurück.
2020 driftet Djokovic in noch höhere Sphären ab. In Livedialogen im Netz lässt er sich öffentlich von Esoterikern inspirieren und beeinflussen. Mit dem holländischen Extremsportler Wim Hof tauscht er sich über die «Kraft der Gedanken» aus und folgt dessen Empfehlung, Eisbäder in der winterlichen Natur zu nehmen. Mit dem US-Iraner Chervin Jafarieh, einem «seelenverwandten» Alchemisten, philosophiert er über die Verschmelzung von Spiritualität und Wissenschaft. Mit der Kraft von Geist und Gebet könne man giftiges Wasser in heilendes verwandeln. Seine Erleuchtung: «Wir Menschen sind elektrische Wesen – ebenso Energie wie Chemie.»
Das Jahr der Skandale
Geist und Gebete sind dann allerdings nicht kräftig genug, um vor eineinhalb Jahren einen verhängnisvollen Wutausbruch an den US Open zu unterdrücken. Vor leeren Rängen schiesst er im Achtelfinal einen Ball unbeabsichtigt, aber unkontrolliert in Richtung einer Linienrichterin. Sie wird an der Kehle getroffen, bricht nach Luft japsend auf dem Platz zusammen. Djokovic wird disqualifiziert.
Ein Skandal, dem ein anderer Fauxpas vorwegging. Mit der Kraft der Gedanken – nicht einer Impfung – sollte auch Corona an ihm abprallen. Tat es aber nicht. Mit der von ihm mitten in der Pandemie initiierten «Adria-Tour» liess Djokovic die Blase, in welcher der Sport damals steckte, mit einem lauten Knall platzen. Richtig peinlich wurde es, als er und andere geladene Gäste sich beim Rahmenprogramm der Showturniere ausgelassen mit nackten Oberkörpern in der Disco feiernd und fussballspielend zeigten und sich prompt mit dem Covid-19-Virus infizierten.
Corona und Djokovic – ein Thema für sich. Obwohl er sich schon seit Beginn der Krise als Impfgegner outete, wurde lange spekuliert, ob er sich dem Druck der Tour und der strengen Einreisebestimmungen ausländischer Regierungen beugen und sich den Piks aus Vernunftgründen doch noch geben lassen würde. Spätestens für die Australian Open, wo die Regeln strenger als sonst wo sind, und es dem neunfachen Rekordsieger wichtiger als sonst wo sein dürfte, seinen Titel zu verteidigen. Denn die Chance, sich mit dem 21. Grand-Slam-Titel als «the GOAT» (Greatest of All Times) vor den 20-fachen Majorsiegern Federer und Nadal zu verewigen, liegt für ihn in Melbourne auf dem Präsentierteller.
Es ist weder eine Überraschung, dass er sich nicht beugt, noch dass er die Konsequenzen nicht trägt. Mit dem naiven (Horror-)Trip nach Down Under hat zumindest die Geheimniskrämerei über seinen Impfstatus ein Ende. Sonst wäre Djokovic nicht am Zoll des Flughafens Tullamarine abgefangen worden, weil seine medizinische Sonderbewilligung für die Einreise aus noch unbekannten Gründen nicht hieb- und stichfest ist. Der Australian-Open-Held ist nun ein Gefangener in Australien. In einem schmuddeligen Quarantänehotel für Migranten und Auszuweisende betet der Tenniskönig nun für einen erfolgreichen Rekurs vor Gericht, über den am Montag entschieden werden soll.
Die Chancen auf einen Start am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres sind klein, aber intakt. Doch selbst wenn er antreten darf – und unter zu erwartenden Anfeindungen des aufgebrachten australischen Publikums Kraft seines Geistes auch noch triumphieren würde: Seine Geschichte wäre noch immer kein Märchen. Der mittlerweile 34-jährige Trotzkopf aus Serbien hätte seinen Kritikern allenfalls ein weiteres Schnippchen geschlagen. Schreibt Cécile Klotzbach im SonntagsBlick.
Seien wir doch froh, dass sich Serbiens neuer Jesus zum derzeit weltbesten Tennisspieler entwickelt hat. Auch wenn er damit den Thron des Schweizer Tennis-Superstars Roger Federer für sich beansprucht, was einigen Schweizern*innen zu akzeptieren ziemlich schwer fällt.
Ohne diese grandiose Karriere wäre Djokovic mit grosser Wahrscheinlichkeit jetzt in der Schweizer Arbeitslosenstatistik, die derzeit vom Balkan dominiert wird, zu finden.
-
8.1.2022 - Tag der Bundesgiesskanne für die Medienförderung
Abstimmungen vom 13. Februar 2022: Pattsituation bei der Medienförderung
Zurzeit sprechen sich 48 Prozent der Befragten für das Massnahmenpaket zugunsten der Schweizer Medien aus – genauso viele sind dagegen. Ein Ja oder Nein am 13. Februar wird deshalb davon abhängig sein, welche Dynamik die Pro- und Contra-Kampagnen im Abstimmungskampf entwickeln. Eine Mehrheit der Befragten ist überzeugt, das neue Medienpaket stärke die Demokratie. Aber insbesondere das Argument, dass der Staat keine protektionistische Rolle einnehmen solle, hat das Potenzial, die Meinungsbildung Richtung Nein zu bewegen. Schreibt SRF.
Die Giesskanne zwecks «Medienförderung» ist prall gefüllt. Parlament und Bundesrat sind sich einig, dass die Berichterstattung der Schweizer Presse systemrelevant ist.
Logisch. Für die mediengeilen Politker*innen ist jede Erwähnung ihres Namens und ihrer Partei von epochaler Bedeutsamkeit. Egal, um welchen Bullshit es sich handelt. Hauptsache, Mann / Frau ist in den Medien. Frei nach dem Motto «Auch schlechte Nachrichten sind News».
Inzwischen ist hinlänglich bekannt, dass Menschen stärker auf schlechte Nachrichten reagieren als auf gute. Damit lassen sich die jeweiligen Gruppen mobilisieren, die zum Beispiel als Stimmvieh für die Abstimmungen von Relevanz sind. Oder die «Trychler», die für die SVP demonstrierend durch die Schweizer Städte marschieren.
Dass aber von den Befürwortern*innen dieser unsäglichen «Medienförderung» querbeet durch alle Parteien, selbst von den neoliberalsten Marktschreiern, ein Wirtschaftszweig zur Systemrelevanz erklärt wird, dessen Geschäftsmodelle längst dem Untergang geweiht sind, erstaunt denn doch.
So gross scheint der Glauben an den Markt, der doch laut neoliberaler Doktrin und der HSG St. Gallen alles regelt, doch nicht zu sein.
Dass wir schwerreichen Medienmogulen und Verlegerfamilien mit Milliardärstatus (Anmerkung: Blocher mit seinen Gratisblättchen ist vom Geldregen ausgeschlossen) ihre vorsintflutlichen Geschäftsmodelle retten sollen, ist eine Zumutung sondergleichen. Dass aber unsere hehren Politker*innen auch noch von «Qualitätsjournalismus» sprechen, ist ein Hohn.
So viel Gnade vor den Regeln des neoliberalen Marktgeschreis erfährt die sanierungsbedürftige AHV nicht. Da haben die Apologeten der Mediengiesskanne (bis auf die SP) nur eine einzige Losung: «Rentenalter hinaufschrauben bis zum geht nicht mehr!»
Es wird Zeit, täglich einen dieser vor Qualität strotzenden Frontseiten-Beiträge zum Wohle des Clickbaiting an den Pranger zu stellen. Heute ist es ein Dumpfbackenartikel aus 20Minuten, den wohl wirklich nur die Dümmsten unter uns anklicken. https://www.20min.ch/story/mann-stellt-sich-der-polizei-und-hat-abgetrennten-kopf-und-penis-bei-sich-389195288294.
Aber an Dummköpfen scheint es bei der Leserschaft von 20Minuten nicht zu mangeln. An systemrelevanten Presseartikeln dafür umso mehr.
-
7.1.2022 - Tag der Corona-Statistiken
In Genf ist fast die Hälfte der statistisch ausgewiesenen Corona-Patienten aus anderen Gründen im Spital gelandet – und erst dort positiv getestet worden: Spitaleinweisungen wegen Corona sind tiefer als ausgewiesen
Täglich teilt das BAG mit, wie viele neue Corona-Patienten ins Spital eingewiesen wurden. Nun stellt sich heraus: In mehreren Kantonen werden etwa die Hälfte der Patienten aus anderen Gründen eingeliefert und erst später positiv getestet.
Die Zahl der Coronafälle ist wegen Omikron auf ein Allzeithoch gestiegen. Gestern meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 32'239 Neuinfektionen – der viel entscheidendere Wert, nämlich die Spitaleinweisungen, bleibt mit 137 aber verhältnismässig niedrig. Und: Die Zahl könnte sogar noch tiefer sein. Denn die Spitäler melden dem BAG nicht nur Patienten, die wegen Corona eingeliefert wurden.
Beim Skifahren verunfallt, mit einem Beinbruch in den Notfall und dort dann positiv auf Corona getestet: Ein Szenario dieser Art erlebt das Universitätsspital Genf laut dem Onlineportal «Léman Bleu» in 45,95 Prozent der Covid-Fälle. Fast die Hälfte aller stationär behandelten Corona-Patienten seien nicht wegen des Virus eingeliefert worden, sondern primär wegen anderer Symptome. Auch Menschen, die zwar keinen schweren Verlauf hätten, sondern einfach zu alt und gebrechlich seien, um das Virus daheim auszukurieren, würden in diese Gruppe fallen – sie stellen aber die Minderheit dar.
Im Universitätsspital Zürich (USZ) zeigt sich ein ähnliches Bild. Auf Anfrage von Blick heisst es: «50 Prozent der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Personen im USZ sind wegen Covid-19 hospitalisiert, die anderen 50 Prozent werden wegen einer anderen Krankheit behandelt und haben als Nebendiagnose eine Corona-Infektion.» Bei den Patienten auf den Intensivstationen sei die Zahl der positiv Getesteten, die wegen Corona hospitalisiert seien, höher – sie liege bei 78 Prozent.
Beinbruch und bisschen Schnupfen: BAG zählt alle Corona-Patienten in der Spital-Statistik!
In den Kantonen Ob- und Nidwalden geschieht es zwar auch, dass Patienten zusätzlich positiv auf Corona getestet werden – jedoch wesentlich seltener. «Zirka 10 bis 15 Prozent der Covid-Fälle werden aufgrund einer anderen Diagnose wie beispielsweise einer Blinddarmentzündung oder eines Unfalls hospitalisiert und erst im Spital aufgrund von Fieber auf Covid positiv getestet und dann isoliert», schreibt das Spital Nidwalden auf Blick-Anfrage. Im Spital Obwalden sind es noch weniger: «Bisher wurden ein bis zwei Patienten vor Ort positiv getestet, die nicht wegen Covid stationär im Spital hätten aufgenommen werden sollen.»
Eine andere Zahl fehlt hingegen in der Statistik
Auch das BAG bestätigt auf Blick-Anfrage, dass die Ärzte zur Meldung von laborbestätigten Covid-19-Fällen verpflichtet seien: «Der Labornachweis kann vor oder nach dem Spitaleintritt erfolgt sein.» Der Hospitalierungsgrund werde jedoch mit der Meldung zum klinischen Befund seit Mitte April 2020 erhoben. In der Praxis sei diese Unterscheidung für die Ärzte jedoch oftmals schwierig: So könnten Covid-Patienten zwar zuerst wegen eines Unfalls eingeliefert worden sein, im Verlaufe aber wegen des Virus gar Intensivpflege benötigen.
Fest steht: In der Statistik tauchen nicht nur die Corona-Patienten auf, die tatsächlich wegen des Virus im Spital behandelt werden mussten, sondern auch solche, die wegen eines anderen Gebrechens eingeliefert wurden. Somit wären die Hospitalisierungszahlen tiefer als gemeldet.
Die Behörde rechtfertigt sich und stellt klar: «Nur weil die primäre Ursache für die Hospitalisierung nicht Covid-19 war, bedeutet dies nicht, dass kein Zusammenhang zwischen der Hospitalisierung und Covid-19 bestand.» Für die Pflegekräfte bedeuten die zusätzlichen Corona-Patienten zudem einen Mehraufwand. «Dies, da für alle positiv getesteten Patientinnen und Patienten spezielle Massnahmen ergriffen werden müssen – unabhängig vom Grund der Hospitalisierung», heisst es von der Behörde.
Ausserdem warnt das BAG davor, die Zahlen zu unterschätzen: «Weil Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung auch erst nach der Infektion, wenn Sars-CoV-2 nicht mehr nachgewiesen werden kann, zu einer Hospitalisierung führen können.» Diese Personen werden in der Statistik nicht abgebildet. Schreibt Blick.
Wasser auf die Mühlen der Trychler.
Bestätigt aber indirekt auch eine meiner früheren Vermutungen, wonach viele ältere Herrschaften der Risikogruppe Ü75, die in der täglichen Statistik der Corona-Todesliste gemeldet werden, nicht AN Corona gestorben sind, sondern MIT Corona.
-
6.1.2022 - Tag der Balkan-Klischees
Jetzt wütet Papa Djokovic: «Sie stellen Novak als Kriminellen dar»
Novak Djokovic darf nicht an die Australian Open. Papa Srdjan tobt deswegen. Und auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic meldet sich zu Wort.
Acht Stunden lang musste Novak Djokovic (34) am Flughafen in Australien ausharren. Mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte wollte die Nummer 1 der Welt an den Australian Open in Melbourne (ab 17. Januar) teilnehmen. Die Behörden haben dem Serben aber einen Strich durch die Rechnung gemacht – der Grenzschutz lässt Djokovic nicht einreisen.
«Es ist beschämend», wütet deswegen Papa Srdjan Djokovic (61) in der serbischen Zeitung «Blic». «Ich kann nicht mit meinem Sohn reden, sie stellen ihn als Kriminellen dar. Ich habe keine Worte für all das, was sie ihm angetan haben.»
«Novak ist Spartakus»
Und der Papa legt nach: «Mein Sohn ist heute Nacht in australischer Gefangenschaft, aber er war noch nie freier.» Novak sei von diesem Moment an «zum Symbol und Führer der freien Welt geworden», er sei der «Spartakus der neuen Welt, die keine Ungerechtigkeit, Kolonialismus und Heuchelei duldet, sondern für die Gleichberechtigung aller Menschen auf dem Planeten kämpft».
Ganz schön viel Pathos für den Wirbel um ein offenbar fehlerhaftes Visum. Srdjan Djokovic geht sogar noch weiter, er wittert offenbar eine Verschwörung. Gegenüber dem serbischen «Telegraf» sagt er: «Vielleicht lässt die reiche Welt Novak nicht mehr Tennis spielen, aber dadurch hat sie ihr wahres Gesicht enthüllt und ein viel ernsteres Spiel beginnt. Auf der einen Seite gierige Mitglieder der Weltoligarchie, auf der anderen die ganze freiheitsliebende und stolze Welt, die immer noch an Gerechtigkeit, Wahrheit, Fairplay und die Träume ihrer Kinder glaubt.»
Serbien-Präsident Vucic will fighten
Auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic (51) stärkt dem Tennis-Star den Rücken. Auf Instagram gibt er noch am Mittwochabend kund: «Ich habe ein Telefongespräch mit Novak geführt und ihm gesagt, dass ganz Serbien bei ihm ist.» Und weiter: «Unsere Behörden werden alle Massnahmen ergreifen, um die Belästigung in kürzester Zeit zu stoppen. In Übereinstimmung mit allen Normen des internationalen Rechts wird Serbien für Novak Djokovic, für Gerechtigkeit und Wahrheit kämpfen.»
Fortsetzung folgt. Bestimmt. Schreibt Blick.
Die Serben tun aber auch wirklich alles, um all die negativen Klischees über den Balkan zu bestätigen. Das gilt auch und vor allem für den begnadeten Tennisspieler Novak Djokovic und seinen Vater.
Wie Novak Djokovic für «Gleichberechtigung aller Menschen auf dem Planeten kämpft» beschrieb schon George Orwell treffend in seinem Buch «Animal Farm» aus dem Jahr 1945: «All animals are equal but some animals are more equal than others.»
Das trifft die Geisteshaltung der Familie Djokovic und ihrer Anhänger im wahrsten Sinn der Orwellschen Worte zu 100 Prozent.
-
5.1.2022 - Tag von Kasachstan-Christa Markwalder
Ärger über Gaspreise: Kasachstans Regierung tritt nach gewaltsamen Protesten zurück
Der Preis für Flüssiggas hatte sich schlagartig verdoppelt – das sorgte für Wut in der Bevölkerung: In Kasachstan kam es bei Protesten zu Ausschreitungen. Nun tritt die Regierung ab.
Seit dem Wochenende hatte es in Kasachstan Proteste gegen steigende Gaspreise, die sich vom Zentrum des Landes rasch auf weite Teile ausgebreitet haben. Nun folgt die politische Reaktion: Der Präsident des Landes hat die Regierung entlassen.
Auf der Website von Staatschef Kassym-Schomart Tokajew hieß es am Mittwoch, dass er den Rücktritt des Kabinetts von Regierungschef Askar Mamin akzeptiert habe. Dessen bisheriger Stellvertreter Alichan Smailow soll die Regierungsgeschäfte kommissarisch übernehmen, bis eine neue Regierung gebildet wurde.
Zuvor hatte die da noch amtierende Regierung wegen der Lage den Ausnahmezustand ausgerufen. Es wurden nächtliche Ausgangssperren in der Wirtschaftsmetropole Almaty im Südosten und der rohstoffreichen Region Mangystau im Westen des zentralasiatischen Landes verhängt.
Die Polizei war am Abend mit Blendgranaten und Tränengas gegen Tausende Demonstranten in Almaty vorgegangen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP zählten am Dienstag trotz eisiger Temperaturen und großem Sicherheitsaufgebot mindestens 5000 Teilnehmer bei den Protesten in der Stadt.
Demonstranten griffen Fahrzeuge an, darunter ein Feuerwehrauto. Mehrere Protestteilnehmer und einige Polizisten wurden mit offenbar leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.
Nachrichten-Apps wie Telegram, Signal oder Whatsapp funktionierten nicht mehr. Zwei unabhängige Nachrichtenseiten im Internet waren blockiert. Nach Regierungsangaben soll der Ausnahmezustand für zwei Wochen in kraft bleiben.
Am Montagabend gab es auch Proteste in der Stadt Aktau am Kaspischen Meer. Am Dienstagabend kündigten die Behörden an, die Gaspreise in Mangystau deutlich zu senken. Tokajew begründete dieses Zugeständnis auf Twitter damit, dass es darum gehe, »die Stabilität im Land zu sichern«.
Die Preise für Flüssiggas hatten sich binnen kürzester Zeit verdoppelt. Viele Menschen im Land betreiben mit dem Gas ihre Autos.
Dringender Aufruf an die Protestteilnehmer
In einem online gestellten Video forderte Tokajew ein Ende der Proteste. »Reagieren Sie nicht auf die Provokationen aus dem Ausland und aus dem Landesinneren«, sagte er darin. »Reagieren Sie nicht auf die Aufrufe, offizielle Gebäude zu stürmen. Das ist ein Verbrechen, für das Sie bestraft werden«, sagte der Staatschef. Außerdem kündigte er an, dass eine Regierungskommission ihre Arbeit aufgenommen habe, um eine für alle Seiten »akzeptable Lösung« zu finden.
Präsident Tokajew ist seit 2019 im Amt. Er ist der Nachfolger des langjährigen Staatschefs Nursultan Nasarbajew, der Kasachstan seit 1989 regiert hatte. Der 81-jährige Nasarbajew kontrolliert die Politik des Landes als »Führer der Nation« nach wie vor. Der Titel sichert ihm umfangreiche Privilegien und Immunität vor Strafverfolgung. Schreibt DER SPIEGEL.
Hat sich die Kasachstan-Beauftragte des Bundes und FDP-Nationalrätin Christa Markwalder schon zum Thema geäussert?
-
4.1.2022 - Fake-News um die Ehe für alle in der Turmstube des Pulverturms Zofingen
Ehe für alle im Pulverturm Zofingen
Der wahrscheinlich im 14. Jahrhundert erbaute Pulverturm gilt als eines der Wahrzeichen von Zofingen und gehört der Ortsbürgergemeinde. Seit Jahrzehnten sorgt der Artillerie-Verein mit viel Herzblut für den Erhalt und die Innenrenovationen. Mit dem Angebot als Trauungslokal wird die Turmstube einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie bietet einen fantastischen Ausblick über die Altstadt. Der Artillerie-Verein ist gerne bereit, einen Apéro auszurichten. Schreibt die Stadt Zofingen in ihrer heutigen Medienmitteilung.
Kaum veröffentlicht, kursieren zwischen der Wigger und dem Vierwaldstättersee bereits die ersten Fake-News in den sozialen Medien, die hier vom Beauftragten für Fake-News-Bekämpfung der neuen Stadtpräsidentin von Zofingen, Christiane Guyer (Grüne), dementiert werden.
1. Falsch ist, dass der Oberturmwart vom Artillerie-Verein Zofingen, Würgen Seiler, auch die zivile Trauung von heiratswilligen Paaren in der Turmstube vornimmt. Richtig ist hingegen, dass Würgen Seiler als Experte für Spirituosen aller Art interessierte Paare sowohl bei der Reservation der Turmstube wie auch bei der Auswahl der Getränke fachmännisch berät.
2. Falsch ist, dass der ledige Luzerner FDP-Ständerat und vehementester Verfechter bei der Abstimmung rund um die «Ehe für alle», Damian «ich bin nicht schwul» Müller, sich als erster prominenter Politiker in der Turmstube vom Pulverturm Zofingen mit einem Jungliberalen aus Luzern trauen lässt. Richtig ist, dass Damian Müller vor lauter Arbeit bis heute gar keine Zeit gefunden hat, den/die/das Richtige/n zu suchen, geschweige denn zu finden.

-
3.1.2022 - Tag der Theologen ohne Geschichtskenntnisse
Darum verloren die Amerikaner: Der Afghanistan-Krieg war nur noch Geschäft
Amerika, heisst es in Afghanistan, hat den Krieg verloren, weil der Krieg zum Geschäft wurde. Private Vertragspartner der USA gingen als die grossen Profiteure aus dem Krieg hervor. Sie hatten keinen Krieg zu gewinnen, sondern das grosse Geld zu machen.
Auf eine Art war es wie beim Goldrausch Mitte des 18. Jahrhunderts in Kalifornien. Das grosse Geld machten nicht die Goldgräber, sondern die Händler, die den nach Gold Schürfenden Schaufeln, Werkzeuge, Proviant verkauften. Auch beim Afghanistan-Krieg: Keine Soldaten haben ihn gewonnen. Die grossen Profiteure waren die sogenannten «contractors»: Vertragspartner, die im Auftrag der USA Sicherheits- und andere Dienste übernahmen. Wie Berichte jetzt aufzeigen, machten diese privaten Auftragnehmer das grosse Geschäft mit dem Krieg.
Amerika war nach den 9/11-Terroranschlägen mit grossen Versprechen in Afghanistan einmarschiert. Manche gingen in Erfüllung – Frauen genossen wieder mehr Rechte, Religionseiferer terrorisierten nicht länger im Namen von Allah. Doch besser wurde das Leben für die meisten Afghanen nicht. Seit der Hals-über-Kopf-Flucht der Amerikaner im August aus Afghanistan herrschen wieder Hunger und Not am Hindukusch. Die Besatzer hatten es nicht vermocht, dem Land den versprochenen Frieden und Wohlstand zu bringen.
Darauf hatten es die Amerikaner offenbar auch nicht mehr abgesehen, wie neue Untersuchungen aus den USA aufzeigen. Insbesondere in der späteren Phase des Krieges schien es nach einem Bericht des konservativen «Wall Street Journals» vorab darum gegangen zu sein, eine Geldflut an militärische Auftragnehmer fliessen zu lassen. Insgesamt 14 Billionen Dollar kosteten die Kriege in Afghanistan und auch im Irak. Laut der Zeitung floss «ein Drittel bis die Hälfte» dieser Gelder an private Auftragnehmer.
Sieben italienische Ziegen für Afghanistan
«Wer gewann in Afghanistan? Private Vertragspartner.» So lautet der Titel der Reportage, die eine Reihe von Unternehmern aufzählt, die mit dem Krieg das grosse Geld machten. Darunter ein kalifornischer Geschäftsmann, der in Kirgisistan eine Bar betrieb. Er startete ein Treibstoffgeschäft, das Milliardeneinnahmen einbrachte. Oder ein junger afghanischer Übersetzer verwandelte ein Business zur Versorgung der Streitkräfte mit Bettlaken in ein Geschäftsimperium, zu dem auch ein Fernsehsender und eine inländische Fluggesellschaft gehören.
Oder zwei US-Nationalgardisten aus Ohio: Sie gründeten eine Firma, die dem Militär afghanische Dolmetscher zur Verfügung stellte. Das Unternehmen wurde zu einem der grössten Partner der US-Streitkräfte. Dokumenten zufolge erhielt sie Staatsaufträge im Wert von fast vier Milliarden Dollar.
Dabei nahmen auch Korruption und Veruntreuung überhand. So gab das US-Verteidigungsministerium sechs Millionen Dollar für ein Projekt aus, um neun Ziegen aus Italien zu importieren. Dies sollte den afghanischen Markt mit Kaschmirwolle ankurbeln. Das Projekt erreichte «nie den gewünschten Umfang», heisst es trocken. Auch für den Bau von Strassen flossen Milliarden. Schliesslich wurden gerade mal 160 von geplanten 2000 Kilometern gebaut. Das Geld floss dennoch.
Krieg wurde zum Geschäft
Eine US-Sonderuntersuchung stellte fest, dass nur 15 Prozent der 7,8 Milliarden Dollar, die für Entwicklungsprojekte vorgesehen waren, tatsächlich ausgegeben wurden. Der Rest des Geldes floss in unbekannte Taschen. Zudem fehlte den privaten Unternehmern der Kampfgeist. Sie waren in Afghanistan, um Geld zu verdienen, und überhaupt wurde der Krieg immer unpopulärer. Der Abzug bahnte sich an. Man versuchte, noch das letzte Geld aus den Kriegsbudgets herauszuquetschen.
Das führende afghanische Newsportal «Tolonews» hat den Bericht des «Wall Street Journals» mit all den Vorwürfen unter die Lupe genommen. Das Fazit der Afghanen fällt vernichtend aus. Die Niederlage der USA in Afghanistan sei darauf zurückzuführen, dass der Krieg nur noch Geschäft war.
«Einer der Hauptgründe für den Zusammenbruch der afghanischen Regierung und die Niederlage der USA in Afghanistan war, dass der Krieg in Afghanistan zu einem Geschäft wurde» sagt der politische Analyst Muqadam Ameen. Korruption frass sich in den höchsten Kreisen fest. Selbst Sold der afghanischen Streitkräfte wurde veruntreut. Die Taliban hatten leichtes Spiel, gegen einen ausgehungerten Gegner ohne Kampfmoral vorzugehen.
Taliban reagieren auf Bericht
Das «Wall Street Jounal» zitiert auch einige US-Militär, wonach die die Vergabe von Aufträgen an private Vertragspartner für die Operationen unerlässlich sei. «Wenn man keine Wehrpflicht hat und einen Krieg mit einer Freiwilligenarmee führt, die kleiner ist als in früheren Konflikten, muss man so viel an Auftragnehmer auslagern, um seine Operationen durchzuführen», sagte der Zeitung Christopher Miller (56), der letzte Verteidigungsminister der Trump-Regierung.
Der ehemalige Pentagon-Sprecher Rob Lodewick: «Die engagierte Unterstützung durch viele Tausende von Auftragnehmern für die US-Militärmissionen in Afghanistan hat viele wichtige Aufgaben erfüllt, unter anderem die Entlastung der uniformierten Streitkräfte für lebenswichtige Kriegseinsätze.»
Einsätze, die offenbar nicht Afghanistan zugute kamen. Auch die neue afghanische Regierung des Islamische Emirats reagierte auf den Bericht und erklärte, dass das Land trotz der grossen Geldsummen, die in Afghanistan geflossen seien, nicht wieder aufgebaut wurde: «Es ist viel Geld nach Afghanistan geflossen, aber es wurde nicht für die Entwicklung verwendet», sagte Inamullah Samangani, stellvertretender Regierungssprecher in Kabul. Die USA hätten über Afghanistan hinweg entschieden. «Die frühere Regierung war sehr schwach.» Schreibt Daniel Kestenholz im Blick.
Solche Nonsens-Artikel sind vermutlich die logische Konsequenz, wenn ein ausgebildeter Theologe wie Kestenholz die Bibel wohl besser kennt als die Geschichte.
Als ob es je einen Krieg auf der Erde gegeben hätte, der kein Geschäft gewesen wäre!
Dass sich Personen, Institutionen, Kirchen und Staaten jenseits der agierenden Armeen in Kriegen stets bereichert haben, ist ebenfalls keine Neuigkeit.
«The winner takes it all. The loser's standing small.» So geht nun mal Krieg. Auch wenn die Pfaffen sämtlicher Religionen dies anders sehen.
Das System der flankierenden Privatfirmen, zu denen inzwischen auch die NGO's (nicht gewählte Organisationen) hinzuzuzählen sind, wurde in den Kriegen des neuen Hegemons USA lediglich pervertiert und stetig den neuesten Marktentwicklungen der «liberalen» Wertegemeinschaft des «Westens» angepasst.
So wie die religiösen Kreuzzüge, die auch nichts anderes als blutige Kriege im Namen irgendwelcher Religionen waren, den Gepflogenheiten und Wünschen der damaligen Akteure entsprachen. Oder glaubt dieser Religionsgelehrte wirklich, die hehren Ritter seien zum Nulltarif nach Jerusalem aufgebrochen?
Das müsste auch ein Theologe wissen, wenn er schon von der hohen Kanzel an der Zürcher Dufourstrasse zu seinen Leserinnen und Lesern predigt.
Schon der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower warnte in seiner Fernsehansprache, die zugleich seine Abschiedsrede als US-Präsident war, vor dem militärisch-industriellen Komplex der USA als Staat im Staat. Heutzutage besser bekannt als «Deep State».
Der umstrittene US-Senator James William Fulbright schrieb im Jahr 1966 sein Buch «Die Arroganz der Macht», in dem er sich mit den Folgen der amerikanischen Kriegstreiberei zum Wohle des militärisch-industriellen Komplexes der USA auseinandersetzte.
Die Moral von der Geschicht: Theologie und Geschichte vertragen sich öfters nicht.
Jedenfalls bei Blick.
-
2.1.2022 - Tag der Blasen
Es geht um Milliarden: Wie der Krypto-Hype die Sportwelt erobert
Man sieht sie fast bei jedem grossen Sportanlass: die Werbung für Krypto-Unternehmen. Die digitale Währung verzeichnete in den letzten Jahren einen Boom. Davon profitiert nun auch die Sportwelt im grossen Stil.
Beim packenden Formel-1-Finale vor einigen Wochen waren die Augen vor allem auf zwei Piloten gerichtet: Lewis Hamilton und Max Verstappen. Die Fans schauten den beiden Runde für Runde zu, wie sie den Titel unter sich ausmachten. Und Runde für Runde tauchte auf den TV-Geräten auch das grosse Werbebanner von Crypto.com auf, einer Handelsbörse für Kryptowährungen.
Das digitale Geld ist Mainstream geworden, und vereinzelt kann mit Bitcoin, Ethereum und Co. bereits im Alltag gezahlt werden. Nun hält der Krypto-Hype auch in der Sportwelt Einzug. Kaum ein Sportanlass geht mehr ohne Werbung einer Krypto-Tauschbörse oder -währung über die Bühne: neben der Formel 1 auch in der NBA, NFL, UFC und im Fussball. Dabei spielen grosse Geldsummen eine tragende Rolle.
«Ich bin überrascht, dass der Sport nicht früher auf Kryptowährungen gesetzt hat», sagt Krypto-Experte Daniel Diemers. Die Corona-Pandemie hat hierbei wie ein Verstärker gewirkt. Sport-Organisationen müssen massive Finanzlöcher stopfen. Und so kommt der digitale Rubel genau zum richtigen Zeitpunkt angerollt. Auch für die Krypto-Unternehmen lohnen sich die Kooperationen mit dem Sport: «Er ist ein gutes Fenster. Sie können mit dem Sport mehr Kunden erreichen.»
700 Millionen Dollar fürs Staples Center
Das ist beispielsweise Crypto.com viel Geld wert – sehr viel. So wird die Handelsplattform 700 Millionen US-Dollar für die Namensrechte des Staples Center in Los Angeles berappen. Die Heimstätte der L.A. Lakers und L.A. Kings wird die nächsten 20 Jahre Crypto.com Arena heissen. Gemäss der «L.A. Times» handle es sich um das grösste Namenssponsoring der Geschichte.
Nur einige Monate vor Bekanntwerden des Deals ging die Formel 1 einen Vertrag über 100 Millionen US-Dollar mit der Crypto.com ein. Daraus entstand auch der neue Überholmanöver-Award, den Sebastian Vettel (132 Manöver) einheimste.
Die Trikotsponsoren sind für Fussballvereine eine grosse Einnahmequelle. 26 Jahre lang prangte zum Beispiel der Schriftzug der Reifenmarke Pirelli auf der Brust der Spieler von Inter Mailand. Seit dieser Saison ist damit Schluss. Nun steht der Schriftzug ihres Fan-Tokens drauf. Die Nerazzurri bewerben somit – wie auch der spanische Verein Valencia – ihre eigene Kryptowährung.
Fans sollen mitbestimmen
Der Fussballkosmos möchte mit der Zeit gehen, aber gleichzeitig die pandemiebedingten Einbussen kompensieren. Um die Löcher in den Kassen zu stopfen, verkaufen grosse Fussballklubs eigene Kryptowährungen – auch unter dem Namen Fan-Token bekannt.
Solche Fan-Token sind nicht mit Aktien gleichzusetzen. Eine Gewinnbeteiligung gibt es keine, sie sollen aber die Fans näher zu den Klubs bringen. So dürfen Token-Besitzer bei gewissen Entscheiden mitbestimmen. Zum Beispiel welche Tor-Musik im Stadion gespielt wird oder welche Botschaft in der Spielerkabine stehen soll. Und ihre Besitzer bekommen auch die Möglichkeit, bestimmte Sonderangebote ihres Klubs zu nützen.
Zahlreiche Fussballklubs wie Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus haben bereits Fan-Token herausgegeben. Aber auch Organisationen wie der Davis Cup, die UFC oder die Formel-1-Rennställe Alfa-Sauber und Aston Martin. Serienmeister YB ist dabei der erste und bisher einzige deutschsprachige Verein auf der Liste.
«Mittels der Token kann Geld eingenommen werden – wie bei einem Crowdfunding», so Diemers. Doch die klassischen Einnahmequellen wie Ticketing und Sponsoring werden damit noch nicht verdrängt.
YB-Token fast 760'000 Euro wert
Den Bernern sei es ohnehin nicht ums Geld gegangen: «Wir finden das Medium mit den Abstimmungen toll. Diese Entscheidungen müssen im Verein sowieso gefällt werden, da können wir es genauso gut den Fans überlassen», sagt Reto Steffen, der Chief Digital Officer von YB. Aktuell liegt der Wert eines YB-Tokens bei rund 70 Cent, was einen Gesamtwert für alle bisher verkauften YB-Tokens von 760'000 Euro ergibt.
Einer BBC-Studie zufolge seien bereits 300 Millionen Euro für Fan-Token ausgegeben worden. Dem Vernehmen nach soll rund die Hälfte der Verkaufserlöse an die Vereine gehen. Barça zum Beispiel habe rund eine Million Euro eingenommen – nur eine Stunde nachdem der Verkauf ihres Tokens losging.
Einige Vereine nutzen die Fan-Währungen als Spekulationsobjekt. So werden beispielsweise die Tokens von Juventus und PSG auf gängigen Krypto-Plattformen gehandelt. Events aus der realen Fussballwelt haben natürlich einen Einfluss auf ihren Wert, was sich zum Beispiel beim Transfer von Superstar Lionel Messi zeigte, als der PSG-Kurs stark anstieg.
Auch wenn die Kryptowährung von YB nicht auf allen Plattformen gehandelt wird, verzeichnet auch sie Kursschwankungen. Bestes Beispiel: Zwei Tage nach dem sensationellen Sieg gegen Manchester United (2:1) in der Champions League verdreifachte sich der Wert des Tokens.
Sportler werden in Kryptos bezahlt
Messi erhielt einen Teil seiner Provision für seinen ablösefreien Wechsel zu PSG in Form der hauseigenen Fan-Token. In Übersee sind sie schon einen Schritt weiter. In der NFL lassen bereits vereinzelte Profis ihre Löhne in Kryptos umwandeln. Football-Superstar Odell Beckham Jr. tauscht sein Salär in Bitcoin um, und Tom Brady hat öffentlich gemacht, gerne einen Teil seines Mega-Lohns von 25 Millionen US-Dollar teilweise in Kryptos zu beziehen.
Besonders Ligen in den USA scheinen diesen Trend zu unterstützen. Aber es gibt auch Organisationen, denen diese Entwicklung Sorgen macht. So hat die englische Premier League angekündigt, die zunehmende Anzahl an Deals mit Krypto-Firmen zu untersuchen. 17 der 20 britischen Erstligisten sind schon mindestens eine solche Vereinbarung eingegangen. Den Skeptikern zu denken gibt, dass die Digitalwährung nicht staatlich reguliert ist.
Viele Finanzexperten warnen auch, dass der Wert der Kryptowährungen über Nacht verpuffen kann. Was würde dies für die daran beteiligte Sportwelt bedeuten? Diemers: «Für die Klubs sind Kursschwankungen weniger relevant, weil sie die Kryptos in herkömmliches Geld umwandeln lassen.»
Nicht unumstrittene Entwicklung
Nicht nur die Schwankungen der digitalen Währungen wird von Kritikern an den Pranger gestellt, auch die unzureichenden Vorteile der Fan-Token. «Am Schluss muss jeder selbst wissen, wie er sein Geld ausgibt. Wichtig ist aber, dass Minderjährige geschützt werden», meint Diemers.
Einer der grössten Kritikpunkte an Kryptowährungen ist aber der massive Energieverbrauch. Ein Beispiel: Die Universität Cambridge schätzt, dass das Entwickeln der Bitcoins pro Jahr mehr Energie verbraucht, als ganz Holland beansprucht. Dies weil enorme Rechenleistungen nötig sind. IT-Experte Alex de Vries beschäftigt sich seit Jahren mit dem immensen Energieverschleiss der Kryptos. Der Holländer setzt seine Hoffnung aber in eine aufkommende neue Art, die Währung herzustellen. «Sie reduziert den Energiebedarf fast vollständig», so de Vries gegenüber der «Zeit».
In einer finanziell schwierigen Zeit hat sich für die Sportwelt eine neue Möglichkeit der Finanzierung und Fanbeziehung eröffnet. Wie lange der Krypto-Hype anhalten wird, ist nicht absehbar. Schreibt der SonntagsBligg.
Höret hin, Ihr Unseligen, und lasset mich mit zwei Worten verkünden die ungehörten Rufe der Kassandra am zweiten Tage des neuen Jahres 2022:
Tulpen- und Dotcomblase!
Beide Spekulationsblasen führten zu einem Börsencrash. Die eine etwas früher (1630-er Jahre), die andere etwas später (Jahr 2000).
Beide Blasen machten ein paar wenige unendlich reich und ein paar sehr viele verloren so ziemlich alles, was sie an Barem eingesetzt hatten.
Es hiess dann, das Geld sei an der Börse verbrannt worden.
Doch Geld wird an den Börsen niemals verbrannt. Das ist eine alte Mär, um die Drahtzieher zu schützen. Es wechselt nur die Besitzer, Ihr Dummerchen!
Homer Simpson würde all den Gierigen, die die ewig gleichen Spielregeln noch immer nicht erkannt haben, wohl zurufen: «Tschüss, Du Trottel.»
-
1.1.2022 - Tag der linksfüssigen Imame
Was steckt dahinter? Die ewigen Transferwirren um Shaqiri
Bayern, Inter, Stoke, Liverpool, Lyon: Xherdan Shaqiri (30) legt eine Bilderbuch-Karriere hin. Doch der Schein trügt. Bleibt er nun auch in Frankreich unglücklich?
Welch Riesentalent! Als der junge Xherdan Shaqiri im FCB-Dress in Liga und Champions League reihenweise Gegner schwindlig spielt, ist rasch klar: Dieser feine Linksfuss hat das Potenzial zu einer ganz grossen Karriere!
Ganz Europa blickt nach Basel, wenn Shaq im Joggeli kickt. Allerspätestens dann, als er beim denkwürdigen 2:1-Sieg in der Königsklasse über Manchester United zwei Vorlagen liefert. Zehn Jahre später steht der mittlerweile 100-fache Schweizer Internationale bei Lyon unter Vertrag. Bei jenem Klub, der in Shaqiris jüngstem Karriereplan eigentlich Ruhe, Beständigkeit und Spielpraxis hätten einbringen sollen. Doch nach einer mässigen Vorrunde könnte es bereits in diesem Winter zum vorzeitigen Aus kommen. Der Tabellendreizehnte will den Schweizer loswerden.
Der Basler hat bislang tatsächlich eine Top-Karriere gemacht – seine Wechsel gingen aber auch oft mit negativen Nebengeräuschen einher.
Bayern München
Sommer 2012. Shaqiri spielt sich beim deutschen Rekordmeister rasch in die Herzen der Fans, allerdings nur als der freche, wirblige Joker, der immer mal wieder für Spektakel sorgt. Pep Guardiola bezeichnet ihn als den «wichtigsten Einwechselspieler» der Bayern. Doch das genügt den Ansprüchen von Shaq nicht. Sein Lager denkt laut über einen Wechsel nach, während der Offensivakteur immer weniger zum Zug kommt. Die Meinungen in Deutschland sind irgendwann gespalten. Zuletzt zählte «Focus Online» Shaqiri gar zu den grössten Transfer-Flops der Bayern.
Inter Mailand
Winter 2014/15. Bei den Nerazzurri wird Shaqiri frenetisch empfangen. Das Bankdrücken wie bei den Bayern? Tempi passati. Naja. Schnell macht Shaq in Liga, Coppa und Europa League je ein Tor. Doch nach nur einem halben Jahr ist schon wieder Schluss. Sein Leistungsausweis ist durchzogen – Inter plant ohne ihn weiter. Später kommt raus, dass die Mailänder beim Transfer mächtig getrickst haben. Um das Financial Fairplay zu umgehen, wird der Nati-Star offiziell nur ausgeliehen. Fragwürdige Klauseln, geknüpft an sehr wahrscheinlich eintreffende Eventualitäten – wie etwa, dass Inter Ende Jahr unter den ersten 17 von 20 Vereinen stehen muss – machen den 17-Millionen-Deal aber praktisch schon im Vorfeld fix.
Stoke City
Sommer 2015. Shaqiri flüchtet auf die Insel. Stoke City greift tief in die Tasche, bezahlt 18 Millionen Ablöse. Shaq wird zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte. Der Lohn ist ebenfalls exorbitant: über 180'000 Franken soll er pro Woche absahnen. Der Wechsel wird in sportlicher Hinsicht kritisch beäugt. Stoke City? Ein Abstieg? Auf dem Platz bekommt der Ex-FCB-Shootingstar dafür mal wieder Spielpraxis. Erstmals im Ausland ist er unumstritten! Drei Saisons, 92 Partien, je 15 Tore und Assists. Das grosse Liverpool klopft an!
Liverpool
Der nächste Big-Name aus Europas Fussball-Elite in Shaqiris Palmarès. Nach dem Champions-League-Sieg mit Bayern wiederholt er das Kunststück mit den Reds. Und nach drei Meisterschaften in München holt er nun auch in England den Titel. Shaq ist auch hier beliebt, aber wieder nur Reservist. Verletzungen plagen ihn zusätzlich. Mit einem Wechsel wartet der Mann, der jährlich rund 13 Millionen abgesahnt haben soll, bis im Sommer 2021.
Lyon
In Lyon werden nun Erinnerungen an die Zeit bei Inter wach. Ist wieder nach nur einem halben Jahr Schluss? Gemäss «L’Équipe» will man ihn bereits wieder loswerden. Dafür gibts Gründe: In 13 von 22 Spielen lief der Schweizer Nationalspieler auf und schoss dabei lediglich ein Tor und lieferte zwei Torvorlagen. Zuletzt sass der 30-Jährige oft auf der Bank oder stand gar nicht erst im Kader. Shaqiri verdient 350'000 Euro pro Monat. Mit einem Verkauf würde man einerseits Geld einholen und andererseits eine stattliche Lohnsumme einsparen.
Es könnte also sein, dass Shaqs Bruder und Berater Erdin, der 2010 nach seinem Lehrabschluss als Detailhandelsfachmann bei Coop ins Fussball-Business einstieg, sich nach dem Jahreswechsel nach einer neuen (Top-)Adresse umschauen muss. Geplant war dies im Hause Shaqiri, als der Lyon-Deal im August eingefädelt wurde, so sicher nicht. Schreibt Blick.
Wenn alle Stricke reissen und der etwas unbedarfte Ersatzbankfussballer bei keinem Club mehr Unterschlupf findet, kann er in Pristina als linksfüssiger Imam das Wort Allahs verkünden.
Moscheen gibt's in der kosovarischen Hauptstadt mehr als genug und gute Freunde aus der radikalen Islamistenszene wie der Imam von Pristina werden ihm bei den Bewerbungsgesprächen sicher helfen.
Übung im Umgang mit Zitaten aus dem Koran hat Shaqiri ebenfalls längst bewiesen: Der Nati-Spieler begrüsst seine Fans in den sozialen Medien mit einem Zitat aus dem Koran.