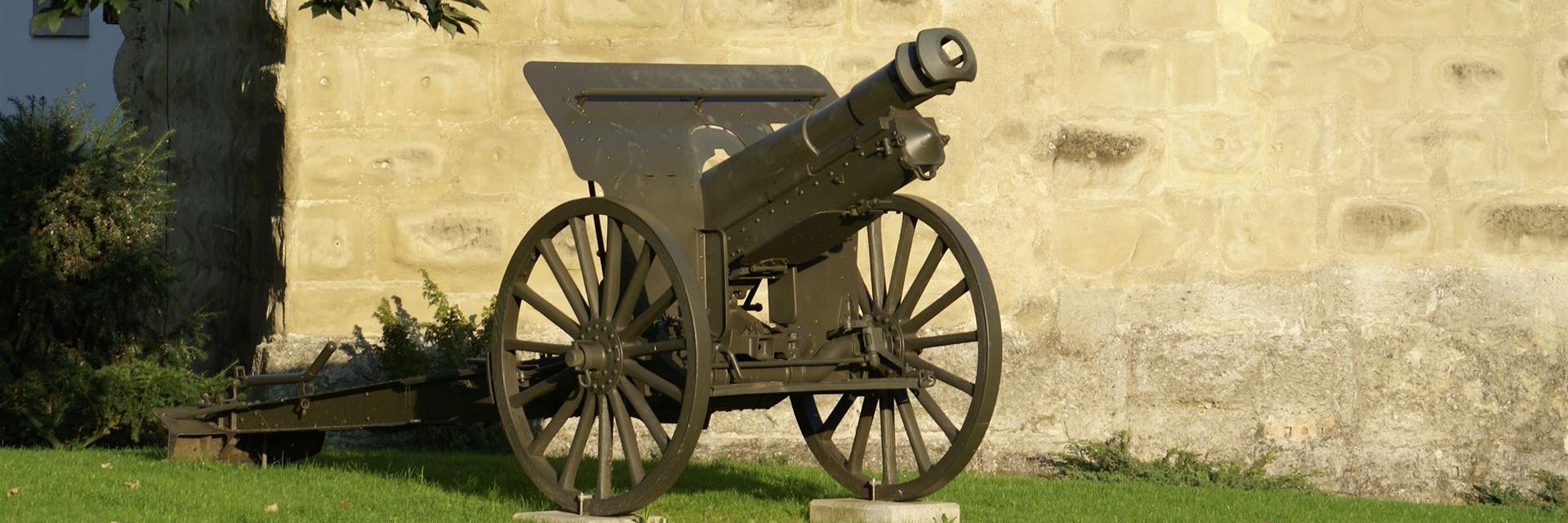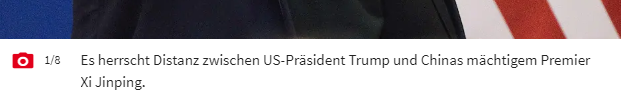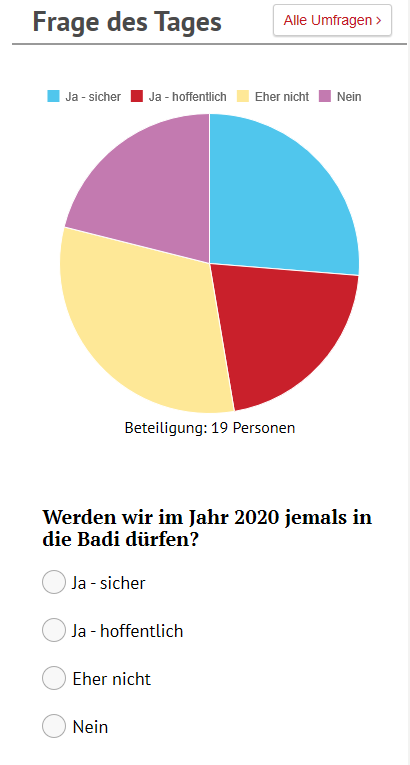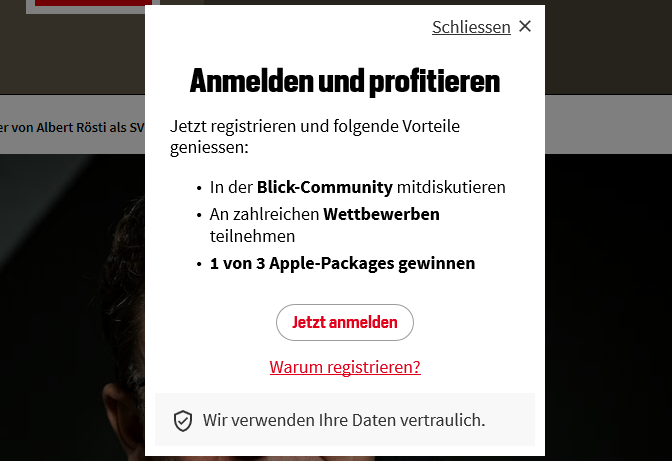Legendär und simply the Best: Das Schweizer Vivi Kola schmeckt wirklich allen
WIRECARD – Wo sich ex-COO Jan Marsalek wirklich versteckt
Es kann der frömmste Vierbeiner nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Zweibeiner nicht gefällt
Die Ehre der Blochers
Die SVP im Jahr 2020 - Räucherstäbchen und Wunderkerzen ersetzen den Zauberstab
Schlagzeilen des Tages
-
21.12.2020 - Tag der Bankrotterklärung
Vier Personen nach versuchtem Diebstahl festgenommen
Gestern Nachmittag kam es im Bahnhof Horw zu einem versuchten Trickdiebstahl an einem Passanten. Nachdem dieses Vorhaben misslang, flüchteten zwei Männer zu Fuss. Zwei weitere bestiegen einen Zug. Im Rahmen der Fahndung konnten die vier mutmasslichen Täter festgenommen werden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.
Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, kurz nach 14:00 Uhr verwickelten zwei Männer einen Passanten beim Bahnhof Horw in ein Gespräch. Zwei weitere Männer kamen hinzu. Plötzlich bemerkte das Opfer, dass sich einer der Männer an seinem Rucksack zu schaffen machte und das Aussenfach bereits geöffnet war. Das Opfer, welches derzeit an Krücken geht, begab sich in einen nahegelegenen Restaurationsbetrieb. Zwei der mutmasslichen Täter flüchteten anschliessend zu Fuss über die Geleise, zwei weitere bestiegen einen Zug. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte Polizeihund Rusty eine Fährte aufnehmen. Diese führte zu einer Baustelle in Horw, wo zwei Männer angehalten und festgenommen werden konnten. Durch die Kantonspolizei Nidwalden konnten zudem die zwei anderen Männer, die mit dem Zug wegfuhren, im Bahnhof in Hergiswil angehalten und festgenommen werden. Sie wurden nach Luzern überführt.
Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um drei Algerier (29, 31 und 32 Jahre) und einen Mann aus Westsahara (18 Jahre).
Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung.
Es fällt nicht nur in der Zentralschweiz auf, dass mit Migranten aus Algerien viele Polizeieinsätze wegen krimineller Handlung verbunden sind. So klaute ein algerischer Asylbewerber im vergangenen Sommer auf dem Luzerner Inseli einer alten Frau am helllichten Tag das Portemonnaie und flüchtete Richtung Aufschütti. Da er von vielen Menschen beobachtet wurde, konnte er dank nützlichen Hinweisen über sein Signalement kurz darauf bei seinen Drogenfreunden (nicht nur Algerier, notabene) auf der Aufschütti von der Luzerner Polizei verhaftet werden.
Die NZZ schreibt: Die Anzahl der Gesuche von Algeriern ist angestiegen, obwohl diese fast keine Chance auf Asyl haben. Viele werden straffällig und sorgen für Probleme, doch die Schweiz kann sie nicht ausschaffen.
Algerische Kriminelle sorgen für Probleme: So etwas hat die Bevölkerung in der Region Neuenburg noch nie erlebt: 718 Diebstähle, Einbrüche und Raubdelikte allein zwischen Juni und Mitte September. Ein Vielfaches gegenüber früheren Jahren. Raubdelikte haben sich im Juli gegenüber dem langjährigen Schnitt etwa verzehnfacht. Die Polizei spürte nach eigenen Angaben insgesamt 230 Verdächtige auf. Die meisten sind laut Polizei Wiederholungstäter. Ein Grossteil stammt aus Algerien. Das Problem: Algerien akzeptiert kaum Zwangs-Rückschaffungen. Schreibt SRF.
Die Luzerner Zeitung schreibt: Wie Algerier mit etwas schlechtem Willen ihre Ausschaffung verhindern können – Ein Algerier hintertreibt seine Ausschaffung – auch mit Hilfe seines Heimatlandes, das ihn zwar als Staatsbürger anerkennt, aber keine Reisepapiere ausstellt. Nicht nur in diesem Fall sind die Schweizer Behörden machtlos.
Was ist nun schlimmer? Der stetige Verlust eines weiteren Stückchens Lebensqualität oder die Bankrotterklärung der Schweizer Behörden? 2019 waren über 500 (fünfhundert in Worten) algerische Asylbewerber ausschaffungspflichtig. Kein einziger konnte ausgeschafft werden. Ob Frau VERMOT-MANGOLD RUTH-GABY von der SP Schweiz mit ihrer dringlichen Anfrage über die «Schweizer Flüchtlingspolitik gegenüber Algerien» sich dessen bewusst ist?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.12.2020 - Tag der Luzerner*innen
In Zürich und im Aargau: Schweizer Firma baut Rechenzenter für Amazon
Mit dem Ausmass der Digitalisierung wächst das Datenvolumen von Unternehmen und privaten Haushalten. Immer neue Speichermöglichkeiten werden geschaffen – besonders beliebt sind derzeit Cloud-Plattformen.
Mit ihnen können Firmen auf Betrieb und Wartung eigener Rechenzentren und Server verzichten: Sie speichern ihre Daten via Netz, bei externen Anbietern. Ein zukunftsträchtiger, hart umkämpfter Markt.
Der weltweit grösste Anbieter solcher Clouds ist Amazon Web Services, eine Tochterfirma des Onlineriesen Amazon, potente Player sind auch Microsoft und Google. Diese US-Konzerne sind stets auf der Suche nach neuen Standorten. Und immer wieder fällt ihre Wahl auf die Schweiz.
Seit Herbst ist bekannt: Amazon Web Services plant hierzulande den Bau von zwei neuen Rechenzentren. Wo sie stehen werden und wer sich diesen Grossauftrag gesichert hat, ist geheim.
SonntagsBlick weiss jedoch aus sicherer Quelle, dass die Firma Green den Bau und Betrieb der Rechenzentren übernehmen wird. Green-Verwaltungsratspräsident ist der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter. Auf Anfrage gibt er sich zurückhaltend: «Ich kann keine Angaben machen über Aufträge und mögliche Kunden. Solche Informationen können wir somit auch nicht kommentieren.»
50 bis 70 Millionen Franken teuer
SonntagsBlick konnte dennoch in Erfahrung bringen, dass Green die beiden Rechenzentren für Amazon baut, eines im aargauischen Birrfeld, ein zweites im Grossraum Zürich. Die Kosten schätzen Experten auf jeweils 50 bis 70 Millionen Franken – der neue Auftrag gilt denn auch als grosser Coup von Green.
Zumal sich die Aargauer Firma damit bereits den zweiten Tech-Giganten angelt: Vor zwei Jahren baute Green ein Rechenzentrum in Lupfig AG für Google.
Der Deal mit Amazon markiert gemäss Branchenkennern den grössten Exploit der Firmengeschichte. Schreibt SonntagsBlick.
Franz Grüter ist Luzerner. Wie der grosse Philosoph Giuseppe di Malaparte zu sagen pflegt (leicht abgewandelt). «Die Luzerner*innen waren der Menschheit schon immer einen Schritt voraus.» So ist es.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.12.2020 - Tag der bestellten Bilder
Es soll ohne hässliche Bilder gehen
Im Gastkommentar schildert der Wandel-Vorsitzende Fayad Mulla die Situation vor Ort.
Es soll ohne hässliche Bilder gehen. Nicht weil die Schande in den Lagern und das Ertrinken an den EU-Außengrenzen zum Guten gelöst worden wäre. Nicht weil Kriegsregionen befriedet wurden oder die Klimakrise, die zum immer größeren Fluchtgrund wird, nachhaltig angegangen worden wäre. Nicht weil Menschen in Not mit Respekt und Würde behandelt werden.
Nein, es soll keine hässlichen Bilder – durch Zensur – geben. So zumindest der Versuch seit letzter Woche an einem der schrecklichsten Orte für Menschen auf der Flucht in Europa. Seitdem ist es den wenigen Helfern, die noch in das Massenlager Kara Tepe auf Lesbos dürfen, untersagt, Fotos und Videos von der Situation im Lager zu veröffentlichen.
Eindeutige Bilder
Zu eindeutig haben diese Fotos in den letzten Monaten gezeigt, unter welchen erbärmlichen und menschenrechtswidrigen Zuständen Menschen in Not in einem EU-Staat zusammengepfercht sind. Für niemanden zu leugnen, hat die Welt das Armenlager auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der griechischen Armee gesehen. Zu klar waren die Bilder der tausenden Kinder und ihrer Familien, die in Zelten bei Wind und Wetter ohne Heizung "leben" müssen. Zwei bis drei Familien in einem Neun-Quadratmeter-Zelt und natürlich auch alleinreisende Frauen und Männer aus aller Welt. Einzig alleinreisende Kinder, die ja manche reiche Staaten aufnehmen wollen, gibt es hier nicht. Auch kein Wunder, denn welches Kind macht sich allein auf die Reise nach Europa?
Sie leben hier mit ihren Eltern und Verwandten, ohne eine einzige Dusche für knapp 10.000 Menschen. Ohne warmes Wasser, nur stundenweise Strom, keiner Beleuchtung und mit Plumpsklos, deren Zustand und Geruch keinerlei Hygiene zulassen. Ohne Schulen für die Kinder und neben einem spärlichen Frühstück nur einer kalten Mahlzeit am Tag. Mit omnipräsenter Polizei im Camp, die zwar für mehr Sicherheit sorgt als noch im alten Moria-Camp, aber auch 300-Euro-Strafen verteilt, wenn jemand einsam mal kurz ohne Maske am Meer steht.
Ein Schlammfeld
Das Regenwasser fließt durch die selbstgegrabenen Kanäle überall durchs Lager und mündet in kleine Bäche, die durchs Lager Richtung Meer preschen. Und auch hier im europäischen Süden bringt der Winter eisigen Wind und kalte Nächte. Das kombiniert mit einer Pandemie, völligem Lockdown in ganz Griechenland und kaum Ausgang aus dem Lager lässt einen nur mehr fragend zurück, wie die Menschen trotzdem noch so friedlich und freundlich sind. Wahrscheinlich, weil sie auf den Überlebensmodus umgeschaltet haben und ihre wahren und zutiefst menschlichen Bedürfnisse nach Geborgenheit unterdrücken. Anders kann man es hier wohl nicht aushalten.
Und nun Zensur
Vergessen von der Welt und übersät mit Hasskommentaren in den klassischen wie in den neuen Medien, bekommen die Menschen von der demokratischen Welt die kalte Schulter. Wären da nicht noch die Menschen, die meist ehrenamtlich bei NGOs arbeiten und mit Händen und Füßen ringend versuchen, das schlimmste Leid zu lindern, indem sie Kleider, Nahrung, Solarduschen und vieles mehr verteilen.
Ich bin einer von ihnen. Seit fast sechs Wochen hier auf Lesbos und nun, wie alle anderen, mit Zensur belegt. Wer weiterhin Bilder oder Videos aus dem Lager veröffentlicht, darf es nie wieder betreten. Aus den Augen, aus dem Sinn ist die Devise der griechischen Regierung, die wie viele Rechtspopulisten Teil der europäischen sogenannten Christdemokraten ist. Wenn man die Bilder aus den Lagern wie Kara Tepe oder vielen anderen Hotspots an den EU-Außengrenzen wie auch in Bosnien kennt, weiß man, dass Nächstenliebe und Gerechtigkeit keine europäischen Werte mehr sind. Das gilt für die Menschen auf der Flucht genauso wie europäische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die von Armut betroffen sind.
In Zeiten des Internets wird die Zensur nicht gelingen. Die Menschen auf Lesbos posten ihre Bilder selbst – und sie verbreiten sich über Social Media weiter. Jetzt sind die Journalisten gefragt, der breiten Masse zu zeigen, welche Bilder für Europas Rechte und Rechtspopulisten zu unangenehm sind. Schreibt der STANDARD.
Machen Sie sich keine Sorgen: Es wird die Bilder geben!
Was der Artikel von Fayad Mulla, «Aegean Boat»-NGO-Mitglied, verschweigt: Die NGO «Aegean Boat Report» hat zu diesem Zweck eine Hotline eingerichtet. «Die Hotline kann dazu verwendet werden, Informationen, Bilder und Video an den Aegean Boat Report zu senden, alle Versender werden anonym gehalten. Bitte nutzen Sie in Notfällen die Notfallnummern für Ihre Region oder die internationale Notrufnummer 112». (https://www.facebook.com/AegeanBoatReport).
Wir werden diese Bilder also mit grösster Wahrscheinlichkeit sehen. Allerdings wird niemand von uns beurteilen können, ob sie «gestellt» sind oder nicht. Wenn nicht gestellt, so sind die Bilder auf jeden Fall bestellt. Das ist eben die Krux mit den smarten NGO's.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
18.12.2020 - Tag der Hoffnung
Vor vier Jahren von der Strasse gerettet: So geht es dem nigerianischen «Hexenbub» heute
Die Situation von Hope (6) war hoffnungslos. Der nigerianische Bub wurde von seinen Eltern verstossen, weil sie dachten, er sei ein Hexer. Als Zweijähriger irrte er in den Strassen der Grossstadt Uyo umher. Abgemagert, allein und ohne Zukunft. Jetzt ist Hope ein strammer Bursche. Dank der dänischen Sozialarbeiterin Anja Ringgren Loven (41), die ihn vor vier Jahren vor dem Hungertod rettete.
Hope lebte als Ausgestossener. Passanten warfen dem Kleinkind Essensreste und böse Blicke zu. Damit überlebte er ein paar Monate, bekam aber auch Darm-Würmer und wurde krank. Sein junges Leben stand schon kurz vor dem Ende, als ihn Loven am Wegrand fand. «Als ich feststellte, dass er noch ein Baby war, erstarrte mein Körper auf der Stelle», sagte die Dänin damals zu den Medien. Sie habe schon oft Kinder von der Strasse geholt, aber selten zweijährige Kleinkinder.
Neue Mutter, neues Leben
Sofort brachte Loven den Jungen in ein Spital. Mit jedem Tag ging es dem Buben besser, er wurde kräftiger und erholte sich. Seine Ziehmutter Loven gab ihm schliesslich den Namen Hope, was auf Deutsch «Hoffnung» bedeutet.
Loven nahm Hope bei sich auf. Sie hatte bereits die Hilfsorganisation African Children's Aid Education and Development Foundation im Süden Nigerias gegründet, um Kindern wie Hope zu helfen und auf deren Leid aufmerksam zu machen.
Dass angebliche Hexer oder Hexen ausgestossen werden, ist leider nicht selten in Nigeria: Viele Leute glauben an schwarze Magie. So werden insbesondere Kinder und Frauen für allerlei unglückliche Umstände verantwortlich gemacht. Loven: «Aberglaube wird durch mangelnde strukturelle Bildung, extreme Armut, religiösen Fanatismus und Korruption verursacht.»
Die Bilder des nackten, abgemagerten Zweijährigen auf den Strassen Nigerias gingen 2016 um die Welt. Hopes Schicksal wurde bekannt und die Organisation von Loven erhielt über eine Million Dollar an Spendengeldern.
Er trägt nun den Spitznamen Picasso
Jetzt – vier Jahre später – veröffentlicht Loven neue Bilder von Hope. Der Bub ist inzwischen sechs Jahre alt und quietschfidel. «Er ist sehr intelligent und kreativ», sagt Loven zur britischen Zeitung «Mirror». Er sei ein besonders talentierter Maler, «viele seiner Gemälde wurden sogar verkauft.» Hope trage daher nun den Spitznamen Picasso.
Seine leiblichen Eltern habe Hope bisher nicht wieder getroffen. Ziehmutter Loven versuchte zwar, die Eltern ausfindig zu machen – ohne Erfolg. Sie wolle nicht, dass Hope einen Groll gegen sie hege. Schreibt Blick.
Hope. Hoffnung. Lasst uns den neuen Tag mit einer positiven Geschichte rund um den kleinen Hope aus Nigeria mit dem Spitznamen Picasso beginnen.
Für die negativen Schreckensnachrichten rund um Corona sind unsere "Opinion-Leader"-Medien ("Meinungsmacher") zuständig. Es soll ja Menschen geben, die das babylonische Stimmengewirr der handelnden und nicht handelnden Corona-Akteure kaum mehr ertragen. Ich gehöre dazu. Man schaut besser weg. Es kommt sowieso wie's kommen muss. Optimismus statt Drohungen aus dem Bundeshaus wäre angesagt. Leider ist der Claim "Wir schaffen das" seit dem Jahr 2015 toxisch beladen. Dennoch: Wir werden es schaffen.
Hope hat's schliesslich auch geschafft. Er sollte für uns ein Vorbild sein. Go ahead, lil' Boy.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.12.2020 - Tag der Selbstverliebten
Führungsprobleme, Dauerstress, Egotrips: Interne Dokumente decken auf, wie die BAG-Seuchenbekämpfer ans Limit kamen
Die Coronapandemie machte die Abteilung Übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit schlagartig zur wichtigsten Einheit des Landes. Doch Dokumente zeigen: Auch im eigenen Haus kriselt es. Ein Blick hinter die Kulissen.
Wenn eine Jahrhundertpandemie zuschlägt, liegt hier die eigentliche Schaltzentrale des Landes: in einem modernen Bürokomplex im Berner Liebefeld. Viel Glas und viel Sichtbeton prägen den Hauptsitz des Bundesamts für Gesundheit (BAG), futuristisch mutet seine Fassade an. Die weitläufigen Lichthöfe, so priesen die Architekten, «sorgen für Durchblicke und für Orientierung».
Auch im Herz der Seuchenabwehr? Die Abteilung Übertragbare Krankheiten wird Anfang dieses Jahres unversehens zur wichtigsten Behördeneinheit des Landes. Wegen der Coronapandemie schaltet sie in den Krisenmodus – und findet sich prompt im Zentrum der politischen Macht wieder, kritisch beäugt vom ganzen Land.
Ihre Angestellten bewältigen Mammutaufgaben: die Ausbreitung des Virus verfolgen und dagegen ankämpfen. Dem Bundesrat die Grundlagen für tiefschneidende Entscheide liefern, für harte Eingriffe in persönliche Freiheiten und das Wirtschaftsleben.
Die Chefs der Abteilung – zuerst Daniel Koch, dann Stefan Kuster – werden zu Autoritäten, auf deren Analysen sich die Politik stützt. Jeden Tag gefordert, jeden Tag auf Sendung. Schon im Sommer wird der eine in Pension gehen, der andere nach nur wenigen Monaten seinen Rücktritt ankündigen.
Versäumnisse von Jahren müssen innert Wochen aufgeholt werden. Immer wieder rückt die Abteilung selbst ins Visier von Kritikern. Sie werfen ihr vor, das Coronavirus anfangs unterschätzt zu haben; mit unzuverlässigen Zahlen zu arbeiten; bei der Digitalisierung hinterherzuhinken; nur widerwillig auf die Wissenschaft zu hören; in Sachen Masken herumzudrucksen. Auch schien die Abteilung erstaunlich unvorbereitet, als es im Herbst losging mit der zweiten Welle.
Stellt sich die Frage: Wie gut sind die obersten Seuchenbekämpfer mit ihren komplexen Strukturen geeignet, um die grösste Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg zu bewältigen?
Antworten liefert ein internes Arbeitspapier, das die Redaktion von CH Media gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat. Der über 60-seitige Bericht gewährt einen bisher nie da gewesenen Blick hinter die Kulissen. Die «Organisations- und Prozessanalyse» inklusive Interviewaufzeichnungen zeigt auf, wie die Krisenorganisation der federführenden BAG-Abteilung funktioniert.
Die psychologischen Experten eines Beratungsunternehmens haben diese im Auftrag der Behörde erstellt. Während Monaten analysierten sie Abläufe, im Sommer und im Herbst liessen sich rund 100 Mitarbeitende sowie die Führungsriege vom Amt und Abteilung befragen, ebenso aussenstehende Partner wie Kantonsärztinnen und Forscher. Das Ziel: die Stärken und Schwächen des bisherigen Handelns benennen; es geht vor allem um die ersten Monate dieser Krise, um die erste Coronawelle und die Vorbereitung auf die zweite.
Es ist eine veritable Chropfleerete. Die Dokumente zeichnen – ergänzt mit Insidergesprächen – das Bild einer Abteilung, die ans Limit kommt; überfordert von all der Aufmerksamkeit. Die mitunter nicht fähig ist, Aufgaben sinnvoll zu verteilen. Deren Führung zu wenig präsent ist, oft zu chaotisch vorgeht.
Die BAG-Dokumente erzählen aber auch von einem fleissigen Apparat mit kompetenten Fachleuten, deren Alltagsgeschäft sonst unsichtbar bleibt. Die im Courant normal lieber gründlich als hastig arbeiten, lieber beraten statt durchgreifen. Je länger die Krise dauert, desto grösser werden die Müdigkeit und der Ärger über fehlende Wertschätzung.
Zweifel an der Führung – und Daniel Kochs «One-Man-Show»
Er war das Gesicht der Krise: Daniel Koch. Berühmt geworden als «Mister Corona». Anfang Jahr, als die Pandemie losrollte, stand er seit elf Jahren an der Spitze der Abteilung Übertragbare Krankheiten. Das Krisenmanagement prägte schon früher seine Arbeit, Koch war als Arzt für das Rote Kreuz in der Welt unterwegs. Er ist ein eigenwilliger Kopf, als Einziger durfte er auch mal seinen Hund mit ins Büro bringen. Selbst in Momenten grösster Aufregung habe er Ruhe bewahrt, heisst es.
Von seinen Angestellten – gerade von solchen, die aus der Wissenschaft kamen – wurde Koch allerdings zusehends hinterfragt. «Lieber hörte er auf ein paar Ärzte aus dem Bekanntenkreis statt auf Studien», fasst es ein langjähriger Mitarbeiter im Gespräch zusammen. Sein Führungsstil galt als informell und wenig stringent.
Schon Ende März stand Kochs reguläre Pensionierung an. Ausgerechnet in der heissen Phase des Lockdowns übergab Koch die Leitung an seinen bereits gewählten Nachfolger Stefan Kuster, zuvor Leitender Arzt am Unispital Zürich. Der Stabwechsel kam zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Gemäss Insidern gestaltete sich der Prozess chaotisch; um die Dossiers zu übergeben, blieben nur wenige Stunden.
Kuster leitete fortan mit Abteilungsvize Patrick Mathys die Taskforce Covid-19, den eigentlichen Krisenstab also. Koch, der begnadete Kommunikator, blieb bis Ende Mai als «Delegierter des BAG für Covid-19» das Aushängeschild gegen aussen.
Intern war die Führungsspitze derweil besonders zu Beginn der Pandemie heftig umstritten, wie die BAG-Dokumente offenbaren. «Kochs Absenz in der Abteilung war enorm», beklagten sich Mitarbeiter. «Der Abteilungsleiter soll bei der Abteilung bleiben und nicht Mediensprecher werden.» Gar von einer «One-Man-Show» von Koch sprachen manche. Zuweilen hätte er mit Gesundheitsminister Alain Berset Dinge entschieden, ohne die Taskforce einzubeziehen, erzählten die Befragten übereinstimmend. Tatsächlich verfügte Koch über Bersets direkte Handynummer, die Beziehung der beiden wird als eng beschrieben.
Mitarbeitende berichteten mit Blick auf die erste Welle von einer «Führung, die nicht entscheidet, zu wenig wertschätzt oder im Zweifel nicht mehr gesehen wird». Ganze 41-mal verwiesen die Befragten auf Mängel in der Entscheidkompetenz. «Ein klarer Lead hat aus meiner Sicht vollständig gefehlt», schimpfte einer.
Zu kurz kam besonders die Personalführung. Auch weil es laut den Experten kaum möglich sei, gleichzeitig die Abteilung zu führen, die Taskforce zu leiten und sich um die Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. Die Aufgaben müssten dringend entflechtet werden. Nach Kochs definitivem Abgang stand Neuling Kuster selbst im Rampenlicht und an der Spitze einer Abteilung im Krisenmodus. Zusätzlich gefordert war er in Parlamentsgremien. Seine Belastung: enorm. Auf Anfang Dezember hin gab Kuster sein Amt auf eigenen Wunsch wieder ab. Heute hat das BAG die Arbeit des «Mister Corona» auf verschiedene Schultern verteilt. Die Leitung der Abteilung ist vakant.
Wenn nicht alle auf dem gleichen Stand sind
Seit Kochs Abgang fehlt dem BAG eine eigene Identifikationsfigur, um die Bevölkerung zu erreichen. Stefan Kuster füllte diese Rolle nicht aus. Welcher Auftritt gegen aussen ist in der Krise sinnvoll? Auch im BAG gingen die Meinungen darüber auseinander. Die einen wünschten sich wieder mehr Personalisierung, die anderen wollten das BAG als Institution in den Vordergrund rücken.
Die externen Experten mahnten dazu, diese Frage rasch zu klären. Einig war man sich zumindest darin, dass jeweils Fachpersonen an der Front stehen sollten – und nicht bloss Mediensprecher.
Für harsche Kritik sorgte im BAG vor allen Dingen die interne Kommunikation. Es fehlte an zentraler Steuerung. Manchmal sei nicht klar gewesen, wer aktuell woran arbeitet, heisst es in den BAG-Dokumenten. Und teilweise hätten Mitarbeitende «mehr über die Medien erfahren als durch die interne Kommunikation, was verständlicherweise zu einigen Irritationen führte». Selbst Mitglieder der Amtsleitung waren demnach nicht mehr immer auf dem aktuellen Stand.
Urteil vernichtend: Ungenutzte Ressourcen und Leerlauf
Die Lasten der Seuchenbekämpfer waren recht ungleich verteilt. Manche in der BAG-Abteilung Übertragbare Krankheiten seien in der Krisenorganisation zuerst im luftleeren Raum gelassen worden, so formulierte es ein Involvierter. «Entsprechend hatten diese Mitarbeitenden kaum etwas zu tun, während andere sehr unter Druck standen.»
Ein anderer kritisierte, man habe sich nicht in Ruhe überlegt, wo die richtigen Kompetenzen im Haus zu finden seien und wie sie sinnvoll genutzt werden könnten. So blieben Ressourcen zuerst ungenutzt. Parallel beklagten sich befragte Kantonsärzte und Forscher, dass sie im BAG anfänglich nicht als Kooperationspartner wahrgenommen worden seien.
An der Basis kam Murren auf. Gleich 73-mal verwiesen die Befragten auf Fehler in der Aufgabenorganisation. Die Rede war von unklaren, ungeplant verteilten Aufträgen, von Leerläufen und Doppelspurigkeiten. Operativ war das Krisenmanagement in bis zu 19 Arbeitsgruppen aufgeteilt, wobei deren Koordination teilweise nicht optimal gewesen sei. Mitunter sei es zu «Durchgriffen» von der Hierarchie auf die Krisenorganisation gekommen, was die Planung erschwert habe.
Gleichzeitig habe die Abteilung «teilweise den formalen Weg zur Einreichung von Bundesratsanträgen via Direktionsstab nicht eingehalten»; kaum aus böser Absicht, aber der übergeordneten Steuerung nicht zuträglich. Ebenso seien andere Departemente «relativ spät zur fachlichen und ressourcenmässigen Unterstützung» beigezogen worden.
Lange galt das Bundesamt für Gesundheit als eher bürokratisches Getriebe. Gut geölt, aber schwerfällig. Die Coronapandemie machte jahrzehntealte Gewissheiten wertlos. Im Amt und in der Abteilung Übertragbare Krankheiten sorgte die Krise für eine, wie es Angestellte nennen, buchstäbliche «Entbürokratisierung».
Dauerstress belastet die motivierte Equipe
Mitarbeitende schwärmten denn auch über kürzere Entscheidungswege und die schnelle Lösungssuche, stolz erzählten sie von ihren Teamleistungen, lobten den Umgang mit Kritik und das Vertrauen untereinander. An der Basis sei das «Wirgefühl» gestärkt worden, und inhaltlich hätten oft alle an einem Strang gezogen. Zugleich warnen die Experten: Der Stolz auf das Geleistete könne in Frustration kippen «aufgrund von starker externer Kritik und wenig wahrgenommener Wertschätzung durch die Vorgesetzten». Hier sehen sie das «unmittelbarste Risiko».
Die Arbeitslast der Angestellten war riesig. Viele sagten, sie seien «komplett abgesoffen». «Die Mitarbeitenden haben hohen Zeitdruck, kaum Pausen und werden regelmässig unterbrochen», konstatieren die Experten. Wörtlich heisst es: «Die Ergebnisse im Bereich Gereiztheit/Belastbarkeit zeigen überwiegend deutlich erkennbaren Handlungsbedarf.»
Augenfällig seien auch die Signale gewesen, was körperliche Symptome wie Schlafstörungen betreffe. Einige hätten nicht mehr abschalten können und seien «gedanklich stark in der Arbeit verhaftet geblieben». Andere standen unter Dauerstress. Die Experten schlugen deshalb einen ganzen Strauss an Massnahmen vor, darunter eine Priorisierung der Aufgaben. Und schliesslich rieten sie dem BAG, seiner Equipe spezielle Trainings zur Stressbewältigung anzubieten.
Täglich neue Entwicklungen; weitreichende Beschlüsse; die Angst, einen Fehlentscheid zu fällen: Manche drohen unter dem Druck ihrer Verantwortung einzuknicken – und die Krise ist noch nicht vorbei, das Land weiter im Würgegriff von Covid-19. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Die gleichen scheinheiligen Medien, die den unsagbar selbstverliebten Selbstdarsteller Daniel Koch ohne Not und nur der billigen Schlagzeile zuliebe zum «Mister Corona» gekürt haben, zerreissen ihn nun. Koch, der längst seine Zukunft nach dem Abgang aus dem BAG als hochbezahlter Experte und Berater aufgegleist hatte, nahm das vergiftete Danaer-Geschenk dankend an und sonnte sich in seiner lukrativen Popularität als Popstar, die er einzig und allein willfährigen Journalisten*innen und einem Virus verdankte.
Koch wurde dermassen von den Pressevertretern*innen gehätschelt, dass man ihm an den Pressenkonferenzen jede noch so dämliche Aussage ohne Nachfrage durchgehen liess. So verkündete «Mister Corona» beispielsweise, dass «Schutzmasken nichts bringen würden».
Fairerweise sei erwähnt, dass auch die WHO – getrieben von einer nicht verifizierten Studie – ebenfalls dieser Meinung war, die jedoch später von der WHO mit einer Kehrtwendung widerrufen wurde. Ob die Tatsache, dass in allen westlichen Ländern, inklusive der Schweiz, im März 2020 durch das peinliche Versagen der Regierungen keine Schutzmasken vorhanden waren, zu dieser von irgendwem bezahlten Studie geführt hat, wird wohl nie geklärt werden.
Der medial hochgejazzte Daniel Koch besass jedoch nicht die Grösse, vor seine geliebten Mikrofone zu treten und sich für die durch ihn verbreitete Fehlinformation zu entschuldigen. Plötzlich waren auch für Koch die Schutzmasken von eminenter Wichtigkeit. Ohne näher auf die Details seiner Sinneswandlung einzugehen.
Und da wundert man sich, dass derart viele Schweizerinnen und Schweizer inzwischen den beinahe im Stundentakt vorgetragenen Drohungen der zuständigen Behörden rund um die Corona-Massnahmen nicht mehr blindlings vertrauen und sie hinterfragen und abstruse Verschwörungstheorien entstehen. Eine alte Volksweisheit bestätigt das Fiasko: «Wer einmal lügt, dem traut man nicht, selbst wenn er die Wahrheit spricht.» An diesem Punkt sind wir inzwischen angelangt.
«Mister Corona», Daniel Koch, hat sich in seinen hochbezahlten Ruhestand verabschiedet, doch die selbstverliebten Selbstdarsteller aus der Regierung, allen voran Bundesrat Berset, sind geblieben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.12.2020 - Tag der Hühner, die keine Eier legen
Corona-Massnahmen: Shutdown vor Weihnachten offenbar kein Thema
Der Bundesrat schlägt den Kantonen drei Massnahmenpakete vor, die bei einer Verschlechterung der Corona-Lage ergriffen würden. Sofern sich die Situation in den nächsten vier Tagen nicht drastisch verschlechtert, ist ein kompletter Lockdown kurzfristig keine Option.
Gemäss den Vernehmlassungsunterlagen, welche die Tamedia-Portale am Montagabend publik machten, schlägt das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) vor, dass erst am 28. Dezember, also nach Weihnachten, über eine Verschärfung der Massnahmen diskutiert werden soll. Die Dokumente liegen auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor.
Schärfere Massnahmen würden demnach nur dann bereits am Freitag diskutiert, wenn die Reproduktionszahl «rasch und stark steigen sollte». Konkret würden Verdoppelungszeiten von zwei Wochen und weniger «einen vertieften Diskussionsbedarf auslösen». Beispielsweise müsste hierfür die Reproduktionszahl (R-Wert) von aktuell 1,13 (Schätzung vom 4. Dezember) auf 1,2 steigen.
• Szenario «Restaurantschliessungen» Geschieht das nicht, will der Bundesrat erst am 28. Dezember die Lage neu beurteilen. Bis dann sollte der R-Wert unter 1 liegen und die Fallzahlen wieder sinken. «Ist dies nicht der Fall und steigen die Zahlen auch Ende Dezember weiter an, sind weitergehende Massnahmen angezeigt», heisst es in den Unterlagen. Angestrebt werden soll ein R-Wert von 0,8 – also eine Halbierung der Fallzahlen alle zwei Wochen. Konkret gibt es drei Eskalationsstufen. Beträgt der R-Wert am 28. Dezember seit drei Tagen über 1 oder sind die betreuten Intensivpflegebetten zu über 80 Prozent ausgelastet, dann würden gemäss EDI-Vorschlag Gastronomiebetriebe geschlossen. Ausnahmen gäbe beispielsweise noch für Take-away- und Lieferbetriebe sowie Hotelgäste. Freizeit- und Sportzentren müssten ganz schliessen. Erlaubt wären nur noch Tätigkeiten wie Joggen und Radfahren sowie Gruppentrainings bis maximal fünf Personen draussen. Kultur-, Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen würden ebenfalls geschlossen.
• Szenario «Bleiben Sie zu Hause»: Das zweite Massnahmenpaket – bei einem R-Wert über 1,1 oder 85 Prozent Intensivpflegebettenauslastung – sieht zusätzliche Beschränkungen vor. Einkaufsläden und Märkte würden etwa an den Wochenenden geschlossen, unter der Woche gäbe es starke Kapazitätsbeschränkungen. Risikogruppen würden bei diesem
• Szenario wie im Frühjahr 2020 spezifisch geschützt – «ohne sie zu diskriminieren». Die Bevölkerung würde explizit dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben.
Szenario «Lockdown»: Beträgt der R-Wert am 28. Dezember über 1,2 oder sind die Intensivbetten um über 90 Prozent ausgelastet, käme das dritte Massnahmenpaket zum Zug – der (Teil-)Lockdown. Läden müssten schliessen. Die Kantone können zu zwei Varianten Stellung beziehen, was die Ausnahmen betrifft.
Das sind die Ausnahmen:
Variante eins sieht Ausnahmen vor für Geschäfte, deren Umsatz zu mindestens zwei Dritteln aus Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs resultiert. Das Sonntagsverkaufsverbot würde für diese Geschäfte aufgehoben.
Variante zwei sieht Ausnahmen nur für den Verkauf von Gütern des täglichen Bedarfs vor. Geschäfte, die auch andere Produkte anbieten, müssten die entsprechenden Regale abdecken. Das Sonntagsverkaufsverbot würde für diese Geschäfte ebenfalls aufgehoben.
Private Veranstaltungen dürften bei dieser epidemiologischen Lage mit maximal zehn Personen aus zwei Haushalten durchgeführt werden. Im öffentlichen Raum dürften sich nur noch maximal zehn Personen treffen.
Skigebiete nicht direkt betroffen
Gemäss den EDI-Plänen wären personenbezogene Dienstleistungen wie beispielsweise Coiffeure, Tattoostudios, Erotikbetriebe sowie Physiotherapie nicht von den jeweiligen Einschränkungen betroffen. Sie blieben weiterhin mit entsprechenden Schutzkonzepten gestattet.
Auch nicht Teil der Massnahmenpakete ist die Schliessung der Skigebiete. Es sei Aufgabe der Kantone, Schutzkonzepte nur dann zu bewilligen, wenn die detaillierten Vorgaben in der Verordnung sichergestellt seien, heisst es in den Vernehmlassungsunterlagen.
«Dennoch ist festzuhalten, dass bei der Ergreifung weiterer Bundesmassnahmen auch die Schliessung von Skigebieten durch den Bundesrat geprüft werden muss.» Beispielsweise wäre es laut dem Bund schwierig erklärbar, dass die Skigebiete trotz Ladenschliessungen weiterhin offenbleiben sollten.
Laufende Beurteilung
Die Kantone können sich bis Dienstagabend zu den Vorschlägen des Bundes äussern. Der Bundesrat wird am Freitag darüber beraten.
Gemäss aktuell vorgeschlagenem Zeitplan wird der Bundesrat kurz nach dem Jahreswechsel, am 5. Januar, die epidemiologische Lage erneut beurteilen – und wenn nötig Massnahmen treffen, konkret dann, wenn weiterhin eine Halbierungszeit von über einen Monat Realität ist. Zum Zuge käme ebenfalls eines der drei Massnahmenpakete, mit leicht angepassten Schwellenwerten.
In der ersten Januar-Hälfte will der Bundesrat zudem «einen Plan für das weitere Vorgehen bis zum Frühling 2021 in einem Winter-Massnahmenpaket vorlegen». Schreibt SRF.
Das Gegacker rund um die Coronamassnahmen der Schweizer «Eliten» aus Politik und Klick-Medien erinnert an einen Hühnerstall. Nur mit dem Unterschied, dass bei diesem Wettlauf um die Kommunikations- und Deutungs-Hoheit (und Klicks bei den Medien) keine Eier gelegt werden. Dafür aber trockene Fürze, die unsere Luft bald mehr verpesten als das Coronavirus.
Eigenartigerweise ist das Verschlafen der Zulassung für einen Covid-Impfstoff durch die zuständigen Instanzen in der Schweiz kaum ein Thema. Sicherheit gehe vor, wird argumentiert. Als ob es bei einem Impfstoff je eine totale Sicherheit geben würde. Man lässt lieber Leute sterben. Ist das die zynische «Güterabwägung», von der Bundesraut Maurer im Zusammenhang mit den Corona-Massnahmen des Bundes gesprochen hat?
Leadership sieht anders aus!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.12.2020 - Tag der Psychiatrie
Polit-Erdbeben in Washington: Wahlleute bestätigen Biden-Sieg, Trump verkündet via Twitter: US-Justizminister William Barr tritt zurück!
Unmittelbar nachdem Joe Bidens Wahlsieg vom Electoral College am Montag bestätigt wird, verkündet Donald Trump via Twitter den Abgang von US-Justizminister William Barr. Der US-Präsident gibt auch mit einer alternativen Liste zu reden.
Die Abstimmung der Wahlleute ist in normalen US-Wahljahren eine Formalie, weil der unterlegene Kandidat in der Regel längst seine Niederlage eingeräumt hat. Ab und zu geben Abweichler etwas zu reden, ansonsten liefert die Zusammenkunft des «Electoral College» im Vergleich zu den US-Wahlen kaum Gesprächsstoff. Doch dieses Jahr ist alles anders! Donald Trump (74) behauptet immer noch, dass eigentlich er die Wahl gewonnen habe, und stellt sich als Opfer massiven Wahlbetrugs dar. Viele Republikaner – darunter die führenden Parteikollegen im US-Kongress – haben Joe Biden (78) öffentlich noch nicht als Wahlsieger anerkannt.
Und das ändert sich auch nach dem gestrigen Montag nicht. Und dies obwohl Biden bei den Abstimmungen der Wahlleute in den US-Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington als neuer Präsident klar bestätigt wurde. Der Demokrat kam wie erwartet auf 306 Stimmen – der Republikaner Trump konnte 232 Stimmen auf sich vereinen. Bedeutet: Bei den Abstimmungen gab es für einmal keine Abweichler – sämtliche Wahlleute stimmten entsprechend der Wahlresultate ab.
Das offizielle Endergebnis der Präsidentenwahl wird nun am 6. Januar im Kongress in Washington verkündet. Dieses Datum ist gleichzeitig der letzte Strohhalm, an den sich Trump noch klammern kann. Denn wer erwartet hätte, dass der amtierende Präsident seine Wahlniederlage nun eingestehen würde, der täuscht sich gewaltig.
Trumps alternative Abstimmung
Donald Trump hat sich mithilfe seiner Partei etwas besonderes für die Zusammenkunft des Electoral College ausgedacht und am Montag eine alternative Abstimmung in den umkämpften Bundesstaaten abgehalten. Diese Wahlleute – die eigentlich keine sind – dürften alle geschlossen für Trump gestimmt haben. Und der Republikaner will diese «alternative Liste» mit den Ergebnissen seiner Wahlleute ebenfalls an den Kongress schicken.
«Das einzige Datum in der US-Verfassung ist die Amtseinführung am 20. Januar», sagte Trump-Berater Stephen Miller in «Fox and Friends», einer der Lieblingsshows seines Chefs aus dem Sender Fox News. «Wir haben also mehr als genug Zeit, die betrügerische Wahl wieder richtigzustellen», so Miller weiter. Durch den Versand einer alternativen Ergebnisliste würde man sich alle rechtlichen Schritte offenhalten.
Biden appelliert an Trump
Joe Biden hat sich am Montagabend in seiner Heimatstadt Wilmington an die Nation gewandt und von einem Sieg der Demokratie gesprochen. «Die Flamme der Demokratie wurde in dieser Nation vor langer Zeit entzündet», sagte er. «Und wir wissen jetzt, dass nichts - nicht einmal eine Pandemie oder ein Machtmissbrauch – diese Flamme auslöschen kann.» Nun sei es an der Zeit, die Gräben zu überwinden und zusammenzukommen. «Wie ich im Wahlkampf sagte, werde ich ein Präsident für alle Amerikaner sein. Ich werde genauso hart für diejenigen von Ihnen arbeiten, die nicht für mich gestimmt haben, wie für diejenigen, die für mich gestimmt haben.»
Biden hat während seiner Rede auch direkt an Trump appelliert und einen Vergleich zu 2016 gezogen. Damals hatte sich der Republikaner mit exakt demselben Ergebnis von 306 zu 232 Stimmen gegen Hillary Clinton (73) durchgesetzt. Trump bezeichnete dies als «Erdrutschsieg». «Diese Zahlen haben damals einen klaren Sieg dargestellt, und ich schlage respektvoll vor, dass sie das auch jetzt tun», sagte Biden.
US-Justizminister Barr tritt zurück
Zwischenzeitlich haben sich am Montag die Meldungen in Washington überschlagen. Minuten nachdem die Wahlleute Bidens Wahlsieg bestätigt haben, verkündet Trump via Twitter den Abgang von US-Justizminister William Barr (70). In einem von Trump am Montagabend auf Twitter veröffentlichten Rücktrittsschreiben hiess es, Barr werde am 23. Dezember aus dem Amt ausscheiden. Trump schrieb auf Twitter, Barr habe einen «hervorragenden Job» gemacht. Dessen Stellvertreter Jeff Rosen (62) werde das Amt geschäftsführend übernehmen.
Derart harmonisch war es zuletzt nicht zugegangen zwischen den beiden: Trump hatte am vergangenen Samstag scharfe Kritik an Barr geäussert. Das «Wall Street Journal» hatte zuvor berichtet, dass der Justizminister bereits seit dem Frühjahr von Ermittlungen gegen den Sohn des gewählten US-Präsidenten Joe Biden, Hunter Biden (50), gewusst habe. Barr habe die Ermittlungen aus dem Wahlkampf heraushalten wollen, hiess es in der Zeitung. «Eine grosse Enttäuschung!», schrieb Trump. «Warum hat Bill Barr der Öffentlichkeit vor der Wahl nicht die Wahrheit über Hunter Biden offenbart?»
Hintergrund: Hunter Biden hatte am vergangenen Mittwoch mitgeteilt, dass auf Bundesebene gegen ihn wegen «Steuerangelegenheiten» ermittelt werde. Er war im Wahlkampf regelmässig Ziel von Angriffen Trumps, der Korruptionsvorwürfe gegen die Biden-Familie erhob. Hintergrund sind fragwürdige Auslandsgeschäfte Hunter Bidens in der Ukraine und in China. Er hatte zwischen 2014 und 2019 einen lukrativen Posten im Aufsichtsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma inne. Während seiner Zeit als US-Vizepräsident war Joe Biden federführend für die Ukraine zuständig.
Barr stellte sich zuletzt gegen Trump
Am Sonntag vergangener Woche hatten die «New York Times» und der Sender CNN berichtet, Barr erwäge seinen Rücktritt noch vor dem Jahresende. Trump hatte sich davor öffentlich enttäuscht über den Minister gezeigt, der eigentlich als sein enger Verbündeter gilt. Grund dafür waren dessen Aussagen in einem Interview, in dem er sich zu dem von Trump angezweifelten Wahlergebnis geäussert hatte. Barr sagte, er habe bislang keine Beweise für Betrug in einem Ausmass gesehen, der zu einem anderen Wahlergebnis hätte führen können.
Trump liess daraufhin offen, ob er an Barr festhalten will, und nannte das Justizministerium eine «Enttäuschung». Auf die Frage einer Reporterin, ob er Barr noch vertraue, sagte Trump: «Fragen Sie mich das in einigen Wochen.» Trump hatte Barr im Dezember 2018 als Justizminister nominiert, nachdem der bisherige Amtsinhaber Jeff Sessions auf Bitten Trumps seinen Rücktritt eingereicht hatte.
Barr (70) hat sich seit seinem Amtsantritt hochgradig loyal gegenüber Trump gezeigt und auch regelmässig Lob von ihm bekommen. Anfang des Jahres gab es allerdings Spannungen zwischen den beiden, weil Trump sich wiederholt per Twitter zu laufenden rechtlichen Verfahren äusserte. Das Justizministerium wies damals Spekulationen über angebliche Rücktrittspläne Barrs zurück. Schreibt Blick.
«You get what you vote for» sagte der amerikanische Volksmund.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.12.2020 - Tag der Pathologie
Lasst die Impfmuffel in Ruhe
Dass Österreich die Corona-Pandemie trotz aller Anstrengungen nicht und nicht in den Griff bekommt und die Zahl der Toten täglich steigt, hat auch mit den vielen Corona-Skeptikern zu tun, die sich weder an empfohlene noch an verpflichtende Maßnahmen halten. Auch beim spärlichen Zulauf zu den Massentests zeigt sich, wie gering die Bereitschaft in der Bevölkerung ist, persönliches Handeln am Interesse der Gemeinschaft auszurichten.
Das lässt für die Impfung gegen Covid-19, die im Jänner anlaufen soll, nichts Gutes ahnen. Trotz hoher Verträglichkeit der Impfstoffe zeigen die Umfragen, dass bestenfalls die Hälfte bereit ist, sich impfen zu lassen, und auch in dieser Gruppe wollen viele abwarten.
Dass Österreich ein Land der Impfmuffel ist, hat sich schon bei der Grippeimpfung in früheren Jahren gezeigt. Aber anders als das oft so unverantwortliche Verhalten im Corona-Jahr 2020 ist Impfskepsis im Jahr 2021 kein gesellschaftliches Problem, das der Staat mit Mitteln wie etwa finanziellen Anreizen oder gar einer Impfpflicht lösen muss.
Normales Leben im Sommer
Vor allem in der Anfangszeit ist ein schwacher Andrang zu Impfungen sogar von Vorteil. Denn zunächst werden zu wenig Dosen für alle vorhanden sein. Gibt es viele Skeptiker, steigen die Chancen für den Rest, rasch an die Impfung zu gelangen – und nicht bis zum Sommer warten zu müssen, um wieder ein normales Leben führen zu können.
Beim Gesundheitspersonal und anderen exponierten Berufsgruppen wie Polizisten wird es wohl nur wenig Widerstand gegen eine frühe Impfung geben. Schließlich sind diese selbst am stärksten gefährdet.
Aber läuft Österreich bei einer zu geringen Durchimpfungsrate nicht Gefahr, die vielzitierte Herdenimmunität zu verfehlen? Auch damit könnte die Gesellschaft leben. Sobald jeder, der geimpft werden will, geimpft werden kann, wird die Covid-Impfung zu einer individuellen Entscheidung, vergleichbar mit der Grippeimpfung. Es gibt nach derzeitigem Wissensstand kaum eine Bevölkerungsgruppe, deren Gesundheit durch Covid-19 gefährdet ist, die aber keinen Impfschutz erhalten kann, wie etwa Kleinkinder im Fall von Masern.
Natürlich wäre es besser, wenn es weniger Infizierte und kaum noch Erkrankte gibt. Aber das muss der Staat nicht verordnen, genauso wie er Rauchen oder Extremsportarten nicht verbietet. Vorausgesetzt, dass Geimpfte tatsächlich niemanden mehr anstecken können, würde eine Durchimpfung aller Impfwilligen die gesetzlichen Corona-Maßnahmen großteils verzichtbar machen.
Vertretbare Ungleichbehandlung
Dennoch könnten Ungeimpfte weiterhin Einschränkungen ausgesetzt sein. Man kann davon ausgehen, dass manche Staaten nur nach einer Immunisierung die Einreise erlauben werden. Vielleicht werden Hotels von ihren Gästen eine Impfbestätigung verlangen, vielleicht auch Unternehmen von gewissen Mitarbeitern. Diese Art der Ungleichbehandlung wird zwar laute Proteste hervorrufen, aber sollte in vertretbaren Fällen erlaubt sein.
Auch ohne volle Herdenimmunität dürfte mit der Impfung die Zahl der Infektionen und damit auch die Belastung der Spitäler sinken. Dass davon auch die Impfmuffel profitieren, ist kein Malheur. Statt die Verweigerer zu bedrängen, soll der Staat lieber dafür sorgen, dass möglichst rasch genügend Impfstoff für alle anderen zur Verfügung steht. Das ist derzeit die größte Herausforderung. Schreibt DER STANDARD.
Grundsätzlich richtig, was Eric Frey in seiner Kolumne schreibt. Jeder Mensch soll das Recht haben, sich für oder gegen die Corona_Impfung zu entscheiden. Wie Appius Claudius Caecus (307 und 296 v. Chr) schon treffend bemerkte: «Jeder ist seines Glückes Schmied.»
Nun müsste Eric Frey der Zeitung, für die er schreibt, nur noch beibringen, dass nicht jeder Furz der pathologischen Impfgegner auf der Frontseite «seiner» Zeitung erscheint. Für die Pathologie ist inzwischen nämlich längst YouTube zuständig und nicht DER STANDARD.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.12.2020 - Tag der Reinacher Moschee
Das Gerüst steht noch, aber die Heizung läuft schon: Der grösste Moschee-Neubau ist bald fertig - dank vieler Freiwilliger
In Reinach haben die Mitglieder der Albanisch-Islamischen Gemeinschaft schon über 5000 Stunden Fronarbeit geleistet.
Das Gerüst steht noch, die Fenster und Türen sind aber montiert, die provisorische Heizung läuft. In normalen Zeiten hätte das Aufrichtefest für das 13,7 Meter hohe Gebäude bereits stattgefunden. In Rekordzeit entsteht in Reinach das Kultur- und Begegnungszentrum «Tulipan» der Albanisch-Islamischen Gemeinschaft, der grösste Moschee-Neubau im Aargau. Wer an Samstagen vorbeifährt, sieht, wie viele Freiwillige da am Arbeiten sind. «Bis Ende November haben sie rund 5000 Stunden Fronarbeit geleistet», erklärt Hasan Bajrami, Vizepräsident der 1992 gegründeten Albanisch-Islamischen Gemeinschaft. Das sind über 600 Tagesschichten à acht Stunden. «Wir haben das Engagement erwartet – aber nicht in diesem Ausmass», sagt er.
«Nur jetzt hat man die Chance, mitwirken zu können»
Wie erklären sich die Vorstandsmitglieder diesen Effort? «Dieses Projekt ist etwas Einmaliges», findet Bajrami. «So ein Gebäude baut man nur einmal. Nur jetzt hat man die Chance, mitzuwirken.» Und Präsident Azir Jusufi beschreibt das Gemeinschaftsgefühl: «Das kann man nicht planen, nicht beschreiben – das kann man nur erleben.»
Die Vorstandsmitglieder sind hörbar glücklich über diese Entwicklung: «Es ist ein schönes Gefühl, wenn man so viel Unterstützung erhält», sagt Mediensprecher Liridon Racaj. Wir, das sind die gut 300 Mitglieder der Gemeinschaft, die sich aktuell noch in einem Gebäude bei der Hochhauskreuzung (an der Hauptstrasse 3) treffen. Die dortigen Räumlichkeiten sind zu klein, sie werden aufgegeben, sobald der Neubau steht. Wenn alles gut geht, soll das im März oder April der Fall sein, wie Projektleiter Muharem Berzati erklärt. Aus Anlass der Eröffnung soll es eine schöne Feier geben. «Wir sind optimistisch, dass das möglich sein wird. Wir hoffen auf die Corona-Impfungen», sagt Präsident Jusufi.
Gibt es beim Bau eines derartigen Kulturzentrums spezielle Zeremonien? Nein, erklärt der in Reinach tätige Imam Halili Adem. Wirklich von grosser Bedeutung sei nur die Eröffnungsfeier. Und er ergänzt, wie wichtige die Bedeutung der Offenheit des Gebäudes aus albanisch-kultureller Sicht ist: «Jeder soll es betreten können.» Schon in der Bauphase ist es gelungen, das ein Stück weit zu leben. Fronarbeit haben nicht nur Albaner, nicht nur Leute mit islamischem Glauben geleistet. Es haben, so versichern die Initianten, auch Schweizer, Griechen, Portugiesen oder Polen mitgeholfen.
Sechs bis sieben Angestellte im Begegnungszentrum
Im «Tulipan» wird es einen Gebetsraum für 300 Personen haben. Aber auch eine Kita, in der es gemäss den Vorgaben des Kantons Platz für maximal 30 Personen hat. Die Kita wird neu gegründet, aktuell läuft die Suche nach einer Leiterin. Ebenso wie die Kita wird auch das Restaurant ein autonomer Betrieb sein. Im öffentlichen Restaurant wird es drei bis vier Angestellte haben, unter anderen einen Koch.
Insgesamt werden im Kultur- und Begegnungszentrum sechs bis sieben Personen arbeiten. Es wird dort dann auch Religionsunterricht erteilt, genau so, wie das andere Religionen in ihren Gebetshäusern auch tun. Und, das ist den Initianten wichtig: Sprachunterricht in Albanisch.
«Wir brauchen noch weitere Spenden»
Die Realisierung des «Tulipan» wird etwa fünf Millionen Franken kosten. Ein Teil des Betrags wird mit dem Frondienst geleistet. Ein weiterer Teil wird mit einem Bankkredit fremdfinanziert (AZ vom 10.6.). Und die Eigenmittel stammen, so versichern die Initianten, «nachweislich aus Beiträgen von Spender und Gönnern». Ausschliesslich Mittel aus dem Inland.
Allerdings ist man da, wie ein Blick auf die «Tulipan»-Facebook-Seite zeigt, noch nicht am Ziel. «Wir brauchen noch weitere Spenden», erklärt Präsident Azir Jusufi. Für ein, wie er sagt, «wunderschönes Projekt». Schreibt die Aargauer Zeitung.
Ich habe einmal gelernt, dass man den Lead einer Kolumne mit einem positiven Aspekt beginnen sollte. Et voila, hier kommt er! Die gesamte Zahl der in der Schweiz lebenden Personen albanischer Abstammung – vorwiegend aus dem Kosovo – inklusive Eingebürgerter und Doppelbürgern wird aktuell auf rund 200'000 Personen geschätzt. Die in der Schweiz lebenden Albaner sind überwiegend Muslime. So steht's geschrieben bei Wikipedia.
In der «Tulipan»-Moschee von Reinach sollen sechs bis sieben Angestellte beschäftigt werden. Es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese aus dem muslimischen Umfeld der albanischen Bevölkerungsgruppe rekrutiert werden, was immerhin die Schweizer Arbeitslosenstatistik etwas entlastet, in der die albanisch sprechende Bevölkerung der Schweiz inzwischen mit Abstand die grösste Gruppe der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund darstellt. Sechs bis sieben Personen aus dem Kosovo, Mazedonien, Albanien usw. bei Halal-konformen Essen und unter Einhaltung der geliebten Scharia in Brot und Arbeit ist doch schon mal eine positive Nachricht. Die darf und soll nicht verschwiegen werden.
Allerdings irritiert mich in diesem so lieblich geschriebenen Artikel einiges. Wie zum Beispiel folgende Textpassage: «Insgesamt werden im Kultur- und Begegnungszentrum sechs bis sieben Personen arbeiten. Es wird dort dann auch Religionsunterricht erteilt, genau so, wie das andere Religionen in ihren Gebetshäusern auch tun. Und, das ist den Initianten wichtig: Sprachunterricht in Albanisch.» Spätestens nach dem Lesen dieser Textzeilen müssten selbst die hartnäckigsten Verfechter*innen über die Integrationsfähigkeiten der romantischen Multi-Kulti-Migration aus muslimischen Ländern aufjucken. Sprachunterricht in Albanisch. Basta! Als ob Allah selbst gesprochen hätte.
Inzwischen wissen wir, die wir eine französische Revolution und die Aufklärung hinter uns gebracht haben aus leidvollen Erfahrungen, dass beinahe sämtliche muslimischen Terroristen und Terroristinnen (die gibt es nämlich auch) beim Brainwashing in den Moscheen radikalisiert worden sind. Egal, ob sich diese Moscheen bzw. Koranschulen in Paris, Ankara, Tunis, Tripolis, Berlin, Winterthur oder Wien befinden. Dass in diesen Brutnestern des muslimischen Terrors nun auch im malerischen Reinach die deutsche Sprache per se – oder besser und erst noch wortwörtlich ausgedrückt «par ordre du mufti» – ausgeschlossen wird, ist ein Unding und hat mit Religionsfreiheit nichts zu tun, auch wenn das heilige Buch schreibt: «Wir haben es zu einem arabischen Koran gemacht, auf dass ihr ihn verstehen möget.» (Sure 43, Vers 3). So oder so werden praktizierende Muslime beim Ausüben ihrer religiösen Pflichten mit der arabischen Sprache konfrontiert. Etwa beim Gebetsruf, Adhan genannt, oder beim rituellen Gebet, in dem die Suren ebenfalls auf Arabisch rezitiert werden. Das ist aber in der Bundesverfassung nicht festgeschrieben, wenn ich mich richtig informiert habe.
Ich lege Wert darauf, die «Tulipan»-Moschee in Reinach nicht mit dem Vorurteil einer «Terrorklitsche» zu überziehen, bevor sie überhaupt offiziell eröffnet ist. Das liegt mir fern. Aber dieser mit aller Vehemenz und dem Absolutismus des Islams geäusserte Hinweis auf die albanische Sprache in der zukünftigen Moschee lässt erahnen, wohin die Reise führen könnte und wessen Geistes Kind der Obermufti möglicherweise huldigt. Wissen wir doch inzwischen aus allen Nachrichten- und Geheimdienstquellen (Wien und Winterthur lassen grüssen!), dass die Überwachung von islamistischen Gefährdern in den Moscheen wegen fehlender Sprachkenntnisse ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Ob die Vergewaltigung der deutschen Sprache durch diesen albanisch geprägten Balkan-Gangsta-Rap, der sich inzwischen quer durch das Sprachrepertoir einer sehr speziellen jüngeren Generation der Bildungsferne verbreitet hat, nur eine Zeiterscheinung ist, wie sie auch in anderen Ländern und anderen Sprachen stattfindet, sei dahingestellt. Für die berufliche Zukunft und die erfolgreiche Integration junger Menschen aus den muslimisch geprägten Balkanstaaten dürfte das babylonische Sprachgewirr wohl kaum förderlich sein.
Die «Tulipan»-Moschee sucht Spenden. Das ist absolut legitim. Dass die bisherigen Mittel für den Bau der Moschee ausschliesslich von Gönnern aus inländischen Quellen stammen, darf allerdings bezweifelt werden. Und wenn dem wirklich so ist und die Reinacher Moschee finanzielle Not leiden müsste, stehen die Salafisten aus Saudi Arabien und den Golfstaaten längst Gewehr bei Fuss. Anders als bei den Flüchtlingen aus ihrem religiösen Umfeld. Da sind die Könige und Prinzen aus dem Morgenland eher knauserig.
Und sollten alle Stricke reissen, lässt sich Geld auch waschen. Muss ja nicht immer Brainwashing sein. Die albanischen Drogenbosse aus Luzern kennen sich da vermutlich bestens aus und geben sicher gerne Nachhilfeunterricht. Inch Allah.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.12.2020 - Tag der Eitelkeiten
Sommaruga laut «Forbes» als einflussreichste Frau der Welt an 56. Stelle
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga steigt laut der amerikanischen Zeitschrift «Forbes» in die Weltrangliste der hundert einflussreichsten Frauen der Welt auf. Sie rangiert dort auf Platz 56, wie das Westschweizer Fernsehen RTS am Donnerstag berichtete.
«Forbes» veröffentlichte diese Woche die Rangliste für 2020. Diese basiert auf Geld, Macht, Einfluss und Medienpräsenz. Mehrere Frauen seien wegen ihrer Rolle bei der Bewältigung der Corona-Pandemie auf die Forbes-Liste gerückt, hiess es.
Sommaruga liegt weit hinter den Top drei, zu denen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und die designierte US-Vizepräsidentin Kamala Harris gehören. Auf politischer Ebene liegt Sommaruga vor der finnischen Premierministerin Sanna Marin (Rang 85). Schreibt Watson.
«Forbes» ist sowas für Erwachsene wie früher «BRAVO» für pubertierende Teenager: Ein harmloses Fegefeuer der Eitelkeiten.
Problematisch wird das an und für sich beliebige «Bullshit»-Ranking erst dann, wenn Frau Sommaruga diesen lächerlichen Joke auch noch selber glaubt und ihre ohnehin schon stark ausgeprägte Spreizwürde der Class Politique ins Unermessliche steigert.
Solche Veränderungen können in den Parietallappen des Grosshirns zu unheilbar psychischen Störungen führen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.12.2020 - Tag der Kakophonie
Bundesrat übernimmt das Ruder: Heute wird er eine letzte Warnung aussprechen – funktioniert dies nicht, kommt der Lockdown
Wo steht der Bundesrat in der zweiten Welle? Eine Analyse zu seiner Rolle in der Pandemiebekämpfung.
Ein Land in Aufregung: So präsentierte sich die Schweiz in den letzten zwei Tagen. Desavouierte Kantonsvertreter, wütende Parlamentarier, verwirrte Bürgerinnen und Bürger, verunsicherte Gastronomen, steigende Fallzahlen, eine der höchsten Sterberaten der Welt. «Wie hat es dieses Land dermassen vermasseln können?», fragte gestern der «Tages-Anzeiger» auf der Frontseite.
Die Antwort darauf gab Gesundheitsminister Alain Berset im «Blick»: «Vor zwei Wochen hätte ich Ihnen gesagt, dass wir auf Kurs sind. Die Fallzahlen sanken, ich war zuversichtlich, dass wir zu Weihachten bei etwa 1000 Fällen am Tag landen.» Hätte gesagt? Das hat Berset gesagt. Wenn wir eines gelernt haben in dieser Pandemie: Exponentielles Wachstum ist brutal. Und die Halbwertszeit von Aussagen kurz.
Heute sind die Blicke wieder auf den Bundesrat gerichtet. Auf die drei Damen und vier Herren, die etwas nicht können: Verantwortung abschieben. Sie sind die letzte Instanz. Mit ihren Entscheiden werden sie dafür sorgen, ob die Ausweitung der Pandemie gebremst wird. Sie müssen spüren, welche Massnahmen von der Bevölkerung mitgetragen werden und deshalb auch wirken. Sie müssen entscheiden, wie viel öffentliches Leben noch zugelassen wird, wie offen die Wirtschaft sein darf.
Am letzten Freitag drückte sich das Gremium um diese Entscheidung. Die bürgerlichen Bundesräte wollten den Kantonen noch einmal eine Chance geben, um härtere Massnahmen zu beschliessen. Schliesslich war der Gesamtbundesrat vor den Sommerferien sehr froh, dass er die ausserordentliche Lage beenden konnte und die Hauptverantwortung für die Pandemiebekämpfung wieder den Kantonen zu übertragen. Die Erleichterung, sie war spürbar. Die Vorwürfe, der Bundesrat sei in einen Machtrausch geraten, hinterliessen bei den Magistraten Spuren. Die Verantwortung liegt bei den Kantonen, war das bundesrätliche Credo der zweiten Welle. Bis am letzten Dienstag.
Unzufrieden mit dem Zaudern der Kantone, übernahm wieder der Bundesrat. Das Gremium diskutierte lange und intensiv, um einen Konsens zu finden. Um die Reihen wieder zu schliessen. Ob der Bundesrat die Öffentlichkeit informieren soll über die Vorschläge, war intern umstritten. Berset und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga traten schliesslich vor die Medien. Sie wollten die Informationshoheit behalten. Den verschiedenen Akteuren Planungssicherheit geben. Nicht, dass der Gastronom zu viele Entrecôtes oder Gemüse einkauft.
Dass er damit ein Chaos auslösen würde, war dem Bundesrat wohl nicht bewusst. Was gilt nun: die neuen Massnahmen der Kantonsregierung oder die Vorschläge des Bundesrates? Nur: Die geplanten Regeln wären ohnehin an die Öffentlichkeit gelangt. Die Indiskretionen aus dem Bundesrat sind zum Merkmal dieser Krise geworden. «Bei so schwierigen Geschäften darf es das nicht geben», konstatierte alt Bundesrat Pascal Couchepin diese Woche in der NZZ. Die Indiskretionen würden Schlagzeilen und Unruhe bringen. Recht hat er. Nur sind die Kantone daran nicht ganz unschuldig.
Heute ist fertig Föderalismus, willkommen Zentralismus. Dass der Bundesrat noch grosse Anpassungen an seinen Vorschlägen vornimmt, ist eher nicht zu erwarten. Es ist also wieder Bundesratszeit. Doch wo steht das Gremium heute?
In der ersten Welle war es eine ziemliche Einheit, zumindest bist zu den Lockerungen. Natürlich weiss die ganze Schweiz, dass zwischen Viola Amherd, die einst eine Ausgangssperre wollte, und Ueli Maurer, der auch mal umgangssprachlich von einer Grippe spricht, anschauliche Welten liegen. Nur: Der Bundesrat als Abbild der Bevölkerung – dieses Bild mag selbst das Gremium.
Berset ist als Gesundheitsminister immer noch im Fokus. Gerade eben ist ein Buch über ihn erschienen. Das Bild des Helden hat allerdings Risse bekommen. T-Shirts mit seinem Konterfei will heute niemand mehr verkaufen. Als er am 12. Oktober das St. Galler Fussballstadion besuchte, sagte er: «Im Kybunpark wurde mir heute gezeigt, wie Grossveranstaltungen mit 10'000 Zuschauern funktionieren können.» Es war ein gewagtes Zeichen, die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag damals schon über tausend.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Bundespräsidentin Sommaruga schon reagiert und die Kantone zu einem Krisengipfel eingeladen. Am 18. Oktober erliess der Bundesrat leichte Verschärfungen, Ende Oktober justierte er nach. Sommaruga übernahm eine aktivere Rolle in der zweiten Welle, machte Druck auf die Kantone. Zwischen ihr und Berset herrschte zuweilen auch dicke Luft. Inhaltlich waren sie sich allerdings durchaus einig. Zusammen mit Amherd bildeten sie das Trio mit der harten Linie. Justizministerin Karin Keller-Sutter stand immer irgendwo dazwischen. Ihre bürgerlichen Kollegen Ignazio Cassis, Guy Parmelin und Ueli Maurer eher auf der legeren Seite.
Parmelin darf ab Neujahr das Gremium nun als Bundespräsident führen. Er wird Sommarugas Rolle übernehmen. Vielleicht wird ein neues Gesicht den alten Botschaften – Distanz halten, Kontakte minimieren, eigenverantwortlich und solidarisch handeln – neuen Schub verleihen.
Finanzminister Ueli Maurer macht derzeit, was er am besten kann: Er schnürt ein neues Hilfspaket – und zieht voll mit auf der bundesrätlichen Linie. Im Frühling hatte er sichtlich Freude, als er das Covid-Kreditprogramm präsentieren konnte. Ueli, der Macher. Das ist seine liebste Rolle.
Der Bundesrat hat wieder Tritt gefasst. Heute wird die letzte Instanz eine letzte Warnung aussprechen: Funktionieren die neuen Massnahmen nicht, dann kommt der Lockdown. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Diese tägliche Kakophonie aus dem Bundeshaus wird langsam unerträglich und verunsichert die Bevölkerung. Eine kompetente Regierung spricht nicht Drohungen aus, sondern handelt. Dafür wurde sie gewählt und nicht für peinliche Selbstdarstellungsorgien vor laufenden Kameras.
Leadership, die unser Land in Zeiten einer Pandemie dringender braucht als je zuvor, sieht anders aus!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.12.2020 - Tag des Klistiers
Merkel verpasst Corona-Skeptikern einen Einlauf
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt am Mittwoch eine glühende Rede für verschärfte Massnahmen. Der Grund: Die Zahlen sind zu hoch. Doch das wollen Corona-Skeptiker der AfD nicht wahrhaben. Es kam zu Zwischenrufen, die Merkel gekonnt parierte.
In einem emotionalen Appell wandte sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) am Mittwoch an die Deutschen. Der Lockdown light reiche nicht aus. Deshalb müssten Massnahmen verschärft werden. Denn die Zahl der Neuinfektionen liegt mittlerweile bei etwa 20'000 pro Tag. Besserung ist nicht in Sicht.
Mitten in der Rede wurde es plötzlich laut in der AfD-Fraktion. Die Partei ist nämlich gegen die Corona-Beschränkungen. Und so kommt es zu Zwischenrufen. Mitten in der Rede stört eine AfD-Politikerin und ruft: «Es ist nicht erwiesen...». Wie der Satz weiterging, ist unklar. Der Rest ging im Schimpfen und Meckern der Corona-Skeptiker unter. Es wurde kurz laut im Bundestag.
An Fakten gibt es nichts zu rütteln
Doch Merkel liess sich nicht aus der Fassung bringen – und gab Konter. «Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, (...) weil ich ganz sicher war, dass man vieles ausser Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht, und das wird auch weiter gelten», so Merkel.
Sie glaube an die Kraft der Aufklärung, die Europa zu dem gemacht habe, was es heute sei. Besonders wichtig sei dabei der Glaube daran, dass «es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte.» Basta! Aus der Ecke der Corona-Skeptiker war daraufhin nichts mehr zu hören.
Öffentliches Leben soll zum Erliegen kommen
Die Kanzlerin stellte sich in ihrer Rede ausdrücklich hinter die Empfehlungen der Wissenschaftsorganisation Leopoldina vom Vortag. Die Politik tue gut daran, das, was die Wissenschaft sage, «auch wirklich ernst zu nehmen».
Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hatte am Dienstag gefordert, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen. In einem ersten Schritt sollten Kinder ab dem 14. Dezember nicht mehr in die Schulen gehen, möglich seien Aufgaben zu Hause. Vom 24. Dezember bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte dann in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen, auch die Geschäfte ausser für den täglichen Bedarf sollten schliessen.
Kanzlerin verteidigte die hohe Neuverschuldung
Merkel betonte, Glühweinstände und Waffelbäckereien in manchen Städten würden sich nicht mit den Vereinbarungen von Bund und Ländern zum Teil-Lockdown vertragen. Und wenn die Wissenschaft «uns geradezu anfleht», vor Weihnachten und dem Besuch bei den Grosseltern eine Woche Kontaktreduzierung vorzunehmen, dann müsse man noch einmal darüber nachdenken, die Schulferien schon vor dem 19. Dezember beginnen zu lassen.
Die Kanzlerin verteidigte die hohe Neuverschuldung von fast 180 Milliarden Euro im Haushalt. In dieser besonderen Situation der Pandemie müsse der Staat auch besonders handeln. «Und das drückt dieser Haushalt aus.» Schreibt Blick.
Als Einlauf (Klistier, Klysma, Analspülung, Darmspülung) wird das Einleiten einer Flüssigkeit über den Anus in den Darm bezeichnet. Anwendung finden Einläufe gegen Verstopfung und zur Darmreinigung. Schreibt Wikipedia.
Toll. Als studierte Physikerin weiss Frau Merkel logischerweise ganz genau, wo der Darm drückt. Eine solche Aktion wünscht man sich auch mal im Schweizer Parlament. Man stelle sich vor, wie unsere Bundespräsidentin, Frau Doktor Sommaruga, die zwar nicht Physik studiert hat, dafür aber das virtuose Klavierspiel bis hin zu Beethovens 5. Klavierkonzert in Es-Dur besser als Lang Lang beherrschen soll, einem Parlamentarier, nehmen wir zum Beispiel den solariumgebräunten Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller, vor den laufenden Bundeshaus-Kameras einen Einlauf verpasst.
Die Frage, die uns alle bewegt: Würde Damian bei dieser Aktion krächzen oder stöhnen?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
9.12.2020 - Tag der bornierten Dummheit
«Lasst uns arbeiten!»: Der Aargauer Gastro-Verband sendet einen offenen Brief nach Bern
Weil keine Planungssicherheit herrscht und immer wieder neue Anpassungen vorgenommen werden müssen, wehrt sich nun der Aargauer Gastro-Verband mit einem offenen Brief in Richtung Bern.
«Wir haben für die Massnahmen aus Bern immer Verständnis gehabt», sagt Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau, am Telefon. Es tönt fast etwas entschuldigend. Als wolle er das abfedern, was nun kommt: «Doch jetzt ist einfach genug. Woche für Woche passt der Bundesrat die Auflagen für die Gastronomie an. Wir kommen gar nicht mehr nach, unsere Schutzkonzepte anzupassen und zu kommunizieren. Es ist eine Katastrophe. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir haben keine Planungssicherheit.»
Darum bekommt Alain Berset Post von Gastro Aargau. Der Branchenverband kritisiert deutlich das Vorgehen des Bundesrates. So schreibt der Verband: «Das Gastgewerbe hat eine schwierige Zeit hinter sich. Leider sieht auch unsere Zukunft – mit Ihren teils wöchentlich ändernden Entscheiden – mehr als düster aus. Wenn Sie jetzt unsere Betriebe wieder schliessen wollen, indem Sie den Druck auf die Kantone erhöhen, dann stehen viele unserer Mitglieder vor einer mehr als ungewissen Zukunft. Unsere Reserven sind fast vollständig aufgebraucht!»
Restaurants seien gar nicht die Hotspots für Ansteckungen
Der Verband äussert sein Unverständnis über die Massnahmen, seien doch Restaurants gar nicht die Hotspots für Ansteckungen. Und er kritisiert, es gebe zu wenig Unterstützung: «Zwar gibt es allerlei Abfederungsmassnahmen, für die wir durchaus dankbar sind. Man beraubt uns aber der Einnahmen und lässt uns auf einem grossen Teil der Kosten sitzen.» Spätestens als das Parlament beschlossen hatte, KMU bei der Miete nicht entgegenzukommen, habe sich die Politik vollends von den Unternehmern abgewandt.
«Wir wollen nichts geschenkt!», heisst es weiter. Aber es brauche Lösungen. «Mit den jetzigen Härtefallmassnahmen, die bei uns kaum greifen, können unsere Mitgliederbetriebe nicht überleben. Wenn Sie uns wieder in ein faktisches Berufsverbot treiben, ohne eine adäquate Lösung für die hohen Fixkosten zu bieten, sind unsere Mittel definitiv und sehr rasch ausgeschöpft.» Die Schutzkonzepte würden funktionieren, das beweise die tiefe Zahl der Ansteckungen, steht abschliessend im Brief. Zusammen mit der Aufforderung: «Also lassen Sie uns arbeiten.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Man kann dem Aargauer Gastro-Verband nur beipflichten. Ohne klare Fakten stösst der selbstverliebte Bundesrat Alain Berset einem Berserker gleich im Stunden-Rhythmus neue Drohungen aus, um vom eigenen Versagen abzulenken.
Es war hinlänglich bekannt, dass eine zweite Corona-Welle unser Land spätestens mit dem Einzug kälterer Temperaturen überrollen würde. Bersets Antwort bei einer Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, warum der Bundesrat keine Vorkehrungen zwischen Frühling und Herbst als Antwort auf die zweite Welle getroffen habe, meinte er lapidar, man hätte die zweite Welle nicht so früh erwartet.
Was hätte sich denn verändert, wenn die zweite Welle ein paar Monate später eingetroffen wäre?
Nichts! Letztendlich geht es nur um die «Intensivbetten» in den Spitälern. Selbst das ist nur die halbe Wahrheit: Wir haben zu wenig ausgebildete Fachkräfte beim Pflegepersonal für die Betreuung der Intensivpatienten. Kein Wunder! Bei der Entlöhnung des Pflegepersonals ist dieser Beruf schlicht und einfach nicht attraktiv. Daran kann auch Berset kurzfristig nichts ändern. Es ist sogar zu befürchten, dass er nicht einmal einen langfristigen Plan hat.
Wir müssen endlich lernen, mit dem Coronavirus umzugehen. Täglicher Aktionismus, Drohungen und das Herunterfahren von Wirtschaftszweigen hilft auch nicht unbedingt weiter, verunsichert aber die Menschen und fördert Insolvenzen inklusive Arbeitslosigkeit.
Wie wäre es, wenn endlich ein Plan zum Schutz der Risikogruppe entwickelt würde anstatt die Gesamtbevölkerung in Geiselhaft zu nehmen?
Österreich hat inzwischen an alle Ü65-Jährigen gratis je sechs FPP-Masken inklusive den notwendigen Filtern verschickt. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist sei dahingestellt. Immerhin fördert die Aktion das Vertrauen in die Regierung.
Wird natürlich in der Schweiz etwas schwierig nach der unsäglichen Aussage zu Beginn der Coronakrise im März / April dieses Jahres durch den zum «Mister Corona» hochgejazzten Daniel Koch: «Masken nützen nichts!» Basta. Der Urknall in Sachen bornierter Dummheit. Wen wundert es, dass ansonsten vernünftige Leute wegen einem Fetzen Stoff Demos veranstalten?
Fairerweise sei erwähnt, dass auch die WHO anfänglich dank einer beinahe ungeprüften Schnellschuss-Studie Kochs Meinung war. Doch nach Bekanntwerden des Überprüfungsdebakels erwähnter Studie änderte die WHO ihre Position gegenüber den Masken. Koch hingegen nicht.
Hätte vermutlich an seinem Heiligenschein gekratzt und negative Auswirkungen auf seine hochbezahlte Beratertätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem BAG verursacht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.12.2020 - Tag der Trauerkleidung
Universeller Grippeimpfstoff rückt näher
Es ist alle Jahre wieder in gewissem Sinne auch ein Glücksspiel: Wissenschafter müssen so akkurat wie möglich prognostizieren, welcher Grippestamm die Menschen in der anstehenden Wintersaison heimsuchen wird, um einen entsprechend passenden Impfstoff bereitzustellen. Kein Wunder also, dass die Wirksamkeit der bisher zugelassenen Influenzaimpfstoffe starken Schwankungen unterworfen ist und durchschnittlich bei etwa 50 Prozent liegt.
Chimärer Impfstoff
Diese Situation könnte aber in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören: Mit einer Mischung aus veränderlichen und stets gleichen Oberflächenelementen der Influenzaviren kreierten in New York forschende Österreicher einen chimären Impfstoff. In einer klinischen Phase-I-Studie bewährte sich dieser bereits gegen verschiedene Stämme.
Influenzaviren tragen an der Außenseite ihrer Hülle ein Eiweißmolekül namens Hämagglutinin, das ihnen hilft, auch an den menschlichen Zellen anzudocken. Die meisten saisonalen Grippe-Impfstoffe machen das Immunsystem auf dessen exponierten "Kopf"-Abschnitt aufmerksam, damit es die Viren daran erkennt und zerstört. Doch er ist bei den vielen Stämmen sehr unterschiedlich und wandelt sich ständig. Ein Team um die österreichischen Virenforscher Florian Krammer, Peter Palese und Raffael Nachbagauer, die an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York forschen, entwickelte einen Impfstoff, der das Immunsystem gegen den bei allen Stämmen äußerst ähnlichen "Stamm"-Abschnitt von Hämagglutinin scharfmacht.
Vom Immunsystem unbeachtet
"Er ist chimär, was bedeutet, dass wir einen Stamm mit verschiedenen Kopfdomänen kombiniert haben", erklärte Krammer. "Indem man mehrfach impft, aber immer eine andere Kopfdomäne verwendet, kommt es zu einer starken Immunantwort gegen den Stamm." Bisher hat man den Stamm nicht als Erkennungsziel verwendet, weil er nicht so exponiert wie der Kopf ist und ohne solche Tricks vom Immunsystem kaum beachtet wird.
Der chimäre Impfstoff hat sich in einer klinischen Phase-I-Studie bei 65 Personen zwischen 18 und 39 Jahren als wirksam und sicher erwiesen, berichten die Forscher im Fachjournal "Nature Medicine". Die Probanden zeigten mindestens 18 Monate lang eine starke Immunantwort gegen Grippeviren. In der nächsten Phase der Entwicklung soll der Impfstoff bei bis zu 59 Jahre alten Menschen getestet werden, so Krammer.
Potenziell lebenslanger Impfschutz
Mit diesem Impfstoff könnte man nach zwei bis drei Impfungen lebenslänglich vor Influenzaviren geschützt sein, meint er: "Man bräuchte dann also keine jährliche Grippeimpfung mehr." Mit dem neuen, universellen Impfstoff, der eine Immunantwort gegen ein breites Spektrum an Influenzaviren auslöst, wäre man wohl auch gegen neu auftretende Influenza-Unterarten (Subtypen) geschützt. Damit könnte man Pandemien wie aktuell bei Covid-19 in Zukunft mit Influenza vermeiden, so Krammer.
Die saisonale Grippe sei aber auch ohne pandemische Ausmaße wie 1918 die Spanische Grippe mit 40 Millionen Toten eine große Gefahr für die Gesundheit, immerhin sterben laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich 650.000 Menschen daran.
Außerdem könnte man sich die jährlichen Impfaktionen sparen, die immerhin einen großen Aufwand erfordern und viel Geld kosten, erklärten die Forscher. Das würde vor allem ärmeren Ländern zugutekommen, die kaum das Geld und die Logistik haben, um ihrer Bevölkerung jährlich eine Grippeimpfung zukommen zu lassen. Schreibt DER STANDARD.
Es gibt auch positive Nachrichten. Selbst in Zeiten wie diesen. Nur redet kaum jemand darüber. Negative Headlines bringen halt den notleidenden Medien, die auf jeden Klick auf ihren Portalen angewiesen sind, mehr Besucher*innen.
Denn Auslaufmodelle wie Printmedien sind mit wenigen Ausnahmen nicht mehr zu retten. Da hilft es den Zeitungen auch nicht unbedingt weiter, wenn ihre Onlineportale - wie z.B. Zofinger Tagblatt oder Luzerner Nachrichten (AZ-Verlag) – ausschliesslich nur noch für Abo-Kunden*innen zugänglich sind.
Das sind reine Verzweiflungsaktionen. Beide Zeitungen haben längst ihr Alleinstellungsmerkmal der «regionalen Berichterstattung» verloren. Blick und 20Minuten – um nur zwei Beispiele zu nennen – pflegen ihre Regio-Portale schneller und effizienter als die Lokalhelden.
Hand aufs Herz. Auch wenn die Hoffnung bekannterweise zuletzt stirbt: Ausser ein paar Senioren*innen wird kaum jemand aus der Zunft der jungen Generation diese beiden Zeitungen, die mit ihren Inhalten jenseits der sogenannten «Interest-Online-Magazines» liegen, virtuell abonnieren. Und ohne Abos keine bezahlten Inserate. «Ohne Moos nix los». So einfach ist das.
Frei nach Harald Schmidt: «Harry, hol schon mal das schwarze Trauergwändle aus dem Schrank!»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.12.2020 - Tag der Wertegemeinschaft
Millionen chinesische Touristen strömen auf coronafreie Südseeinsel
Angesichts der Beschränkungen in Europa wirkt es fast schon surreal: Zahlreiche chinesische Touristen machen derzeit Urlaub auf Hainan, einer Inselprovinz am südlichsten Punkt des Landes.
Die Insel, die als «Hawaii Chinas» gilt, hatte seit sechs Monaten keinen Corona-Fall mehr. Neben tropischen Temperaturen lockt das Eiland mit Duty-free-Einkaufszentren.
Zwar erhielt Hainan dieses Jahr von Januar bis Oktober nur 46 Millionen Besucher – weit weniger als 2019, als es 83 Millionen waren. Die vielen einheimischen Touristen dürften diesen Winter jedoch für einen unerwarteten Boom sorgen. Weil viele Grenzen wegen Corona geschlossen bleiben, machen die Chinesen vermehrt Urlaub im eigenen Land. Schreibt SRF heute Morgen in aller Herrgottsfrühe.
«Weil viele Grenzen wegen Corona geschlossen bleiben, machen die Chinesen vermehrt Urlaub im eigenen Land.» Noch Fragen zum Corona-Handling der hehren, über jeden Zweifel erhabenen «westlichen Wertegemeinschaft*» im Vergleich zu China? Asiaten handeln während die «westliche Wertegemeinschaft*» palavert und alle Mühseligen und Beladenen der ganzen Welt zu retten versucht.
* Hätte es verdient, zum Unwort des Jahrhunderts gewählt zu werden.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.12.2020 - Tag der Prediger*innen
Kurze Inlandflüge und Promis an Bord: So nutzen Berset, Maurer und ihre Kollegen die Bundesratsjets
Wer darf bei Bundesräten im Regierungsjet mitfliegen? Warum gibt es Zwischenhalte für Karin Keller-Sutter? Und was sagen die Flüge der Bundesratsjets über die Klimaaffinität der Landesregierung aus? Fünf Antworten zu Inlandflügen und Promis an Bord.
Seine Ehefrau nahm der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller gerne mal in der Regierungsmaschine mit. Für die Fachpolitiker der Opposition hatte er dagegen keinen Platz an Bord. Darüber hat Deutschland in den letzten Wochen diskutiert Höchste Zeit also für die Frage: Wer darf in der Schweiz im Bundesratsjet mitfliegen? Die «Schweiz am Wochenende» hat, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz, beim Bund die Liste der Mitreisenden der Jahre 2019 und 2020 verlangt. Inzwischen liegen die Angaben von fünf Bundesräten vor. Die wichtigsten Erkenntnisse:
Die Wirtschaft bleibt fast immer draussen
Reisen Bundesräte ins Ausland, mögen sie dort der Schweizer Wirtschaft Türen öffnen. Doch kaum je fliegt ein CEO im Bundesratsjet mit. Dies zeigt ein Blick auf die Gästeliste der Flüge. Meist befinden sich nur enge Stabsmitarbeiter, Amtschefs und Spezialisten aus der Verwaltung im Jet. Einzig Finanzminister Ueli Maurer hatte prominente Gäste an Bord: 2019 flog er von einem Besuch in Abu Dhabi weiter zum König von Saudi-Arabien in Riad. Mit an Bord waren Blaise Goetschin, Chef der Genfer Kantonalbank, Thomas Gottstein, inzwischen CEO der Credit Suisse, und UBS-Topbanker Ali Janoudi. Herbert Scheidt, der Präsident der Bankiervereinigung, war die ganze Reise dabei, von Bern über Abu Dhabi nach Riad und zurück.
Man fliegt gerne hin und wieder ins Tessin
Klimaschädliche Inland-Linienflüge, etwa von Zürich nach Lugano, gehören verboten: Dies forderten 2019 zwei Politikerinnen in einem Vorstoss. Der Bundesrat sprach sich dagegen aus. Alles andere wäre inkonsequent gewesen. Denn die Bundesräte nutzen ihre beiden Jets auch für Inlandflüge. Ueli Maurer flog etwa von Bern nach Genf. SP-Mann Alain Berset flog die Strecke Zürich-Genf oder nutzte den Bundesratsjet, um am Montag nach dem Filmfestival Locarno mit seiner Frau zurück nach Bern zu gelangen. Gerade das Tessin wird aus Zeitgründen immer wieder mit dem Regierungsjet angeflogen. Die Terminpläne der Bundesräte sind äusserst eng. Müssten sie mit dem Dienstwagen ins Tessin, könnten sie manchen Termin dort wohl gar nicht wahrnehmen. Meist aber fliegen die Jets die Bundesräte ins europäische Ausland; nach Rom, Wien oder Brüssel. Selten geht es weiter, etwa nach Tunis, Washington oder Moskau.
Extra-Halt für Karin Keller-Sutter
Zwischenhalte brauchen zwar Kerosin und sind wenig klimafreundlich. Es kommt gelegentlich trotzdem vor, dass sich Bundesräte näher an der Haustüre (oder beim nächsten Termin) abladen lassen, bevor der Jet mit dem Rest des Stabes an den Stammplatz Bern-Belp zurückkehrt. Bundesrat Guy Parmelin wurde schon in Payerne rausgelassen. Mehrfach kamen die Zwischenhalte bei der Ostschweizerin Karin Keller-Sutter vor. Sie ist dann nicht in Bern zugestiegen, sondern auf dem bundeseigenen Militärflugplatz Dübendorf, also näher bei ihrem Wohnort Wil (SG). Es kam sogar vor, dass Keller-Sutters Kommunikationschef, die persönliche Mitarbeiterin und ihr Staatssekretär von einer Pilatus PC 24 von Bern nach Dübendorf geflogen wurden. Dort stieg man dann mit Keller-Sutter und einer weiteren Person in eine Bombardier-Maschine der Luftwaffe um, um nach Berlin zu fliegen. Beim Rückflug gab es für die drei Personen wieder einen Bern-Extra-Flug ab Dübendorf . Der Flugzeugwechsel sei aus Kapazitätsgründen erfolgt, sagt Keller-Sutters Departement. Sitzungen seien in der grösseren Maschine besser möglich.
Allerdings ist auch festzuhalten: Keller-Sutter nutzt den Bundesratsjet im Vergleich zu anderen Bundesräten sehr selten. Vielflieger ist verglichen mit der Justizministerin ihr Migrations-Staatssekretär Mario Gattiker. Er sass in den vergangenen zwei Jahren deutlich öfter im Bundesratsjet als seine Chefin.
Kaum Parteikollegen an Bord
Parlamentarier sind kaum je mit dabei, wenn Bundesräte fliegen. Einzig Guy Parmelin nahm seinen Parteifreund und Bauernkollegen, SVP-Nationalrat Marcel Dettling, mit, als er im Januar 2020 an eine internationale Landwirtschaftsmesse, in Berlin flog. Auch in Berlin anwesend, aber nicht mit dabei im Bundesratsjet waren mehrere Mitarbeitende des Bundesamtes für Landwirtschaft. Für sie bezahlte der Bund Linienflüge, denn sie waren früher da oder blieben länger in Berlin als ihr Chef. Dettling war vom Landwirtschaftsminister als Mitglied der Wirtschaftskommission eingeladen worden, erklärt Parmelins Departement. Ein weiteres Kommissionsmitglied sei auch noch eingeladen worden, konnte aber nicht teilnehmen.
Gute Bilder schaden nie
Alain Berset hat kein Problem, vor eine Kamera zu stehen. Im Gegenteil. Dass sich der Innenminister gerne zeigt, wurde im Lockdown deutlich. Bei Berset war in den vergangenen zwei Jahren denn auch zwei Mal ein Fotograf einer Bildagentur an Bord, als der SP-Mann ins Ausland reiste. Im Mai 2019 war Berset zu Besuch in der Zentralafrikanischen Republik. Berset im Spital, bei Gesprächen mit Regierungsmitgliedern: Das wurde fotografisch für das Schweizer Publikum festgehalten, immerhin machte der Besuch auch auf die Gesundheitsversorgung in Krisengebieten aufmerksam. Auch im Corona-Jahr gab es einen wichtigen Termin, der nicht verpasst werden durfte: Ende Februar reiste ein Agenturfotograf mit, als sich Berset in Rom mit den Gesundheitsministern von Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien traf.
2019/20 reisten die Bundesräte in drei Flugzeugmodellen: Eine Falcon 900 sowie eine Cessna Citation Excel waren jahrelang die offiziellen Bundesratsjets. Seit 2019 ist auch ein Schweizer Modell in Betrieb, eine Pilatus PC 24. Total waren die Bundesräte 2019 554 Stunden in der Luft, deutlich weniger als 2018 (788 Stunden), am häufigsten der Aussenminister. Mit der Coronakrise dürfte die Zahl der Flüge 2020 nochmals deutlich tiefer liegen. Schreibt die AZ.
Inlandflüge? Wie sagt der Volksmund (bei Blocher «Volchsmund» genannt) so schön wie auch richtig: «Politiker*innen predigen Wasser und trinken Wein.»
Das zeigte sich einmal mehr bei der Geburtstagsparty zum 70. Geburtstag von Bundesrat Ueli («90 Prozent aller Corona-Toten sind über 80 Jahre alt») Maurer vor ein paar Tagen im Hohen Haus von und zu Bern, wo viele der Beteiligten so ziemlich alle Corona-Vorschriften vermissen liessen. Dazu hat sich der Bildverliebte Glatzkopf der Nation (Alain «nach George Clooney und Brad Pitt the sexiest Man alive» Berserker) bisher noch nicht geäussert.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.12.2020 - Tag der Mühseligen und Beladenen
In der Pandemie haben sich Depressionen verdreifacht: Jeden Zehnten macht Corona depressiv
Die Corona-Krise hat nicht nur Folgen für körperliche Gesundheit und Wirtschaft. Je länger sie dauert, desto mehr drückt sie auf unsere Stimmung. Für viele Menschen ist das ein ernstes Problem.
Corona tut unserer Seele nicht gut. Eine im Juni veröffentlichte Umfrage der wissenschaftlichen Taskforce hat ergeben, dass während des Lockdowns fast dreimal so viele Menschen von Depressionssymptomen betroffen waren – neun statt drei Prozent.
Diese Entwicklung beobachtet auch Marieke Kruit (52). Die Psychologin, die am Sonntag in die Berner Stadtregierung gewählt wurde, leitet noch bis Ende Jahr die psychiatrischen Ambulatorien des Spitals Oberaargau. «Seit dem Ausbruch der Pandemie kommen vermehrt Patienten zu uns, die bisher nicht unter psychischen Erkrankungen gelitten haben», bestätigt sie.
Existenzängste, Stress, Isolation
Bei diesen Patienten sei eine sogenannte Anpassungsstörung diagnostizierbar – also eine psychische Reaktion auf Belastungen, die mit der Krise einhergehen. «Existenzängste, Stress, soziale Isolation und Verunsicherung führen vermehrt zu Ängsten und auch depressiver Stimmung», erklärt Kruit.
Diese Symptome nehmen seit Beginn der zweiten Welle wieder zu, wie eine aktuelle Bevölkerungsbefragung im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt. Ende Oktober gaben 15 Prozent der Bevölkerung an, sich schlecht bis sehr schlecht zu fühlen.
Senioren und Junge besonders betroffen
Senioren schätzen ihr Wohlbefinden sogar noch schlechter ein als während des Lockdowns im Frühling. Sie fühlen sich seit dem Herbst wieder einsamer und ausgeschlossener. Mehr als zehn Prozent geben an, dass sie sich nach Gesellschaft sehnen. Einerseits ist das mit den Besuchseinschränkungen in Altersheimen zu erklären. Und andererseits damit, dass Angehörige den persönlichen Kontakt vermeiden, um die Älteren zu schützen.
Allerdings zeigen Studien auch, dass es nicht die Senioren sind, die am meisten leiden – sondern die Jugendlichen. Der Anteil unter ihnen, der sich «nie, selten oder manchmal» glücklich fühlt, lag im November bei 38 Prozent und damit höher als in den Vorjahren. Kein Wunder: Kontakte zu Gleichaltrigen, die in diesem Alter eine entscheidende Rolle spielen, sind deutlich reduziert.
Es sind zudem andere Sorgen, die uns nun auf der Seele lasten: Während der ersten Welle raubte uns vor allem die unmittelbare Bedrohung den Schlaf. Nun bringen viele einfach keine Kraft mehr auf, die anhaltenden Krise emotional zu bewältigen. Zudem fürchten acht Prozent um ihren Arbeitsplatz, was existenzielle Ängste auslösen kann. Schreibt Blick.
Think positiv, wie die Amerikaner zu sagen pflegen: 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung singen der fragwürdigen «Studie» zufolge nicht den Coronablues!
Die Medien sollten aufhören, aus jeder 10-Prozent-Mücke den berühmten Elefanten zu kreieren und für ein paar Klicks dem negativen Alarmismus zu huldigen.
Die ohnehin Mühseligen und Beladenen, die bei jeder Gelegenheit auch ohne Coronavirus den Depressiv-Blues bemühen, werden sich bestärkt fühlen und den 90 Prozent positiv Denkenden gehen solche Artikel sowieso am Allerwertesten vorbei.
By the Way hat es der Blues nicht verdient, mit Menschen in einen Topf geworfen zu werden, die am Morgen aufstehen und erst die «Anleitung zum Unglücklichsein» des österreichischen Psychologen Paul Watzlawick aus dem Jahr 1983 lesen, bevor sie sich dem Stuhlgang widmen, der dann vermutlich auch noch buchstäblich in die Hose gehen wird.
Listen the Blues! https://www.youtube.com/watch?v=qaE7C-hf6Wg
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.12.2020 - Tag der japanischen Toiletten
Neue Toiletten in Tokio: Architektur als Bedürfnis
Auf Gastfreundschaft legt man in Japan großen Wert. Dass das nicht bloß Lippenbekenntnisse sind, sondern die Bemühungen um das Wohlergehen des Gastes sozusagen auch tiefer reichen, zeigt das Projekt "Tokyo Toilet".
In der japanischen Metropole Tokio werden nämlich anlässlich der Olympischen Spiele (die Corona-bedingt von 2020 auf 2021 verschoben wurden) neue öffentliche Bedürfnisanstalten errichtet. Das Besondere dabei: Entworfen wurden sie durchwegs von renommierten, großteils japanischen Architekten, darunter etwa die beiden Pritzker-Preisträger Tadao Andō und Shigeru Ban.
Letzterer hat für zwei Standorte in Tokio Toilettenpavillons erdacht, die zunächst von außen völlig transparent sind.
"Über zwei Dinge machen wir uns beim Betreten einer öffentlichen Toilette – insbesondere in einem Park – Sorgen", erklärt der Pritzker-Preisträger dazu. "Zum einen ist es die Frage nach der Sauberkeit der Räumlichkeiten, zum anderen fragt man sich, ob sich jemand im Inneren aufhält." Beide Fragen soll man hier nun also mit einem einzigen Blick schon von außen beantworten können, also schon bevor man eintritt, um auszutreten.
Insgesamt 17 neue "Tokyo Toilets" sollen bis zu den Olympischen Spielen fertig werden, sieben davon sind es bereits, darunter auch jene von Tadao Andō. Er entwarf einen Toilettenpavillon für den Jingu-Dori Park ganz in der Nähe eines Eingangs zum Bahnhof Shibuya.
Zwei Öffnungen an gegenüberliegenden Seiten sollen hier für ein ständig durchziehendes Lüftchen sorgen, was bei einer öffentlichen Toilette wohl keine so schlechte Idee ist. So kann der Platz unter der Traufe möglicherweise tatsächlich zur "communal relaxing area" werden, wie es auf der offiziellen Website zum Projekt heißt. Schreibt DER STANDARD.
Worauf die Welt definitiv gewartet hat. Durchsichtige Toilettenhäuschen? Wär das nicht was für Orbans EU-Abgeordneten József Szájer?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.12.2020 - Tag der Burka
Nach der Wahl ist vor der Wahl: Keller-Suter setzt im Abstimmungskampf Prioritäten
Karin Keller-Sutter wird bei den eidgenössischen Vorlagen eher die E-ID vertreten, als gegen das Burkaverbot kämpfen.
Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Kaum hat Justizministerin Karin Keller-Sutter mitgeholfen, die Konzernverantwortungs-Initiative zu bodigen, muss sie sich bereits in den nächsten Abstimmungskampf stürzen.
Es geht um die «Burka-Initiative» und das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID).
Aussergewöhnliche Konstellation
Wenn immer möglich versucht der Bundesrat zu vermeiden, dass eines seiner Mitglieder einen doppelten Abstimmungskampf führen muss. Entsprechend kommt das äusserst selten vor. Nun trifft es aber Justizministerin Karin Keller-Sutter, die am 7. März gleich zwei Vorlagen vertritt.
Das sei tatsächlich aussergewöhnlich, sagt die Bundesrätin. Denn in der Regel habe ein Departement für den Bundesrat nur eine Vorlage zu vertreten.
«Aber nachdem wegen Corona eine Abstimmung ausgefallen ist und wir bei Volksinitiativen auch Fristen haben, ist jetzt diese Konstellation eingetreten», erklärt sie.
Auf eine Vorlage konzentrieren
Mit der Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» – der Bundesrat empfiehlt hier eine Ablehnung – und dem Bundesgesetz über die sogenannte E-ID, mit der man sich in der digitalen Welt identifizieren kann, warten auf Keller-Sutter zwei heftig umstrittene Vorlagen.
Zu beiden werde sie zwar Anfang Jahr eine Medienkonferenz durchführen, kündigt die Justizministerin an, betont aber auch: «Ich werde sicherlich nicht bei beiden Vorlagen gleich viel machen können.»
Das heisst, die FDP-Bundesrätin will sich danach auf eine Vorlage konzentrieren. Ihre Priorität liegt dabei bei der E-ID. Denn die Digitalisierung sei für den Standort Schweiz sehr wichtig. «Das hat sich auch jetzt in der Coronakrise gezeigt. Von daher ist wahrscheinlich die elektronische Identität schon etwas im Vordergrund», so Keller-Suter.
Kompetenz bei Kantonen belassen
Vielleicht aber kommt es ihr sogar ganz gelegen, sich nicht so engagiert gegen das Verhüllungsverbot einsetzen zu müssen. Immerhin führte sie als Regierungsrätin im Kanton St. Gallen selbst eines ein. «Das war auch vor dem Hintergrund der Hooligan-Gewalt rund um Sportstadien», verteidigt sich Keller-Suter heute.
Ausserdem betont sie: «Der Bundesrat lehnt dieses Verhüllungsverbot ja ab.» Das Gremium vertritt die Meinung, dass ein solches Verbot keine Frage ist, die in der Bundesverfassung geklärt werden muss. «Das ist eine klare kantonale Kompetenz, die der Bundesrat nicht beschneiden will», sagt Keller-Suter.
Klar ist aber auch: Karin Keller-Sutter will ihr Herzblut bei der E-ID vergiessen und nicht beim Nein zur «Burka-Initiative». Schreibt SRF.
Ein guter Freund, stets für ein Spässchen mit einer feurigen Brasilianerin oder Marokkanerin aus dem Luzerner Nizza aufgelegt, fragte mich kürzlich, ob ich unter einer Islam-Phobie leide? Während er mir diese Frage stellte, schaute er mich mit dem etwas vorwurfsvollen Blick an, wie ihn sonst nur Papst Franziskus zur Schau stellt, wenn er seine Schäfchen auffordert, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Immer mit dem Verweis, dass der Vatikanstaat trotz beengten Platzverhältnissen fünf syrische Flüchtlingsfamilien samt Kind und Kegel aufgenommen habe (was in etwa mit dem Nachzug sämtlicher Grossmütter, Grossväter, Onkel und Tanten etwa 200 Personen entspricht) und man sich doch bitte diesem Beispiel anschliessen möge.
Ich antwortete meinem Freund, dessen Namen ich hier nicht nennen will, weil Eddy Buser (genannt «Busen-Eddy») ja noch lebt: «Mein abgrundgutester Freund! Du liegst einmal mehr völlig falsch mit Deiner Vermutung. Als Atheist habe ich nicht eine Phobie gegen den Islam, sondern gegen alle monotheistischen Religionen mit Allmachtsansprüchen und der Deutungshoheit für Texte, die aus tausendjährigen Fabelbüchern stammen.»
Und nun kommt einmal mehr die SVP mit einer unsinnigen Volksabstimmung über ein «Burkaverbot» daher, die Busen-Eddy mit aller Vehemenz befürwortet. Kein Wunder, mag er doch die Damen aus dem Nizza und Milano unverschleiert. Kann ich durchaus nachvollziehen. Man kauft ja nicht ein Kätzchen im Sack für eine Nacht, ohne vorher ihr Gesicht gesehen zu haben. Wär' ja auch schade um die schönen, blauen Pillen von Pfizer, mit denen sich Eddy auf dem asiatischen Schwarzmarkt in Luzern jeweils eindeckt.
Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist diese lächerliche Volksabstimmung über ein Burkaverbot in der Schweiz. Erinnert mich an die ebenso unselige wie unnötige Volksabstimmung über das Minarett-Verbot in der Schweiz. Jeder auch nur einigermassen mit den Schweizer Baugesetzen täglich konfrontierte Bauunternehmer hätte dem Wahlvolk erklären können, dass in der Schweiz mit den bestehenden Baugesetzen niemals auch nur eines der vier (!) Minarette, um die es damals ging und für die man ein ganzes Volk an die Wahlurnen bemühte, hätte gebaut werden können.
Nun soll das Schweizer Volk über ein Burkaverbot abstimmen. Dabei ist das Tragen der Burka dort, wo es nicht unbedingt wünschenswert ist, also bei den öffentlichen Institutionen von Bund, Kantonen und Gemeinden, in der Schweiz längst gesetzlich geregelt.
Welche Kopfbedeckung Musliminnen in ihrem privaten Bereich bevorzugen, ist allein deren Angelegenheit. Die SVP argumentiert allerdings mit der «Würde und Unterdrückung der Frauen» durch die islamischen Männer.
Das mag so sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass allein die muslimischen Frauen entscheiden, ob sie eine Burka tragen wollen oder nicht. Befehl hin oder her, von wem auch immer er kommen möge.
Solange Musliminnen ihrem Göttergatten nicht von sich aus knallhart den Tarif erklären mit einem Satz wie «Hör mal Üzgür, steck Dir deine Burka in den Allerwertesten. Allahu akbar!», oder so ähnlich, wird das nichts mit dem Beenden einer angeblichen, mehr oder weniger nur von der SVP etwas sibyllinisch wahrgenommen Unterdrückung islamischer Frauen mit Bezug auf die Burka. Wenn wir schon von Unterdrückung reden: Die Burka dürfte in diesem Unterdrückungs-Katalog der Sheilas und Amatullahs (übersetzt: Magd Allahs, Gottesdienerin) wohl das kleinste Übel sein.
Die SVP als glorreiche Volkspartei sollte sich tunlichst daran erinnern, dass die Schweizerinnen ihr Stimmrecht auch selber erkämpfen mussten. Wären damals, und das ist ja noch gar nicht so lange her, nicht mutige Schweizer Frauen aufgestanden und hätten dem Bartli gezeigt, wo Frau den Most holt, hätte es wohl mit dem Schweizer Frauenstimmrecht noch viel länger als bis zum Jahr 1971 (!) gedauert.
Wie wär's denn, wenn die SVP-Granden ihre Argumente über die Unterdrückung islamischer Frauen bei ihren Geschäftspartnern aus Saudi Arabien vortragen würden? Selbst auf die Gefahr hin, dass die Wüstensöhne keine Spuhler-Züge oder Chemieprodukte von der EMS mehr kaufen würden. Dann könnte selbst ich die Argumente der SVP nicht ganz, aber immerhin etwas, ernster nehmen.
Solche Volksabstimmungen, in welchem Land auch immer sie stattfinden, helfen letztendlich nur den Hardcore-Islamisten, ihre Opferrolle zu zementieren und bewirken somit das Gegenteil: Der Kurs der Islamisten wird noch härter gefahren. Ein Terroranschlag ist selbst in der Schweiz längst nicht mehr undenkbar. Auf der Strecke bleibt die längst fällige Anpassung des Islams an das 21. Jahrhundert. Auch und vor allem bei den Salafisten Saudi Arabiens.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.12.2020 - Tag des Luzerner Velos
«Ganz easy»: So geht der Corona-Schnelltest in der Luzerner Allmend mit dem Velo
Kurzerhand aufs Velo gesessen und ab auf die Luzerner Allmend, wo man sich neuerdings mit dem Velo direkt ins Corona-Testzentrum kurven kann. zentralplus hat den Selbstversuch gewagt.
Sorgenfalten zieren die Stirn des Leiters Gesundheitsversorgung, Christos Pouskoulas. Herr und Frau Schweizer traben weniger zum Coronatest an – doch die Fallzahlen sind nach wie vor bedenklich hoch.
«Die Menschen sollten sich mehr testen lassen», sagt Pouskoulas mit klarer, ruhiger Stimme. «Es macht mir Sorgen, denn es ist sehr schwierig, die Pandemie in den Griff zu kriegen, wenn wir nicht wissen, wer erkrankt ist und wer nicht.» Sanken die Fallzahlen in den letzten Tagen wieder, weil die Fallzahlen effektiv rückläufig sind? Oder weil weniger getestet wird? «Wir wissen es schlicht nicht.»
Kantonale Testcenter könnten bis zu 500 Tests täglich durchführen
In Luzern hat man auf die rückläufigen Testzahlen reagiert. Coronatests sollen noch einfacher zugänglich sein und das Ergebnis schneller vorliegen. So setzt man nun auch auf Schnelltests, seit Kurzem können beim Drive-in-Testcenter in der Allmend auch Velofahrerinnen vorfahren. Deswegen kreuzen aber nicht mehr Testwillige auf. Nach wie vor werden in den kantonalen Testzentren täglich rund 200 Menschen auf das Coronavirus getestet. «Mit den bestehenden Ressourcen könnten wir hierin unseren drei Testzentren bis zu 500 Tests täglich durchführen», sagt Pouskoulas.
An diesem kalten Novembernachmittag ist es auf der Luzerner Allmend, als wir um die Mittagszeit eintreffen, noch ruhig. Noch lassen die Menschen, die sich einem Test unterziehen wollen, auf sich warten. Auf dem Areal des Armee-Ausbildungszentrums bereiten sich zwei Zivilschützer vor, stellen Pylon für Pylon auf.
Per SMS zum Test geladen
Wer sich hier testen lassen will, muss sich erst online anmelden. Danach wird einem per SMS der Termin bestätigt und ein Timeslot angegeben. Aufs Velo gesessen – zur Allmend ist man von der Stadt aus innert Minuten gedüst – reiht man sich an die Schlange vor der Schranke des AAL-Areals.
Veloreifen quietschen hinter mir, Kommandant Marco Pieren, die Maske bereits über Mund und Nase gezogen, steigt vom Drahtesel und grüsst freundlich. Er begleitet mich heute bei meinem Test und erklärt mir das Prozedere.
PCR- oder Schnelltest? Die Zuweisung erfolgt automatisch
Vor der Schranke werden Anmeldung und die Versichertenkarte überprüft. Stimmt alles, wird man vorgewunken, man darf mit seinem Auto – oder eben mit seinem Velo – vorfahren. Im Testzentrum auf der Allmend reiht man sich in vier Bahnen ein. «Je nachdem, ob man für den Schnelltest oder den PCR-Test eingeteilt wurde», so Pieren. Pouskoulas erklärt, wann welcher Test erfolgt: Bei jüngeren und gesünderen Menschen reicht der Schnelltest aus, bei Menschen, die in die Risikogruppe gehören oder in der Pflege arbeiten, erfolgt ein PCR-Test, wo der Abstrich im Labor ausgewertet wird. «Bei ihnen wollen wir ein exaktes Resultat», sagt Pouskoulas.
Ist der Schnelltest denn überhaupt zuverlässig? «Ja», meint Pouskoulas. «Die Schnelltests sind sehr zuverlässig. Aber die Zuverlässigkeit des Resultats ist davon abhängig, wer getestet wird und wie häufig das Virus in dieser Bevölkerungsgruppe vorkommt.»
Links geht’s zum PCR, rechts zum Schnelltest
Wir fahren mit unseren Velos weiter in den Warteraum. Zu Spitzenzeiten können sich hier bis zu 30 Autos einreihen. Jetzt herrscht noch gähnende Leere. Erst um 12.50 Uhr ist das erste Brummen eines Autos zu hören: Pieren hält in seinen Erklärungen kurz inne, läuft quer über den Platz und begrüsst die Frau hinter dem Lenkrad. Pieren wünscht ihr «einen guten Test». «Es kommt selten bis nie vor, dass man hier jemanden kennt», sagt er noch.
Wir fahren weiter, vor uns liegen die beiden Bahnen: Links geht’s zum PCR-Test, rechts zum Schnelltest. Witterungsgeschützt unter einem weissen Zelt stehen die beiden knallorangen Container. Hier wird der Nasenrachenabstrich genommen. Autofahrerinnen bleiben im Auto, Velofahrer auf dem Sattel sitzen. Für den Test im Auto muss man lediglich das Fenster öffnen.
Nach wenigen Sekunden ist der Spuk vorbei
Nun bin ich am Zuge. Ich fahre vor, zum Container bei den Corona-Schnelltests. Ein Schild, mit dicken schwarzen Buchstaben, klärt mich auf, wie ich mich zu verhalten habe: Blick nach vorne, Kopf nicht abdrehen.
Eine Fachfrau, eingepackt in einen Schutzanzug, Haarnetzkappe und Handschuhe, tritt nach vorne. Nase und Mund hat sie versteckt hinter einem doppelten Mundschutz, die Augen blicken hinter einer Schutzbrille hervor. Sie erklärt mir das Vorgehen und erkundigt sich, ob ich ein Taschentuch brauche.
«Das kann jetzt ein wenig unangenehm werden», sagt sie, den Stab vor meinen Augen. Vorsichtig führt sie das Wattestäbchen ein. Tiefer und tiefer. Es brennt ein wenig und ich spüre, wie es auf die Tränendrüsen drückt. Nach nicht einmal 20 Sekunden ist das Prozedere aber vorbei, das Wattestäbchen draussen, die Tränen fliessen.
Das Testresultat ploppt mer SMS auf
Ich bin jetzt fertig, kann mich auf den Sattel schwingen und losfahren. Beim Schnelltest wird das Stäbchen anders als beim PCR-Test nicht ins Labor geschickt, sondern vor Ort ausgewertet, erklärt Christos Pouskoulas. In einem Reagenzglas wird das Wattestäbchen mit einer Flüssigkeit angereichert. Innerhalb von 15 Minuten liegt das Resultat vor.
Ähnlich einem Schwangerschaftstest zeigen die Streifen, ob der Test negativ oder positiv ausgefallen ist. Ein Strich bedeutet negativ, zwei Striche positiv. In wenigen Stunden wird eine SMS auf meinem Handy aufploppen, die mich darüber informiert, ob das Testergebnis positiv oder negativ ist.
«Es ist eine ganz simple Sache», sagt Marco Pieren. Und Pouskoulas ergänzt: «In fünf Minuten ist der Test vorbei. Es ist für Sie eine kleine Sache, aber es hilft viel bei der Bekämpfung des Virus.»
Als ich aus dem Drive-in-Testcenter fahre, ist es mit der Ruhe im Drive-in-Testcenter vorbei. Rund 20 Autos und Velos stehen Schlange, warten, bis sie zum Zuge kommen. Ein Auto springt nicht mehr an. Vier Zivilschützer packen an, stossen das Auto. «Wir haben bis jetzt noch jeden zum Test gebracht», sagt Marco Pieren und lacht. Schreibt ZentralPlus.
Wie der grossartige Schriftsteller Giuseppe di Malaparte richtigerweise bemerkte: «Luzern war der Menschheit schon immer einen Schritt voraus.» Jetzt sogar noch auf dem Velo.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.11.2020 - Tag der EXIT-Strategie
Grosse Nachfrage auf Gratisessen in Luzern: «Drogensüchtige sind jetzt noch viel dankbarer als vorher»
Früher hat der Verein Windrad zum Spaghettiplausch geladen – seit Corona verteilt er bedürftigen Menschen ein Lunch-Paket. Diese sind gefragter denn je.
Es waren Bilder, die man sonst nur aus Krisengebieten kennt: In Genf standen im Frühling rund 2’500 bedürftige Menschen stundenlang an, um sich einen Sack mit Nahrungsmitteln zu ergattern.
Auch in der Stadt Luzern wird kostenlos Essen verteilt. Ganz so viele Menschen wie in Genf sind es in der Zentralschweiz zwar nicht. Doch auch hier zeigt sich an jedem Freitagabend an der St. Karli-Strasse bei der Stadtmission Luzern folgendes Bild: Rund 70 Menschen stehen meterlang Schlange, um ein Lunch-Paket des gemeinnützigen Vereins Windrad Luzern abzuholen.
«Letzte Woche warteten einige bereits eineinhalb Stunden, bevor wir an der St. Karli-Strasse die Tür öffneten», erzählt Reto Siegrist, der Präsident des Vereins.
Präsident ist selbst erstaunt, dass so viele kommen
Die Mitarbeitenden von Windrad Luzern wollen Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, Zeit und gute Gedankenanstösse schenken. Entstanden ist der Verein vor über sieben Jahren. Drei ehemalige Junkies haben ihn ins Leben gerufen.
Vor Corona besuchten die Verantwortlichen einmal pro Woche die Randständigen am Busperron 2 in der Stadt Luzern. Einmal pro Monat luden sie zum Spaghetti-Essen ein.
Seit Corona hat sich das Blatt gewendet: Sie suchen nur noch einmal im Monat die Randständigen auf, dafür kommen diese einmal wöchentlich zu ihnen. Grund ist unter anderem die Abgabe eines kostenlosen Lunch-Pakets.
Siegrist ist selber erstaunt, wie rege das Angebot seit Corona genutzt wird. «Es ist aussergewöhnlich, wie viele Menschen in Not sind. Klar ist ein Teil davon auch eine selbstgemachte Not durch die Sucht nach Drogen.»
Auch warme Winterkleider sind hoch im Kurs
Kommen nun andere Menschen als früher? Siegrist verneint. Viele seien drogenabhängig. Aber die Menschen hätten sich in der Krise verändert. «Sie waren schon immer dankbar für unser Angebot. Aber jetzt sind sie noch viel dankbarer als früher.»
Neben Essen verteilt der gemeinnützige Verein auch Winterkleider, Hygieneartikel oder Migros-Gutscheine. Siegrist erzählt von einem Mann, der ein paar Schuhe anprobierte. Schuhe, die ein anderer nicht mehr wollte. «Der Mann war so glücklich über seine neuen Schuhe und strahlte über das ganze Gesicht.»
Dem Verein ist der Glaube ein wichtiges Anliegen. Siegrist sagt, dass sich jetzt mehr Menschen ein seelsorgerisches Gespräch wünschen oder das gemeinsame Gebet suchen würden. «Viele Drogensüchtige suchen jetzt Hoffnung und brauchen mehr Halt als vorher.»
Einige überlegten sich, auf die Drogen zu verzichten
Die Situation auf der Gasse habe sich inzwischen wieder fast normalisiert. Gerade während des Lockdowns sei die Situation doch sehr angespannt gewesen. Die Grenzen waren zu, der Stoff rar. Möglichkeiten, Drogen zu finanzieren, brachen ein. Viele konnten sich weniger Geld erbetteln, denn die Menschen waren auf mehr Abstand oder trugen kein Bargeld auf sich.
Der Druck stieg – gezwungenermassen. «Ich hörte im Frühling von einigen Drogensüchtigen, die mit den Drogen aufhören wollten und sich überlegten, die Krise als Chance für einen Ausstieg zu nutzen», sagt Siegrist. Viele hätten ihm erzählt, dass sie sich in der Psychiatrie in St. Urban angemeldet hätten und einen richtigen Entzug machen wollten.
Doch sobald sich die Situation soweit wieder normalisiert hatte, habe die Sucht bei den meisten Überhand gewonnen.
Doch davon lässt sich der Verein Windrad nicht unterkriegen. Er will den Menschen auf Augenhöhe begegnen, ihnen Hoffnung und Mut schenken, um einen Weg aus der Drogensucht zu finden. Schreibt ZentralPlus.
Ohne den guten Willen des gemeinnützigen und etwas religiös angehauchten Vereins WINDRAD schmälern zu wollen: Das Mitleid mit den Drogensüchtigen hält sich in Grenzen. Niemand wird mit vorgehaltener Pistole zum Konsum von Scheissdrogen gezwungen. Wo man hineingeht, gibt es immer auch die Möglichkeit hinauszugehen. Wann, wenn nicht jetzt?
Luzern muss ja nicht für alle Ewigkeit der zweitgrösste Drogen-Hotspot der Schweiz bleiben. Warum nicht Corona als Chance nutzen, um von diesem zweifelhaften Ranking an zweitvorderster Stelle herunterzukommen?
Der politische Wille zu einer unabdingbaren Zero Tolerance-Strategie scheint in der Stadt Luzern allerdings zu fehlen.
Nur die Hände im Schoss oder zum täglichen Gebet zu falten, hilft nicht unbedingt weiter.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.11.2020 - Tag der Unaufgeklärtheit
Politisierte Religiosität
Eine Entscheidung des Supreme Court legt fest, dass in den USA die Ausübung religiöser Handlungen höher gewertet wird als die Sicherheit in einer Pandemie.
In einer hierzulande (noch) zu wenig beachteten Entscheidung hat der Supreme Court der USA die Beschränkungen verworfen, die Andrew Cuomo, der Gouverneur des Staates New York, wegen Corona für katholische Kirchen und Synagogen in der Bronx und in Queens verfügt hatte.
Der Supreme Court hob die Verfügung mit 5:4 Stimmen auf, den Ausschlag gab die Stimme der von Donald Trump eingesetzten ultrakonservativen neuen Richterin Amy Coney Barrett. Damit ist festgelegt, dass die Ausübung religiöser Handlungen höher gewertet wird als die Sicherheit in einer Pandemie. Zumindest in den Vereinigten Staaten.
Wir haben es hier mit einem "politischen Christentum" zu tun, das sich in der Intention nicht sehr vom "politischen Islam" unterscheidet, den die Türkisen bei uns unter Strafrecht stellen wollen. Darüber hinaus gibt es auch in Europa eine Art Wiedergeburt eines ausdrücklichen "politischen Christentums", in Polen oder Ungarn. Auch H.-C. Strache wachelte einst mit einem riesigen Kreuz herum (obwohl die Wurzeln der FPÖ im antiklerikalen Deutschnationalismus und Nationalsozialismus liegen). Sebastian Kurz ließ sich von einem freikirchlichen Erweckungsprediger in einer berühmten Stadthallenshow segnen. In der türkisen ÖVP sind fundamentalistische Funktionäre im Hintergrund wirksam.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Religionsausübung hat frei zu sein, und die Religionsgemeinschaften leisten oft Großartiges im spirituellen wie humanitären Bereich. Der Trend zu einer "politisierten Religiosität" ist aber nicht harmlos.
Dominante Religion
Die Virulenz eines politischen Islam ist heute zweifellos wesentlich größer als die anderer Religionsgemeinschaften (vielleicht mit Ausnahme des Hindu-Nationalismus im Indien des Premiers Narendra Modi). Der Islam hat sich immer als dominante Religion verstanden. Das war sehr lange auch beim Christentum so, aber beginnend mit der Aufklärung wurde die ursprünglich dominierende Stellung des Christentums stetig zurückgedrängt.
Der Islam ist in der Moderne schwer ins Hintertreffen geraten. Die entsprechenden Reformbewegungen, wie etwa die Muslimbrüder, zogen daraus den Schluss, die Muslime dürften ja nicht die geistige Freiheit der Moderne annehmen, sondern müssten im Gegenteil ihre wissenschaftlich-technologische Rückständigkeit durch eine strikte Rückkehr zur "religiösen Reinheit" der Vorfahren ausgleichen.
Religiosität ist Bestandteil der menschlichen Lebenswelt. Aber man darf nicht zulassen, dass Fanatiker und Obskurantisten die Herrschaft übernehmen, weder im europäischen Islam, noch in einem neuen politischen Katholizismus, den man mühsam zurückgedrängt hat. Die erzreaktionäre Amy Coney Barrett ist Mitglied einer katholischen Sekte namens "People of Praise", in der die Männer ausdrücklich als Oberhaupt der Familie gelten und die Frauen "Handmaids" sind ("Mägde", klingt nach Margaret Atwoods dystopischem Roman The Handmaids Tale, das Vorbild war allerdings eine andere Sekte).
In den USA wird Barrett nun versuchen, ihre reaktionären Überzeugungen zu Waffenbesitz, Einwanderung und vor allem Abtreibung durchzubringen. Dasselbe passiert ja in Polen und, abgeschwächt, in anderen europäischen Ländern. Sosehr man daher den politischen Islam oder eher einen fundamentalistischen, aggressiven Islamismus beobachten und auch eindämmen muss, so sehr ist darauf zu achten, dass aggressives, rückwärtsgewandtes politisches Christentum nicht wieder an die Macht kommt. Schreibt DER STANDARD.
Bei grossen Teilen der amerikanischen Religionsgemeinschaften ist die europäisch geprägte Aufklärung bis zum heutigen Tag nicht angekommen. Eine mehr als erschreckende Parallele zum Islam.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.11.2020 - Tag der Senioren-SUVs
Neue SUVs für jedes Budget: Das sind die besten Autos für Senioren
Die Auswahl an Neuwagen war noch nie so gross wie heute – klein oder gross, praktisch oder stylisch, günstig oder teuer. Welche Autos besonders für reifere Semester am attraktivsten sind, haben wir in einem grossen Test zusammengefasst.
Die Seniorinnen und Senioren von heute kosten ihren Lebensabend in vollen Zügen aus, sind unternehmungslustiger denn je. Das ist auch beim Thema Autokauf zu spüren. Gerade ältere Leute entscheiden sich oft für die boomenden SUVs.
Wie das kommt? Ein SUV deckt ihre Bedürfnisse genau ab: Er bietet einen angenehmen Ein- und Ausstieg, eine höhere Sitzposition und damit bessere Rundumsicht als einer Limousine. Der deutsche Automobil-Club ADAC hat kürzlich untersucht, welche Fahrzeuge sich für Seniorinnen und Senioren am besten eignen und dabei Kriterien wie Länge des Autos (max. 4,50 m), Anzahl Sitzplätze (vier bis fünf) oder Ladekantenhöhe (max. 77 cm) miteinbezogen und eine Übersicht nach verschiedenen Preisklassen erstellt. Schreibt Blick.
Toll! SUVs für Senioren*innen. Wer die täglichen Polizeinachrichten mit den schockierenden Horrornachrichten über Verkehrsunfälle* unter Beteiligung von Senioren*innen liest, vermisst allerdings ein ganz spezielles Zusatz-Feature: Eine automatische Abschaltung des Fahrzeugs, basierend auf künstlicher Intelligenz (KI). Es müsste ja möglich sein, mit Hilfe von KI-Parametern die Fahrtüchtigkeit dieser von der Automobilbranche heftig umworbenen Klientel festzustellen. Ärztliche Untersuchungen können dies scheinbar nicht. Oder wollen es häufig bewusst nicht können, weil sich Arzt und Patient seit Jahrzehnten kennen.
* In der Schweiz sind laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) immer mehr ältere Menschen von Verkehrsunfällen betroffen. Politik- und Verwaltung müssten mehr tun, um die Schweizer Strassen noch sicherer werden zu lassen, fordert die Beratungsstelle. Die BFU stützt sich bei den Angaben auf ihren Sicherheitsbarometer 2019. Demnach ist die Anzahl schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle auf Schweizer Strassen in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. Davon hätten alle Altersgruppe bis 64 Jahre profitiert. Bei Seniorinnen und Senioren hingegen bleibe die Zahl der schweren Verkehrsunfälle schon länger konstant. Im letzten Jahr sei sie sogar noch angestiegen. Andere europäische Länder stünden diesbezüglich besser da. Quelle BFU
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.11.2020 - Tag der Defätisten
Infektiologe Christoph Fux: «Die Positivitätsrate im Aargau ist viel zu hoch»
Im Schweizer Durchschnitt ist der Anteil positiver Tests rückläufig. Nicht so im Aargau, wo letzte Woche jeder fünfte Test positiv war. Das beunruhigt den Infektiologen Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau.
Testen, testen, testen! Der Appell ist klar. Aber er dringt offenbar nicht zur Bevölkerung durch, wie die Statistik zeigt. Im Kanton Aargau wurden letzte Woche 11'197 Coronatests durchgeführt. Das sind leicht weniger als in der Vorwoche und mehr als 2000 weniger als Anfang November, als sich mehr als 13'000 Aargauerinnen und Aargauer testen liessen.
Gleichzeitig hat der Anteil positiver Tests seit Anfang Oktober praktisch stetig zugenommen. Die Positivitätsrate lag letzte Woche bei 20,4 Prozent; 1,3 Prozent höher als in der Vorwoche. Jeder fünfte Test war positiv.
Schweizweit reduzierte sich der Anteil positiver Tests im Vergleich zur Vorwoche von 24,1 auf 20,8 Prozent. In besonders stark betroffenen Kantonen, zum Beispiel Freiburg, sank der Anteil positiver Tests von 37,8 Prozent auf 28,3 Prozent.
Dass die Positivitätsrate im Aargau steigt und sich gleichzeitig weniger Leute testen lassen, beunruhigt Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Aarau (KSA): «Die Kurven bewegen sich in die falsche Richtung. Die Positivitätsrate ist viel zu hoch.»
Laut Weltgesundheitsorganisation gilt eine Pandemie als kontrollierbar, wenn der Anteil positiver Tests bei 5 Prozent liegt. Ist die Positivitätsrate höher, ist das ein Zeichen dafür, dass zu wenig getestet wird. Die Folge: Viele Ansteckungen werden nicht erkannt und das Virus verbreitet sich immer weiter. Fux sagt: «Unsere Freiheit kriegen wir nur zurück, wenn wir es schaffen, die Übertragungsketten schnell zu unterbinden. Testen ist der Schlüssel dazu.»
Warum sich Leute nicht testen lassen, darüber kann der Infektiologe nur mutmassen. «Vielleicht wollen sie nicht schuld sein, dass Kolleginnen wegen ihnen in Quarantäne müssen.» Vielleicht seien sie auch einfach Corona-müde oder hielten es nicht für notwendig, wegen Halsweh oder Husten einen Test zu machen. «Dabei sind es oft Menschen mit leichten Symptomen, die das Virus weiterverbreiten», sagt Fux.
Ein bisschen Husten kann dieses Jahr auch Corona sein
Während in anderen Jahren Halsweh oder Husten einfach als Erkältung abgetan werden konnten, kann es dieses Jahr eben auch Corona sein. «Das müssen wir mit einem Test ausschliessen.»
Aktuell sieht Fux zwei Möglichkeiten: Entweder bleibe alles, wie es ist. «Damit akzeptieren wir viele zusätzliche Todesfälle – aber auch, dass nicht- dringliche Operationen warten müssen, weil die Spitäler nicht alle Eingriffe sofort durchführen können.»
Die Alternative sei nicht zwingend ein Lockdown. Es sei nicht so, dass die Schutzmassnahmen in Restaurants, Kinos oder Geschäften versagten, sagt Fux. «Das Problem ist, dass die Schutzmassnahmen im privaten Bereich zu wenig eingehalten werden.»
Er würde sich deshalb wünschen, dass jede und jeder selbstverantwortlich versucht, sich vorbildlich zu verhalten. «Im Gegenzug könnten dafür Kinos und Restaurants offen bleiben.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Es ist zwar absolut richtig, dass niemand, meine Durchraucht eingeschlossen, mit vorgehaltener Pistole gezwungen wird, den oder jenen Artikel zu lesen. Dennoch ist es (aus meiner subjektiven, rein persönlichen Sicht) ärgerlich, wie jeden Tag auf den Frontseiten unserer Medien die neuesten News im «Live-Ticker-Takt» als «aller neueste» Sau durchs Dorf getrieben werden. Frei nach dem Motto: «Der frühe Vogel frisst den Wurm.»
Alle kommen sie zu Wort, egal ob sie etwas zu sagen haben oder nicht. Besonders gefragt sind derzeit in Zeiten der Corona-Pandemie Virologen, Infektiologen, Politiker*innen jeglicher Couleur aus dem zweiten Glied, Esoteriker, Alu-Hüte, abgehalfterte Comedians und sonstige Leuchttürme des täglichen Alarmismus. So drohte der Rockstar unter den Virologen, Christian Drosten, vor wenigen Tagen bereits mit einer neuen Pandemie (Mers), die uns drohen «könnte». Es könnte ebenso gut in China ein Sack Reis umfallen. Oder Freddy Quinn könnte sterben. Er ist immerhin etwas über 90 Jahre alt.
Es mag ja sein, dass Drosten, Fux & Co. mit ihren häufig im Konjunktiv geäusserten Befürchtungen und Weltuntergangs-Szenarien absolut richtig liegen. Nur können wir von der Abteilung «Fussvolk» ohne entsprechende Fachausbildung dies nicht beurteilen. Aber wir bilden uns eine Meinung.
Und genau diese Meinungen tragen zur Verunsicherung vieler Menschen bei. Aus Meinungen werden schnell Tatsachen, die uns an den Massnahmen der Verantwortlichen Politiker*innen zweifeln lassen und treiben inzwischen in Deutschland «Querdenker» zu Tausenden auf die Strasse.
Dabei ist es eine alte Tatsache, dass sich die Völker in Krisenzeiten um ihre Regierung scharen. Das ist völlig normal. Denn irgendwem muss man letztlich ja noch vertrauen können.
Auch wenn Fehler passiert sind, haben die Verantwortlichen Politiker*innen in der Schweiz, von der Bundes- bis zur Kommunalebene, so ziemlich das Meiste richtig gemacht, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin jedenfalls zufrieden, dass unser Land keinen Brachial-Lockdown erleben muss wie Deutschland oder Österreich. Das verdanken wir dem Entscheid unserer Regierung. Die damit aber auch einen Teil der Verantwortung, wie beispielsweise klar differenzierte Maskenpflicht an uns Bürgerinnen und Bürger delegiert hat.
«Wir leben in einer Zeit, die zu viel liest, um weise, und zu viel denkt, um schön zu sein», sagte Oscar Wilde. Schliessen wir uns ihm an und empfehlen wir all den defätistischen Horrorpredigern der Virologen- und Infektiologenzunft ihr «Herrschaftswissen» schlicht und einfach dort zu verbreiten, wo es möglicherweise gebraucht wird und wo die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. Beim Fux-Artikel wäre das die Aargauer Kantonsregierung. Und nicht die Aargauer Zeitung.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
26.11.2020 - Tag der «Konvertit(t)en»
Das Profil der Täterin von Lugano: Zwischen Irrsinn und Islamismus
Die Attacke in Lugano wurde von einer Frau mit zwei Eigenschaften begangen: psychisch gestört, dschihadistisch geprägt – was war stärker?
Sie ist 28 Jahre alt, Schweizerin, psychisch krank, und sie hat eine brisante Vorgeschichte. 2017 lernte sie über soziale Medien einen IS-Kämpfer kennen, in den sie sich verliebte. Deshalb wollte sie zu ihm nach Syrien reisen.
Das ist ein typisches Muster in der Dschihadisten-Szene. Männer reisen in den Krieg. Frauen reisen den Kriegern nach. Doch an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien wurde die Frau von den türkischen Behörden gestoppt. Mit dem Flugzeug reiste sie zurück in die Schweiz, wo sie von der Polizei empfangen wurde.
Die Bundespolizei Fedpol erstellte einen Ermittlungsbericht, den sie im März 2018 der Bundesanwaltschaft zustellte. Diese eröffnete jedoch kein Strafverfahren, weil sie keinen hinreichenden Tatverdacht erkannte. Die Bundesanwaltschaft teilt mit: «Die Ermittlungen konnten keine strafbaren Handlungen aufzeigen.»
Reisen in den Dschihad, in den sogenannten Heiligen Krieg, sind in der Schweiz aber verboten. Weshalb genügt diese Ausgangslage nicht für ein Strafverfahren? Dazu schweigt die Bundesanwaltschaft.
Die Bundesanwaltschaft vermutet Terror und führt ein Verfahren
Die Frau wurde damals in eine Psychiatrie eingewiesen. Seither fiel sie der Bundespolizei nicht mehr auf. Dann kam der Dienstagnachmittag. In der Manor-Filiale von Lugano packte die Frau ein grosses Messer und ging auf zwei Frauen los. Eine verletzte sie schwer an der Kehle. Dabei soll sie gerufen haben, sie gehöre zur Terrororganisation IS. Zum Glück griff ein Paar ein und hielt sie fest, bis die Polizei kam.
Die Bundesanwaltschaft hat die Frau am Mittwoch zum ersten Mal einvernommen. Sie geht von einem «mutmasslich terroristisch motivierten Angriff» aus und hat Untersuchungshaft beantragt. Nun führt sie ein Strafverfahren, und zwar wegen vorsätzlicher Tötung, schwerer Körperverletzung und Verstoss gegen das IS-Verbot.
Das Profil der Frau weist typische Elemente von Dschihadisten-Biografien auf. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat Angaben zu 130 Dschihadisten untersucht, die vom Nachrichtendienst des Bundes beobachtet wurden. Mit dem Alter von 28 Jahren liegt die Frau exakt im Durchschnitt. Auch psychische Probleme sind in diesem Milieu verbreitet: von ADHS bis Schizophrenie.
Nicht ins Muster passt einzig ihr Geschlecht. In der Schweiz ist nur jede zehnte Person des Dschihadmonitorings eine Frau. In anderen europäischen Ländern ist der Anteil radikalisierter Frauen grösser und beträgt bis zu dreissig Prozent.
Umstritten ist, welcher Einfluss die psychische Krankheit hat. Die Autoren der Zürcher Studie gehen davon aus, dass psychische Probleme selten die Ursache von Radikalisierung sind, sondern eher eine Folge der sozialen Situation von Extremisten darstellen.
Die Mutter verteidigt ihre Tochter und hat eine Erklärung
Eine ganz andere Erklärung hat die Familie der 28-jährigen Tessinerin. Sie lebt in Vezia bei Lugano und wird nun von Reportern belagert. Der «Corriere del Ticino» zitiert die Mutter:
«Meine Tochter war immer krank: Sie nimmt Medikamente, und wir sind überzeugt, dass das, was am Dienstag passiert ist, darauf zurückzuführen ist, dass sie die Therapie abgebrochen hat.»
Nach der Episode 2017 in Syrien habe ihre Tochter alle Beziehungen zu diesen Leuten abgebrochen. Deshalb können sich die Eltern nicht vorstellen, dass ihre Tochter eine Terroristin sein solle. Sie kritisieren, dass die Strafverfolgungsbehörden diese Annahme voreilig getroffen hätten.
Dabei besteht allerdings ein Missverständnis. Islamistische Terrorattacken werden heutzutage nicht mehr von Kommandostrukturen gesteuert, weil diese weitgehend zerschlagen worden sind. Der Terror existiert weiter, weil er sich verselbstständigt hat. Die IS-Propaganda spricht psychisch gestörte Einzeltäter an, die in ihrem Irrsinn zur Tat schreiten. Eine gefährliche Mischung, die kaum berechenbar ist. Zudem kann die Ursache für eine solche Wahnsinnstat dann oft nicht mehr eindeutig bestimmt werden.
Zwischen Irrsinn und Islamismus: Ein fliessender Übergang, sofern es überhaupt einen Unterschied zwischen Irrsinn und Islamismus gibt.
Auffallend ist, dass vor allem weibliche Konvertitinnen nach dem - meistens salafistischen – Brainwashing einen exzessiven Extremismus entfalten. Siehe Nora Illi.
Vielleicht gehört der extreme Irrsinn zur Rache von Frauen, die nicht selten am heimischen Heiratsmarkt durchfallen und sich dann notgedrungen und hurtigen Schenkels in die Arme eines Islamisten begeben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.11.2020 - Tag des Dschihadismus
Nicht nur Islamisten: Terror-Anschläge in der Schweiz
Beim Blutbad in einer Manor-Filiale in Lugano TI vom Dienstag wird ein terroristischer Hintergrund nicht ausgeschlossen. Die Täterin, eine 28-jährige Schweizerin, war polizeibekannt. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) schrieb am Dienstagabend in einem Tweet, dass die Frau bereits aus einer polizeilichen Untersuchung aus dem Jahr 2017 in Bezug auf dschihadistischen Terrorismus bekannt ist. Die Tessiner Polizei hat die Ermittlungen deshalb den Bundesbehörden übergeben.
In der neutralen Schweiz sind dschihadistische Terror-Attacken eine Seltenheit. Aber hierzulande gibt es Hunderte von Einwohnern, die als Bedrohung eingestuft werden und Gefährder, die in Kriegsgebiete gereist sind. Und auch auf Schweizer Boden kam es in der Vergangenheit immer wieder zu einzelnen Vorfällen.
Im September hat ein schweizerisch-türkischer Doppelbürger (26) Rodrigo G.* (†29) in einem Kebab-Laden in Morges VD ermordet. Kaltblütig wurde der Portugiese beim Abendessen mit seiner Familie erstochen. Er verlor so viel Blut, dass er noch im Imbiss verstarb.
Morges-Täter wollte sich an der Schweiz rächen
Die Bundesanwaltschaft ermittelt im Fall von Morges wegen Terror-Verdachts. Der Täter legte laut dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS Mitte September ein Geständnis ab. Als Beweggrund für seine Tat soll er «Rache gegenüber dem Staat Schweiz» geltend gemacht haben, hiess es. Die Bundesanwaltschaft wollte den Bericht bislang weder bestätigen noch dementieren.
Klar ist: Der Mann war seit 2017 im Visier der Bundesbehörden. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) beobachtete ihn unter anderem wegen Konsums und Verbreitung dschihadistischer Propaganda. Im April 2019 wurde er im Kanton Waadt wegen des Verdachts auf Brandstiftung an einer Tankstelle festgenommen. Die für Terrorermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft übernahm das Verfahren von der Waadtländer Staatsanwalt.
Islamismus und die Stadt Winterthur
Die Stadt Winterthur ZH sorgte in den vergangenen Jahren schweizweit für Schlagzeilen. Immer wieder im Fokus: die mittlerweile geschlossene An'Nur-Moschee. Dort hat ein Imam 2016 vor rund 60 Personen zu Gewalttaten aufgerufen. Der Mann wurde 2019 vom Bundesgericht letztinstanzlich zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Der Imam soll auch versucht haben, mehrere Gläubige zu radikalisieren.
Im September 2020 wurde Sandro V.* (34), der «Emir von Winterthur», vom Bundesstrafgericht in Bellinzona TI zu 50 Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte mit dem Projekt «Lies!» und in der Kampfsportschule MMA Sunna junge Leute angeworben und für einen Einsatz in Syrien rekrutiert. Zuvor war er von Mitte November bis am 9. Dezember 2013 selbst in Syrien.
Attentat in Wien – Spuren führen in die Schweiz
Die Stadt Winterthur geriet auch Anfang November in die weltweiten Schlagzeilen. Nach dem Anschlag im österreichischen Wien mit vier Toten und 23 Verletzten kam es zu einer Razzia im Grüzefeld-Quartier, wo Fahnder der Spezialeinheit EG Diamant zwei Salafisten, 18- und 24-jährig, verhafteten. Beide sind involviert in laufende Islamismusverfahren.
Haben sie von der Tat gewusst? Oder waren sie gar daran beteiligt? Konkrete Anhaltspunkte dafür gibt es bis jetzt nicht. Sicher hingegen ist: Die zwei haben den IS-Terroristen von Wien getroffen. Das bestätigte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (56). Die beiden seien «Kollegen» des Attentäters gewesen.
SonntagsBlick-Recherchen vor zwei Wochen zeigten: Die verhafteten Winterthurer reisten nur wenige Monate vor dem Anschlag nach Wien. Zwischen dem 16. und 20. Juli trafen sie sich dort gemäss Informationen aus Sicherheitskreisen mit mehr als einem Dutzend Islamisten aus Deutschland und Österreich – darunter Kujtim F., dem Attentäter von Wien.
Das war der blutigste Terror-Akt in der Schweiz
Seit 1902 haben sich laut «Berner Zeitung» mindestens 37 Organisationen zu Terroranschlägen in der neutralen Schweiz bekannt. Die Angriffe haben mindestens 60 Tote und 140 Verletzte gefordert, die Täter miteingerechnet.
Der blutigste Terror-Akt war kein dschihadistisch motivierter: Ein Paketbombenanschlag der «Volksfront zur Befreiung Palästinas – Generalkommando» (PFLP-GC) auf eine Swissair-Maschine am 21. Februar 1970 über dem aargauischen Würenlingen. 47 Menschen kamen damals ums Leben. Schreibt Blick.
* Namen der Redaktion bekannt
Um einen nicht dschihadistischen Terroranschlag in der Schweiz aufzuspüren, muss man also bis ins Jahr 1970 zurückblättern?
Festgehalten sei, dass sich auch die Terror-Kommandos der «Volksfront zur Befreiung Palästinas» auf das heilige Buch der Muslime, genannt Koran, berufen durften. Sure 9. Absatz 5.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.11.2020 - Tag des Aktionismus
Wie die Sicherungshaft für Terroristen gelingen könnte
Norbert Nedopil gilt als Doyen der forensischen Psychiatrie. Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt er die Regierungspläne für machbar – mit Einschränkungen.
Wer sich mit der Frage der forensischen Psychiatrie beschäftigt, bekommt von jedem Gesprächspartner einen Tipp: Man solle doch mit Norbert Nedopil reden. Denn niemand kenne sich im deutschsprachigen Raum so gut mit diesem Themengebiet aus wie Nedopil, der von 1992 bis 2016 die Abteilung für Forensische Psychiatrie an Ludwig-Maximilians-Universität München geleitet hat. Nedopil verfasst Gutachten über Neonazi Beate Zschäpe von der Terrorgruppe NSU, über Pädokriminelle und Serienmörder.
DER STANDARD erreichte den mittlerweile emeritierten Professor am Telefon, um die heikelste Frage nach dem Wiener Terroranschlag zu stellen: Kann man gefährliche Islamisten einsperren?
Wenn der "Gefährder" unbescholten sei, sei das mit seinem Verständnis von Grundrechten prinzipiell nicht vereinbar, antwortet Nedopil. Anders sei das, wenn dieser bereits verurteilt wurde und bei diesem Spruch schon eine mögliche Unterbringung nach dem Strafvollzug ausgesprochen wurde, ergänzt der Psychiater. Das von der türkis-grünen Regierung vorgeschlagene Modell hält Nedopil also grundsätzlich für akzeptabel.
"Behandlung" ist essenziell
Allerdings gibt es Einschränkungen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und das deutsche Verfassungsgericht haben präzise Einschränkungen für eine präventive Unterbringung ausgesprochen. Diese sei nur möglich, wenn der Täter dort behandelt wird. Dieser Punkt ist wichtig, da die deutsche Sicherungsverwahrung beziehungsweise der österreichische Maßnahmenvollzug bislang vor allem geistig abnorme Rechtsbrecher betreffen. Es gibt zwar auch einen Paragrafen für mehrfach verurteilte Rückfallstäter, der ist in Österreich de facto aber totes Recht.
Sind Jihadisten geistig abnorm? Muss man nicht psychisch krank sein, um vier zufällig ausgewählte, unschuldige Menschen in der Wiener Innenstadt zu töten? Der entscheidende Faktor ist für Nedopil die Frage, ob der Täter sein Weltbild anderen vermitteln kann.
Der Fanatiker teile sein Denksystem mit vielen anderen Menschen, die ihn beispielsweise als Märtyrer betrachten. Eine Geisteskrankheit sei hingegen nicht an andere vermittelbar. Man nehme beispielsweise den Briefbombenterroristen Franz Fuchs, den Nedopil begutachtet hat: Dieser wäre wohl in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gekommen, wenn er sich nicht in Haft selbst ermordet hätte. Fuchs sei schon abnorm gewesen, bevor er sich in die fiktive Bajuwarische Befreiungsarmee hineinfantasiert habe, so Nedopil.
Allerdings könne auch die Deradikalisierung als eine Form der Behandlung gelten, sagt der Psychiater. Die Bundesregierung plant ohnehin, Jihadisten nicht als geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen, sondern einen eigenen Paragrafen für verurteilte und noch radikalisierte Terroristen zu schaffen, über die die Unterbringung dann gerichtlich verhängt wird.
Aber wie prüft man während der Unterbringung, ob der Islamist noch gefährlich ist? Immerhin betrachten Instrumente zur Messung der Radikalisierung großteils Faktoren, die im Maßnahmenvollzug wegfallen: etwa den Besuch von radikalen Moscheen, den Freundeskreis oder stabile Wohn- und Arbeitsverhältnisse. "Bei Sexualstraftätern kann man in Unterbringung ja auch vieles nicht prüfen", erklärt Nedopil. Entscheidend sei, dass Kriminalität "ein Bedürfnis der Betroffenen erfüllt". Wenn jemand auf Kränkungen mit Gewalt reagieren muss, dann sei das auch in Haft so – mit beschränkten Möglichkeiten, also zugeknallten Türen oder Verbalaggressionen statt Mord und Totschlag. Diesem könne man dann beibringen, anders zu reagieren – und engmaschig prüfen, ob das gelinge.
Verantwortung tragen
Die heimische Regierung plant, Entscheidungen über die Freilassung von Tätern im Maßnahmenvollzug auf eine Fallkonferenz zu übertragen. Während der berühmte Gutachter Reinhard Haller diesen Vorschlag lobt, sieht Nedopil – der schon mit Haller gemeinsam gearbeitet hat – das kritisch: "Es muss festgelegt werden, wer die Verantwortung trägt."
Aber sorge das nicht dafür, dass Gutachter konservativ sind, um das Risiko einer Fehleinschätzung zu minimieren? "Wenn Einschätzungen zum Schutz des Gutachters erfolgen, dann ist ohnehin etwas falsch", antwortet Nedopil. Jedem müsse klar sein, dass die Unterbringung im Maßnahmenvollzug ein "starker Grundrechtseingriff" sei. Aber: "Ich kann mir vorstellen, dass man mit religiösen, psychologischen, psychosozialen Mitteln eingreifen kann", sagt Nedopil – auch bei fanatisierten Islamisten.
Derzeit erarbeitet das Justizministerium eine Gesetzesnovelle, um die Unterbringung verurteilter Terroristen juristisch zu ermöglichen. Das dürfte neben einem strafrechtlichen Verbot des "politischen Islam" der legistisch schwierigste Punkt des Antiterrorpakets werden. Die Idee einer "Präventivhaft" geistert seit Jahren durch die ÖVP, angedacht wurde sie einst auch vom blauen Innenminister Herbert Kickl. Sie hätte aber auch auf unbescholtene Asylwerber abzielen sollen – verfassungsrechtlich wäre das kaum machbar gewesen, und wenn, dann nur für kurze Zeit. Die Grünen blockierten diesen Vorschlag. Schreibt DER STANDARD.
Mission Impossible
Wie der Volksmund zu sagen pflegt: Und täglich wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Die NZZ – und nicht täglicher Aktionismus – hilft weiter: https://www.youtube.com/watch?v=DRZCd3VYw0k
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.11.2020 - Tag des Zölibats
Ehemaliger Vikar der Luganeser Diözese verhaftet: Armando C. (80) hielt Frau 12 Jahre in Wohnung versteckt
Don Armando C.* (80) wurde am Freitag von vier Polizeibeamten festgenommen. Dem emeritierten Erzpriester werden nach ersten Ermittlungen Freiheitsberaubung, Nötigung, pflichtwidriges Unterlassen und leichte Körperverletzung vorgeworfen.
Die Messe beginnt. Hinter den dicken Mauern ertönt ferner Gesang. In der kurzen Gasse, die die Kirche San Lorenzo mit dem Sitz der Kurie verbindet, ist es ansonsten still. Jeder huscht über den kleinen Platz. Den Blick aufs Kopfsteinpflaster geheftet. Leisen, aber schnellen Schrittes. Vorbei an jenem Haus, in dem verschiedene emeritierte Priester ihren Lebensabend verbringen. Einer von ihnen hütete ein dunkles Geheimnis.
Über das, was sich über zwölf Jahre im Borghetto Nr. 2 ereignete, will kaum jemand reden. Man habe nichts gewusst, alles erst aus den Medien erfahren. Am Freitag führten Beamte in Zivil den ehemaligen Vikar der Luganeser Diözese in Handschellen ab. Die Fassade eines gottesfürchtigen Lebens beginnt zu bröckeln. In seiner Wohnung, die ihm die Kurie zur Verfügung stellte, soll Don Armando C.* (80) eine Frau (48) versteckt haben, berichtet die Tessiner Sonntagszeitung «Il Caffè». Die Finnin habe keine gültigen Aufenthaltspapiere und wurde, so der Verdacht, vom Erzpriester gegen ihren Willen festgehalten.
Diözese will mit Behörden zusammenarbeiten
Die Tessiner Staatsanwaltschaft jedenfalls lässt den ehemaligen Professor an der theologischen Fakultät in Lugano TI wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, pflichtwidriger Unterlassung und leichter Körperverletzung festnehmen. In einer knappen Pressemitteilung bestätigt die Diözese die Festnahme, betont, es seien keine Minderjährigen verwickelt, und verspricht, mit den ermittelnden Behörden eng zusammenzuarbeiten.
Noch sind die Einzelheiten bruchstückhaft. In der Wohnung soll ein unbeschreibliches Chaos geherrscht haben. Die Frau sei derartig verdreckt und verwahrlost gewesen, dass es zu einer Anzeige wegen Körperverletzung kam. Überall hätten Postpakete gelegen, viele von Zalando. Die Anwesenheit der Frau im Hause des emeritierten Priesters ist kaum aufgefallen. Und wenn jemand die Finnin einmal erblickte, dann erklärte Don Armando, sie sei eine Cousine und zu Besuch.
Kennengelernt hat Don Armando die Finnin während eines Online-Unterrichts im Internet. Er habe sie, so scheint es, zunächst als Hausdame nach Lugano geholt. Wie eng das Verhältnis schliesslich wurde und warum es derart ausartete, muss die Staatsanwaltschaft nun klären.
«Don Armando ist jeden Tag um sieben Uhr aus dem Haus gegangen. Er ist zur Messe gegangen, dann mit seinem VW ins Büro der Fakultät», erzählt der Küster gegenüber BLICK. Aber eine Frau mit Gewalt festzuhalten? «Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Don Armando ist doch ein so zierlicher, kleiner älterer Herr.» Schreibt Blick.
Ohne Zölibat wäre das nicht passiert.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.11.2020 - Tag der heissen Sommer
Ueli Maurer verteidigt Corona-Strategie – trotz vielen Toten: «Grosser Teil sind über 80-Jährige»
Bundesrat Ueli Maurer (69) bekräftigt in einem SRF-Interview, dass die Schweizer Corona-Strategie die Richtige sei – obwohl viele Menschen sterben. Schliesslich seien Ältere auch im heissen Sommer einem Risiko ausgesetzt.
SVP-Bundesrat Ueli Maurer (69) verteidigt die Corona-Strategie des Bundes in einem Interview mit dem Radiosender SRF. «Wir müssen mit der Krankheit leben», sagt er. Selbst wenn allein in den letzten 14 Tagen 1000 Menschen an dem Virus gestorben sind.
«Der ganz grosse Teil sind über 80-Jährige», verteidigt Maurer die im Vergleich zum Ausland eher lockere Strategie der Schwiez. «Ich relativiere die Todeszahlen nicht, aber wenn man schaut, sind, glaube ich, unter den unter-50-Jährigen 31 gestorben.»
Güterabwägung
Zuvor sind immer wieder Stimmen, dass die Bevölkerung einem unnötigen Risiko ausgesetzt ist. «Wir sind bewusst dieses Risiko eingegangen, weil wir eine Güterabwägung gemacht haben», erklärt Maurer. Die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben seien neben der Gesundheit auch wichtig.
Der Finanzminister lässt in dem Interview offen, ob weniger Menschen gestorben wären, wenn man strengere Regeln in der Schweiz durchgesetzt hätte. «Vielleicht – das wissen wir nicht», sagt er.
Nicht die erste umstrittene Aussage
Trotzdem fühlt sich Maurer mit der derzeitigen Situation wohl. «Der Weg, den wir eingeschlagen haben, stimmt für mich.» Man dürfe nicht vergessen, dass ältere Menschen auch im Sommer, wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, wegen ihres schwachen Immunsystems sterben.
Schon in der Vergangenheit provozierte der Minister mit Aussagen zur Corona-Krise. Maurer sagte, viele Menschen würden sich nicht mehr getrauen, in Sachen Corona ihre Meinung zu vertreten. Schreibt Blick.
«Schliesslich seien Ältere auch im heissen Sommer einem Risiko ausgesetzt.»
Sagt Ueli Maurer, der mit seinen 70 Jahren (geboren am 1. Dezember 1950) auch nicht mehr zu den Jüngsten zählt... Ist solch eine Ansage – auch wenn sie faktisch zwar absolut richtig ist – von einem Bundesrat nun lustig oder eher traurig? Fehlt es dem Mann an Empathie? Oder hat er keinen Kommunikationsberater?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.11.2020 - Tag der Wendehälse
Der Präsident der Aargauer FDP Lukas Pfisterer schiesst scharf – und zwar gegen die eigene Parteichefin Petra Gössi
Die kantonale Sektion wirft der FDP-Präsidentin vor, dass die Positionen der Partei zu wenig bekannt seien. Die Partei sei nicht mehr proaktiv und innovativ.
An der Konferenz der kantonalen FDP-Parteipräsidenten vom vergangenen 30. Oktober gab ein Brief der Aargauer Sektion zu reden. Inhalt: Um die nationale FDP sei es zu ruhig geworden. Es gelinge ihr zu wenig, in den Medien mit klaren Positionsbezügen auf sich aufmerksam zu machen.
FDP ist keine proaktive und innovative Kraft mehr – schreibt Lukas Pfisterer, Präsident der FDP Aargau
Zwölf Tage zuvor hatte die Aargauer FDP in den kantonalen Wahlen 1,3 Wählerprozente verloren. Das war kein Debakel– aber die Serie von Rückschlägen seit den nationalen Wahlen vom Oktober 2019 setzte sich für die Freisinnigen damit fort. In seinem Brief an Parteipräsidentin Petra Gössi schreibt Lukas Pfisterer, der Präsident der Aargauer FDP, zunächst, dass er die kantonalen Wahlen selbstkritisch analysieren und «die notwendigen Korrekturmassnahmen erarbeiten werde».
Dann folgen ziemlich happige Vorwürfe an Petra Gössi und ihren Parteivorstand: Die FDP werde auf nationaler Ebene seit längerem nicht mehr als «proaktive, innovative und kommunikationsstarke politische Kraft» wahrgenommen. Den anderen Parteien gelinge es immer wieder, sich medial positiv zu inszenieren, während «wir unsere FDP auf nationaler Ebene nicht wahrnehmen». Dabei wäre ein aktives Auftreten der Wirtschaftspartei FDP gerade in dieser Krisenzeit wichtig.
Partei startet Konsultation: Wie gross ist das Malaise?
Lukas Pfisterer ruft dazu auf, dass das «Steuer nun herumgerissen werden» müsse. Er fordert die «rasche Erarbeitung von klaren, verständlichen und gut kommunizierbaren Botschaften in zentralen Dossiers wie den bilateralen Beziehungen zur Europäischen Union, dem wirtschaftspolitischen Umgang mit Covid-19 und der Umweltpolitik im Umfeld des CO2-Gesetzes». Es seien Schritte aufzuzeigen, um diese Themen verbindlich anzugehen: «Wer macht was bis wann?» Dazu gehöre auch eine starke Sichtbarkeit der nationalen Parteileitung – intern wie extern.
Wie ist die Kapuzinerpredigt aus dem Aargau von den anderen Kantonalpräsidenten aufgenommen worden? Einige Mandatsträger wollen nichts zum Thema sagen. Andere wünschen, nicht namentlich erwähnt zu werden. «Ja, man darf den Freisinn mehr spüren», pflichtet der Präsident einer grossen Sektion Pfisterer bei.
Gössi sagt, die FDP müsse «weiter arbeiten und kämpfen»
Petra Gössi wird von den kantonalen FDP-Präsidenten bald erfahren, ob sie die Kritik aus dem Aargau teilen. Auf einen Vorschlag der St.Galler Kantonalpartei hin wurde eine interne Konsultation gestartet. «Noch sind nicht alle Stellungnahmen aus den Kantonen bei uns eingetroffen», erklärt FDP-Mediensprecher Marco Wölfi. Die Antworten würden ausgewertet, und dann führe man an der kommenden Konferenz der Parteipräsidenten eine Diskussion darüber.
Mehrere freisinnige Politiker erwähnen, dass der Parteizentrale zurzeit personelle Veränderungen zu schaffen machten: Sowohl Generalsekretär Samuel Lanz als auch Kommunikationschef Martin Stucki haben ihre Funktionen in den vergangenen Wochen abgegeben. Generalsekretär Lanz war seit 2014 im Amt und galt als Organisationstalent. Seine Nachfolgerin, Fanny Noghero aus Neuenburg, muss nun in ihre neue Aufgabe hineinwachsen.
In einem Interview mit dieser Zeitung nahm Gössi vor zwei Wochen Stellung zur Serie von Wahlrückschlägen der FDP. «Wir müssen arbeiten und kämpfen», sagte sie. Die Partei sei in der Kommunikation oft zu differenziert. «Da müssen wir noch pointierter und klarer auftreten.» Gössi verkündete damit öffentlich eine ähnliche Botschaft, wie Lukas Pfisterer dies intern bereits getan hatte: Die Partei muss ihre Positionen offensiver kommunizieren.
An der Ausrichtung der FDP will Gössi nichts ändern
Inhaltliche Korrekturen am Kurs der Partei kündigte Gössi keine an. Sie verteidigte die ökologischere Ausrichtung, die sie den Freisinnigen acht Monate vor den nationalen Wahlen von 2019 verpasst hatte. Gössi wies darauf hin, dass eine Mitgliederbefragung den sogenannten Öko-Schwenk gestützt habe. Und die Delegierten hätten sich vor kurzem klar für das neue CO2-Gesetz ausgesprochen. Es sieht Lenkungsabgaben vor.
Petra Gössi ist überzeugt, dass die FDP noch mehr Wähler an die Grünliberalen verloren hätte, wenn die Partei keine Kurskorrektur vorgenommen hätte. Im Wahlbarometer der SRG, das vor einer Woche publiziert worden ist, liegt die FDP bei 15,1 Prozent – exakt gleich wie in den Wahlen von 2019. Der Abwärtstrend scheint vorerst gebremst. Gemäss der Umfrage verliert hingegen die SVP weiter an Unterstützung.
Am Freitag präsentierte die FDP die Ergebnisse einer weiteren Befragung ihrer Mitglieder. Sie ergab, dass die Freisinnigen einverstanden sind mit der sogenannten Enkelstrategie, die von Gössi angeregt worden ist. Im Vordergrund stehen Reformen der Altersvorsorge sowie die Sicherung der Lebensgrundlagen und der Arbeitsplätze. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Das ist die Quittung für die unglaubwürdige Wendehals-Politik der FDP bei den National- und Ständeratswahlen 2019. Wenn zum Beispiel ein intellektueller Tiefflieger wie der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller seine Wiederwahl in den Ständerat nebst albernen Interviews über seine Sexualität und mit opportunistischen Positionen zur Klimapolitik gewinnt, die mehr oder weniger aus dem Parteiprogramm der Grünen abgeschrieben wurden, ist das für eine liberale Wirtschaftspartei bedenklich.
Wasserfallen zog sich ja nicht ohne Grund in den Schmollwinkel zurück.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
20.11.2020 - Tag der Infantilos
Constantins wichtigstes Spiel: Sion-Präsidenten weibelt in Bern für Hilfsgelder
Christian Constantin weibelt im Parlament für das Sporthilfspaket von Bundesrätin Viola Amherd. Der Sion-Boss kann dabei auf die Walliser Connection zählen.
Walliser sind im Fussball überdurchschnittlich präsent – zumindest abseits des Rasens. Die Liste der einflussreichen Köpfe geht vom ehemaligen Fifa-Chef, Sepp Blatter (84), über seinen Nachfolger, Gianni Infantino (50), bis hin zum Medienchef des Schweizerischen Fussballverbands, Adrian Arnold (47).
Nun scheint die Walliser Connection auch in der Politik zu spielen. Am Mittwoch hat die Sportministerin und frühere Stadtpräsidentin von Brig, Viola Amherd (58, CVP), den Fussball- und Hockeyklubs ein Geschenk gemacht: 115 Millionen Franken erhalten sie vom Bund à fonds perdu, das heisst ohne Verpflichtung auf Rückzahlung.
Der Bundesrat will die Klubs damit für zwei Drittel der Ticketeinnahmen entschädigen, die ihnen wegen der Corona-Massnahmen entgangen sind. Im Gegenzug müssen sie Spielerlöhne über 148'200 Franken um 20 Prozent senken und dürfen keine Dividenden mehr ausbezahlen. Zudem verpflichten sie sich, beim Nachwuchs und den Frauen keine Abstriche zu machen.
Walliser lädt Constantin ein
Damit das Geld fliesst, muss das Parlament das Hilfspaket in der Wintersession allerdings erst noch absegnen. Die vorberatende Sportkommission hat sich deshalb bereits am Donnerstag unter dem Vorsitz des Walliser SP-Nationalrats Mathias Reynard (33) über das Dossier gebeugt – auch hier mit kräftigem Walliser Beigeschmack. Denn der Unterwalliser lud ausgerechnet den Präsidenten des FC Sion, Christian Constantin (63), zur Anhörung ein.
Der schwerreiche Sion-Boss gehört zu den umstrittensten Figuren im Schweizer Fussball. Über 50 Trainer hat CC bereits entlassen. Im März stellte er mitten in der Corona-Krise neun Spieler auf die Strasse, weil sie nicht bereit waren, in Kurzarbeit zu gehen. Darunter Stars wie Johan Djourou (33), Pajtim Kasami (28) oder Seydou Doumbia (32).
Ambri-Fan Reynard
Kommissionspräsident Reynard macht denn auch keinen Hehl daraus, dass er Constantin aus dem Wallis kennt. Beim letzten Sporthilfspaket habe die Kommission die Spitzen der Fussball- und Eishockeyliga angehört. Deshalb habe er dieses Mal zwei Klubvertreter, Sion-Boss Christian Constantin und SCB-Chef Marc Lüthi, eingeladen. «Hätte ich meinen Lieblingsverein zu Gast haben wollen, hätte ich den Präsidenten des HC Ambrì-Piotta eingeladen», verteidigt sich Reynard augenzwinkernd. Zudem könne man von Constantin halten, was man wolle, aber er sei stets «klar in seinen Aussagen».
Der Auftritt von CC sei in der Kommission zwar mit Spannung erwartet worden, sagen Parlamentarier. Allerdings sei sein Auftritt so unspektakulär gewesen «wie ein Fussballmatch zwischen den Färöer-Inseln und Liechtenstein». Der Sion-Boss habe lediglich ein Statement abgelesen.
«Gelddruckmaschine gefunden»
Amherds Sportpaket hingegen scheint im Parlament auf viel Goodwill zu stossen. Harsche Kritik kommt einzig aus der SVP. «Die Freigiebigkeit von Viola Amherd erstaunt mich sehr», sagt der St. Galler SVP-Nationalrat und Sportmanager Roland Rino Büchel (55). Im Sommer habe man noch von Krediten gesprochen. «Und jetzt plötzlich scheint es, als hätte der Bundesrat eine Gelddruckmaschine gefunden und könne den Klubs das Geld einfach so nachwerfen.»
Sein Parteikollege Peter Keller (49, NW) sieht im Entscheid einen Tabubruch: «Wenn wir das Geld im Sport einfach so verteilen, werden andere Branchen unweigerlich auch A-fonds-perdu-Beiträge verlangen.» Und in der Tat protestierte bereits am Nachmittag der Verband der Schweizer Schausteller. Während das Geld im Sport unbürokratisch fliesse, seien die rund 350 Schausteller-Familien in den Kantonen mit ganz unterschiedlichen Situationen konfrontiert, monierten die Schausteller.
Neues Militär-Trikot
Beim FC Sion freut sich derweil nicht nur der Präsident auf den Geldsegen von Amherds Sport- und Militärdepartement. Der Fussballklub hat am Donnerstag auch sein neues Auswärtstrikot präsentiert, das – Zufall oder nicht – im braun-grünen Militärmuster daherkommt. Schreibt Blick.
Dass die Profi-Fussballvereine im Parlament eine unglaublich starke Lobby seit jeher für ihre Anliegen werben lässt, ist eine bekannte Tatsache. Soll ja Ständeräte geben, die sich an behaarten Fussballerbeinen und strammen Waden kaum satt sehen können. (Hello Damian).
Dass auch SVP-Politiker zwischendurch einleuchtende Statements abgeben können, ist eine angenehme Überraschung. Peter Keller (49, NW) sieht im Entscheid einen Tabubruch: «Wenn wir das Geld im Sport einfach so verteilen, werden andere Branchen unweigerlich auch A-fonds-perdu-Beiträge verlangen.» Oder der St. Galler SVP-Nationalrat und Sportmanager Roland Rino Büchel (55): «Die Freigiebigkeit von Viola Amherd erstaunt mich sehr». Im Sommer habe man noch von Krediten gesprochen. «Und jetzt plötzlich scheint es, als hätte der Bundesrat eine Gelddruckmaschine gefunden und könne den Klubs das Geld einfach so nachwerfen.»
Eine Frage drängt sich unweigerlich auf: Wäre da eigentlich nicht Gianni Infantilos FIFA der richtige Ansprechpartner für A-fonds-perdu-Beiträge? Immerhin handelt es sich bei der FIFA nicht nur um die grösste und mächtigste Sport-Organisation der Welt, sondern auch um eine der reichsten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.11.2020 - Tag der Hydra
Was bislang zum Terroranschlag in Wien bekannt ist
Mehr als zwei Wochen sind seit dem tödlichen Anschlag in Wien vergangen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat über zwanzig Verdächtige ins Visier genommen, die "Gruppe 2. November" ermittelt auf Hochdruck mit Experten aus unterschiedlichenPolizeibehörden. Ihre eigene Untersuchung hat bereits eine von Innen- und Justizministerium eingesetzte Kommission gestartet. Sie soll Behördenversagen aufklären.
Der Anschlag
Knapp vor 20 Uhr hallen am 2. November die ersten Schüsse durch die Wiener Innenstadt: Der Attentäter K. F. eröffnet das Feuer auf eine fünfköpfige Gruppe, trifft eine Person tödlich. Neun Minuten lang bewegt er sich rund um den jüdischen Stadttempel und das Bermudadreieck. Um 20.09 Uhr ist der Täter tot. In den zehn Minuten hat er vier Personen ermordet und über zwanzig Menschen teils schwer verletzt.Dafür nutzte er einen serbischen Kalaschnikow-Nachbau, eine Tokarew-Pistole und ein Macheten-ähnliches Messer; außerdem trug er eine Sprengstoffgürtelattrappe.
Nach wie vor ist unklar, wie K. F. zum Tatort gelangt ist, auf Überwachungsvideos der Wiener Linien ist er nicht zu sehen. Ein Uber-Fahrer will ihn chauffiert haben, die Polizei hält von dieser Spur allerdings nicht viel. Ein Beitragstäter, der ihn hingefahren hat, wird nach wie vor nicht ausgeschlossen. Warum der Täter genau am 2. November zugeschlagen hat, ist unklar. Womöglich alarmierte ihn eine SMS, in der seine Meldung eines Einbruchs an die Polizei bestätigt wurde. Vielleicht wollte er aber den letzten Abend vor dem Lockdown nutzen.
Das Jihadistentreffen
Am 16. Juli 2020 fährt der spätere Attentäter K. F. gemeinsam mit Argjend G. und einem weiteren, noch unbekannten Mann zum Flughafen Wien-Schwechat. Die drei holen Besuch aus Deutschland ab: Zwei amtsbekannte Jihadisten haben sich auf den Weg nach Wien gemacht – und der Verfassungsschutz beobachtet sie auf Schritt und Tritt. In den nächsten vier Tagen gibt es Treffen in Parks und in Moscheen, K. F. beherbergt mindestens einen der Deutschen. Auch aus der Schweiz reisen zwei Islamisten an.
Eine zentrale Rolle dürfte Anzor W. spielen, der zu diesem Zeitpunkt noch in Wien wohnt. Er war bereits 2017 wegen der versuchten Ausreise nach Deutschland verurteilt worden; zwischen Jänner und Oktober 2020 wohnte er mit seiner Familie in Wien. Der im Umfeld des berüchtigten Predigers Abu Walaa radikalisierte Islamist ist durchgehend im Visier der Ermittler, die etwa über eine von ihm erstellte Whatsapp-Gruppe Bescheid wissen. Darin wird IS-Propaganda geteilt, mehrere aktuell Verdächtige waren Mitglied. Das Jihadistentreffen könnte der Anschlagsplanung gedient haben, denken Ermittler. In einer Haftanordnung heißt es, dass die Beschuldigten anlässlich der Treffen "die Tatausführung besprachen sowie Pläne zur Anschaffung der Tatmittel schmiedeten". Das wird von den Anwälten der Verurteilten klar dementiert.
Im August reisten dann drei Verdächtige ins deutsche Hanau – angeblich, um eine Freundin zu besuchen. Diese drei Personen sollen davor und danach in engem Kontakt mit K.F. gestanden sein. Der spätere Attentäter nahm von zwei der Verdächtigen, die nach Deutschland reisten, ein Foto mit erhobenem Zeigefinger auf – der Geste des IS. Diente die Reise auch der Tatvorbereitung? Die Verdächtigen halten dem entgegen, dass das Treffen mit einer Bekannten in Hanau gut dokumentiert ist. Darüber – und über das Aussehen der Frau – hätte einer der Verdächtigen mit seiner Mutter gechattet.
Das Netzwerk in Österreich
Schon in der Nacht nach dem Anschlag werden zwölf Personen verhaftet: Um 3.46 Uhr ordnet der Journaldienst der Staatsanwaltschaft die Maßnahmen an. Um 7.14 Uhr folgen drei weitere Verdächtige. Die Liste wächst beinahe jeden Tag, heute, Donnerstag, finden nach zwei Wochen U-Haft die ersten Haftprüfungsverhandlungen statt. Fast alle sind amtsbekannt, manche waren bereits angeklagt, andere bereits verurteilt: Einer wollte mit dem späteren Attentäter einst nach Syrien ausreisen; ein anderer war in den geplanten Überfall eines Waffengeschäfts involviert; ein Dritter soll IS-Propaganda verbreitet haben.
Rasch stellen Ermittler fest, dass es Bezüge zu einem weiteren Verfahren gibt: Der Islamist Serfiraz K. soll im Sommer 2017 ein junges Mädchen nach Syrien gebracht und dem IS "zugeführt haben", wie es in den Akten heißt – für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Unklar ist, wie eng die Verdächtigen mit "früheren Generationen" von Predigern und Islamisten zu tun hatten, beispielsweise mit dem verurteilten Ebu Tejma. K. F. besuchte jedenfalls dieselbe Moschee wie Lorenz K., der verurteilte Bombenbastler.
Zwei Verdächtige sollen noch wenige Stunden vor dem Attentat Kontakt mit K.F. gehabt haben – sie brachten ihm ein geliehenes "islamisches Buch" zurück. Für die Staatsanwaltschaft ist es eine "lebensnahe Annahme", dass das Treffen in Verbindung mit dem Attentat stünde. Der Anwalt der Betroffenen hält dem entgegen, dass "keinerlei Ermittlungsergebnisse" diese These unterstützen.
Ermittlungspannen
Nach fast jedem Terroranschlag ist rasch klar: Die Behörden haben den Täter gekannt und wichtige Warnsignale übersehen. Das war bei K. F. nicht anders: Nach dem Jihadistentreffen im Juli 2020 fuhr er in die Slowakei, um Munition zu kaufen – was für den Besitz einer Waffe spricht. Der Verfassungsschutz wurde durch sein slowakisches Pendant informiert; ein Beamter schlug eine Erhöhung der Gefährdungseinschätzung vor – ohne Folgen. Laut Akten wurden Maßnahmen gegen K. F. geplant, eine andere, von dem Thema unabhängige Aktion hatte jedoch Vorrang.
Nur wenige Tage nach dem Terroranschlag in Wien folgte die großangelegte Razzia "Luxor" gegen 70 Beschuldigte eines angeblichen Netzwerks von Muslimbrüdern. Dabei wurde laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ein Vermögen von mehr als 20 Millionen Euro sichergestellt. Der höchste Bargeldfund: 100.000 Euro. Festgenommen wurde niemand. Mehr ist nicht bekannt. Ob die Priorisierung dieser Ermittlungen ein tödlicher Fehler war, soll nun eine Untersuchungskommission klären. Sie legt im Dezember ihren ersten Bericht vor. Schreibt DER STANDARD.
Zum Versagen der Behörden kommt die generelle Naivität des Westens gegenüber der islamischen Hydra hinzu:
Hydra ist ein vielköpfiges Ungeheuer der griechischen Mythologie. Wenn sie einen Kopf verliert, wachsen ihr zwei neue, zudem ist der Kopf in der Mitte unsterblich. Ihr Hauch soll tödlich sein. So steht's geschrieben bei Wikipedia.
Sagt eigentlich alles.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.11.2020 - Tag der Mordsanführer
Warum Biden für Erdogan zum Super-GAU werden könnte
Der türkische Präsident gratulierte dem Wahlsieger in den USA sehr spät. Tatsächlich gibt es gute Gründe für Erdogans Zurückhaltung. Dem starken Mann am Bosporus drohen jetzt Sanktionen und auch ganz persönliche Gefahren.
Als US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in der Türkei eintraf, markierte sein Besuch das etwas unterkühlte Ende einer eigentlich erstaunlich guten Beziehung zwischen den Regierungen von Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump. Pompeo traf in Istanbul Patriarch Bartholomäus I., das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Christen, die sich von der Regierung Erdogan angegriffen sehen. Gespräche mit dem türkischen Präsidenten sowie mit Pompeos Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu standen nicht auf dem Programm – trotz einer Einladung Cavusoglus.
In einem Interview mit der französischen Zeitung „Figaro“, das auch WELT veröffentlichte, kritisierte Pompeo Ankaras Einmischungen in Libyen, Bergkarabach und dem östlichen Mittelmeer: „Wir sind besorgt über den verstärkten Einsatz der türkischen militärischen Fähigkeiten. Wir haben unsere Besorgnis sowohl privat als auch öffentlich zum Ausdruck gebracht.“ Doch auch wenn Pompeo hier die erste Person Plural benutzt – sein Chef Donald Trump scheint die Türkei anders zu sehen.
Noch Ende vergangenen Jahres beschrieb Trump Erdogan bei dessen Besuch in Washington so: „Er ist mein Freund. Und ich bin froh, dass wir nie ein Problem miteinander hatten, denn – ehrlich gesagt – er ist ein Mordsanführer und er ist ein harter Mann. Er ist ein starker Mann und er tut das Richtige, und das schätze ich und das werde ich auch in der Zukunft schätzen.“
Tatsächlich kam Trump trotz zwischenzeitlicher Reibereien, etwa um den in der Türkei inhaftierten Pastor Andrew Brunson, Erdogan immer wieder bemerkenswert weit entgegen. Im Herbst 2019 ließ Trump zu, dass die Türkei gegen die bis dahin mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG im Nordosten Syriens einmarschierte. Als der US-Kongress Sanktionen gegen die Türkei forderte, weil Ankara das russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hatte, blockierte Trump die Strafmaßnahmen.
Dabei trennt die beiden Präsidenten vieles. So verschärfte Erdogan immer wieder seine Rhetorik gegen Israel, während sich Trump als vielleicht bedingungslosester Verbündeter des jüdischen Staates präsentierte, der je im Weißen Haus gewohnt hat. Unter Trumps internationalen Männerfreundschaften war die mit Erdogan vielleicht die widersprüchlichste, aber sie funktionierte.
Das mag auch daran liegen, dass Trump in der Türkei geschäftlich aktiv ist und Erdogan sogar der Einweihung der Trump-Tower in Istanbul 2015 beiwohnte. Zudem sollen sich die Schwiegersöhne beider Präsidenten, Berat Albayrak und Jared Kushner, gut verstehen.
Klare Ansagen von Biden
Was der Regierung Erdogan dagegen unter der Präsidentschaft von Joe Biden droht, wirkt von Ankara aus betrachtet wie ein potenzieller Super-GAU. Und der könnte Erdogan auch ganz persönlich treffen. Zu seiner möglichen Außenpolitik hat sich Biden vor der Wahl meist nur vage geäußert. Aber in Sachen Türkei hat der designierte Präsident schon als Kandidat auffallend klare Ansagen gemacht.
Etwa zum östlichen Mittelmeer, wo Erdogan seine Marine und Luftwaffe im Gasstreit mit Griechenland und Zypern einsetzt. In einem Statement von Bidens Wahlkampfteam zu den griechisch-amerikanischen Beziehungen vom Oktober heißt es: „Anders als Präsident Trump wird Joe Biden türkischem Verhalten entgegentreten, das gegen internationales Recht verstößt und gegen die Verpflichtungen der Türkei als Nato-Mitglied, etwa die Verletzung des griechischen Luftraums.“
Biden werde gemeinsam mit Griechenland an der Stabilisierung des östlichen Mittelmeers arbeiten, und er sei schon immer gegen die türkische Besetzung Zyperns gewesen. Zudem verurteile er die Umwandlung der ehemaligen Basilika Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee durch die Regierung Erdogan.
Bidens langjährige Sympathie für den türkischen Erzfeind Griechenland geht so weit, dass er sich angeblich einst als Ehren-Griechen bezeichnete und sich bei einem Wahlkampfauftritt vor griechischstämmigen Amerikanern 2012 als „Joe Bidenopoulos“ vorstellte.
Belastungsproben: Armenien und Halkbank-Prozess
Aber auch aus anderen Gründen ist schon Bidens Vorgeschichte problematisch für Erdogan. Immerhin galt Biden als enger Berater von Barack Obama, der als US-Präsident das Bündnis mit den syrischen Kurden einging.
Immer wieder beklagte sich der türkische Präsident damals über die US-Waffenlieferungen an die kurdische YPG in deren Kampf gegen die Terrormiliz IS. Washington unterstütze die eine Terrororganisation, um die andere zu bekämpfen, ätzte Erdogan.
Und damals war es der US-Vizepräsident Biden höchstpersönlich, der Erdogan vorwarf, er habe selbst zur Entstehung des IS beigetragen, indem er zahllose islamistische Kämpfer über die türkische Grenze nach Syrien habe einreisen lassen. Zwar entschuldigte sich Biden später. Doch manche Beobachter spekulieren sogar, als Präsident könnte Biden das Bündnis mit den Kurden erneuern. Das ist alles andere als gewiss.
Zwei Spannungspunkte zwischen Ankara und Washington sind hingegen so sicher, dass sie gewissermaßen im Kalender stehen. Das eine neuralgische Datum ist der 24. April 2021. An diesem Tag gedenken die Armenier alljährlich des Massenmords an ihren Landsleuten durch die Armee des osmanischen Sultans im Jahre 1915.
Im April dieses Jahres versprach Biden, er werde die Gräuel im Fall eines Wahlsiegs namens der USA als Völkermord anerkennen. Gegen diese Bezeichnung kämpft die Türkei international, und die Regierung Erdogan verfolgt auch im Innern Menschen, die sie öffentlich verwenden. Sollte Biden seine Ankündigung etwa zum nächsten Gedenktag wahr machen, ist eine scharfe Reaktion aus Ankara sicher. Den ganzen Artikel DER WELT lesen Sie hier.
«Er ist mein Freund. Und ich bin froh, dass wir nie ein Problem miteinander hatten, denn – ehrlich gesagt – er ist ein Mordsanführer und er ist ein harter Mann.»
The Donald at its best! Ich kenne das Original-Zitat von Trump über Erdogan in englischer Sprache nicht. Es könnte durchaus sein, dass das Wort «Mordsanführer» vom Englischen falsch in die deutsche Sprache übersetzt worden ist.
Dennoch trifft «Mordsanführer» im wahrsten Sinne des Wortes auf den Sultan vom Bosporus zu, der das Nato-Mitglied Türkei seit seiner Machtübernahme je länger je mehr in einen islamistischen Staat mit Kurs auf die Scharia verwandelt und bei den kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien, Libyen und Bergkarabach an vorderster Front zusammen mit den aus Syrien übernommenen IS-Kämpfern vertreten ist. Schliesslich geht es für den Despoten um nicht weniger als die Wiederherstellung des Osmanischen Reichs.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.11.2020 - Tag der Pseudologia phantastica
Trumps Top-Berater stellt Joe Biden geordnete Übergabe in Aussicht
Zwei Wochen nach der Wahl sträubt sich Donald Trump weiter gegen die Niederlage. Sein Nationaler Sicherheitsberater hingegen plant bereits die Weitergabe der Amtsgeschäfte an Joe Biden – und lobt dessen Personal.
Auch aus dem engsten Umfeld von Donald Trump kommen inzwischen klare Signale, dass der noch amtierende US-Präsident früher oder später den Sieg seines Kontrahenten akzeptieren sollte. Und selbst wenn Trump zu diesem Schritt nicht in der Lage sein sollte: Die Macht- und Amtsübergabe wird stattfinden, auch ohne Zustimmung des 45. Präsidenten.
Eines dieser Signale sendet der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Robert O'Brien. Er hat dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden eine geordnete Übergabe in Aussicht gestellt. Zugleich ließ O'Brien am Montag in einem Interview keinen Zweifel daran, dass er es noch nicht für abschließend entschieden halte, dass Biden die Wahl gegen Amtsinhaber Trump tatsächlich gewonnen habe.
Dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge ist die Entscheidung allerdings eindeutig. Vereidigung und Amtsübernahme Bidens sind für den 20. Januar kommenden Jahres geplant.
O'Brien sagte in dem Interview im Rahmen des digitalen Global Security Forum, es werde zweifelsohne eine »sehr professionelle Übergabe der Amtsgeschäfte« vonseiten des Nationalen Sicherheitsrats geben – vorausgesetzt, Trumps Klagen seien nicht erfolgreich und Biden stehe als Gewinner fest. »Und offensichtlich sieht es jetzt danach aus.« Damit legt er sich zwar nicht restlos fest, trotzdem ist es ein Schlüsselsatz.
Der Trump-Berater fügte hinzu: »Das Großartige an den Vereinigten Staaten ist, dass wir den Staffelstab selbst in den umstrittensten Zeiten weitergegeben haben und friedliche, erfolgreiche Übergänge hatten.«
Ohne geordnete Übergabe erwartet Biden ein schwerer Start
Der Republikaner Trump und die meisten seiner Vertrauten behaupten immer noch, er werde am Ende die Wahl gewinnen. Biden war bereits am 7. November von US-Medien als Gewinner ausgerufen worden. Die faktisch abgewählte Regierung verweigert dem Demokraten jedoch mit Blick auf die Klagen die vom Gesetz vorgesehene Unterstützung für eine Amtsübergabe (»transition«). Dadurch bekämen Biden und sein Team schon vor der Amtsübernahme Zugang zu Ministerien, Behörden und vertraulichen Informationen.
Mit Blick auf die Zusammensetzung des Weißen Hauses unter Biden sagte O'Brien: »Sie werden sehr professionelle Leute haben, um diese Positionen einzunehmen. Viele von ihnen waren schon einmal hier und haben viel Zeit im Weißen Haus in früheren Regierungen verbracht.«
Biden selbst rief Trump ebenfalls erneut eindringlich auf, eine Übergabe der Regierungsgeschäfte einzuleiten. »Es könnten mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren«, sagte Biden am Montag in seiner Heimatstadt Wilmington mit Blick auf die Pandemie. So müsse bereits jetzt geplant werden, wie ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus verteilt werde.
Klare Worte des kommenden an den amtierenden Präsidenten
»Wenn wir mit dem Beginn der Planungen bis zum 20. Januar warten müssen, verlieren wir einen Monat, eineinhalb Monate«, sagte der 77-Jährige. Deswegen müsse die Trump-Regierung »jetzt« oder »so schnell wie möglich« mit seinem Übergangsteam zusammenarbeiten.
In den USA breitet sich das Coronavirus derzeit rasant aus. Inzwischen wurden mehr als elf Millionen Infektionsfälle und mehr als 246.000 Corona-Tote bestätigt, die höchsten Zahlen weltweit.
Große Hoffnungen ruhen auf künftigen Impfstoffen: Vergangene Woche meldeten das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer, ihr Impfstoffkandidat sei bei Versuchen zu mehr als 90 Prozent wirksam gewesen. Am Montag erklärte dann das US-Biotech-Unternehmen Moderna, sein Impfstoffkandidat sei zu fast 95 Prozent wirksam. Schreibt DER SPIEGEL.
The Donald wird mit grösster Wahrscheinlichkeit nie öffentlich zugeben, die US-Präsidentenwahl 2020 verloren zu haben. Lassen wir den SPIEGEL auf seinen Artikel über Pseudologia phantastica doch gleich selber mit einem SPIEGEL-Artikel aus dem Jahr 2014 antworten:
Von krankhaftem Verhalten spricht man in der Regel dann, wenn jemand so massiv schwindelt, dass er sich oder anderen dadurch schadet. Der Übergang vom normalen zum krankhaften Lügen sei allerdings fliessend, sagt Freyberger. Auch die Motive sind dabei die gleichen: Egal ob jemand einfach im Alltag viel lügt oder es Teil einer Persönlichkeitsstörung ist - wie bei fast allen extremen Lügnern. Bei den einen steckt das unbewusste Bedürfnis sich aufzuwerten dahinter. Die anderen setzen Lügen ganz bewusst ein, um sich Vorteile zu verschaffen. Ihnen mangelt es schlichtweg an Unrechtsbewusstsein und Sozialkompetenz.
Trifft eigentlich so ziemlich alles auf The Donald zu.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.11.2020 - Tag der Reisebranche
Massenentlassung bei Knecht Reisen? Jetzt spricht der Firmeninhaber
Der Vorwurf ist happig: Das Aargauer Reiseunternehmen – schweizweit die Nummer eins im Fernreise-Geschäft – baue mittels Salamitaktik massiv mehr Stellen ab als angekündigt. Firmeninhaber Thomas Knecht widerspricht jetzt mit deutlichen Worten.
Die Coronapandemie trifft kaum eine Branche so hart wie die Reiseunternehmen. Die Herbstferien waren noch ein Hoffnungsschimmer, da wurde zum Teil wieder gebucht, doch seit die zweite Infektionswelle über ganz Europa schwappt, sind die Aussichten düster. Bei Knecht Reisen betragen die Umsatzeinbrüche je nach Geschäftsbereich 70 bis sogar 95 Prozent.
Das Unternehmen mit Sitz in Windisch AG ist schweizweit an 18 Standorten vertreten, von Basel bis Luzern, vom Aargau bis in die Ostschweiz. Vor Corona beschäftigte die Reisegruppe fast 300 Personen, inzwischen sind es deutlich weniger. Ende Juni gab der damalige CEO Roger Geissberger bekannt, bis Ende 2020 würden vier Filialen geschlossen und jeder fünfte Arbeitsplatz werde abgebaut, wie die «Aargauer Zeitung» berichtete.
In Wahrheit würden nun aber viel mehr Stellen abgebaut als die kommunizierten 20 Prozent, meldet die «SonntagsZeitung» mit Verweis auf interne Quellen. Im Oktober sei bereits die vierte Entlassungswelle über die Bühne gegangen. Von Salamitaktik sei die Rede, und die Chefs mehrerer Reisemarken – Baumeler Reisen, Glur, Kira Reisen, House of Sport – hätten in den letzten Monaten und Wochen freiwillig gekündigt.
Was ist eine Massenentlassung?
Konkret steht der Vorwurf im Raum: Hat bei Knecht Reisen heimlich eine Massenentlassung stattgefunden, ohne dass die entsprechenden Regeln des Obligationenrechts eingehalten worden sind? Von einer Massenentlassung spricht man, wenn eine Firma Angestellte nicht aus individuellen Gründen (Verhalten, Leistung) entlässt, sondern aus wirtschaftlichen. Als Massenentlassung gelten Kündigungen in KMU dann, wenn sie in einem Betrieb innerhalb von 30 Tagen ausgesprochen werden und mindestens zehn Arbeitnehmer betreffen.
Firmeninhaber Thomas Knecht hat sich bislang dazu nicht öffentlich geäussert. Auf Anfrage von CH Media weist er nun den Vorwurf der heimlichen Massenentlassung entschieden zurück. Knecht wird ab 2021 auch operativer Chef der Gruppe, weil der langjährige CEO Roger Geissberger kürzer tritt. Knecht sagt: «Gemäss unseren Abklärungen liegt keine Massenentlassung vor.»
Er verweist darauf, dass die Sparmassnahmen in mehreren Kantonen und an diversen Standorten durchgeführt würden. Zehn Entlassungen innerhalb von 30 Tagen, das habe es in keinem der verschiedenen Betriebe gegeben, die zur Knecht-Gruppe gehören. Näher will sich Knecht nicht dazu äussern, gemäss Informationen von CH Media läuft der Abbau aber klassisch dezentral ab. Ein typischer Vorgang ist, dass ein Reisebüro von vier auf drei Arbeitsplätze verkleinert wird.
Die Behörden wollen es genau wissen
Ob eine Massenentlassung vorliegt oder nicht, das will jetzt auch das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau wissen. Offenbar bekam es durch Angestellte entsprechende Hinweise und hat sich beim Unternehmen gemeldet. Thomas Knecht sagt, man sei diesbezüglich mit dem Amt «im Austausch». Im Fall einer Massenentlassung gelten für den Arbeitgeber verschiedene Spezialvorschriften, so muss er unter anderem die Arbeitnehmer vor dem Entscheid schriftlich informieren und die Gründe, Anzahl Betroffene und den Zeitraum der Entlassungen bekannt geben.
Dass es «schmerzhafte Massnahmen» gebe, bestreitet Knecht nicht. Wegen des Umsatzeinbruchs seien «Anpassungen der personellen Kapazitäten» unumgänglich. «Diese erfolgen fairerweise auf allen Stufen, also auch auf Kaderstufen», sagt der Firmeninhaber. Es könne auch gut qualifizierte Mitarbeitende treffen.
Betroffenen wird in anderen Geschäftsbereichen eine Stelle angeboten
Die Knecht-Gruppe ist nicht nur im Reisegeschäft tätig, sondern auch im Transport und in der Gesundheitsbranche. Thomas Knecht, ehemaliger Chef von McKinsey Schweiz, betont, dass man versuche, offene Stellen in anderen Bereichen mit Angestellten aus dem kriselnden Reisebereich zu besetzen. «Wir sind froh, dass wir aufgrund der Diversifikation den Betroffenen jeweils interne offene Stellen anbieten konnten und immer noch können», sagt Knecht, der vom Magazin «Bilanz» letztes Jahr zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft gewählt wurde.
Eine «grössere Anzahl Mitarbeitender» sei intern gewechselt, und das habe den Stellenabbau abgefedert, sagt Knecht. Ein Branchenwechsel kommt aber nicht für alle Betroffenen des Reisesektors infrage. «Wir respektieren, dass nicht alle gekündigten Mitarbeitenden diese Möglichkeit wahrnehmen, und auch nicht die angebotenen Freelancer-Lösungen», sagt Knecht. Zurzeit sind in der Knecht-Gruppe mehr als ein Dutzend Stellen vakant. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Was soll Knecht, dessen Firmen (aus der Reisebranche) von der Corona-Krise in extremis getroffen wurden und weiterhin noch getroffen werden, denn machen? Warten, bis er Konkurs anmelden muss?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.11.2020 Tag der unerwünschten Treffen
Kurz zum bevorstehenden Lockdown: "Treffen Sie niemanden"
Der Kanzler ruft zu drastischer Kontaktreduktion auf. Die Lage in Österreich sei "dramatisch". In den kommenden drei Wochen müsse die Reproduktionszahl stark gesenkt werden.
Am kommenden Dienstag beginnt der zweite harte Lockdown. Der sogenannte Lockdown light hat nach zehn bis 14 Tagen nicht die erhoffte Wirkung erzielt, die Neuinfektionen sind nicht "im entsprechenden Ausmaß" gesunken, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstagnachmittag. Das mache nun eine "weitere Verschärfung nötig". Bei mehr als 7.000 Neuinfektionen pro Tag gehe es schlicht nicht mehr anders. In manchen Bundesländern – etwa Kärnten – verzeichne man sogar weiterhin ein exponentielles Wachstum.
"Insgesamt haben wir damit eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 550. Der Zielwert ist 50. Das ist mehr als zehnmal so hoch, wie gut wäre", erklärte Kurz.
77 Prozent nicht zuordenbar
Es gebe weiterhin diejenigen, die der Meinung seien, dass es im Handel oder in der Schule nicht zu Ansteckungen komme. Dem entgegnete der Kanzler: 77 Prozent der Neuinfektionen könnten nicht mehr zurückverfolgt werden. Und: Selbst wenn die Zahlen jetzt zu sinken beginnen würden, dann würden sie dies "viel zu langsam" tun. Bei dem aktuellen Lockdown light dauere es einfach viel zu lange, bis Österreich wieder an einem ausreichend niedrigen Niveau an Neuinfektionen ankommt und "wir wieder hochfahren können".
Bis inklusive 6. Dezember werde deswegen der "harte Lockdown" gelten. Neben der Gastronomie wird ab Dienstag auch der Handel geschlossen und körpernahe Dienstleistungen untersagt – ausgenommen bleibt die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Auch die Pflichtschulen stellen mit diesem Tag auf Fernunterricht um. Sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen besteht die Möglichkeit zur Betreuung. Auf Homeoffice soll überall dort umgestellt werden, wo es möglich ist.
Keine Treffen
Die aktuell ab 20 Uhr geltenden Ausgangsbeschränkungen werden ab Dienstag auf den ganzen Tag ausgedehnt. Das Haus darf dann nur aufgrund der Ausnahmen verlassen werden. "Meine eindringliche Bitte ist", sagte Kurz: "Treffen Sie niemanden."
So solle man die Freizeit ausschließlich mit jenen Personen, mit denen man in einem gemeinsamen Haushalt lebt, verbringen. Wenn man alleine wohnt, solle man sich nur mit einer einzigen Person treffen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) präzisierte dies in der "ZiB 2" am Abend: Die entsprechende Passage der Verordnung ist nach seiner Darstellung vielmehr so zu verstehen, dass Treffen mit engen Angehörigen "als Einzelperson" stattfinden sollen. "Wir wollen verhindern, dass es wieder zu Familienfeierlichkeiten, zu Familienfesten kommt." Ziel sei eine "massive Reduktion der Kontakte".
Reisefreiheit im Rahmen der Beschränkungen
Die Lage sei "drastisch", sagte der Kanzler. Die Reisefreiheit innerhalb Österreichs bleibe natürlich gewahrt – schließlich müssten viele auch beruflich reisen. Aber nur innerhalb der Ausnahmen der Ausgangsbeschränkungen, sagte Kurz. Wenn die Maßnahmen in Österreich greifen, dann müsse man sich die Entwicklung in den Nachbarländern weiter ansehen. Derzeit herrsche eine ähnliche Situation mit Lockdowns oder lockdownähnlichen Zuständen. "Die Lage in den Ländern rund um Österreich ist eine sehr ähnliche wie bei uns. Wenn es eine Verschlechterung gibt, dann wird man das neu betrachten müssen", sagte Kurz. Die Grenzkontrollen gegenüber Ungarn und Slowenien bleiben aufrecht.
"Es zipft jeden an, sich an die Maßnahmen zu halten", erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Aber jetzt seien diese dringend notwendig: "Es geht darum, den Weg in ein normales gesellschaftliches Leben zu finden." Die Polizei werde mit der Bevölkerung diesen Weg "an der Seite gehen". Werde das Gespräch suchen, aber auch durchgreifen, so der Innenminister.
Weihnachten retten
Es brauche nun diese radikale Kontaktreduktion, betonte Kurz: "Nur so können wir das Weihnachtsfest und die Vorweihnachtszeit retten." Der harte Lockdown sei das einzige Mittel, mit dem es schon einmal gelungen sei, die Ansteckungszahlen zu reduzieren.
"Wir haben in Österreich den ersten Teil der Pandemie gut bewältigt", sagte Anschober. Nach dem Lockdown habe man fünf Monate einen relativ angenehmen Alltag herstellen können. Nun sei aber die befürchtete zweite Welle im Herbst eskaliert. "Die zweite Welle ist gewaltiger und dynamischer als die erste Welle im Frühling." Schreibt DER STANDARD.
In Österreich zirkuliert nach der Verkündigung des harten Lockdowns von Kanzler Sebastian Kurz, der in Österreich nicht unumstritten ist, ein Running Gag in den Social Media-Portalen:
«Treffen Sie niemanden» - Das hätte er dem Wiener Terroristen sagen sollen!*
Über Geschmack lässt sich trefflich streiten. Die Hinterbliebenen der Opfer werden den Witz wohl nicht so toll finden.
* Anmerkung: Bei dem terroristischen Amoklauf in Wien wurden vier Personen getötet und 23 weitere teils schwer verletzt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.11.2020 - Tag der Wechselhaare
Heisse Diskussionen im Netz: Trump hat plötzlich graue Haare
Vor wenigen Tagen noch blond, jetzt plötzlich grau: Trumps Haarpracht gibt in den sozialen Netzwerken zu reden.
Die erste öffentliche Ansprache von Donald Trump (74) seit mehr als einer Woche hat am Freitag für viel Gesprächsstoff gesorgt: Der US-Präsident trat mit ungewohnt grauer Haarfarbe vor die Kameras im Rosengarten des Weissen Hauses. Zuschauer fragten sich weltweit, wo auf einmal die blonde Tolle des Republikaners geblieben ist. In den sozialen Netzwerken brach eine Welle von Fragen los, warum sich der 74-Jährige wohl nicht mehr die Haare gefärbt hat.
Eine Antwort gab Trump nach seinem Auftritt am Freitag nicht. Fragen der eingeladenen Journalisten liess er weder zu diesem noch zu anderen Themen zu.
Am 6. November war der Amtsinhaber bei seinem bislang letzten Pressetermin noch mit deutlich blonder Haarfarbe zu sehen gewesen. Tage danach gab es eine Kranzniederlegung am Tag der Veteranen – bei strömendem Regen auf dem Nationalfriedhof von Arlington schien Trumps Haarfarbe am Mittwoch weniger blond als zuvor, aber nicht so grau wie am Freitag.
Graue Haare wegen Wahlniederlage?
«Hat sein Haar die Realität eher erkannt als er selbst?», fragte eine Twitter-Nutzerin in Anspielung auf Trumps Wahlniederlage und seine wiederholten Vorwürfe, dass es bei der Abstimmung am 3. November nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Der Präsident weigert sich beharrlich, den Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden (77) anzuerkennen.
Auch auf Facebook bewegte Trumps Haarfarbe die Gemüter. Dort wurde auch besorgt nach dem Befinden des Wahlverlierers gefragt – und seine Haarfarbe neben der bedrückten Mine und dem langsamem Gang des Präsidenten als weiteres Indiz dafür gewertet, dass ihm die Wahlniederlage offenbar mächtig zu schaffen mache. Schreibt Blick.
Einerseits ist es schon etwas mysteriös, wenn sogar ein Schömörö (französisch für «Toupet») plötzlich die Farbe für die künstlichen Federn wechselt.
Andererseits ist es ganz normal, dass sich irgendwann die Haarfarbe verändert: Die Wechseljahre bringen beinahe automatisch und zu 99 Prozent eine Wechselfarbe für die Haarpracht mit sich. Ich rede aus Erfahrung.
Einigen aus dieser unseligen Gruppe geht's noch viel schlimmer. Stimmt doch, oder etwa nicht, lieber Res?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
13.11.2020 - Tag des Tangos
Halbe Million Franken erschlichen: Sozial-Betrüger scheffelt Staatsgeld – und führt heimlich Auto-Garage
Jeden Monat kriegt ein Winterthurer Sozial-Betrüger-Paar bis zu 5000 Franken vom Staat. Seit 1997. Doch mindestens neun Jahre lang führt der Familienvater eine gut laufende Autogarage. Seine Frau meint: «Ich dachte, dieses Geld erhält man in der Schweiz einfach.»
Es ist ein Betrugsfall, der ratlos macht. In Winterthur erhielt ein Ehepaar mit fünf Kindern jahrelang Sozialhilfe, bis zu 5000 Franken pro Monat – und das, obwohl der Familienvater eine gut laufende Autogarage führte und das nicht mal wirklich versteckte.
So fuhr er ein Auto im Wert von 63'000 Franken. Damit kutschierte er täglich völlig offensichtlich zur Arbeit. Das berichten laut «Tages-Anzeiger» Zeugen, denn der Fall landete vor Gericht. Der Sozial-Betrug ist aufgeflogen. Nun drohen dem Mann, der die Garage führte, und seiner Ehefrau je vier Jahre Gefängnis.
Heimlich gewinnbringend Autos verkauft
Die fünffachen Eltern, die vor über zwei Jahrzehnten aus Nordmazedonien immigrierten, erhalten bereits seit 1997 Unterstützung vom Staat. Doch während mindestens neun Jahren, von 2006 bis 2015, hätten sie diese Sozialhilfe nicht erhalten sollen. In der Zeit soll der Familienvater eine Autogarage in einer Gemeinde im Zürcher Weinland geführt haben.
Die Garage lief nicht schlecht. Laut dem «Tages-Anzeiger» reparierte und verkaufte er ausserdem heimlich alte Autos. Gewinnbringend, 492 Stück. Und das, obwohl er 2009 nach einem Autounfall als arbeitsunfähig eingestuft worden war.
«Er humpelte nur auf dem Sozialamt»
Dazu kam vor Gericht noch der heftige Vorwurf, dass Zeugen nie eine gesundheitliche Einschränkung gesehen hätten. Es hiess gar: «Er humpelte nur, wenn er auf dem Sozialamt erscheinen musste.»
Jahrelang flog das nicht auf. Auch nicht, als er von Mitarbeitern der Sozialen Dienste Winterthur auf seine geschwärzten und lädierten Hände angesprochen wurde. Hände, wie sie viele arbeitende Mechaniker haben.
Bis 2014 dann doch einem Verdacht nachgegangen wurde. Die Staatsanwältin sagt dazu: «Den Behörden kann die Schuld nicht in die Schuhe geschoben werden.» Es sei unmöglich, bei jedem Bezüger die Angaben auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.
Der Beschuldigte gab den Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs vor Gericht zu. Er bestritt jedoch den Deliktsbetrag. Die Staatsanwaltschaft sprach laut dem «Tages-Anzeiger» einer halben Million Franken Gewinn, die er mit der Garage gemacht haben soll. Er spricht von etwa 130’000 Franken.
Auch die Frau wurde angeklagt. Sie sagt jedoch, sie habe nicht gewusst, dass ihnen die Sozialhilfe nicht zustand. Sie sagte: «Ich dachte, dieses Geld erhält man in der Schweiz einfach.» Mit dieser Begründung überzeugte die Frau die Winterthurer Richter nicht: Sie wurde am Donnerstag zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Ihre Ehemann erhält eine teilbedingten Freiheitsstrafe von 33 Monaten. Davon muss er 12 Monate absitzen. Schreibt Blick.
It takes two to tango: Einen / eine / eines*, der / die / das bescheisst und einen / eine / eines, der / die / das sich bescheissen lässt.
* Political Correctness at its best
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.11.2020 - Tag des Impfzwangs
Christoph Franz (60) stellt sich gegen Bundesrat Berset: Roche-Präsident für Impfzwang!
Christoph Franz ist nicht irgendwer. Franz ist Roche-Präsident und Multi-Verwaltungsrat. Und in Impfsachen hat der Schweizer Wirtschaftsführer eine klare Meinung. Franz ist für ein Impfobligatorium, besonders in der Corona-Krise.
Der Bund will ihn. Und auch der Basler Pharmamulti Roche ist begeistert vom Impfstoffkandidaten der Firmen Biontech und Pfizer. Chef Severin Schwan (52) bezeichnet ihn als «Durchbruch». «Das ist wirklich beeindruckend, dass diese Technologie zu greifen scheint», schwärmt Schwan. Roche selber hat kein Impfstoffgeschäft.
Noch ist das Mittel nicht auf dem Markt. Wenn es denn einmal so weit ist, soll das Impfen mit einem Covid-19-Mittel verbindlich sein. Dieser Meinung ist zumindest Christoph Franz (60), Verwaltungsratspräsident von Roche. «Ich persönlich bin für Impfobligatorien», sagt Franz in der heutigen Ausgabe der «Handelszeitung». «Obwohl ich weiss, dass das eine umstrittene Position ist.» Im Vorabdruck, der BLICK vorliegt, sagt der Schweizer Wirtschaftsführer weiter: «Der Herdenschutz in einer Bevölkerung ist sehr wichtig.» Denn eine Impfung sei nicht nur eine Schutzmassnahme für einen selber.
Franz: Kampf gegen Corona nur mit Impfung
«Mit einer Impfung trägt jeder, jede auch dazu bei, dass die ganze Bevölkerung geschützt ist.» Und damit auf Einschränkungen verzichtet werden könne. «Insofern schafft eine Impfpflicht Freiheiten an anderer Stelle», gibt sich der Familienvater von fünf Kindern überzeugt.
Ein Impfzwang für die Bevölkerung? Ein Ja vom Roche-Präsidenten – eine klare Absage aber von Alain Berset (48). «Eine Impfpflicht ist nicht vorgesehen», stellte der Gesundheitsminister gestern an einer Medienkonferenz klar. Jede Person könne selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen wolle.
Durchimpfungsrate von 60 Prozent angestrebt
Um das Coronavirus langfristig unter Kontrolle zu bekommen, strebe man in der Schweiz eine Durchimpfungsrate von 60 Prozent an, so Berset weiter.
Bis es ein Corona-Impfstoff – vielleicht jener von Biontech/Pfizer – grossflächig auf den Schweizer Markt schafft, dürfte es noch eine Weile gehen. «Die Gesamtsituation wird sich erst Mitte nächsten Jahres verbessern», sagt Roche-Präsident Franz. Zuerst gelte es dann vulnerable, ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen zu impfen. In zweiter Priorität Mitarbeitende im Gesundheitswesen und in den Altersheimen. Schreibt Blick.
Die Argumente sind nicht von der Hand zu weisen: Nicht nur aus der Sicht von Christoph Franz macht ein Impfzwang durchaus Sinn und kurbelt - nur so nebenbei gedacht – erst noch dem Umsatz an. Allerdings ist seine Position politisch – aus meiner subjektiven Sicht zu Recht – nicht umsetzbar: Die Massendemos der Aluhüte wären vorprogrammiert.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.11.2020 - Tag der Kleinkarierten
«Trumpismus» und «blanke Lüge»: Linkes Lager kritisiert FDP-Politiker Stefan Jaecklin wegen Flyer
Der Ton im Badener Stadtratswahlkampf wird rau: Ein Flyer aus den Reihen von Stefan Jaecklin missfällt Benjamin Steiner. Der FDP-Politiker Jaecklin stellt derweil klar dass der Flyer nicht von ihm oder seinem Wahlteam stammt. Gleichzeitig kann er die Aufregung darum nicht verstehen.
Der Flyer, den «Freundinnen und Freunde» des Stadtratskandidaten Stefan Jaecklin (FDP) in Badener Briefkästen gelegt haben, kommt im Lager seines Konkurrenten Benjamin Steiner (Team) gar nicht gut an. «Wahlkampf à l’américaine», und «Welcome Trumpism», lauten Kommentare auf Facebook. Und auch Benjamin Steiner missfällt der Flyer: «Ich finde, er passt vom Stil her nicht zur politischen Kultur in Baden.»
Das A4-Blatt mit dem Titel «Taten statt Worte» vergleicht die Leistungen der beiden Badener Stadtratskandidaten bei verschiedenen Themen wie Umwelt, Verkehr, Gewerbe, Digitalisierung und Steuern. Da der Flyer aus dem Lager von Jaecklin stammt, ist die Liste seiner Erfolge wenig überraschend viel länger als diejenige von Steiner.
«Bei mir wurden viele Positionen weggelassen»
Beim Stichwort Gewerbe beispielsweise heisst es, Jaecklin habe in der Coronazeit dafür gesorgt, dass die Beizen die Gäste im öffentlichen Raum bewirten können; er setze sich für ein vielfältiges Gewerbe für das lebensfrohe Baden ein, und er wolle Baden als weltoffene Pionierstadt weiter entwickeln. Zu Benjamin Steiners Leistungen punkto Gewerbe heisst es auf dem Flyer: «Keine Position im Wahlkampf.»
Benjamin Steiner sagt auf Anfrage: «Meine Positionen zu verkünden, ohne mit mir Rücksprache zu nehmen, finde ich unschön, ja nicht statthaft.» Das Problem aus inhaltlicher Sicht sei, «dass bei mir viele Positionen weggelassen wurden. Ich hätte erwartet, dass die Urheber des Flyers auf mich zukommen, dass ich Stellung beziehen kann».
Dass er beispielsweise bei der Unterstützung des Gewerbes keine Position habe, «ist eine blanke Lüge». Auch die pauschale Aussage, dass er «für Steuererhöhungen» sei, stimme so nicht. «Ich setze mich dafür ein, dass jeder Steuerfranken effizient eingesetzt wird.» Stei- ner äussert sich auch auf einem Video auf Youtube zum Flyer; zu sehen ist, wie er diesen mit seinen Positionen und Leistungen ergänzt.
Stefan Jaecklin versteht die Aufregung nicht
Stefan Jaecklin stellt klar, dass der Flyer nicht von ihm oder seinem Wahlteam stamme; die Urheber seien einige seiner Wählerinnen und Wähler. «Die Initiative kam von privater Seite.» Er könne die Aufregung nicht ganz verstehen, «denn es gilt Meinungsfreiheit, und der Flyer widerspiegelt ausdrücklich die Meinung der Unterschreibenden». Der Inhalt zeige Unterschiede aus Sicht der Unterschreibenden auf, was für die Meinungsbildung im demokratischen Prozess nützlich sei.
Einer der Personen, die den Flyer mitunterzeichnet haben, ist Matthias Bernhard, ehemaliger Präsident der Badener FDP. «Als Mitunterzeichner des Flyers tat ich eigentlich nur, was jede Einwohnerin und jeder Einwohner von Baden auch macht vor einer Wahl: sich informieren über die Stadtratskandidaten.» Die Aussagen auf dem Flyer hätten sich aufgrund einer neutralen Analyse herauskristallisiert. «Grundlagen waren vor allem die beiden Kandidaten-Websites, Zeitungsberichte, Interviews und auch Erkenntnisse aus persönlichen Gesprächen», sagt Bernhard.
Der zweite Wahlgang für die Nachfolge von Sandra Kohler (parteilos) im Badener Stadtrat findet am 29. November statt. Im ersten Wahlgang holte Steiner 3345 Stimmen, gefolgt von Stefan Jaecklin mit 2849 Stimmen. Luzi Stamm (564 Stimmen), der fürs Komitee B. Jäger ins Rennen ging, tritt nicht mehr an. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Die Politik der intellektuell schmalbrüstigen «Eliten» verkommt mit ihrem kleinkarierten Gekeife zum Kindergarten. Und da wundert man sich, dass die «Trumpisten» weltweit derart Erfolg haben? Und die Wahlbeteiligung in der Schweiz im Schnitt dank einer "Leckt mich doch am Arsch"-Stimmung im Schnitt auf unter 30 Prozent fällt!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.11.2020 - Tag er Enthüllungen aus der Jauchegrube
US-Justizminister gibt grünes Licht für Ermittlungen: Trump verspricht «absolut schockierende» Enthüllungen
Noch-US-Präsident Donald Trump kündigt «absolut schockierende» Enthüllungen zu angeblichem Wahlbetrug in Nevada an. Georgias Wahlchef bestätigt illegale Stimmabgaben in seinem Bundesstaat, während US-Justizminister Barr Staatsanwälten grünes Licht für Ermittlungen gibt.
Donald Trump (74) bestreitet weiter seine Niederlage bei der US-Präsidentenwahl und greift zu weiteren Klagen, um das Ergebnis der Abstimmung zu kippen. Im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania greifen seine Anwälte die Stimmauszählung und das System der Briefwahl an.
Trump bekräftigte in einer Serie von Tweets am Montag auch seine Betrugsvorwürfe zu der Wahl in Georgia, Nevada und Wisconsin. Es wurden nach wie vor keine Fälle von Wahlbetrug zugunsten des gewählten Präsidenten Joe Biden (77) bestätigt.
«Nevada stellt sich als Jauchegrube falscher Stimmen heraus», schrieb Trump auf Twitter und versprach «absolut schockierende» Enthüllungen dazu. Twitter versah den Tweet des Präsidenten umgehend mit einem Warnhinweis, weil es sich um eine umstrittene Behauptung zur Wahl handele.
Georgias Wahlchef bestätigt Unregelmässigkeiten
Trump schrieb ausserdem, dass er den Bundesstaat Georgia, in dem Biden vorne liegt, gewinnen werde – «so wie in der Wahlnacht». Biden hatte die Führung übernommen, nachdem die Briefwahlstimmen ausgezählt wurden. Angesichts der Corona-Pandemie hatten vor allem Wähler der Demokraten per Briefwahl abgestimmt. Der stellvertretende Gouverneur des Bundesstaates, der Republikaner Geoff Duncan (45), sagte am Montag im Fernsehsender «CNN», ihm seien bisher keine nennenswerten Fälle von Wahlfälschung bekanntgeworden. Angesichts des knappen Ergebnisses ist ein Neuauszählung in Georgia sehr wahrscheinlich.
Es habe in Georgia sicherlich Fälle illegaler Stimmabgabe gegeben, schrieb der für die Wahlen zuständige Staatssekretär Brad Raffensperger (65) auf Twitter. «Gab es illegale Stimmabgaben?», fragt Raffensperger. «Ich bin sicher, es gab.» Aber es sei unwahrscheinlich, dass sie ein Ausmass gehabt hätten, das ausgereicht hätte, damit Trump den Bundesstaat gewinnen könnte.
Forderungen nach seinem Rücktritt lehnt Raffensperger ab: «Als Staatssekretär werde ich weiterhin jeden Tag dafür kämpfen, dass in Georgia faire Wahlen stattfinden, dass jede legale Stimme zählt und dass illegale Stimmen nicht zählen», schreibt er in einer Erklärung.
US-Justizminister erlaubt Staatsanwälten Ermittlungen zu Wahlbetrug
Inzwischen hat US-Justizminister Bill Barr (70) Medienberichten zufolge Staatsanwälten die Erlaubnis erteilt, Vorwürfe über Wahlbetrug noch vor der Bekanntgabe der Endergebnisse zu untersuchen. Solche Verfahren dürften aufgenommen werden, wenn es «klare und offenbar glaubwürdige Vorwürfe über Unregelmässigkeiten» gebe, die den Wahlausgang in einem Bundesstaat beeinflusst haben könnten, hiess es in dem Schreiben des Ministers an Staatsanwälte. Das berichteten am Montagabend (Ortszeit) unter anderem die «Washington Post» und das «Wall Street Journal».
Normalerweise dürfen Staatsanwälte erst tätig werden, sobald Endergebnisse vorliegen. Das könnte nach der Wahl vom 3. November, je nach örtlicher Rechtslage, noch Tage oder Wochen dauern. Die Bundesstaaten müssen ihre beglaubigten Endergebnisse bis spätestens 8. Dezember nach Washington gemeldet haben.
Republikaner gespalten
In den Klagen von Trump-Anwälten in Pennsylvania geht es zum einen um die Behauptung des Präsidenten, dass den Republikanern die Möglichkeit verweigert worden sei, einen grossen Teil der Stimmauszählung zu beobachten. Ausserdem argumentieren die Republikaner, dass bei der Briefwahl einige Bezirke mit einem hohen Anteil von Demokraten die Regeln gebrochen hätten und das System insgesamt anfällig für Betrug sei. Pennsylvania mit 20 Stimmen von Wahlleuten für die Präsidentenwahl war ein entscheidender Bundesstaat, der Biden zum Sieg verhalf.
Die Chefin der Republikanischen Partei, Ronna McDaniel (47), räumte ein, dass sie nicht wisse, ob die rechtlichen Schritte ausreichen würden, um das Ergebnis zugunsten Trumps zu drehen. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany (32) unterstellte den Demokraten in einer Pressekonferenz, dass diese Betrug gutheissen würden. Der TV-Sender «Fox News», der in den vergangenen Jahren auf der Seite des Präsidenten stand, schaltete daraufhin ab, weil die Vorwürfe nicht belegt seien.
Der einflussreiche Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell (78), sprach am Montag nur von «vorläufigen Ergebnissen» der Wahl. «Präsident Trump hat hundertprozentig das Recht, Vorwürfe über Unregelmässigkeiten zu untersuchen und seine rechtlichen Optionen zu prüfen», sagte er im Senat.
Bisher gratulierten Biden nur vier republikanische Senatoren
Bisher gratulierten auf Seiten der Republikaner nur vier Senatoren Biden zum Wahlsieg: Mitt Romney (73), Lisa Murkowski (63), Susan Collins (67) und Ben Sasse (48). Sie waren schon vorher als Abweichler vom Kern der Republikanischen Partei bekannt – und könnten für Biden als Präsident eine wichtige Rolle spielen, wenn die Republikaner die Kontrolle über den Senat behalten sollten.
Entscheidend dafür dürften Stichwahlen für die beiden Senatssitze in Georgia Anfang Januar werden. Die republikanischen Amtsinhaber David Perdue (70) und Kelly Loeffler (49) forderten den Staatssekretär des Bundesstaates nach dem Wahlergebnis zum Rücktritt auf, weil die Abstimmung schlecht organisiert gewesen sei. Dieser wies die Vorwürfe zurück.
Der amtierende Präsident spricht nach der Wahl vom Dienstag von Wahlbetrug und hofft, Bidens Sieg noch auf dem Rechtsweg zu kippen. Biden war am Samstag aufgrund der Prognosen der US-Medien zum Sieger erklärt worden. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt gratulierten Biden inzwischen zum Sieg. Schreibt Blick.
Der AVZ wäre nicht der AVZ, wüsste er nicht ganz genau, woher The Donald die Informationen über die «absolut schockierende» Enthüllungen aus der Jauchegrube hat: Von ihm selbst! Denn niemand anders als The Donald hat höchstpersönlich tausende von Fake-Stimmzetteln ausgefüllt und abgeschickt. Er posaunte ja seit Monaten über Twitter an seine treuen Anhänger*innen, dass die Briefwahl in den USA ein totaler Fake sei.
Da der AVZ das Geheimnis über The Donalds Informationen nur dank den exzellenten Beziehungen zum NSA kennt, sollten Sie diese AVZ-Enthüllung für sich behalten oder nur hinter vorgehaltener Hand an vertrauenswürdige Bekannte, vorzugsweise Artilleristen*innen, weiterflüstern. Very Secret.
Weniger geheim ist die Tatsache, dass die Demokratie in den USA langsam aber sicher zur Farce verkommt. Darüber sollten wir uns mehr Gedanken machen als über die Befindlichkeiten eines Egomanen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
9.11.2020 - Tag der menschlichen Dummheit
Menschenansammlungen ohne Maske am Bahnhof: «Solche Szenen darf es nicht geben»
Am Bahnhof Aarau kommt es zu Massenansammlungen von Menschen ohne Schutzmasken. Warum schreitet die Polizei nicht ein? Die Stadtpolizei könne nicht immer überall sein, sagt die zuständige Stadträtin.
«Wer durch den Haupteingang den Bahnhof Aarau betreten will, muss sich durch eine unmaskierte muntere Menge meist junger Menschen quetschen, die nicht so aussehen, als wollten sie auf den Zug.» – Dies schrieb am Donnerstag der grüne Grossrat und VCS-Geschäftsführer Christian Keller auf Twitter und postete ein entsprechendes Foto (siehe rechts). Er sei überhaupt kein Freund von Rayonverboten, aber an diesen Tagen würde er Verständnis für solche Massnahmen haben.
Die Menschenmengen fallen auch dem Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales auf. «Ich sehe in Aarau jeden Tag viele Junge auf dem Bahnhofplatz, denen offenbar alles egal ist. Die haben es nicht begriffen», sagte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati kürzlich im AZ-Interview.
Die Aarauer Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, Ressortvorstehende der Abteilung Sicherheit und damit Chefin der Stadtpolizei, schrieb in besagter Twitter-Diskussion zwar auch, dass es «solche Szenen in der aktuellen Zeit nicht geben darf». Stadt- und Kantonspolizei könnten aber «nicht immer und überall vor Ort sein – und man müsse halt eine «korrekte Meldung» machen. «Twitter funktioniert nicht zur Alarmierung», schrieb sie. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Erstaunlich wie sich der Aargauer Regierungsrat Gallati (SVP) vom Masken-Saulus (vor den Aargauer Regierungsratswahlen) zum Masken-Paulus (einen Tag nach den Aargauer Regierungsratswahlen) gewandelt hat.
Was die Masken-Verweigerer*innen anbelangt, lassen wir den Mann sprechen, der für die Beurteilung von menschlicher Intelligenz wie kaum ein anderer prädestiniert ist: «Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.» Albert Einstein
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.11.2020 - Tag des Konjunktivs
Verkauf von Staatsgeheimnissen, eigene «Regierung», Deals mit Herrschern: So könnte sich Trump nach seiner Niederlage rächen
Nach seiner Wahlniederlage könnte Donald Trump seinem Nachfolger arg ins Handwerk pfuschen. Ein US-Polit-Kenner malt düstere Prognosen.
Trump wird wohl alles dran setzen, Geld zu machen und seinem verhassten Nachfolger im Weissen Haus Sand ins Getriebe zu streuen. Das schreibt Garrett M. Graff (39), Historiker und Direktor der Cyber Initiatives am Aspen Institute, im Politmagazin «Politico» und beruft sich auf Interviews mit Historikern, Sicherheitsexperten und Verwaltungsangestellten.
So zitiert er eine Person zum Thema Trump: «Er wird alles tun, um im Gespräch zu bleiben – und er wird immer empörender werden müssen, um gehört zu werden.»
Verkauf von Staatsgeheimnissen
Der Experte traut Trump nach seiner Abwahl das Schlimmste zu:
• Er verkauft Regierungs-Geheimnisse an andere Staaten. Dazu gehören nicht nur Informationen über US-Geheimdienste und Waffenprogramme, sondern auch über die Macken von Staatsführern in der ganzen Welt.
• Trump profitiert von seinem lebenslangen Geheimdienstschutz, um seine Liegenschaften zu bewachen.
• Trump wird von seinem Hotel an der Pennsylvania Avenue aus Bidens Regierung beeinflussen. Die Rede ist sogar von der Bildung einer Art «Schattenregierung» mit seinem treuen Aussenminister Mike Pompeo (56) und seinem Vize Mike Pence (61). Ziel: mit täglichen Politstatements auf einem eigenen TV-Kanal sowie Tweets seine Anhänger aufzuwiegeln.
• Er nutzt seine Beziehungen mit Herrschern wie Erdogan (66), Kim Jong Un (36), Assad (55) oder Duterte (75), um in deren Ländern Trump-Hotels zu bauen und Kohle zu machen.
Nein, den lieben langen Tag lang einfach nur zu golfen, wird Trump nicht passen. Polit-Historikerin Nancy Gibbs (60), die in «The Presidents Club» über das Leben früherer Präsidenten geschrieben hat, sagt über Trump: «Er ist immer noch Anführer einer Bewegung.» Schreibt SonntagsBlick.
Es ist schon unglaublich, wieviel Unsinn man im Konjunktiv schreiben kann. Ich setze noch einen drauf: Trump ist über 70 Jahre alt. Er könnte zum Beispiel auch sterben. In Frieden und in den Armen von Melania.
Nice Sunday.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.11.2020 - Tag der ganz grossen Sorgen
LGBT-Szene in Luzern besonders betroffen – Mehr als nur feiern: Deswegen fehlt jungen Menschen das Nachtleben
Die Clubs sind zu – vielen fehlt es, wieder einmal eine Nacht durchzutanzen und so den Kopf zu lüften. First World Problems? Nicht unbedingt. Denn für einige Menschen geht es dabei um viel mehr als nur Feiern und Tanzen. Ida löste einen Shitstorm aus. Weil die junge Frau sagte, dass sie das Feiern vermisse. Zu sehen war das in einem «ZDF»-Beitrag rund ums Thema Sperrstunde im deutschen Nachtleben. Seit sechs Monaten war Ida an keiner Party mehr, vorher waren es drei Mal in der Woche. «Darauf zu verzichten, geht mir echt ab.»
Idas Worte lösten Hass und Häme aus. «First World Problems» hiess es, begleitet von Kopfschütteln. Als Luxusproblem abgetan auf der einen Seite, gab es auch Verständnis auf der anderen Seite.
Denn Nächte durchzutanzen bedeutet für viele, frei zu sein. Abzuschalten, den Kopf durchzulüften. Für andere heisst es noch viel mehr: So zu sein, wie man ist. Sich nicht verstecken zu müssen, keine Angst vor urteilenden Blicken und Sprüchen haben zu müssen.
Insbesondere für die LGBT-Szene – also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen – sind queere Partys und Treffpunkte Orte, an denen ein sogenannter Safe Space geschaffen wird. Zwei queere Menschen aus Luzern erzählen, was die geschlossenen Clubs für sie bedeuten. Schreibt ZentralPlus.
Diese queeren Menschen haben aber Sorgen! Hat sich der Luzerner Ständerat Damian «packt an. setzt um.» Müller zu diesem weltbewegenden Thema schon geäussert?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
6.11.2020 - Tag des Tribunals
Anklage wegen Kriegsverbrechen – Kosovos ehemaliger Präsident Hashim Thaci festgenommen
Wenige Stunden nach seinem Rücktritt wegen einer Anklage des Kosovo-Kriegsverbrechertribunals ist der ehemalige Präsident des Landes, Hashim Thaci, festgenommen worden. Wie das Tribunal in Den Haag am Donnerstagabend mitteilte, wurde Thaci inzwischen in eine Haftanstalt des Tribunals gebracht. Thaci soll als Oberkommandierender der Untergrund-Armee UCK für Verbrechen an Zivilisten während des Unabhängigkeitskrieges 1998-1999 verantwortlich gewesen sein.
«Ich werde nicht als Präsident vor Gericht erscheinen. Um die Integrität des Staates zu schützen, trete ich heute zurück», erklärte Hashim Thaci auf einer Pressekonferenz in Pristina. Das Kosovo-Sondertribunal in Den Haag habe die bisherige vorläufige Anklage gegen ihn nunmehr bestätigt, sagte er weiter.
Thaci war während des Unabhängigkeitskrieges 1998-1999 Oberkommandierender der kosovo-albanischen Untergrund-Armee UCK gewesen. Die Staatsanwaltschaft des Sondertribunals hatte bereits im letzten Juni gegen ihn und mehrere andere ehemalige UCK-Kommandeure vorläufige Anklage erhoben.
Kurz zuvor hatte auch der Vorsitzende der Präsidentenpartei PDK (Demokratische Partei des Kosovos), Kadri Veseli, bekannt gegeben, dass die Anklage gegen ihn bestätigt wurde. Er begebe sich umgehend nach Den Haag, um den Anschuldigungen entgegenzutreten, schrieb er auf der Webseite der PDK.
Anklage legt Mord, Verfolgung und Folter zur Last
Die vorläufige Anklage vom Juni legte den Politikern schwere Verbrechen in zehn Punkten zur Last, darunter Mord, Verfolgung und Folter. Hunderte Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner, Serbinnen und Serben, Roma und Angehörige anderer ethnischer Gruppen sowie politische Gegnerinnen und Gegner gehörten der Anklage zufolge zu ihren Opfern.
Der heutige Präsident Thaci war damals Oberkommandierender der UCK. Viele Spitzenpolitiker bekleideten in der Miliz Kommandeursposten. Die UCK kämpfte gegen die serbischen Sicherheitskräfte, die das hauptsächlich von Albanerinnen und Albanern bewohnte Kosovo mit Gewalt davon abhalten wollten, sich von Serbien abzuspalten. Schreibt SRF.
Lassen Sie mich Ihnen heute eine wahre Geschichte erzählen, die man durchaus auch als Schmonzette bezeichnen kann. Der ehemalige Präsident des Kosovos und nun als Kriegsverbrecher angeklagte Hashim Thaci lebte während seiner Zeit als «Student» teilweise auch in Luzern.
Es ist ja längst eine Tatsache, dass die Zentralschweiz und mit ihr ganz besonders die Stadt am Fusse des Pilatus dank einer soliden kosovarischen Community sowas wie Pristinas Brückenkopf zur Schweiz darstellen.
Da kann es schon mal passieren, dass ein beinahe 70-jähriger Kosovare, der zuletzt mehrere Jahre in Deutschland lebte, mit Hilfe der vorerwähnten Community nach Luzern zieht. Was auch verständlich ist, sind doch die Sozialleistungen hierzulande wesentlich höher als bei den Germanen. Insbesonders dann, wenn sich der ältere Herr kurz nach seiner Ankunft in Lucerne North auch noch mit einer knapp 25-jährigen, vollverschleierten Roma aus dem Kosovo verheiratet. Formerly known as «Scheinheirat».
Kein Einzelfall. Da wären noch zwei junge, arbeitslose Kosovaren, die urplötzlich in Luzern auftauchen und einen schwunghaften Handel mit Drogen betreiben. Dass die Luzerner Polizei quasi im Wochentakt an ihrer Haustüre klingelt, beeindruckt die beiden nicht wirklich, frustriert aber die Polizei, wie mir ein Polizist hinter vorgehaltener Hand ins Ohr flüsterte.
Doch kommen wir zurück zu meiner Geschichte. Während seinem Aufenthalt in Luzern kaufte «Student» Hashim Thaci ab und zu im Emmen-Center ein. Irgendwann liess er dann eine Jeans-Hose mitlaufen, wurde erwischt und es gab auch eine Verurteilung mit einem Bussenbescheid, der von der Luzerner Presse veröffentlicht wurde. Peanuts. Wer von uns noch nie eine Jeans-Hose geklaut hat, werfe den ersten Stein.
Meine Geschichte hat allerdings einen grossen Haken: Ich kann sie nicht (mehr) beweisen. Es heisst ja so schön, das Internet würde niemanden vergessen.
Falsch: Personen, die in die höheren Sphären der Gesellschaft aufsteigen, vergessen Google & Co. sehr wohl. Der Beitrag über Thacis Jeans-Schmonzette, den ich damals kopierte und über die Jahre hinweg «verhühnerte», ist aus dem digitalen Gedächtnis der Suchmaschinen verschwunden.
Auch das kein Einzelfall. Das Live-Video auf YouTube von Ueli Maurer, der vor laufenden Kameras als Nationalrat im Hohen Haus von und zu Bern ins Mikrofon sabberte «Bei uns in Bern wird ein N... (das N-Wording) noch ein N... genannt», war einen Tag nach der Wahl Maurers zum Bundesrat nicht mehr aufzufinden. Einen Tag vorher, man ahnte ja, dass Maurer «gesalbt» würde, war es noch da gewesen. Ich wollte es sogar runterladen, wurde dann aber durch ein Telefon abgelenkt und verschob den Download auf den nächsten Tag. Da war es allerdings längst weg.
Vor Gott sollen alle gleich sein, sagt der Volksmund. Bei den digitalen Göttern trifft dies in Bezug auf die «Gesalbten» längst nicht mehr zu.
Und ich wage jetzt noch eine Prognose: Thaci wird den Gerichtshof des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag schon bald durch die gleiche Türe wieder verlassen, durch die er hineingekommen ist. Irgendeine Community wird schon dafür sorgen.
Nein, jetzt liegen Sie falsch: Ich bin kein SVP-Sympathisant. Nur Realist.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.11.2020 - Tag der Overdose
Man kann Gott nur danken für dieses Fleckchen Erde
Südtirol ist eine famose Melange aus alpiner Tradition und italienischer Leichtigkeit. Im Herbst leuchtet die Sonne hier noch kraftvoller als im Sommer. Selbst die Kühe auf den satten Wiesen wirken glücklicher als anderswo.
Es ist das Tor zum Süden. Wenn man den Brenner überwunden hat, sieht man den Eisack, der später in die wasserärmere Etsch mündet. Von den Bergen über Meran aus kann man bis in die Po-Ebene schauen. Einmalige Panoramen.
Jeder Bauer auch noch im dunkelsten Tal weiß um den Nutzen und Wert dieser überwältigenden Natur aus Gebirge und fruchtbaren Tälern. Die Armut aus früheren Jahren steckt noch in der einen oder anderen Erinnerung, vielleicht auch in den Knochen. Doch heute ist Südtirol wohlhabend und ein Traumziel vieler – und wird es bleiben.
Noch hängen viele Äpfel an den großen Spalieren. Die Herbstsonne tut ihnen gut. Die meisten Trauben sind dieses Jahr schon geerntet. Die Winter sind trotz Schnee nie sonderlich kalt, und im Herbst wärmt die Sonne auch noch das Herz des größten Griesgrams. Dieses gleißende Licht ist Gold wert. Die schneebedeckten Gipfel und das Blau des Himmels kontrastieren trefflich mit dem vielen Grün. Schreibt DIE WELT.
US-Präsidentschaftswahlen Trump vs. Biden. Corona. Islamistischer Terror. Es ist in Zeiten wie diesen wahrlich schwierig, auch nur einen einzigen Artikel ausserhalb dieser drei Themen in den Medien zu finden.
Doch frei nach Hölderlin («Wo die Not am grössten ist, da wächst das Errettende auch») ist es mir dank meinen Scroll-Fähigkeiten gelungen, einen aufbauenden Artikel jenseits der unerträglichen Overdose von Angst und Schrecken zu finden. Geniessen Sie diesen Ausreisser. Überlassen Sie Heulen und Zähneknirschen den Andern.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.11.2020 - Tag der Huris
Die «Lizenz zum Töten», die wahnhafte Heilsphilosophien an junge Männer ausgeben, ist sehr verführerisch
Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen haben in ihren Ansprachen zum Terroranschlag die richtigen und wichtigen Worte gefunden. VdB betonte, der Angriff "galt dem Leben in einer liberalen Demokratie, das Terroristen offenbar abgrundtief hassen".
Das ist der Punkt. Ja, es handelt sich um einen islamistischen Terroranschlag. Ja, der erschossene Täter war ein junger Muslim mit albanischem Hintergrund, in Österreich geboren, kein Flüchtling oder Asylant, Doppelstaatsbürger und radikalisiert in einem Hinterhofverein, der sich "Moschee" nennt.
Dieser junge Mann hat wüst und willkürlich getötet und schwer verletzt. Es gibt ein Video, wo man sieht, wie er einen jungen Nachtschwärmer im "Bermuda-Dreieck" zuerst mit einem Feuerstoß aus der Kalaschnikow niederstreckt, weitergeht, dann umkehrt und mit einer Pistole endgültig tötet.
Wer macht so etwas? Wer hat diese absolute Empathielosigkeit, diesen verrückten Fanatismus? Viele, viele junge Männer, die für Gewaltideologien empfänglich sind, ist die bittere Antwort. Auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden: Auch bei uns haben sich junge Männer zur SA und SS gemeldet und, verblendet durch eine wahnsinnige Ideologie, aber auch aus bloßer Mordlust, entsetzliche Verbrechen begangen. Die "Lizenz zum Töten", die wahnhafte Heilsphilosophien an diese jungen Männer ausgeben, ist sehr verführerisch.
Und ein früherer Vizekanzler (Anm. AVZ: gemeint ist HC Strache) der Republik, der als junger Bursch mit Neonazis und Waffenattrappen durch den Wald gekrochen ist, hat nur Glück gehabt, dass nichts Ernsteres daraus geworden ist.
Schnittstelle
Dennoch wird gefragt: Warum müssen wir uns das antun, warum haben wir so viele Muslime "hereingelassen", wenn so relativ viele von ihnen unsere westliche Lebensweise und unsere Werte mit Todfeindschaft betrachten?
Es hat sich so ergeben. Nüchtern-realistisch: Zum einen haben wir Muslime geholt – als billige (türkische) Arbeiter vor zwei, drei Generationen. Die damaligen Entscheidungsträger haben sich gesellschaftspolitisch nicht viel dabei gedacht. Zum anderen, auf der grundsätzlichen Ebene: Wir sind ein offener, demokratischer, leidlich humaner, wohlhabender Staat, in dessen näherer und weiterer Nachbarschaft sich dramatische Krisen abspielten. Wir konnten und können dem nicht ausweichen.
Wir haben zehntausende muslimische Bosnier aus dem Jugoslawienkrieg genommen, zehntausende vor der Gewalt fliehende Syrer, Iraker und Afghanen. Oder Kosovaren, oder Albaner ...
Das heißt letztlich, dass wir an einer geopolitisch-kulturellen Schnittstelle liegen und in zwei miteinander verbundene Weltereignisse hineingezogen wurden: die große Flucht- und Migrationsbewegung und den Kampf der muslimischen Gesellschaften um und gegen die Moderne. Hier treffen offene Gesellschaft und totalitäre Muslime aufeinander. Eine historische Auseinandersetzung.
Damit müssen wir mühsam umgehen (lernen). Aber wir können darauf nicht mit autoritären und illusionären Fantasien reagieren ("alle heimschicken!"), sondern nur mit den Mitteln des offenen, demokratischen, leidlich humanen, wohlhabenden Rechtsstaates, der wir sind – und bleiben wollen. Schreibt Hans Rauscher vom DER STANDARD.
Ein realistischer Kommentar von Hans Rauscher ohne die üblichen, verharmlosenden Nebengeräusche. «Nüchtern-realistisch: Zum einen haben wir Muslime geholt – als billige (türkische) Arbeiter vor zwei, drei Generationen» bringt ein wichtiges Detail aus den Fehlern der Vergangenheit auf den Punkt.
Unsere Gier nach billigen Arbeitskräften setzte den Verstand ausser Betrieb. War der Mix unserer Gesellschaft mit billigen Arbeitskräften aus einer Kultur, die von einer archaischen Religion geprägt wird, anfänglich für beide Seiten von Vorteil, änderte sich dies spätestens mit den Nachkommen dieser «billigen Arbeitskräften» der zweiten und dritten Generation, die mehr Loser erzeugten als erfolgreiche Mitbürger*innen. Da mögen vermutlich auch gewisse Ressentiments gegen fremd klingende Namen in unserer Gesellschaft ihren Teil zur heutigen Situation beigetragen haben.
Hinzu kommt, dass sich die Türkei unter Erdogan de facto zu einem islamistischen Staat entwickelt hat, in dem die Scharia längst in gewissen gesellschaftlichen Bereichen angewandt wird. Allerdings nicht im Namen des Propheten Mohammed, sondern basierend auf der Willkür des neuen Sultans vom Bosporus, der von einer Neuauflage des Osmanischen Reichs träumt.
Wir haben aber auch billige Arbeitskräfte aus kulturnahen Ländern wie Italien, Spanien, Portugal usw. geholt, deren Nachkommen sich nicht radikalisiert und als mordende Terroristen entwickelt haben. Nicht die Multikultur an sich ist gescheitert, sondern unsere Naivität gegenüber einer intoleranten Religion, die unfähig ist, sich ähnlich wie das Christentum über Jahrhunderte hinweg zu reformieren. Was irgendwie auch verständlich ist: Würde sich ein aufgeklärter, islamischer Reformer auch nur einer einzigen Zeile im Koran mit modernem Gedankengut nähern, würde augenblicklich über ihn eine Fatwa (Todesurteil) ausgesprochen.
Und nun stecken wir mitten im «Kampf der muslimischen Gesellschaften um und gegen die Moderne», wie Rauscher richtig schreibt, was aber keine neue Erkenntnis darstellt. Das wissen wir schon lange. Doch leider tun sich Demokratien schwer mit Lösungen gegen ein «heiliges Buch», welches das Töten von Ungläubigen nicht nur legitimiert, sondern auch noch mit Jungfrauen (Huris, al-ḥūr, die «Blendendweissen») im Paradies belohnt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.11.2020 - Tag der Worte statt der Taten
Islamistischer Terroranschlag in Wien: Ein Überblick
Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind am Montagabend, zu Allerseelen, vier Zivilisten – zwei Männer und zwei Frauen – sowie ein mutmaßlicher Täter getötet worden. 17 Menschen wurden verletzt, darunter ein 28-jähriger Polizist. Der Anschlag nahm gegen 20 Uhr in der Seitenstettengasse, nahe einer Synagoge, seinen Ausgang, insgesamt gab es sechs Tatorte in der Innenstadt. Die Polizei erschoss einen der mutmaßlichen Attentäter.
Der mutmaßliche Täter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen, mit Sturmgewehr und Sprengstoffattrappe ausgestattet, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen. Man führe intensive Ermittlungen im Umfeld des Täters durch.
Ob es einen oder mehrere weitere Angreifer gibt, ist nach Informationen der Polizei Wien noch Gegenstand der Ermittlungen. Für Dienstagvormittag wurde ein Sonderministerrat und ein Parteien-Krisentreffen einberufen.
Angespannte Lage
Der Anschlag sei sehr gut vorbereitet gewesen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits am späten Montagabend. Die Terroristen seien sehr gut mit Waffen ausgerüstet gewesen. Es herrsche insbesondere in Wien eine "sehr angespannte Sicherheitslage", betonte der Kanzler. Mehrere Angreifer seien nach wie vor unterwegs, der Polizeieinsatz laufe auf Hochtouren.
Schulpflicht ausgesetzt
"Österreich ist seit 75 Jahren eine starke Demokratie", geprägt von Grundwerten wie Toleranz und Rechtsstaatlichkeit, sagte Nehammer auf der Pressekonferenz. Der Anschlag sei ein Angriff auf die demokratischen Werte gewesen. "Das lassen wir uns auf keinen Fall gefallen!", sagt Nehammer und droht schwere Konsequenzen an.
Am Dienstag gibt es keine Schulpflicht in Wien. Der Tag gilt als entschuldigt. Wenn es den Eltern möglich ist, können die Kinder also daheim bleiben. Alle Menschen, die in der Wiener Innenstadt arbeiten sollen laut Innenminister wenn möglich zu Hause bleiben. Die Polizei sorge für die Sicherheit aller. "Die schwere Situation können wir gemeinsam stemmen, wenn wir uns diszipliniert verhalten", so der Innenminister noch in der Nacht auf Dienstag. Dank an Polizisten. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer." Eines müsse klar sein: "Wer einen von uns angreift, der greift uns alle an."
Die Polizei bat eindringlich darum, keine Videos oder Fotos zu verbreiten. Das Verbreiten von derartigen Inhalten in Sozialen Medien gefährdet Zivilisten wie auch Einsatzkräfte, betonte die Polizei. Die Exekutive bittet darum, derartiges Material der Polizei zur Verfügung zu stellen, um sie zu unterstützen. Dazu wurde eine Upload-Plattform eingerichtet.
Sechs Tatorte
Der Terrorakt erstreckte sich auf sechs Tatorte. In der Seitenstettengasse fielen erste Schüsse, in unmittelbarer Nähe der Synagoge. In einem "zeitlichen Zusammenhang", so die Polizei, gab es dann Vorfälle an weiteren fünf Innenstadtorten, alle in räumlicher Nähe zum Ausgangspunkt. Die weiteren Orte waren nach Angaben von Harald Sörös, Sprecher des Innenministeriums, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben. Berichte über eine Geiselnahme in einem Lokal auf der Mariahilfer Straße erwiesen sich als falsch.
Hintergründe unklar
Die Hintergründe des Anschlags waren lange unklar. Montagfrüh wurde ein islamistischer Hintergrund von Innenminister Nehammer bestätigt. Das auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen SITE hatte bereits im Vorfeld auf seiner Homepage einen Jihadisten zu dem mutmaßlichen Anschlag in Wien zitiert: "Jihadist sagt, der Angriff in Wien ist 'Teil der Rechnung' für die österreichische Beteiligung an der US-geführten Koalition", hieß es dort in einem Satz.
Die Attacke löste national wie international zahlreiche Reaktionen des Entsetzens aus. So zeigte sich Bundespräsident Alexander van der Bellen "tief betroffen". "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl ist bei den Opfern, Verletzten und deren Angehörigen", schrieb Van der Bellen auf Twitter. "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen", betonte der Bundespräsident.
Dramatische Szenen
Ein Video zeigte dramatische Szenen aus der Seitenstettengasse. Ein mit einer Langwaffe bewaffneter Mann läuft die Gasse entlang und schießt auf einen vor einem Lokal stehenden Mann, der daraufhin zusammenbricht. Kurz darauf kehrt der Täter zurück und schießt mit einer Pistole aus kurzer Distanz ein zweites Mal auf den am Boden liegenden Mann.
Niemand im Stadttempel
Zum Zeitpunkt des Anschlages dürften sich keine Menschen im Stadttempel in der Seitenstettengasse und in den Räumlichkeiten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) befunden haben. Man habe die Gemeindemitglieder dazu aufgefordert, nicht das Haus zu verlassen, hieß es vonseiten der IKG. Generell rief die Polizei dazu auf, Wohnungen oder Lokale rund um den Schwedenplatz nicht zu verlassen. Schreibt DER STANDARD.
«Der Zusammenprall der Zivilisationen wird die globale Politik dominieren und die gesellschaftlichen Fehler zwischen den Zivilisationen werden die Schlachtlinien der Zukunft sein.» Samuel Phillips Huntington, Autor des Buches «The Clash of Civilizations» (Kampf der Kulturen) aus dem Jahr 1996.
Huntington wurde seinerzeit von den westlichen Rezensenten als «Rassist» gescholten. 24 Jahre später hat der Westen ausser den üblichen und inzwischen unerträglich gewordenen Betroffenheitsarien (https://www.derstandard.at/.../es-ist-unser-europa-wir...) für die täglich stattfindenden Halal-Gemetzel nichts anzubieten.
Salbungsvolle Worte statt einer Strategie gegen den «politischen Islam», wie das inzwischen gängige Narrativ für den islamistischen Terror politisch korrekt lautet. Die wohl dümmste Bezeichnung für die abartige Auslegung einer aus der Zeit gefallenen Religion.
Es gibt keinen «unpolitischen Islam»! Es sei denn, der Koran würde umgeschrieben. Denn das Wort «Laizismus» – die radikale Trennung von Religion und Staat – kommt im heiligen Buch des Islams nicht vor.
Huntington äussert in seinem Buch die pessimistische Prognose, dass «wir (der Westen) dieser Kraft (gemeint ist der Islam) ausser der wirtschaftlichen Überlegenheit nichts entgegenzusetzen haben». Betrachtet man die Versäumnisse des Westens bezüglich Integration von Menschen mit einer vorsintflutlichen (im wahrsten Sinne des Wortes!) Religionsgläubigkeit in den vergangenen Dekaden, könnte Huntingtons Prophezeiung durchaus eintreffen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.11.2020 - Tag der Bratpfannen und Trüllhölzer
Ex-Gardist Dhani B. (40) attackierte Freundin mit Bratpfanne: «So einen Ausraster soll es nie mehr geben»
Einst bewachte er als stolzer Schweizergardist Papst Johannes Paul II. Die letzten Monate verbrachte Dhani B. (40) jedoch im Knast. Nun möchte er alles ungeschehen machen.
Stolz schüttelte Dhani B.* (40) die Hand von Papst Johannes Paul II.: Bei seiner Vereidigung als Schweizergardist im Jahr 2003 war die Welt noch in Ordnung. Der gebürtige Inder, der von einer Schweizer Familie adoptiert wurde, war der erste dunkelhäutige Soldat in der über 500-jährigen Geschichte der Schweizergarde.
«Den Girls fallen fast die Augen aus dem Kopf. Beim Eingang zum Vatikan steht ein dunkelhäutiger junger Gott. Dhani B. aus Hildisrieden», beschrieb BLICK damals seinen Auftritt. Der damalige Kommandant Pius Segmüller (68) war des Lobes voll. 17 Jahre später sitzt Dhani B. in U-Haft in Kriens LU. Wie konnte es so weit kommen?
Landete nach der Garde bei der Fremdenlegion
Segmüllers Nachfolger schloss Dhani B. einige Jahre später wegen Drohungen gegen seine Person aus der Garde aus. Gegenüber BLICK beteuert der Ex-Gardist: «Ich selber wurde bedroht, weil ich Sachen gesehen habe, die ich nicht hätte sehen sollen. Ausserdem wurde ich von Priestern sexuell angemacht.»
Nach seinem Austritt landete der Ex-Gardist bei der französischen Fremdenlegion, die er ebenfalls frühzeitig verliess. Trotzdem wurde er 2013 von der Schweizer Militärjustiz wegen fremden Militärdienstes zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt.
Von diesem Zeitpunkt an ging es für Dhani B. nur noch bergab. Er sprach übermässig dem Alkohol zu und wurde mehrmals wegen kleinerer Vermögensdelikte verurteilt.
«Dhani schwang die Bratpfanne wie einen Tennisschläger»
Trauriger Höhepunkt: Im Januar 2020 ging Dhani B. mit einer Bratpfanne auf seine Freundin los. Die beiden hatten Alkohol getrunken, es kam zum Streit – und der endete mit einer sieben Zentimeter langen Rissquetschwunde am Kopf von Klara C.**. Gemäss ihren Aussagen bei der Polizei habe Dhani B. eine Bratpfanne «wie einen Tennisschläger geschwungen» und ihr gegen den Kopf geschlagen.
Dhani B. bestreitet jegliche Absicht: «Während ich kochte, hatten wir einen blöden Streit. Auch Schimpfwörter sind gefallen. Zu meinem Bedauern bin ich deswegen ausgerastet. Dabei ist dies mit der Bratpfanne passiert.» Bei einem weiteren Vorfall soll er seine Freundin gewürgt haben, was Dhani B. bestreitet.
Aus Gram hat sich der Ex-Gardist einen Bart wachsen lassen
Der einstige Stolz der Schweizergarde möchte alles ungeschehen machen. Mittlerweile wurde er aus der U-Haft entlassen – und geht sofort zum Barbier. «Mein Herz ist seit der Trennung von meiner grossen Liebe in Millionen Scherben zerbrochen», sagt er auf dem Coiffeurstuhl zu BLICK. «Aus Gram habe ich mir im Gefängnis einen Bart wachsen lassen.»
Nun liess er sich im Zürcher Seefeld von Coiffeurmeister René Kaltbrunner seines Bartes entledigen und gleich noch eine Glatze scheren. «Ein passender Start für einen neuen Lebensabschnitt», sagt Dhani B.
«Im Knast nannte man mich Bratpfannenkönig»
Was hat er denn für Erinnerungen an die Zeit in U-Haft? «Durchwachsen. Wissen Sie, wie man mich im Gefängnis genannt hat? Bratpfannenkönig.» Dhani B. hofft nun auf eine angemessene Strafe.
Der Prozess findet Mitte November in Uster ZH statt. Der Staatsanwalt fordert wegen Körperverletzung zehn Monate unbedingt. Diese soll jedoch zugunsten einer psychiatrischen Therapie aufgeschoben werden. «Ich bin bereits in der Therapie und will diese erfolgreich beenden. So einen Ausraster soll es nie mehr geben.» Dhani B. will versuchen, in seinem angestammten Beruf als Personalberater wieder Fuss zu fassen.
«Dies wäre auch mein Wunsch», sagt sein Anwalt Hugo Werren. «Ich hoffe für ihn, dass sein Leben nun in geordneten Bahnen verläuft. Ich werde Dhani auch privat weiter unterstützen.» Schreibt Blick.
Natürlich schlägt man als Mann niemals eine Frau. Weder mit der Bratpfanne noch mit einem sonstigen Gegenstand. Schon gar nicht, wenn man zuvor die Hand des Papstes gedrückt hat.
Andererseits kenne ich Frauen, die ihrem Götter-Gemahl bei längeren Telefonaten ab und zu mit dem Trüllholz winken. Politisch auch nicht wirklich korrekt und könnte vermutlich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingeklagt werden.
Stimmt doch, lieber Res?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.11.2020 - Tag der Millionaros
FC Barcelona droht laut Medienberichten der Konkurs
Dem FC Barcelona droht nach spanischen Medienberichten bereits im Jänner die Zahlungsunfähigkeit, wenn die Spieler um Superstar Lionel Messi nicht auf Teile ihre Gehälter verzichten. Das berichten am Samstag Marca und AS unter Berufung auf eine Meldung des Radiosenders RAC1. Die Verhandlungen zwischen den Club-Anwälten und denen der Fußballprofis hätten demnach am Freitag begonnen.
Bis spätestens 5. November müssten Kürzungen von 30 Prozent vereinbart werden, damit sollen rund 190 Millionen Euro eingespart werden. Zuletzt hatten die Profis das nach Angaben der Zeitungen abgelehnt. Durch die Corona-Pandemie und die fehlenden Zuschauereinnahmen sind die Einnahmen von Barca dramatisch gesunken.
Weniger Einnahmen
Laut den Berichten steht Messi, der nach der Vorsaison die Katalanen eigentlich verlassen wollte, offenbar eine hohe Bonuszahlung zu, da er sich in seinem letzten Vertragsjahr befindet.
Nach dem Rücktritt von Präsident Josep Bartomeu hatte Vorstandschef Carles Tusquets gesagt: "Unser Hauptaugenmerk sind die Finanzen. Die Pandemie hat Barcelona besonders hart getroffen. Der Verein ist von den Zuschauern abhängig, und diese ganzen Einnahmen sind verloren." Schreibt DER STANDARD.
Das Mitleid mit den «Millionaros» hält sich wohl bei den meisten Menschen in Grenzen. Die Corona-Pandemie böte eigentlich die Chance, eine längst fällige Bereinigung der exorbitanten Fussballersaläre vorzunehmen. Die Formel-1, von der Coronakrise ebenfalls stark gebeutelt, macht's vor und begrenzt die Fahrergehälter. Allerdings auf einem sehr hohen Level von 40 Millionen Dollar pro Rennstall.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
31.10.2020 - Tag der Zyniker
Landesweit schon über 2000 Verstorbene: So alt waren die Schweizer Corona-Opfer
52 zusätzliche Corona-Todesopfer wurden am Freitag innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit ist die Grenze von landesweit 2000 Covid-19-Toten überschritten. BLICK zeigt, welchen Altersgruppen die Verstorbenen angehören.
Die zweite Corona-Welle hat die Schweiz voll im Griff.
Die neuen Corona-Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vom Freitag gleichen einem Paukenschlag: 52 zusätzliche Corona-Todesopfer wurden innerhalb von 24 Stunden bekannt. Damit hat die Zahl der tödlich verlaufenen Fälle die Grenze von 2000 überschritten – insgesamt sind inzwischen deren 2037 bekannt.
Wie die Statistik des BAG zeigt, waren die verstorbenen Infizierten zum grössten Teil 80 Jahre und älter. 1421 Fälle gehören zu dieser Alterskategorie. 405 Corona-Todesfälle betrafen Menschen zwischen 70 und 79. Eine Infektion mit dem Coronavirus nahm zudem für 147 Menschen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren ein tödliches Ende.
Jüngere ebenso betroffen
Auch für jüngere Menschen hatte die Erkrankung mitunter tödliche Folgen: So dokumentiert das BAG 48 Fälle, bei denen die Verstorbenen 50 bis 59 Jahre alt waren. Die Altersgruppen der 40- bis 49-Jährigen und der 30- bis 39-Jährigen sind in der Statistik mit je sechs Fällen vertreten.
Bei Menschen im Alter von zehn bis 29 Jahren ist es in der Schweiz bisher zu keinem tödlichen Krankheitsverlauf gekommen. Hingegen ist ein Fall in der Kategorie bis neun Jahre dokumentiert. Dabei handelt es sich um ein Baby, das im Mai im Kinderspital Zürich verstarb. Es hatte sich in Mazedonien mit dem Coronavirus infiziert und starb laut Angaben des Kinderspitals an einer schweren neurologischen Krankheit. Inwiefern das Coronavirus dafür verantwortlich war, blieb damals unklar.
Höchstwert von Neuansteckungen am Donnerstag
Die Zahl der seit Beginn der Epidemie gemeldeten Corona-Infektionen in der Schweiz und in Liechtenstein beträgt inzwischen 154'251. Der am Freitag vermeldete Wert von 9207 Neuansteckungen liegt nur leicht unter dem Allzeitrekord von Donnerstag, als 9386 neue Fälle verzeichnet wurden.
Auch bei den Hospitalisierungen sind die Zahlen weiterhin sehr hoch. Am Freitag wurden 279 Hospitalisierungen gemeldet, am Donnerstag waren es 287. Die Situation ist in vielen Spitälern angespannt. «Ohne weitere Massnahmen reicht es bei den Akutbetten für 15 Tage, bei den Intensivstationen für zehn», warnte Andreas Stettbacher (58) vom Koordinierten Sanitätsdienst des Bundes (KSD) am Dienstag. Schreibt Blick.
Die Sanierung der AHV ist in vollem Gang, wie einige Zyniker zu sagen pflegen. Wir sollten uns in einer zivilisierten Gesellschaft allerdings hüten, die Altersgruppen gegeneinander auszuspielen und nach ihrem gesellschaftlichen Wert zu beurteilen, wie das bei einigen Aluhüten in der Verschwörungs-Szene bereits inszeniert wird.
«Die wären ohnehin gestorben» hört man inzwischen immer öfters. Dieses Argument ist durch nichts zu entkräften. Allerdings könnte man das Gleiche auch kolportieren, wenn ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall stirbt. Irgendwann wäre er gestorben. Denn soweit mir bekannt ist, sind Menschen ausnahmslos dem Verdikt der Sterblichkeit unterworfen.
Gustav Heinemann, der ehemalige Bundespräsident der BRD sagte: «Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt.»
In Zeiten der Corona-Pandemie sind das nun mal die Alten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.10.202 - Tag der verlorenen Eheringe
Bundesrat Cassis äussert sich zu fehlendem Ehering: «Der Haussegen ist intakt»
Hängt bei Aussenminister Ignazio Cassis (59) der Haussegen schief? Kriselt die Ehe mit Frau Paola (57)? Der FDP-Bundesrat trägt nämlich schon seit einiger Zeit keinen Ehering mehr. Und das rund 28 Jahre, nachdem die beiden in der romanischen Kirche San Pietro e Paolo in Biasca TI geheiratet haben. Bis dass der Tod Euch scheidet – so wie es im Tessin nicht unüblich ist.
Doch gottlob ist alles halb so wild! «Ich habe den Ring verlegt und finde ihn nicht. Meine Frau und ich haben zu Hause überall gesucht», verrät Cassis dem katholischen Kirchenportal «kath.ch». Irgendwann komme der Ring wieder zum Vorschein, gibt sich der Bundesrat zuversichtlich.
Und auf den BLICK-Artikel hin gibt Cassis heute via Twitter gleich zusätzlich Entwarnung: «Lieber BLICK, danke für Eure Fürsorge. Der Haussegen ist intakt und wir sitzen immer noch gemeinsam auf dem berühmtesten Sofa der Schweiz», schreibt der Tessiner mit einem Augenzwinkern.
Damit erinnert er auch mit viel Schalk an eine frühere BLICK-Story, die für Furore sorgte. Vor der Bundesratswahl 2017 empfing Cassis BLICK bei sich zu Hause. Den Reportern stach sogleich das bunte Sofa ins Auge – welches danach auch in anderen Medien für Schlagzeilen sorgte. Als «Sofa der Nation» ging es in die Mediengeschichte ein.
Als Ministrant heimlich Messwein probiert
Aber zurück zum «kath.ch»-Interview: Da plaudert Cassis auch sonst aus dem Nähkästchen. Spricht über die Rolle der Religion in seiner Kindheit im Tessin. Dabei wird klar: Als Ministrant hatte er es faustdick hinter den Ohren. «Manchmal haben wir auch etwas Verbotenes getan – zum Beispiel in der Sakristei heimlich etwas Messwein probiert», erzählt er. «Und wenn ich das Rauchfass schwang, wollte ich natürlich möglichst viel Rauch machen.»
Cassis räumt aber auch ein, dass ihn Politik und Religion manchmal in einen Zwiespalt bringen. So hat etwa Papst Franziskus (83) grosse Sympathien geäussert für die Konzernverantwortungs-Initiative, über welche die Schweiz am 29. November abstimmt. Der Aussenminister wiederum ist gegen das Volksbegehren.
Zielkonflikte gehören zu einer Demokratie
«Der Bundesrat lehnt die Initiative ab, obwohl er das Grundziel teilt», versichert Cassis. Er verstehe aber, warum sich Papst Franziskus dafür einsetze. Aber: «Der Bundesrat findet es problematisch, dass Schweizer Gerichte über das Geschehen in anderen Ländern urteilen sollen.» Das verletze das territoriale Prinzip und öffne die Büchse der Pandora. «Was passiert, wenn morgen ausländische Gerichte über Fälle bei uns urteilen?»
In ein ähnliches Dilemma bringt den Katholiken Cassis – auf den ersten Blick – auch die Korrektur-Initiative, die Waffenexporte in Bürgerkriegsländer verbieten will. Das sei heute schon verboten, erklärt der Freisinnige seine Ablehnung.
«Die Industrie darf aber unter sehr restriktiven Auflagen exportieren, weil wir eine Armee haben, die auf eine Rüstungsindustrie angewiesen ist», sagt er weiter. «Wir wollen Frieden, aber auch Sicherheit.» Das sei ein Zielkonflikt. Solche Zielkonflikte gehörten zu einer Demokratie. Schreibt Blick.
Ehering-Lockdown? Ist doch schön, dass in verseuchten Zeiten wie diesen auch mal was zum Schmunzeln im Corona-Irrgarten der Schweizer Presselandschaft gefunden wird.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.10.2020 - Tag der Sniffnasen
Den Luzerner Clubs geht es nun ans Eingemachte
Die erneute Schliessung der Nachtclubs könnte für die Luzerner Betriebe einschneidende Konsequenzen haben. Kann sich der Bund nicht zu einer finanziellen Unterstützung für die Branche durchringen, werden einige wohl in wenigen Monaten vor dem definitiven Aus stehen.
Nun ist es also amtlich: Die Nachtclubs müssen in der ganzen Schweiz ab Donnerstag und bis auf Weiteres schliessen. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch bekanntgegeben. Für einige Betriebe ist deshalb der Punkt gekommen, an dem das Überleben nicht mehr gesichert ist, sollte die Zwangsschliessung andauern. Dies zeigt eine kurze Umfrage bei ausgewählten Clubs in Luzern.
«Wir haben zum Glück noch ein paar finanzielle Reserven. Deshalb steht bei uns eine Schliessung noch nicht unmittelbar bevor», sagt Philipp Kathriner vom Rok-Klub an der Seidenhofstrasse. Ewig könne man aber nicht mehr durchhalten und sei irgendwann auf Hilfe vom Staat angewiesen.
Reserven gehen zur Neige
Ins gleiche Horn stösst Mark Häfliger vom Madeleine an der Baselstrasse. Dieses ist bereits geschlossen, «um die Ausbreitung des Virus zu verhindern», wie der Website des Lokals zu entnehmen ist. «Unser Polster wird bis Ende des Jahres reichen, danach wird es aber kritisch.» Zwar könne man die laufenden Kosten aufgrund der Schliessung des Clubs und der Kurzarbeitsentschädigung nahe auf ein Minimum reduzieren, dennoch würde stetig Geld abfliessen. «Jeder Franken tut extrem weh, so Häfliger. Hauptposten sei die Miete. «Mit unserem Vermieter konnten wir uns auf eine Mietzinsreduktion bis Ende Jahr einigen. Für die Zeit danach muss aber eine neue Lösung her.»
Auch Häfliger macht keinen Hehl daraus, dass nur staatliche Hilfen das Überleben des Madeleine auf lange Sicht sichern können. «Diese müssen à fonds perdu gesprochen werden, sonst geht es nicht», betont er. Einen Covid-Kredit werden wir sicher nicht anrühren und uns verschulden. «Wir kämpfen bis zum letzten Tag und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Bund auch für die Clubs finanzielle Hilfe leisten wird», sagt Häfliger mit Nachdruck. «Falls der Bund aber kein Geld spricht, ist es nahezu aussichtslos.»
Sind wirklich die Clubs das Problem?
Wie bereits in den vergangenen Monaten zeigt man sich im Vegas Club in Kriens einigermassen pragmatisch, auch wenn im Süden Luzerns die Geduld langsam zu Ende zu gehen scheint. «Wir leisten unseren Beitrag, um die Verbreitung des Virus so gut wie möglich zu verhindern», sagt Betreiber Philipp Waldis.
Für den Entscheid des Bundesrates habe man Verständnis, obwohl im Vegas dank des Schutzkonzeptes und der aktiven Teilnahme der Gäste sowie der Mitarbeitenden kein einziger Corona-Fall registriert worden sei. Folglich liege das Problem nicht unbedingt bei den professionell arbeitenden Nachtclubs. «Die Gefahr lauert überall. Jüngste Beispiele zeigen, dass Ansteckungen im privaten Umfeld passieren, wo die Disziplin bei der Einhaltung von Schutzmassnahmen mangelhaft ist», so Waldis.
Wie seine Berufskollegen hadert auch er damit, dass Unterstützungsleistungen für die Branche bislang ausgeblieben sind. «Bund und Kanton haben jetzt die Chance, gute Betriebe zu unterstützen und so am Leben zu erhalten. Denn insbesondere solche Lokale schaffen ein kontrolliertes Umfeld.» Zumal es zu bedenken gelte, dass bei der jungen Generation das Bedürfnis nach Ausgang und Feiern nicht verschwinden wird. Die Jungen würden dieses Bedürfnis an privaten Feiern befriedigen, wo Schutzkonzepte eine untergeordnete Rolle spielen, so Waldis. Schreibt ZentralPlus.
Welch eine Tragödie! Nun müssen halt die Sniffnasen aus den Drogenklitschen – called «CLUB» wie z.B. «Princesse - The Club» – ihre geliebten Drogen-Cocktails und Pülverchen wie Kokain und Crystal Meth wieder über das private Konto bei Instagram bestellen und irgendwo zwischen Luzerner Bahnhof, KKL, Inseli und neuerdings auch am Mühleplatz direkt beim Dealer abholen. Und nicht mehr beim Türsteher vom Balkan.
Aber bitte mit Maske!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.10.2020 - Tag der chinesischen Diktatur
China stellt alle Industrienationen in den Schatten
Zuerst wütete das Coronavirus in China. Während sich Covid um den Erdball ausbreitete, begann China mit der Lockerung von Massnahmen. Heute steht das Land politisch und wirtschaftlich stark da - auch dank der Rückschläge, die der Westen wegen der Viruskrise erleidet.
China, mutmassliches Ursprungsland der globalen Coronavirus-Pandemie, scheint diese grösstenteils überstanden zu haben. Die Welt hatte den Atem angehalten, als im Januar Bilder um die Welt gingen, wie China mit dramatischen Massnahmen das Virus bekämpfte. Kaum jemand im Westen hätte damals zu träumen gewagt, dass sich das Virus längst über den Erdball auch nach Europa eingeschleppt hatte und in ein paar Wochen Lockdowns folgen sollten. Jetzt steht Europa womöglich vor einer neuen zweiten Welle von Lockdowns. Und die Chinesen haben das Virus längst unter Kontrolle gebracht.
Ein harter Lockdown war es, mit dem China Covid-19 in den Griff bekam. Offiziell gibt es kaum noch Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus. Experten zufolge ist dies umfangreichen Testkampagnen, konsequenter Nachverfolgung von Fällen und drastischen Quarantäne-Regeln zu verdanken - teils harsche Massnahmen, die in dem Überwachungs- und Polizeistaat China möglich sind. Persönlichkeitsrechte sind nebenrangig, Datenschutz gibt es nicht. Menschen können einfach gezwungen werden.
Schon, da und dort gibt es ab und zu wieder lokale Infektionsherde. Bei einer Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen sind diese zu vernachlässigen. Masken werden noch immer getragen, doch Abstandsregeln nicht mehr eingehalten. In Chinas Städten herrscht das übliche Gedränge und Markttreiben wie vor Covid. Es finden Partys, Kongresse, Veranstaltungen statt. China hat zudem längst mit Impfkampagnen begonnen; mit Impfstoffen, die nach westlichen Standards noch nicht genehmigt wären.
China stellt alle Industrieländer in den Schatten
Was den Ursprung des Virus angeht, gibt sich die chinesische Führung verschlossen. Einer Aufklärungsmission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Einreise verboten. Berichterstattung im Land über die Hintergründe der Pandemie wird behindert.
Während der Westen unter neuen Ausgangssperren, Wirtschaftseinbrüchen und teils drastischen Massnahmen leidet, scheint China politisch und wirtschaftlich noch gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen. Der Einbruch in ersten Jahresquartal ist längst überwunden. Nach offiziellen Zahlen ist die Wirtschaft im dritten Quartal um robuste 4,9 Prozent gewachsen. «China ist die einzige grosse Volkswirtschaft auf der Welt, die einigermassen unbeschadet aus der Corona-Krise herauskommt», zitiert die «FAZ» Jörg Zeuner, Chefökonom von Union Investment.
Auch wenn Chinas offizielle Wirtschafts- und Corona-Zahlen mit Vorsicht zu geniessen sind: China stellt derzeit alle Industrieländer in den Schatten. Laut chinesischen Ökonomen wird ihr Land die USA im Jahr 2032 als die grösste Wirtschaftsmacht der Welt ablösen. Ein Aufstieg, den das China-Virus vielleicht noch beschleunigt. Schreibt Blick.
Ein Aufstieg (zur grössten Wirtschaftsmacht der Welt), den das China-Virus vielleicht noch beschleunigt. Schreibt Blick. Das wird wohl unzählige Verschwörungstheorien auslösen. Worauf Sie, ja genau Sie, jetzt einen fahren lassen dürfen. Aber nur, wenn Sie eine Schutzmaske (aus China) tragen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.10.2020 - Tag der Aluhüte
Nach Festnahme von Corona-Skeptiker in Ebikon: Ueli Maurer kritisiert «Wegsperrungen»
Bundesrat Ueli Maurer sorgt in seiner Rede an der Delegiertenversammlung der SVP für Verwirrung. Beim Thema Corona kritisiert er die Intoleranz gegenüber abweichenden Corona-Meinungen – und greift zu harten Aussagen.
Vergangenen Samstag fand die Delegiertenversammlung der SVP statt. Diese wurde coronabedingt im Internet gestreamt und somit digital abgehalten. In der Rede von Ueli Maurer wird das Thema Corona thematisiert. Der Finanzminister zeigt sich dabei echauffiert, was die Intoleranz gegenüber anderer Meinungen in Sachen Corona-Massnahmen angeht.
In einem Video, das einen Ausschnitt seiner Ansprache zeigt und die Partei auf Facebook postete, spricht er von Briefen, die ihm dies mitteilen: «Ich erhalte oft Briefe von Leuten, die mir genau das sagen – sie sind anderer Meinung, sie möchten das zum Ausdruck bringen. Und sie werden weggesperrt», erklärte er im Video. Ein Satz, den er immer häufiger zu hören und zu lesen bekomme, sei, «me dörfs e fäng nömme lut säge.» «Das ist etwas ganz gefährliches in einer Demokratie», so der Magistrat.
Er nimmt Bezug auf einen kurzen Film, den er im Internet gesehen haben soll. Dabei handelt es sich um einen Clip, der der «Luzerner Zeitung» vorliegt. Es zeigt die Festnahme eines Demonstranten, der sich mit zirka 50 weiteren Personen vor einem Schulhaus in Ebikon versammelt hatte, um gegen eine vermeintliche Maskenpflicht in der Schule zu plädieren (zentraplus berichtete).
Bundesrat äussert sich nicht zur Aussage
Maurer zeigt sich nicht sehr glücklich über die Botschaft, die er diesem Video entnimmt: «Solche Dinge tun mir weh in einer Demokratie», sagt er später an der digitalen Delegiertenversammlung. Es steht nun die Frage im Raum, ob Ueli Maurer tatsächlich glaubt, dass Menschen «weggesperrt» werden, weil sie bei Corona anderer Meinung sind. Die «Luzerner Zeitung» schreibt in einem Beitrag, dass Maurers Sprecher auf Anfrage nur folgendes entlocken liess: «Auf die Äusserungen von Bundesrat Maurer an der SVP-Delegiertenversammlung gegen wir nicht näher ein.»
Der Clip von der Festnahme an der unbewilligten Demonstration im Luzerner Ebikon kursiert seit mehreren Tagen in den Social Media. Auf Facebook hat er bereits 400’000 Aufrufe. Gegenüber der «LZ» erklärte Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, dass die Demonstration nicht bewilligt war. Die Polizei habe die Demonstrierenden mehrfach mündlich abgemahnt – also dazu aufgefordert, den Platz vorläufig zu verlassen.
Bewilligung hätte eingeholt werden können
«Die Person hat trotz mehrmaliger Aufforderung, den Platz zu verlassen, sich nicht daran gehalten. Deshalb wurde sie vorläufig festgenommen», meint Bertschi gegenüber dem Blatt. Am Nachmittag des Demo-Tages soll der Mann wieder entlassen worden sein.
Bei der Person, die verhaftet wurde, handelt es sich um einen bekannten «Coronarebellen». Er soll bereits zuvor als Redner bei verschiedenen Demonstrationen von Coronaskeptikern aufgetreten sein. Bertschi führt aus: «Die Verhaftung hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass die Luzerner Polizei abweichende Meinungen nicht tolerieren würde. Der Punkt ist die fehlende Bewilligung. Die Organisatoren hätten ohne Probleme bei der Gemeindebehörde eine Bewilligung beantragen können.» Schreibt ZentralPlus.
Oh heilige Maria Mutter Gottes! Was hat der denn geraucht? Die Partei der Aluhüte* ausser Rand und Band?
Immerhin zitiert Maurer diesmal kein (falsches) Einstein-Zitat. Und das ist doch schon mal ein Fortschritt.
* Einzelne Teilnehmer der Demonstrationen zu Schutzmassnahmen gegen die COVID-19-Pandemie (auch «Hygienedemos» genannt) tragen Aluhüte als Reappropriation des Schimpfworts, mit dem sie sich von etablierten Medien belegt sehen. Zahlreiche Artikel zu den Verschwörungstheorien um COVID-19 wurden mit Fotos von Demonstranten mit Aluhüten bebildert. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wurde bei einer Demonstration in Pirna im Gespräch mit einem Mann mit Aluhut abgebildet. Eine Demonstrantin in Wien sagte dem Standard, sie trage den Aluhut, damit sie «frei denken könne». Einige Demonstranten trugen Kugeln aus Alufolie, sogenannte «Querdenker-Bommel», um ihre Kritik an dem Umgang der Regierung und der etablierten Medien mit der Pandemie zum Ausdruck zu bringen. Quelle: Wikipedia
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
26.10.2020 - Tag der Symptome
Ein zuverlässiger Indikator hilft bei Erkennung:Ist es Corona oder bloss ein Pfnüsel?
Herbst, Zeit von triefenden Nasen, Erkältungen, Grippe. Neu drohen dieses Jahr auch Covid-Infektionen. Wie weiss man, ob man bloss Schnupfen hat? Eine Studie verrät, auf welches Symptome speziell geachtet werde muss, um eine Coronavirus-Ansteckung zu erkennen.
Die Verunsicherung ist gross. Covid-Symptome können auf den ersten Blick ähnlich wie bei typischen Erkältungskrankheiten sein. Das kühlere, feuchte Herbstwetter ist zudem wieder die Zeit von triefenden Nasen, Pfnüsel, Erkältung, Grippe. Wie weiss man, ob man bloss einen Schnupfen oder das neuartige Coronavirus aufgelesen hat?
Das University College London (UCL) hat eine Studie herausgegeben, die hilft, Corona von üblichen Erkältungen und Grippe zu unterscheiden. Die schlechte Nachricht vorab. Symptome von Covid-19 allein liefern keine verlässlichen Hinweise, ob es sich um eine Corona-Infektion handelt oder nicht. Viele Leute, die positiv auf das Virus testen, weisen keine Symptome auf. Nur ein Test kann Gewissheit schaffen.
Doch im Zweifelsfall, wenn die Nase zu tropfen beginnt oder erster Husten auftaucht, ist die Studie allemal hilfreich. Ein Symptom steht dabei besonders im Fokus: der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. 567 der untersuchten 590 Personen, die plötzlich ihren Geruchs- oder Geschmackssinn verloren, wiesen Coronavirus-Antikörper auf.
Das entscheidende Symptom
Die infizierten Probanden der Studie beklagten sich zudem über folgende Symptome:
• Halsschmerzen
• Fieber
• Husten
• Bauchschmerzen
• Schweissausbrüche
• Muskelschmerzen
• Kopfschmerzen
• Atembeschwerden
• Brustschmerzen
Je mehr dieser Symptome und je stärker sie auftreten, desto wahrscheinlicher ist eine Corona-Infektion. Der zuverlässigste Indikator bleibt der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, sagt Studienleiterin Rachel Batterham.
Wenn selbst Knoblauch nicht mehr riecht
Man soll auf einen Geruchsverlust achten, rät die Professorin, ohne eine verstopfte oder triefende Nase zu haben. «Alltägliche Dinge wie Parfüm, Waschmittel, Zahnpasta oder Kaffee riechen plötzlich nicht mehr», sagt sie.
Wer also selbst bei frischem Knoblauch nichts mehr riecht oder bei scharfem Chili nichts mehr schmeckt, der hat höchstwahrscheinlich keine gewöhnliche Erkältung oder Grippe aufgegriffen.
Wer plötzlich nichts mehr riecht und schmeckt, sollte von einer Sars-Cov-2-Infektion ausgehen, sich selbst isolieren, mögliche Kontaktpersonen ermitteln und einen Test machen, der Gewissheit bringt. Batterham fordert gar, dass der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns von Regierungen weltweit als Kriterium für Selbstisolierung, Test und Ermittlung von Kontaktpersonen in Betracht gezogen wird. Schreibt Blick.
Gut zu wissen, dass es in der Flut der Corona-Artikel auch sowas wie sinnvolle Beantwortung wesentlicher Fragen gibt. Ohne Alarmismus.
Nun frage ich mich, wie ich mich verhalten muss, der ich all die oben aufgeführten Symptome mit mir herumschleppe. Allerdings seit zehn Jahren.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.10.,2020 Tag der Leckerbissen
Peach Weber (68) über Corona, Marco Rima und 44 Bühnenjahre: «Virus greift Hirn von Schweizer Komikern an»
Peach Weber blickt auf eine erfolgreiche Komiker-Karriere zurück. Bis zu seinem Ruhestand gibt er sich noch sieben Jahre. Was danach kommt, lässt er offen. Sehr alt möchte er aber nicht werden.
Die ganze Schweiz kennt seinen Namen: Peach Weber (68) sorgt auch in seinem 44. Jahr auf der Bühne quer durchs Land für Lacher. Während des Corona-Lockdowns im Frühling hat er an seinem 16. Programm gearbeitet, trotzdem lässt er die Pandemie bei seinen Witzen aussen vor. «Mir war damals schon bewusst, dass das eine langwierige Angelegenheit wird», sagt er. «Darum denke ich, dass die Leute gerne mal etwas anderes hören möchten. Witze über WC-Papier wurden zur Genüge gemacht.»
SonntagsBlick: Sie standen mit Ihrem neuen Programm «Gäxplosion» in diesem Jahr bereits auf der Bühne, obwohl Sie gemäss eigenen Angaben gleich wegen vier Faktoren zur Corona-Risikogruppe gehören. Wie war das?
Peach Weber: Ich hatte mich entschieden, nicht alles auf 2021 zu verschieben, da auch in diesem Jahr Events stattfinden sollen. Bei den wenigen Auftritten war die Stimmung sehr gut, man hätte sogar eine CD-Aufzeichnung machen können. Derzeit verzichte ich aber auf Selfies und Autogramme. Das war für die Groupies sehr hart, aber sie haben es überlebt (lacht). Schliesslich gehören sie alterstechnisch auch zur Risikogruppe.
Wie schützen Sie sich?
Privat bin ich sowieso ein Stubenhocker und sehr gerne zu Hause, da gibt es für mich nicht viele Gefahren. Ich reise nur wegen meiner Auftritte. Medientermine mache ich von daheim aus per Videokonferenz. Nur für drei Minuten Radiozeit fahre ich nicht in ein Studio. Da haben aber alle Verständnis dafür.
Kollegen wie Marco Rima und Andreas Thiel sind bei Anti-Corona-Demos aufgetreten. Haben Sie Angst um den Ruf von Schweizer Komikern?
Da mache ich mir keine Sorgen, die machen sich selber lächerlich. Ich vermute, dass neben dem Coronavirus noch ein zweites Virus umherschwirrt und das Hirn von Schweizer Komikern angreift. Es ist wirklich sehr seltsam, auch den Angriff von Rob Spence auf Patrick Frey finde ich Kindergarten. Das scheint wohl zu passieren, wenn man Komiker zu lange einsperrt. Dann müssen sie den Blödsinn irgendwo anders machen. Ich habe vollstes Verständnis, wenn Berufskollegen Existenzängste haben. Aber es ist nicht die schlauste Art, bei Corona-Demonstrationen auf sich aufmerksam zu machen.
Empfinden Sie als Teil der Risikogruppe diese Auftritte als Affront?
Nein. Ich habe ja immer gesagt, ich kenne keinen Komiker, der länger als zehn Jahre gut im Geschäft ist, der nicht intelligent ist. Aber zum Staunen brachten mich die Auftritte schon. Als öffentliche Person sollte man sich genau bewusst sein, wo man mitläuft und mit welchen Menschen man sich zeigen will.
Die Eventbranche liegt flach. Wie gross sind Ihre finanziellen Sorgen?
Mein Ziel war immer, dass ich im Alter nicht von der AHV abhängig bin. Ich war ja zuerst acht Jahre als Lehrperson tätig, danach habe ich mir stets den Lehrerlohn als Richtlinie für mein Leben als Komiker gesetzt. Sonst hätte ich damit wohl irgendwann aufgehört und das nicht 44 Jahre durchgezogen. Ich habe ja keine weltbewegende Message, die ich in die Welt hinaustragen will.
Sie bezeichnen Ihre Arbeit auch nicht als Kunst.
Genau. Ich muss lachen, wenn andere, die genauso Pausenclowns sind wie ich, sich als Künstler bezeichnen. Was ich mache, ist Verbrauchsunterhaltung. So wie ein Bäcker Brötchen verkauft, verkaufe ich Gags.
Wie sparsam sind Sie?
Ich bin mit relativ wenig zufrieden. Ich reise nicht gerne, ich habe kein Ferienhaus, Golf spiele ich nicht. Wenn ich ab und zu ein paar Vorstellungen geben kann, bin ich zufrieden.
Haben Sie sich jemals gewünscht, nicht berühmt zu sein?
Nein, ich finde das Unsinn, wenn Menschen das Rampenlicht suchen und sich danach beschweren, dass man auf der Strasse erkannt wird. Klar, ich bin jetzt nicht Justin Bieber. In der Schweiz läuft das alles ohnehin gesittet ab. Das Herzigste ist, wenn Menschen sich bei mir für die Witze bedanken, die sie in schweren Zeiten zum Lachen gebracht haben. Mühsam wird es nur, wenn jemand betrunken ist. Aber ich gehe ja auch nicht um Mitternacht in eine Festhütte.
Sie wohnen allein in Ihrem Haus. Sind Sie ein Hausmann?
Das wäre wohl zu viel gesagt, ich habe ja weder einen Hund noch mehrere Kinder. So gibt es nicht viel zu putzen, ich selber bin stubenrein.
Wie sieht ein Tag bei Peach Weber aus?
Wenn ich einen Auftritt habe, richte ich den ganzen Tag darauf aus, abends eine gute Leistung bringen zu können. Wenn ich freihabe, mache ich oft freiwillige Quarantäne und arbeite mehrere Tage zu Hause an meinen Projekten. Nach Lust und Laune schreiben, Kafi trinken, Rasen mähen – das nenne ich dann Klostertage.
Wie gut können Sie kochen?
Für mich reichts (lacht). Oft gehe ich ins Restaurant, aber Salat, Gschwellti, Spaghetti und Gemüseeintopf koche ich mir abends selbst. Meine Tochter und ihre Freundinnen schwärmen zudem seit der Kindheit von meinen panierten Plätzli. Bis heute kommen sie regelmässig, wenn ich das koche. Sie nennen es «Göttlichs», nach einem Rezept, das ich von meiner Mutter erhielt.
Wann waren Sie zuletzt in den Ferien?
Wohl vor etwa zwanzig Jahren auf Mallorca. Ich reise nicht gerne, und mir ist es egal, ob ich meine freie Zeit am Hallwilersee oder auf den Malediven verbringe. Das Schlimmste, was man mir schenken kann, ist ein Gutschein für ein Wellnesswochenende.
Wieso?
Wellness macht mich nervös. Wenn man dort ist, hat man schon im Kopf verankert, dass man sich nun erholen muss. Mir sagen die verschiedenen Massagen und Saunabesuche einfach nichts. Ich bin danach nicht entspannter. Da bleibe ich lieber zu Hause oder gehe Pétanque spielen.
Wie schauen Sie fern?
Fast gar nicht. Die grösste Erfindung ist für mich die Replay-Funktion, so hole ich Dokumentationen und Talksendungen, wie jene von Markus Lanz, nach. Aber ich könnte mir beispielsweise keinen Film anschauen. Es gibt keinen Streifen, der mich zwei Stunden fesselt.
2027 stehen Sie für Ihre Abschiedsvorstellung im ausverkauften Hallenstadion auf der Bühne. Wird der Auftritt wegen der Corona-Pandemie nun verändert daherkommen?
Ich bin eine optimistische, aber informierte Person. Ich glaube daran, dass irgendwann wieder alles gut kommt und mein Auftritt so stattfinden kann, wie ich das beim Vorverkaufsstart 2009 angedacht habe. Das beste Beispiel ist die Spanische Grippe vor hundert Jahren. Die wütete zwei Jahre, und seither gab es bei uns nichts Vergleichbares mehr. Wahrscheinlich ist das jetzt ein ähnliches Kaliber.
Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
Der kommt wohl von meiner Mutter. Sie hatte immer ein gutes Gemüt und ging alles positiv an. Ein Urvertrauen, das ich auch meiner Tochter mitgeben wollte, das kann Kraft geben bis ans Lebensende.
Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Ich plane nie so weit voraus – der Auftritt im Hallenstadion 2027 bildet die Ausnahme und ist aus einer Idee meines Bruders entstanden, sonst mache ich das nie. Bis zum Jahresende fände ich es schön, wenn wir die angekündigten sechs Vorstellungen noch irgendwie über die Bühne bringen könnten. Längerfristig will ich in drei Jahren ein weiteres Programm herausbringen und 2027 dann das letzte. Ein Best-of wird es von mir nicht geben. Ausser es kommt mir wirklich nichts Neues in den Sinn.
Wovon träumen Sie?
Ich habe keine grossen Träume. Sicher ist: Ich will nicht hundert Jahre alt werden. Es ist eine unpopuläre Meinung, aber ich finde es eine schlechte Entwicklung, dass die Menschen immer älter werden. Ich missgönne alten Leuten ihren schönen Ruhestand überhaupt nicht, aber ich will nicht zehn Jahre Schmerzen haben, bis ich dann irgendwann sterbe. Heute gibt es zum Glück Sterbehilfe-Organisationen. So weiss man, dass es in einer schlimmen Situation, aus der man keinen Ausweg sieht, Hilfe gibt und man nicht von der Brücke oder vor den Zug springen muss.
Haben Sie Angst vor dem Tod?
Nein, aber vor einem mühsamen Sterben. Der Tod ist ja die Quittung für unsere Geburt, das sollte keinen überraschen. Aber die Vorstellung, über einen längeren Zeitraum zu leiden, bevor ich erlöst werde, macht mir Angst.
Sind Sie Mitglied einer Sterbehilfeorganisation?
Ja, bei Exit. Und es ist ja nicht so, dass plötzlich alle Leute deren Hilfe in Anspruch nehmen möchten, wenn das Thema enttabuisiert ist. Niemand ruft Exit an, weil er am Montagmorgen Kopfweh hat. Das ist ein langwieriger Prozess, den sich die Betroffenen bestimmt sehr gut überlegen. Übrigens: Einmal pro Woche gehe ich auf den Friedhof.
Wieso?
Das mache ich seit meiner Kindheit. Damals hat meine Grossmutter das Familiengrab betreut und hat mich mitgenommen. Darum war das nie ein negativer Ort. Ich wusste zwar, dass dort tote Menschen begraben sind, trotzdem herrscht dort für mich bis heute stets eine friedliche Atmosphäre. Mich fasziniert es, dass Menschen, die ein Leben lang Streit hatten, plötzlich drei Gräber voneinander entfernt friedlich liegen.
Was wünschen Sie sich fürs nächste Jahr?
Dass die Corona-Pandemie abflaut und die Wirtschaft, insbesondere auch die Eventbranche, wieder einigermassen ins Rollen kommt.
Würden Sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen?
Nicht als Erster, eine Grippeimpfung habe ich noch nie gemacht. Aber wenn der Bund das empfiehlt und es gute Studien über die Wirksamkeit und Nebenwirkungen gibt, würde ich das wohl tun. Schreibt SonntagsBlick.
Marco Rima und Andreas Thiel Komiker zu nennen ist eine Beleidigung für jeden Komiker. Die beiden schrägen Verschwörungstheoretiker mit dem ultrarechten, rassistischen und leicht faschistoiden Gedankengut sind eher der Kategorie «Leckerbissen für die Psychiatrie» zuzuordnen. Man sollte sie totschweigen und in eine psychiatrische Anstalt überweisen, wo sie – mit etwas Glück – auf Kosten der Krankenkasse möglicherweise genesen könnten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.10.2020 - Tag der Nathalie
Natalie Rickli mimt in der «Arena» die neue «Mrs. Corona» – und lässt die Experten alt aussehen
Eine klare Kommunikation ist in einer Krise essentiell. In der zweiten Corona-«Arena» in Folge gab es unter den Studiogästen nur eine, die mit Ehrlichkeit und konkreten Aussagen punkten konnte.
Vor einer Woche warnte Michael Salathé, Epidemiologe in der Task Force des Bundesrates, in der SRF-«Arena» vor den hohen Hospitalisierungszahlen und der Gefahr, in einen erneuten Lockdown zu steuern. Beruhigt hat sich die Situation seither nicht. Die täglichen Infektionszahlen haben auch diese Woche ungebremst zugenommen. Mehrere Schweizer Kantone haben in Eigenregie strengere Massnahmen beschlossen. Am Freitagnachmittag rechnete Martin Ackermann, Leiter der Corona-Task-Force, dass die Schweizer Intensivstationen im schlechtesten Fall am 5. November voll sein werden.
Kein Wunder also machte SRF-Moderator Sandro Brotz das Coronavirus erneut zum Mittelpunkt seiner Sendung. «Packen wir es jetzt?», wollte er von seinen Studiogästen wissen – und muss wohl wenig erleuchtet in den Feierabend gegangen sein. Denn so richtig konnte ihm diese Frage niemand beantworten.
Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) verlangte, dass nun der Bund das Ruder wieder verstärkt übernimmt. Die FDP-Nationalrätin und Direktorin der Zürcher Handelskammer, Regine Sauter, machte klar, dass ein zweiter Lockdown für die Wirtschaftsvertreter keine Option ist. Manuel Battegay, Infektiologe und Mitglied der Task Force mahnte, es sei nun eher fünf nach zwölf statt fünf vor. Und das Anliegen von CVP-Nationalrätin und Präsidentin der Gesundheitskommission, Ruth Humbel, blieb irgendwie diffus zwischen verschiedenen Argumentationslinien verborgen.
Staatsfrauisch trat Rickli auf. In den vergangenen Wochen hatte die SVP-Politikerin viel Kritik einstecken müssen. Weil das Contact Tracing im Kanton Zürich nicht funktioniere, ihr das Wasser bis zum Hals stehe, sie zu wenig Erfahrung habe, um Herrin der Lage zu sein.
Einen anderen Eindruck hinterliess sie in der «Arena». Überraschend transparent beschrieb sie, wie hart der Bund und die Kantone arbeiten, um die Situation in den Griff zu bekommen. Konzepte dazu gebe es gewiss, doch jedes Mal wenn man eines davon aus der Schublade ziehe, sei man schon wieder einen Schritt hinterher.
Es sei richtig gewesen, dass der Bund im Sommer den Lead an die Kantone zurückgegeben habe. Doch jetzt sei der Moment gekommen, wo eine nationale Strategie nötig sei und der Bundesrat das Zepter – in enger Absprache mit den Kantonen – wieder übernehmen müsse.
Angeschossen wurde Rickli von FDP-Nationalrätin Sauter. Man habe den ganzen Sommer über Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Warum man jetzt so überrascht werde, verstehe sie nicht. Auch nicht, warum das Contact Tracing im Kanton Zürich derart an den Anschlag komme.
Eine Kritik, die Rickli ungern auf sich sitzen liess. Das Hauptproblem seien die hohen Ansteckungen. «Im Kanton Zürich haben wir ein exponentielles Wachstum, eine Verdoppelung der Zahlen alle sechs bis sieben Tage. Da kommen wir mit dem Testen und dem Contact Tracing nicht mehr nach. Eingerichtet waren wir auf hundert Fälle pro Tag.»
Mit dieser Dossierfestigkeit, gepaart mit erfrischender Ehrlichkeit – ein Auftreten, das sie an so manch einem früheren Medienauftritt vermissen liess – konnte die Zürcher Gesundheitsdirektorin punkten. Schreibt die Aargauer Zeitung.
«Arena» – Ist das nicht die Sendung, der die Zuschauer*innen in Scharen weglaufen, in der mediengeile und vom Intellekt befreite Politiker*innen ihre Parteiprogramme herunterleiern und in der alle Beteiligten einander ununterbrochen ins Wort fallen?
Und zu Nathalie Rickli, in Anlehnung an Gustav Mahler: «In der Schweiz wird jede*r das, was er/sie/es nicht ist.» Immerhin sieht sie gut aus. Und das will bei einer SVP-Politikerin etwas heissen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.10.2020 - Tag der Frau Fux
Fux über Sex: «Warum wollen sie nicht vom Oralsex kommen?»
Ich habe es schon oft erlebt, dass eine Frau Oralsex von mir geniesst, aber kurz vor dem Kommen meinen Kopf wegstösst. Also dass sie quasi krampfhaft nicht kommen will. Kumpels von mir ist das auch schon oft passiert. Was könnte eine Erklärung sein? P. (34, m.)
Lieber P.
Über die Erlebniswelten und Beweggründe von anderen Menschen zu spekulieren, ist spannend und verführerisch. Und wenn einem etwas mehrfach passiert und auch andere Leute vergleichbare Erfahrungen machen, dann liegt der Schluss nahe, dass hinter den Erlebnissen ein Muster stecken könnte.
Solche Spekulationen sind allerdings auch immer ziemlich heikel. Denn was genau die betreffenden Frauen in jenem Moment bewegt hat, können schlussendlich nur sie selbst erklären. Immer vorausgesetzt, dass es ihnen überhaupt bewusst und klar ist.
Grundsätzlich kann man sagen, dass der Moment des Orgasmus und die Zeit kurz davor für die meisten Menschen besondere Augenblicke sind. Dabei muss es längst nicht nur um Glücksgefühle gehen. Manche Menschen fühlen sich vielleicht ausgerechnet dann besonders stark beobachtet oder unter Druck, andere fürchten sich vor einem Kontrollverlust. Vielleicht geht es diesen Frauen auch gar nicht um das Abblocken eines nahenden Orgasmus, sondern um etwas ganz anderes.
Lös dich von der Idee, dass diese Frauen grundlos ihr sexuelles Glück sabotieren. Schlussendlich tun sie einfach das, was für sie im Moment am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Frag nach, wenn du wissen willst, wie du noch besser dazu beitragen kannst, dass eine sexuelle Begegnung rundum für beide passt. Das bedingt aber, dass du offen bist und diesen Frauen deine Vorstellung von sexuellem Glück und dem richtigen Ablauf eurer Begegnung nicht aufstülpst. Denn verschiedene Menschen erleben die gleiche Situation oft sehr unterschiedlich. Schreibt Blick.
Es ist schwierig, wirklich schwierig, in Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt noch einen Artikel ausserhalb des Themas «Virus» zu finden. Doch auf Blick ist Verlass. Selbst die abgrundguteste Frau Fux erwähnt die Maskentragpflicht mit keinem Wort. Wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt bei Oralsex.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.10.2020 - Tag der Auslaufmodelle
Orgasmusgarantie hoch 3: Mit diesen Sextoys kommt Frau auf ihre Kosten
Es ist das Gefühl der Gefühle, ein Feuerwerk im Körper – der Orgasmus! Wenn Sie als Frau Ihr Liebesleben auf den Kopf stellen wollen oder Lust auf Solo-Exkurse haben, dann sind diese drei Toys der weltweit bekannten Womanizer-Serie genau das Richtige.
Früher Tabu, heute salonfähig
Sextoys gehören mittlerweile für viele Frauen und Männer zum Liebesleben, egal ob in der Beziehung oder Solo. Gerade für Frauen können die unterstützenden Spielzeuge eine grosse Bedeutung für den Höhepunkt haben. Statistiken belegen beispielsweise, dass in heterosexuellen Beziehungen nur 69 % der Frauen beim Sex zum Orgasmus kommen, während die Männer mit 95 % die Überflieger sind. Wenn Sie als Frau also ein Sextoy suchen mit Orgasmusgarantie, dann können wir diese drei Womanizer-Toys empfehlen – als BLICK-Leserin oder Leser mit dem Rabattcode Blick20 jetzt noch 20 Franken günstiger! Weltweit haben über 6 Millionen Frauen bereits einen dieser Womanizer zu Hause. Schreibt Blick*.
Das männliche Glied, formerly known as Penis, scheint ein Auslaufmodell zu sein. Sechs Millionen Frauen können nicht irren!
Oder wie Manfred Poisel treffend bemerkte: «Der Mensch ist der Joker im Glücksspiel Evolution.»
* Dies ist ein bezahlter Beitrag, schreibt Blick: Der Artikel wird im Auftrag eines Kunden erstellt und von diesem bezahlt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen der Blick-Gruppe. Wir schreiben objektiv über Produkte und Dienstleistungen, von denen wir überzeugt sind, dass sie unseren Lesern gefallen könnten. Der Kunde nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt oder Meinungen im Artikel.
So viel über die Qualitätsanforderungen der Blick-Gruppe und deren «Blick» auf die Leserinnen und Lesern des Zürcher Boulevard-Blättchens.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.10.2020 - Tag der Overdose
Horrorskop & Spiritualität
Wir starten mit guter Laune in den neuen Tag. Wie die Sterne für Sie stehen, verrät Ihnen unser Horrorskop. Schreibt Blick.
Heute einen Beitrag auf den Frontseiten der Schweizer Medien zu finden, der nicht die Corona-Pandemie thematisiert, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die reinste «Overdose» in Sachen Berichterstattung über das Corona-Virus. Eine mediale Übertreibung, die vermutlich viele Menschen mehr irritiert und verängstigt statt aufzuklären.
Immerhin wurde ich bei BLICK fündig mit einer positiven Nachricht: Wir starten mit guter Laune in den Tag.» Auch wenn es sich dabei nur um ein Horrorskop aus Delphi handelt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.10.2020 - Tag der wundersamen Wandlung von Saulus zu Paulus
Gesundheitsdirektor Gallati für einmal rigoroser als der Bund – diese Massnahmen gelten ab 18 Uhr
Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati reagiert auf die steigenden Coronazahlen und verschärft die Massnahmen: 50er-Limite in Clubs und Bars, Kontaktdaten erheben auch an kleinen privaten Anlässen und Maskenpflicht für Erwachsene in sämtlichen Schulgebäuden.
Auch im Aargau sind die Coronazahlen in den letzten Tagen massiv gestiegen: Am Montag meldete der Kanton insgesamt 364 neue bestätigte Ansteckungen in den letzten 72 Stunden. Am Freitag wurden 155, am Samstag 118 und am Sonntag 91 Fälle registriert. Derzeit sind im Aargau 26 Personen mit Covid- Erkrankung hospitalisiert, zwei davon liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. «Wir erleben seit Anfang letzter Woche einen massiven Anstieg der Zahlen und haben am Freitag mit 155 bestätigten Fällen den bisherigen Höhepunkt erlebt», sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel am Montagnachmittag an einer Medienkonferenz.
Seit dem 13. Oktober hat sich die Zahl der Infizierten im Kanton laut Hummel mehr als verdreifacht. Der starke Anstieg bei den Covid-Infektionen wirkt sich auch auf die Zahl der Aargauerinnen und Aargauer aus, die von den Mitarbeitern des Contact-Tracing-Centers in Quarantäne oder Isolation geschickt werden. 400 Personen befinden sich laut der Kantonsärztin in Quarantäne, 230 sind in Isolation.
Contact-Tracing am Anschlag: Kontakte direkt informieren
«Wir haben beim Contact-Tracing die Kapazität stetig ausgebaut, das Team ist heute viermal grösser als am Anfang», erläuterte Hummel. Allein in der letzten Woche habe man zehn neue Mitarbeiter eingestellt, das Team leiste Überstunden am Abend und am Wochenende, man habe die Effizienz gesteigert – und doch stösst die Rückverfolgung und Unterbrechung von Ansteckungsketten im Aargau an Grenzen.
«Es ist möglich, dass einzelne Personen nicht zeitgerecht kontaktiert werden können», räumte Hummel ein. Die Mitarbeiter des Contact-Tracing-Centers setzten Prioritäten und konzentrierten sich primär auf die infizierten Personen. Hummel bat die Bevölkerung um Unterstützung: «Es ist wichtig, dass Infizierte in einem ersten Schritt ihre Kontaktpersonen direkt informieren.»
Zahl der Kontakte möglichst reduzieren
Die meisten Ansteckungen wurden in den letzten vier Wochen am Arbeitsplatz, in der Familie und bei privaten Veranstaltungen registriert. Hummel nannte Grossraumbüros von Banken, Logistikbetriebe und Verteilzentren, in denen es zu Infektionen gekommen sei. Damit die Ausbreitung der Pandemie eingedämmt werden kann, ist es laut Hummel sehr wichtig, dass die Bevölkerung die Zahl der Kontakte möglichst reduziert. Dazu sollen die neuen Coronamassnahmen beitragen, die der Kanton per Allgemeinverfügung erlässt. Diese gehen über die verschärften Regeln des Bundes hinaus und gelten ab Dienstagabend um 18 Uhr.
1) Kontaktdaten erheben: Auch bei allen privaten Anlässen mit weniger als 15 Personen muss der Veranstalter die Kontaktdaten aller Gäste erheben und diese dem Contact-Tracing-Center auf Anfrage liefern. Der Bund verlangt dies erst bei Anlässen ab 15 Personen. «So wird das Contact-Tracing entlastet, wenn wir schnell eine Liste haben, können wir rascher Kontaktpersonen informieren», erläuterte Hummel.
2) Weniger Gäste in Bars und Clubs: Die Besucherzahl in Clubs und Bars wird von bisher 100 auf neu 50 reduziert. Zudem müssen alle Gäste eine Maske tragen – ausser, wenn sie gerade am Essen oder Trinken sind (Reaktionen dazu siehe Kontext links). «Gerade in Bars und Clubs ist die Ansteckungsgefahr relativ hoch», begründete Hummel. Allerdings erfolgen gemäss kantonaler Statistik nur gerade 1,4 Prozent der Ansteckungen in Bars und Clubs.
3) Maskenpflicht in der Schule: Künftig müssen Erwachsene in allen Innenräumen von Schulgebäuden Masken tragen. Die neue Regelung gilt ab Mittwoch, ausgenommen davon sind nur Lehrpersonen, wenn während des Unterrichts im Klassenzimmer die Abstände eingehalten werden können. Das Bildungsdepartement empfiehlt den Schulen ausserdem, auf Schulreisen oder Klassenlager zu verzichten.
Kanton unterstützt Homeoffice-Empfehlung
Für die Durchsetzung der Regeln kann die Kantonsärztin die Polizei beiziehen, Betriebe schliessen oder Veranstaltungen auflösen lassen. Auch das Gesundheitsdepartement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati richtet Empfehlungen an die Bevölkerung. So sollen private Veranstaltungen nur in kleinen Gruppen bis 30 Personen stattfinden. Der Kanton unterstützt die Homeoffice-Empfehlung des Bundes und ruft auf, auch in Grossraumbüros Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern mehr als eine Viertelstunde lang nicht eingehalten werden kann.
Die Verschärfungen und Empfehlungen stützen sich auf die Analyse der Ansteckungsorte. Weil bei Grossanlässen wie Fussballspielen mit mehreren tausend Zuschauern in anderen Kantonen bisher keine Infektionsherde aufgetreten sind, verzichtet der Aargau auf eine Wiedereinführung der 1000er- Grenze. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Eigenartig. Wie sich Gesundheitsdirektor Gallati (SVP) vom Salus zum Paulus wandelt. Eine Woche vor den Aargauer Wahlen wehrte sich Gallati noch vehement gegen eine Maskenpflicht in den Aargauer Läden und Einkaufszentren. Es hätte sich bis jetzt noch nie jemand in einem Laden angesteckt. So sein Argument.
Nun wissen wir, dass es vor allem Anhänger (und Anhängerinnen, um politisch korrekt zu sein) aus den esoterischen Kreisen der SVP waren (Alpenparlament lässt grüssen!), die sich vehement gegen eine Maskentragpflicht sträubten und unselige Verschwörungstheorien verbreiteten. Die Zuger SVP-Fraktion reichte sogar ein dringendes Postulat ein, um die erweiterte Maskenpflicht im Kanton Zug wieder aufzuheben.
Ob Herr Gallati bewusst vor den Aargauer Wahlen den Hardliner in Sachen Maskentragpflicht spielte, sei dahingestellt. Wer Böses denkt, ist für einmal jedenfalls kein Schelm.
Oder um Otto von Bismarck zu zitieren: «Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.10.2020 - Der Tag danach
Coronakrise verdrängt Klima nicht – das half der SP nicht und zwingt die SVP zu neuen Antworten
Der Wahlsonntag bringt drei Erkenntnisse: Der Absturz der SVP ist ausgeblieben. Die grüne Welle lässt sich von der Coronakrise nicht stoppen. Die Tür zum Regierungsrat bleibt für Frauen zu. Wie kam es dazu?
Die Frauenfrage: Das Stimmvolk will kaum partout eine rein männliche Regierung, aber es nimmt bei einer Personenwahl das Geschlecht nicht als allein entscheidendes Kriterium. Christiane Guyer hätte zwar auch das Zeug für den Regierungsrat, hat sich im Wahlkampf aber zu wenig aufgedrängt. Dieter Egli überzeugte mehr, Mann hin oder her. Die SP kann froh sein, dass die Wählenden nicht aus Prinzip eine Frau bevorzugt haben, so wie es die Linken selber sonst gerne einfordern.
Die grüne Welle: Dafür musste die SP im Parlament zu Gunsten der Grünen Federn lassen. Die Genossen können ihre Umweltpolitik noch so herausstreichen: Im Zweifelsfall wählt man das Original. Noch mehr den Nerv der Zeit treffen die Grünliberalen: ökologisch handeln, aber nicht auf Kosten der Wirtschaft. Gerade in der Coronakrise kommt das besonders gut an.
Die SVP-Verluste: Die wählerstärkste Partei hat die psychologisch wichtige Hürde von 30 Prozent gerade nochmals geschafft und kommt mit einem blauen Auge davon. Um den Abwärtstrend zu stoppen, muss die SVP aber wieder vermehrt Lösungen zu Themen anbieten, die auch Wechselwählern unter den Nägeln brennen. Die pauschale und saloppe Ablehnung aller Coronamassnahmen wird es kaum sein. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Alles gut und recht. Aber der Wurm sitzt bei der SP tiefer. Viel tiefer. Am unaufhaltsamen Niedergang und der verlorengegangenen Glaubwürdigkeit dieser Partei wird auch das neue Führungs-Duo nichts ändern.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.10.2020 Tag der Systemrelevanz
Hilfsgelder drohen auszugehen: Swiss braucht wohl bald eine neue Finanzspritze
Als Swiss und Edelweiss 1,5 Milliarden Franken Hilfe erhielten, wurde noch mit einem baldigen Ende der Corona-Krise gerechnet. Dem ist nicht so. Einnahmen bleiben aus, Swiss und auf dem Mutterkonzern Lufthansa droht ohne neue Staatsgelder bald die Luft auszugehen.
1,5 Milliarden Franken Staatshilfe haben Swiss und ihre Schwester Edelweiss erhalten. Aber das Geld zerrinnt den Verantwortlichen zwischen den Fingern. Nach eigenen Angaben verbrennt Swiss täglich 1,5 Millionen Franken. Aufs Jahr hochgerechnet sind das mehr als eine halbe Milliarde Franken.
Entgegen Prognosen bleiben Einnahmen aus. Die Corona-Krise erweist sich als hartnäckiger als noch vor Monaten angenommen. Hoffnungen haben sich zerschlagen, den Flugbetrieb seit Sommer langsam wieder hochzufahren und im Herbst die meisten Langstreckenflüge wieder in Betrieb zu nehmen.
Im Gegenteil geht die Zahl der Swiss-Flüge seit Juli wieder zurück, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Bei dem anhaltenden Bargeldabfluss würden neue Finanzhilfen für Swiss wahrscheinlicher - und auch für die Muttergesellschaft Lufthansa, die pro Monat eine halbe Milliarde Euro verliert.
Auch dem Mutterkonzern droht bald die Luft auszugehen
Laut Swiss-Sprecherin Karin Müller sei der zu 85 Prozent vom Bund abgesicherte 1,5-Milliarden-Kredit eines Bankenkonsortiums für Swiss und Edelweiss für die «kommenden Krisenjahre ausreichend».
Doch hinter den Kulissen sei aus Swiss-Managementkreisen zu hören, dass es mit dem Geld «knapp werden könnte». Demnach rechnet auch Lufthansa damit, dass der Airline bald die Luft ausgeht. Stand heute dürfte die Liquidität bis Jahresende aufgebraucht sein und neue Hilfe nötig werden.
Die Gretchenfrage bleibt, wie lange Quarantänen und Reisebeschränkungen bestehen bleiben. Zudem werde die Airline deutlich mehr als 1,5 Millionen Franken pro Tag brauchen, wenn die Kurzarbeit ausläuft. Die ganze Belegschaft ist derzeit in Kurzarbeit.
Streitpunkt Quarantäne
Laut eidgenössischerFinanzverwaltung liege noch kein Gesuch der Swiss um neue Staatshilfe vor. Doch im Umfeld des Bundesrats werde in den nächsten Wochen mit einem neuen Gesuch gerechnet, wenn sich die Ertragslage bis zur Jahreswende nicht bessert.
Den grössten Strich durch die Rechnungen macht der Airline offenbar das Problem der Quarantäneregel. Erst wenn Schnelltests die Abschaffung der Quarantäneregel erlauben würden, erst dann sei mit einer Stabilisierung zu rechnen, heisst es in Airline-Kreisen.
Zudem scheinen dem Bund die Hände gebunden. Nachdem er eine Bürgschaft von 1,275 Milliarden Franken übernommen hat, könne er ein weiteres Begehren um einen zusätzlichen Hilfskredit nicht ablehnen.
Radikale Sparmassnahmen?
Die Lage scheint verzweifelt und erfordert womöglich radikale Sparmassnahmen – nicht zuletzt, weil der Bund in den Verträgen zum Rettungskredit von der Swiss einen hohen Gewinn verlangt.
Entlassungen will die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben vermeiden. Ein 15-Prozent-Lohnabbau soll einen Stellenabbau verhindern. Doch das ist nur möglich, wenn die Angestellten zu Lohnverzicht, Frühpensionierung und Teilzeitpensen bereit sind. Gefährdet sind 1425 der insgesamt 9000 Stellen.
Dauert die Corona-Krise ins neue Jahr an, scheint Swiss nicht um Entlassungen umhinzukommen. Auch bei der Lufthansa ist der im August angekündigte Abbau der 22'000 von insgesamt 135'000 Stellen bereits Makulatur. Laut Konzernspitze müssen zusätzliche 5000 Stellen gestrichen werden, davon allein 1100 bei den Piloten. Schreibt SonntagsBlick.
Auf eine Milliarde mehr oder weniger aus der Giesskanne des Bundes kommt es jetzt auch nicht mehr an. Die Systemrelevanz öffnet nun mal alle Schleusen. Da braucht sich die zur deutschen Lufthansa gehörende SWISS wirklich keine Gedanken zu machen.
Bei der seinerzeitigen Abwicklung der SWISSAIR, die vom Bund mehr oder weniger an die Lufthansa «verschenkt» wurde, hiess es noch, die Schweiz brauche keine eigene Airline. (O-Ton Blocher)
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.10.2020 - Tag der abgesagten Geburtstagsfeiern
Guido Graf: «Wer seinen Geburtstag mit über 50 Gästen feiern will, sollte lieber zwei Jahre warten»
Aufgrund der steigenden Fallzahlen verschärft der Kanton Luzern die Coronamassnahmen. Regierungsrat Guido Graf (CVP) sagt, wie es so weit kommen konnte, in welchen Bereichen weitere Einschränkungen folgen werden – und wo er das Zepter lieber dem Bund übergeben möchte.
zentralplus: Guido Graf, im März sagten Sie, zu viele Leute seien zu sorglos unterwegs (zentralplus berichtete). Erleben Sie gerade ein Déjà-vu?
Guido Graf: Wir haben einen sehr guten Sommer mit tiefen Fallzahlen hinter uns. Viele haben sich wieder an das «normale» Leben gewöhnt. Jetzt, wo die Infektionszahlen steigen, müssen wir dafür sorgen, dass wir die Bevölkerung mitnehmen können.
zentralplus: Sind wir in der zweite Welle?
Graf: Nein, ich würde derzeit nicht von der zweiten Welle sprechen. Aber wir müssen handeln, bevor die zweite Welle ausbricht. Es ist wichtig, dass unser Gesundheitssystem funktionsfähig bleibt. Gleichzeitig darf die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommen. Einen zweiten Lockdown wollen wir um keinen Preis.
zentralplus: Sie sagten am Freitag vor den Medien, der Kanton Luzern sei seit zehn Tagen in der Phase rot. Was heisst das?
Graf: Dafür gibt es verschiedene Indikatoren. Zum Ersten die Zahl der Infizierten, die in den letzten Tagen gestiegen ist. Zum Zweiten die Reproduktionszahl, die derzeit bei einem Wert von 2 liegt. Das heisst, jeder Infizierte steckt zwei weitere Personen an. Zum Dritten – und das macht uns grosse Sorgen – sind 15 bis 16 Prozent der Getesteten positiv. Da liegen wir weit über der Vorgabe von 5 Prozent. Und viertens (das werden wir erst verzögert merken) dürfte die Belegung der Spitäler ansteigen.
zentralplus: Wieso hat es trotzdem so lange gedauert, bis Luzern reagierte?
Graf: Die Ansteckungsrate war lange tief und es gab konstant wenige Patienten, die wegen Corona eine Spitalbehandlung brauchten. Lange waren es in erster Linie jüngere Menschen, die positiv getestet wurden. Da beobachten wir jetzt eine Verschiebung hin zu einer älteren Generation. Und was sich ebenfalls geändert hat: Nicht nur die Menschen in der Stadt und der Agglomeration sind betroffen, sondern von Vitznau bis Pfaffnau, von Escholzmatt bis Hochdorf, kurz: im ganzen Kanton.
zentralplus: Man wusste immer, dass im Herbst eine zweite Welle droht. Haben es die Behörden verschlafen, rechtzeitig zu reagieren?
Graf: Nein. Wir im Kanton Luzern haben uns aufgrund der Erfahrungen vom Frühling organisiert und nun rechtzeitig reagiert. Es ist aber so, dass die Bevölkerung nach dem guten Sommer teilweise nachlässig geworden ist. Ich habe das selber festgestellt: Man ist an einer Tagung, trägt den ganzen Tag eine Maske und hält den Abstand ein, doch beim Apéro steht man dann zusammen und vergisst alles.
zentralplus: Jeder Kanton agiert anders und beschliesst unterschiedliche Massnahmen. Sollte der Bund das Zepter wieder übernehmen?
Graf: Nach aussen sieht es vielleicht aus wie ein Flickenteppich, der dem Kantönligeist geschuldet ist. Aber es hat Vorteile, wenn man auf kantonale Zahlen reagieren kann und die Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone ist intensiv. Bei der Einführung der Maskenpflicht würde ich eine nationale Lösung des Bundesrates aber begrüssen.
zentralplus: Und in anderen Bereichen?
Graf: Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Bund betreffend Homeoffice oder bei der Anzahl Personen für Versammlungen eine nationale Empfehlung abgibt. Damit hätte ich als Regierungsrat eines Kantons kein Problem. Das oberste Gebot muss der Schutz unserer Bevölkerung sein.
zentralplus: Der Kanton Luzern hat bei diesen zwei Punkten keine Massnahmen beschlossen. Wieso nicht?
Graf: Die Gesundheitsdirektoren der Zentralschweiz koordinieren die Massnahmen in diesen zwei Punkten derzeit. Wir sind also daran, da werden demnächst Entscheide gefällt.
zentralplus: Das heisst, es dürfte bald auch eine Obergrenze für private Anlässe und Feste geben. Von welcher Zahl reden wir?
Graf: Das wird derzeit diskutiert. Ich gehe davon aus, dass wir demnächst eine Zahl definieren werden, die festlegt, ab wann man bei privaten Veranstaltungen Masken tragen muss. Es soll sicher weiterhin möglich sein, dass Familien zusammenkommen. Doch wer seinen Geburtstag mit über 50 Gästen feiern will, sollte lieber noch zwei Jahre warten.
zentralplus: Empfiehlt der Kanton Luzern auch bald wieder Homeoffice, wenn es möglich ist?
Graf: Es wird aller Voraussicht nach relativ schnell eine unkomplizierte Regelung geben. Innerhalb der Verwaltung haben wir bereits Spielregeln definiert. Meine Erfahrung zeigt auch: Viele Unternehmen haben die Lehren aus dem ersten Lockdown gezogen und praktizieren bereits beziehungsweise immer noch Homeoffice.
zentralplus: Will der Kanton Luzern mit den schärferen Massnahmen auch den von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga geforderten Ruck in der Bevölkerung forcieren?
Graf: Ein Ruck alleine reicht nicht mehr. Sonst explodiert das System. Wir müssen handeln, die Lage ist extrem ernst.
zentralplus: Nicht alle goutieren die Maskenpflicht und strengere Einschränkungen. Erhalten Sie negative Rückmeldungen?
Graf: Ja, viele. Die grosse Mehrheit trägt die Massnahmen verantwortungsvoll mit. Aber es gibt Kreise, die sich nicht daran halten, da ist Luzern jedoch nicht allein.
zentralplus: Viele sind coronamüde und fragen sich: Wann hört das endlich auf?
Graf: Es ist eine gute Frage. Sobald eine Impfung verfügbar ist, haben wir die Lage im Griff. Ich gehe davon aus, dass dies 2021 der Fall sein wird. Schreibt ZentralPlus,
Und was ist, wenn der/die/das Betroffene innerhalb der nächsten zwei Jahre von den Göttern ins ewige Nirwana zurückgerufen wird? Wird dann die abgesagte Geburtstagsfeier mit den Engeln nachgeholt?
Oder zitieren wir dann einfach den grossartigen Dichter und Denker Giuseppe di Malaparte mit seinen Worten: «Luzern war der Menschheit schon immer einen Schritt voraus»?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.10.2020 - Tag der Schein-Ehen
Nach 3,5-Millionen-Franken-Klage: Elton John einigt sich mit seiner Ex-Frau
Sir Elton John und seine Ex-Frau Renate Blauel legen ihren Rechtsstreit bei. Blauel reichte eine Klage gegen den Sänger ein, nachdem er Einzelheiten ihrer Ehe in seiner Autobiografie öffentlich machte.
Eigentlich wollte Sir Elton Johns (73) Ex-Frau Renate Blauel (67) 32 Jahre nach der Scheidung 3,5 Millionen Franken von ihrem ehemaligen Ehemann. Der Grund: Der Popstar packte in seiner Autobiografie «Ich Elton John» über die vierjährige Ehe mit der deutschen Tontechnikerin aus – trotz einer von beiden unterschriebenen Geheimhaltungsvereinbarung.
Nun gab ein Sprecher von Elton John am Mittwoch bekannt, dass sich die beiden geeinigt haben, der Rechtsstreit sei beigelegt worden. Das schreibt der britische «Guardian». «Die Parteien freuen sich, mitteilen zu können, dass sie diesen Fall in einer Weise lösen konnten, der Renates Bedürfnis nach Privatsphäre gerecht wird.» Weiter heisst es in dem Statement, dass Renate betone, dass Elton John sie in den vergangenen 30 Jahren stets würdevoll und mit Respekt behandelt habe. Er habe ihr ausserdem immer gerne geholfen. «Sie werden in Zukunft nicht mehr übereinander oder ihre Ehe diskutieren und keine weiteren Kommentare zu diesem Fall abgeben.»
Elton John ist inzwischen mit David Furnish verheiratet
Elton John und Renate Blauel lernten sich 1983 bei Aufnahmen zu Johns Album «Too Low for Zero» kennen. Ein Jahr später gaben sie sich am Valentinstag in Sydney (Australien) das Jawort. Bei der Scheidung 1988 soll die Deutsche einen Betrag zwischen umgerechnet 5,5 und 10,5 Millionen Franken erhalten haben. Seit 2005 ist Elton John mit dem Filmproduzenten David Furnish (57) zusammen, seit 2014 sind sie verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.
In Blauels Klage geht es auch um Szenen aus dem Elton-John-Film «Rocketman». Dort wird der Hochzeitstag thematisiert, ebenso wie getrennte Schlafzimmer. In einer anderen Szene wird Elton John in einer Gruppentherapiesitzung gezeigt, in der das Scheitern seiner Ehe besprochen wird.
Elton Johns Seite reichte zur Verteidigung gegen die Klage ein, dass die Einzelheiten, die im Buch und im Film diskutiert werden in der Öffentlichkeit bekannt gewesen seien. Schreibt Blick.
Bei der Klage könnte es sich durchaus um ein abgekartetes Marketing-Spiel handeln, die schleppenden Buchverkäufe etwas anzukurbeln. Trotzdem können wir eine Lehre aus diesem Artikel ziehen: Schein-Ehen sind ja noch teurer als wirkliche Ehen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.10.2020 - Tag der Fragen
Was wir über Wiederansteckung wissen: Verläuft die zweite Corona-Infektion schlimmer?
Ein 25-Jähriger hat sich innerhalb von 48 Tagen ein zweites Mal mit Corona infiziert. Er musste im Spital beatmet werden. Beim ersten Mal hatte er milde Symptome. Eine 89-Jährige aus den Niederlanden starb nach einer Corona-Reinfektion. Was bedeutet das?
Zwei Fälle geben neue Aufschlüsse über Wiederansteckungen mit dem Coronavirus. Eine 89-Jährige mit Vorerkrankung starb in den Niederlanden, als sie sich erneut mit dem Virus infizierte. Ein 25-Jähriger aus Nevada (USA) infizierte sich anderthalb Monate nach seiner ersten, milden Corona-Erkrankung erneut. Diesmal musste er im Spital beatmet werden.
Der Fall aus Nevada wurde in einer Studie vom Fachmagazin «The Lancet Infectious Diseases» veröffentlicht. Zwischen seinen Corona-Erkrankungen wurde er negativ getestet. Beim zweiten Mal hatte sich das Virus genetisch verändert. Es war mutiert.
Was ist eine Corona-Reinfektion?
Erkrankt man noch mal an der Krankheit, die man bereits überstanden hatte, nennt man das Reinfektion. Eine Wiederansteckung mit demselben Virus. Das geht auch beim Coronavirus, wie die neuen Fälle zeigen. Bislang gibt es jedoch nur sehr wenige bestätigte Corona-Wiederansteckungen.
Sind die Symptome bei der zweiten Corona-Infektion schwerer?
Der Amerikaner wurde innerhalb von 48 Tagen positiv auf zwei verschiedene Coronavirus-Infektionen getestet. Beim Patienten traten beim zweiten Mal schwere Covid-19-Symptome auf. Darunter Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel, Husten, Übelkeit und Durchfall. Er wurde ins Spital eingeliefert. Bei der ersten Infektion war das nicht nötig, seine Symptome waren mild.
Sein Fall zeigt, dass eine Reinfektion innerhalb eines kurzen Zeitrahmens auftreten – und vor allem schwerer verlaufen – kann. Das zeigt auch der Fall der verstorbenen 89-Jährigen aus den Niederlanden. Die Seniorin erkrankte laut «Telegraaf» erstmals zu Beginn des Jahres an Corona und wurde ins Spital eingeliefert. Beim ersten Mal hatte sie hohes Fieber und Husten.
Fünf Tage lang wurde sie im Krankenhaus behandelt, bis ihre Symptome abklangen. Sie überlebte, obwohl sie eine seltene Form von Knochenmarkkrebs hatte. Zwei Monate später bekam sie erneut Fieber, Husten und Atemnot. Eine Corona-Reinfektion. Tests zeigten, dass sie nach der ersten Infektion keine Antikörper entwickelt hat. Sie verstarb als Folge der zweiten Infektion.
Haben sich auch Schweizer zweimal mit Corona angesteckt?
Ja. Gegenüber Nau.ch bestätigt das BAG, dass auch in der Schweiz bereits «mehrere Fälle von Zweitinfektionen registriert» worden sind. Wie viele genau, ist aktuell nicht bekannt.
Ist man nach einer Infektion nicht immun?
Laut der US-Studie, die den niederländischen Fall nicht beinhaltet, sei noch ungeklärt, wie lange die Immunität nach einer ersten Corona-Infektion andauere. Das erläutert der Autor der Studie, Mark Pandori vom Nevada State Public Health Laboratory der Universität von Nevada. Die Untersuchung zeigt, dass eine vorherige Infektion nicht unbedingt vor einer erneuten Ansteckung schützt.
Laut Mark Pandori bedeute das, dass man nach einer überstandenen Infektion «weiterhin Vorsichtsmassnahmen ergreifen sollten.» Darunter Mindestabstände einhalten, Atemschutzmasken tragen und das regelmässige Händewaschen. Dennoch bleibt vieles über Corona-Reinfektionen unklar.
«Wir brauchen mehr Forschung, um zu verstehen, wie lange die Immunität von Menschen, die Sars-Cov-2 ausgesetzt sind, andauern kann, und warum einige dieser zweiten Infektionen zwar selten sind, sich aber als schwerwiegender darstellen», erklärt Pandori.
Was bedeutet das für einen Impfstoff?
Laut den Machern der Studie aus den USA sei es dennoch wichtig zu beachten, dass ihre Untersuchung noch keine Verallgemeinerbarkeit des Phänomens ermöglicht. Aber: «Auch wenn weitere Forschung erforderlich ist, könnte die Möglichkeit von Reinfektionen erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der Covid-19-Immunität haben, insbesondere in Ermangelung eines wirksamen Impfstoffs.» Bei der Impfstoff-Entwicklung stellt das eine weitere Schwierigkeit dar. Schreibt Blick.
Nie wäre er wertvoller gewesen als jetzt bei der atemlosen Berichterstattung der Medien rund um die Uhr in der zweiten Corona-Welle. So viele unbeantwortete Fragen! Und all diese «sowohl-als-auch»-Antworten.
Doch wir können Mike Shiva nicht mehr anrufen. Sein iPhone ist stumm geschaltet. Scheitert vermutlich am 5G-Netz, das hinter den Sternen im unendlichen Nirwana noch nicht installiert ist. Aber das kommt sicher noch.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.10.2020 - Tag der verschärften Maskenpflicht
«Ich beobachte genau, wer sich ansteckt»: Chefinfektiologe Fux über Senioren sowie Maskenpflicht in Clubs und Läden
Die Corona-Fallzahlen steigen. Am Kantonsspital Aarau beobachtet Chefarzt Christoph Fux, dass sich wieder mehr ältere Menschen anstecken. Er ruft positiv Getestete auf, ehrlich zu sein, und würde eine Maskenpflicht in Läden begrüssen.
Die Covid-Taskforce des Bundes warnt davor, dass die Zahl der Spitaleinweisungen und Todesfälle wieder steigen könnte. Spüren Sie davon bereits etwas?
Christoph Fux: Wir haben mehr Fälle. Aber noch nicht in einem Ausmass, das beunruhigend wäre. Im Moment kümmern wir uns überwiegend um Coronapatientinnen und Coronapatienten, die auf der Bettenstation behandelt werden können und nicht auf die Intensivstation müssen. Die Kapazität ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Das kann sich aber innert Tagen völlig ändern.
Die steigenden Fallzahlen schlagen sich jeweils erst verzögert in der Zahl der Hospitalisierungen nieder. Beunruhigt Sie das?
Das ist so. Unsere Erfahrung zeigt klar, dass es zwei bis drei Wochen dauert, bis wir im Spital spüren, was wir heute an Zunahme bei den positiven Testungen sehen. Wer sich jetzt ansteckt, kann weitere Personen anstecken – schon Tage bevor er selber Symptome entwickelt. Es dauert im Schnitt fünf Tage, bis bei Angesteckten Symptome auftreten. Dann geht es weitere zwei Wochen, bis sie schwer krank werden.
Wie bereiten Sie sich auf diesen möglichen Anstieg der Zahlen bei den Coronapatienten vor?
Wir haben am Kantonsspital Aarau (KSA) eine designierte Abteilung, auf der Verdachtsfälle und bestätigte Fälle behandelt werden. Wir trennen Covid-Patienten strikt von anderen Patientinnen und Patienten. Im Moment ist es eine Abteilung. Wir können aber – je nach Bedarf – auf zwei, drei oder vier Abteilungen ausbauen. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Strengere Maskenpflicht? Was wohl Marco Rima und sein Kumpan aus der Verschwörungstheoretiker-Zunft Thiel dazu sagen?
Die beiden ziemlich abgehalfterten «Stars» aus der Comedianbranche planen sicher schon die nächste Demo in Zürich.
Irgendwie müssen die Cervelatpromis ja noch auf sich aufmerksam machen. Für bessere Zeiten nach Corona. Und sei's auch nur mit der eigenen Dummheit. Das Verschwörungs-Team Rima/Thiel ist sich für nichts zu schade.
Wir dürfen gespannt sein.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.10.2020 - Tag der Konkordanz
Die Drohkulisse von CVP und SP: Entweder wird die SVP konkordant, oder sie fliegt – zumindest teilweise – aus der Regierung
Man könnte denken, dass es abgesprochen war: Zuerst attackierte CVP-Präsident Gerhard Pfister die SVP. Und nur fünf Tage später sekundierte SP-Präsident Christian Levrat. Die beiden Parteichefs haben damit die Tonlage für die Wahlen 2023 vorgegeben.
Es war ein kleines Stakkato. Zuerst stellte CVP-Präsident Gerhard Pfister im «Tages-Anzeiger» fest, dass die SVP als «grösste Partei in diesem Land alles tut, um die Entwicklung zu einem Regierungs-Oppositions-System voranzutreiben.»
Kurz darauf sekundierte SP-Präsident Christian Levrat in der «NZZ am Sonntag»: «Die Frage stellt sich, ob der SVP weiterhin zwei Sitze in der Landesregierung zustehen sollen.»
CVP und SP haben ein neues Narrativ entwickelt
Der Ton für die nächsten drei Jahre ist damit vorgegeben. Bis 2023 dürfte SVP-Bundesrat Ueli Maurer zurücktreten und es stellt sich die Frage, was mit seinem Sitz geschieht. CVP und SP stellen implizit ein neues Droh-Narrativ auf: Entweder wird die SVP konkordant, oder sie könnte – zumindest teilweise – aus dem Bundesrat fliegen.
Die Verärgerung bei CVP und SP (aber auch FDP) ist gross. Die SVP stellt zwar die grösste Fraktion im Parlament und besetzt im Bundesrat mit Finanz- und Wirtschaftsdepartement zwei sehr wichtige Departemente. Verantwortung will sie aber noch immer nicht übernehmen. Sie kämpft im Gegenteil mit ständig neuen Initiativen gegen die Bilateralen. Das ist der Tenor hinter den Kulissen.
In 30 Minuten waren die Konkordanzgespräche tot
Dass die SVP mit dem Angriff auf ihren Bundesrichter Yves Donzallaz die Gewaltenteilung torpedierte, brachte das Fass zum Überlaufen. Es dauerte nur 30 Minuten, bis SP, CVP und FDP die Konkordanzgespräche zur Zauberformel im Bundesrat platzen liessen. Levrat sagte ab, Pfister informierte FDP-Präsidentin Petra Gössi – und die Gespräche waren tot.
Die seltene Einmütigkeit hat noch einen anderen Grund. Die SVP macht heute niemandem mehr Angst. Sie erlitt bei den Wahlen 2019 einen schweren Dämpfer und blieb mit der Begrenzungsinitiative chancenlos. Bei den kantonalen Wahlen im Kanton Aargau vom 18. Oktober droht ihr der Fall unter die ominöse 30-Prozent-Marke.
Die Angst vor der SVP ist verschwunden
«Kann man noch mehr persönliche Angriffe auf Bundesräte führen? Kann man die Unabhängigkeit der Justiz noch stärker in Frage stellen? Kann man noch mehr Referenden ergreifen?» Das fragt sich CVP-Präsident Pfister im Interview. Es sind rhetorische Fragen.
SP-Präsident Levrat formuliert es direkter: «Heute muss man vor der SVP keine Angst mehr haben.» Noch bis 2016 wäre eine solche Aussage undenkbar gewesen. Ex-CVP-Präsident Christophe Darbellay wälzte vor den Wahlen 2015 mit Levrat den Plan, die SVP aus der Regierung zu kippen. Die Angst, die SVP zu stärken, hielt sie davon ab. Der Sieg der SVP bei den Wahlen 2015 machte das Gedankenspiel zur Makulatur.
Der Nimbus der Unbesiegbarkeit der SVP wurde am 28. Februar 2016 gebrochen. Ein Netzwerk aus der Zivilgesellschaft machte vor, wie man gegen die SVP gewinnen kann. Seither wurde die Partei Schritt für Schritt entzaubert.
Der Showdown folgt beim Rücktritt von Ueli Maurer
Zum Showdown kommt es, wenn Ueli Maurer zurücktritt und die SVP etwa Magdalena Martullo-Blocher nominiert. Dieses Szenario ist nicht abwegig. Martullo sagte 2017 im «SonntagsBlick»: «In einem Notfall, wenn die EU uns plötzlich unerwartet stark unter Druck setzen würde, würde ich das Amt wohl in Betracht ziehen.» Martullo werde «sicher nie Bundesrätin», sagen aber wichtige Politiker anonym. Und: «Die SVP ist ein Familienclan. Hier gibt es eine Grenze, was den Bundesrat betrifft.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wie steht es so schön in Johann Wolfgang von Gothes «Erlkönig» geschrieben: «Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.» Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen in einer so hoch gelobten Demokratie wie derjenigen der Schweiz.
Die SVP war noch NIE konkordanzfähig. Das Wort «Konkordanz» ist weder in der DNA der SVP vorhanden, noch in der für die SVP gültigen Bundesverfassung, genannt «Die Weltwoche».
Wie gut die SVP nach einem Rauswurf aus dem Bundesrat mit der dann logischen Märtyrer-Rolle leben und Stimmen gewinnen könnte hat sie schon einmal beim Rauswurf von Blocher aus dem Bundesrat bewiesen. Eine Steilvorlage für die SVP. Ob sich das die unsäglichen Strategen der unheiligen Allianz von CVP und SP überlegt haben?
-
12.10.2020 - Tag der Wahlverlierer
Die Reaktionen auf das vorläufige Endergebnis bei der Wien-Wahl: Die Spitzenkandidaten pochten in der krone.tv-Diskussionsrunde großteils auf Zusammenarbeit nach einem wohl für alle Beteiligten mühsamen Wahlkampf, während die Wahlverlierer (FPÖ: „Vertrauen nach Ibiza wiedergewinnen“) sich weiterhin gegenseitig attackierten.
Allen voran Heinz-Christian Strache, der zum einen die „Krone“ als Ursache hinter seiner Niederlage vermutet, aber die Hoffnung weiterhin nicht aufgeben möchte: „Ich habe im letzten Jahr begonnen, als Unternehmer tätig zu sein und ich werde auch weiterhin als Unternehmer tätig sein. (...) Aber es wäre schön, wenn noch ein Wunder gelingt und wir auch den politischen Einzug in den Wiener Landtag schaffen würden.“
„Meine Nachfolger haben die freiheitliche Familie zerstört“
Zuvor attackierte er in mehreren TV-Interviews seine ehemalige Partei FPÖ. Schuld am Abschneiden der Freiheitlichen sei die derzeitige Führung, denn diese habe „herzlos“ eine Spaltung herbeigeführt. Sie habe viele Menschen „nicht nur verletzt, sondern vor den Kopf gestoßen“. Seine Nachfolger hätten „eiskalt und herzlos“ agiert und die freiheitliche Familie zerstört. Sie müssten daher ersetzt werden, so Strache. Schreibt die Kronen Zeitung.
Frei nach Gustav Mahler: «In Österreich wird jeder das, was er nicht ist.»
-
11.10.2020 - Tag der «Generation Konsum»
Lohneinbussen wegen Corona und vermehrter Konsum auf Pump: Im Herbst rollt grosse Betreibungswelle an
Betreibungsämter und Inkassofirmen bereiten sich auf arbeitsreiche Monate vor. Die Zahl der überschuldeten Personen dürfte deutlich zugenommen haben – nicht nur wegen Corona.
Viele Schweizerinnen und Schweizer konnten in den vergangenen Monaten sparen. Statt ihr Geld für Ferien und Freizeit auszugeben, häuften sie es auf dem Konto an. Vielen anderen erging es aber genau umgekehrt, wegen Kurzarbeit oder Jobverlust klafft ihnen ein Loch im Portemonnaie.
Wer seine Rechnungen nicht bezahlt hat, musste sich bisher trotzdem nicht vor Geldeintreibern fürchten. Weil während des Lockdowns ein temporärer Betreibungsstopp galt, schoben Gläubiger ihre Forderungen vorerst auf. Laut dem Verband der schweizerischen Betreibungsämter sind die Fallzahlen aktuell um bis zu 20 Prozent im Rückstand.
Nun ist die Schonfrist für die Schuldner vorbei. Betreibungsämter und Inkassofirmen rechnen damit, dass es im Herbst eine Welle von Betreibungen und Gläubigerforderungen geben wird, sei es von Krankenkassen, Telekomfirmen oder Detailhändlern.
«Manche Gläubiger warteten bisher vielleicht aus Solidarität zu», sagt Stephan Boesch, Präsident der Zentralschweizer Betreibungsämter. «Viele dürften die Beträge jetzt auf einmal einfordern.» Dafür haben sie drei Möglichkeiten: Es auf eigene Faust versuchen, private Anbieter wie Inkassofirmen beauftragen oder den gerichtlichen Weg (Betreibung) einschlagen.
Schuldenberatungen sind «ziemlich auf Nadeln»
Schuldenberatungen sind ob dieser Situation beunruhigt. Auch sie glauben, dass es zu einem deutlichen Anstieg überschuldeter Personen gekommen ist. Häufiger als sonst klingelt das Telefon aktuell aber noch nicht: «Wir spüren solche Entwicklungen immer erst verzögert und sind deshalb ziemlich auf Nadeln», sagt Olivia Nyffeler, Rechtsanwältin bei der Berner Schuldenberatung.
Ehe sich Betroffene entschliessen, eine Beratungsstelle aufzusuchen, haben sie demnach meist schon mehrere Mahnungen und Zahlungsbefehle per Post erhalten. Damit es gar nicht erst soweit kommt, empfiehlt Nyffeler, frühzeitig zu handeln und zum Beispiel direkt mit den Gläubigern eine Lösung zu suchen (siehe Text unten).
Während des Lockdowns sei das Beratungstelefon «praktisch verstummt», sagt Nyffeler weiter. Die Leute hatten demnach plötzlich andere Ängste, mussten sich in der neuen Situation zurechtfinden, Betreuung für ihre Kinder organisieren. Geldsorgen dürften bei einigen kurzzeitig in den Hintergrund getreten sein. Doch jetzt klingle das Telefon wieder wie eh und je, in Luft aufgelöst hätten sich die Geldsorgen nicht, bei manchen seien sie wahrscheinlich sogar schlimmer geworden.
Schuld daran ist aber nicht bloss Corona. In die Schuldenspirale geraten häufig Leute, die ihren Konsum nicht im Griff haben: Sie kaufen unbeschwert Kleider, Möbel oder Elektronikprodukte auf Kredit ein und verschieben die Zahlung auf den St.Nimmerleins-Tag – moderne Zahlungsmethoden wie Paypal machen es möglich.
Oder sie haben langjährige Leasingverträge und somit relativ hohe monatliche Fixkosten, die sie sich im Falle eines Jobverlustes nicht mehr leisten können. Gerade der coronabedingte Boom des Onlineshoppings könnte dieses Problem verschärft haben. Darüber hinaus verschulden sich Leute freilich auch aus Gründen wie Scheidung, Krankheit, Erbschaften oder Familiengründung.
Inkassofälle nehmen schon seit Jahren zu
Dick Wolff, Inhaber der Liechtensteiner Inkassofirma IB Score AG, hat nach eigenen Aussagen mehrheitlich mit der ersten Sorte zu tun. «Zahlreiche Leute leben über ihren Verhältnissen und bezahlen Rechnungen einfach nicht.
Solche Inkassofälle nehmen seit Jahren zu», sagt er beim Besuch des Betriebs in Liechtenstein. «Wir haben deshalb mehr als genug Arbeit und wollen nicht von der Coronakrise profitieren», betont er im Gespräch, darum bemüht, den schlechten Ruf seiner Branche zu korrigieren. IB Score AG ist in der Schweiz, in Liechtenstein sowie im Ausland tätig.
Der Branche wird zum Beispiel vorgeworfen, Schuldnern mit harten Formulierungen und Drohungen zu verunsichern. Nicht selten werden Inkassofälle in Sendungen wie Kassensturz thematisiert. Wolff argumentiert, dass in diesem Bereich die Rolle des Täters und Opfers in der öffentlichen Wahrnehmung vertauscht ist.
«Ein Zahnarzt oder ein Maler, der eine Dienstleistung erbringt, hat das Recht, bezahlt zu werden. Sonst kommt er in finanzielle Schwierigkeiten». In der aktuellen Situation könnte es so tatsächlich zu einer Abwärtsspirale kommen. Schon jetzt wird im Herbst mit einer Welle von Firmenkonkursen gerechnet. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Kein schönes Wort zum Sonntag. Aber leider die bittere Wahrheit. Vermutlich muss die «Generation Konsum bis zum bitteren Ende» noch lernen, mit veränderten Situationen umzugehen. Wann, wenn nicht jetzt?
-
10.10.2020 - Tag der Neutronen
Regierungs-Kandidatin Christine Guyer setzt auf die Gender-Karte: «Als Frau setze ich andere Prioritäten»
Christiane Guyer, Regierungsratskandidatin der Grünen, über Männerbastionen, ihre Erfahrungen als Mutter und wirksame Klimapolitik.
Es war Ihre Idee, das Interview hier auf dem Polizeiposten in Zofingen zu führen. Wollen Sie signalisieren, dass Sie gerüstet sind, nach der Regionalpolizei als Regierungsrätin auch die Kantonspolizei zu führen?
Christiane Guyer: Der Ort hier ist mir sehr vertraut. Ich habe schon unzählige Stunden Sitzungen hier verbracht. Und ja, als Zofinger Stadträtin und Zuständige für Sicherheit und Kultur bin ich mittlerweile seit zehn Jahren mit der Polizeiarbeit vertraut.
Auch in Aarau würde eine Männerbastion auf Sie warten. Das schreckt Sie offenbar nicht ab.
Das ist einfach Teil meines Lebens. Schon in der Kanti im naturwissenschaftlichen Typus C waren wir zwei Mädchen und zwanzig Jungen. Und schauen Sie hier. Nimmt einen Schwarz-Weiss-Flyer hervor. Das hier sind die Wahlunterlagen der Grünen von 1987, da war ich auf der Nationalratsliste. Unsere Forderungen damals (liest vor): «Ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen in allen Gremien.» Das ist über 30 Jahre her.
Wieso hat sich so wenig verändert?
Das liegt vor allem an den Strukturen. Für das Amt als Regierungsrat etwa ist die Vereinbarkeit mit einer Familie weiterhin schwierig. Die Belastung mit kleinen Kindern erlaubt es einer Frau kaum, gleichzeitig eine Aufgabe zu übernehmen, die den Einsatz sieben Tage die Woche fordert.
Sie haben fünf Kinder. Ist das der Hauptgrund, warum Sie erst jetzt für ein solches Amt kandidieren?
Ja, die Kinder sind jetzt selbstständig, die Jüngste ist 15. Darum ist das kein Hindernis mehr.
Das heisst: In der Realität passen sich die Frauen den Strukturen an und nicht umgekehrt?
Nicht nur. Als meine Kinder kleiner waren, ging das erste um halb acht in die Schule, das zweite um halb neun und um zehn kam eines schon wieder nach Hause. Es war ein ständiges Hin und Her. Darum haben wir, ein paar Eltern, uns damals zusammengetan und in Zofingen eine Initiative für Blockzeiten lanciert. Die kam beim Volk deutlich durch. Wir waren eine der ersten Aargauer Gemeinden mit Blockzeiten.
Zurück zum Regierungsrat. Der Tenor bei den Bisherigen ist: Gemischte Gremien seien zu begrüssen. So sagt es Stephan Attiger. Aber auch: Mann oder Frau spiele keine Rolle. So sagt es Jean-Pierre Gallati.
Das ist falsch. Frauen setzen andere Prioritäten. Sie haben weniger lineare Lebensläufe als Männer. Frauen wissen, wie wichtig Eigenständigkeit ist. Frauen müssen ihr eigenes Einkommen haben. Da geht es nicht um Selbstverwirklichung, das ist vor allem auch eine finanzielle Vorsorge fürs Alter oder bei einer Trennung. Es kann nicht sein, dass die Hälfte der Bevölkerung keine Stimme hat in einer Regierung.Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wenn Gender-Themen tatsächlich aktuell unsere «prioritären» Themen sind, dann sollten Sie, liebe Aargauerinnen und Aargauer in Euren furchtbaren weissen Socken, Frau Christiane Guyer aus Zofingen unbedingt wählen. Die öffentliche Toilette bei der Markthalle in Zofingen ist in der Tat nicht gendergerecht. Nicht mal ein separates Häuschen für Neutronen*innen.
-
9.10.2020 - Tag der Pommes
Weil den Schweizern der Appetit auf Pommes vergangen ist: Kartoffeln landen im Sautrog statt in der Friteuse
Seit März ist der Pommes-Konsum massiv unter Vorjahr, die Lager sind noch voll. Und jetzt kommt schon die neue Kartoffelernte. Millionen landen im Saufutter.
Die Kartoffelernte steht kurz vor dem Abschluss. Die meisten Äcker sind schon umgegraben, das Resultat erfreulich. 2020 ist ein sehr gutes Kartoffeljahr. «Die Ernte fällt überdurchschnittlich aus», sagt Ruedi Fischer (52), Präsident der Schweizer Kartoffelbauern. «Im Osten noch besser als im Westen.»
Hans Gränicher (62) bestätigt diese Aussage. Der Bauer aus dem bernischen Berken hat bereits tonnenweise Härdöpfel aus dem Boden geholt. «Die Qualität der diesjährigen Kartoffeln ist sehr gut», sagt er. «Das gilt für fast alle Sorten.»
Auch die Industrie jubelt: Chips-Hersteller Zweifel kündigt an, bis Mitte des nächsten Jahres auf deutsche Importe verzichten zu können. «Wir gehen davon aus, dass die Erträge der Kartoffelernte gut sein werden und wir eine vollständige Kartoffelversorgung aus Schweizer Anbau erreichen», so eine Sprecherin.
Pommes-Krise wegen Corona
Das sind gute Nachrichten. Eigentlich. Es gibt nur ein Problem: Die Rekordernte trifft auf volle Lager. Die Schweiz sitzt auf einem Berg von Fritten. Der Lockdown im Frühjahr und die weiteren Corona-Massnahmen haben den Pommes-Konsum einbrechen lassen. Die Restaurants waren wochenlang zu, Grossveranstaltungen sind seit Monaten verboten. In der Folge blieb das Pommes-Futtern aus, denn die frittierten Stäbli werden meistens ausser Haus konsumiert. Beim Skifahren oder Wandern am Berg. In der Burger-Bude. Beim Grümpi.
Der Berner Traditionsbetrieb Kadi hat die Fritten-Krise voll zu spüren bekommen. Das Unternehmen gehört zu den drei grössten Pommes-Fabrikanten im Land – neben Migros und Fenaco. Kadi produziert unter anderem für Burger King und hat sich auf die Gastronomie spezialisiert. Im Frühling schlug Corona durch. «Während des Lockdowns ist der Umsatz um rund 80 Prozent eingebrochen», sagt ein Sprecher. Seit Mai habe sich die Situation wieder etwas entspannt, das Niveau von einst ist aber nicht erreicht.
Tonnenweise lagern die Pommes noch in den Tiefkühllagern bei minus 25 Grad. Bei Kadi, bei der Landi-Mutter Fenaco, bei der Migros. Haltbar ist die Ware bis ins nächste Jahr. Deshalb zögert die Industrie, kräftig neue Kartoffeln einzukaufen. Für die Bauern bedeutet das, dass sie womöglich auf ihrer Ware sitzenbleiben. Schlimmstenfalls landen Tausende Tonnen wertvolle Pommes-Kartoffeln im Futtertrog der Schweine. Im Klartext heisst das: Millionen sind zur Sau!
Hilfe aus Bern
In normalen Jahren ist eine Überschussproduktion kein Problem. Die Bauern haben eine eigene Versicherung aufgezogen, den Verwertungsfonds. Das ist ein Kässeli, das für Schwankungen bei der Ernte aufkommt und den Markt stabilisiert. Wenn es im Sommer sehr heiss ist und die Ernte gering ausfällt, erhält der Bauer Geld. Wenn die Ernte wie in diesem Jahr besonders üppig ist und ein Teil der teuren Knollen als Tierfutter enden, wird der Landwirt ebenfalls zu einem Teil entschädigt.
Das System hat sich bewährt, doch im Corona-Jahr 2020 ist alles anders. Auch bei den Härdöpfel-Produzenten. Jede vierte Pommes-Kartoffel läuft Gefahr, im Schweinetrog zu landen, wie Landwirt Gränicher schätzt. Der Fonds reicht nicht mehr. Die Ware muss eingelagert werden. Erste Schritte in diese Richtung gibt es, aber auch das kostet Geld.
Hinter den Kulissen laufen deshalb seit einigen Wochen Gespräche mit Bundesbern, wie Ruedi Fischer und der Branchenverband Swisspatat bestätigen. Ein Härtefallgesuch beim Bundesamt für Landwirtschaft wurde abgelehnt. Das Dossier liegt nun beim Eidgenössischen Finanzdepartement. Dieses soll Lösungen für «Einzelfälle von kantonaler oder regionaler Bedeutung» suchen. Schreibt Blick.
Geht's uns schlecht?
-
8.10.2020 - Tag der Lächerlichen
«Gewissen Exponenten fehlt der Anstand»: SVP-Bezirkspräsidentin kritisiert Glarners Stil und Kurs
Bisher übte von den wichtigen SVP-Funktionsträgern niemand Kritik am Provokateur. Jetzt tut sie es: Barbara Borer-Mathys greift Stil und Kurs von Andreas Glarner an: «Gewissen Exponenten fehlt der Anstand.»
«Arschlan», Mohrenkopf-Plakat, keine Doppelbürger im Nationalrat: SVP- Kantonalparteipräsident und Nationalrat Andreas Glarner (Oberwil-Lieli) hat in den letzten Wochen immer wieder provoziert – und damit selbst in den eigenen Reihen für Verärgerung gesorgt. In zehn Tagen wird im Aargau gewählt, bei der SVP hat man Angst vor Verlusten, und viele ihrer Kandidaten bangen um ihre Wahlchancen.
Von den wichtigen SVP-Funktionsträgern übte bisher niemand Kritik am Provokateur. Jetzt tut es Barbara Bohrer-Mathys, die Tochter des früheren SVP-Aargau-Präsidenten und Nationalrats Hans Ulrich Mathys. Ohne den Namen Glarner zu nennen, aber so deutlich, dass klar ist, wen sie meint. Rechtsanwältin Bohrer-Mathys ist Präsidentin der SVP des Bezirks Kulm.
Sie schreibt in einem Diskussionsbeitrag über die SVP: «Gewissen Exponenten fehlt der Anstand.» Und: «Wir politisieren offensichtlich teilweise am Volk vorbei.» Für Borer-Mathys ist klar: «Wir müssen aufhören, uns auf alte Strategien zu verlassen. Sie helfen uns heute kaum noch.»
«Nicht immer nur Nein sagen»
Immer nur Nein zu sagen, treibe die Wähler in die Arme der Gegner. Für die Grossratskandidatin steht fest:«Wir müssen lernen, ein verlässlicher Partner zu sein. Hart in der Sache, anständig im Ton, mit dem Willen zum Kompromiss – wenn auch nicht um jeden Preis.» Borer-Mathys (37) ist dreifache Mutter und wohnt in Holziken. Sie sagt von sich, sie sei Realistin genug, um zu merken, «dass wir im SVP-Getriebe wohl gewisse angerostete, ausgeleierte und überflüssige Teile auswechseln müssen». Für die Präsidentin jener Bezirkspartei, die 2016 mit 42 Prozent kantonsweit den höchsten Wähleranteil erreichte, ist klar: «Die SVP hat eine gehörige Revision nötig.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Der Mann, den man ohne rechtliche Folgen einen «Dummschwätzer» nennen darf, wieder mal im medialen Rampenlicht. Ob Glarner der Anstand fehlt, ist in der heutigen Social Media-Zeit Ansichtssache. Von seinen Fans, und von denen muss es ja ein paar geben, sonst wäre er nicht zum Aargauer SVP-Präsidenten gewählt worden, wird er für seine verbalen Entgleisungen geliebt.
Zitieren wir ein Zitat von Napoleon Bonaparte, dessen Worte es exakt auf den Punkt bringen, was auf den «Dummschwätzer» Glarner definitiv zutrifft: «Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt.»
Et voila! Glarner ist nichts anderes als eine von jedem Intellekt befreite lächerliche Person.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
7.10.2020 - Tag der Unkeuschheit
Der Ständerat erhöht beim Rahmenabkommen den Druck auf den Bundesrat – dazu kommen neue Gräben im bürgerlichen Lager
Die Aussenpolitische Kommission des Ständerates hat eine klare Erwartung an den Bundesrat, wie deren Präsident FDP-Ständerat Damian Müller betont: «Ich erwarte, dass er diese Präzisierungen knallhart macht, damit sie mehrheitsfähig sind.»
Doch welche Präzisierungen, zu welchen Themen? Bis anhin sprach der Bundesrat von Präzisierungen bei den flankierenden Massnahmen, der Unionsbürgerrichtlinie und den staatlichen Beihilfen. Doch letzte Woche meldete CVP-Präsident Gerhard Pfister grundsätzliche, darüber hinausgehende Bedenken an – das Rahmenabkommen gefährde die Souveränität der Schweiz.
Scharfe Kritik an der CVP
Müller hatte ob dieser Wortmeldung gar keine Freude. Der Bundesrat habe vor zwei Jahren bei sämtlichen Parteien eine Konsultation gemacht. «Wenn jetzt Parteipräsidenten neue Forderungen ins Feld führen, haben sie ihren Job bei der Konsultation nicht gemacht. Oder sie wollen ihre Partei in eine konservative Ecke ziehen, um Wähleranteile zu gewinnen.»
Angesprochen ist neben Pfister auch Beat Rieder. Doch der konservative Walliser CVP-Ständerat weist den Vorwurf entschieden zurück. Die CVP-Fraktion habe von Anfang an klargestellt, dass «auch die automatische Rechtsübernahme in einem Streitschlichtungsverfahren, welches die Souveränität der Schweiz nicht respektiert, ein gravierender Punkt ist.»
So muss die FDP mehr auf die SP setzen. Von deren Präsident Christian Levrat kommt Schützenhilfe: «Ich finde den Mechanismus zur Streitbeilegung an und für sich nicht problematisch. Viel problematischer sind dessen Anwendungsbereiche.»
Diese Aussage ist interessant, weil sich Levrat damit auch von den Gewerkschaften distanziert. Gleich wie die CVP äusserten auch sie zuletzt immer lautere Kritik an der dynamischen Rechtsübernahme und der vorgesehenen Streitbeilegung mit der dominanten Rolle des EuGH.
Levrat geht nicht so weit. Für ihn muss sichergestellt sein, dass die flankierenden Massnahmen zum Schutz der Löhne nicht unter das Abkommen fallen: «Es braucht eine klare Regelung, um zu sichern, dass die flankierenden Massnahmen so belassen werden, wie sie sind. Und es muss Spielraum für den Ausbau der Massnahmen geben.»
Für diese Präzisierungen ist in den letzten Tagen der Begriff der «Immunisierung» aufgetaucht. Doch das ist lediglich ein neuer Begriff für ein altes Konzept: dass nämlich Bereiche definiert werden, die nicht unter das Abkommen fallen.
Die Frage ist dann, wie offensiv der Bundesrat gegenüber der EU solche Immunisierungen fordert und welche Konsequenzen er bereit ist zu tragen, sollte die EU nicht nachgeben. Levrat sagt dazu: «Der Bundesrat muss sich mit einem Plan B auseinandersetzen. Das gehört zu einer klugen Verhandlungsführung. Ein Scheitern des Rahmenabkommens wäre für mich kein Drama.» Nur wer ein Scheitern in Kauf nehme, könne den Gegner unter Druck setzen.
APK-Präsident Müller erwidert darauf: «Ohne diese drei Präzisierungen, die auch nach Schweizer Prinzipen klar geregelt sind, wird das Rahmenabkommen innenpolitisch keine Chance haben. Aber diese Verantwortung trägt jetzt der Bundesrat.»
Müller ist zuversichtlich, dass die EU bereit ist, auf die Schweiz zuzugehen. Er war kürzlich im Rahmen einer Parlamentarier-Reise in der EU-Zentrale in Brüssel: «Ich habe hinter vorgehaltener Hand Kompromissbereitschaft gespürt.» Das wären gute Nachrichten für ein mögliches Rahmenabkommen. Schreibt SRF.
«Ich habe hinter vorgehaltener Hand Kompromissbereitschaft gespürt», berichtet der grosse Staatsmann und Pöstchenjäger Damian Müller von der Luzerner FDP. Der solariumgebräunte Liebling aller Schwigermütter mit dem Intellekt einer erloschenen Glühbirne und dem Vokabular einer Kioskverkäuferin muss sich allerdings eine Frage gefallen lassen:
Fällt der Begriff «hinter vorgehaltener Hand» bei uns Bibelkundigen unter «Mauschelei» oder schon unter das sechste Gebot der Unkeuschheit? Beides ist bei Müller vorstellbar.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
6.10.2020 - Tag der Büezer
Zulagen nicht bezahlt, Verhandlungen geplatzt: Postauto-Chauffeure drohen mit Streik
Sie wurden öffentlich beschimpft, weil ihre Chefs die Steuerzahler betrogen. Sie wurden um Zuschläge geprellt und «ausgepresst», während sich ihre Manager über Boni freuten. Jetzt sollen die Postauto-Chauffeure einfach weiter alles schlucken. Doch sie drohen mit Streik.
Im Zusammenhang mit dem Postauto-Bschiss müssen sich sechs Personen wegen Leistungsbezugs-Betrug verantworten. Abgesehen davon ist es ruhig geworden um die gelben Busse. Über Chef Christian Plüss (58) und seine Kollegen in der Geschäftsleitung sind die Chauffeure voll des Lobes. «Da ist ein Kulturwandel spürbar», sagt ein Fahrer zu BLICK. Ein anderer: «Die sind glaubs schon recht. Bei Plüss habe ich jedenfalls ein sehr gutes Gefühl.»
Weiter unten in der Postauto-Hierarchie sieht das anders aus. In den Mittelbau, der zum Teil mit dabei war, als der 200-Millionen-Subventionsbetrug lief, fehlt das Vertrauen. Denn gleichzeitig mit dem Bschiss waren die Chauffeure «ausgepresst» worden, wie der damalige Postauto-Lenker Thomas Baur (56) im BLICK-Interview vor zwei Jahren zugab. Der Konzern hatte seinen Chauffeuren Zulagen und Spesen vorenthalten. Baur versprach Besserung – glaubte man seinen Worten, hatten die Fahrer bis auf wenige Ausnahmen ihr Geld schon zurückbekommen.
Chauffeure sollen bedroht werden
Bloss verhält es sich in der Realität anders: Nur in Ausnahmefällen ist das auf fünf Jahre zurückgeforderte Geld bei den Chauffeuren angekommen. Postauto will die Fahrer mit einer Pauschale für zwei Jahre abspeisen. Eine grosse Ausnahme ist der Jura, wo 1,4 Millionen Franken flossen.
In anderen Regionen streiten die Chauffeure mit Hilfe der Gewerkschaften noch immer ums Geld für Pausen, Spesen und Anfahrtswege. Zudem ist die Neuverhandlung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) gescheitert, weil Postauto vom Verhandlungstisch wegfuhr.
Und das ist nicht alles. Die Chauffeure sollen Ausnahmen beim Arbeitsgesetz akzeptieren, sonst würden sie künftig miserable Einsatzpläne erhalten, sollen sie von ihren Teamleitern gewarnt worden sein. Chauffeure berichten zudem, dass sie aufgefordert wurden, ihre Unterschrift zurückzunehmen, mit der sie die Gewerkschaft Syndicom mandatiert hatten, sie zu vertreten. Täten die Fahrer das nicht, würden beispielsweise strittige Ferientage doch nicht gutgeschrieben.
Doch Syndicom lässt sich vom gelben Goliath nicht überfahren. «Das Gesetz sieht vor, dass die Arbeitnehmer bei den Ausnahmen im Arbeitsgesetz ein Mitspracherecht haben», sagt Sprecher Christian Capacoel. Darauf bestehe man. Die Gewerkschaft habe sich für einen guten GAV eingesetzt. «Den wollen wir noch immer. Wir wünschen uns darum, dass der gelbe Riese die Verhandlungen weiterführt.»
Elternurlaub für über 50-Jährige
Postauto widerspricht der Darstellung von Syndicom, dass die versprochenen Verbesserungen nicht erfolgt seien, macht aber keine Angaben zu Zahlungen und schreibt BLICK von Massnahmen, mit denen die Arbeitsqualität der Fahrerinnen und Fahrer verbessert worden sei. Die Verkehrssparte des gelben Riesen weist zudem den Vorwurf zurück, Druck auszuüben. Es sei vielmehr die Gewerkschaft, die Druck aufsetze. Schreibt Blick.
Irgendwer muss ja den Schlamassel aus dem «Postauto-Bschiss» bezahlen. Wer, wenn nicht die Büezer? Die für das Desaster verantwortlichen Politiker*innen (die gibt es; siehe Luzerner VBL!) werden sicher nicht zur Kasse gebeten. Die Verwaltungsräte*innen treten lieber zurück und waschen ihre Hände in Unschuld. So funktioniert nun mal der Brachial-Neoliberalismus. Nicht nur am Fusse des Pilatus, obschon Pontius Pilatus seinerzeit seine Hände auch in Unschuld gewaschen hat.
-
5.10.2020 - Tag der Erklärungsnot
Streit um Bundesrats-Rente: Blocher in Erklärungsnot
Christoph Blocher beharrt auf seiner Forderung: Er will vom Bund rückwirkend sein Bundesrats-Ruhegehalt. Nun will die Regierung von ihm eine stichhaltige Begründung.
Hat sich Christoph Blocher (79) zu früh gefreut? Nachdem die Finanzdelegation des Parlaments dem Bundesrat auf die Finger geklopft hat, muss die Regierung das voreilige Ja zu Blochers Rentenforderung noch einmal überdenken. Der alt Bundesrat hatte jahrelang nichts von seinem Ruhegehalt wissen wollen. Jetzt will er es doch beziehen – rückwirkend. Es geht um 2,77 Millionen Franken.
Wegen des Widerstands aus dem Parlament muss Blocher sein Gesuch nun begründen. Offenbar liegt dem Bundesrat bis jetzt einfach ein Formular vor, mit dem der SVP-Doyen rückwirkend die Rente einfordert, berichtet die «SonntagsZeitung». Nun wurde er aufgefordert, schriftlich zu erläutern, weshalb er aus seiner Sicht Anrecht auf die Millionen hat. «Man gibt mir rechtliches Gehör», bestätigt Blocher gegenüber der Zeitung.
Er ist überzeugt, das Geld zugute zu haben und hat auch bereits gedroht, im Falle einer Ablehnung seines Gesuchs rechtliche Schritte zu prüfen. Zwei Gutachten, die der Bundesrat in Auftrag gegeben hatte, sind zum Schluss gekommen, dass Blocher die Rente rückwirkend nicht zusteht. Offen bleibt, weshalb die Regierung die Forderung des alt Bundesrats trotzdem einfach durchwinken wollte.
Bevölkerung gegen Blocher
Im Parlament, auch bei SVPlern, kommt die Forderung des Milliardärs gar nicht gut an. Sie hat die Diskussion um das umstrittene Ruhegehalt für alt Magistraten neu entfacht. Finanzpolitiker fordern eine «Lex Blocher», auch die komplette Abschaffung der Rente steht wieder zur Debatte.
Auch in der Bevölkerung ist das Unverständnis gross. Drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer sind dagegen, dass Blocher seine Rente rückwirkend ausbezahlt wird. Laut einer Umfrage von Tamedia, die die Westschweizer Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche» veröffentlichte, sind selbst innerhalb der SVP nur 44 Prozent für die Rentenauszahlung an Blocher. 49 Prozent sind dagegen.
Noch ausgeprägter ist die Ablehnung bei den anderen Parteien. Die Grünliberalen lehnen die nachträgliche Zahlung einer Rente an Blocher mit 87 Prozent wuchtig ab, gefolgt von der SP mit ebenfalls 87 Prozent, den Grünen (85 Prozent), der CVP (79 Prozent) und der FDP (77 Prozent). Gemessen am Alter sind die über 65-jährigen befragten Personen skeptischer als die junge Generation. Schreibt Blick.
Wird da plötzlich ein Sprichwort obsolet, nur weil es um den Gesalbten vom Herrliberg geht? Hackt nun plötzlich eine Krähe der andern Krähe doch ein Auge aus? Werden nun dem Alt-Bundesrat alte Rechnungen präsentiert? Er hat ja in seiner Amtszeit so ziemlich alle irgendwann vor den Kopf gestossen, beleidigt und der Verächtlichkeit preisgegeben.
Man muss Blocher nicht mögen, aber grundsätzlich steht ihm wie allen anderen Bundesrats-Pensionären*innen die Rente zu. Milliardär hin, Milliardär her. Egal, was er früher mal bezüglich seiner Rente gepoltert hat. Dass Politiker*innen ihr eigenes Geschwätz von gestern gerne und oft unter den Teppich kehren, ist eine bekannte Tatsache.
Unsere Parlamentarier*innen vom Hohen Haus in Bern haben ja beispielsweise auch die Sitzungsgelder für die Zeit des Lockdowns während der Coronakrise eingefordert, obwohl keine einzige Sitzung stattfand. Wo blieb da die Empörung? Wenn zwei das Gleiche tun, ist es trotzdem nicht das Gleiche?
Da scheinen alle Beteiligten in Erklärungsnot zu sein.
-
4.10.2020 - Tag der Neutronen
Ex-SBB-Chef Andreas Meyer im Glück: 450'000 Franken fürs Nichtstun
Ende März hatte Andreas Meyer seinen letzten Arbeitstag als SBB-Chef. Den letzten Monatslohn bekam er aber Ende September dieses Jahres ausbezahlt. Am 1. April hatte Vincent Ducrot (58) seinen ersten Arbeitstag als SBB-CEO. Um seinen Vorgänger Andreas Meyer (59) ist es seither ruhig geworden.
Am Donnerstag aber meldete sich der Ex-Chef zu Wort. Auf Facebook frohlockte er: «Gestern war mein letzter Tag unter SBB-Vertrag. Heute, am 1.10.2020, ist mein ‹Independence Day›.» Letzter Tag unter SBB-Vertrag? Das wirft Fragen auf. Liessen die SBB nicht im April verlauten, er habe sein Amt «per Ende März» abgegeben?
Frage nach Lohn bleibt unbeantwortet
Auf Nachfrage erklärt Meyer: «Mit den SBB wurde im September 2019 abgemacht, dass das Arbeitsverhältnis auf Ende September 2020 aufgelöst wird. Mit der Bekanntgabe des Rücktritts konnte die offizielle Suche nach einem Nachfolger gestartet werden.»
Damals sei nicht klar gewesen, wann eine geeignete Person zur Verfügung stehe und ob sie ein Einführungsprogramm benötigt. «Deshalb wurde vereinbart, dass ich bis Ende September 2020 zur Verfügung stehen würde.»
Auf die Frage, ob er in den sechs Monaten seit seinem Abgang weiterhin den vollen CEO-Lohn erhalten habe, geht Meyer nicht ein. Ein SBB-Sprecher richtet jedoch aus: «Andreas Meyer hat im September 2019 seinen Rücktritt bekannt gegeben.»
Weiter lässt die Bahn wissen: «Vertraglich ist geregelt, dass seine Kündigungsfrist ein Jahr beträgt. Daher lief sein Vertrag bis Ende September 2020. Der Lohn ist Bestandteil des Vertrags.»
Aufgrund der frühzeitig abgeschlossenen Nachfolgeregelung sei der Wechsel dann im April erfolgt, erklärt der Sprecher noch. Es sei aber vereinbart worden, dass Meyer bis Ende September 2020 «jederzeit zur Verfügung» stehen müsse. Schreibt SonntagsBlick.
Auch wenn das jetzt eine Story ist, die viele Gemüter bewegt: Pacta sunt servanda, wie wir* Lateiner zu sagen pflegen. «Veträge sind einzuhalten.»
Hand aufs Herz: Jeder, jede und jedes** von uns hätte unter den vertraglichen Bedingungen, so sie denn tatsächlich stimmen, den Meyer gemacht!
* Ist Ihnen schon aufgefallen, dass ich gerne mit meinen Latein-Kenntnissen protze? Seien Sie gnädig in Ihrem Urteil: Es ist meine späte Rache für stundenlanges Lernen für Nichts. Bin ja weder Pfarrer noch Mediziner geworden.
** Politisch korrekt: Beim AVZ wird niemand diskriminiert oder vergessen. Auch nicht die Neutrums (aus dem lateinischen «keins von beiden») oder Neutronen (das wär dann was ganz anderes).
-
3.10.2020 - Tag der Superspreader
Welche Medikamente Donald Trump im Spital wirklich verabreicht werden
In der Nacht zum Samstag teilte Trumps Leibarzt Sean Conley mit, dem Präsidenten gehe es "sehr gut". Er benötige keine künstliche Beatmung. Nach Beratung mit Spezialisten habe man aber begonnen, ihn mit dem Medikament Remdesivir zu behandeln. Er habe die erste Dosis bekommen und ruhe nun. Medizinkorrespondent Sanjay Gupta sagte auf CNN, Remdesivir werde in der Regel für Covid-19-Patienten verschrieben, die Atemprobleme hätten. Schreibt DER SPIEGEL.
Vergessen Sie alles, was Sie in diesem SPIEGEL-Artikel über die medikamentöse Behandlung von The Donald lesen. Das sind reine Fake-News. Der AVZ wäre nicht der AVZ, würde er Ihnen nicht die volle Wahrheit über Trumps Medikamente nach eingehender Recherche offenbaren. Siehe Bild.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
2.10.2020 – Tag der Louis-Quinze-Perücken
US-Präsident Donald Trump mit Coronavirus infiziert: «Ich bin positiv getestet worden»
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit. Zuvor hatte sich Hope Hicks, eine enge Beraterin des US-Präsidenten mit dem Coronavirus infiziert.
US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt er auf Twitter am Freitag mit.
Trump und First Lady Melania hatten sich einem Coronatest unterzogen, nachdem eine enge Präsidenten-Beraterin positiv auf das Virus getestet wurde. Beide Resultate seien positiv gewesen. «Wir werden unverzüglich unsere Quarantäne antreten und den Gesundungsprozess beginnen», so der US-Präsident auf Twitter. Und im selben Eintrag gab sich Trump zuversichtlich: «Wir werden das gemeinsam schaffen!» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Was lernen wir daraus?
1. Es gibt doch noch sowas wie Gerechtigkeit.
2. Unser Mitleid hält sich in Grenzen.
3. Schutzmasken schützen definitiv besser als eine Louis-Quinze-Perücke, die aussieht wie eine Landepiste für verwirrte Vögel.
-
1.10.2020 – Tag der Dilettanten
Dritter Fall in vier Tagen! Räuberbande sprengt Bankomat in Rothrist AG
Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, einen Bankomat in Rothrist AG zu sprengen. Das ist nach zwei Vorfällen im Kanton Bern bereits der dritte Anschlag innerhalb einer Woche.
Eine Bankomaten-Bande hat in Rothrist AG gewütet! Wie ein BLICK-Leserreporter schreibt, sollen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag versucht haben, einen Bankomaten an der Coop-Tankstelle zu sprengen.
«Unzählige Polizisten waren vor Ort», schreibt der Leser. Die Tankstelle und diverse Parkplätze wurden abgesperrt.
Aline Rey von der Kantonspolizei Aargau bestätigt gegenüber BLICK den Vorfall. «Es handelt sich um einen AKB-Bankomaten. Die Unbekannten hatten keinen Erfolg. Es ist bei einem Versuch geblieben.» Die Tatbestandsaufnahme sei im Gange.
Die gleiche Bande wie in Bern am Werk?
24 Stunden zuvor kam es in Büren an der Aare BE zu einem Anschlag auf einen UBS-Bankomaten. Die Täter konnten mit einem Roller flüchten. Der Geldautomat wurde vollständig zerstört.
Am Montag knallte es in Utzenstorf BE. Maskierte haben dort kurz vor 3.30 Uhr einen Bankomaten der Raiffeisenbank-Filiale aufgesprengt. Während einer Wache hielt, schnappte sich der andere das Geld, packt es in eine grosse Sporttasche. Danach flüchtete das Panzerknacker-Duo auf einem Roller – genauso wie die Gangster von Büren an der Aare BE. Ob in Rothrist AG die gleichen Kriminellen am Werk waren, ist noch unklar. Schreibt Blick.
Zitieren wir heute wieder einmal Bertolt Brecht: «Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.»
-
30.9.2020 - Tag der Durchlauferhitzer
Ausserrhoder Chauffeur (39) glaubt an Verschwörungstheorien. BLICK hat ihm zugehört – Erklären Sie uns Ihre Welt, Herr Signer
Verschwörungstheorien haben während der Corona-Krise Hochkonjunktur. Pascal Signer (39) aus dem Appenzellerland ist Anhänger der QAnon-Theorie. Er glaubt, die Welt wird von einer geheimen Elite regiert.
Das Coronavirus bringt unsere Weltordnung ins Wanken – und neue Verschwörungstheorien ans Tageslicht. Besonders eine scheint dabei im Trend zu liegen: «QAnon». An den Schweizer Corona-Demos sind die Q-Zeichen unübersehbar. Auch die Frau, die Daniel Koch (65) im Grossmünster bedrängte, zeigte sich offensiv mit einem Plakat der Bewegung (BLICK berichtete). Anhänger der Theorie denken, die Welt werde von einem Geheimbund regiert, der sich vom Blut getöteter Kinder ernährt. Einer von ihnen ist Pascal Signer (39) aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden. BLICK hat ihn getroffen.
Der Chauffeur hat sich lange überlegt, ob er sich als QAnon-Anhänger outen soll. Seine Motivation, es dann doch zu tun. «Vieles, was über uns geschrieben wird, stimmt nicht», erklärt er auf einem Bänkli im Grünen. Und: «Ich will einfach sagen, dass ich kein Rechtsradikaler bin.» In seiner Welt hängt alles irgendwie zusammen: Trump (74), die Queen (94) in London, der Papst (83) und auch der Kult-Schauspieler Tom Hanks (64) spielen alle eine Rolle in der globalen Verschwörung. «Ja, ich denke, es gibt eine Elite von Superreichen, die die Welt im Hintergrund regiert», so Signer.
Kinderblut für ewige Jugend
Im Internet verbreiten QAnon-Anhänger auch, dass diese Elite die Formel für ewige Jugend gefunden hat: im Blut Zehntausender Kinder, die gefoltert und getötet werden, um an den Stoff namens Adrenochrom zu kommen. Halt, müssten hier nicht alle Alarmglocken des gesunden Menschenverstands schrillen? «Was wäre, wenn es trotzdem stimmen würde?», fragt Signer rhetorisch zurück und behauptet: «Jeden Tag verschwinden 20'000 Kinder!» Und überhaupt: Der Schauspieler Tom Hanks sei seit Mai nicht mehr gesehen worden. «Ich habe gelesen, dass Hanks Hollywood mit Adrenochrom versorgte und darum verhaftet wurde.» Doch: Für ihn sei die Kinderblut-Sache aber eher ein Nebengleis, sagt Signer.
Der Chauffeur setzt sich täglich bis zu acht Stunden mit dem Thema auseinander. «Wenn ich fahre, höre ich QAnon-Podcasts, die einfach im Hintergrund laufen.» Am Feierabend haut der Appenzeller dann selber in die Tasten, schreibt in sozialen Netzwerken seine Kommentare. «An vielen Orten bin ich schon gesperrt», sagt er mit einem Schmunzeln. «Etwa auf den Kanälen des Bundesamtes für Gesundheit.» Auch bei BLICK würden seine Kommentare dauernd gelöscht. Signer sieht sich als «digitalen Krieger», der einfach Fakten liefere: «Eben wie Q.» Zeit habe er genug, da er Single sei und keine Kinder habe.
Video auf Video, Klick auf Klick
Auf QAnon kam er durch die Corona-Krise. Der Mann, der seit 21 Jahren in der Wrestling-Szene aktiv ist, war frustriert über die Massnahmen und abgesagten Events. Irgendwann stiess er auf Youtube zwischen Corona-Beiträgen auf die Verschwörungstheorie. Dann führte ein Video zum anderen. «Es werden dir bei jedem Video ja gleich Vorschläge gemacht, was man als Nächstes schauen könnte.» Klick um Klick ging er der Sache auf den Grund.
Ein Merkmal der US-Verschwörungstheorie: Jeder kann mitmachen. «Q», laut der Erzählung eine Person oder Gruppe aus dem inneren Machtzirkel der USA, gibt der Öffentlichkeit immer wieder Hinweise. Tausende kamen seit 2017 zusammen. Der Interpretationsspielraum ist riesig: Ein jüngerer Hinweis zeigt nur eine Mickey-Mouse-Uhr. Dafür ist die politische Stossrichtung klar. Schon der allererste Hinweis besagte, Hillary Clinton (72) würde bald verhaftet. Donald Trump ist für die Bewegung dafür der Kämpfer des Guten. In den USA kam es in Zusammenhang mit QAnon schon zu Tötungsdelikten. Das FBI stuft die Bewegung als mögliche Terrorgefahr ein.
Eine Mickey-Mouse-Uhr mit Bedeutung
Für Pascal Signer bedeutet QAnon aber etwas anderes. «Man wird immer wieder aufgefordert, selbst zu recherchieren. Und nicht alles zu glauben, was in den Medien steht.» Und genau das machen der Ausserrhoder und seine Mitstreiter. Im Fall der erwähnten Mickey-Mouse-Uhr ist QAnons aufgefallen, dass ausgerechnet Schauspieler Tom Hanks in einem Film eine Uhr mit Mickey-Mouse-Zifferblatt getragen habe. Eben jener Tom Hanks, der Hollywood mit Kinderblut versorgen soll! Alles Zufall? Für die Verschwörungs-Fans ist die Antwort klar. Schreibt Blick.
Statt dem Bartli den Most abzudrehen, erniedrigt sich unser aller Boulevardblatt von der Zürcher Dufourstrasse, als willfähriger Durchlauferhitzer für ein paar Klicks die kruden Thesen des Armleuchters aus dem Appenzellerland unter die Leute zu bringen. Was, by the Way, nun auch der AVZ tut.
-
29.9.2020 - Tag des Scheiterns
SOZIALHILFE IM ASYLBEREICH: «Integration kann man nicht kaufen» - SVP-Nationalrätin Bircher führt den Kampf der Gemeinden an
Der Bund will für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge nur noch während fünf Jahren Sozialhilfe zahlen. Der Schweizerische Gemeindeverband bekämpft diese Pläne.
Bei den Gemeinden sorgen neue Pläne des Staatssekretariats für Migration (SEM) für Unmut. Es möchte künftig nur noch fünf statt sieben Jahre lang Geld für die Sozialhilfe von vorläufig aufgenommenen Personen beisteuern – gleich lang wie für anerkannte Flüchtlinge. Voraussichtlich im nächsten Frühjahr wird der Bundesrat einen Entscheid fällen. «Mit diesen Massnahmen verlagert der Bund das finanzielle Risiko der Nichtintegration schon früher auf die Kantone und Gemeinden», sagt Christoph Niederberger. Der Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands will das Vorhaben des Bundes auf politischer Ebene bekämpfen. Auch die Städte lehnen die verkürzte Dauer ab, wie Nicolas Galladé (SP), Sozialvorsteher der Stadt Winterthur und Präsident der Städteinitiative Sozialpolitik, sagt.
Der Bund entrichtet den Kantonen pro anerkanntem Flüchtling (1500 Franken) und pro vorläufig aufgenommener Personen (1550 Franken) einen Beitrag an die Sozialhilfekosten, die sogenannte Globalpauschale. Die Gemeinden können den Kantonen die Sozialhilfe-Kosten für die Personen im Asylbereich so lange in Rechnung stellen, wie der Bund für die Globalpauschale aufkommt.
Bund verspricht sich Anreiz für rasche Integration
Das SEM sieht in seinem Vorhaben keinen Leistungsabbau. Es will die Neuerung nämlich kostenneutral umsetzen, wie Sprecher Lukas Rieder auf Anfrage sagt. Das bedeutet: Die Kantone erhalten gleich viel Geld wie bisher, aber verteilt auf fünf anstatt sieben Jahre. «Dadurch soll ein Anreiz für eine rasche und nachhaltige Integration geschaffen werden», sagt Rieder. Die Kantone erhielten früher die nötigen finanziellen Mittel, um auch im Rahmen der Sozialhilfe vermehrt situationsbedingte Leistungen im integrativen Bereich zu finanzieren. Das SEM erhofft sich durch die Änderung eine tiefere Sozialhilfeabhängigkeit von Personen im Asylbereich.
Aktuell werden 87 Prozent der vorläufig aufgenommenen Personen und 83,1 Prozent der anerkannten Flüchtlinge von der Sozialhilfe unterstützt. Die Erwerbsquote beträgt nach sieben Jahren Anwesenheit in der Schweiz 52,9 respektive 43,3 Prozent. Auch dank einer neuen Integrationsagenda sollen diese Werte verbessert werden. Zu diesem Zweck hat der Bund die Integrationspauschale an die Kantone auf 18'000 Franken verdreifacht. Dank Sprachkursen, individueller Förderung und vertieften Potenzialabklärungen soll die Hälfte aller erwachsenen Personen aus dem Asylbereich sieben Jahre nach Einreise nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt integriert sein.
Christoph Niederberger vom Gemeindeverband hält diese Zielvorgaben für sehr ambitioniert. «Mehr Geld bedeutet nicht automatisch eine tiefere Sozialhilfeabhängigkeit», sagt er. Die siebenjährige Globalpauschale sei eine Art Rückversicherung für die Gemeinden, falls die Integration in den ersten fünf Jahre misslinge. Nicolas Galladé weist darauf hin, dass die Integrationspauschale erst 2019 erhöht worden sei und die kantonalen Integrationskonzepte erst nächstes Jahr in Kraft treten. «Wir sollten diese zuerst einmal gut implementieren und Erfahrungen sammeln, bevor man schon wieder neue konzeptionelle Änderungen vornimmt.»
Auch Nationalrätin Martina Bircher (SVP/AG) kündigt Widerstand an. «Mit der Erhöhung der Integrationspauschale wollte der Bund die Gemeinden im Zuge der Flüchtlingskrise besänftigen. Dass er zwei Jahre später durch die Hintertüre versucht, die Dauer der Globalpauschale zu kürzen, ist ein Affront», sagt die Sozialvorsteherin von Aarburg. Damit lasse er die Gemeinden im Regen stehen. Bircher schlägt in einem Vorstoss, den sie in der abgelaufenen Session eingereicht hat, eine ganz andere Lösung vor.
Sie verlangt, dass der Bund für den Asylbereich den Kantonen während mindestens zehn Jahren Globalpauschalen für die Sozialhilfe zahlt. «Integration kann man nicht kaufen. Mehr Geld bedeutet nicht automatisch eine höhere Erwerbsquote», sagt sie mit Blick auf die Integrationsagenda. Und die verkürzte Dauer bei der Globalpauschale werde vor allem die Gemeinden treffen, weil sie von der Erhöhung der Integrationspauschale nicht direkt und finanziell höchstens potenziell profitierten.
SVP-Nationalrätin fordert längere Bundesbeteiligung
Bircher befürchtet, dass die Coronakrise den Personen aus dem Asylbereich den Einstieg in den Arbeitsmarkt zusätzlich erschwert. «Viele Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sind bildungsfern und hätten – wenn überhaupt – Chancen, in Berufen mit tiefem Qualifikationsprofil zu arbeiten.» Mit der sich abzeichnenden Rezession werde sich der Verdrängungskampf in diesen Branchen noch verschärfen. Bircher sieht den Bund auch aus staatspolitischer Sicht in der Pflicht: Er sei zuständig für die Asylpolitik und trage deshalb auch eine finanzielle Verantwortung.
Die Gemeinden blicken mit Sorge auf das Jahr 2022. Zum einen müssen sie dann die vollen Sozialhilfekosten von Personen im Asylbereich, die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 einreisten, zahlen. Zum anderen drohen wegen der Coronakrise vermehrt Langzeitarbeitslose in der Sozialhilfe zu landen.
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe rechnet im pessimistischsten Szenario mit 100'000 zusätzlichen Sozialhilfebezügern – und 1,36 Milliarden Franken Mehrausgaben. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wie wahr! Integration kann man nicht kaufen. Doch ebenso wahr ist die Tatsache, dass eine sinnvolle Integration von Flüchtlingen von allem Anfang an (sic!) vernünftige und praktikable Pläne seitens der Behörden braucht. Diese Pläne, die tatsächlich auch vorhanden sind und hohe finanzielle Mittel benötigen, stehen meistens diametral den Ansichten der so genannten «Asylindustrie» gegenüber, die angeblich alle Probleme günstiger handeln kann.
Dass sich SVP-Nationalrätin Bircher mit dem Status quo in fatalistischer Art und Weise zufrieden gibt und die Hände in den Schoss der endlosen Sozialhilfe legt, zeugt mehr von Hilflosigkeit als von Tatendrang und Esprit. Birchermüesli at its best statt einer währschaften Bernerplatte halt wieder mal von der wohlgenährten Dame. Das Problem auf die «Bildungsferne» zu reduzieren, steht vermutlich in den von der «WELTWOCHE» propagierten SVP-Statuten, ist aber trotzdem falsch und trifft auch auf viele Schweizer*innen zu.
Dadurch nimmt man in Kauf, dass die Integration in einer erschreckend hohen Prozentzahl scheitert (siehe Arbeitslosenstatistik, auch in Zeiten vor Corona!) und letztendlich auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus, viel höhere Kosten verursacht als eine von allem Anfang an professionell geplante und dezidiert auf die Probleme der einzelnen Flüchtlinge ausgerichtete Integration.
Das würde zwar höhere Kosten verursachen als die 08/15-Schablonen, wäre aber eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Ohne Investitionen läuft nämlich auch im «Human Resource Management» rein gar nichts. Und genau darum geht es! Das wird ja schliesslich nicht zu Unrecht an der Kaderschmiede der Hochschule St. Gallen vom ersten Tag an in die Köpfe der zukünftigen Wirtschaftselite gehämmert.
Ich nenne hier nur eines der vielen Beispiele: Echte Kriegsflüchtlinge, nicht selten von den grauenhaften Erlebnissen in ihren Heimatländern traumatisiert, in Asylunterkünften ohne psychologischen Beistand mit den Wirtschaftsmigranten und den ein- und ausgehenden Drogendealern zusammenzupferchen und alleine zu lassen, ist der Nährboden für eine Integration, die früher oder später scheitern muss und irgendwo zwischen Baselstrasse, Inseli und Aufschütti endet. Jedenfalls in Luzern.
Dass gescheiterte Integrationen aber langfristig zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Von diesen Verwerfungen werden dann allerdings nicht die Sparfüchse von heute profitieren, sondern die Populisten von morgen. Donald Trump («We Build the Wall») lässt grüssen.
PS. Ich könnte Ihnen auch tolle Geschichten über die gelungene Integration von Flüchtlingen erzählen. Selbst aus Luzern.
-
28.9.2020 - Der Tag danach
Armeegegner wollen Kampfjet mit einer «Express-Initiative» abschiessen
Die Kampfjet-Gegner rechneten nicht mit einem so knappen Abstimmungsresultat – jetzt wollen sie die Beschaffung via Typenfrage verhindern.
Enge Mitarbeiter von Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) waren am Sonntagmorgen extrem nervös. Sie trauten den Umfragen nicht, die ein klares Ja zum Kampfjet voraussagten. Der Tagesverlauf gab ihnen recht, am Schluss schrammten die Befürworter und die Bundesrätin mit 50,2 Prozent Ja haarscharf am Fiasko vorbei.
Genau umgekehrt die Ausgangslage im Lager der Kampfjet-Gegner um die SP, Grünen und die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA). Dort rechnete man aufgrund der deutlichen Umfragen mit einer mehr oder weniger deutlichen Zustimmung. Als sich gestern ab Mittag die äusserst knappe Entscheidung abzeichnete, als das Nein plötzlich in Reichweite lag, wirkten die Kampagnenverantwortlichen wie überrumpelt. Sie hatten dieses Szenario im Vorfeld nicht vertieft diskutiert.
Der Zuger alt Nationalrat Jo Lang (Alternative, Grüne), Zugpferd der GSoA, sagte: Bei einem Nein müsste sofort eine Denkpause eingeschaltet werden, ein Marschhalt bei Rüstungsausgaben. «Ein Nein bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Armee keine zeitgemässe Antwort auf die heutigen Sicherheitsprobleme mehr sehen.» Aber auch das haarscharfe Ja, das am Schluss resultierte, ist wie ein Sieg für die Verantwortlichen des Referendumskomitees. Die Befürworter hätten ihre besten Kräfte aufgeboten, die glaubwürdigste Bundesrätin, und trotzdem nur mit Ach und Krach gewonnen. Schreibt die AargauerZeitung.
Am Tage danach – Oder wie man die Demokratie ad absurdum führt
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Oder frei nach Otto von Bismarck: «Es wird niemals so viel gelogen wie vor und nach der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd.»
Und da wundert man sich, dass so viele Menschen der Meinung sind, die da Oben machen ja sowieso was sie wollen, egal was man wählt.
Rennfahrer-Legende Niki Lauda schreibt in seiner Biographie: «Es ist egal, ob du ein Rennen mit zwei Minuten oder 0,2 Sekunden Vorsprung gewinnst: Gewonnen ist gewonnen.» Gilt diese Aussage nicht auch für demokratische Wahlen? Zumal es in der Schweiz bei nationalen Wahlen ja noch sowas wie die Hürde des Ständemehrs gibt.
Herzliche Grüsse an den Zuger alt Nationalrat Jo Lang (Alternative, Grüne). «Und bist du nicht willig, zupf' ich eine EXPRESS-INITIATIVE aus dem Ärmel.» Grüne Demokratie?
-
27.9.2020 - Tag des Konjunktivs
Experten schauen in die Kristallkugel: So wird die Corona-Pandemie schliesslich enden
Ein Impfstoff bis Anfang 2021, ein stetiger Rückgang der Fälle bis zum nächsten Herbst und in einigen Jahren wieder Normalität - so sehen Experten den weiteren Verlauf und Ausklang der Covid-19-Krise. Doch das Virus dürfte mit uns bleiben.
Die Corona-Krise ist auch eine Blütezeit der Experten, Virologen und Epidemiologen. Ein Blick in die Kristallkugel dieser Experten verrät, dass die meisten davon ausgehen, dass die Krise im nächsten Jahr ausgestanden ist. Sicher ist das nicht, und wie zurück zur Normalität zu gelangen, darüber scheiden sich die Geister.
Der Epidemiologe Marcel Salathé, Mitglied der Corona-Taskforce Wissenschaft des Bundes, sieht einen Silberstreifen am Horizont. Es gebe «viel Grund zur Hoffnung», sagt Salathé in einem Interview mit der «SonntagsZeitung». Er glaubt, dass wir die Corona-Pandemie bereits Anfang 2021 so weit in den Griff bekommen, dass Covid-19 nicht mehr schlimmer ist als eine Grippe: «Nach einem holprigen Sommer» seien wir «auf einem guten Weg». Er gehe nicht davon aus, dass im Winter «alles ganz schlimm werde. Ich glaube vielmehr, die Situation wird bald besser.» Falls Sie das Konjunktiv-Geschwurbel (hätte, könnte) wirklich bis zum Ende lesen wollen: Hier geht es weiter bei SonntagsBlick.
Mike Shiva hätte vermutlich einen ebenso tollen und nichtssagenden Blick in die Kristallkugel geworfen. Allerdings zum Tarif von CHF 3.50. Pro Minute.
-
26.9.2020 - Tag von Friedrichs von Schiller
Umstrittene Wissenschafter raten zur Rückkehr zur Normalität: «Berset könnte berühmter werden als Wilhelm Tell»
Weg mit den Masken, Schluss mit Quarantäne, fertig mit Abstandhalten: Die deutschen Forscher Sucharit Bhakdi und Karina Reiss sagen, weshalb sie die Coronamassnahmen total falsch finden – und nehmen Stellung zur Kritik, ihre Ansichten seien wissenschaftlich nicht haltbar.
Beim Publikum kommen Sucharit Bhakdi und Karina Reiss gut an. Ihr Buch «Corona Fehlalarm?» hat sich schon über 200'000 Mal verkauft und steht seit Wochen zuoberst auf der «Spiegel»-Beststellerliste der Taschenbücher. Wissenschafter und Universitäten hingegen distanzieren sich vom deutschen Forscherehepaar. Als Sohn des ersten thailändischen Botschafters in der Schweiz hat Bhakdi vier Jahre als Kleinkind in der Schweiz verbracht und beste Erinnerungen an diese Zeit.
Zum ersten grossen Interviewtermin für eine Schweizer Zeitung begrüssen sie die Journalisten mit freundlichem Händedruck im Hotel Vitznauerhof. Am Donnerstagabend hielten Bhakdi und Reiss im luzernischen Vitznau auf Einladung des Rotary Club Küssnacht-Rigi-Meggen einen Vortrag über das Coronavirus. Schreibt die Aargauer Zeitung. Das Interview lesen Sie hier.
Das wär' doch mal ein Ding: Bundesrat Berserker berühmter als Friedrich von Schillers Wilhelm Tell? Berüchtigter als die Schweizer Sagenfigur ist er ja schon.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
25.9.2020 - Tag des Freisinns
Überdurchschnittlicher Prämienanstieg in Luzern: Es braucht endlich eine Debatte über den Wert unserer Gesundheit
Haben Sie Ihre Krankenkassenprämie für 2021 schon verglichen? Wieder steigen unsere monatlichen Gesundheitskosten, im Kanton Luzern sogar überdurchschnittlich um 1,4 Prozent (zentralplus berichtete). Seit 1996 hat die Schweizer Durchschnittsprämie jedes Jahr um rund 3,7 Prozent zugenommen. Dass das kaum mehr Empörung auslöst, ist erbärmlich für unser Land – gerade in Pandemiezeiten.
Was kriegen wir für dieses Geld? Bestimmt eine der weltweit besten gesundheitlichen Versorgungen. Jedoch sind in den letzten 20 Jahren die Krankenkassenprämien im Vergleich zu den Löhnen und Renten geradezu explodiert. Es gibt Familien, die monatlich höhere Prämien- als Mietkosten haben.
Mehrkosten fliessen den Falschen in die Tasche
Wenn dieses Geld wenigstens bei denen auf dem Konto landen würde, die es verdient hätten; beispielsweise beim Pflegepersonal, das in den Frühlingsmonaten wegen Covid-19 Sonderefforts leisten musste. Aber nein, die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten fliessen zum Beispiel in die Dividenden der Pharmabranche, ins Marketing der Krankenversicherer und auf die Lohnkonti von Chef- und Fachärzten; dorthin, wo hohe sechsstellige Jahresgehälter Standard sind.
Für die Pflegenden gab‘s bekanntlich Applaus, was den Entscheidungsträgerinnen und -trägern in der Politik offenbar genügt.
Gesundheit an erster Stelle, nicht Geld
Die Krankenversicherer tun gut daran, ihre milliardenschweren Reserven abzubauen. Nicht nur, weil dieses zu viel bezahlte Geld uns Prämienzahlerinnen und -zahlern gehört, sondern um die Wogen der Bevölkerung geglättet zu halten. Bald wird das Thema Gesundheitskosten nämlich auf nationaler Ebene Konjunktur haben, wenn die Volksinitiativen zur Umwälzung des Gesundheitssystems von CVP und SP in die eidgenössischen Räte und später vors Volk kommen.
Wir müssen endlich eine Debatte darüber führen, wie wir die Kosten für unsere Gesundheit in den Griff bekommen, ja, was uns unsere Gesundheit wert ist. Denn nicht erst seit Corona ist es offensichtlich: Oft steht nicht die Genesung des Patienten im Fokus, sondern das, was man an ihm verdienen kann. Das muss sich sofort ändern und das bedingt tatsächlich einen Systemwechsel, den es aber ohne neues, unbefangenes Politpersonal in Bern nie geben wird.
135.60 Franken gespart
Übrigens: Gemäss dem Prämienvergleichsdienst des Bundes spare ich 2021 135.60 Franken, wenn ich zur günstigsten Grundversicherung wechsle. Das bedeutet ein Essen zu zweit auswärts bei minimalem Aufwand, nämlich einen eingeschriebenen Brief an meine jetzige Versicherung. Immerhin lässt sich so im Kleinen etwas gegen den persönlichen Prämienschock unternehmen. Schreibt ZentralPlus.ch.
Mehrkosten fliessen den Falschen in die Tasche, meint Autor Mario Stübi, und zählt gleich ein paar der üblichen Verdächtigen auf. Dabei vergisst er aber eine Spezies, die nicht nur gnadenlos abkassiert, sondern auch als willfährige «Pöstchenjäger*innen» Reformen unserer längst überbordenden Gesundheitsindustrie frei nach dem Motto «wer zahlt befiehlt» zu blockieren weiss.
Von den 246 Gesalbten aus dem Parlament (46 Ständeräte und 200 Nationalräte) dürften wohl so um die 90 Prozent in irgendeiner Form mit einer Krankenkassen-Versicherung verbandelt sein.
Als besonders abschreckendes Beispiel dieser widerwärtigen Zunft der Abkassierer*innen darf man ruhig und ohne schlechtes Gewissen den solariumgebräunten Liebling aller Schwiegermütter, FDP-Ständerat Damian Müller aus dem Kanton Luzern erwähnen. Man darf sich schon fragen, wer hat diesen intellektuellen Tiefgänger aus der Ecke des abartigen Neoliberalismus denn gewählt? Genau! Es waren die Luzernerinnen und Luzerner. Was bedeutet das? Schnauze halten, keine Stories über ein Nachtessen zu zweit schreiben und KK-Prämien bezahlen. Ihr habt es so gewollt! So einfach ist das.
You get what you vote for, wie die Amerikaner zu sagen pflegen.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
24.9.2020 - Tag der Dummschwätzer
Parlamentarier verlieren öffentlich die Nerven, den Verstand und den Anstand: Huere fucking Bundeshaus
Die Klimademo auf dem Bundeshaus hat dem Klima vielleicht nicht geholfen. Doch sie hat den Politikern offenbar am Nervenkostüm gezehrt.
Die schlechte Nachricht: Dem Klima hat die Besetzung des Bundesplatzes nicht viel gebracht. Die gute: dem Volk schon. Dank der Protestaktion konnte dieses seine Vertreter einmal von einer anderen Seite kennenlernen. Wenn auch nicht von der besten.
Kopfschüttelnd beobachtete das Land, wie wenig es braucht, um selbst die erfahrensten Politiker auf die Palme zu bringen. Ein paar harmlose Aktivisten reichen, um ihnen die Zornesröte auf die Stirn zu treiben und jeden Anstand fahren zu lassen. So wie bei SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel (54), der die Klimajugendlichen als «Arschlöcher» beschimpfte, die den «Rüssel heben» und «abfahren» sollten.
Wie kann man so die Nerven verlieren?
Klar, die Aktion auf dem Bundesplatz war illegal, und die Stadt Bern reagierte einmal mehr zaudernd und zu spät. Doch wie kann man derart die Nerven verlieren wegen Yoga-Stunden und veganer Burger? Und das als bürgernahe Milizpolitiker, als die sie sich verstehen?
Weltanschaulich bedingt hatte der politische Furor eine rechte Schlagseite – doch auch bei Linken führte die Klimademo zu verbalen Entgleisungen. Jacqueline Badran (58), Zürcher SP-Nationalrätin, machte ihrem Ruf alle (zweifelhafte) Ehre. In einer für sie typischen Tirade fluchte sie über Journalisten, weil die immer nur über «d�� huere fucking Glarner» berichteten – und nicht über die Anliegen der Klimajugend.
Sogar für Badran starker Tobak
Man sollte sich nun keine falschen Vorstellungen machen: Auch in den Seitengängen des Bundeshauses ist der Ton zwar herzlich, aber oft auch rau. Doch einen Ratskollegen in aller Öffentlichkeit so zu beleidigen – das ist sogar für eine Kettenraucherin wie Badran starker Tobak.
Wobei der so beleidigte Andreas Glarner (57) nicht in die Opferrolle passt. In der Hitze eines Gefechts über die Klima-Demo nannte der SVP-Nationalrat seine grüne Basler Ratskollegin Sibel Arslan (40) «Arschlan» – wofür er sich später entschuldigte.
Wenn der Rechtsstaat nicht Rechtsstaat ist
Glarner sprach ihr auch das Recht ab, überhaupt im Parlament zu sitzen. Denn für den Aargauer ist die in der Türkei geborene Arslan gar keine richtige Schweizerin. «Das nennt sich Recht und Ordnung, das hat es in deinem Staat nicht gegeben», schleuderte er ihr öffentlich ins Gesicht.
Was nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Glarner, der gegenüber der illegalen Besetzung auf den Rechtsstaat pochte, nimmt es damit selbst nicht so genau. Laut dem Gesetz gibt es nämlich keine Papierli-Schweizer. Sondern nur Bürger und Nichtbürger. Gut, Wutbürger offenbar auch. Vor der Bundeshauskuppel, aber manchmal auch darunter. Schreibt Blick.
Die üblichen Verdächtigen der Dummschwätzer und Eliten mit der Spreizwürde der Etablierten aus unserem Parlament verlieren also Nerven, Vernunft, Anstand und Contenance, wie unser aller Blick schreibt. Trump würde sowas zu Recht «Fake News» nennen. Denn etwas, was nicht vorhanden ist, kann man auch nicht verlieren, abgrundgutester Blick.
-
23.9.2020 - Tag der Ballermänner und Ballerfrauen
Schweizer Skiorte zittern: Deutsche Regierung rät von Reisen im Winter ab
Eine Wintersaison ohne deutsche Touristen? Bis dato undenkbar. Diesen Winter könnte es aber so weit kommen. Deutschland ruft seine Bürger auf, sich zu überlegen, ob Reisen im Winter sein müssen.
Auch in Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen derzeit wieder an. Die Regierung rät deshalb von Reisen im Winter ab. So sagte Kanzleramtschef Helge Braun im Morgenmagazin von ARD und ZDF: «Wir müssen jetzt gut durch diesen Winter kommen, aber im Grunde haben wir sowohl für den Bereich der Arbeit, für den Bereich des Tourismus, wir haben überall Konzepte, die uns eigentlich eine Chance geben, dass wir das schaffen, wenn wir konsequent sind.»
Disziplin sei auch bei der Planung der Winterferien verlangt. Im Sommer seien Reiserückkehrer wesentliche Treiber des Infektionsgeschehens auch in Deutschland gewesen, so Braun.
«Müssen den Winter noch durchhalten»
Gesundheitsminister Jens Spahn betont, auch durch Reisen und Mobilität würden zusätzliche Infektionsrisiken entstehen. «Deswegen werbe ich schon auch dafür, sich genau zu überlegen, ob jetzt im Herbst und im Winter das Reisen auch ausserhalb Deutschlands sein muss.» Man müsse nun einheitliche Signale senden, «dass wir diesen Herbst und Winter noch durchhalten müssen», fordert er.
«Das Virus ist hier der Spielverderber, nicht ich, nicht wir in der Politik. Aber gerade in den Bereichen, finde ich, müssen wir jetzt bei Herbst und Winter besonders vorsichtig sein und da wünsche ich mir schon, dass es keine weiteren Öffnungen gibt», so Spahn. An Ferien im Ausland könne man dann frühestens im Frühling denken. In der Hoffnung, dass dann ein Impfstoff vorhanden sei. Schreibt Blick.
Alles halb so wild. Die deutsche Regierung hat im Sommer auch von Reisen zum Ballermann (Mallorca) abgeraten. Die Germanen*innen reisten trotzdem in Scharen genau dort hin. Man kann den Deutschen so ziemlich alles verbieten, nur nicht das Reisen.
-
22.9.2020 - Tag der Molligen und Dünnen
Stadt Luzern: SP-Politikerinnen stören sich an Muskelprotz auf Fitnessplakat
Die Stadt Luzern schliesse bei ihrer Kommunikation einzelne Personengruppen aus, kritisieren die SP-Grossstadträtinnen Maria Pilotto und Tamara Celato. Stein des Anstosses ist unter anderem ein Fitnessplakat in der Luzerner Ufschötti.
Sie will – aber irgendwie doch nicht. Die Stadt Luzern will sich zwar vermehrt für die Gleichstellung einsetzen. Mit der Unterschrift der europäischen Charta für Gleichstellung beispielsweise.
«Trotzdem zeigen sich in letzter Zeit immer wieder Beispiele, wo die städtische Kommunikation ihren eigenen Bekenntnissen zurückbleibt», kritisieren die beiden SP-Grossstadträtinnen Maria Pilotto und Tamara Celato. Namens der SP-Fraktion haben sie kürzlich einen Vorstoss eingereicht. Darin fordern sie den Stadtrat auf zu überprüfen, wie «eine zeitgemässe ein- statt ausschliessende Kommunikation» in den städtischen Kommunikationsstellen konsequent umgesetzt werden kann.
Kommuniziert werden soll, dass niemand ausgeschlossen wird. Weder die verschiedenen Geschlechter, noch Menschen mit Behinderungen oder Zugewanderte.
Fitnessplakat soll auch Frauen, Molligere und dünnere abbilden
Die beiden Politikerinnen führen drei Beispiele auf, die ihnen die Bevölkerung zugetragen habe und an denen sie sich stören. Zum einen das Plakat vor dem Street-Workout-Park in der Ufschötti. Darauf zu sehen ist ein Mann, der zeigt, wie man Push-Ups, Squats & Co. macht. Dieses zeige «eindeutig auf, für wen dieser Park gedacht ist», so Pilotto und Celato.
Wie würde das Plakat im besten Fall aussehen? «In dem beispielsweise eine Übung eine eher rundliche Person vorzeigt, die andere Übung eine Frau», sagt Pilotto auf Anfrage. Aber auch eine dunkelhäutige Person könnte abgebildet werden, sowie jung und alt. Bei den zwölf Workout-Übungen, die auf dem Plakat abgebildet sind, sei es eigentlich kein Problem und auch eine Chance, mehr Menschen damit abholen zu können, findet die Politikerin. Schreibt ZentralPlus.
Glücklich ist, wer solche Sorgen hat. In ihrem unaufhaltsamen Niedergang entdeckt die Luzerner SP nun die Molligen und Dünnen und erklärt sie zu den Mühseligen und Beladenen. Als ob die Stadt Luzern keine anderen Sorgen hätte. Na denn, Glück auf!
-
21.9.2020 - Tag der Pragmatiker
Österreichs Kanzler Sebastian Kurz im grossen Interview: «Es macht keinen Sinn, die Schweiz in etwas hineinzuzwingen»
Für den österreichischen Regierungschef ist nach einem Treffen mit Schweizer Pharmachefs klar: Bald kommen wirksame Covid-19-Medikamente, um die Sterblichkeit zu senken. Beim EU-Rahmenvertrag sichert Sebastian Kurz der Schweiz seine Hilfe zu. Und er verteidigt seine harte Linie in der Flüchtlingspolitik.
Wien zählt die Schweiz zu den Risikogebieten. Für Normalbürger gilt nach der Einreise eine zehntägige Quarantänepflicht. Nicht so für den österreichischen Bundeskanzler. Etwas mehr als 24 Stunden verbrachte Sebastian Kurz, 34, in der Schweiz. Er traf Bundesräte und die Chefs der Pharmaunternehmen Novartis, Roche und Lonza. Eine Bestellung für Medikamente gab er nicht auf; er wollte sich aus erster Hand über die Fortschritte bei der Forschung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19 informieren. Vor seinem Rückflug trafen wir ihn am Flughafen Zürich zum Gespräch.
Herr Bundeskanzler, Sie haben sich und ihre Regierung für das Management der Coronakrise sehr gelobt. Jetzt erfasst die zweite Welle Österreich. Was ging schief?
Sebastian Kurz: Es kommt der Herbst und die Kontakte verlagern sich nach drinnen. Die Schulen fangen wieder an. Die Reiserückkehrer sind nach Hause gekommen und haben in vielen Fällen das Virus mitgebracht. Dass die Fallzahlen ansteigen, ist kein österreichisches Phänomen. Auch in der Schweiz steigen die Zahlen wieder an. Wir geben nun Gegensteuer. Private Feierlichkeiten haben wir zum Beispiel auf zehn Personen beschränkt.
Im März gehörte Österreich zu den ersten Ländern, die Grenzen schlossen. Nun pochen Sie auf offene Grenzen. Weshalb dieser Meinungsumschwung?
Wir haben uns sehr genau angesehen, wo Grenzschliessungen Sinn gemacht haben. Die Schliessung zu Italien war mit ein Grund, weshalb wir die erste Welle gut abwehren konnten. In der Bodenseeregion hingegen ist die epidemiologische Entwicklung in allen drei Ländern ähnlich verlaufen, obschon die Grenzen geschlossen waren. Die Region ist derart stark zusammengewachsen, dass es schwierig ist, die Grenzen zuzumachen. Selbst wenn man es tut, braucht es Ausnahmen etwa für Pendler oder Geschäftsreisende. Wir sind uns mit der Schweizer Regierung einig: Ziel muss sein, diese Grenze offen zu halten.
Mehrfach haben Sie gesagt, im Sommer 2021 sei alles wieder gut. Ist diese Zuversicht noch aktuell?
Ja, ich hatte am Samstag ein Gespräch mit den drei Chefs der Pharmaunternehmen Novartis, Roche und Lonza. Sie haben ein ähnliches Bild gezeichnet: Es stehen uns ein sehr fordernder Herbst und Winter bevor, ab dem nächsten Sommer wird es aber bergauf gehen und eine Normalisierung möglich sein. Dank der Fortschritte in der Erforschung eines Impfstoffes und von Medikamenten.
Haben die Pharmachefs konkrete Termine genannt?
Natürlich. Ich rechne damit, dass es bei den Medikamenten schneller gehen wird als beim Impfstoff. Dass wir bereits in den nächsten Monaten Medikamente haben werden, die die Mortalität senken und die Aufenthaltsdauer in Spitälern bei schweren Verläufen verkürzen. Bei der Impfung erwarte ich die Zulassung im ersten Halbjahr 2021. Doch es braucht dann natürlich auch noch die entsprechenden Produktionskapazitäten.
Kann die Schweiz von Ihnen auch Unterstützung bei den Verhandlungen um das Rahmenabkommen mit der EU erwarten?
Ja, natürlich, das war in der Vergangenheit schon so. Die Schweiz ist für uns ein wichtiger Nachbar, von dem wir sehr viel lernen können. Wir sind für den starken Austausch sehr dankbar. Wir können und wollen behilflich sein, wenn es Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU gibt. Unser Ziel ist es, eine starke Kooperation sicherzustellen. Nicht nur, weil wir glauben, dass es für beide Seiten gut ist. Sondern weil wir als Nachbarn auch davon profitieren.
Gerade der Lohnschutz ist von existenziellem Interesse für die Schweiz. Verstehen Sie, dass das Land da seinen Sonderfall verteidigen will?
Nationale Interessen sind immer nachvollziehbar. Aber genauso ist es nachvollziehbar, dass die EU Standards definiert, die für alle gelten. Mein Wunsch ist es, dass beide Seiten positiv an diese Gespräche herangehen und ein Ergebnis erzielt wird, das für alle Beteiligten ein gutes ist. Es macht langfristig keinen Sinn, die Schweiz in etwas hineinzuzwingen, das sie gar nicht will. So etwas geht nie gut aus.
Glauben Sie, dass sich die EU beim Lohnschutz der Schweiz annähern wird?
Das ist kein einfaches Thema und ich möchte da nicht mutmassen. Was das Rahmenabkommen betrifft, werden wir weiterhin versuchen, Brücken zu bauen. Wir haben ein Interesse, dass die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz weiter gestärkt werden. Dafür werden wir unseren Beitrag leisten.
Aktuell werden Sie wegen Ihrer Migrationspolitik kritisiert. Sie wollen keine Flüchtlinge aus dem niedergebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen. Warum bleiben Sie da so hart?
Erstens haben wir in Österreich in den vergangenen fünf Jahren über 200 000 Menschen aufgenommen. Zweitens sind wir das Land in Europa, das am drittmeisten Menschen aufgenommen hat. Und drittens hat Österreich auch am zweitmeisten Kinder aufgenommen. Wir haben einen überproportionalen Beitrag geleistet, und das ist eine Herausforderung. Bevor wir noch mehr Menschen ins Land holen, müssen wir jene integrieren, die schon hier sind.
Gerade jetzt wäre die Aufnahme von Flüchtlingen doch ein Gebot der Solidarität.
Auch ich will Menschen helfen, die in Not sind. Aber oft geht das vor Ort am nachhaltigsten. Österreich hat sofort Hilfslieferungen vorbereitet, als die Brandkatastrophe in Moria war. Wir bauen winterfeste Quartiere für 2000 Menschen auf, inklusive sanitärer Einrichtungen und medizinischer Versorgung. Das halte ich für nachhaltiger als zwei, vier oder zwölf Flüchtlinge aufzunehmen, wie es andere EU-Staaten tun.
Sie fürchten, dass sich die Flüchtlingskrise von 2015 wiederholt.
Damals war Europa überfordert. Unzählige Menschen verloren auf dem Weg ihr Leben im Mittelmeer. Wohin würde es führen, wenn nun die europäische Linie wieder lauten soll: «Sobald Du auf Lesbos ankommst, kannst Du nach Deutschland, Schweden oder Österreich weiterreisen?» Dann machen sich wieder mehr Menschen auf den Weg, die Schlepper verdienen Unsummen und Unzählige verlieren im Mittelmeer ihr Leben. Das ist ein unmenschliches System, das wir unbedingt verhindern sollten.
Ihnen eilt seit der Schliessung der Balkanroute 2016 ein Ruf voraus: Sie stehen für einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Jetzt aber äusserte gar die Ihnen wohlgesinnte «Bild»-Zeitung in Deutschland die Befürchtung, Sie könnten zum «Herzlos-Kanzler» werden.
Im Jahr 2015 wurde ich für meine Position viel stärker kritisiert. Da bin ich gar als rechtsradikal dargestellt worden. Mittlerweile hat ein Grossteil der europäischen Regierungschefs eine ähnliche Position wie ich. Sollte man nicht einmal hinterfragen: Warum will kein Land in Europa ausser Deutschland Flüchtlinge im grossen Stil aufnehmen? Wie kann es sein, dass die meisten europäischen Länder – darunter auch sozialdemokratisch regierte wie Schweden oder Dänemark – gesagt haben, sie wollen keine Flüchtlinge aus Moria haben?
Nun?
Es ist irrsinnig einfach, sich in der Migrationspolitik moralisch überlegen zu fühlen. Ich wünsche mir eine differenziertere, weniger polemische Debatte.
Befürchten Sie, dass die aktuelle Lage die Union weiter spalten könnte? Mit der Aufnahme von 1500 Flüchtlingen aus Moria wagt Deutschland als grösstes EU-Land einen selbstbewussten Alleingang.
Die 2015 eingeschlagene Linie war falsch. Deutschland hat aus gutem Grund eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Wer nun so tut, als wäre Österreich das einzige Land, das keine Flüchtlinge aufnehmen möchte, missachtet die Fakten. Und verkennt schlicht die Realität in anderen Ländern.
Die EU-Kommission versucht seit Jahren, das Asylsystem zu reformieren. In den kommenden Tagen legt sie jetzt einen «Migrationspakt» vor. Was erwarten Sie davon?
Es ist richtig, die Aussengrenzen besser zu schützen, gegen Schlepper anzukämpfen und die Hilfe vor Ort auszubauen. Das unterstützen wir hundertprozentig. Es ist jedoch nicht sinnvoll, abermals eine Verteildebatte in der EU zu führen. Die Mehrheit der Staaten lehnt die Verteilung von Flüchtlingen strikt ab. Aber selbst, wenn das anders wäre: Dann stünden wir vor dem Problem, dass die meisten Menschen, die teuer für einen Schlepper bezahlt haben, lieber in Österreich oder der Schweiz leben möchten. Und nicht in Rumänien oder Polen. Schreibt die Aargauer Zeitung. PS: Es lohnt sich, das ganze Intrview der AZ zu lesen.
Mehr Pragmatismus von Kanzler Kurz und weniger verlogene Moral- und Symbolpolitik seitens der EU. Und schon erübrigen sich in der Schweiz sinnlose Abstimmungen wie z.B. die Begrenzungsinitiative und - im weitesten Sinne - sogar die SVP.
-
20.9.2020 - Tag der Mutigen
Senior (73) spitalreif geprügelt – weil er junge Frau verteidigte
Dieser Fall schockiert Italien. Ein 73-Jähriger verteidigt eine junge Frau vor ihrem aggressivem Partner (25). Dieser prügelt den Senioren daraufhin spitalreif. Die junge Frau verteidigt den Täter – ihren Verlobten.
Vittorio Cingano (73) sieht, wie aggressiv Akos Alberto Fontanarosa (25) seine Partnerin behandelt. Er ohrfeigt sie, wird immer lauter. Der Senior geht dazwischen, greift mit Worten ein, will schlichten. Doch der Mann kennt offenbar nur Gewalt als Antwort.
So schlägt Fontanarosa den 73-Jährigen zuerst mit der Faust ins Gesicht. Der Senior geht zu Boden. Dann tritt der Täter nach. Mehrmals. So heftig, dass Vittorio Cinganos Oberschenkelknochen bricht. Dann spaziert der 25-Jährige davon. Mit seiner Freundin. Wann genau das passiert ist, geht nicht aus den Medienberichten hervor.
«War meine moralische Verpflichtung»
Vittorio Cingano, der sich nach der Attacke in Vicenza (I) einer Operation unterziehen musste und immer noch im Spital ist, würde wieder dazwischen gehen. Zur Zeitung «Corriere del Veneto» sagt er: «Dieses Mädchen zu retten, war meine moralische Verpflichtung.»
Ausserdem sagt er: «Da war ein Typ, der ein armes Mädchen schlug. Was hätte ich tun sollen – wegschauen?» Für den Senioren war es selbstverständlich, einzugreifen. Die Frau ist die Verlobte des Angreifers. Fontanarosa ist laut lokalen Medien italienischer Staatsbürger ungarischer Herkunft, drogensüchtig und mehrfach vorbestraft.
Verlobte verteidigt den Täter – nicht ihren Retter
Seine Partnerin verteidigt ihn. Fontanarosa habe nichts getan, soll sie gegenüber der Polizei gesagt haben. Das Video zeigt das Gegenteil. Kurz nach dem Angriff auf den Rentner wurde der Täter verhaftet. Vittorio Cingano gibt sich bezüglich seiner Verletzung optimistisch. Immerhin sei es keine schwere Kopfverletzung, sagt er. Schreibt SonntagsBlick.
Ich war kürzlich an einer Vernissage eines Behindertenzentrums aus der Zentralschweiz, das kleine, aber feine Kunstwerke von Menschen mit Behinderungen vorstellte. Unter vielen anderen Beiträgen waren ein Bild sowie eine käuflich erwerbbare Atemschutzmaske zu sehen mit dem Titel «Mut ist definitiv nichts für Igel».
Das im Stil eines kindlichen Graffitis gemalte Kleinkunstwerk regte mich zum Nachdenken an. Was will uns der junge Mann damit sagen? Welche Gedanken gingen ihm beim Malen durch den Kopf? Es gibt wie so oft im Leben der Deutungen viele. Und das ist gut so. Mutig eine von Autos befahrene Strasse zu überqueren ist zum Beispiel definitiv nichts für Igel.
So wie Mut nichts für Igel ist, ist Mut in gewissen Situationen auch definitiv nichts für Senioren. Besonders wenn es um handfeste Streitigkeiten geht.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
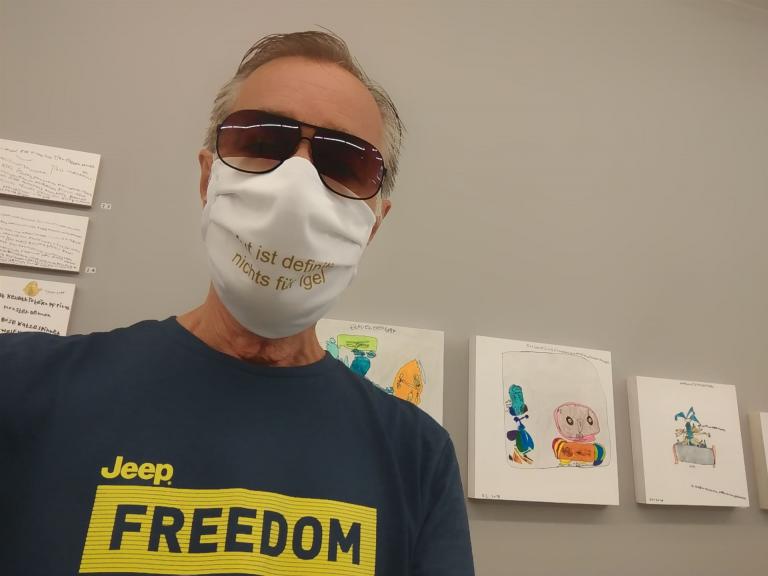
-
19.9.2020 - Tag der Gierigen
General Electric streicht in der Schweiz 500 Jobs – der CEO behält die Chance auf einen Megabonus
Chef Larry Culp darf wieder auf einen Bonus von 230 Millionen hoffen. Der Verwaltungsrat hat das Kursziel halbiert, über das Culp die GE-Aktie treiben muss. Es ist die letzte Wendung im Niedergang des einst wertvollsten Unternehmen der Welt.
General Electric streicht in der Schweiz über 500 Arbeitsplätze und einen Standort in Oberentfelden AG, für den ein Bundesrat persönlich in den USA gekämpft hatte. Hinter diesen News steht der Wandel in der Energieproduktion, das Scheitern eines überholten Gigantismus – und der tiefe Fall von General Electric, einer Ikone des amerikanischen Kapitalismus.
Rettung eines 230-Millionen-Bonus
In dieser Geschichte eines Niedergangs leiden einige mehr. Andere werden vom Verwaltungsrat von GE behütet. Chef Larry Culp kann wieder auf einen Megabonus von 230 Millionen hoffen.
Der Verwaltungsrat halbiert das Kursziel, über das Culp die GE-Aktie treiben muss, um den 230-Millionen-Jackpot zu knacken. Das frühere Ziel war in weite Ferne gerückt, die GE-Aktie war in der Coronakrise weiter abgestürzt. Nun darf Culp wieder hoffen.
Ein Analyst an der Wall Street ätzt daraufhin: GE habe neu definiert, was «gewinnen» bedeute. Es klingt wie eine Anspielung auf einen Managementklassiker, den der berühmteste GE-CEO Jack Welch einst geschrieben hat. Der Titel ist ein einziges Wort: «Winning».
Welch verstarb im März 2020, auf seinem Karriere-Höhepunkt ist er für die US-Wirtschaftspresse «Manager des Jahrhunderts». Einige der chaotischen Schauplätze, auf denen seine Nachfolger aufräumen müssen, gehen direkt auf Deals dieses einstigen Über-CEO zurück.
In der Schweiz wird der Fall von General Electric bald über 3300 von einst 5300 Arbeitsplätzen gekostet haben. In den USA leiden die Investoren, traditionell viele Kleinaktionäre: die Aktie ist in fünf Jahren von 30 auf 7 Dollar kollabiert. GE fliegt aus dem prestigeträchtigen Börsenindex «Dow Jones», dem es seit dem Jahr 1896 angehört hat.
Exorbitante Goodies werden bekannt. Jeffrey Immelt, nach Welch sechzehn Jahre lang GE-Chef, liess auf seinen Reisen mit dem firmeneigenen Jet einen Reservejet hinterher fliegen. Man weiss ja nie. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Die GE-Aktie innert fünf Jahren von 30 auf sieben Dollar runtergefallen. Who cares? Der gute Jeffrey Immelt erhält seinen gigantischen Bonus ja nicht für fallende oder steigende Aktienkurse, sondern für die Gewinnmaximierung. Und die wiederum treibt die Aktienkurse jeder Klitsche in die Höhe. Jeffrey macht alles richtig im Sinne der Investoren. Das ist seit den Zeiten des abartigen, brachialen Neoliberalismus, vorangetrieben vor allem durch die herrschenden Eliten von Wallstreet & Co. in den USA und von den «lupenreinen» und «wirtschaftsliberalen» Demokratien der westlichen «Wertegemeinschaft» willfährig übernommen; business as usual: Verluste werden sozialisiert und die Gewinne privatisiert.
Die unersättliche Gier der «Investoren» folgt immer den günstigsten Arbeitsplätzen. Um die Arbeitslosen dürfen sich – auch in der Schweiz – die Gmeinden und der Staat kümmern. Beispiel gefällig? LEGO Willisau!
Wer jetzt über den perversen Bonus von 230 Millionen Dollar den Kopf schüttelt und die Welt nicht mehr versteht, darf dies selbstverständlich tun. Allerdings sind 230-Millionen-Boni im Grande Casino des US-Neoliberalismus beinahe schon sowas wie ein Trinkgeld.
Wenn sich ein Schweizer KMU-Familienbetrieb mit etwas über 70 Mitarbeitern*innen vier Millionen Dividende pro Jahr auszahlen lässt, ist das im Verhältnis zu den Arbeitsplätzen von General Electric nicht viel weniger. Also den jetzt Richtung Amerika ausgestreckten Stinkefinger gleich wieder runternehmen und vor der eigenen Haustüre wischen.
-
18.9.2020 - Tag der Wechseljahre
Komiker Marco Rima wird Galionsfigur der Corona-Skeptiker: Hier darf er noch auftreten
Komiker Marco Rima (59) ist zusammen mit Satiriker Andreas Thiel (49) Stargast an der Demo der Corona-Skeptiker in Zürich. Auf der Bühne stehen soll auch die Frau, die Daniel Koch im Grossmünster bestürmte – und sich gern mit Reichsbürger-Transparenten zeigt.
Als Corona-Skeptiker musste sich Komiker Marco Rima (59) in den letzten Monaten viel Kritik gefallen lassen (BLICK berichtete). Nun hat er eine Bühne gefunden, wo ihm der Applaus sicher ist: Er ist der Stargast an der Kundgebung der Bewegung am Samstag in Zürich. Auch Satiriker Andreas Thiel (49) wird von den Organisatoren angekündigt.
Auf Youtube jubelt Demo-Mitorganisatorin Tatiana Chamina: Man habe mit Rima und Thiel «die Besten der Besten» für einen Auftritt gewinnen können. Und Daniel Stricker (49), der den Corona-skeptischen Youtube-Kanal betreibt, meint: Die Anwesenheit der beiden Promis zeige, «dass die Leute keine Angst haben müssen, zu kommen.»
Nicht die erste Corona-Kritik von Marco Rima
Ebenfalls auf der Bühne stehen soll Melanie Kolic (29), die Daniel Koch (65) im Zürcher Grossmünster bestürmte (BLICK berichtete). Sie zeigt sich im Netz mit Reichsbürger-Transparenten und Plakaten von QAnon. Anhänger dieser Verschwörungstheorie glauben, dass Kinder von einer Weltelite gefangen gehalten werden, um ihr Blut zu trinken. Auch auf Demo-Flyern finden sich entsprechende Gruppen. Kein Problem für die beiden prominenten Ehrengäste?
Marco Rima sagt in einer Whatsapp-Sprachnachricht, er wolle sich dazu nicht äussern. Andreas Thiel schreibt, ihm gehe es darum, dass der «Bundesrat durch Selbstermächtigung die Verfassung ausser Kraft gesetzt» habe. Und: «Das akzeptiere ich als freier Bürger nicht!» Auf Reichsbürger und QAnon angesprochen, meint er: Einen Anteil an Schwachköpfen gebe es überall und je nach Standpunkt seien es andere.
Rima, der Auftritte wegen Corona absagen musste, löste mit seinen Aussagen schon mehrfach kontroverse Reaktionen aus. Via Facebook kommentierte er kürzlich, man müsse vielleicht einfach aufhören zu testen und keine Nachrichten mehr hören: «Plötzlich wären die Fallzahlen auf null.» Schreibt Blick.
Marco Rima war mal richtig gut. Doch inzwischen scheinen ihm die Wechseljahre und Wechselhaare arg zuzusetzen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst und entwickelt sich langsam aber sicher zum unerträglichen Vollidiot mit rassistischen Neigungen. Lustig ist Rima jedenfalls – ausserhalb der rechten Szene, die im logischerweise Beifall klatscht und seinen Müll bejubelt – längst nicht mehr, peinlich aber umso mehr.
Seine Nähe zum unsäglichen, ultrarechten Verschwörungstheoretiker und Bauzeichner – wer Thiel einen Satiriker oder Komiker nennt, weiss nicht, was Satire und Komik ist oder liest nur DIE WELTWOCHE – wirft einen zusätzlichen Schatten auf den ehemaligen RTL-Star Rima. «Sag mir, mit wem du gehst, und ich sag dir, wer du bist.»
-
17.9.2020 - Tag der visionären Fusionen
Die UBS ist zu klein für ihn: Axel Weber will sich ein Denkmal setzen – was treibt ihn an?
UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber trat 2012 an, die Grossbank zu stabilisieren. Das gelang. Zum Schluss seiner Karriere möchte er aber mehr. Nicht zum ersten Mal lässt er jetzt das vermeintlich Unmögliche durchrechnen: Eine Fusion mit der Credit Suisse.
Axel Weber, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, aufgestiegen zum Wirtschaftsprofessor und Präsidenten der Deutschen Bundesbank, ist vieles. Eines aber nicht wirklich: ein Banker.
Als die UBS einmal Journalisten zu einem Nachtessen im kleinen Kreis einlud, gab es zwei Tische. Am einen sass Axel Weber, der Präsident, am anderen Sergio Ermotti, der Konzernchef. Nach dem Hauptgang tauschten die beiden Männer ihren Platz.
Mit dem Tessiner Ermotti sprach man über Aktienkurse, Investmentbanking, über Risiken am Immobilienmarkt, über das Abwerben von Personal, auch über Fussball.
Mit dem Deutschen Weber sprach man über die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank, über Sicherheit und Terrorismus, über Deutschlands Rolle in der Welt und auch über das eine oder andere Telefonat, das er mit Angela Merkel führte.
Ermotti ist der Banker, der Mann fürs Konkrete. Weber ist der Professor, der Mann für die grossen Linien.
Die beiden sind nicht die besten Freunde. Aber sie funktionieren als Duo – weil sie sich nicht in die Quere kommen. Sie führten die UBS wieder in ruhigere Gewässer. Sie verkleinerten das Investmentbanking und fokussierten auf die Vermögensverwaltung. Dieser Auftrag ist erfüllt. Und jetzt?
Ermotti, der Weber gern als UBS-Präsident beerbt hätte, zieht es weiter zu Swiss Re; sein Nachfolger Ralph Hamers arbeitet sich zurzeit ein.
Weber, so hiess es bislang, werde im Frühjahr 2022 zurücktreten. Noch einmal zwei Jahre im ruhigen Gewässer fahren? «Das wäre eine intellektuelle Unterforderung für Axel Weber», sagt einer aus seinem Umfeld.
Dass er an der Generalversammlung 2022 abtrete, sei nicht mehr sicher, eine Verlängerung keineswegs ausgeschlossen, hört man neuerdings aus dem Innern der Bank. Ironischerweise war es Weber, der eine Klausel eingeführt hat, wonach die Amtszeit des Präsidenten statt zwölf nur noch zehn Jahre betragen soll. Doch die Klausel ist nicht zwingend. «Je nach Zustand und Lage der Bank» könnte Weber auch länger bleiben.
Der 63-Jährige, der einst vom Präsidentenjob bei der Europäischen Zentralbank (EZB) träumte, strebt zum Schluss seiner Karriere nach etwas Grossem. Er will nicht bloss als «Gesundschrumpfer» der UBS in die Geschichte eingehen. Weber ist kein Selbstdarsteller, aber er sucht Anerkennung. Er wolle mit einer Leistung abtreten, «für die man ihm ein Denkmal setzen würde», sagt ein Banker.
Es hat viel mit der Person Weber zu tun, dass die Spekulationen nicht verpufften, sondern weite Kreise zogen. Der Finanzblog «Inside Paradeplatz», der am Montag zuerst über das Fusionsprojekt namens «Signal» berichtete, nannte Weber die treibende Kraft. Die Story ging um die Welt und bewegte die Aktienkurse von UBS und CS.
Schon 2015 liess Weber eine Fusion mit der CS prüfen
Recherchen zeigen: Es ist nicht das erste Mal, dass Weber eine Fusion mit der CS tiefer prüfen lässt, als es in den alljährlichen Strategieübungen mit Beratern üblich ist. Schon 2015, als bei der Credit Suisse Tidjane Thiam Konzernchef wurde, liess Weber diese Option abklären. Die CS-Aktie war tief bewertet. Massgebend ist das Verhältnis des Aktienkurses zum Buchwert, das zum damaligen Zeitpunkt für die UBS vorteilhaft gewesen wäre. 2015 sickerte nichts von den Überlegungen durch. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Weber kann tun und lassen, was immer er will. Grossbanken wie die UBS und CS geniessen den Vorteil der Systemrelevanz und die verleiht bekannterweise nicht nur Flügel, um in unbekannte Sphären von visionären Fusionen aufzusteigen, sondern auch Narrenfreiheit. Egal, was immer auch passiert, die Boni landen so oder so bei den Göttern der monetären Glücksspielzunft, im vorliegenden Fall also bei Weber, und die Verluste beim Steuerzahler.
-
16.9.2020 - Tag der Untoten
Bewaffneter Überfall auf eine Raiffeisen-Filiale in Muri bei Bern
Am Dienstagmittag überfiel ein maskierter Mann eine Raiffeisen-Filiale in Muri bei Bern, teilt die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit. Mit einer Waffe bedrohte er die Bankmitarbeiterin und zwang sie, ihm eine unbekannte Summe Bargeld auszuhändigen. Die Ermittler suchen nach Zeugen.
Der unbekannte Mann soll beim Überfall einen Fischerhut, einen dunklen Pullover und eine dunkle Weste getragen haben. Er sei zirka 40-jährig und etwa 180 cm gross. Nach dem Überfall ergriff er mit einer Tasche die Flucht in unbekannte Richtung. Die Ermittler suchen nach Zeugen. Schreibt Blick.
Das ist ja mal ein Thriller: Michael Jackson lebt!
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.9.2020 - Tag der Eloquenz
SVP-Nationalrat Roger Köppel zur Personenfreizügigkeit: «Das ist wie ein offener Kühlschrank»
Der ausgebaute Sozialstaat sei ein Magnet – und mit der Personenfreizügigkeit nicht tragbar, sagt SVP-Nationalrat Roger Köppel. Mit einem Ja zur Begrenzungsinitiative könne das Volk dem Bundesrat den Rücken stärken für Neuverhandlungen. Köppel erklärt zudem, was die Personenfreizügigkeit mit der Dorfmusik Kloten und den Wienern Philharmonikern zu tun hat.
Roger Köppel empfängt in seinem Büro in Zürich-West. Der SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger nippt beim Gespräch über die Begrenzungsinitiative seiner Partei an einer Cola-Flasche. Einmal zieht er sich als Jux eine Schutzmaske über, «Freiheit» und «Selbstverantwortung» steht darauf. Es ist eine Werbemaske der FDP. Schliesslich sei auch er ein Liberaler, witzelt Köppel.
Ihr jüngster Sohn Paul wird im November ein Jahr alt. In was für einer Schweiz lebt er in 10 oder 20 Jahren?
Roger Köppel: In den letzten 13 Jahren ist die Wohnbevölkerung in der Schweiz um eine Million angestiegen, rund drei Viertel davon stammen aus der EU. Eine solche Dimension ist für die Schweiz nicht verkraftbar. Ich möchte verhindern, dass mein Sohn in einer Schweiz mit Überbevölkerung und all deren negativen Folgen aufwächst.
Welche negativen Folgen?
Wir sehen und spüren sie im Alltag. Die Strassen sind überfüllt, Staus kosten uns bis zu drei Milliarden Franken im Jahr. Die Arbeitslosigkeit bei Ausländern steigt, sie wandern indirekt in unseren grosszügigen Sozialstaat ein. Wir haben einen höheren Lebensstandard und ein ausgebautes Sozialsystem, das wie ein Magnet wirkt. In Schulen sprechen viele Kinder keine Landessprache mehr. Die Nachteile der Personenfreizügigkeit werden quasi sozialisiert: steigende Mieten, Arbeitsplatzverlust, Lohndruck. Die Zuwanderer brauchen Häuser, Strom, produzieren Abfall und Abgas. Die ökologischen Folgen sind unübersehbar.
Die SVP gebärdet sich neu als wachstumskritische Partei. Doch früher war sie zum Beispiel gegen ein griffiges Raumplanungsgesetz. Das ist widersprüchlich.
Nein, gar nicht. Eine ausgeklügelte Raumplanung oder die Rationierung von Wohnraum, wie sie teilweise propagiert wird, sind Ausdruck einer Hyperregulierung als Folge der offenen Grenzen. Wir müssen an der Grenze die Zuwanderung besser dosieren, damit wir in der Schweiz eine freiheitliche Ordnung aufrechterhalten können.
Sie sehen in der Zuwanderung eine Gefahr für die Freiheit?
Ja. Wir haben in der Schweiz einen riesigen Kontrollapparat installiert, um die Zuwanderung zu verkraften. Das Paradebeispiel dafür sind die flankierenden Massnahmen, die uns eine Lohnpolizei, Gesamtarbeitsverträge, Mindestlöhne und weitere Einschränkungen beschert haben. Wegen der Personenfreizügigkeit ist der freie Arbeitsmarkt mit freier Lohnbildung und freier Anstellung bedroht. Dieser aber macht die Schweiz für Firmen attraktiv.
Plädieren Sie für uneingeschränkte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt?
Nein. Der totale Liberalismus auf dem Arbeitsmarkt funktioniert nicht. Das würde zu einem darwinistischen Verdrängungskampf führen. Wir müssen den Arbeitsmarkt irgendwie regulieren, am besten an der Grenze. Wenn in gewissen Branchen hohe Arbeitslosigkeit herrscht, dürfen wir für diese Branchen nicht noch zusätzliche Ausländer rekrutieren. Schreibt die Aargauer Zeitung. Das ganze Interview finden Sie unter diesem Link.
Das Maschinengewehr Gottes, sprich des Gesalbten vom Herrliberg, veranstaltet einmal mehr ein verbales Rockkonzert, das in Sachen Eloquenz und subtiler Wortgewalt von kaum einem anderen Schweizer Politiker*in übertroffen wird. Rhetorik vom Feinsten as usual. Das muss man ihm einfach lassen.
Ein Luzerner Nationalrat, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, weil Franz Grüter ja noch lebt, erzählte mir einmal, wenn Roger Köppel im Hohen Haus von und zu Bern spreche, sei der Saal immer bumsvoll und alle Anwesenden würden muxmäuschenstill und ehrfürchtig zuhören, stets mit der schweisstriefenden Angst im Nacken, dass der/die/das eine oder andere Parlamentsmitglied namentlich genannt würde.
Wären jedoch alle Vorschläge Köppels bezüglich Einwanderung und Migration umgesetzt worden, wäre er wohl kaum mit der wunderschönen Tochter zweier Asylsuchenden aus Vietnam verheiratet.
-
14.9.2020 - Tag von Pudeli Chocolat
Pudeli (†7) war der beste Freund des verstorbenen Hellsehers (†56): Findet Shiva seine letzte Ruhe neben Chocolat?
Sein Tod kam überraschend, am Freitag ist Mike Shiva nach schwerer Krankheit verstorben. Gut möglich, dass er seine letzte Ruhe neben seinem Hund Chocolat findet.
Als Mike Shiva (†56) am vergangenen Freitag für immer die Augen schliesst, brennt bald darauf eine Kerze auf dem Grab von seinem Pudeli Chocolat. Angezündet hat sie Marlies Mörgeli (63), seit 20 Jahren führt sie den Tierfriedhof am Wisenberg in Läufelfingen BL. «Das Ableben von Mike hat mich sehr berührt, er war ein so feiner Mensch. Seine Hunde waren für ihn echte Familienmitglieder, die er über alles liebte. Darum war es ihm auch wichtig, ihnen eine letzte Ruhestätte zu geben.»
Trauriger Abschied von Chocolat
Erst Ende Januar musste sich Shiva von Chocolat (†7) verabschieden, von einem Tag auf den andern erkrankte das Pudeli schwer und musste eingeschläfert werden. «Es ist der Horror für mich, ich vermisse ihn so sehr», erzählte Shiva damals unter Tränen. Wie tragisch der Verlust für ihn tatsächlich gewesen sein muss, wird erst jetzt klar. Zu diesem Zeitpunkt lebte der TV-Hellseher längst mit der Diagnose Darmkrebs, er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Bei gut gemeinten Ratschlägen, sich doch wieder einen Hund anzuschaffen, schüttelte er darum jeweils nur den Kopf.
Shiva war zwar berühmt, enge Freunde hatte er aber nur wenige, am nächsten waren ihm seine Vierbeiner. Bereits 2012 verlor Shiva den Malteser Wanchai, die beiden Hunde liegen im gleichen Grab. Gut möglich, dass Shiva seine letzte Ruhe bei ihnen finden wird. «Es gibt einige Tierbesitzer, deren Asche auf Wunsch zu den verstorbenen Vierbeinern kommt», so Marlies Mörgeli. Also ein Mensch-Tier-Grab.
Der Wunsch, nach dem Tod vereint zu sein
Ein Wunsch, der laut dem reformierten Pfarrer Andrea Marco Bianca (59) nicht selten vorkommt: «Es geht um die Sehnsucht, seinen Liebsten nach dem Tod wieder nahe zu sein. Das respektieren wir.» Darum wird auch auf «normalen» Friedhöfen die Asche von Haustieren beigefügt, nur wird auf der Grabtafel der Name der Vierbeiner nicht eingetragen. «Es sind aber Bestrebungen im Gange, dass gemischte Gräber künftig offiziell möglich sind.»
Ob Mike Shiva seine letzte Ruhe an der Seite von Chocolat und Wanchai finden wird, das ist noch nicht bekannt. Einer, der sich das gut vorstellen kann, ist sein Basler Kollege, der Komiker Patrick «Almi» Allmandinger (54): «Chocolat war sein Ein und Alles. Der kleine Pudel gab ihm Halt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Mike ebenfalls dort beerdigt wird.» Schreibt Blick.
Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich beim Lesen dieses wunderbaren Blick-Artikels geweint habe. Doch eine Frage drängt sich mir auf: Hat der «berühmte Hellseher» dies alles nicht vorausgesehen, um es zu Lebzeiten noch selbst bestimmen zu können? Sowas überlässt man doch nicht Blick und der Frau Mörgeli!
-
13.9.2020 - Tag der Palmölpampe
Es muss nicht immer Nutella sein: Diese Brotaufstriche machen Morgenmuffel wach
Kokus-Mus, Marshmallow-Creme oder gesalzenes Caramel-Püree: Die Lebensmittelindustrie versucht gerade, den Brotaufstrich neu zu erfinden. Fettig und süss aber bleibt er.
Ich bin ein Konfibrot-Kind. Rhabarber, Trüübeli, Quitten, Holunder, Brombeeren … und die gleiche Menge Zucker. Jeden Tag. Nur sonntags: Honig. Vielleicht wäre ich gern ein Nutella-Kind gewesen. Manchmal schnappe ich mir heute ein Döschen von einem Hotel-Frühstücksbuffet. Aber mein Wissen, wie teuflisch ungesund Nutella sein soll, hat längst meine Geschmackspapillen auf der Zunge bedeckt. Wirklich geniessen kann ich das Schokoladen-Palmöl-Geschmier nicht.
Und Sie? Sind Sie eher der English-Breakfast-Typ, der schon beim Frühstück zeigt, was er alles bewältigen kann? Oder die Ich-will-doch-keine-Pickel-bekommen-Fruchtmüesli-Esserin? Am Ende gar der Ein-Kaffee-reicht-mir-Muffel?
Es gibt keine Studien dazu, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass ein Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer zum Konfibrotklub gehört. Oder jedenfalls zur Ich-schneide-mir-eine-Scheibe-Brot-ab-Fraktion. Denn mit Konfitüre allein wird man heute offenbar nicht mehr richtig wach. Die Auswahl an Brotaufstrichen ist fast schon irritierend gross. Und irgendjemand kauft das ja: Nussaufstriche ohne Palmöl, Marroni-Konfitüre, Kokos-Mus, gesalzenes Caramel fürs Brot.
Bei der Auswahl darf die Lust entscheiden, nicht der Verstand. Der neuste Zugang im Aufstrich-Regal ist ein Löwenzahnhonig von Coop. Also das, was schon unsere Grosseltern mit ein paar Blüten und viel Zucker als Honigersatz hergestellt haben. Coop nennt es Bee-Free. Keine Biene musste dafür arbeiten, und somit ist er vegan. Blumig, wie auf der Etikette beschrieben, schmeckt er nicht. Immerhin nicht so herb wie der Selbstgemachte.
Das Problem am ausufernden Sortiment von Frühstücksaufstrichen: Mehr als ein oder zwei Brotscheiben liegen an einem normalen Morgen nicht drin. Wie sich also entscheiden? Gesundheitskriterien ziehen nicht: Sehr süss oder sehr fettig sind alle Brotaufstriche. Es geht ja auch nicht darum, schon beim Frühstück streng mit sich zu sein. Wer Nutella nicht krass genug findet, kann sich einmal die Marshmallow-Creme Fluff aufs Brot schmieren. Man fühlt sich sofort wie ein Kind. Dabei stimmt es eigentlich nicht, dass Kinder morgens auf süsse Brotaufstriche abfahren. Untersuchungen an über 10 000 deutschen Grundschülern belegen, dass Kinder lieber zu Joghurt und deftigen Käse- oder Wurstbroten greifen.
Sowieso: Der Körper verzeiht deftiges Essen morgens viel besser als abends. Der menschliche Energieumsatz ist morgens höher als abends, die Energie wird verbrannt statt in Fett umgewandelt. Und Zucker lässt den Insulinwert im Blut auch weniger in die Höhe schnellen. Lübecker Forscher stellten zudem fest, dass man nach einem üppigen Frühstück tagsüber weniger Lust auf Süsses hat.
Die neuste Frühstück-Forschung zeigt auch: Wenn der Cholesterinspiegel sinken soll, sollte man Gemüse schon zum Frühstück verzehren. Die positiven Effekte gegen entzündliche Krankheiten von Obst hingegen entfalten sich eher gegen Abend.
Nach oben getrieben werden die Entzündungswerte auf jeden Fall, wenn man sich rotes Fleisch schon zum Frühstück gönnt. Also her mit der Scheibe Brot und dem Aufstrich. Das Frühstücksritual wird zwar mit der grossen Auswahl etwas kompliziert – aber immer noch besser als lange Früchte schnippeln oder halb wach ein Rührei braten. Anschliessend Rezepte für Guetzli-Brotaufstrich. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Es muss NIEMALS Nutella sein. Die furchtbare Palmölpampe soll nicht nur ungesund für Kinder und Erwachsene sein (das behaupten jedenfalls einige Ernährungswissenschaftler), sondern – und das ist eine Tatsache – trägt mit dem verfluchten Palmöl zum Aussterben der Orang Utans bei.
-
12.9.2020 - Tag der unverbesserlichen Heuchler
Kahlschlag: Birr ist wütend auf General Electric: «Wir haben noch nie so eins ans Bein bekommen»
Um 11 Uhr am Freitagvormittag werden die Mitarbeitenden von General Electric in Oberentfelden in die nüchternen Eventräume des Palmas Bistro gebeten. Hier offenbaren ihnen die Manager in den folgenden Minuten, dass der Standort geschlossen und ihre Stellen zu einem grossen Teil abgebaut würden. 57 Stellen sollen erhalten bleiben, 436 stehen vor dem Aus. Noch sei das Verfahren nicht abgeschlossen. Bis Ende Jahr soll Klarheit herrschen, wohin genau die Produktion von gasisolierten Schaltanlagen verlegt wird. Von Frankreich und Indien war die Rede, auch China und allenfalls Italien.
Der Stellenabbau im Aargau ist ein Schock. Wohl deshalb das Sicherheitspersonal bei der Mitarbeiterinformation. Man hat wohl mit Handgreiflichkeiten gerechnet. So weit kam es nicht. Es ändert nichts daran, dass die neue Beurteilung für alle überraschend kam. Denn eigentlich war nicht die Streichung der Stellen geplant, sondern ein Umzug. Nach Birr, keine 20 Kilometer nordwestlich von Oberentfelden. So hat man das Mitte 2018 entschieden.
2014 hatte GE in Birr noch 1500 Mitarbeiter, heute sind es noch 400
Im Dezember 2019 verkaufte GE dann das Gelände in Oberentfelden an das Transportunternehmen Dreier AG mit Sitz in Suhr. Kurz vorher hat man bei der Gemeinde Birr erste Baugesuche eingereicht, um die für den Umzug notwendigen Umbauten in den Fabrikhallen bei den Bahngeleisen voranzutreiben. Im Frühling, «so Ende April, Anfang Mai», habe er die ersten Bewilligungen erteilen können, erinnert sich René Grütter, der parteilose Gemeindeammann von Birr. Im Juli, also noch ein wenig später, hat GE den Mitarbeitenden in Oberentfelden gesagt, dass sie nach Birr wechseln könnten. Zwei Monate später ist alles anders.
Im Februar 2020 wurde der Umzug aufgeschoben, weil man derart viele Aufträge hatte. Von einem Wegzug war damals nicht die Rede. Und auch für Gemeindeammann Grütter kam alles aus heiterem Himmel. Er sagt: «Wissen Sie, früher wurden wir vorzeitig über gewichtige Entscheidungen informiert. Doch der Vorlauf wurde immer kürzer und jetzt erfahren wir von solchen Entscheiden erst im Nachhinein durch die Presse.» Dabei sei das Einvernehmen mit Werksleiter Falk-Ingo Jaeger eigentlich bestens, so Grütter. Er vermutet, dass die GE-Konzernleitung Jaeger nun einen Maulkorb verpasst hat. Ansonsten wäre die Gemeinde mit Sicherheit vorgängig informiert worden. «So extrem haben wir noch nie eins ans Bein bekommen», sagt er enttäuscht.
Die grosse Frage ist nun, welche Konsequenzen dieser Stellenabbau für Birr hat. GE betont auf Nachfrage die grosse Bedeutung der verbleibenden Standorte in Baden und Birr. Mit ihren Innovationszentren würden sie das Geschäft weltweit unterstützen. In Birr sei man zudem auf der Suche nach externen Unternehmen, die den freigewordenen Platz in den Fabrikhallen übernehmen.
Als GE im Jahr 2014 das Gasturbinengeschäft in Birr von der Alstom übernahm, arbeiteten noch rund 1500 Menschen in den Hallen. Jetzt sind es noch zwischen 400 und 450, genauer kann es selbst Grütter nicht sagen. Bis Freitag dachte er, dass bald wieder fast 1000 Menschen in der Halle arbeiten würden, die von der BBC zwischen 1960 und 1962 gebaut wurden.
GE ist ein «Unsicherheitsfaktor», aber es gibt Hoffnung für Birr
Als die damals grössten Fabrikhallen Europas fertig gestellt waren, kam Grütter gerade in die Primarschule in Birr. «Nach der Eröffnung des Werkes wuchs unsere Gemeinde innert zweier Jahre rasant an, die Einwohnzahl schnellte von 600 auf über 1800 Einwohner hoch», erzählt er. Das war eine Herausforderung für das Dorfleben, Grütter spricht gar von einer Art Schock. Doch er weiss, wie stark Birr von der Industrie profitierte. Die BBC war ein hervorragender Steuerzahler. Die Schulhäuser seien zu zwei Dritteln von der GE-Vorgängerfirma finanziert worden.
Die goldene Ära für die Eigenämter Gemeinde dauerte an, bis die BBC 1988 mit der schwedischen ASEA zur ABB fusioniert wurde. «Da kam es zu einem ersten Knick», so Grütter. Danach ging es runter. Mal langsamer, mal schneller. Mit einem Ausbau rechnet er längst nicht mehr. Aber er nimmt dieses Schicksal mit einer gewissen Gelassenheit. GE ist längst nicht mehr so zentral für Birr wie einst die BBC. Trotz des Stellenabbaus der letzten Jahre ist die Gemeinde in den letzten zwei Jahren um 300 Einwohner grösser geworden. Zudem haben sich in den Jahrzehnten seit dem Aufkommen der Industrie in Birr bis heute über 80 Unternehmen in der Gemeinde angesiedelt. Vor allem kleines und mittleres Gewerbe, etliche Handwerksbetriebe.
Das Vertrauen hat unter all den Richtungswechseln gelitten
Es sollen weitere dazu kommen. Das Areal rund um die GE-Fabrikhallen gehört heute noch immer der ABB. Es ist Teil eines Entwicklungsschwerpunktes im Kanton. Dort soll moderne Industrie angesiedelt werden. Forschung und Entwicklung, 24-Stunden-Betriebe. «Wir rechnen damit, dass auf diesem Gebiet in den nächsten 30 Jahren 3000 bis 3500 Arbeitsplätze entstehen», sagt Grütter.
Ob GE dann noch in Birr ist, bleibt abzuwarten. Für den Gemeindeammann ist das US-Unternehmen ein
Unsicherheitsfaktor. Er sagt: «Ich bin guter Hoffnung, dass wir neben GE noch ein paar verlässliche Firmen ins Dorf bekommen.» Das Vertrauen hat unter all den Richtungswechseln der letzten Monate und Jahre gelitten. Auch wenn Grütter nachvollziehen kann, dass das Geschäft mit gasisolierten Schaltstellen gelitten hat. Die Preise sollen laut GE in den letzten zwölf Jahren um 40 Prozent gefallen sein. Und dann kam Corona hinzu. Die Aussichten haben sich massiv verschlechtert. GE rechnet 2021 mit einem Auftragsrückgang von 30 Prozent. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Grosses Kino und Wehklagen allerorten. Allerdings erstaunt es einen schon, dass ausgerechnet die Apologeten der hemmungslosen Globalisierung nun plötzlich sehr laut schreien. Diesen Aufschrei hat man bisher bezüglich den gravierenden Umweltschäden, die allein durch die Warentransporte von Billigstprodukten oder Lebensmittel rund um den Erdball verursacht werden. Kommt hinzu, dass die Empörung nichts anderes als pure Heuchelei ist. Wer A sagt, muss auch B sagen! Das Kapital folgt nun mal nicht der Moral und Ethik, sondern den günstigsten Produktionskosten. Donald Trump hat mit seinen Slogans «America first» und «I'll bring back the Jobs from China to USA» 2016 die Wahl gewonnen. Auch wenn er bis heute keinen einzigen Job von China nach Amerika zurückgebracht hat. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
-
11.9.2020 - Tag der Parallelgesellschaften
Demo für Flüchtlingsopfer: Luzerner Demonstranten: «Wir sind traurig und wütend»
In Luzern wurde demonstriert – zum dritten Mal innert einer Woche. Während am Freitag Aktivistinnen mit einer Velo-Demo auf den Klimawandel aufmerksam machten, forderten am Samstag 12 Organisationen einen gesellschaftlichen Wandel.
Nun also Demo Nummer 3 am Donnerstagabend. Bei dem bewilligten Anlass, hinter dem die Gruppe Resolut steht, forderten die Beteiligten, dass die Schweiz sich um die Opfer des heruntergebrannten Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos kümmert. Schliesslich, so eine Aktivistin, hat die Schweiz genug Platz.
Anwesend war beim Start der Demo um 18 Uhr ein bunt gemischtes Publikum von jung bis alt. «Wir sind heute hier, um unsere Trauer und unsere Wut auf die Strasse zu bringen», sagt ein Demonstrant ins Mikrofon. Für die Schweizer Politik fand er klare Worte: «Wenn es um die Flüchtlingspolitik geht, ist die Schweiz nicht bereit, sich in einem globalen Kontext zu sehen. Schämt euch.» Die Menge applaudiert.
Unter den Rednern war auch SP-Kantonsrätin Sara Muff, die selbst vor einigen Jahren auf Lesbos im Flüchtlingslager karitativ tätig war. Sie kritisiert ebenfalls die Haltung der Regierung. Bern sei bereit, 20 Menschen aufzunehmen. «Was soll dieser Scheiss?» ruft sie empört. «Wir wissen alle, dass wir viel mehr Platz haben und viel mehr tun können – gerade jetzt, wo Hotels leer stehen.» Sie schäme sich, Teil, dieses Systems zu sein.
«Das Coronavirus hat gezeigt, was wir in Bewegung setzen können – wenn wir wollen», sagt Muff weiter. Moria sei der Ort, wo Europa die Flüchtlingskrise ausgelagert habe. Ein Ort, der für 2800 Personen gebaut war, aber von 13’000 bewohnt wurde. Im Namen der Gruppe hatte die Aktivistin eine klare Forderung: «Die sofortige Evakuierung aller Lager. Und zwar jetzt.»
Nach den Ansprachen setzten sich die rund 200 Teilnehmer in Bewegung. Ihr Ziel: Der Kreuzstutz. Einsatzkräfte der Luzerner Polizei lotsten die mit Schutzmasken, Banner und Transparenten ausgerüsteten Demonstranten durch die Strassen der Stadt. «Kein Mensch ist illegal», riefen sie. Tracy Chapmans «Talking about a Revolution» schallte aus einem Lautsprecher.
Mit weniger kämpferischen Parolen, aber mit sinndeckendem Inhalt macht sich auch die Stadt Luzern für die Opfer der Krise stark. Am Donnerstagnachmittag gab die Stadt bekannt, für die Aufnahme von Flüchtlingen bereit zu sein. Auch wenn «die Schweizer Asylpolitik grundsätzlich in der Kompetenz des Bundes liegt», wie es in dem Schreiben heisst.
«Die Stadt Luzern hat dem Bund bereits im Juni 2020 gemeinsam mit anderen Städten die Bereitschaft signalisiert, Flüchtlinge aus Lesbos aufzunehmen», schreibt die Stadt weiter. Diese Bereitschaft werde hiermit noch einmal bekräftigt. Schreibt ZentralPlus.
Es sind unerträgliche Bilder aus den Asylantenlagern auf der Insel Lesbos. Keine Frage. Und es war auch vorauszusehen, dass die Asylanten vom Flüchtlingslager Moria irgendwann mit einer erfolgreichen Brandstiftung vollendete Tatsachen schaffen würden.
Genau das ist nun geschehen. Jahrelang hat die «westliche Wertegemeinschaft» zugeschaut, die Augen geschlossen, die Arme verschränkt und nichts gegen die Misere unternommen. Eines der ärmsten EU-Länder, nämlich Griechenland, wurde von der «Wertegemeinschaft EU» wie zuvor schon Italien allein gelassen.
Zwar flossen EU-Hilfsgelder, leider nicht selten in falsche Kanäle, wie das in Griechenland nun mal üblich ist und die NGO's vor Ort bemühten sich redlich. Doch einen Plan hatte und hat die EU, die doch sonst bis zur Gurkenkrümmung so ziemlich alles regelt, bis zum heutigen Tag nicht.
Es ist auch legitim und spricht für die Schweizer Demokratie, gegen die Ignoranz und das totale Versagen der Verantwortlichen mit einer Demonstration auf die unhaltbaren Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern aufmerksam zu machen.
Allerdings steht hinter der Forderung der Demonstranten und der Stadt Luzern, diese Flüchtlinge nach Luzern zu holen, kein Plan. Dass sich die Demonstration ausgerechnet über die Baselstrasse Richtung Bahnhof bewegte, ist nur noch ein schlechter Treppenwitz.
Denn nirgendwo wird das Versagen der Luzerner Asylpolitik augenfälliger als in der Baselstrasse. Die Verzahnung der Connections (Community) aus Arabien, Afrika und dem Balkan regelt inzwischen so ziemlich alles in Luzern. Von der arabischen Barbershop-Schwemme über die Kebab-Läden und Halal-Metzgereien bis hin zur Verteilung von Rauschgiften jeglicher Art.
Das hat mit den romantischen Vorstellungen von Multi-Kulti nichts mehr zu tun. Da sind längst knallharte wirtschaftliche und religiöse Parallelgesellschaften mit teilweise kriminellen Strukturen entstanden, die nicht mal mehr von der Luzerner Polizei kontrolliert werden können. Paris und Berlin lassen grüssen.
Es gibt Gründe, weshalb Luzern inzwischen nach Zürich der zweitgrösste Drogen-Hotspot der Schweiz geworden ist. Es gibt auch Gründe, weshalb in Luzern, Kriens, Emmen/Emmenbrücke und Ebikon neun gut besuchte Moscheen entstanden sind. Drei Messerstechereien in einer Woche in den Problem-Vierteln der Stadt leisten ebenfalls ihren Anteil, die Lebensqualität in der Stadt Luzern stetig zu senken.
Dass die Demonstranten mit ihrer Demo der unseligen Begrenzungsinitiative Vorschub leisten, ist den hehren Menschen wohl kaum bewusst. Obschon das Eine mit dem Anderen rein gar nichts zu tun hat, werden wohl etliche Wahlberechtigte mit falschen Hoffnungen die falsche Wahlentscheidung treffen.
Alles hängt mit allem zusammen. Demonstrationen sollten nicht zum Selbstzweck der neverending Party verkommen.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
10.9.2020 - Tag der Zweitklassigkeit
Infolge der SBB-Zugausfälle: «Die Aargauer fühlten sich als Fahrgäste zweiter Klasse»
Die zahlreichen Zugausfälle im Aargau haben erste politische Folgen. An der Grossratssitzung am Dienstag wurden gleich mehrere Vorstösse eingereicht. Die FDP-Grossräte Titus Meier (Brugg), Bernhard Scholl (Möhlin) und Stefan Huwyler (Muri) schreiben: «Infolge schlechten Personalmanagements fallen ganze Linien wie etwa die S42 zwischen Muri und Zürich aus. Im Fricktal fällt der «Flugzug» von Basel nach Zürich Flughafen weg, der intensiv von Pendlern genutzt wird. Die Aargauer/innen fühlten sich als Fahrgäste zweiter Klasse.» Die drei fragen, welche negativen Auswirkungen das für die betroffenen Gebiete habe. Sie wollen auch wissen, ob eine gezielte Reduktion des Angebots auf wenig nachgefragten Strecken am Abend oder am Wochenende nicht besser wäre. Schliesslich fragen sie, ob der Kanton seine Zahlungen zu kürzen gedenkt, oder ob gar Schadenersatz ein Thema sei.
CVP: Der Busersatz verlängert die Reisezeit
Gross ist der Ärger auch bei den CVP-Grossräten Werner Müller (Wittnau), Cécile Kohler (Lenzburg) und Alfons Kaufmann (Staffelbach). Sie kritisieren, dass die Direktverbindungen von Lenzburg nach Zofingen mit Bussen ersetzt und damit die Fahrtdauer verlängert wird. Ebenso, dass Verbindungen von Muri nach Zürich teilweise ganz ausfallen. Auch das Fricktal sei mit dem «Flugzug» stark betroffen. Der Aargau habe diese Leistungen bestellt und leiste einen finanziellen Beitrag, halten die drei fest. Auch sie haben viele Fragen. Sie wollen wissen, wie und wann der Regierungsrat über die Zugausfälle informiert wurde, aber auch wie der Aargau entschädigt werde: «Können nicht erfüllte Leistungen mit einer Konventionalstrafe geahndet werden?» Zusätzlich fragen sie: «Wie sicher ist es, dass alle Zugsverbindungen ab Fahrplanwechsel vom 13. Dezember wieder fahrplanmässig verkehren?»
Perroud: Will die SBB die S42 in Raten abbauen?
Ein weiterer Vorstoss stammt von SP-Grossrat Arsène Perroud, dem Gemeindeammann von Wohlen – naheliegenderweise zur S42. Diese weise steigende Frequenzen von bis zu 250 Personen stündlich auf, schreibt er. All diese Leute müssen jetzt andere schlechtere Verbindungen suchen oder mit dem Auto fahren. Perroud: «Das Vorgehen der SBB weist darauf hin, dass die S42 in Raten abgebaut werden soll.» Das Freiamt trage als Güterverkehrskorridor hohe Belastungen. Deshalb seien die Kapazitäten für den Personenverkehr beschränkt. Er fragt: «Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, dass bei der S42 nicht einfach ein «Zusatzangebot» oder ein «Verstärkungszug» weggestrichen wird, sondern das Rückgrat der Pendlerverbindung Freiamt-Altstetten-Zürich HB?» Auch Perroud regt an, von der SBB die vorübergehende Einstellung anderer, schlechter frequentierter (Rand-)Angebote zu fordern, damit wenigstens zwei tägliche Zugspaare der S42 gefahren werden können. Schreibt das Zofinger Tagblatt beim Mutterhaus AZ ab.
Liebe Aargauerinnen und Aargauer. Euer Zweitklasse-Syndrom hat nun aber wirklich rein gar nichts mit den Zugausfällen der SBB zu tun. Diesen fatalen Ruf habt Ihr Euch selbst über Jahrzehnte hinweg mit Euren furchtbaren weissen Socken erarbeitet.
Nehmen Sie zum Beispiel die Innerschweiz: Hier tragen die Menschen ausschliesslich modische Socken von Gucci oder Prada. Made in China. Gut, es gibt auch Ausnahmen. Der Luzerner Ständer-Rat Damian Müller trägt vorzugsweise FOGAL-Strümpfe. Aber Mitglieder von Randgruppen fallen nun mal nicht ins Gewicht.
-
9.9.2020 - Tag der Internetconnection
In eigener Sache: Ein Unglück kommt selten allein. Es kommt meistens noch ein zweites.
«Aargauer News – Tag für Tag frisch auf den Tisch ab 09.00 Uhr.» So steht es geschrieben auf der Frontseite der Website vom Artillerie-Verein Zofingen. Doch dem war heute, 9.9.2020 überhaupt nicht so. Es dauerte ganz genau bis 14.15 Uhr, bis die ersten News online waren. Was ist denn da passiert?
Es zeichnete sich schon seit Tagen ab, dass da bezüglich Internet-Connection im Haus, in dem ich mein Penthouse bewohne, irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung war. Sowohl PC wie auch Handy (wenn über WLAN laufend) meldeten ab und zu eine "instabile Internetverbindung", die sich gestern Abend kurz nach 19.00 Uhr zum ersten Mal komplett verabschiedete, um sich kurz vor 20.00 Uhr wieder zurückzumelden. Immerhin war es mir vergönnt, den am Montag verpassten «Inspektor Barnaby» auf dem Replay doch noch zu Gemüte führen zu können.
Doch als ich heute Morgen nach meiner sprichwörtlich senilen Bettflucht in aller Herrgottsfrühe so gegen 05.15, als der Hahn bei meinem arabischen Nachbarn noch auf der Henne krähte, den PC startete, kam das böse Erwachen: Kein Internet. Ein Blick auf den Status meiner Geräte bei meinem UPC-Konto via Handy, das ich als Vorsorge für solche Verbindungsprobleme stets bei Swisscom beliess, deckte auf, dass im ganzen Haus, womöglich sogar im ganzen Quartier ein grosses Problem anstand, das Internet, TV und Festnetz ausser Betrieb setzte.
Kein Problem. Wozu hat man denn einen Hotspot auf dem Handy mit dem Swisscom-Abo geschaffen? Genau! In solchen Fällen hilft «doppelt genäht» weiter.
Doch als ich den seit Ewigkeiten nie mehr verwendeten Handy-Hotspot beim PC (und später beim Laptop) aktivieren wollte, meldete mir Microsoft, dass die Software ein UpDate benötige. Die Software von Microsoft, wohlverstanden, nicht diejenige meines HTC-Handys, das ja eine funktionierende Internetverbindung gehabt hätte. Mission impossible – ein Ding der Unmöglichkeit ohne Internetverbindung. Ein Unglück kommt wirklich selten allein.
Obwohl UPC auf der Statusmeldung angedroht hatte, dass die Wiederherstellung der Verbindung möglicherweise mehrere Stunden dauern könnte, standen knapp nach neun Uhr zwei Servicemonteure von UPC vor der Haustüre und suchten die Hauswartin, die – selbst ein zweites Unglück kommt selten allein – derzeit in den verdienten Ferien weilt. Ein Kellerschlüssel musste her, war doch der Verursacher der Störungen in der Verteilerzentrale im Keller unseres Hauses geortet worden.
Wie gut, dass ich einen Schlüssel für dieses Kellerabteil besitze, wo der UPC-Verteilerkasten steht. Hat nicht jeder. Die beiden wirklich kompetenten Fachleute von der UPC, Fieldforce Senior Techniker Van Lewis, ein waschechter und höchst sympathischer Afrikaner und seine rechte Hand, ein Deutscher, machten sich an die Arbeit (so viel nebenbei zur Begrenzungsinitiative).
Kurz nach elf Uhr war der Schaden behoben. Die beiden Netz-Koryphäen gingen von dannen, nicht ohne eine Zwanzigernote von mir, die mir UPC nach einem kurzen Telefonat bereits für die nächste Rechnung als Rückvergütung gutgeschrieben hat. Man will ja keinen alten (im wahrsten Sinne des Wortes) Kunden verlieren.
Und die Moral von dieser doch etwas langen G'schicht? Über das Zofinger Tagblatt lästern lohnt sich nicht!
Schon mehrmals habe ich mich nämlich hier in Wort und Bild leicht hämisch geäussert, wenn das ZT wieder mal online wegen Serverproblemen nicht zu erreichen war. Wir leben nun mal in einer hochkomplexen digitalen Infrastruktur, bei der jederzeit und bei jedem Anbieter ein kleineres oder grösseres Malheur passieren kann. Mal trifft es die UPC (eher selten), mal die Swisscom. Oder die PostFinance.
Und nun hat es mich getroffen. Zum ersten Mal übrigens, seit ich die AVZ-Website betreue. Den Handy-Hotspot habe ich seit drei oder vier Jahren kaum mehr bemühen müssen. Und wenn, dann nur für ganz kurze Momente.
Noch nie, und darauf bin ich stolz, gab es je einen Ausfall oder eine derartige Verspätung. Und dies 365 Tage im Jahr, manchmal sogar 366 Tage. Eines aber habe ich gelernt: In Zukunft werde ich mit dem Zofinger Tagblatt gnädiger umgehen. Lange wird das Blatt ja sowieso nicht mehr bestehen.
Herzlichst und mit etwas Verspätung
Ihr Master of Disaster*, formerly known as Webmaster
* PS: «Master of Disaster» ist ein offizieller akademischer Titel, den man sich mittels Studium an einer Uni in Kopenhagen (Dänemark) erarbeiten kann. Ich habe mir den Titel ohne Studium, dafür mit ehrlicher Selbsteinschätzung, einfach angemasst. Und unser wandelndes Lexikon Res findet ihn zutreffend.
-
8.9.2020 - Tag der Schnattäre
Reiseberater Koni Kölbl hofft auf Hilfe aus dem Parlament: Seit März verkaufte er gerade mal drei Reisen
Reiseberater wie Koni Kölbl gehören zu den grossen Verlierern der Corona-Krise. Nun hoffen sie auf Hilfe aus dem Parlament. Dieses berät ab Mittwoch über eine Verlängerung des Corona-Erwerbsersatzes.
Es ist leer im Reisebüro von Koni Kölbl (58) in der Berner Altstadt. Ein einziger Termin stand am Montag auf seiner Agenda: Eine Kundin fliegt am Dienstag nach Tansania und wollte ihre Reiseunterlagen abholen. «Das ist wahrscheinlich die letzte Abreise bis Ende Jahr», sagt Kölbl.
Sein Geschäft ist mit Corona eingebrochen. Seit Mitte März konnte Kölbl gerade mal drei Reisen verkaufen. Sonst heisst es für den 58-Jährigen: Flüge annullieren, Geld zurückerstatten – und sich finanziell irgendwie über Wasser halten.
Die Reisebranche gehört zu den grössten Verlierern der Corona-Krise. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) haben bis zu 40 Prozent der Reisebüros ein hohes Konkursrisiko. Dennoch liess der Bundesrat die Kurzarbeitsentschädigung für Personen in «arbeitgeberähnlicher Stellung» – was viele Reisebüro-Inhaber sind – Anfang Juni auslaufen. Dasselbe beim Erwerbsersatz für Selbständige. Diesen musste die Regierung auf Druck des Parlaments allerdings bis Mitte September verlängern.
Hoffen auf das Parlament
Seit 1. Juni erhält Reisebüro-Inhaber Kölbl vom Bund kein Geld mehr. Seine finanziellen Reserven sind inzwischen so knapp, dass er seiner einzigen Mitarbeiterin vorübergehend kündigen musste.
Nun liegt seine ganze Hoffnung auf dem Parlament. Am Mittwoch berät der Nationalrat nämlich das Covid-Gesetz. Darin wird unter anderem geregelt, wie es mit dem Erwerbsersatz für Selbständige weitergehen soll. Bundesrat und Gesundheitskommission wollen, dass nur noch jene Geld erhalten, die ihre Arbeit aufgrund der Corona-Massnahmen «unterbrechen» müssen.
SP-Meyer will Hilfen ausweiten
Das mache überhaupt keinen Sinn, findet SP-Nationalrätin Mattea Meyer (32). Niemand müsse im Moment die Arbeit unterbrechen. «Rein theoretisch kann man auch in die weite Welt verreisen», sagt sie. «Nur macht das derzeit praktisch niemand!»
Meyer fordert deshalb, dass weiterhin auch Selbständige unterstützt werden, die ihre Arbeit wegen Corona «massgeblich» einschränken müssen. Sie zielt mit dem Vorschlag insbesondere auf die Reise- und Eventbranche.
CVP-Humbel fürchtet Missbrauch
Meyers Vorschlag berge Potenzial für Missbräuche, warnt hingegen CVP-Nationalrätin Ruth Humbel (63). «Eine generelle Weiterführung der Corona-Hilfen finde ich höchst problematisch. Wir haben bei der Verlängerung des Erwerbsersatzes für Selbständige gesehen, dass solch allgemeine Formulierungen zu teilweise absurden Situationen führen.»
Humbel spricht an, was BLICK öffentlich machte: Selbständige, die nicht mehr auf den Corona-Erwerbsersatz des Bundes angewiesen sind, müssten das melden. Nur machen das längst nicht alle. Manche aus Unwissen, andere dürften den Corona-Batzen genüsslich einstreichen. Und Dritte wurden von der AHV-Ausgleichskasse sogar dazu angestiftet, die hohle Hand zu machen.
«Diese Fälle müssen uns ein Warnsignal sein», sagt Humbel. Doch auch sie verkennt nicht, dass die Reise- und Eventbranche besonders unter der Krise leidet. «Der Bundesrat ist dabei, mit den Kantonen hier eine spezifische Lösung zu finden», sagt sie. Schreibt Blick.
Natürlich geht einem das Schicksal von Reiseberater Koni Kölbl ans Herz. Doch Hand auf eben dieses Herz: Reisebüros und Reiseberater sind Auslaufmodelle, die so oder so der Digitalisierung zum Opfer fallen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Corona hat diesen unaufhaltsamen Prozess lediglich beschleunigt.
Dass die unsägliche Ruth Humbel von der Aargauer CVP (neu «Die Mitte»), von einem Luzerner CVP-Politiker (!) kürzlich als «forchtbari Schnattäre» bezeichnet, ihrem Misstrauen Ausdruck verleihen muss, zeigt einmal mehr, wessen Geistes Kind diese Frau «der Mitte» ist.
So viel Misstrauen bringt die selbsternannte «Gesundheitsexpertin» den von ihr hofierten Krankenkassen jedenfalls nicht entgegen.
-
7.9.2020 - Tag der Blabla-Behauptungen
Twint bedroht Freundschaften und holt aus Schweizern das Schlechteste heraus – eine Abrechnung
Viele Schweizer starten heute wegen 90 Rappen Twint und überweisen Kleinstbeträge. Unsere Autorin ist überzeugt: die App macht uns zu Geizhälsen.
Es geschah in einem Restaurant. Sara feierte ihren 31. Geburtstag mit ihren Freundinnen. Pizza und Negroni, fröhliches Geschnatter. Kurz nach dem Essen verschwand das Geburtstagskind, um unbemerkt die Rechnung zu bezahlen. «Ihr seid eingeladen», sagt sie, als sie wieder am Tisch war. Was darauf folgte, ist typisch schweizerisch. «Wirklich? Das wäre aber nicht nötig gewesen!»
Das monetäre Ungleichgewicht macht vielen Mühe
Soweit der höfliche Floskelaustausch. Dann zückten zwei Freundinnen ihr Smartphone. «Ich twinte dir das Geld», sagten sie. Gegen diese Art von Einladungssabotage konnte Sara nichts machen. Eine hingestreckte 50er-Note kann man abwehren, bei Twint geht das nicht. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Da macht Janine Gloor mit viel Blabla aus einer Mücke einen Elefanten. Kein Mensch auf dieser unserer Erde wird gezwungen, die TWINT-App auf dem Handy zu installieren. Dass wegen TWINT Freundschaften zerbrechen, ist eine gesuchte Behauptung aufgrund einer einzelnen Beobachtung an einer Geburtstagsfeier, um dem Artikel doch noch einen Hauch von Dramatik zu verleihen.
-
6.9.2020 - Tag des Jammertals
Doppel-Interview mit Branchengrössen François Launaz und Urs Wernli: «Sommaruga hat kein Ohr für unsere Branche»
Corona-Krise, CO2-Bussen, Autosalon-Absage – für die Schweizer Autobranche lief zuletzt wenig rund. SonntagsBlick bat François Launaz, Präsident Importeursvereinigung Auto Schweiz, und Urs Wernli, Zentralpräsident Auto Gewerbe Verband Schweiz AGVS, an einen Tisch.
Die Corona-Krise hinterlässt in Ihrer Branche eine fette Bremsspur – oder gar einen Totalschaden?
François Launaz: Totalschaden wäre übertrieben. Aber es entsteht schon ein massiver Schaden. Derzeit sind die Neuwagenverkäufe gegenüber 2019 um 30 Prozent im Minus. Für die nächsten Monate erwarte ich noch etwas Besserung. Aber wir werden niemals aufholen, was wir im Frühling verloren haben. Ende Jahr werden wir wohl 20 bis 25 Prozent im Minus sein.
Ein Viertel weniger ...
Launaz: … ist viel. Und ich sorge mich um die Zukunft! Was passiert nächstes und übernächstes Jahr? Ich fürchte, um auf das frühere Niveau von 300’000 Neuwagen zurückzukommen, brauchen wir einige Jahre.
Herr Wernli, siehts bei Ihnen auch so düster aus?
Urs Wernli: Unser Geschäft beim AGVS-Garagisten ist dreiteilig aufgebaut. Bei den Neuwagen siehts natürlich genauso schlecht aus wie bei Auto Schweiz, wobei wir das Ganze noch etwas pessimistischer beurteilen. Der Occasionsmarkt läuft dagegen erstaunlich gut. Und auch beim Werkstattgeschäft sind wir unter den gegebenen Umständen mit einer guten Auslastung unterwegs. Schreibt SonntagsBlick.
Jammern auf hohem Niveau - Nach sieben fetten Jahren folgen sieben magere Jahre.* Die Autobranche wirds überleben.
* Die Wendung entstammt der Bibelgeschichte, in der Joseph den Traum des Pharaos von sieben fetten und sieben mageren Kühen so auslegt, dass nun sieben ertragreiche Jahre und dann sieben Jahre mit Hungersnot folgen werden.
-
5.9.2020 - Tag der Mühseligen und Beladenen
Neuer Name, neues Glück? Politologe Michael Hermann über den Wandel der CVP zu «Die Mitte»
Im Logo der neuen Partei «Die Mitte» erinnert nur noch die Farbe Orange an die CVP-Herkunft. Die CVP könnte damit in ihren Hochburgen verlieren, sagt Politologe Michael Hermann.
Die Fusion mit der BDP biete der CVP gewisse Chancen, aus dem katholischen Ghetto herauszukommen. «Sie muss etwas ändern, wenn sie das will», sagt Politologe und Geograf Michael Hermann. «Die Fusion ist eine Chance, mehr Stimmen in der Mitte zu gewinnen.» Dieses Feld sei allerdings «nicht sehr gross».
Hermann sieht dafür beträchtliche Risiken für die CVP. «Es besteht die Gefahr, dass die CVP in ihren Hochburgen verliert, wo sie heute in den Exekutiven, in den Parlamenten und im Ständerat so stark vertreten ist.»
Neu ist die CVP mit 37 Regierungsräten auf Rang eins der stärksten Parteien in den kantonalen Regierungen. Seit der Abwahl Christian Amslers aus der Schaffhauser Regierung am letzten Sonntag liegt die FDP in dieser Rangierung mit 36 Mandaten hinter der CVP. Die FDP befindet sich auf einer eigentlichen Talfahrt. Sie verlor seit Anfang
2019 41 Exekutivsitze. SP und SVP folgen auf den Rängen drei und vier mit 32 respektive 25 Regierungsräten. Dies machte der «Tages-Anzeiger» publik.
Eine herausragende Stellung nimmt die CVP auch im Ständerat ein. Sie vertritt darin 13 Kantone und liegt an erster Stelle, ebenfalls vor der FDP mit 12 Mandaten, der SP (9 Mandate) und der SVP (7 Mandate). Zwischen 2008 und 2011 hatte die CVP gar 16 Ständeratsmandate. Sie stellte letztmals 2003 nicht die grösste Ständeratsfraktion: Die FDP hatte damals 18 Mandate, die CVP kam auf 15. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wenn die CVP «Die (neue) Mitte» ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass der brachiale Hardcore-Neoliberalismus in der «Mitte der Gesellschaft» angekommen ist. Bezogen auf die Wahlresultate stimmt das sogar.
So kommt's dann halt, wenn die Wahlbeteiligung selbst bei nationalen Abstimmungen unter 40 Prozent fällt.
Da sollten sich die 60 Prozent Nichtwähler*innen, die sich an den Stammtischen drüber aufregen, welche Wahlentscheidungen «die Arschlöcher» getroffen haben, mal an der eigenen Nase nehmen.
Und vielleicht in Zukunft nicht nur bei Abstimmungen über Minarette, Burkas und kriminelle Ausländer den Arsch Richtung Wahllokal bewegen.
-
4.9.2020 Tag der Scheibe
Einmal mit, einmal ohne zum Einkaufen: Hier verläuft die Maskengrenze mitten durchs Dorf
Wer in Erlinsbach SO im Coop einkauft, muss seit gestern Donnerstag eine Maske tragen – anders im Migros und Denner in Erlinsbach AG.
«Scheibe!», flucht ein Mann. Er wollte im Coop in Erlinsbach SO einkaufen und hat die Maske vergessen. Die ist seit gestern Pflicht in allen Geschäften auf Solothurner Kantonsgebiet. Anders im Aargau. Im Denner und in der Migros ennet dem Bach, in Erlinsbach AG, darf weiterhin ohne Maske eingekauft werden. Ein BMW mit Solothurner Nummernschild fährt auf den Parkplatz vor dem Denner. Fredy Moll steigt aus. Der 76-Jährige trägt eine Maske. «Ich wohne im Kanton Solothurn», sagt er. «Dort tragen wir Maske. Wenn die Aargauer das nicht brauchen, ist das ihr Problem.»
Eine Mutter aus dem Kanton Aargau sieht das anders: «Ich bin froh, hat sich der Aargau gegen eine Maskenpflicht entschieden.» Sie werde den Coop und den Kanton Solothurn wegen der Maskenpflicht meiden; den Kanton Zürich ohnehin. Sie findet: «Im März sind die Ansteckungszahlen gesunken – ohne Maskenpflicht.»
Denner-Mitarbeiterin Evelyne Aebi hat das Gespräch mitgehört. «Es könnte schon sein, dass wegen der Maskenpflicht im Coop mehr Leute von ennet dem Bach im Aargau einkaufen», sagt sie. Für eine Aussage sei es aber noch zu früh. Ausserdem könne es gut sein, dass die Maskenpflicht im Aargau auch noch komme.
Heinz von Arx füllt sein Einkaufswägeli vor dem Denner mit Bier. Eine Maske trägt der Erlinsbacher aus dem Kanton Solothurn nicht. Es sei aber nicht deshalb im Denner einkaufen, stellt von Arx klar. «Mich stört die Maske überhaupt nicht. Im Kanton Solothurn ziehe ich sie automatisch an. Sie ist im Vergleich zum Coronavirus das kleinere Übel.» Was ihn hingegen stört, ist, dass in jedem Kanton andere Regeln gelten. «Einheitliche Vorschriften wären für alle einfacher.»
Im Coop ennet dem Bach liegen bei der Kasse Masken. Die Mitarbeitenden verkaufen sie, wenn jemand nicht an die Maskenpflicht gedacht hat. «Wir machen die Leute darauf aufmerksam, wenn sie ohne Maske den Laden betreten – vor allem weil wir ein spezielles Dorf sind», sagt die Filialleiterin.
Eine Coop-Kundin aus Lostorf SO kommt aus dem Laden. Die Maske hat sie unters Kinn geschoben. Die Maskenpflicht stört sie. «Ich mag es nicht, wenn einem solche Dinge aufgezwungen werden. Ich halte mich daran, aber ich nehme es nicht mehr so ernst. Ich habe keine Angst.» Die 68-Jährige wird aber trotz Maskenpflicht weiterhin im Kanton Solothurn einkaufen. «Diese zehn Minuten mit Maske nehme ich in Kauf und fahre deshalb nicht extra von Lostorf in den Aargau.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Formerly known as «Schildbürgerstreich».
PS: Waren das noch Zeiten, als man «Scheibe» mit zwei «s» schrieb.
-
3.9.2020 - Tag der sexuellen Frustration
Küssen weglassen: Oberste Medizinerin Kanadas empfiehlt Maske beim Sex!
Die oberste Medizinerin Kanadas hat zum Schutz gegen das Coronavirus das Tragen einer Maske auch beim Sex empfohlen. Wer Sex mit jemandem habe, der nicht im eigenen Haushalt wohne oder der zu den Corona-Risikogruppen zähle, solle dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen, erklärte am Mittwoch die Chefin der Behörde für öffentliche Gesundheit, Theresa Tam.
Sie riet auch dazu, das Küssen wegzulassen und Berührungen der Gesichter zu vermeiden. «Sex kann in Zeiten von Covid-19 kompliziert sein», gab Tam zu bedenken. Dies gelte besonders für Menschen, die keine Sexpartner im eigenen Haushalt hätten. «Die sexuelle Aktivität mit dem niedrigsten Risiko ist jene, an der nur Sie alleine beteiligt sind», fügte die Medizinerin zu.
Die New Yorker Gesundheitsbehörde hat bereits zu Beginn der Pandemie eine Anleitung erstellt, wie man eine Corona-Ansteckung beim Sex vermeidet. Auf Gruppensex sei beispielsweise zu verzichten. Die Behörde hat ebenfalls darauf hingewiesen: «Sie sind Ihr sicherster Sexpartner.» Schreibt Blick unter Verwendung von SDA-Material.
Auch das noch!
-
2.9.2020 - Tag der Frauengebete
Stadtmission im Einsatz nach Corona-Fall im Zürcher Milieu – Helfer erzählen: «Wir haben mit den Frauen gebetet»
Wegen eines Corona-Falls müssen 50 Prostituierte in Quarantäne. Auch zwei Polizisten müssen sich isolieren, weil ihre Gesichtsmasken sich beim Einsatz verschoben haben. Eine Hilfsorganisation springt den Frauen zur Seite.
Am Sonntagmorgen musste die Stadtpolizei Zürich ins Rotlicht-Milieu ausrücken. Im Auftrag des Contact-Tracing-Teams sollten sie einer Frau an der Langstrasse 108 ausrichten, dass sie sich wegen eines Corona-Tests vom 28.08.2020 beim Contact-Tracing-Team melden müsse, da sie zuvor telefonisch nicht erreicht werden konnte.
Die Betroffene konnte erst am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr angetroffen und orientiert werden, dass sie positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei. Diese befindet sich momentan in einem Spital in Zürich.
Rund 50 Frauen wohnen auf engem Raum
Die weiteren Abklärungen der Stadtpolizei zeigten, dass in der Liegenschaft Langstrasse 108 rund 50 Frauen auf engem Raum zusammenwohnen. Im Haus befindet sich auch die als Kontaktbar bekannte «Lugano-Bar», in der sich regelmässig Freier und Prostituierte treffen.
Der Kantonsärztliche Dienst hat in der Zwischenzeit verfügt, dass sich die rund 50 Frauen aufgrund des positiven Resultats der Mitbewohnerin in Quarantäne begeben müssen. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem zweiten Polizeieinsatz. Beamte erschienen in Schutzkleidung bei der Liegenschaft, um den betroffenen Prostituierten die Quarantäneverfügung auszuhändigen. Die Frauen weigerten sich, am Hauseingang den Empfang der Papiere zu bescheinigen. Deshalb betraten vier Polizisten in Schutzkleidung schliesslich die Räumlichkeiten, um die Unterschriften einzuholen.
«Alle Damen im Haus müssen bis am 9. September in Quarantäne bleiben», sagt der Einsatzleiter der Stadtpolizei Zürich gegenüber BLICK.
Für die Frauen ein harter Schlag: «Wir haben versucht sie zu beruhigen und zu erklären um was es hier geht», sagt Beatrice Bänninger (56) zu BLICK. Sie ist Geschäftsführerin der Zürcher Stadtmission, die die Anlaufstelle für Sexarbeitende «Isla Victoria» betreibt. «Wenn sie auf diesen Verdienst angewiesen sind, dann führt das sehr schnell zu existenziellen Ängsten», sagt sie.
Wie es für die Frauen weiter geht ist noch nicht klar. Laut Bänninger sind die Testresultate der anderen betroffenen Prostituierten noch nicht da. Diese sollten aber noch am Dienstag übermittelt werden. «Wenn jemand positiv ist, dann gibt es nur eins – Isolation», sagt sie. Aber: «In solchen Räumlichkeiten kann niemand in Selbstisolation. Das ist ein grosses Problem», sagt Bänninger.
«Wir sind nun am abklären wo die Frauen überhaupt untergebracht werden könnten», heisst es beim Gesundheits- und Umweltdepartement Zürich auf Anfrage von BLICK.
Direkten Kontakt zu den betroffenen Frauen haben seit Sonntag Ariane Stocklin und Karl Wolf von der Hilfsorganisation «Incontro». Stocklin sagt gegenüber BLICK, dass die Prostituierten zu Beginn «sehr aufgeregt und verunsichert» gewesen seien. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. «Wir sind heute in ein afrikanisches Geschäft gegangen, damit sie ihnen bekannte Gerichte kochen können», so Stocklin.
«Wir versuchen sie auch geistlich zu unterstützen», erzählt Karl Wolf, Pfarrer aus Küsnacht. «Die Frauen haben sich gewünscht, dass wir alle zusammen beten. Viele von ihnen sind sehr gläubig und spirituell.» Ariane Stocklin zieht ein positives Fazit vom zweiten Tag in Quarantäne: «Die Frauen vertrauen uns jetzt schon viel mehr. Da wächst etwas heran. Es ist auch eine Chance.»
Auch Polizisten müssen in Quarantäne
Die zwei Polizisten, welche die Frau über das positive Resultat informierten, wurden von den emotional reagierenden Kolleginnen körperlich bedrängt. Dadurch verschoben sich ihre getragenen Gesichtsmasken. Darum wurde entschieden, dass sie sich nach dem Einsatz in Quarantäne begeben müssen.
Die positiv getestete 23-jährige Frau wurde bereits am Sonntag in ein Isolationszimmer gebracht. Die Behörden von Stadt und Kanton Zürich arbeiten in diesem aussergewöhnlichen Fall eng zusammen. Schreibt Blick.
Alles halb so wild. Solange es beim Beten bleibt, werden auch keine sündigen Viren übertragen. Frei nach Apostel Paulus: Gehet hin in Frieden, Ihr Unseligen, und sündigt weiter.
-
1.9.2020 - Tag der Luzerner Müllhalden
Littering auf Kuhweiden macht Luzerner Regierung ratlos
Wanderer und Autofahrerinnen, die ihren Abfall auf Kuhweiden entsorgen, sind laut Bauernverband ein tödliches Problem. Trotzdem will der Kanton Luzern keine zusätzliche Kampagne auf die Beine stellen. Wie dem Problem zu begegnen sei, da wirken die Beteiligten etwas ratlos.
145 Millionen Franken kostet laut Bundesamt für Umwelt unachtsam weggeworfener Müll jährlich die Gemeinden. Das Thema Littering beschäftigt nicht nur in den Städten wie Luzern, wo die Ufschötti diesen Sommer gelegentlich wie ein Festivalgelände nach dem letzten Konzert aussah (zentralplus berichtete).
Auch auf dem Land ist das Thema, verstärkt durch Corona-bedingte Ferien zu Hause, brennend aktuell. Wanderer und Autofahrer, die ihren Müll auf Kuhwiesen entsorgen, verschandeln dabei nicht nur das Landschaftsbild, sondern gefährden auch Tiere und Umwelt.
Am schlimmsten sind die Aludosen: Wenn die achtlos weggeworfenen Büchsen im Gras landen, beim Heuen in die Maschinen geraten und schliesslich kleine, scharfkantige Teile ins Tierfutter, droht den Kühen und anderen Nutztieren ein qualvoller Tod.
Abfallsünder sollen härter bestraft werden
Im Juli lancierte der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband dazu eine Plakatkampagne (zentralplus berichtete).
Nun äussert sich auch die Kantonsregierung zum Problem – und zwar in einer Antwort auf eine Motion von CVP-Kantonsrat Roger Zurbriggen.
Die Motion verlangt, dass das Wegwerfen von Aluminiumdosen und anderen Gegenständen auf Weideland und Wiesen als Gefährdung des Tierwohls und entsprechend dem Tierschutzrecht oder einer anderen Gesetzesgrundlage bestraft wird.
Wer eine Aludose ins Gras wirft, ist noch kein Tierquäler
In seiner Antwort benennt der Regierungsrat das Hauptproblem: Nicht unbedingt die Mittel der Bestrafung, sondern das Ermitteln der Täterschaft ist der schwierigste Teil.
Mit den bestehenden Tierschutzgesetzen braucht es nämlich zwingend den Nachweis, dass eine weggeworfene Aludose oder anderer Müll zur Verletzung oder zum Tod eines Tieres geführt hat, um den Täter mit einer saftigen Geldstrafe oder gar einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu belegen.
Die Sünder werden kaum erwischt
Eine Bestrafung wegen möglicher Gefährdung des Tierwohls, also bereits dann, wenn die Aludose weggeworfen wird, sieht das Gesetz hingegen nicht vor. Das bestehende Litteringgesetz berücksichtigt die Gefährdung des Tierwohls nicht. Sowieso gilt das seit 2009 geltende Litteringgesetz eher als zahnloser Papiertiger (zentralplus berichtete).
Um dies zu ändern, wäre aber laut Luzerner Regierung eine Gesetzesanpassung auf nationaler Ebene erforderlich, um zumindest diejenigen Täter härter bestrafen zu können, die inflagranti ertappt werden. Aber eben: Die Abfallsünder werden nur in den wenigsten Fällen erwischt. Auch aus diesem Grund empfiehlt der Regierungsrat, die Motion abzulehnen.
Kanton will sensibilisieren statt bestrafen
Stattdessen will der Kanton mit Aktivitäten und Massnahmen «die Bevölkerung für die Problematik des Littering sensibilisieren». So sollen die gravierenden Folgen des achtlosen Wegwerfens von Aludosen und Glasbehältern und ähnlichen Abfällen für Tiere besser sichtbar gemacht werden.
Nur: Kampagnen, wie die eingangs erwähnte des Bauernverbandes, erachtet der Kanton kaum als geeignet. Aus einer Antwort auf ein Postulat von SVP-Kantonsrätin Angela Lüthold geht nämlich hervor, dass Kampagnen in anderen Kantonen kaum wirken. Eine Evaluation im Thurgau aus dem Jahr 2016 habe ergeben, dass die Kosten für die Müllentsorgung entlang der Kantonsstrassen und auf Parkplätzen nicht gesenkt werden konnten, «sondern zugenommen haben». Zudem verlören Kampagnen nach ihrem Ende sehr schnell auch ihre positiven Wirkungen.
Ein runder Tisch soll frische Ideen bringen
Was aber soll getan werden? Der Kanton schreibt, dass «womöglich durch eine verstärkte Koordination noch gezielter» sensibilisiert werden könnte. Wie genau das aussehen könnte, lässt er aber offen.
Frische Ideen soll nun ein runder Tisch mit den Interessenverbänden – darunter der Bauernverband, die Polizei und die Umweltschutzverbände – bringen. Deshalb empfiehlt der Kantonsrat das Postulat von Lüthold für erheblich zu erklären, obwohl er die Kampagnen für wirkungslos hält. Das Geschäft kommt voraussichtlich in der Herbstsession in den Kantonsrat.
Nach der Absage möchte Zurbriggen laut «20 Minuten» nun versuchen, Nationalräte für sein Anliegen zu gewinnen und eine neue gesetzliche Grundlage zu schaffen. Er glaubt, dass im Bereich Sensibilisierung schon genug gemacht worden ist. Zudem gehe es nicht nur um die Gesundheit von Kühen, sondern auch um Wildtiere: «Auf dem Land ist es vorsätzliche Gefährdung des Tierwohls und beabsichtigte Schädigung von fremdem Eigentum und nicht Littering», so Zurbriggen gegenüber dem Portal. Schreibt ZentralPlus.
Ein runder Tisch und neue Sensibilisierungskampagnen (die wievielten eigentlich?) sollen wieder mal frische Ideen bringen? Das ist schlicht und einfach nichts anderes als eine Bankrotterklärung der Luzerner Politgranden*innen.
Wer es nicht schafft, vor der eigenen Haustür für Ordnung zu sorgen, die entsprechenden Müllproduzenten der Geschäfts-, Klub- und Kioskbetreiber (Aufschütti!) zur Verantwortung zu ziehen und bestehende Gesetze bezüglich Littering durchzusetzen, wird auch die Kuhwiesen nicht vor diesem unerträglichen Müll schützen können.
Die Stadt Luzern ist längst eine einzige Müllhalde. Sei es auf dem Inseli, der Aufschütti, dem Europlatz, vor dem McDonalds beim Bahnhof und diversen Nachtlokalen: Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen.
Wer diese Müllhotspots nur ein einziges Mal nach Mitternacht besucht, ist fassungslos. Ich rede hier nicht von ein paar weggeworfenen Petflaschen, nein, ich rede von Müllhalden, wie man sie normalerweise nur von Bildern aus Bangladesch und Afrika kennt. Ich entschuldige mich bei Bangladesch und Afrika, aber diese Bilder existieren nun mal in unseren Köpfen.
Doch inzwischen ist Luzern drauf und dran, ähnlich schockierende Bilder zu liefern*, wie ich sie in der Realität in meinem Leben bisher nur ein einziges Mal vor vielen Jahren sah: Morgens um fünf Uhr in einem Taxi in Neu Delhi. Ich sage nur «Aufschütti» und «Europaplatz» toppen Neu Delhi.
Eine Shortstory am Rande: Bei einem Spaziergang am Luzerner Quai kam ich kürzlich mit einem englischen Gentleman ins Gespräch. Er fragte mich nach einer öffentlichen Toilette. Zur Schande der Stadt Luzern musste ich ihm gestehen, dass es am Luzerner Quai keine einzige öffentliche Toilette mehr gebe. Die Stadt habe in ihrem Sparmodus alle geschlossen. Nebenbei: Dafür steht jetzt ein übelst stinkendes und vermutlich auch nicht kostenloses Dixi-Klo am Quai.
Dann erzählte mir der Brite in seinem feinen Oxford-Englisch, dass er vor genau 40 Jahren Luzern zusammen mit seiner Frau auf der Hochzeitsreise besucht habe. Er sei beeindruckt gewesen von der Sauberkeit der wunderschönen Stadt Luzern. Das habe er dann auch überall in London erzählt. London sei damals eine einzige «garbage dump» (Müllhalde) gewesen. Doch jetzt, 40 Jahre später, sei er schockiert über das, was er in Luzern gesehen habe: «Luzern ist so schmutzig geworden, selbst London ist sauberer.» Es sei eine schlechte Idee gewesen, die Hochzeitsreise nach Luzern zu wiederholen.
Ich gebe es zu: Irgendwie schämte mich vor diesem englischen Gentleman und seiner Frau.
* Sollten Sie meine Behauptung nicht glauben, werde ich ein paar aktuelle Bilder veröffentlichen. Die Haare, sofern sie noch welche haben, werden Ihnen zu Berge stehen.
-
31.8.2020 Tag von Schuld und Sühne
Der aktuelle Leserbrief im Zofinger Tagblatt: NAB-Ende: Wer ist hauptschuldig?
Das bevorstehende Ende der NAB berührt auch mich persönlich, denn ihre Vorgängerinstitute im Fricktal, die Ersparniskasse Laufenburg und dann die Aargauische Hypothekenbank, waren praktisch mein Elternhaus. In Frick und in Laufenburg, wo mein Vater seine gesamte berufliche Laufbahn engagiert dieser Bank gewidmet hatte, hatten wir stets Wohnsitz im Bankgebäude. Wenn ich nun in diversen Medien zu lesen oder hören bekomme, CS-CEO Thomas Gottstein «beendet abrupt die Geschichte dieser traditionsreichen Regionalbank», oder «nun wird die Marke NAB ausradiert, ein kapitaler Fehler», so darf daraus nicht auf die Hauptursache für das heutige Ende der NAB geschlossen werden. Wenn schon, dann wurden die Weichen in die heutige Sackgasse Anfang der 90er-Jahre gestellt, als die damaligen NAB-Verantwortlichen die Aktienmehrheit dieser einst kräftestrotzenden Regionalbank der Grossbank Credit Suisse vermittelt hatten. Nun war man auf Gedeih und Verderb von einem «Finanzplayer» abhängig, wo in der Chefetage Millionen-Saläre und noch höhere Boni den Kompass der Unternehmensführung mitbestimmen. Solche habgierigen Exzesse waren der alten NAB völlig fremd. Es ist nun aber müssig, heute darüber zu streiten, ob es 1994 solidere Lösungen für die Zukunft der leicht angeschlagenen NAB gegeben hätte. Ich weiss es auch nicht. Aber wer heute nun einfach die Hauptschuld der CS anzulasten versucht, macht es sich schlicht zu einfach! Schreibt der ehemalige Nationalrat Maximilian Reimann, Gipf-Oberfrick in seinem Leserbrief an das ZT.
Halleluja! Um 08.10 ist es mir doch noch gelungen, einen taufrischen Artikel mit dem Datum vom 31.8.2020 (08.03 Uhr) im Zofinger Tagblatt zu sichten. Irgendwann müsste irgendwer dem Zofinger Lokalblatt die uralte Internet-News-Weisheit übermitteln: «Der frühe Vogel frisst den Wurm.» Oder Gorbatschow zitieren: «Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.»
Nun denn, alt-Nationalrat Maximilian Reimann, dessen Sohn Lukas Reimann den Hardcore-Verein ANUS präsidiert, stellt eine Frage und gibt dennoch keine Antwort. Business as usual bei Politikern. Fairerweise sei festgehalten, dass Reimann immerhin und ehrlicherweise zugibt, dass er die Antwort schlicht und einfach nicht weiss, was für einen Politiker äusserst selten ist.
Vielleicht kann der Kanton Aargau Maximilian Reimann bei der Beantwortung seiner Frage etwas nachhelfen. Schrieb doch der Kanton Aargau in seiner Medienmitteilung zur Auflösung der Aargauer Traditionsbank: «Die NAB lieferte unter anderem mit ihrer Regionalstudie wertvolle Beiträge zur ökonomischen Entwicklung des Kantons Aargau», wie Regierungsrat Hofmann feststellte.
Tolle Sache diese Regionalstudie der NAB. Doch leider verdient man damit kein Geld. Und eine Bank, die kein Geld verdient, wird nicht nur von der CS entsorgt.
-
30.8.2020 - Tag des Niedriglohnsektors
Luzerner Tavolago AG entlässt dutzende Mitarbeiter
Gemäss einem internen Dokument, welches zentralplus vorliegt, hat die Tavolago AG rund zwei Dutzend Mitarbeitern die Kündigung ausgesprochen. Die Tavolago bestätigt die darin gemachten Angaben. Angestellte im Stundenlohn, die auf Abruf im Einsatz stehen, wurden informiert, dass sie wohl bis in den Sommer 2021 hinein nicht mit Arbeitseinsätzen rechnen dürfen.
Die Nachricht kam zwar nicht ohne Vorzeichen, dürfte aber für viele Betroffene trotzdem ein Schock sein. Die Tavolago AG, ein Tochterunternehmen der SGV Holding AG, hat in den letzten Tagen rund zwei Dutzend Kündigungen ausgesprochen. Dies ist einem internen Dokument zu entnehmen, das zentralplus vorliegt. Die Firma hat in der Folge dessen Authentizität bestätigt und eine offizielle Mitteilung verfasst.
Demnach rechnet das Unternehmen im aktuellen Jahr mit einem Umsatz von 13 bis 14 Millionen Franken. Das entspreche einer Differenz von rund 60 Prozent gegenüber dem Budget. Die Tavolago AG ist für die Gastronomie der gesamten SGV-Schiffsflotte zuständig ist und führt an Land mehrere Lokale. Der Umsatzrückgang bei der Gastronomie zu Land liege per Ende Jahr – je nach Betrieb – bei Minus 25 bis Minus 65 Prozent.
Stellenabbau betrifft alle Abteilungen
Der Stellenabbau betreffe alle Abteilungen, heisst es in der internen Nachricht weiter. Auch am Hauptsitz seien Anpassungen vorgenommen worden.
Die Hälfte der bisher ausgesprochgenen Kündigungen seien aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. Die andere Hälfte vorwiegend aus organisatorischen und strukturellen Gründen. Dies aufgrund von Umorganisationen in Betrieben, die zukünftig mit weniger Öffnungstagen oder mit kürzeren Öffnungszeiten operieren müssten, heisst es weiter.
Keine Einsätze bis Sommer 2021
Neben den ausgesprochenen Kündigungen, sind Mitarbeitende ohne garantiertes Pensum – also Stundenlöhner auf Abruf – informiert worden, dass wohl bis in den Sommer 2021 hinein mehrheitlich nicht zu Arbeitseinsätzen bei Tavolago aufgeboten werden.
Diese Massnahme betrifft mehere Dutzend Personen, die bei der Tavolago ein Arbeitsverhältnis haben, sagt Tavolago-Geschäftsführer Fredy Wagner auf Anfrage. Was das arbeitsrechtlich für sie heisst, bleibt vorerst unklar. Es handle sich dabei aber um Personen die oftmals nur Saisonal oder an vereinzelten Grossanlässen im Einsatz stehen.
«Wie lange die Krise anhalten und wie viel Kraft und Durchhaltevermögen uns noch abverlangt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussehbar», heisst es im Schreiben der Tavolago AG. Man werde heuer aber einen Verlust von mehreren Millionen Franken einfahren. Dieser sei nur dank der Zugehörigkeit zur SGV Gruppe aufzufangen. Schreibt ZentralPlus.
Jetzt mit dem Stinkefinger auf Tavolago zu zeigen, wäre genau so falsch wie es gegenüber dem Luzerner Uhren-Mogul Bucherer falsch war. Das Luzerner Gastrounternehmen (wie auch der Uhren-Hotspot von Bucherer) sind nun mal keine sozialen Institutionen, sondern nach wirtschaftlichen Regeln geführte Unternehmen.
Zu denken geben sollte uns allerdings die Tatsache, dass es sich bei den Entlassenen (in beiden Unternehmen) vorwiegend um Personen aus dem Niedriglohnsektor handelt, die in der nahen Zukunft wohl über eine längere Zeitdauer mit 80 Prozent des bisherigen Einkommens ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Das wird hart für die Betroffenen, denn 20 Prozent weniger von einem ohnehin schon niedrigen Einkommen sind eine Menge Holz. Miete und die gesamten Lebensunterhaltskosten sinken ja nicht um 20 Prozent.
Da wird wohl einiges auf die ohnehin gebeutelten Sozialämter von Stadt und Kanton Luzern zukommen. Man darf jetzt schon gespannt darauf warten, was wohl die Hardliner der neoliberalen Parteien von FDP, CVP und SVP dazu absondern werden.
-
29.8.2020 - Tag der fünf-Rappen-Schnäppchen
«Keine Corona-Ladenhüter»: Denner packt Preishammer aus – 200 Produkte billiger
Die Lebensmittelhändler gehörten zu den wenigen, die während des Lockdowns fleissig weiterverkaufen durften. Offenbar laufen die Geschäfte nun so gut, dass Preise gesenkt werden können – ohne dass Lieferanten dafür bluten müssen, sagt Denner.
Lange war es ruhig an der Preisfront. Jetzt aber purzeln die Rabatte im Laden. Interessant für Konsumenten: Es handelt sich nicht um Aktionen, sondern um Preisreduktionen auf Dauer.
BLICK hat erfahren, dass Denner über 200 Produkte verbilligt. Das entspricht 10 Prozent des gesamten Sortiments des Discounters. Ab 1. September stehen sowohl Marken- als auch Eigenmarkenprodukte günstiger im Regal. Sie kosten zum Teil bis zu 40 Prozent weniger als zuvor.
Preisbeispiele: Die Frühstücksflocken Kellogg's Choco Krispies gibts für 2.50 statt 2.75 Franken. Die Red-Bull-Dose kostet neu 2.15 Franken. Das sind fünf Rappen weniger als zuvor. Unter den 200 Produkten sind auch diverse Kosmetika der Marken Axe, Nivea und Head & Shoulders.
Lieferanten mussten nicht kleinbeigeben
Denner lässt sich nicht lumpen. «Es sind keine Corona-Ladenhüter», sagt Sprecher Thomas Kaderli. Die Preisnachlässe habe man auch nicht etwa bei den Lieferanten durchgeboxt. Möglich seien sie durch optimierte Abläufe und effizientere Logistik.
Oder vielleicht auch deshalb, weil der Discounter während des Lockdowns anständig verdient hat? Im Gegensatz zu Baumärkten oder anderen Gewerblern durften Denner, Coop, Migros und Co. ihre Supermärkte offen lassen. «Der Lebensmittel-Detailhandel kam vergleichsweise gut durch den Lockdown», lässt sich Denner entlocken, ohne näher auf die Umsätze einzugehen. Man sei seit Jahresbeginn jedenfalls im Plus. Schreibt Blick.
Das ist ja mal ein Ding. Die Red Bull-Dose fünf Rappen billiger! Und was kriege ich günstiger, der ich Red Bull verabscheue?
-
28.8.2020 - Tag der Fressorgien
Irischer EU-Kommissar Hogan nach Festessen zurückgetreten
Ausgerechnet das kleine Irland hat Ursula von der Leyen eine schwere Bewährungsprobe beschert. Am Dienstagnachmittag musste sich die EU-Kommissionspräsidentin mit den Details des Heimaturlaubs ihres Handelskommissars befassen, bei dem Phil Hogan vergangene Woche an einem hochkarätigen Dinner teilnahm. Weil die Veranstaltung gegen Corona-Regeln verstieß, befindet sich die Öffentlichkeit auf der Grünen Insel in heller Aufregung; die Regierung unter Premierminister Micheál Martin hatte ihren wichtigsten Mann in Brüssel bereits indirekt zum Rücktritt aufgefordert. Einen solchen lehnte Hogan erst ab, trat am Mittwochabend aber doch zurück. Landwirtschaftsminister Dara Calleary war zuvor bereits zurückgetreten, weil er dieselbe Veranstaltung besucht hatte.
Das seit Monaten geplante zweitägige Fest des parlamentarischen Golfklubs mit 81 hochrangigen Politikern, Journalisten und Richtern im westirischen Clifden (Bezirk Galway) kulminierte am vergangenen Mittwochabend mit einem mehrgängigen Menü und anschließender Tombola. Freilich erhielten köstliche Speisen und die gewonnenen Preise, etwa ein Grill für Kommissar Hogan, einen bitteren Beigeschmack, sobald irische Medien darauf hinwiesen: Die fröhliche Feier hatte eklatant gegen erst tags zuvor erlassene Verschärfungen der Corona-Regeln verstoßen. So dürfen sich vorerst bis Mitte September lediglich sechs Personen aus drei verschiedenen Haushalten im gleichen Raum aufhalten; Einreisende nach Irland müssen wieder in eine 14-tägige Quarantäne.
Haben Angehörige der politischen und gesellschaftlichen Elite des Landes geglaubt, für sie würden die Vorschriften nicht gelten? Dieser Eindruck hat einen Entrüstungssturm in der ohnehin stets misstrauischen und von Covid-19 heftig gebeutelten Bevölkerung hervorgerufen, von den Medien und Oppositionsführerin Mary Lou McDonald (Sinn Féin) angefacht. Zwei Minister traten eilig zurück, der Parlamentspräsident verfügte die Schließung des Golfklubs. Hogan aber wartete zunächst mit ausweichenden Erklärungen auf, rang sich erst am Sonntag zu einer umfassenden Entschuldigung durch – und lehnte den Rücktritt vorläufig ab, den ihm Taoiseach (Gälisch für Häuptling) Martin und dessen Stellvertreter Leo Varadkar "nahelegten".
Der Verlust des Handelskommissars ist ein schlimmer Schlag für die Grüne Insel, der in vier Monaten, nach Ablauf der Übergangsfrist, heftige Brexit-Turbulenzen bevorstehen. In Londoner Regierungsstuben wird die Schwächung des kleinen Nachbarn wohl begeistert aufgenommen.
Dass Kommissar Hogan, wie sich später herausstellte, auf dem Weg zum Golfdinner auch noch von der Verkehrspolizei beim Telefonieren mit dem Handy erwischt wurde, hatte seine Lage nicht gerade verbessert. Die Beamten beließen es bei einer Warnung und ließen den 60-Jährigen ohne Strafe davonkommen.
Für die wackelige Jamaika-Koalition kommt der Skandal jedenfalls denkbar ungelegen. Erst seit zwei Monaten im Amt, hat Regierungschef Martin bereits seinen zweiten Landwirtschaftsminister und zudem seinen Handelskommissar ein. Pikanterweise liegen sich die Koalitionspartner von Martins nationalliberaler Fianna Fáil und die konservativen Fine Gael unter dem vorherigen Premier Varadkar über das weitere Vorgehen in der Pandemie in den Haaren. Der Wirtschaftsminister (und gelernte Arzt) Varadkar hatte öffentlich Zweifel an der deutlichen Verschärfung der Regeln geäußert. Umstritten ist auch, wie die Republik das entstandene Covid-19-Loch im Staatssäckel stopfen soll. Dabei lechzt das Land nach staatlichen Investitionen, nicht zuletzt im verlotterten Gesundheitssystem, das im Frühjahr der Corona-Pandemie nur knapp standhielt. Schreibt DER STANDARD.
«Ficken, fressen, saufen.» In dieser Reihenfolge benannte der deutsche Politiker Oskar Lafontaine vor vielen Jahren als Parteipräsident der deutschen SP die Prioritäten für seine Lebensgestaltung. Es scheint, als ob der gute Oskar einige Nachahmer gefunden hat.
-
27.8.2020 - Tag der Hyperventilation
Sneaker-Fans stehen seit Stunden Schlange für Federer-Sneaker
Federer- und On-Fans haben darauf gewartet: Seit heute Donnerstag gibt es den erste Schuh von Roger Federer in der Schweiz im Laden zu kaufen. 20 Minuten berichtet vor Ort, wenn Jelmoli um 7.00 Uhr das Warenhaus in Zürich öffnet. So steht es geschrieben im «Live-Ticker» von 20Minuten.
Geht's uns schlecht?
-
25.8.2020 - Tag der SVP-Plakate
Hat die SVP Martullos Allerwertesten auf's Plakat projiziert?
Blochers Ururgrossvater Johann Georg Blocher (1811–1899) war als Armenlehrer aus dem grenznahen Ort Beuggen in Baden eingewandert und 1861 im Kanton Bern eingebürgert worden. So steht's geschrieben bei Wiki. Christoph Blocher ist also nichts anderes als ein Abkömmling einer Einwandererfamilie. By the way frage ich mich nun, ob es sich bei dem etwas voluminösen Hinterteil, das sich auf dem SVP-Plakat über die ganze Schweiz breitmacht, gar um Martullos Allerwertesten handelt? So steht's geschrieben auf Facebook.
Nicht schlecht beobachtet von diesem Facebook-User. Die Proportionen des gewaltigen Hinterteils lassen zumindest den Verdacht aufkeimen, dass Martullo mit ihrem Allerwertesten für dieses künstlerisch ansprechende SVP-Plakat als Model fungiert hat. Im Zusammenhang mit Martullos Backside passt denn auch der Plakatslogan wie die Faust auf's Auge: Zu viel ist zu viel.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
24.8.2020 - Koma-Tag
Nordkoreas Diktator Kim Jong Un soll im Koma liegen
Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (36) befinde sich «im Koma», während Machtbefugnisse an seine Schwester übergeben würden. Das behauptet ein südkoreanischer Diplomat. Im Land drohe ein gefährliches Machtvakuum.
Laut Chang Song Min (56), einem ehemaligen Berater von Südkoreas verstorbenem Präsidenten Kim Dae Jung (1924-2009), befinde sich Nordkoreas paranoider Führer Kim Jong Un in einem komatösen Zustand. Dies, nachdem er eben noch weitere Machtbefugnisse an seine Schwester übertragen habe. Nord- und auch südkoreanische Regierungskreise schwiegen zunächst zu den Berichten.
Ein Machtvakuum, so der Diplomat, «könnte eine Katastrophe für das Land bedeuten», zitiert ihn die britische «Daily Mirror». Kim hatte Berichten zufolge vor einigen Tagen Befugnisse an seine jüngere Schwester, Propagandachefin Kim Yo Jong (32), übergeben. Der Bruder ist weiterhin Staats- und Regierungschef. Eine weibliche Dynastin wäre erstmalig in der nordkoreanischen Machtfolge, die von Kims Grossvater Kim Il Sung (1912-1994) begründet worden war.
Südkoreanische Medien zitieren den Diplomaten Chang mit den Worten, dass Kim seiner Einschätzung nach im Koma liege, aber sein Leben sei noch nicht zu Ende. Die Machtübergabe sei keinesfalls geregelt: «Eine vollständige Nachfolgestruktur hat sich nicht herausgebildet, so dass Kim Yo Jong in den Vordergrund gerückt wird, da das Vakuum nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann.»
Ähnliche Berichte bereits im Frühjahr
Bereits vor ein paar Tagen waren Berichte durchgesickert, wonach Kim einige Befugnisse an seine Schwester übertragen habe und aber weiterhin «absolute Macht ausübt». Er werde Autorität jedoch nach und nach auf Kim Yo Jong übertragen, «um Stress abzubauen». Der jüngeren Schwester vertraut Kim seit Jahren. Sie ist oft an seiner Seite zu sehen und sorgt dafür, dass ihr Bruder die richtigen Worte wählt und im richtigen Licht erscheint.
So ist die Schwester, die inzwischen defacto zu seiner Stellvertreterin ernannt worden sei, neu für die Verhandlungen mit Südkorea und den USA verantwortlich - etwas, das Kim bislang als seine Aufgabe erachtete, indem er US-Präsident Donald Trump (74) und Südkoreas Präsident Moon Jae In (67) persönlich traf.
Bereits dieses Frühjahr hatten Spekulationen um Kims Gesundheitszustand für Schlagzeilen gesorgt. Infolge Übergewicht und sonstigen, auch durch Alkohol und Kettenrauchen verursachten Gesundheitsproblemen habe sein Herz versagt. Eine spontane Notoperation sei misslungen, er befinde sich in vegetativem Zustand. Schreibt Blick.
Kims Koma als Running Gag: Totgesagte leben bekanntlich länger.
-
22.8.2020 - Tag der Unverbesserlichen
«Aber, äääh»: Darum fehlen Martullo-Blocher in der EU-Arena plötzlich die Worte
Die Personenfreizügigkeit eliminieren will die SVP mit ihrer Begrenzungsinitiative. Bringt uns Zuwanderung aus Europa Wohlstand oder Elend? In der «Abstimmungs-Arena» kreuzen erstmals Bundesrätin Karin Keller-Sutter und die Tochter von Christoph Blocher die Klingen.
Der SVP droht ein Abstimmungs-Fiasko: Satte 61 Prozent lehnen die Begrenzungsinitiative laut einer ersten GFS-Umfrage ab. Mit der Vorlage wollen Blocher und Konsorten die Personenfreizügigkeit mit der EU am 27. September ein für allemal bodigen. Und setzen damit die bilateralen Verträge aufs Spiel.
Mit der «Arena» startet die heisse Phase des Abstimmungskampfs so richtig. Denn erstmals kreuzen FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter und SVP-Aushängeschild Magdalena Martullo-Blocher die Klingen.
Die 51-jährige Chefin der EMS-Chemie zeigt sich gewohnt hemdsärmlig, angriffslustig, fällt den Gegnern immer wieder ins Wort. Und scheut nicht davor zurück, ihre eigene Familie für den Abstimmungskampf ins Spiel zu bringen. Die Schweiz sei wegen der Personenfreizügigkeit aus der EU für Frauen unsicherer geworden. «Ich sage meiner Tochter, sie soll nicht mehr alleine an den Zürcher Seepromenade gehen. Selbst wenn es hell ist», sagt die Tochter von Christoph Blocher.
Doch sie hat die Rechnung ohne Moderator Sandro Brotz gemacht. Dieser haut ihr im 1:1-Interview die eigene, von Briten verfasste SVP-Studie zur Personenfreizügigkeit um die Ohren. «Darin steht, dass die Einwanderer aus den wichtigsten Herkunftsländern gar nicht krimineller als die Schweizer sind», so Brotz. Dann passiert, was fast nie vorkommt. «Aber, äääääh. Ich weiss nicht welche Studie sie meinen». Martullo-Blocher sagt ein paar Augenblicke gar nichts mehr.
Umso mehr in Fahrt kommt ihre Gegenspielerin, Justizminsterin Karin Keller-Sutter. Als Martullo-Blocher kolportiert, die EU werde die bilateralen Verträge bei einem Ja zur Initiative schon nicht kündigen, gibt Keller-Sutter Gas. Erstens sei die Guillotine-Klausel in den Verträgen festgeschrieben. Weiter seien neue Verhandlungen nicht realistisch, das habe die Geschichte mit der Masseneinwanderungsinitiative gezeigt. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Jetzt mal Hand aufs Herz: Wer schaut denn noch die «Arena»? Nur Unverbesserliche, die Talkrunden mögen, in denen sich die üblichen Verdächtigen nonstop gegenseitig ins Wort fallen und das Parteiprogramm vor sich hin plappern.
-
21.8.2020 - Tag der Alterskontrolle
Der minderjährige Flüchtling Hussain wurde als volljährig eingeschätzt – mit verheerenden Folgen
Als minderjähriger Asylsuchender kam Hussain 2018 in die Schweiz. Erst jetzt wird er auch so behandelt – mit Folgen.
«Wie alt sind Sie?» Es ist eine simple Frage, die ihm die Migrationsbehörden im August 2018 stellten. Doch für das Leben von Hussain* ist sie folgenschwer.
Als der junge Afghane die Frage beantworten muss, ist er 15 Jahre alt. Er reiste allein in die Schweiz ein, wurde im Bundesasylzentrum in Basel untergebracht. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) befragte ihn zu seinen Fluchtgründen, seiner Identität und eben seinem Alter. Hussain gab sein Geburtsdatum an, beweisen konnte er es aber nicht: Seinen afghanischen Personalausweis – die Tazkera – liess er bei Schwester und Tante im Iran zurück. Ein Handyfoto davon reichte den Behörden nicht, es sei kein «fälschungssicheres Dokument».
«Wir werden Ihr Geburtsdatum auf den 01.01.2000 datieren», lautete der Beschluss im Gesprächsprotokoll, das dieser Zeitung vorliegt. Bis der junge Afghane ein offizielles Dokument vorlegen könne, gelte er für das Asylverfahren als volljährig.
Einsame Flucht nach Europa
Hussain ist Waise, seine Eltern verunfallten, als er acht oder neun Jahre alt war. Danach lebte er mit seiner Schwester bei einem Onkel. Dieser habe ihn wie einen Diener behandelt, sagt Hussain. Als der Onkel die jüngere Schwester mit einem Cousin verheiratet hatte, gingen die Geschwister zusammen in den Iran. Doch auch dort sah Hussain keine Zukunft für sich. «Wenn ich geblieben wäre, hätten sie mich nach Syrien geschickt.»
Als unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender hätte Hussain in der Schweiz Anspruch auf Hilfe gehabt. Eine Vertrauensperson, einen Beistand, Deutschkurse, Schulförderung, eine altersgerechte Unterkunft. Hussain wurde aber von Beginn weg als Erwachsener behandelt. Das führte dazu, dass er von Asylunterkunft zu Asylunterkunft geschoben wurde, mit erwachsenen Männern das Zimmer teilen musste und keine Schulbildung erhielt. Der junge Afghane entwickelte schwere psychische Problemen: Im Dezember 2018 versuchte er, sich mit einer Tablettenüberdosis das Leben zu nehmen. In der Klinik seien sich die Psychiater einig gewesen, dass Hussain als Jugendlicher behandelt werden sollte, sagt Hussains Anwalt Guido Ehrler. Im November 2019 zog er den Fall vor das Bundesverwaltungsgericht.
Ehrler wusste nicht, was zu erwarten war. «Die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist uneinheitlich», sagt der Basler Anwalt. Je nach Richter oder Richterin würde ein anderes Urteil gefällt. Für Hussain fiel es positiv aus: Das Gericht urteilte, das SEM müsse beweisen, dass das im Zentralen Migrationsinformationssystem eingetragene Geburtsdatum wahrscheinlicher als die Angaben des Jugendlichen sei. Das Amt habe überdies die Begründungspflicht verletzt. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Sache zur Neubeurteilung ans SEM zurückgewiesen.
Im Juni 2020 erhielt Hussain die erlösende Nachricht: «In Gesamtwürdigung der Aktenlage, mithin in Abwägung der Kriterien, die für und gegen die Minderjährigkeit Ihres Mandanten sprechen, sowie mit Blick auf die Prozessökonomie und die lange Verfahrensdauer, verzichtet das SEM auf die Durchführung eines Altersgutachtens und geht bei der weiteren Behandlung des Asylgesuchs ihres Mandanten von seinem gegenüber den Asylbehörden angegebenen Geburtsdatum aus.» Hussain ist nun offiziell minderjährig.
Der Fall von Hussain sei exemplarisch, sagt Ehrler. Er vertrat schon etliche Mandanten in ähnlichen Situationen. Einer seiner Fälle sei derzeit beim UN-Kinderrechtsausschuss hängig. «Natürlich gibt es Asylsuchende, die sich bei den Befragungen jünger machen, um einer Dublin-Abschiebung zu entgehen. Es gibt aber auch solche, die machen sich älter, weil sie befürchten, als Jugendliche nicht ernst genommen zu werden.» Gleichzeitig gebe es aber auch Fehlentscheide der Behörde, wie im Fall Hussain. Darum, sagt Ehrler, sollte ein Asylsuchender im Zweifelsfall als Minderjähriger behandelt werden. «Alles andere verletzt die Rechte dieses Menschen.»
Kanton will Hussain nicht einschulen
Zwei Jahre hat Hussain verpasst. Seit Sommer 2019 besucht er das Brückenangebot Integration an der Kantonalen Schule für Berufsbildung im Kanton Aargau. Er ist Klassenbester. Der Unterricht unterfordert den heute 17-Jährigen oftmals. Sein Wunsch: «Ich möchte einen normalen Sekundarschulabschluss machen und Pflegefachmann werden.» Das Aargauer Bildungsdepartement will ihn aber nicht einschulen. Nach dem vollendeten 16.Lebensjahr sei ein Eintritt in die Volksschule nicht mehr möglich, darum gebe es die Brückenangebote, teilt das Bildungsdepartement auf Anfrage mit. Ehrler sagt: «Hussain ist sehr bildungsfähig und er wünscht sich nichts sehnlicher als einen Schulabschluss.» Seiner Ansicht nach müsste das SEM nun Wiedergutmachung leisten und dem Jugendlichen den Schulbesuch ermöglichen. Ehrler: «Ihm läuft die Zeit davon.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Natürlich geht einem diese Geschichte ans Herz. Doch so sehr sie auf die Tränendrüsen drückt, verschweigt sie elementarste Fakten.
Jede, aber auch wirklich beinahe jede Flucht nach Europa beginnt getreu den Weisungen aus den Handbüchern auf den social Medias und den von Mund zu Mund weiterverbreiteten Erfahrungen und Survive-Strategien auf dem langen Weg ins gelobte Land mit gewissen Lügen.
Dazu gehört in erster Linie, den Pass entweder zu vernichten oder irgendwo dermassen gut zu verstecken, dass ihn niemand finden kann. Sei es, um das Alter entsprechend vorteilhaft zu korrigieren oder mit einem falschen Namen Nachforschungen im Herkunftsland zu verunmöglichen. Was in Anbetracht der Infrastrukturen in diesen Ländern meistens so oder so eine Mission impossible ist.
Dass im einen oder andern Fall unter diesen Umständen von den Schweizer Asylbehörden auch Fehlurteile gefällt werden, liegt auf der Hand.
Ein Flüchtling aus dem Nahen Osten erklärte mir kürzlich beim Betteln um eine Zigarette die drei wichtigsten Punkte für eine Flucht nach Europa: 1. Ein modernes Hightech-Handy, 2. totale Vernetzung mit den social Medias, anderen Flüchtlingen, die ebenfalls auf dem langen Marsch sind sowie ständiger Kontakt mit den Connections im Zielland und last but not least 3. Pass vernichten, um gewisse Korrekturen bezüglich Alter und Namen vornehmen zu können und – ebenfalls wichtig – eine allfällige Abschiebung nach dem Schengen-Abkommen in ein Transitland zu verhindern.
Er erzählte dies mit einem gewissen Stolz, der den Arabern zu eigen ist und mir schien eine leichte Häme durchzusickern, wie einfach doch unsere Asylgesetze- und Vorschriften zu knacken sind. Vielleicht irre ich mich und der Megajoint, der wohl jeden Beduinen vom Kamel geworfen hätte, machte ihn zusammen mit dem konsumierten Alkohol etwas geschwätzig.
Zur Ehre aller Flüchtlinge sei gesagt: Ich würde an ihrer Stelle genau das Gleiche tun! Damit meine ich aber nicht Joint und Alkohol.
-
20.8.2020 - Tag der Gier im Casino
Dax-Aufsteiger Delivery Hero: Der sanfte Ausbeuter
Der Lieferdienst Delivery Hero löst Wirecard im Dax ab. Das Start-up gibt sich hip und modern - kämpft aber erbittert um Marktanteile. Vor allem Fahrer fühlen sich ausgenutzt.
Niklas Östberg ist nicht so grell wie viele Start-up-Gründer. Der 40-Jährige wirkt meist ruhig und besonnen, geht in seiner Freizeit mit seinen Kindern angeln, er hat diesen charmanten schwedischen Akzent, wenn er Interviewern auf Podien seine Geschäftsvision erklärt.
Das Logo seiner Firma Delivery Hero ist ein rot-gelber, stets freundlich dreinschauender Superheld. In ihrer Zentrale, einem alten Berliner Fernmeldeamt, arbeiten überwiegend junge Leute, die sich überwiegend auf Englisch unterhalten.
Klingt nach einem sympathischen Start-up - und nach einem netten Chef dazu. Tatsächlich muss sich das Unternehmen von Niklas Östberg in einem der weltweit wohl am stärksten umkämpften Märkte der Welt behaupten. Und tatsächlich halten viele das Geschäftsmodell von Delivery Hero für Ausbeutung.
So oder so wird dem Unternehmen nun eine der größten Ehren der deutschen Wirtschaft zuteil: Es steigt am kommenden Montag in den Dax auf, die Entscheidung fiel am Mittwochabend, dann verkündete die Börse in Frankfurt am Main den Ausschluss des insolventen Münchner Zahlungsdienstleisters Wirecard aus dem deutschen Leitindex. Nachrücken wird Delivery Hero, derzeit gelistet im M-Dax.
Für Östberg und seine Firma bedeutet dieser Aufstieg nicht nur Prestige. Er hat auch handfeste ökonomische Vorteile. Indexfonds, sogenannte ETF, bilden Börsenindizes exakt nach. Dax-ETFs müssen also Aktien von Delivery Hero kaufen. Der Kurs des noch recht jungen Unternehmens dürfte steigen. Stärker noch als er es ohnehin schon tut.
Die Rekordeinnahmen erzählen nur die halbe Geschichte
Östbergs aggressiver Wachstumskurs spiegelt sich in zunächst beeindruckenden Zahlen wider. Im zweiten Quartal verzeichnete Delivery Hero 281 Millionen Buchungen auf seinen Plattformen, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Der Jahresumsatz könnte sich 2020 sogar mehr als verdoppeln: auf bis zu 2,8 Milliarden Euro.
Doch die Rekordeinnahmen erzählen nur die halbe Geschichte. In der Branche der Lieferdienste tobt ein heftiger Verdrängungskampf. Am Ende dürften nur eine Handvoll Unternehmen übrig bleiben, die den Weltmarkt für Essenslieferungen unter sich aufteilen.
Delivery Hero will eines dieser Unternehmen sein. Entsprechend stark geht Östbergs Firma ins Risiko, dringt mit hohen Investitionen in neue Märkte, wirbt kostspielig um neue Kunden.
Und entsprechend groß sind die Verluste von Delivery Hero: 2018 waren es minus 242 Millionen Euro, 2019 sogar minus 648 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2020 fielen laut Analystenschätzungen 352 Millionen Euro Verlust an. Ursprünglich wollte Delivery Hero schon 2018 operativ schwarze Zahlen schreiben.
Dem Erfolg an der Börse schadet das nicht: Seit Jahresbeginn legte die Aktie um 47 Prozent auf rund 104 Euro zu. Delivery Hero wird inzwischen mit 20,7 Milliarden Euro bewertet. Schon jetzt ist die Firma mehr wert als die Deutsche Bank. Investoren scheinen an Östbergs Wachstumsstory, an seine Heldenreise, zu glauben. Obwohl es durchaus Warnungen vor der Firma gibt.
Arbeitnehmervertreter sehen Delivery Hero ebenfalls kritisch. Denn die Firma behandelt ihre Fahrer rechtlich oft als Selbstständige, zahlt ihnen statt gearbeiteter Stunden nur erledigte Fahrten. Die Löhne sind entsprechend überschaubar.
In Kanada wollten Fahrer von Foodora, einer Tochter von Delivery Hero, deshalb eine Gewerkschaft gründen. Foodora warnte sie, das Verhältnis zum Unternehmen nicht "durch Dritte" zu verkomplizieren. Die Firma drohte, der Gewerkschaftsbeitrag könne die Fahrer "bis zu 1100 Dollar" pro Jahr kosten. Vor der nationalen Behörde für Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehungen argumentierte der Lieferdienst, die Fahrer verfügten nicht über die nötigen rechtlichen Voraussetzungen für die Gründung einer Gewerkschaft. Schreibt DER SPIEGEL.
Schon erstaunlich, welche Klitschen es in den deutschen Dax-Aktienindex schaffen. Nach dem Finanzdienstleister WIRECARD, der zur Zeit die Insolvenzphase durchläuft und am 24. August 2020 aus dem DAX fliegt, folgt nun Delivery Hero.
WIRECARD war vom ersten Tag an auf Betrug und halbseidene Geschäftsaktivitäten aufgebaut. Das hinderte die institutionellen Anleger (darunter auch Schweizer Pensionskassen) nicht, trotz eindringlichen Warnungen und seriösen Hinweisen der FT auf die kriminellen Machenschaften, die Aktien der Schwindelfirma ins Portefeuille zu übernehmen.
Das Geschäftsmodell des nun in den DAX aufsteigenden Unternehmens Delivery Hero basiert auf einer Start-Up-Idee, die zwar rechtlich legal ist, dafür moralisch umso verwerflicher. Die Ausbeutung von Menschen im Niedriglohnsektor (zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben) als Geschäftsmodell wird jedoch die Anleger an der Börse kaum daran hindern, vor Gier triefend die Aktien der Ausbeuterfirma wie wild zu ordern.
-
19.8.2020 - Tag der legalen Staatsplünderung
Trotz Pleiten, Pech und Pannen: BAG will Mitarbeitern Corona-Bonus zahlen
Das Bundesamt für Gesundheit prüft, seinen Mitarbeitern wegen der Corona-Pandemie höhere Leistungsprämien zu bezahlen. Auch in einzelnen Kantonen können sich Staatsangestellte auf einen Krisen-Zustupf freuen.
Kurzarbeit, Jobverlust, weniger Einkommen: Die Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise – und mit ihr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ganz anders sieht es derweil für manch einen Angestellten von Bund und Kantonen aus. Wie die «NZZ» berichtet, winken ihnen wegen der Pandemie teilweise beachtliche Boni.
In den Genuss einer Corona-Prämie könnten zum Beispiel die Beamten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kommen – ausgerechnet jenes Amtes, das in den vergangenen Wochen mit diversen Pannen für Negativschlagzeilen sorgte. Das BAG klärt derzeit ab, ob die Mittel für ausserordentliche Leistungsprämien erhöht werden. Und, ob die Obergrenze für die an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbezahlten Prämien heraufgesetzt werden.
Nach geltender Regelung können die Angestellten des Bundes für «überdurchschnittliche Leistungen» und «besondere Einsätze» Prämien in der Höhe von bis zu zehn Prozent ihres Jahreslohns bekommen. Ausbezahlt werden die Boni jeweils auf Ende Jahr.
BAG-Beamte hatten extrem viel zu tun
Grund für die Diskussion über eine Erhöhung der Zustüpfe ist, dass die BAG-Mitarbeiter in der Krise unter grossem Druck standen und die Arbeitsbelastung sehr hoch war. Viele Angestellte des Amtes arbeiteten in den vergangenen Monaten praktisch durch.
Allerdings: Die Überstunden können sie kompensieren oder werden allenfalls ausbezahlt. Auch in anderen Bundesstellen war die Arbeitsbelastung zudem hoch – mehr Geld als sonst gibts für sie aber nicht. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), die Eidgenössische Zollverwaltung und das Staatssekretariat für Migration (SEM) beispielsweise teilen auf Nachfrage der «NZZ» mit, dass keine besonderen Corona-Prämien vorgesehen seien.
Bis 5000 Franken im Kanton Bern
Auch die meisten Kantone verzichten ganz bewusst darauf, in der Krise mehr Geld für Boni auszugeben. Ausnahmen sind zum Beispiel die Kantone Bern und St. Gallen. In Letzterem hat die Regierung das Budget für ausserordentliche Leistungsprämien von 700'000 auf 2,1 Millionen Franken aufgestockt, um besonders stark geforderte Mitarbeiter zu honorieren. Profitieren sollen unter anderem Mitarbeiter des kantonsärztlichen Dienstes oder des Amts für Wirtschaft und Arbeit.
In Bern kommen die Angestellten der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion in den Genuss eines Corona-Zustupfs. In einem vertraulichen Entscheid hat der Regierungsrat beschlossen, dass das Budget für Leistungsprämien dieses Jahr überschritten werden darf. Um wie viel, sagt der Kanton nicht. Den Kantonsangestellten winken maximal 5000 Franken Corona-Bonus. Schreibt Blick.
Ein Sprichwort sagt: «Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus». So ist es. Im Parlament wie auch bei den Bundesbehörden. Wenn es darum geht, den Staat zu plündern, fallen alle Hemmungen. Bei allen.
Für das Pflegepersonal hingegen reichte es nur noch für den Applaus vom Balkon und salbungsvolle Worte.
-
18.8.2020 - Tag der Ehe für alle
Weil sie dem Bund nicht trauen: Ständeräte bremsen «Ehe für alle»
Es war ein Jubeltag für Lesben und Schwule: Am 11. Juni hat sich der Nationalrat überraschend deutlich für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen – und für die Legalisierung der Samenspende für Lesben. Nach über sechs Jahren parlamentarischer Debatten war der Entscheid für die Befürworterinnen und Befürworter ein gesellschaftspolitischer Meilenstein.
Auch in der Bevölkerung ist die Zustimmung zur Heirat von gleichgeschlechtlichen Paaren inzwischen gross. Dennoch ist die «Ehe für alle» noch nicht besiegelt. Wie bei der Ehe braucht es auch im Parlament zwei, die Ja sagen: nach dem National- muss auch der Ständerat einwilligen.
Und Letzterer ziert sich. Die Rechtskommission des Ständerats zweifelt daran, dass der Beschluss der Grossen Kammer rechtlich in Ordnung ist. Lässt sich die «Ehe für alle» wirklich mit einer Gesetzesänderung einführen – oder muss dafür nicht die Verfassung geändert werden?
Ständeräte trauen Juristen des Bundes nicht
Die Ständeräte wollen zu dieser Frage jetzt noch Experten anhören. Das hat die Kommission vergangene Woche beschlossen – zur Überraschung manch eines Nationalrats. Denn die Grosse Kammer hat diesen Punkt längst geklärt. Bereits vor vier Jahren hat das Bundesamt für Justiz (BJ) im Auftrag der Nationalratskommission ein Gutachten erstellt. Die Rechtsexperten des Bundes kommen zum Schluss: Um die «Ehe für alle» einzuführen, ist eine Verfassungsänderung unnötig. Auch der Bundesrat teilt diese Sicht.
Ist das juristische Argument bloss vorgeschoben? Schliesslich steht die ständerätliche Rechtskommission unter der Leitung des als besonders konservativ geltenden Walliser CVP-Ständerats Beat Rieder (57). Er begründet das Vorgehen seiner Kommission damit, dass es inzwischen externe Gutachten von Verfassungsrechtlern geben würde, die zu einem anderen Schluss kämen als das BJ.
«Das Geschäft verdient eine profunde Abklärung, da es gesellschaftspolitisch wichtige Themen betrifft», lässt sich Rechtsanwalt Rieder zitieren. Damit lässt er durchblicken, dass der Nationalrat aus seiner Sicht die Sache nicht genügend vertieft geprüft hat.
«Das ist ein Affront»
Im Nationalrat kommt das Vorgehen der Kollegen im Stöckli nicht gut an. «Der Entscheid der Rechtskommission des Ständerats ist ein Affront gegenüber der Schwesterkommission», sagt GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy (41), die zuvorderst für die Öffnung der Ehe kämpft. Man habe die Frage «seriös und umfassend abgeklärt», «was die Ständeräte auch in den Berichten und Gutachten nachlesen können». Bertschy stellt fest: «Ein Stück kommt hier wieder die Abgehobenheit zum Ausdruck, die sich im Ständerat immer mal wieder zeigt.»
Auch Parteikollege Beat Flach (55), Mitglied der nationalrätlichen Rechtskommission, kann den Entscheid des Ständerats nur bedingt nachvollziehen: «Wenn man schon seit sechs Jahren über das Thema diskutiert, kann man uns nicht vorwerfen, einen Schnellschuss gemacht zu haben.» Es gebe viele gute Gründe dafür, nur das Gesetz, nicht aber die Verfassung zu ändern, sagt der Jurist.
Schliesslich kann auch bei einer Gesetzesänderung das Referendum ergriffen werden. Im Gegensatz zu einer Verfassungsänderung ist dann zwar nur ein Volks- und kein Ständemehr nötig. Doch aus Sicht von Flach gibt es bei der «Ehe für alle» auch keinen Grund, weshalb die Kantone ein besonderes Gewicht haben sollten. «Kleine Kantone sind von der Vorlage nicht besonders betroffen und ich bin sicher, die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung sagt heute Ja zur ‹Ehe für alle›.»
Am Schluss entscheidet wohl das Volk
Der Ständerat dürfte wegen der zusätzlichen Abklärungen nun erst im Dezember über die «Ehe für alle» und die Samenspende für Lesben entscheiden. Sollten bei den Anhörungen weitere Fragen auftauchen, könnte sich der Ständeratsentscheid sogar noch weiter verzögern.
Abgeschlossen wird die Debatte aber auch dann noch nicht sein. Denn unabhängig von der Diskussion um Gesetz oder Verfassung: Der Plan des Nationalrats, gleich auch die Samenspende für Lesben zu erlauben, hat im konservativeren Ständerat einen sehr schweren Stand. Eine Volksabstimmung zur «Ehe für alle» – egal ob mit Samenspende oder ohne – gilt zudem schon jetzt praktisch als sicher. Schreibt Blick.
Eigenartig: Ausgerechnet der ledige Luzerner Ständerat Damian Müller, selbsternannter FDP-Experte für den Vaterschaftsurlaub, hat sich zu diesem Regenbogenthema bisher noch nicht gemeldet. Ist ihm die Tinte ausgegangen?
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
17.8.2020 - Tag der Senilität
Kommts zum Comeback nach 30 Jahren?: Alt-Nationalrat Luzi Stamm will Badener Stadtrat werden
Für die SVP sass er Jahrzehnte im Nationalrat. Jetzt überrascht Luzi Stamm (67) mit einem Comeback-Versuch. Der Alt-Nationalrat will in die Regierung von Baden AG.
Schon einmal, vor dreissig Jahren, schaffte Stamm die Wahl in den Stadtrat. Die SVP Baden unterstütze ihn aber nicht, schreibt die «Schweiz am Wochenende». Stamm tritt für ein Komitee an.
Die Stadtratsersatzwahl findet am 27. September statt. Grund: Die parteilose Sandra Kohler war Anfang Jahr zurückgetreten.
«Komitee B. Jäger»
Nicht nur seine Kandidatur überrascht. Auch für wen Stamm antritt: das «Komitee B. Jäger». Wer dahinter steckt, wissen auch seine Konkurrenten nicht. Stamm selbst war gestern offenbar nicht erreichbar.
Daniel Glanzmann, Fraktionspräsident der SVP Baden, betont gegenüber der Zeitung: «Es handelt sich um eine private Kandidatur. Die SVP Baden unterstützt offiziell Stefan Jaecklin von der FDP.»
Wie gross die Chancen Stamms sind, ist schwer abzuschätzen. Er ist immerhin noch sehr bekannt in Baden.
Luzi Stamm machte letztes Jahr mit der Falschgeld- und Kokskauf-Affäre Schlagzeilen. Schreibt Blick.
Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt, sagte Napoleon Bonaparte. Wie wahr!
-
16.8.2020 - Tag der Väter
Philippe Pfister vom Zofinger Tagblatt zum Vaterschaftsurlaub
Am 27. September stimmen wir auch über den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ab; die Vorlage wird im Getöse um die Begrenzungsinitiative wohl etwas untergehen. Bei der kantonalen FDP stehen sich in dieser Frage offenbar zwei exakt gleich grosse Lager gegenüber. Die Partei hatte jedenfalls ihre liebe Mühe damit, eine Parole zu fassen.
Während Nationalrat Matthias Jauslin mit einem Ja ein Zeichen setzen will, hält die Zofinger Grossrätin Sabina Freiermuth dagegen, auf dem Hintergrund von Corona könne sich die Schweiz ein Zeichen, das 230 Millionen Franken im Jahr kostet, gar nicht leisten. Erst kam ein superknappes Ja zustande, dann, nach der Intervention eines Delegierten, ein superknappes Nein. Mit dem Vorschlag des Präsidenten, Stimmfreigabe zu beschliessen, konnten schliesslich alle leben.
Auch am FDP-Parteitag wurde gegen den Vaterschaftsurlaub wieder zu Felde geführt, dieser werde vor allem Klein- und Kleinstbetriebe schädigen, weil diese grosse Mühe hätten, die Ausfälle zu verkraften. Tatsächlich? Klar: Kleine Unternehmen stecken es nicht einfach so weg, wenn ein Kollege zwei Wochen fehlt. Aber nehmen sie dadurch tatsächlich ernsthaft Schaden? Gerade im Lockdown haben unzählige Kleinbetriebe bewiesen, zu welcher Flexibilität sie fähig sind – sie werden auch lernen, mit einem zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub umzugehen, und zwar schnell. Die heutige Lösung – bei der Geburt eines Babys gibts für den Papa einen Freitag – ist, pardon, hinterwäldlerisch. Wir dürfen uns ruhig davon verabschieden. Vor allem jene, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf ihre Fahnen geschrieben haben. Schreibt Chefredaktor Philippe Pfister vom Zofinger Tagblatt in seiner Kolumne zum Wochenende.
Perfekter Beitrag von Philippe Pfister. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ausser, dass vielleicht irgendwer Pfisters Gedanken an den Luzerner Hardcore-Ständerat und freisinnigen Pöstchenjäger Damian Müller von der FDP weiterleiten sollte. Der Ledige von Hitzkirch, der vom Vatersein keine Ahnung hat, kämpft nämlich mit aller Vehemenz und seiner geballten intellektuellen Ödnis gegen den Vaterschaftsurlaub.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
15.8.2020 - Tag des belgischen Roulettes
Für Genf gilt nur noch Warnstufe Orange: Jetzt auch Zürich, Basel und Luzern: Belgien warnt vor Reisen in neun Kantone
Belgien streicht den Kanton Genf von seiner Reiseverbotsliste. Doch neu gilt für neun Kantone Warnstufe Orange – darunter nun auch Zürich, Basel oder Luzern.
Belgien schiebt die Schweizer Kantone auf seiner Corona-Risikoliste hin und her. Grundsätzlich gilt für Reisen in die Schweiz grünes Licht, doch seit Freitag stehen neu neun Kantone auf der Corona-Risikoliste.
Für alle gilt Warnstufe Orange: Basel-Stadt, Genf, Glarus, Luzern, Waadt, Schaffhausen, Schwyz, Zug und Zürich. Sie alle figurieren auf der entsprechenden Liste des belgischen Aussenministeriums. Für die neun Kantone gilt «erhöhte Wachsamkeit» – eine Quarantäne oder ein Corona-Test werden bei der Rückkehr empfohlen, sind aber nicht obligatorisch.
Mit Zürich trifft es nun auch den bevölkerungsreichsten Kanton und seine Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (43). Doch die SVP-Regierungsrätin lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. So erklärt ihr Sprecher Marcel Odermatt gegenüber BLICK: «Belgien hat nach seinen epidemiologischen Kriterien entschieden, die es zu akzeptieren gilt.»
Genf und Graubünden zurückgestuft
Zu den «Gewinnern» der neusten Entwicklung gehört der Kanton Genf. Letzte Woche galt für den Kanton noch Alarmstufe Rot – Reisen war untersagt, Rückkehrer mussten zwingend in Quarantäne. Jetzt wurde Genf von der roten Liste gestrichen und auf die orange Liste gesetzt.
Auch der Kanton Graubünden kann aufatmen. Galt bisher Warnstufe Orange, ist er nun ganz von der Liste verschwunden. Damit ist eingetroffen, was der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer (55) schon letzte Woche vorausgesagt hatte: «Ich gehe davon aus, dass wir bald wieder von der Liste verschwinden», meinte er zu BLICK. Graubünden ist in den Sommermonaten nämlich eine beliebte belgische Feriendestination. Letztes Jahr gingen in den Sommermonaten 62'000 Logiernächte auf ihr Konto.
Weiter auf Entwarnung warten müssen hingegen Schaffhausen und Zug, die immer noch auf der Risikoliste figurieren. Schreibt Blick.
Die Belgier spielen mit den Schweizer Kantonen russisches, pardon, belgisches Roulette. Der Schaden für die Schweizer Kantone hält sich allerdings in Grenzen. Die belgischen Beamten scheinen sich zu langweilen.
-
14.8.2020 - Tag der ledigen Staatsmänner
Die FDP Aarburg sagt an der Parteiversammlung Jein zum Vaterschaftsurlaub
Haarscharf war es. Mit 33 zu 32 Stimmen fassten die anwesenden Freisinnigen an der Parteiversammlung der FDP Aargau die Ja-Parole zum Vaterschaftsurlaub, über den wir im September abstimmen werden. Es gab einige Lacher im Saal, dann ungläubige Blicke. Schliesslich fragte ein Anwesender in der Mehrzweckhalle in Aarburg: Stimmt das wirklich? Also entschied Parteipräsident Lukas Pfisterer: Stimmen wir doch nochmals ab. Beim zweiten Durchgang lautete das Ergebnis: 31 Ja- zu 33 Nein-Stimmen. Nun war die Verwirrung perfekt. Schliesslich sagte Pfisterer: «Darf ich Ihnen vorschlagen, dass wir Stimmfreigabe beschliessen?» Dagegen hatte schliesslich niemand etwas einzuwenden.
Dem Entscheid war eine mehrminütige Debatte vorausgegangen. Den Auftakt machte Claudia Hauser, Vize-Präsidentin der Kantonalpartei. «Ich stelle mich nicht gegen einen Urlaub für Väter, damit sie nach der Geburt zu Hause sein können. Doch ich finde: Wir brauchen einen Elternurlaub. Das wäre die fortschrittlichere Lösung.»
Damit war die Debatte lanciert. In der Folge wechselten sich die Voten ab, es wurde darüber diskutiert, was den Unternehmen teurer zu stehen kommen würde: Ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub, oder aber die Konsequenzen, wenn man, als eines der einzigen Länder in Europa, keinen solchen einführen würde.
Schliesslich meldete sich Nationalrat Matthias Jauslin zu Wort: Er hätte auch gerne einen Elternurlaub gehabt. Doch dieser wurde im nationalen Parlament abgelehnt. Deshalb würde er sich für diese Lösung einsetzen: «Wir sind im Jahr 2020. Wenn wir auf unsere Plakate schreiben, dass wir uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen, müssen wir jetzt ein Zeichen setzen.»
Dem wiederum widersprach Sabina Freiermuth, Fraktionspräsidentin der FDP im Aargauer Grossen Rat: «So ein wichtiges Thema ist nicht dazu da, um Zeichen zu setzen. Eine richtige Lösung muss her. Und das ist der Elternurlaub.» Einig wurden sich die Freisinnigen nicht.
Der Vaterschaftsurlaub war der einzige Punkt, der in einer ansonsten unaufgeregten Parteiversammlung für Diskussionen sorgte. Für kleine Adrenalinschübe sorgte am ehesten noch das laute Rauschen im Saal, das jedes Mal dann aus den Boxen dröhnte, wenn zwischen den verschiedenen Rednern das Rednerpult inklusive Mikrofon desinfiziert wurde.
Zu zwei Abstimmungen, zur eidgenössische Begrenzungsinitiative und zur kantonalen Initiative über die Abschaffung der Schulpflege, hatte die Geschäftsleitung der FDP Aargau wegen Corona bereits die Parolen beschlossen. Darüber wurde nur noch informiert. Und bei zwei weiteren Abstimmungen, bei der eidgenössischen über die Kampfflugzeuge und bei der eidgenössiche Konzernverantwortungsinitiative (über die allerdings nicht am nächsten Abstimmungstermin im September, sondern erst im November abgestimmt wird), war die Lage klar: Zu den Kampfflugzeugen wurde einstimmig die Ja-, zu der Konzernverantwortungsinitiative einstimmig die Nein-Parole beschlossen. Schreibt das Zofinger Tagblatt.
Es sind nicht nur die Aargauer Politiker*innen, die den Vaterschaftsurlaub ihrer Klientel zuliebe ablehnen. Auch der Luzerner Damian «ich bin nicht schwul» Müller spricht sich vehement dagegen aus.
«Jetzt ist nicht Zeit für Geschenke» schreibt er auf Twitter. In der schwierigen wirtschaftliche Lage rund um Corona ist der «Papi-Urlaub» kein dringendes Anliegen. Müller weiter im Text: «Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch nötig.» Das gelte in der aktuellen Wirtschaftskrise «insbesondere auch für das scheinbar populäre Anliegen eines staatlich finanzierten Papi-Urlaubs». Sein gegenüber den Vätern fast schon höhnisches Geschwurbel krönt der Solariumgebräunte mit einem süssen Bildchen von einem Knaben in kurzen Höschen. Herzergreifend schön.
Ausgerechnet «der ledige Müller», schreibt das Luzerner Online-Magazin ZentralPlus. Vermutlich mit einem Augenzwinkern; hatte sich doch der Liebling aller Schwiegermütter im letzten Herbst in einem ZentralPlus-Interview (wie auch bei der LZ usw.) ungefragt als «ich bin nicht schwul» geoutet. Vermutlich in einem Anflug von proaktiver Bekämpfung der selbst im Hohen Haus von Bern grassierenden Gerüchten über die Sexualität des Hitzkircher Staatsmannes.
Der Pöstchenjäger vom Dienst scheint irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein. Wen interessiert heutzutage noch die Sexualität eines Politikers? In Deutschland bekleiden ein schwuler Wirtschaftsminister und ein schwuler Gesundheitsminister zwei der höchsten Staatsämter.
Andererseits sollten wir Müllers Ablehnung gegenüber dem Vaterschaftsurlaub, den er als «Geschenk» bezeichnet, etwas gnädiger und milder begegnen. Einer, der möglicherweise nicht mal weiss, wie man ein Kind zeugt, und der vermutlich nie im Leben von einem Vaterschaftsurlaub profitieren wird, muss seinen Instinkten folgend dieses «staatlich finanzierte Geschenk» aus tiefster Seele ablehnen.
Immerhin bei der Bildauswahl auf seiner Twitter-Attacke zeigt er Geschmack. Hübscher Bube. Wenn auch von hinten.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
13.8.2020 - LIDL-Day
Maskenpreise immer tiefer: Discounter heizt mit Mega-Aktion Preiskampf an
Lidl Schweiz senkt erneut die Maskenpreise. Ab sofort bietet der Discounter Schutzmasken zum Preis von 14.90 Franken für eine Box mit 50 Stück an. Aber nicht für lange Zeit. Schreibt Blick.
Nicht lange reden: Nix wie rein in die nächste LIDL-Filiale und gleich 100 Stück kaufen.
-
12.8.2020 - Tag der Profi-Fussballclubs
Amherds Corona-Sportpaket kommt nicht gut an: Jetzt will das Parlament den Profi-Sport retten
Das Corona-Rettungspaket des Bundesrats stösst bei den leidenden Profiligen auf Ablehnung: Zu hart sind die Bedingungen. Damit der Sport keinen bleibenden Schaden nimmt, will das Parlament nun einschreiten.
Das Bundesparlament zieht die Reissleine. Der Schweizer Profisport dürfe nicht komplett ins Abseits geraten! Denn die Not sei gross. Dürfen die Vereine nicht bald wieder mehr Zuschauer in die Stadien lassen, droht vielen über kurz oder lang der finanzielle Kollaps. Mit Spannung wird deshalb der Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch erwartet. Fällt Ende August die 1000er-Regel für Grossveranstaltungen? Für die Clubs ist es eine Existenzfrage.
Doch so gross die Not auch ist: Vom Corona-Rettungspaket von Sportministerin Viola Amherd (58) wollen die Profiligen in Fussball und Eishockey nichts wissen. Viel zu streng sind ihnen die Auflagen. Vor kurzem haben die 20 Clubs der zwei höchsten Fussballligen einstimmig beschlossen, den Darlehensvertrag nicht zu unterschreiben. Auch der Eishockeyverband wehrt sich: «Die formulierten Bedingungen könnten dazu führen, dass die Existenz des Schweizer Eishockeys in seiner Gesamtheit gefährdet werden könnte.»
Parlamentarier wollen Paket neu aufgleisen
«Es kann nicht sein, dass wir Kredite zur Verfügung stellen, die niemand will», findet SP-Nationalrat Matthias Aebischer (52). Gemeinsam mit FDP-Ratskollege Christian Wasserfallen (39) hat er erreicht, dass in der zuständigen Kommission am Donnerstag erneut Vertreter der Sportverbände angehört werden. Zu viele Punkte seien ungeklärt. «Das Hilfspaket ist gut gemeint, mehrere Punkte sind in der Praxis aber nicht umzusetzen», sagt Wasserfallen.
Gleich zwei Sport-Pakete hat CVP-Bundesrätin Amherd geschnürt. Eines im März zur Soforthilfe mit je 50 Millionen Franken für Breitensport und Profisport, um Konkurse zu verhindern. Im Mai doppelte der Bundesrat mit 500 Millionen nach. Geld fliesst aber nur unter strengen Bedingungen. So müssen beispielsweise Clubs, die ein Darlehen nicht innert drei Jahren zurückzahlen, ihre Lohnsumme um 20 Prozent senken. Gleichzeitig sollen sie solidarisch haften, wenn sich ein Verein übernimmt.
Bedingungen sind «völlig widernatürlich»
Für SVP-Nationalrat und Sportmanager Roland Rino Büchel (54) ist das Rettungspaket ein Schuss in den Ofen. So sei eine Solidarhaftung unter sportlichen Konkurrenten «völlig widernatürlich». Das sieht Aebischer ähnlich: «Es kann nicht sein, dass Clubs, die seriös arbeiten, für Vereine haften müssen, welche ihre Finanzen nicht im Griff haben.»
Für Grünen-Fraktionschefin Aline Trede (36) haben Amherd und ihr Bundesamt für Sport nicht sauber gearbeitet. Das Parlament sei ungenügend informiert worden – habe aber auch zu wenig genau hingesehen. Die Ligen hätten sich ebenfalls stärker einbringen müssen. Nun aber sei das Hilfspaket möglichst rasch neu aufzugleisen, so Trede kürzlich zu BLICK.
Bundesrat macht keine Anstalten
Ganz so rasch wird das aber nicht gehen. «Die Verordnung kann nur vom Gesamtbundesrat angepasst werden», stellt Christoph Lauener vom Bundesamt für Sport klar. Doch dafür gibt es bisher keine Anzeichen. Will das Parlament Anpassungen vornehmen, muss es dazu den ordentlichen politischen Weg einschlagen. Und der kann Monate dauern.
Davon lassen sich die Parlamentarier nicht entmutigen. «Wenn ein Gesetz in dieser Form nicht funktioniert, muss man es anpassen. Dafür ist das Parlament da», betont Aebischer. Und auch für Wasserfallen steht fest: «Der Wille im Parlament ist gross, hier nachträglich nochmals Verbesserungen zu erreichen.» Schreibt Blick.
Es ist schon auffällig, wie sich die Damen und Herren vom Hohen Haus in Bern für die Profi-Fussballklubs extrem laut und persönlich engagieren und mit der Konkurs-Keule winken. Wahlkampf at its best? Wohl eher von der schlechteren Seite. Die Kultur- und Festivalveranstalter geniessen hingegen kaum Aufmerksamkeit von den Politikern*innen. Obschon sie von den gleichen Problemen geplagt werden wie die Fussball-Proficlubs.
Man darf sich schon fragen, warum nicht einer der reichsten Verbände dieses Erdballs, die FIFA, zur finanziellen Lösung allfälliger Konkursprobleme von Profi-Fussballclubs in der Pflicht steht. Scheinbar ist es einfacher für die hohen Damen und Herren von und zu Bern den Ball den Steuerzahlern*innen vor die Füsse zu kicken. Das war (und ist) bei der Überbrückungsrente für die Ü60-Jährigen nicht der Fall.
-
11.8.2020 - Tag der Begrenzungsinitiative
Und wenn die Schweiz die Personenfreizügigkeit kündigt? Acht Fragen und Antworten zur SVP-Initiative
2014 die Masseneinwanderungs-, jetzt die Begrenzungsinitiative: Diesmal geht die SVP aufs Ganze. Darum geht es bei der Vorlage vom 27. September.
Was will die Begrenzungsinitiative?
Mit der sogenannten Begrenzungsinitiative – die Gegner sprechen lieber von «Kündigungsinitiative» – will die SVP erreichen, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländern aus der EU «eigenständig» regeln kann. Zum einen soll die geltende Personenfreizügigkeit abgeschafft werden. Und zum anderen soll die Schweiz mit anderen Ländern auch keine neuen Verträge oder Verpflichtungen eingehen dürfen, mit denen Ausländern eine Personenfreizügigkeit gewährt wird.
Was passiert bei einem Ja zur Initiative?
Das bestehende Freizügigkeitsabkommen mit Brüssel gewährt EU/Efta-Bürgern das Recht, ihre Arbeitsstelle und ihren Aufenthaltsort in der Schweiz frei zu wählen – umgekehrt ist der europäische Arbeitsmarkt auch für Schweizer Bürger liberalisiert. Ein Ja würde das Ende des Freizügigkeitsabkommens bedeuten. Gemäss der Initiative müsste der Bundesrat zuerst auf dem Verhandlungsweg versuchen, es innerhalb von zwölf Monaten einvernehmlich aufzulösen. Klappt dies nicht, muss er das Abkommen innert eines weiteren Monats kündigen. Die Zuwanderung müsste danach mit einem neuen Regime geregelt werden, im Vordergrund steht eine Rückkehr zu Kontingenten.
Was bedeutet die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens?
Die Abstimmung ist faktisch ein Richtungsentscheid über die Schweizer Europapolitik, mit potenziell weitreichenden Folgen. Denn: Das Freizügigkeitsabkommen ist Teil des ersten Pakets der bilateralen Verträge mit der EU. Die sogenannte Guillotine-Klausel besagt, dass bei der Kündigung eines der Verträge das gesamte Paket hinfällig wird. Dazu gehören sechs weitere Verträge, darunter das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse. Sie garantieren der Schweizer Wirtschaft einen «privilegierten Zugang» zum EU-Markt, wie der Bundesrat wirbt. Das Initiativkomitee gibt sich dagegen überzeugt, dass die EU die Bilateralen nicht einfach ohne neue Verhandlungen auflösen würde.
Wer ist dafür – und mit welchen Argumenten?
Die Initiative wird von der SVP und der Auns, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, getragen und unterstützt. Ihr Anliegen portieren sie vor dem Hintergrund, dass die Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» und deren zentrales Anliegen – die eigenständige Steuerung der Zuwanderung – nicht umgesetzt worden sei. Die Vorlage soll aus ihrer Sicht weniger Einwanderung bringen und so eine «10-Millionen-Schweiz» verhindern. Natur und Landschaft würden zusehends zubetoniert, warnen sie. Im Arbeitsmarkt hätten Einheimische mehr und mehr Schwierigkeiten. Viele Eingewanderte seien «billige Hilfsarbeiter».
Wer ist dagegen – und mit welchen Argumenten?
Die Wirtschaftsverbände, die Gewerkschaften und alle national bedeutenden Parteien ausser der SVP. Die Hauptargumente: Mit dem Ende der Personenfreizügigkeit fällt das gesamte Paket der Bilateralen I weg. Damit verliere die Schweiz den direkten Zugang zum EU-Binnenmarkt und handle sich als Exportnation gewichtige Wettbewerbsnachteile ein – mit einem Wohlstandsverlust als Folge. Die Gewerkschaften befürchten zudem das Ende der flankierenden Massnahmen und eine Aufweichung des Lohnschutzes.
Wie hat sich die Nettozuwanderung aus der EU mit der Personenfreizügigkeit entwickelt?
Eine Studie im Auftrag des Bundes schätzte das jährliche Einwanderungspotenzial einst auf jährlich 8000 Personen – das war vor der Abstimmung über die Bilateralen I. Seit die Personenfreizügigkeit 2002 schrittweise in Kraft getreten ist, übertraf die Realität diesen Wert stets um ein Vielfaches. Der höchste Wanderungssaldo – 68'000 Personen – datiert aus dem Jahr 2013. In den letzten drei Jahren pendelte sich der Saldo bei gut 30'000 Personen ein. Offen sind die Auswirkungen des Coronavirus. Im ersten halben Jahr betrug der Wanderungssaldo 17'100 Personen. Das entspricht einer Zunahme von 15,4 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Auch in den Monaten Mai und Juni wanderten unter dem Strich knapp 3000 Personen mehr ein als aus.
Nützt oder schadet die Personenfreizügigkeit dem Sozialstaat?
Für die Gegner der SVP-Initiative stabilisieren die EU/Efta-Bürger den Sozialstaat. Mit ihren Lohnabzügen finanzieren sie zum Beispiel die AHV und IV zu 26,5 Prozent, beziehen aber nur 15,8 Prozent der Leistungen. Die Befürworter hingegen warnen vor einer Einwanderung ins Sozialsystem. Aus der Arbeitslosenkasse erhalten EU/Efta-Bürger mehr Geld, als sie einzahlen.
Ist das Verhältnis zu Europa nach der Abstimmung ein für alle mal geklärt?
Nein. Das Rahmenabkommen mit Regeln zur Übernahme von EU-Recht harrt nach wie vor des Abschlusses. Bei der Unionsbürgerrichtlinie, dem Lohnschutz und den staatlichen Beihilfen verlangt der Bundesrat Nachbesserungen. Die Abstimmung über die SVP-Initiative – und die Coronapandemie – verzögern den Prozess. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Die Abstimmung über die Begrenzungsinitiative wird laut Umfragen mit grosser Wahrscheinlichkeit den Bach runter gehen. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, wird die SVP einmal mehr das altbekannte Schema anwenden und das Wahlresultat Bundesrat und Parlament vor die Füsse kippen, die den Schlamassel auszubaden haben, während sich die Granden rund um den Herrliberg die Hände in Unschuld waschen.
-
10.8.2020 - Tag der Steueroptimierer
Investorenlegende George Soros wird 90: Wohltäter oder rücksichtsloser Finanzhai?
George Soros polarisiert: Die einen verehren ihn als Investorenlegende und Wohltäter, für andere ist er ein rücksichtsloser Finanzhai und Strippenzieher. Am 12. August feiert der gebürtige Ungar seinen 90. Geburtstag.
Einmal im Jahr hält George Soros (89) in der Schweiz Hof. Wenn das Finanzorakel Ende Januar in Davos GR am WEF jeweils zur Audienz bittet, sind die Reihen gut gefüllt. Alle hängen an seinen Lippen, auch wenn es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, seinen Ausführungen zu den Märkten und der Weltwirtschaft zu folgen.
Soros wird von Anhängern als Investorenlegende und Wohltäter verehrt, während Gegner ihn als rücksichtslosen Finanzhai und Strippenzieher charakterisieren. Der Staranleger, Multimilliardär und Philanthrop bleibt auch im hohen Alter sehr umstritten.
Er zwang die Bank von England in die Knie, forderte Deutschland zum Euro-Austritt auf und warnte die Welt vor Donald Trump. George Soros, der Altmeister unter den Finanzspekulanten, wird am 12. August 90 Jahre alt.
Über UK in die USA ausgewandert
Der Starinvestor gilt als eine der erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Grössen der Finanzwelt. Als abgezockter Anlagestratege spekulierte er im grossen Stil gegen ganze Volkswirtschaften, als Philanthrop spendet er immense Summen. Und immer wieder mischt er sich in politische Diskussionen ein.
Der 1930 in Budapest geborene Hedgefonds-Manager, der 1947 zunächst nach Grossbritannien und 1956 in die USA auswanderte, polarisierte etwa in der Euro-Krise mit dem Vorschlag, dass Deutschland und nicht das hoch verschuldete Griechenland den Währungsraum verlassen solle. «Europa spart sich kaputt, anstatt auch etwas fürs Wachstum zu tun», echauffierte sich Soros damals. Schuld seien die «Bürokraten bei der Bundesbank» mit ihrem Stabilitäts- und Ordnungsfimmel.
«Trump ist ein Betrüger»
In den vergangenen Jahren meldete sich Soros kontinuierlich mit Warnrufen gegen nationalistische Tendenzen zu Wort. An US-Präsident Trump und auch Chinas Staatspräsident Xi Jinping etwa liess er kein gutes Haar. Die beiden versuchten, ihre Macht bis an die Grenzen und darüber hinaus auszudehnen. «Präsident Trump ist ein Betrüger und ein ultimativer Narzisst, der will, dass sich die Welt um ihn dreht», sagte Soros im Januar 2020 beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
Doch selbst wenn die Stimme des New Yorker Multimilliardärs in der Öffentlichkeit Gehör findet – Gewicht hat Soros' Wort selten. Denn ihm hängt auch im fortgeschrittenen Alter als Fondsmanager im Ruhestand stets sein Image als abgebrühter Spekulant nach. Nie weiss man so recht, welcher Finanzwette seine «Ratschläge» und Meinungsbeiträge gerade dienen. Angesichts der Coups, auf denen sein Ruf als Investorenlegende beruht, ist das auch kein Wunder.
Ratgeber und Abkassierer
1992 spekulierte Soros erfolgreich gegen das britische Pfund. Er machte ein Vermögen, weil Grossbritannien unter dem Druck der Finanzmärkte nachgab und seine Währung aus dem europäischen System fester Wechselkurse löste. Soros schrieb Finanzgeschichte als «der Mann, der die Bank von England knackte». Mit seinen Hedgefonds fuhr Soros jahrzehntelang traumhafte Renditen ein, wenngleich die Methoden nicht nur bei seinen Währungswetten mitunter umstritten waren.
Vor allem beim Thema Europa wurden Soros' Rollenkonflikte immer wieder deutlich. Der Geschäftsmann auf der Jagd nach Rendite und der altersweise Weltmann, der Regierungen mit Rat und Tat zur Seite stehen will – das passt nur begrenzt unter einen Hut. So stellte Soros einerseits lautstark Überlegungen an, in Griechenland oder in kriselnde Banken im Euroraum zu investieren. Dann tat er sich als Bedenkenträger hervor, Europa könne an Einzelinteressen und mangelnder Unterstützung für Schuldenstaaten zugrunde gehen.
Spekulant mit philosophischem Ansatz
Soros selbst beteuert indes immer wieder, der schnöde Mammon interessiere ihn bestenfalls am Rande. Vielmehr sieht sich der Geldguru, dessen Vermögen «Forbes» zuletzt auf 8,6 Milliarden Dollar (7,85 Milliarden Franken) schätzte, der Philosophie verpflichtet. Er sehnt sich danach, auf diesem Feld ernst genommen zu werden. Doch das wollte bislang nicht so recht gelingen. So viele Bücher mit Soros' teilweise recht abstrakten Gedanken auch auf den Markt kommen – den Erfolg als Spekulant hat er als Autor noch nicht ansatzweise erreicht.
Im Gegenteil: Soros' «Reflexivitätstheorie» etwa, mit der er nicht weniger als die ganze Welt erklären zu können glaubte, wurde in Fachkreisen eher belächelt. Sein fieberhafter Versuch, sich als Vordenker und grosser Theoretiker in der Tradition des von ihm hochverehrten Philosophen Karl Popper (1902–1994) einen Namen zu machen, brachte wenig Lorbeeren ein. Dafür ist der Grossanleger, wie viele andere Superreiche in den USA, für sein gönnerhaftes Mäzenatentum bekannt.
Wohltäter in der alten Heimat
Als US-Amerikaner mit ungarischer Herkunft legt Soros grossen Wert auf seine europäischen Wurzeln. Über Osteuropa schüttet der Philanthrop schon seit Jahrzehnten ein Füllhorn aus – bereits Anfang der 1990er-Jahre entschied er sich, seinen Reichtum für humanitäre Zwecke im ehemaligen Ostblock einzusetzen. Jahr für Jahr spendet Soros Milliarden an diverse Einrichtungen und Organisationen.
Dies sorgt jedoch auch für viel Argwohn. Kritiker nehmen ihm den Wohltätigkeitsgedanken nicht ab und sehen Soros als eine Art graue Eminenz im Hintergrund, die mit enormem Finanzaufwand Einfluss kauft. Im Internet ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien um Stiftungen und Initiativen von Soros, die Rechtspopulisten helfen, ihn zur Zielscheibe zu machen. US-Präsident Donald Trump (74) etwa stellte Soros in seiner Wahlkampfwerbung 2016 als Sinnbild einer korrupten Finanzelite dar, obwohl sein Finanzminister Steven Mnuchin (57) und Soros als frühere Geschäftspartner eine enge Verbindung zueinander haben. Schreibt Blick.
Unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches Denken und Verhalten. Als Motiv wird manchmal eine die gesamte Menschheit umfassende Liebe genannt, die «allgemeine Menschenliebe». Materiell äussert sich diese Einstellung in der Förderung Unterstützungsbedürftiger, die nicht zum Kreis der Verwandten und Freunde des Philanthropen zählen, oder von Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienen. Das Bild der Philanthropie prägen vor allem in grossem Stil durchgeführte Aktionen sehr reicher Personen. Schreibt Wikipedia.
Der Begriff Philanthropie stammt aus der Antike und wurde vermutlich zur damaligen Zeit seiner Bedeutung gerecht, wie sie von Wiki beschrieben wird. Doch die heutigen Milliardäre, vorwiegend aus den USA stammend, die ihre «philanthropischen» Stiftungen in erster Linie als Steuersparmodelle betreiben, als «Philanthropen» zu bezeichnen, ist ein Hohn gegenüber dem Begriff der Nächstenliebe.
Dass obskure und selten dämliche Verschwörungstheorien über die unseligen Neuzeitphilanthropen wie Soros, Gates und Konsorten im Netz zirkulieren, ist lediglich eine Folge der unkontrollierbaren und intransparenten Handlungen dieser mächtigen «Steueroptimierer». Wahrer werden die abstrusen Verschwörungstheorien dadurch allerdings auch nicht.
-
9.8.2020 - Tag der Systemrelevanz
Das meint SonntagsBlick zu Corona: Ein Fehler im System
Die Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor immense Herausforderungen. Vor einem halben Jahr war das Coronavirus noch eine abstrakte Gefahr aus dem Fernen Osten. Während Regierung und Bevölkerung die möglichen Auswirkungen von Sars-CoV-2 auf unser Leben noch zu begreifen suchten, war der Erreger schon in der Schweiz angekommen. Erst mit dem Lockdown Mitte März wurde allen klar: Das ist kein Spass!
Dabei war die Pandemie in höchstem Mass vorhersehbar. Zu diesem Schluss kommt ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Uno-Umweltprogramms Unep. Unsere Lebensweise – so die Kernaussage – macht uns anfälliger für Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen.
Zunehmender Fleischkonsum, Massentierhaltung, Wildtierhandel, Urbanisierung, Rückgang der Biodiversität – der Kontakt zu Tieren wird immer enger und unnatürlicher. Auch zu solchen, die für den Menschen gefährliche Erreger in sich tragen.
Es handelt sich um ein systemisches Problem. Die Erkenntnis aus dem Uno-Bericht ist eindeutig: Die Gesundheit der Natur und der Tierwelt ist aufs Engste mit der Gesundheit des Menschen verknüpft. Experten sprechen vom «One Health»-Konzept.
Diesem Zusammenhang kann nicht genug Bedeutung beigemessen werden: Gemäss Unep haben seit 1930 gut 75 Prozent aller neu auftretenden Infektionskrankheiten beim Menschen ihren Ursprung in der Tierwelt – Tendenz steigend! Beispiele gibt es genug: HIV, Ebola, Sars, Mers, Zika, Vogel- oder Schweinegrippe. Und eben auch Covid-19.
Wir sollten uns bei diesen Krankheiten von dem Gedanken lösen, es handle sich ausschliesslich um medizinische oder wirtschaftliche Probleme. Wenn sich Virologen und Epidemiologinnen streiten, mit welcher Strategie wir am besten mit dem Virus umgehen können, dann ist das Symptombekämpfung. Die ist zwar dringend nötig. Doch die Krise liegt tiefer. Um ihrer Ursache auf den Grund zu gehen – und damit eine künftige Pandemie zu verhindern – müssten wir uns dieser Diskussion stellen.
Denn das Streben nach mehr Tempo, schnellerem Wachstum und höherer Effizienz hat zur Folge, dass das Risiko eines Systemfehlers zunimmt. Krisenfester werden unsere Gesellschaften erst, wenn Vertreter aller relevanten Bereiche an einem Tisch sitzen – Epidemiologen und Ökonominnen genauso wie Veterinärmediziner, Umweltwissenschaftlerinnen und Klimatologen.
Wir müssen den Systemfehler an der Wurzel packen. Sonst bekämpfen wir auch in Zukunft weiterhin nur die Symptome. Schreibt Valentin Rubin im SonntagsBlick.
Es gibt an diesem Artikel von Valentin Rubin – einem Vertreter der jüngeren Generation – nichts auszusetzen. Ausser der Tatsache, dass seine Botschaften weder in der Gesellschaft noch bei der Politik ankommen. Denn die von Rubin genannten Systemfehler sind leider systemrelevant und nicht verhandelbar. Daran wird sich so schnell nichts ändern.
-
8.8.2020 - Tag des Agenturmülls
China will Wiederwahl von Trump angeblich verhindern
Den US-Geheimdiensten zufolge wollen China, Russland und der Iran die im November bevorstehenden Wahlen in den Vereinigten Staaten beeinflussen. Cjhina und der Iran wollten eine Wiederwahl von Präsident Donald Trump (74) verhindern.
Russland bemühe sich derweil, den designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden (77) zu untergraben, hiess es aus dem Büro des Geheimdienstkoordinators (DNI) am Freitag. Man sei «besorgt über die anhaltenden und potenziellen Aktivitäten» der drei Länder, hiess es.
Russland nutze «eine Reihe von Massnahmen», um den früheren Vizepräsidenten Biden zu «verunglimpfen», hiess es weiter. Als Beispiele nannte das DNI unter anderem Aussagen von Politikern, die die Glaubwürdigkeit Bidens durch angebliche Korruptionsvorwürfe beschädigen wollten. Kreml-nahe Akteure nutzten zudem soziale Medien, um die Kampagne des Republikaners Trump zu unterstützen, hiess es.
Eine erneute Wahl Trumps hingegen sei nicht im Sinne Chinas, weil Peking ihn für «unberechenbar» halte, hiess es. Das Land habe angefangen, verstärkt Einfluss nehmen zu wollen auf das politische Umfeld in den USA. China versuche, Politiker unter Druck zu setzen, die den Interessen des Landes zuwider handelten. Die Spannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften hatten zuletzt deutlich zugenommen. Peking sei sich dabei bewusst, dass die China-Politik auch im Wahlkampf eine Rolle spiele, hiess es.
«Verdeckte und offene» Einflussnahmen
Dem Iran unterstellen die Geheimdienste, die demokratischen Einrichtungen der USA untergraben zu wollen. Auch andere Länder nutzten «verdeckte und offene» Massnahmen um die Wähler in den USA zu beeinflussen und das Vertrauen in den demokratischen Prozess zu untergraben, hiess es weiter.
In Washington gibt es seit langem Befürchtungen, dass sich Russland und andere ausländische Regierungen in die Präsidentschaftswahl am 3. November einmischen wollen. Die US-Geheimdienste sind überzeugt, dass sich Russland bereits 2016 zugunsten Trumps in den Wahlkampf eingemischt hat. Trump hat das wiederholt infrage gestellt.
Die Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Senat, der Republikaner Marco Rubio (49) und der Demokrat Mark Warner (65), lobten die Mitteilung der Geheimdienste in einer gemeinsamen Stellungnahme. Eine der Lehren aus der Wahl 2016 sei es, dass man die Bestrebungen ausländischer Akteure am besten bekämpfe, indem man so viel Informationen wie möglich mit den Wählern teile, erklärten sie. Schreibt Blick with a little Help from SDA/keystone.
Lieber Blick. Wenn man als führendes Boulevardblatt der Schweiz einen Artikel aus Material der Agenturen SDA und Keystone zusammenstellt, ist das absolut legitim. Die Aussagekraft einer Lagebeurteilung mit dem Wort «angeblich» in der Titelzeile lässt ohnehin nur inhaltlichen Kaffeesatz erwarten. Da werden keine Hardfacts genannt. Mit dem Wort «angeblich» verhält es sich wie mit dem Konjunktiv: Man kann so ziemlich alles behaupten. Das gehört nun mal beim Agenturmüll dazu wie die Luft zum Atmen.
Was aber selbst beim Boulevard nicht passieren dürfte, sind eindeutig falsche Aussagen. Wie zum Beispiel die Bildlegende zu Bild 1/8 (Trump und Xi Jinping): «Es herrscht Distanz zwischen US-Präsident Trump und Chinas mächtigem Premier Xi Jinping.»
Xi ist nicht Chinas Premier, sondern Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas sowie Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und seit 2013 Staatspräsident der Volksrepublik China. Der «Premierminister» der Volksrepublik China heisst Li Keqiang.
Auch wenn's Korinthenkacke ist: So kommt's halt, wenn das Lektorat in den Balkan «outgesourct» oder gar gänzlich aufgegeben wird. Fake News at its best.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.8.2020 - Tag der Camouflage (Tarnung)
1,4 Millionen Stück sollen beschafft werden: Armee steigt um auf Stoffmasken – in Tarnfarben!
Zum Schutz vor Corona kommen in der Armee derzeit Wegwerfmasken zum Einsatz. Das soll sich ändern. Die Armee will wiederverwendbare Stoffmasken für die Armeeangehörigen beschaffen – zehn Stück pro Person. Entscheiden muss nun der Bundesrat.
Hunderte Millionen Einweg-Schutzmasken hat der Bund bisher beschafft. Auch in der Armee kommen derzeit handelsübliche Hygienemasken zum Einsatz – etwa in der Rekrutenschule, die Ende Juni mit 12'500 neuen Rekruten begonnen hat.
Doch nun will die Armee auf Stoffmasken umrüsten – ein entsprechendes Beschaffungsprojekt ist aufgegleist. Das bestätigt Armeesprecher Daniel Reist gegenüber BLICK: «Es gibt Überlegungen dazu, versuchsweise Stoffmasken für die Armee zu beschaffen», sagt er. Für Textilmasken würden ökologische wie auch ökonomische Gründe sprechen. «Da eine waschbare Stoffmaske etwa fünf Hygienemasken ersetzen kann, müssten weniger Masken beschafft werden und auch die Umwelt könnte durch weniger Wegwerfmasken geschont werden.»
Der konkrete Beschaffungsauftrag wurde aber noch nicht erteilt, wie Reist betont. Denn zuerst muss der Bundesrat grünes Licht dazu geben. Erst dann wird klar, ob und wie viele Stoffmasken genau beschafft werden können und zu welchem Preis.
Zehn Stoffmasken für jeden Armeeangehörigen
Die Armee hat aber bereits konkrete Vorstellungen: «Wir möchten jeden Armeeangehörigen mit zehn Textilmasken ausrüsten, damit man eine Woche damit durchhalten kann – und im Wochenendurlaub können die Masken gewaschen werden», so Reist. Bei derzeit rund 140'000 Armeeangehörigen steht also die Beschaffung von gut 1,4 Millionen Masken zur Debatte.
In den Läden sind Stoffmasken derzeit schon für fünf bis zehn Franken pro Stück zu haben – bei einem Grossauftrag dürfte der Preis deutlich tiefer ausfallen. Zum Budget will Reist nichts sagen, doch die Beschaffung dürfte einen tiefen Millionenbetrag ausmachen. Schreibt Blick.
Stoffmasken in Tarnfarben sind alternativlos für die Soldaten*innen der Schweizer Armee. Nicht aus Hygienegründen. Nein! Wie Bill Clinton schon sagte: «It's just the Camouflage. Stupid!» Oder will jemand, dass unsere Soldaten und Soldatinnen im ungetarnten Maskenkostüm vom Russen gleich auf den ersten Blick entdeckt werden?
-
5.8.2020 - Tag der widerstanslosen Übernahme
Millionen für Schweizer Moscheen: Was bezweckt Katar mit seinem finanziellen Engagement?
Die Nichtregierungsorganisation Qatar Charity aus dem kleinen, aber reichen Golfstaat finanziert islamische Zentren in ganz Europa. Auch in die Schweiz flossen mindestens 3,7 Millionen Euro. Islamexpertin Saida Keller-Messahli warnt: «Qatar Charity fördert aktiv die Bildung von Parallelgesellschaften in Europa.»
Mit knapp 3,7 Millionen Euro hat die katarische Nichtregierungsorganisation Qatar Charity (QC) Moscheen, islamische Vereine und Projekte in der Schweiz finanziert: Diese Zahl enthüllen die französischen Journalisten Christian Chesnot und Georges Malbrunot in ihrem Buch «Qatar Papers», von dem seit wenigen Tagen eine deutsche Übersetzung vorliegt.
Mit Hilfe von Whistleblowern konnten die beiden Journalisten die Finanzflüsse von QC durchleuchten. Nicht nur die Zahl für die Schweiz lässt aufhorchen. Im Jahr 2014 beliefen sich die Investitionen auf knapp 72 Millionen Euro für mehr als 100 Projekte in 14 europäischen Ländern, darunter Italien, Deutschland und Frankreich. Viel Geld lenkt QC in Bildungseinrichtungen.
Was ist das Problem, könnte man sich fragen. Immerhin ist QC eine humanitäre Organisation, die mit UNO-Organisationen zusammenarbeitet und sich für bedrohte muslimische Minderheiten wie die Rohingya in Myanmar einsetzt. QC versorgt Flüchtlinge aber nicht nur mit Essen, Trinken und Medikamenten, sondern auch mit Koranen. Finanziert wird QC von vielen Klein-, aber von auch Grossspendern und dem katarischen Aussenministerium. Ideologisch und personell bestehen enge Verbindungen zur Muslimbruderschaft, einer 1928 in Ägypten gegründeten Organisation mit weltumspannendem Netzwerk. Die bedeutendste islamistische Bewegung liefert den ideologischen Nährboden für Terrororganisationen.
Was bezweckt QC mit ihren missionarischen Aktivitäten in Europa? Saida Keller-Messahli hat das Vorwort für «Qatar Papers» beigesteuert. Die Präsidentin des Forums für einen fortschrittlichen Islam sagt: Qatar Charity fördert aktiv die Bildung von Parallelgesellschaften in Europa. Sie denkt dabei etwa an Imame, die in den Moscheen einen politischen Islam vertreten und im schlimmsten Fall labile Jugendliche radikalisieren würden. Es gelte, die Aktivitäten der kleinen, aber umso aktiveren Minderheit innerhalb der muslimischen Bevölkerung in Europa kritisch zu betrachten. Keller-Messahli fordert schon lange Transparenz über die Finanzen islamischer Vereine in der Schweiz. Christian Chesnot und Georges Malbrunot halten derweil fest: Das Geld aus Katar soll dafür sorgen, dass Muslime ihre religiöse Identität in den liberalen und laizistischen Gesellschaften Europas nicht verlieren. Oder anders formuliert: Die Muslime sollen ideologisch abgeschottet werden.
1,4 Millionen für Museum in La Chaux-de-Fonds
Nach aussen treten die Vertreter der Muslimbrüder in Europa moderat auf. Gemäss dem aktuellen Verfassungsschutzbericht von Baden-Württemberg lehnen sie aber demokratische Errungenschaften wie Meinungsfreiheit, Volkssouveränität oder Gleichberechtigung ab. Ihr Ziel laute, islamische Prinzipien und Werte in allen Lebensbereichen durchzusetzen. Lorenzo Vidino, Programmdirektor für Extremismus an der George Washington Universität, ist einer der besten Kenner der Muslimbrüder. Er schätzt ihren harten Kern in Europa auf mehrere tausend Personen, in der Schweiz auf etwa 100.
Gemäss den Buchautoren überwies QC allein dem soziokulturellen Komplex der Muslime von Prilly/Lausanne 1,6 Millionen Franken. Mit knapp 1,4 Millionen Franken zwischen 2011 und 2013 erhielt auch das Museum der Islamischen Zivilisationen in La Chaux-de-Fonds einen bedeutenden Zustupf. Museumsdirektorin Nadia Karmous, Schweizerin algerischer Herkunft und eine Verfechterin des islamischen Schleiers, sagte aber, QC habe das Museum nicht finanziert – obwohl die Buchautoren Belege vorlegen konnten. Karmous argumentierte, QC habe lediglich die Transaktionen durchgeführt. Die Spenden stammten von Privatpersonen. Chesnot und Malbrunot betonen, ihre Gesprächspartner hätten oft versucht, Spuren zu verschleiern.
Der ausländische Geldsegen für Schweizer Moscheen ist hierzulande nicht verboten. Sie müssen ihre Finanzen auch nicht offenlegen. Der Ständerat versenkte einen entsprechenden Vorstoss von Lorenzo Quadri (Lega, TI). Er hatte argumentiert, das Ziel des finanziellen Engagements des Auslands könnte es sein, einen radikalen Islam zu propagieren. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Dazu Douglas Macgregor, Donald Trumps Kandidat für das Amt des US-Botschafters in Deutschland, in der heutigen Ausgabe der WELT:
Muslimische Migranten kämen nach Europa «mit dem Ziel, Europa in einen islamischen Staat zu verwandeln», hatte der pensionierte Armeeoberst, der auch häufiger Gast bei Fox News ist, unter anderem gesagt.
In einem Radiointerview im Juni 2016 sagte er zur Einwanderungspolitik: «Diese Menschen kommen nicht, um sich zu assimilieren und Teil Europas zu werden. Sie kommen, um davon zu profitieren, um zu konsumieren und sich in den Ländern anderer Menschen niederzulassen, mit dem Ziel, Europa schliesslich in einen islamischen Staat zu verwandeln. Das ist eine schlechte Sache für den Westen. Das ist schlecht für die Europäer.»
In einem 2015 veröffentlichten Interview beklagte er, dass die Europäische Union muslimischen Flüchtlingen auf dem Höhepunkt der weltweiten Migrantenkrise «sehr luxuriöse und extrem teure Sozialleistungen» gewährt habe und dass «diese Menschen nicht kommen, um sich zu assimilieren oder Europäer zu werden – ganz im Gegenteil. Sie kommen, um alles zu übernehmen, was sie bekommen können».
Man muss die Worte des alten weissen Mannes Macgregor nicht für bare Münze nehmen. Doch wenn man bedenkt, dass Luzerns christliche Kirchen mehrheitlich leer sind und Kapellen verkauft und zu Discos umgebaut werden, in der Region um den islamischen Hotspot Luzern jedoch bereits jetzt schon neun meistens brechend volle Moscheen, beispielsweise in Luzern, Emmenbrücke, Kriens und Horw existieren, sind Macgregors Gedanken schon eine Überlegung wert. Jedenfalls nicht ganz von der Hand zu weisen.
Liest man dazu noch das Buch «The Clash of Civilizations» (Kampf der Kulturen») von Samuel P. Huntington, für das er im Übrigen heftig kritisiert und als Rassist abgestempelt wurde, findet man den bemerkenswerten Satz: «Wir (gemeint ist die westliche Wertegemeinschaft inklusive USA) werden dieser Kraft (gemeint ist der Hardcore-Islam) nichts entgegenzusetzen haben.»
Trotzdem sollten wir jetzt nicht jeden muslimischen Flüchtling unter Generalverdacht stellen. Problematisch wird die Situation erst dann, wenn die grossen Hoffnungen und Erwartungen der Asylanten nicht erfüllt werden, was durch die Folgen der Coronakrise in den nächsten Jahren - besonders auf dem Niedriglohnsektor – zu erwarten ist. Kein Job. Kein Geld. Frust. Das ist der Nährboden für den fatalen Radikalismus, den wir schon beim IS erlebt haben.
Was soll's? Draussen scheint wieder die Sonne und das ist nach drei Tagen Regenwetter doch aus was. Was kümmern einen da die Millionen für Schweizer Moscheen?
-
4.8.2020 - Tag der Infantilen
Nach jüngster BAG-Panne nimmt die SVP den Gesundheitsminister ins Visier: «Berset ist ein Schönwetter-Pilot»
Es war eine weitere Panne im Bundesamt für Gesundheit (BAG). Die meisten Ansteckungen finden in der Familie statt – und nicht in Clubs und Bars, wie das BAG zuerst behauptet hatte. Für die Politik ist das Mass nun voll.
«Es ist doch keine Hexerei, Zahlen sauber aufzubereiten und zu kommunizieren», sagt CVP-Nationalrätin Marianne Binder (62). «Ein solcher Fehler darf nicht mehr passieren», fordert sie. Schon das «Chaos um das Maskentragen» habe unnötig für Verunsicherung gesorgt. Und jede neue Panne untergrabe das Vertrauen in die Behörden weiter.
Noch schärfer geht SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (41) mit dem BAG ins Gericht – und mit dessen Departementschef, Gesundheitsminister Alain Berset (48). «Bundesrat Berset ist ein Schönwetterpilot», wettert er. Statt seine Führungsverantwortung im BAG wahrzunehmen, übe sich der SP-Magistrat lieber in Selbstdarstellung.
Es sei ja nicht die erste Panne im BAG, fügt Aeschi an und verweist ebenfalls auf die Maskenfrage. «Wie die Bevölkerung da belogen wurde, ist eine Unverschämtheit.» Auch Berset habe monatelang behauptet, dass Masken nichts bringen. «Wie soll man Berset in dieser Krise noch trauen?», fragt Aeschi. Schreibt Blick.
Der gute Aeschi hat ja recht: Bundesrat Berserker mit dem üppigen Haarwuchs, der auf den ersten Blick öfters mal mit FIFA-Pate Gianni Infantilo verwechselt wird, ist ein Selbstdarsteller. Allerdings mit dem Hang zu verkorksten Drehbüchern. Man denke nur an seine ebenso lächerliche wie groteske Slapstick-Komödie mit dem Schlapphut inmitten der Coronakrise.
Doch diese Selbstdarstellungsmanie wird mehr oder weniger von allen Politikern*innen inklusive Aeschi intensiv gepflegt. Wobei Aeschi scheinbar die besseren Berater hat.
Leider vergessen dabei die Volksvertreter*innen Napoleon Bonapartes kluge Äusserung: «Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt.» Wie wahr!
-
3.8.2020 - Tag der Steuerfüsse
Immer mehr Berufspolitiker lösen Ehrenamtliche ab – der grosse Lohnreport: Das ist der teuerste Gemeindepräsi der Schweiz
Die grosse BLICK-Auswertung zeigt, wo die Schweizer Stadtpräsidenten am besten verdienen – und in welcher Gemeinde die Bürger am meisten bezahlen fürs Regiertwerden.
Dass die grossen Städte wie Zürich und Lausanne obenaus schwingen, erstaunt kaum. Darum hat BLICK weitergerechnet: Wo kostet der Gemeindepräsident pro Einwohner am meisten? Die Zahlen zeigen: Wer in Flawil SG wohnt, zahlt fast eine Zwanzigernote pro Jahr für CVP-Gemeindepräsident Elmar Metzger (60). Zum Vergleich: In Zürich sind es knapp 60 Rappen pro Bewohner.
Flawil also: ein Kleinstadt im Kanton St. Gallen, etwas mehr als 10'000 Einwohner und eine Schokoladenfabrik. Metzger ist seit 2014 im Amt und verdient 206‘192 Franken, dazu kommen pauschal 10'000 Franken Spesenentschädigung. Allerdings arbeitet er Vollzeit für die Gemeinde. Anders als andere Gemeindepräsidenten von Städten der gleichen Grössenordnung, die oft in Teilzeit regieren.
Dennoch ist Metzger kein Einzelfall in der Ostschweiz. Auch die Bewohner von Weinfelden TG, Altstätten SG, Romanshorn TG, Buchs SG und Uzwil SG zahlen mehr als 16 Franken pro Kopf an den Lohn ihres Gemeindepräsidenten.
Gerade im Kanton St. Gallen sind aussergewöhnlich viele Gemeindepräsidenten Vollzeit angestellt – auch bei kleineren Gemeinden, die in der BLICK-Umfrage nicht berücksichtigt wurden. Bereits 2017 hat die «Medienvereinigung Öffentlichkeitsgesetz» eine Umfrage nur bei den Ostschweizer Gemeinden durchgeführt. Cornel Egger, Gemeindepräsident in Oberuzwil verdiente demnach 206'192 Franken, für seine Tätigkeit in der 5800-Seelen-Gemeinde. 35 Franken und 55 Rappen zahlt jeder Bürger für den Lohn des Gemeindepräsidenten. Schreibt Blick.
Wir sollten den Wochenfang nicht mit Defätismus und einer Neid-Debatte starten! Die Amtsträger*innen sind jeden Rappen ihres Salärs wert. Schliesslich wollen wir ja die besten und intelligentesten Köpfe, die uns regieren. Wie das zum Beispiel in einer Luzerner Gemeinde der Fall ist, die vor allem mit ihrem Steuerfuss-Ranking in obersten Gefilden präsent ist. Dass in dieser burlesken Gemeinde ein nebenamtlicher Gemeinderat bis zu 140'000 Franken pro Jahr so nebenbei verdienen kann, erklärt vermutlich den exorbitanten Steuerfuss dieser Gemeinde.
-
2.8.2020 - Tag der Überdosis
Rogers Boxenstopp: Kimi Räikkönen wehrt sich gegen den Kniefall
Der Kniefall vor den Formel-1-Rennen stösst immer mehr auf Gegenwind. Einer der «Rebellen»: Kimi Räikkönen.Stellen Sie sich vor, bei allen NBA-Spielen gehen die schwarzen Superstars auf die Knie und demonstrieren bei allen Spielen so gegen den Rassismus. Oder David Alaba versucht seine Mitspieler bei Bayern München dazu zu bringen, jeweils vor jedem Punktspiel den Kniefall zu machen. Fast unmöglich! In der Formel 1 gibt Lewis Hamilton seinen Plan nicht auf, die ganze Saison vor dem Start mit seinen Kollegen auf die Knie zu gehen. Der Brite hatte Druck gemacht, nachdem die Front der Fahrer in Ungarn – nach dem Demo-Start in Österreich – immer weiter aufgebrochen war.
Einer der «Rebellen» ist Kimi Räikkönen (40). Der Finne in den sozialen Medien: «Ich glaube, dass jeder das Recht hat, bei diesem Thema so zu reagieren, wie er will. Natürlich sind wir alle gegen den Rassismus und wir haben auch unsere Unterstützung gezeigt. Ich denke jedoch nicht, dass wir in dieser Angelegenheit uns erklären müssen, warum wir nicht auf die Knie gehen oder sonst was tun. Das ist eine persönliche Sache!» Schreibt SonntagsBlick.
Hamiltons Aktionen waren klug, durchdacht und wichtig. Doch langsam aber sicher bewegt sich der Superstar in Richtung «Overdose». Das (amerikanische) Thema wird überstrapaziert und die Formel1-Fans ausserhalb Amerikas sind die falschen Ansprechpartner. Das beweisen unzählige Kommentare in den entsprechenden Foren von Menschen, die absolut keine Rassisten sind, aber sich inzwischen von Hamiltons diktatorischen «Verordnungen» genervt fühlen. Ein Hauch von Greta schwebt über den Formel1-Pisten.
-
1.8.2020 - Tag der eidgenössischen Ballermänner
Spanien droht die Quarantäne-Liste des BAG: Können wir bald nicht mehr nach Mallorca?
42 Länder stehen auf der Risikoliste. Zwar soll diese nur monatlich aktualisiert werden, aber in schlimmen Fällen kann sie auch früher ergänzt werden. Spanien bleibt unsicher. Reiseveranstalter hoffen, dass Balearen und Kanaren von der Liste verschont bleiben.
Die traumhaften Ferien am Mittelmeer können zum Albtraum bei der Rückkehr werden. Zumindest für diejenigen, die sich für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Denn 42 Länder setzte das BAG bereits auf eine Quarantäne-Liste.
Neben Montenegro, Bosnien, Luxemburg oder Serbien könnte bald schon auch Spanien auf der Liste stehen. Andere europäische Länder haben bereits auf die steigenden Infektionszahlen im beliebten Ferienziel reagiert. Aktuell hat Spanien laut dem Gesundheitsministerium 282'641 bestätigte Infektionen.
Das Auswärtige Amt in Deutschland etwa spricht heute eine offizielle Reiswarnung für die Regionen Aragón, Katalonien und Navarra aus. Auch Frankreich und Belgien differenzieren je nach Region.
Mallorca, Menorca und Ibiza verzeichnen hingegen weiterhin niedrige Infektionszahlen. Für die Tourismusbranche sind diese Gebiete wichtig und sehr beliebt. «Unsere Kunden schätzen die Ferien und die Schutzmassnahmen auf den Balearen und den kanarischen Inseln», sagt eine Sprecherin von Tui.
Zehn Feriengäste sind auf Mallorca derzeit in Quarantäne. Dies ist der erste Fall, seit der Wiederöffnung der Insel, schreibt «Diario de Mallorca». Die Personen weisen nur leichte oder keine Symptome auf.
Die Schweizer Kunden schreckte die Situation auf dem spanischen Festland noch nicht ab: «Bisher haben wir keinen Einbruch in der Nachfrage registriert und kaum Stornierungen von Spanienreisen vornehmen müssen», heisst es seitens Hotelplan. Das könnte sich durch die Entscheidungen des BAG ändern.
Beschliessen Touristen, dass sie wegen der Liste früher heimkehren wollen, organisiert Hotelplan die Rückreise. Allerdings trägt der Kunde hierbei die Kosten. Unabhängig von der Risikoliste bietet Tui für alle Reisen bis zum 31. August eine kostenlose Umbuchung. Das sei Anfang der Sommermonate oft bei Italienreisen vorgekommen. Schreibt Blick.
Was hat Mallorca, was die Schweiz nicht hat? Genau, Sie sagen es! Den Ballermann. No Risk, no Fun!
-
31.7.2020 - Tag der Rückzieher
Andreas Glarner zieht Kandidatur zurück: Tessiner Ständerat Marco Chiesa soll neuer SVP-Präsident werden
Die Suche nach einem neuem SVP-Präsidenten nimmt eine überraschende Wende. Die Findungskommission empfiehlt den Tessiner Ständerat Marco Chiesa für die Nachfolge des Berner Nationalrates Albert Rösti, wie sie am Donnerstag bekanntgab.
Die Findungskommission unter Leitung des früheren Nationalrates Caspar Baader bezeichnet Chiesa als «Glücksfall». Es sei ein grosser Vorteil, dass er aus der lateinischen Schweiz komme, weil er dadurch die SVP in der Romandie stärken könne. Als Bewohner eines Grenzkantons setze er sich auch gegen die «unkontrollierte Zuwanderung» ein. Überzeugt hat die Kommission nicht zuletzt Chiesas «klare politische Auffassung» wie auch die solide Aufbauarbeit für die SVP im Tessin.
Der gestrige Entscheid ist ein Affront für die beiden Nationalräte Andreas Glarner (AG) und Alfred Heer (ZH), den beiden einzigen verbliebenen offiziellen Kandidaten. Dass aber einer der beiden Politiker Albert Rösti als Parteipräsidenten beerben wird, war immer unwahrscheinlicher geworden. Immer wieder machten neue Namen in den Medien die Runde, um kurze Zeit wieder abzusagen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es im engsten Kreis der SVP starke Widerstände gibt gegen einen Präsidenten Glarner oder Heer.
Auf Anfrage von« Blick» erklärte Andreas Glarner bereits, seine Kandidatur zurückzuziehen. «Ich finde das eine sehr gute Lösung», sagte er. Er habe bereits das Schlimmste befürchtet. «Es wurden ja sehr viele Namen genannt. Nicht alle wären qualifiziert gewesen.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wenn sich der Dummschätzer vom Dienst an sein übliches Muster (Rückzieher vom dumm Geschwätzten am Tage danach) hält, müsste er spätestens heute den Rücktritt vom Rücktritt bekannt geben.
-
30.7.2020 - Tag der Clickbaitings
Schreckmoment für Sutil: Ex-Sauber-Pilot fährt Millionen-Karre zu Schrott
Ex-Formel-1-Fahrer und Sauber-Pilot Adrian Sutil (37) baut in Monaco mit seinem 1,4 Millionen Schweizer Franken teuren Supersportwagen einen Unfall.
Adrian Sutil bestritt zwischen 2007 und 2014 128 GP-Starts in der Formel 1. Nun hat der Deutsche, ehemalige Sauber-Fahrer in Monaco seinen nagelneuen McLaren Senna LM gegen einen Laternenmast gefahren – Das Hypercar ist schrottreif. Eigentlich sollte man meinen er kenne die Strassen in Monaco, fuhr er doch 2013 genau dort mit Platz fünf sein bestes Ergebnis in der Königsklasse ein.
Beim geschrotteten Supersportwagen handelt es sich um ein besonderes Exemplar. Das Fahrzeug ist nach der verstorbenen Formel-1-Legende Ayrton Senna benannt. Das im Frühjahr erschienene Modell ist insgesamt nur 24-Mal ausgeliefert worden. In der Farbe «Papaya Orange», wie ihn Sutil fährt, gibt es den 800-PS-Boliden sogar nur sechsmal. Querlenker und Auspuffspitzen der Luxus-Karosse sind vergoldet. Insgesamt bringt es der Supersportler mit all den Extras auf einen Wert von umgerechnet 1,4 Millionen Schweizer Franken. Ein teurer Spass, der jäh endet.
Während am Wagen ein Totalschaden zu vermelden ist, hat der 37-Jährige Glück im Unglück und trägt keine schweren Verletzungen davon. Schreibt Blick.
Einer der üblichen Clickbaiting-Teaser, wie sie das Sommerloch täglich Millionenfach worldwide live in die mediale Aufmerksamkeit befördert. Eine reisserische Überschrift («Schreckmoment») erzeugt Neugierde, die jedoch vom kärglichen Inhalt nicht befriedigt wird. Called Clickbaiting.
So wird zum Beispiel Sutils «Schreckmoment» aus der Headline überhaupt nicht thematisiert und die Deutung den Leserinnen und Lesern überlassen. Hat er gar in die Hosen geschissen? Das wäre zwar nicht unbedingt appetitlich, aber immerhin eine Schlagzeile wert.
Was Blick kann, kann auch der AVZ. :)
-
29.7.2020 - Tag der Endstation
BLICK-Leser muss wegen Militärübung Reuss verlassen: Armee verdirbt Böötlern den Badespass
Sonne, Hitze und Ferien – ideale Voraussetzungen für eine Abkühlung. Doch wer in der Reuss baden gehen will, könnte in diesen Tagen eine böse Überraschung erleben. Rekruten der Genietruppen bauen dort gerade eine Brücke. Für Böötler heisst es Endstation. Ein BLICK-Leserreporter berichtet von einer Militärübung in der Nähe der Ortschaft Obfelden ZH. Dort seien Rekruten dabei, eine Brücke zu bauen.
«In der 1.-August-Sommerferienwoche mit höchster Sommerhitze eine solche Übung durchzuführen, ist wohl nicht der geschickteste Zeitpunkt», sagt der 44-jährige Familienvater zu BLICK.
«Das hat die Leute grausam genervt»
Der Leserreporter war am Dienstagnachmittag mit seiner Familie auf der Reuss unterwegs – mit Stand-up-Paddle und Gummiboot. Plötzlich musste die fünfköpfige Familie das Wasser verlassen.
«Das Militär schickt die Böötler aus der Reuss und lässt sie barfuss über einen Kiesweg rund 600 Meter am Ufer entlanglaufen», sagt er. «Das hat die Leute grausam genervt.» Immerhin: Weiter unten durften die Böötler wieder ins Wasser.
«Die Rekruten müssen lernen, wie man eine Brücke baut»
Armeesprecher Daniel Reist hat Verständnis für den Unmut der Badegäste. Aber: «Momentan findet die Sommer-Rekrutenschule statt und die hat eben ihr Programm», sagt er zu BLICK. «Die Rekruten müssen lernen, wie man eine Brücke baut.»
Wenn immer möglich, versuche man solche Übungen auch zum Wohl der Bevölkerung zu verschieben, sagt Reist. Das gehe aber nicht immer. Zur genauen Übung konnte Reist keine Auskunft geben. Solche Übungen seien aber nur an bestimmten Orten möglich, die extra dafür vorbereitet wurden. Schreibt Blick.
Das hat die Schweizer Armee sehr gut gemacht! Für Blick-Leser sollte sowieso generell und überall Endstation sein. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Worldwide. Live.
-
28.7.2020 - Tag der Downhill-Racer
SVP-Präsidium: Findungskommission will Franz Grüter doch noch von einer Kandidatur überzeugen
Wird Alfred Heer bald SVP-Präsident? Am Sonntag spielte sich im «SonnTalk» auf «TeleZüri» folgender Dialog ab zwischen Moderator Oliver Steffen und Gast Heer:
Oliver Steffen: Ist Deine Lust der Woche vielleicht, dass die Chancen mit jedem Tag steigen, SVP-Präsident zu werden?
Alfred Heer: Das weiss ich nicht. Da musst Du die Findungskommission fragen. Ich bin nicht zuständig dafür, wer Präsident wird.
Steffen: Aber nach den vielen Absagen ...
Heer: Ja, gut. Sie werden so lange suchen, bis sie einen anderen finden. Die Gefahr ist relativ klein.
Ein Misstrauensvotum gegen Heer und Glarner?
Diese Aussagen bringen die Stimmung bei den Nationalräten Alfred Heer (ZH) und Andreas Glarner (AG), den einzigen Kandidaten für das SVP-Präsidium, auf den Punkt. Heer wie Glarner spüren, dass die Findungskommission weitersucht. Sie empfinden das als Misstrauensvotum.
Als in der Sommersession plötzlich der Name von Nationalrätin Martina Bircher als neue Kandidatin auftauchte, waren Heer wie Glarner versucht, den Bettel hinzuschmeissen. Sie machten aber doch weiter.
Nach der Absage von Bircher will die Findungskommission nun nochmals das Gespräch mit Nationalrat Franz Grüter suchen. Quellen bestätigen das. Grüter hat die SVP des Kantons Luzern als Präsident wieder aufgebaut und dabei viele Ortssektionen gegründet.
Schon Ueli Maurer versuchte Grüter zu überzeugen
Grüters Name stand schon mehrfach zur Diskussion für das Präsidium. Selbst Bundesrat Ueli Maurer hat den Luzerner SVP-Nationalrat schon von einer Kandidatur zu überzeugen versucht. Bisher blieb Grüter stets hart und sagte Nein. Er prägt die Green-Gruppe, die er mit seinem Bruder gegründet hat, als Verwaltungsratspräsident noch immer stark mit.
Der Findungskommission gefällt es, wie Grüter die Luzerner SVP geführt hat. Sie hegt eine gewisse Hoffnung, dass sich der Nationalrat doch noch freischaufeln und sie ihn damit zu einer Kandidatur bewegen kann.
Die SVP hat Grüter bereits enger eingebunden. Ende März teilte die Parteileitung mit, der Luzerner Nationalrat sei per sofort Stabschef und nehme mit beratender Stimme Einsitz im Parteileitungsausschuss, dem zentralen Führungsgremium der SVP. Als Stabschef ist Grüter für die Kantone zuständig. Er hat in seiner neuen Funktion schon einzelne Kantone besucht.
Grüter: «Präsidium ist für mich kein Thema»
Mit ihm habe in den letzten Tagen niemand von der Findungskommission gesprochen, sagt Franz Grüter selbst. Er weilt zurzeit in den Ferien. «Das Präsidium ist für mich nach wie vor kein Thema», betont er. «Ich bin bei der Green-Gruppe noch immer stark engagiert.»
Zurzeit bleiben Glarner und Heer somit die einzigen Kandidaten für den Präsidentenposten der SVP. Insider sagen, die Findungskommission möchte dem Parteileitungsausschuss aber drei Kandidaten für den Präsidentenposten präsentieren können.
Die Befürchtung, dass Glarner Heer im Duell schlägt
Es existieren aber offenbar auch Befürchtungen, dass Glarner eine Ausmarchung gegen Heer am 22. August vor den SVP-Delegierten in Brugg gewinnen würde. So, wie er den Kampf um das Präsidium der SVP des Kantons Aargau gewann.
Nationalrat Glarner war als klarer Aussenseiter in die Ausmarchung mit Grossrat Rolf Jäggi gestiegen, schlug ihn aber dank einer «Brandrede» vor den Delegierten deutlich.
Das könnte sich wiederholen. Auch weil es in der Findungskommission so aussah, dass Glarners Motivation, SVP-Präsident zu werden, höher sei als jene von Heer. Damit hätte die SVP einen Präsidenten, der sehr stark provoziert und polarisiert. Schreibt das Zofinger Tagblatt.
Franz Grüter ist nicht nur ein hervorragender Politiker, sondern auch ein ebenso herausragender Unternehmer. Doch leider ist er in der falschen Partei. Das ist unisono die Meinung, wann immer man jemanden über Franz Grüter befragt. Wie aus der Pistole geschossen tönt es einhellig «Guter Mann, aber in der falschen Partei».
Kommt erschwerend hinzu, dass Parteien dazu neigen, nicht die Besten sondern die Krassesten aufs Podest zu hieven. Vor allem dann, wenn sie sich in der Wählergunst im Schnellzugtempo wie bei einem Abfahrtsrennen über die Minsch-Kante downhill bewegen. Was bei der guten alten Tante SVP derzeit der Fall ist.
-
27.7.2020 - Tag der Plattitüden
Gerichtspsychiater Frank Urbaniok (57) über menschliches Verhalten während der Pandemie: «Wirtschaftshooligans ignorieren die Fakten»
Der bekannteste Schweizer Gerichtspsychiater, Frank Urbaniok (57), hat ein Buch über die Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre schädlichen Nebenwirkungen geschrieben. Der selbständige Gutachter und Berater ist überzeugt, dass wir der Pandemie Herr werden können.
Der bekannteste Schweizer Gerichtsgutachter beschäftigt sich nicht nur mit gefährlichen Straftätern. In seinem neusten Buch analysiert Frank Urbaniok (57) gesellschaftliche Fehlentwicklungen. In diesem Zusammenhang befasst er sich auch mit den Auswirkungen der Corona-Krise und deren Bewältigung. Er sieht die Gefahr, dass bei den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen vor allem die kleinen Leute auf der Strecke bleiben. Schreibt Blick.
Ein spannendes Interview, das zu lesen sich lohnt. Allerdings auch mit Plattitüden vermischt, die zwar gut tönen, von Frank Urbaniok aber nicht erwartet werden: «Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht umgekehrt.» Etwas arg plump und unvollständig. Ergibt im Umkehrschluss keinen Sinn. Wären die Menschen nicht für die Wirtschaft da, gäbe es auch keine Wirtschaft. Menschen und Wirtschaft gehören zusammen wie siamesische Zwillinge. Kant hätte es vermutlich anders und besser formuliert: «Wenn wir die Ziele wollen, wollen wir auch die Mittel.»
-
26.7.2020 - Tag der Hoffnung
Alina Buchschacher brachte vor acht Monaten Sohn Noah zur Welt: «Ich bin fürs Muttersein geschaffen»
Eigentlich wollten Alina Buchschacher (29) und ihr Freund Fabien Papini (27) im letzten Frühsommer auf einen grossen Trip durch Europa aufbrechen. Die Jobs waren gekündigt, alles bereit für eine längere Zeit im Ausland. Doch dann machte die Schwangerschaft der Miss Schweiz von 2011 den Plänen des Paars einen Strich durch die Rechnung. Bereut haben sie das nie.
Seit der Geburt von Noah sind mittlerweile acht Monate vergangen. Die kleine Familie lebt gemeinsam mit Hund Onyx und den Katzen Mambo und Baghira in Bern. Alina Buchschacher geniesst diese Zeit. «Ich bin fürs Muttersein geschaffen», sagt sie mit Stolz in der Stimme. «Ein Kind zur Welt zu bringen, ist das Schönste, was ich je erleben durfte.» Sie sei von den grossen Emotionen überrascht gewesen, die sie für Noah nach der schnellen und komplikationsfreien Geburt verspürte. «Das Gefühl ist viel grösser, als was ich von Partner oder Eltern kannte. Diese bedingungslose Liebe hat mich umgehauen.»
An ihre neue Rolle als Mama hat sich die Bernerin schnell gewöhnt. Corona habe ihr dabei in die Hände gespielt. «Mein Mutterschaftsurlaub war kurz vor dem Lockdown zu Ende. So hatten wir noch einige Wochen mehr, um unser neues Familienleben zu geniessen. Es war sehr intim, ohne Besuche von Freunden und Familie.»
Genug Zeit, um das eigene Baby näher kennenzulernen. «Noah ist ein richtiges Energiebündel – aufgeweckt und aufmerksam. Und er hat einen grosser Charakter», schwärmt die Betriebswirtschafterin. Und fügt schmunzelnd an: «Das kann streng werden, wenn er älter ist.»
Eine Hochzeit des Paars ist nicht geplant. «Fabien hat die Frage noch nicht gestellt», sagt Buchschacher. Auch ein Geschwisterchen für Noah ist nicht auf dem Weg. «Ich sagte zwar immer, dass ich zwei, drei Kinder haben will. Aber da können wir uns momentan noch Zeit lassen.»
Jetzt konzentrieren sich die beiden auf die schöne Zeit mit dem kleinen Noah. «Ein Kind zu haben, ändert die Sichtweise auf alles», sagt sie. «Noah hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben.» Schreibt SonntagsBlick.
Das ist doch mal eine Promi-Geschichte für den Sonntag, die sich zu lesen lohnt. Sätze wie «Noah hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben» beweisen, dass es doch noch Hoffnung für zukünftige Generationen gibt. Energiebündel mit grossem Charakter wie Noah werden es richten! Alles Gute Noah. Bleib stark!
-
25.7.2020 - Tag des Volchsmundes
SVP-Präsidium: Die einzige Frau zieht sich zurück – bekommt jetzt Glarner seine Kampfwahl gegen Heer?
Die Aargauer Nationalrätin Martina Bircher verzichtet wegen ihres zweijährigen Sohnes auf eine Kandidatur. Damit könnte es zur Wahl kommen zwischen Andreas Glarner und Alfred Heer. Es wäre die erste Kampfwahl in der Geschichte der SVP.
Einen Moment lang sah es so aus, als ob in der SVP historisches passieren könnte. Martina Bircher, die 36-jährige Nationalrats-Newcomerin aus dem Aargau, schien auf dem Weg, die erste Präsidentin der grössten Partei der Schweiz zu werden.
Daraus wird wohl nichts. Bereits vor knapp drei Wochen hat Bircher der Findungskommission eine Absage für eine Kandidatur als SVP-Präsidentin erteilt. Sie sei erst seit sieben Monaten im Nationalrat und damit zu wenig erfahren, argumentierte sie. Vor allem aber führte sie ihren zweijährigen Sohn James-Henry als Hinderungsgrund für eine Kandidatur an, wie Informationen der «Schweiz am Wochenende» zeigen.
Findungskommission reagierte enttäuscht auf Absage
Eine hochrangige Quelle bestätigt die Absage. Die Findungskommission nahm sie enttäuscht zur Kenntnis. Sie hätte dem Parteileitungsausschuss gerne auch eine Frau als potenzielle Nachfolgerin von Albert Rösti präsentiert – weil es noch nie eine SVP-Präsidentin gab.
Damit zeichnet sich an der Delegiertenversammlung der SVP vom 22. August in Brugg ein Duell ab zwischen den Nationalräten Andreas Glarner (57, AG) und Alfred Heer (58, ZH). Sie sind übrig geblieben nach den acht Anhörungen, welche die Findungskommission geführt hat. An ihrer nächsten Sitzung wird sie noch weitere Kandidaturen erwägen.
Eine neue Generation von SVP-Vertretern
Die Absage von Martina Bircher hat sich abgezeichnet. Die Aargauerin gehört zur neuen Generation der SVP-Vertreter. Ihr sind Familienaspekte zentral. Bircher teilt sich die Betreuung ihres Sohnes James-Henry mit ihrem Partner auf. Zwei Tage pro Woche betreut sie ihn, einen Tag ihr Partner – und zwei Tage verbringt er in der Kita. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wie der Volksmund so schön sagt, der bei der SVP ja so etwas wie Verfassungscharakter hat, schwimmt Fett stets obenauf. Da ist es wirklich nur schwer zu verstehen, dass das Pummelchen Bircher, die in Bezug auf Dumpfbackensprüche (vorwiegend gegen Arbeitslose und Sozialhilfe-Empfänger) dem Dummschwätzer Glarner in Nichts nachsteht, auf die Kandidatur verzichtet. Eine Doppelspitze Birchermüesli/Glarner Zigerkrapfen hätte wenigstens für einen gewissen Unterhaltungswert – befreit von jeglichem Intellekt – gesorgt.
Glarner als alleiniger Präsident der SVP ist für die Partei allerdings ein grosses Risiko. Denn getreu seinem Muster «zuerst handeln und erst danach das Hirn einschalten» ist der Dummschwätzer durchaus in der Lage, den roten Knopf zu drücken und die SVP in die Luft zu sprengen. Seine inzwischen zum Ritual gewordene Entschuldigung auf der Facebook-Seite «am Tage danach» nützt dann den Gläubigen der Schweizer «Volchspartei» (Originalslang vom Herrliberg) auch nichts mehr. Futsch ist futsch.
Who cares? Shit happens, wie der amerikanische Volksmund sagt, und der Verlust dieser «bürgerlichen» Sekte würde sich in überschaubaren Grenzen halten. Mag sein, dass Parmesans Waadtländer Weinbauern die Trauerkleidung hervorholen würden. Doch selbst das wäre vernachlässigbar und der Bund würde erst noch Geld sparen. Womit die Linken und Netten (ebenfalls Originalslang vom Herrliberg) endlich genderverträgliche Haarwuchstabletten sozial gerecht fördern könnten.
Ende gut, alles gut.
Sollten Sie in diesem Kommentar einen Schreibfehler finden, dürfen Sie ihn behalten.
-
24.7.2020 - Tag der üppigen Ruhestandsregelungen
300'000 Franken Entschädigung: Auch im Aargau erhalten etwa Susanne Hochuli oder Franziska Roth Ruhegehälter
Christoph Blocher fordert vom Bund 2,8 Mio. Franken Ruhegehalt. Die meisten Kantone haben solche teuren und lebenslangen Renten für abtretende Politiker längst gestrichen. Zum Beispiel Luzern, St. Gallen oder Thurgau.
So weich gebettet möchte manch einer in den Ruhestand gleiten: Eben hat der Solothurner Regierungsrat Roland Fürst angekündigt, 2021 nicht mehr zu den Wahlen anzutreten. Fürst wird dann 60 sein.
Um Geld muss er sich auch ohne Job nie mehr Sorgen machen: Nach acht Amtsjahren hat er Anspruch auf eine Übergangsrente: Fast 160'000 Franken jährlich erhält er vom Steuerzahler bis zur ordentlichen Pension, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird.
Der fürstliche Batzen wird nur gekürzt, wenn der CVPler mit der Rente und einem allfälligen neuen Job mehr verdient als heute. CVP-Mann Fürst ist kein Einzelfall: In fast jedem Kanton gibt es scheidende Regierungsräte, die auf die 60 zugehen, Überbrückungshilfen.
Politiker haben damit ein Privileg, das kein Bürger hat: Das nationale Parlament hat zwar eben erst eine Überbrückungsrente für Arbeitslose über 60 beschlossen. Um diese zu erhalten, muss jemand aber vor dem Gang zum Sozialamt stehen. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Die Apologeten der radikalen Marktwirtschaft aus den Kreisen der üblichen Verdächtigen von SVP, FDP, CVP, GLP und hinter vorgehalter Hand auch von SP (Daniel Jositsch, um nur einen Namen zu nennen) und den Grüninnen und Grünen, werden nicht müde, gebetsmühlenartig zu betonen, dass der Staat kein guter Unternehmer ist. In mancher Hinsicht stimmt das sogar, wie Christoph Eisenring in einem klugen Artikel, bezogen auf die deutsche Industriepolitik, beschreibt.
Warum das so ist, geht aus dem Artikel ebenfalls hervor: Es liegt vor allem an den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern selbst, die mehr oder weniger jedes staatliche Industrieprojekt mit Partei-Interessen und persönlicher Vorteilsnahme derart belasten und überlagern, dass ein Scheitern vorprogrammiert ist.
Geht es aber um die persönliche Plünderung des Staates mit völlig überzogenen Übergangsrenten und Pensionen, herrscht unter sämtlichen Schweizer Parteien Konsens, dass es sich hier um angemessene und rechtmässige Forderungen handelt.
De jure mag das ja stimmen, de facto zeigt es, wie abgehoben und fern jeglicher Realität die Politeliten querbeet durch alle Parteien ticken.
Urteilen Sie selbst: Wie viele Menschen kennen Sie persönlich, die pro Jahr als Angestellte eines mittleren Unternehmens 250'000 Franken Salär und mehr beziehen? Vermutlich geht es Ihnen wie mir: Sie können diese Personen an einer Hand abzählen.
Wird die Frage jedoch ausgeweitet auf Kommunalpolitiker wie zum Beispiel Stadträte oder Regierungsräte, macht sich die Inflation breit. Bei dreistelligen (Aktive) bis zu vierstelligen Zahlen (Pensionierte und Abgewählte mit entsprechenden Dienstjahren) genügen nicht mal beide Hände und Füsse zusammen für die bildliche Darstellung.
Da braucht man sich über Politikverdrossenheit und Zerfall der Demokratie nicht zu wundern. Wahlbeteiligungen an den Urnen um die 40 Prozent – wenn überhaupt – sprechen ihre eigene Sprache als zuverlässige Seismometer für den Zustand einer Gesellschaft.
-
23.7.2020 - Tag des vorsintflutlichen SVP-Trolls
Lehrabgänger angeprangert: Aldi versetzt Glarner noch einen Seitenhieb
Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner ist in einen ordentlichen Fettnapf getreten. Nach seinem Internetpranger für Lehrabgänger aus Perlen legt Aldi nun nochmals nach.
Die Reaktionen auf Andreas Glarners Facebook-Post waren gewaltig. Von vielen Seiten wurde der SVP-Nationalrat scharf kritisiert, weil er die Namen von Aldi-Lehrabgängern in Perlen ins Netz gestellt. Sein Ziel: Er wollte auf die «Überfremdung» der Schweiz aufmerksam machen. Dabei sei gerade dieser Abschluss ein Zeichen gelungener Integration, so die Kritik (zentralplus berichtete). Nicht nur Facebook-Nutzer, auch Parteikollege Roger Köppel meldete sich online zu Wort.
Die Junge SVP Luzern distanzierte sich noch am Dienstag von Glarners Aussagen. Sie gratuliert den Lehrabgängern vielmehr und versprach sogar, ihnen ein «Präsent» zukommen zu lassen.
Von Andreas bis Zade…
Aldi selbst nahm den Internetpranger gelassen. «Wir freuen uns über die mittlerweile mehr als 1800 verdienten Glückwünsche, die unsere Lernenden seitdem unter dem Post erhalten haben», so die neckische Antwort.
Nun legte das Unternehmen sogar noch nach. «Wir sind stolz auf jede einzelne der 450 Lehrabgängerinnen, die seit Markteintritt bei uns erfolgreich ins Berufsleben gestartet sind», schreibt Aldi auf Twitter.
Damit nicht genug. Dem Post ist ein Gratulations-Bild beigefügt, auf dem steht: «Von Andreas bis Zade – Bereits 450 junge Erwachsene sind bei uns erfolgreich ins Berufsleben gestartet!» Ein Seitenhieb gegen Glarner. Und was sagt der dazu? «Ich finde es eine sehr witzige und humorvolle Aktion», sagt er zu «20 Minuten». Schreibt ZentralPlus.
Glarner, den man laut Urteil des Aargauer Obergerichts straflos einen (infantilen) «Dummschwätzer» nennen darf, kann sich darauf verlassen, dass sein täglicher Bullshit, den er in seiner erbärmlichen Echokammer auf Facebook für seine getreuen Sonderlinge absondert, von wirklich allen Empörungsmedien übernommen wird.
Würden diese Medien endlich checken, dass sie nichts anderes als willfährige Durchlauferhitzer für Glarners Sondermüll sind und auf die Weiterverbreitung von Facebook-Schrott eines Mannes verzichten, bei dem man längst nicht mehr sicher ist, ob er wirklich noch alle Tassen im Schrank hat, würde kein Hahn über Glarners stupide Provokationen auch nur einen einzigen Krächzer abgeben.
Seien wir doch mal ehrlich: Glarners ewig gleiches Drehbuch zu seiner vermutlich ebenso persönlichen wie perversen Befriedigung folgt stets dem gleichen Ablauf in zwei Schritten: Schritt eins besteht aus provokativer Konfrontation. In Schritt zwei folgt Glarners Entschuldigung.
Ein aufrechter Mann, den der vorsintflutliche Troll der Aargauer SVP darzustellen versucht, muss sich niemals oder höchstens im Ausnahmefall für seine Statements und Veröffentlichungen entschuldigen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass alles, was dieser nicht wirklich begnadete Provokateur von sich gibt, am nächsten Tag als obsolet erklärt wird. Von ihm selbst, wohlverstanden.
Na denn Prost auf einen Schweizer SVP-Präsidenten, der charakterliche Eigenschaften mit sich rumschleppt, die wohl für jeden Psychiater sowas wie ein Leckerbissen wären.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.7.2020 - Tag der Ausschaffungen und Abschaffungen
So unterschiedlich schaffen die Kantone kriminelle Ausländer aus
Luzern setzt den Volkswillen um: 54 Verurteilungen, die einen Landesverweis rechtfertigen, führten zu 49 Ausschaffungen – macht eine Quote von 90 Prozent. Doch nicht alle Kantone wenden die rechtliche Umsetzung der Ausschaffungs-Initiative so strikt an. Schreibt Blick.
Wow! Wie sagte schon Giuseppe di Malaparte? «Luzern war der Menschheit schon immer einen Schritt voraus.» Auf den ersten Blick stimmt das absolut in Bezug auf die hervorragende Ausschaffungsquote krimineller Ausländer Luzerns. Doch ein zweiter Blick offenbart eine brutale Ernüchterung. Bei den Ausgeschafften, die in der Regel mit Landesverweis auf eine bestimmte Anzahl von Jahren belegt werden, handelt es sich vorwiegend um Kleinkriminelle wie Taschendiebe, Trickdiebe, Einbrecher und Opferstock-Knacker aus den Balkanstaaten. Rumänien und Kosovo führen diese Länderliste an. Tatsache aber ist, dass die Ausgeschafften ein paar Wochen später trotz Landesverweis mit Einreiseverbot wieder in der Innerschweiz anzutreffen sind. Das bestätigt beinahe jeder Innerschweizer Polizist. Wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand. Ausschaffung krimineller Ausländer mit Landesverweis und offene Grenzen widersprechen sich nun mal diametral. Kurz und bündig: Mission impossible.
Zu wenig Patienten: Arztpraxis von Herzspezialist wegen Corona Konkurs
Die Coronakrise hat ihr erstes Opfer unter den Gesundheitsversorgern im Aargau gefordert: Die Herzpraxis Oftringen-Aarburg AG hat per 14. Juli Konkurs angemeldet. Die Praxis war erst am 2. März eröffnet worden; in den Räumen des ehemaligen Blumengeschäfts von Gemeindeammann Hanspeter Schläfli an der Oftringer Baslerstrasse. Eine Woche darauf zeigte sich Praxisinhaber Firas Aldebssi im «Zofinger Tagblatt» noch glücklich darüber, in Oftringen den gesamten nichtoperativen Bereich der Kardiologie abdecken zu können. «Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit mit allen meinen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen», liess er sich zitieren.
Die Herzpraxis als Start-up traf dies im allerdümmsten Moment. «Bei einer Facharztpraxis für Kardiologie ist man komplett auf hausärztliche Zuweisungen angewiesen, da Patienten in der Regel nicht direkt zu Fachärzten gehen», erklärt der Praxisinhaber. Durch den Lockdown, angeordnet bloss zwei Wochen nach Eröffnung der Oftringer Herzpraxis, hatten sämtliche Hausarztpraxen für längere Zeit massiv weniger Patienten und enorme Umsatzeinbrüche.
«Eine auf Hausärzte angewiesene und vor allem neu eröffnete Facharztpraxis hat unter den Umständen praktisch keine Überlebenschance», konstatiert Aldebssi, der zuletzt Oberarzt in zwei Solothurner Spitälern war. «Auch nach schrittweiser Lockerung der Massnahmen blieben die meisten Patienten aus Angst zu Hause: Herzpatienten sind im Schnitt 60 bis 70 Jahre alt, also zur Hochrisiko-Gruppe gehörende Personen, die sich lange nicht mehr zu Ärzten trauen. Die Lage bleibt für diese Patienten nach wie vor angespannt, auch in Bezug auf eine mögliche zweite Welle.»
Der Arzt sagt, man habe alles Mögliche probiert, um die Herzpraxis zu retten. Kurzarbeit, die andere Praxen im Aargau gerettet hat, sei nicht möglich gewesen, weil die AG erst gerade gegründet worden war. Dass er als Belegarzt in der Privatklinik «Villa im Park» gemeldet ist, bringt ihm nichts, weil er dort auch eigene Patienten mitbringen müsste – und diese blieben aus.
«Die wirtschaftliche Lage hat das Weiterführen der Praxis nicht mehr erlaubt. Daher habe ich selbst die Insolvenz über die AG beantragt», erklärt Firas Aldebssi, der neben seinen Facharzttiteln (Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie) auch eine Ausbildung zum Gesundheitsökonomen hat.
Patienten, die die Herzpraxis seit März besucht haben, müssen nichts unternehmen; medizinische Berichte seien an die Hausärzte verschickt und die Akten elektronisch gemäss gesetzlicher Vorschrift gesichert worden. Schreit die Aargauer Zeitung.
Man kann die Corona-Epidemie für vieles verantwortlich machen, keine Frage. Doch im Umkehrschluss könnte sie auch eine bereinigende Wirkung haben. Wer mit offenen Augen durch etwas grössere Ortschaften als Oftringen oder Aarburg wandert, wird sehr schnell feststellen, dass sich inzwischen an beinahe jeder zweiten Ecke eine Arztpraxis an bester Lage eingenistet hat. Vorzugsweise Herzspezialisten, deren Kundenpotenzial dank der Hochrisikogruppe der 60- bis 70-Jährigen beinahe unerschöpflich ist, wie der Artikel richtigerweise feststellt. Wenn nun die Corona-Krise dazu beiträgt, das schon fast bis zur Unbezahlbarkeit aufgeblähte Gesundheitssystem zu verschlanken, kann man das nur begrüssen. Sterben wird deswegen niemand. Oder, etwas fatalistisch ausgedrückt: Vielleicht schlägt der Sense Mann ein paar Tage oder Monate früher zu, auf die es aber nun wirklich nicht mehr ankommt. Hier spricht der Verfasser aus eigenen, schmerzlichen Erfahrungen.
-
20.7.2020 - Tag der Sommerausflüge
Sommerhighlight für Gipfelstürmer: Erleben Sie den Säntis von seiner schönsten Seite
Im Osten der Schweiz thront er über der Bodenseeregion – der Säntis. Der Hausberg im Appenzellerland mit einer Höhe von 2502 Metern über Meer ist das perfekte Ausflugsziel für Wanderer, Entdecker und Geniesser. Schon die zehnminütige Fahrt mit der Schwebebahn von der Talstation Schwägalp hinauf zum Säntis hat etwas magisches. Oftmals bricht sie durch das Nebelmeer und legt den Blick frei auf ein einmaliges Bergpanorama und eine Aussicht, die es so in der Schweiz kein zweites Mal gibt. Vom Gipfel aus hat man den Rundumblick über die Bodenseeregion und sechs Länder – die Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Frankreich und Italien.
Die Region Säntis-Schwägalp lädt die Besucher ein zum Wandern, Walken oder Biken, vom gemütlichen Spaziergang bis hin zum anspruchsvollen Gipfel-Trekking für erfahrene Wanderer. Neben einmaliger Natur und frischer Bergluft bietet die Region rund um den Säntis auch alles für kleine und grosse Entdecker. Eine Alpschaukäserei, den Geologie-Steinpark und den Natur-Erlebnispark direkt vor der Haustüre. Auf dem Gipfel erwarten Sie zwei Erlebniswelten: «Säntis – der Wetterberg» und «Säntis – die Eiswelt». Erfahren Sie interaktiv viel Wissenswertes und Spannendes zu diesen beiden Themen. Schreibt Blick und präsentiert gleichzeitig ein Super-Spezialangebot.
Auch wenn es sich beim Artikel um einen bezahlten Promo-Auftrag handelt, kann man sowohl dem Inhalt des Geschriebenen wie auch dem tollen Spezialangebot nur beipflichten. Die Gegend rund um den Säntis lohnt sich immer für einen Ausflug. In Zeiten wie diesen sogar noch mehr.
-
19.7.2020 - Tag der Murmeltiere
Chefarzt Pietro Vernazza schlägt Durchseuchung der Schweiz vor
Pietro Vernazza hinterfragt in der Sonntagspresse die Corona-Strategie des Bundes. Das Virus sei weniger gefährlich als gedacht.
«Man könnte die Schutzmassnahmen in der breiten Bevölkerung reduzieren, damit die junge Bevölkerung nach und nach mit dem Virus in Kontakt kommt.» Diesen brisanten Vorschlag macht Pietro Vernazza, Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen, in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» (Artikel ist kostenpflichtig). Die ältere Bevölkerung soll hingegen besser geschützt werden. Er sieht eine solche Durchseuchung als Alternative zur Strategie des Bundesrats. Dabei stützt er sich auf Studien aus dem Tessin, Spanien und der USA, wonach zehnmal mehr Menschen mit dem Virus infiziert wurden, als tatsächlich diagnostiziert. «Das Virus scheint weniger gefährlich als gemeinhin vermutet», sagt Vernazza. Die Sterblichkeit der Infizierten sei weniger hoch als zunächst befürchtet.
Zwar ist der Infektiologe «zufrieden» mit dem, was die Schweiz bisher erreicht hat. Den Fahrplan des Bundesrates nennt er aber «ambitiös» und er müsse überdenkt werden. Einerseits sei es aufwendig, die hohen Sicherheitsmassnahmen über Monate oder Jahre durchzusetzen. Seinen Angaben zufolge werden pro Monat 40 Millionen Franken für Coronatests ausgegeben, für die Quarantänemassnahmen sind es 10 Millionen Franken.
«Die in Schweden haben nichts falsch gemacht»
Andererseits hat er Zweifel in Sachen Impfung. Diese bringe nur etwas, wenn der Grossteil der Bevölkerung mitmache. Nicht nur Risikopatienten müssten sich impfen lassen, sondern auch junge Menschen aus Solidarität zu den Alten. Es bestehe die Wahrscheinlichkeit, dass die «Impfung bei älteren Menschen kaum nützt».
Auch zur viel kritisierten Corona-Strategie von Schweden äussert sich Vernazza. «Die in Schweden haben nichts falsch gemacht», sagt er. Schliesslich gehen auch dort die Fallzahlen linear zurück. Er würde «bedenkenlos» im nordeuropäischen Land Ferien machen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man aber noch nicht sagen, welche Strategie – die der Schweiz oder die von Schweden – besser ist. Schreibt 20Minuten.
Und täglich grüsst das Murmeltier.
-
18.7.2020 - Tag der Parallelgesellschaften
Luzerner Kantonsrat kritisiert Missstände bei den Billig-Coiffeuren: Mit mehr Kontrollen gegen schwarze Schafe
Trotz Corona-Lockdown sind die Meldungen wegen vermuteter Schwarzarbeit in Luzerner Coiffeursalons deutlich angestiegen. Der Kanton soll aktiver werden und gezielte Razzien ins Auge fassen, fordern Politiker. Ein Haarschnitt für weniger als 25 Franken? Mit solchen Preisen werben einige Salons Kunden an. Nicht immer erfüllen die Billiganbieter aber die Auflagen. Bereits vor rund einem Jahr sorgte das für Schlagzeilen (zentralplus berichtete).
Doch verbessert hat sich offenbar wenig. Das findet jedenfalls CVP-Kantonsrat Daniel Piazza: «Mir fällt auf, dass in der Stadt und der Agglomeration Luzern sowie mehr und mehr auch auf dem Land teilweise explosionsartig neue Coiffeurbetriebe eröffnet werden, häufig Barbershops.» Das wäre an sich noch kein Problem. Aber: «In den Betrieben werden vor allem Einheitshaarschnitte mit der Maschine zu Dumpingpreisen angeboten», so der Politiker aus Malters.
Die Rechtschaffenen sind die Geprellten
Er wolle die Barbershops keinesfalls unter Generalverdacht stellen, versichert Piazza. «Aber es hat mit Sicherheit auch unter den neu eröffneten Barbershops einige schwarze Schafe.»
Er verlangt darum in einem Postulat, dass die Behörden die Missstände in der Branche aktiv bekämpfen. Gemeint sind insbesondere Schwarzarbeit, fehlende Sozialversicherungsbeiträge oder die Anstellung von Ausländern, die gar nicht hier arbeiten dürften. Unterzeichnet haben den Vorstoss auch Vertreter der SVP und der FDP.
«Der Kanton muss etwas unternehmen», verlangt Piazza. «Ansonsten sind die rechtschaffenen Coiffeure die Geprellten.» Das habe er im Austausch mit Branchenvertretern oft bestätigt bekommen.
Zwei von drei kontrollierten Salons fallen auf
Mehr Kontrollen – und zwar auch Überraschungskontrollen – kündigte bereits vor einem Jahr die Paritätische Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe (PK Coiffure) an. Hat das nichts gebracht? Diese Frage lässt sich noch nicht beantworten; denn ein aussagekräftiges Fazit lasse sich erst Ende Jahr ziehen, sagt Claudia Hablützel, Leiterin der Geschäftsstelle.
Die 2019 durchgeführten und abgeschlossenen Verfahren legen allerdings nahe, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht. Bei rund zwei Dritteln der 168 Betriebe und rund der Hälfte der gut 700 kontrollierten Mitarbeitenden wurden laut Hablützel Abweichungen festgestellt. «Diese reichten von Bagatellen bis zu groben Abweichungen.»
Der Region am Vierwaldstättersee stellt Hablützel ein vergleichsweise gutes Zeugnis aus: «Die Zentralschweiz hatte eine geringere Verfehlungsquote als der Durchschnitt.» Konkret lagen bei rund der Hälfte der 20 Überraschungskontrollen Abweichungen vor oder mussten Unterlagen nachgefordert werden.
Noch schnell einen Vertrag abschliessen
Nach oben zeigt die Tendenz bei der Schwarzarbeit. «Im Vergleich zum 2018 sowie 2019 ist im 2020 – trotz temporärem Berufsverbot der Coiffeurbranche – bereits jetzt eine erhöhte Melde- sowie Kontrolltätigkeit zu verzeichnen», sagt Lea Marberger, Teamleiterin bei WAS Wira Luzern. Wurden 2018 lediglich 3 Verdachtsmeldungen registriert, waren es letztes Jahr 20 – und im laufenden Jahr bereits Mitte Juli deren 17.
Claudia Hablützel von der PK Coiffeure erwartet vorerst ebenfalls einen weiteren Anstieg der Verfehlungen. Denn auch 2020 wird – trotz Covid 19 – die Kontrolldichte möglichst hoch gehalten. Und: «Viele Betriebe können sich nicht mehr auf die Kontrolle vorbereiten, indem sie zum Beispiel in Windeseile noch eine Versicherung abschliessen.» Zudem könnten gerade schwierige wirtschaftliche Situationen – wie die aktuelle Coronakrise – erfahrungsgemäss auch zu Lohndumping führen.
Bis die unangenehmen Überraschungsbesuche präventiv wirken, dauere es zwei bis drei Jahre, so Hablützel. «Den Coiffeuren muss bewusst sein, dass jederzeit eine unangekündigte Kontrolle erfolgen – und Konsequenzen haben kann.»
Was getan werden muss, darüber ist man sich einig
Für die Branche sei es ein Problem, wenn sich Billiganbieter nicht an die Vorschriften hielten und dadurch den Markt verzerrten, sagt Mirjam Blättler-Ambauen, Präsidentin des Zentralschweizer Coiffeurverbandes. Mit der Coronakrise sei es zwar etwas in den Hintergrund getreten, aber keinesfalls verschwunden. «Zurzeit müssen alle Coiffeure schauen, dass sie nach dem Lockdown wieder auf eigenen Beinen stehen können. Da bleibt wenig Zeit für andere Sorgen.»
Blättler betont, dass sie nicht grundsätzlich gegen tiefe Preise sei. «Solange man faire Löhne, Sozialleistungen und Mehrwertsteuer zahlt, mag ich es jedem gönnen, der mit diesen Preisen existieren kann.» Die Kontrollen zeigten jedoch oft ein anderes Bild. Für Blättler ist darum klar: «Es braucht mehr Kontrollen – auch von den Kantonen.»
Darin scheinen sich alle einig zu sein. Auch Claudia Hablützel von der PK Coiffure ist überzeugt, dass die Branche durch einen Ausbau der kantonalen Kontrollen im Bereich Schwarzarbeit gestärkt würde. «Es hätte einen viel stärkeren Effekt, wenn wir koordinierte Aktionen durchführen könnten.»
Ins selbe Horn stösst CVP-Kantonsrat Daniel Piazza: «In anderen Kantonen hat man gute Erfahrungen mit Razzien gemacht, die über mehrere Behörden koordiniert und an mehreren Standorten gleichzeitig durchgeführt wurden.» In seinem Vorstoss lässt er allerdings bewusst offen, mit welchen Massnahmen der Kanton die Missstände angehen soll – Hauptsache, er tut etwas. Schreibt ZentralPlus.
Seit fast zwei Jahren gilt auch für Luzerner Coiffeur-Salons der Gesamtarbeitsvertrag für das schweizerische Coiffeurgewerbe. Dieser schreibt für gelernte Coiffeusen im ersten Berufsjahr einen Mindestlohn von 3'800 Franken vor.
Coiffeusen, also weibliche Hairstylistinnen, die im Koran vermutlich nicht vorgesehen sind, findet man in keiner dieser arabisch-muslimisch geprägten Barberstuben. Ebenso wenig wie «gelernte» Arbeitskräfte, die wohl an einer Hand abzuzählen sind. Wenn überhaupt. Also sind de Facto auch keine Mindestlöhne von 3'800 Franken pro Monat fällig.
Das Personal dieser längst zur wirtschaftlichen Parallelgesellschaft mutierten Szene setzt sich vorwiegend aus Migranten der syrischen, türkischen, irakischen, kurdischen und afghanischen «Clans» zusammen. Ein Modell, das auch bei den unzähligen Fastfood-Klitschen rund um die Moschee und Halal-Metzgerei an der Baselstrasse scheinbar bestens funktioniert. Wo bleibt eigentlich da der Aufschrei?
Und wo bleibt der Aufschrei der SP, deren «S» im Parteinamen für das Wort «sozial»(demokratische) Partei steht? Und wo die Empörung der UNIA, der grössten Gewerkschaft der Schweiz, die ja ebenfalls von der SP dominiert wird? Beide tun sich halt mit Problemen im Epizentrum der Flüchtlingsproblematik etwas schwer und überlassen das Feld lieber den marktradikalen Vertretern der CVP, FDP und SVP, die scheinbar ihrer eigenen Formel «Der Markt reguliert alles» nicht mehr so ganz vertrauen.
PS: Die Begriffe «schwarze Schafe» und «Schwarzarbeit» sind seit der «Mohrenkopf»-Empörung derart toxisch beladen, dass sie längst auf dem Index stehen müssten. Wo bleibt da der Aufschrei der MIGROS? Sind die «Schwarzkopf»-Shampoos endlich aus den MIGROS-Regalen entfernt?
-
17.7.2020 - Tag der Witwen und Waisen
Walter Bellers Konten sind gesperrt: «Ich muss den Gürtel enger schnallen»
Mit dem reinen Luxusleben ist es für die Society-Lady nun vorbei. Was das für sie genau heisst, verrät sie BLICK.
Stürmische Zeiten für die vom Luxus verwöhnte Witwe Irina Beller (48). Vor zwei Monaten verstarb ihr Mann, der Zürcher Baulöwe Walter (†71). Seine beiden Kinder Natascha (38) und Patrick (39) zweifeln sein verfasstes Testament an, wie BLICK gestern schrieb.
Doch das ist nicht alles. Da sich die beiden mit der Buchautorin nicht einigen können, bleiben Walter Bellers Bankkonten gesperrt. «Erst wenn Walters Kinder und ich uns einig sind und die Erbverteilung von allen unterschrieben und somit abgeschlossen ist, habe ich wieder Zugriff darauf.» Sie sei gelangweilt von dem absurden Zwist, mag nicht weiter mit ihnen streiten. «Weil es keinen Sinn hat. Walter hat sie in ihrem Testament grosszügiger bedacht, als es der Pflichtanteil wäre. Da sie das nicht einsehen wollen, kann es noch Monate dauern. So lange bin ich blockiert.»
Von vier Mietshäusern gehören ihr nun noch zwei
Doch auch wenn sie wieder Zugriff auf die Konten hat, wird es nicht so sein wie vorher. «Walter gehörten vier Mietshäuser. Zwei gehen an seine Kinder, zwei an mich. Da fehlen mir schon einmal Einnahmen der Mieten. Und Erträge aus den Bauaufträgen kommen künftig auch nicht mehr rein», so die Instagramkönigin, der 275'000 Follower folgen.
Beller hat nonstop gearbeitet. Sein letztes grosses Bauprojekt war der Umbau des Casino Zürich, das 2014 eröffnet wurde. Ansonsten hat Walter Beller vor allem Mehrfamilienhäuser konzipiert. «Sein letztes Projekt konnte letzten Monat abgeschlossen werden.»
Eine Million wird ihr pro Jahr künftig fehlen
Pro Jahr werde ihr nun ein Betrag von gegen einer Million Schweizer Franken fehlen. «Ich muss den Gürtel enger schnallen», sagt sie. «Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich nie arbeiten muss, ich habe auch noch die Witwenrente. Doch ich muss behutsam mit dem Geld umgehen, auch wenn die Konten nicht mehr gesperrt sind.» Denn nun müsse ja noch die Steuerrechnung vom letzten Jahr bezahlt werden und diejenige von diesem Jahr bis zu seinem Todestag am 19. Mai. «Wer diese bezahlen wird, ist noch offen», so Irina Beller.
So werde sie wohl nicht mehr viermal pro Jahr in der 1. Klasse in die Ferien reisen, wohl nur noch zweimal, wie sie sagt. «Neue Diamanten werden kleiner, diejenigen von Walter werde ich behalten. Und von vier Autos behalte ich nur zwei.»
Bis die Erbteilung abgeschlossen ist, können Bellers Kinder jede einzelne Schublade von ihr öffnen und infrage stellen, ob der Inhalt weiter nur ihr alleine gehöre. «Ja, das tut er», ist sie sich sicher, «so stehts in Walters Testament.» Einen Ehevertrag hatte das Paar nicht.
Das Rolf-Knie-Bild mit dem Clown will sie den Kindern schenken
Um endlich Frieden zu finden, sei sie auch bereit, ihnen grosszügige Geschenke zu machen. «Natascha und Patrick können gerne die Hälfte meiner 30 Pelzmäntel haben, ich gebe ihnen auch gerne 16 Stück. Und das Bild von Rolf Knie, mit dem Tiger und dem Clown gebe ich ihnen obendrauf ebenfalls von Herzen gerne.»
Sie wolle vorerst nur eins: «Ruhe, Frieden und meine eigene, liebe Familie.» Schreibt Blick.
Nein, ich schäme mich nicht meiner Tränen und gebe es zu: Als ich diesen Blick-Artikel las, habe ich geweint: Die arme Irina! Die Society-Lady (nicht zu verwechseln mit Lady Chatterley) muss pro Jahr mit einer Million weniger auskommen.
Nun, dieses Risiko besteht allerdings immer, wenn Frau einen Immobilienheini heiratet. Da fehlen öfters mal Millionen.
Und die Idee mit dem Rolf Knie-Bild, das Irina den Kindern von Walter Beller schenken will, hat einen grossen Haken: Damit die Beller-Kinder dieses Geschenk überhaupt annehmen, müsste sie wohl einen üppigen Bargeldbetrag zusätzlich für die Entsorgungskosten des Bildes noch drauflegen. Knies Diaprojektor-Bilder stehen nämlich nicht mehr sonderlich hoch im Kurs; der Hype um den «Füdlibürger»* ist längst vorbei und als Kunst wurden sie unter Kunstkennern sowieso noch nie betrachtet.
* So bezeichnete der ehemalige CEO von Philip Morris Switzerland und Managing Director von Philip Morris International, Dieter Schulthess, den Circus-Maler am Jazz-Festival in Montreux. Weniger wegen seinen künstlerischen Fähigkeiten, sondern eher wegen seinem bünzlihaften Benehmen.
-
16.7.2020 - Tag des Gleichklangs
NICHT IM GLEICHSCHRITT: Schweizer Armee blamiert sich in Paris
Vier Schweizer Armeeangehörige haben am Dienstag in Frankreich an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilgenommen. Wie ein Video zeigt, marschierten sie nicht im Gleichschritt. Gleichschritt – das üben Rekruten bereits in den ersten Wochen im Militär. Darauf folgen Stunden an Training. Doch das half offenbar alles nichts, wie ein Video vom französischen Nationalfeiertag zeigt. Ein Detachement der Schweizer Armee hat am Dienstag an den Feierlichkeiten auf dem Place de la Concorde in Paris teilgenommen. Es war laut einem Tweet von Bundesrat Alain Berset, der ebenfalls anwesend war, das erste Mal, dass Schweizer Armeeangehörige im Ausland defilierten. Schreibt 20Minuten.
Nur so nebenbei: Hitlers Stechschritt ist over und wird mehr oder weniger nur noch in Nordkorea, China und von Indien an der indischen Grenze zum grossen Nachbarn praktiziert. Der pervertierte preussische Militarismus, der schon unter dem deutschen Kaiser Wilhelm II. so viel Unglück über die Welt gebracht hat, sollte nicht Vorbild für moderne Armeen sein.
Immerhin marschierte der arg kritisierte Schweizersoldat – die Marschmusik still vor sich hin summend – im Gleichklang zur Musik. Und das schätzen selbst die Franzosen mit Präsident Macron an der Spitze.
So richtig blamieren tut sich da nur 20Minuten. Aber was schreibt man nicht alles, um auch im Sommerloch ein paar mickrige Klicks zu erzeugen?
-
15.7.2020 - Tag der Polygraphen
BLICK-Expertin Caroline Fux über offene Beziehungen: «Es gibt durchaus Argumente gegen Monogamie»
Ex-Snowboardprofi Fabien Rohrer trennte sich von seiner Freundin, weil diese eine offene Beziehung forderte. Mit diesem Verlangen sei sie nicht allein, meint BLICK-Psychologin Caroline Fux.
Caroline Fux: Zuerst einmal: Ich bin kein Fan des Wortes «Polygamie». Es ist tendenziell veraltet und vor allem negativ behaftet. Fachleute und Vertreter dieser Szene sprechen lieber von einer offenen Beziehung. Und was die Treue angeht, dann ist das ein extrem grosses, vielschichtiges Thema. Nüchtern betrachtet, darf man aber sagen, dass in der Menschheitsgeschichte wohl seit jeher extrem viel betrogen wird. Übrigens von beiden Geschlechtern.
Ich denke, es gibt durchaus gewisse Argumente gegen die Monogamie. Weil Menschen heute viel länger leben, dauern auch Paarbeziehungen länger. Man ist also stärker gefordert, wenn es um lange Monogamie geht. Einige Forscher argumentieren auch, dass es evolutionsbiologisch von Vorteil ist, wenn eine Frau rund um den Eisprung mit mehreren Männern Sex hat. Andere halten dagegen, dass Monogamie Beziehungen stabilisiert und ökonomischen Fortschritt fördert. Es ist ein ewiger Streit.
Das Thema kommt und geht. Die 1968er-Bewegung hat ja letztmals schon intensiv damit experimentiert. Viele erlebten dieses Experiment aber irgendwann als gescheitert. Aktuell ist das Thema gerade wieder sehr in Mode. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass sich Menschen nicht festlegen und vor allem auch auf nichts verzichten wollen. Offene Beziehungen oder «Freundschaften Plus» wirken wie Modelle, bei denen man alles haben kann.
Ich finde es toll, dass Menschen heute mehr Möglichkeiten haben, was Beziehungsmodelle angeht. Und dass man überhaupt darüber sprechen darf, dass man andere vielleicht immer noch spannend findet oder ihr Begehren schätzt. Weil dass man sich über diese Bedürfnisse austauscht, ist die zwingende Basis dafür, dass man zu seinem Glück findet. Und nur weil man über eine Öffnung spricht, heisst das ja nicht, dass man sie auch ungefiltert auslebt.
Was ist der Reiz an der Polygamie? Das ist individuell. Manche Menschen erleben es schlicht und einfach als ihrem Naturell entsprechend, offen für eine Sexualität oder eine Liebe zu mehreren Menschen zu sein. Andere denken, bei allem Respekt, vielleicht wirklich, dass sie alles haben müssen und auf keinen sexuellen Kick verzichten wollen. Schreibt Blick.
Zurück in die Vergangenheit oder do it as the Caveman / Cavewoman: Wer nicht bis drei auf den Bäumen ist, landet in der Kohabitationsmühle. Oder bei Frau Fux im kreativen Sommerloch: Wichtig ist nicht, was man sagt. Hauptsache, man sagt etwas.
-
14.7.2020 - Tag der Sommerlochstars
«Glee»-Star Naya Rivera ist tot
Schauspielerin Naya Rivera wurde seit Tagen vermisst. Nun hat die Polizei ihre Leiche im Lake Piru nordwestlich von Los Angeles gefunden. «Glee»-Star Naya Rivera war während eines Bootausflugs mit ihrem vierjährigen Sohn verschwunden. Der Kleine wurde schlafend allein im Boot aufgefunden und gab an, dass seine Mutter ins Wasser gegangen und nicht mehr zurückgekommen sei. Wie die US-Polizei nun mitteilte, wurde die 33-Jährige tot aus dem See geborgen. Nach dem Verschwinden der Schauspielerin Naya Rivera haben Einsatzkräfte in Kalifornien ihre Leiche in einem See entdeckt. «Wir sind sicher, dass der Körper, den wir gefunden haben, der von Naya Rivera ist», sagte Sheriff William Ayub am Montag (Ortszeit). Die Beamten gehen nicht von einem Suizid aus. Schreiben 20Minuten und sämtliche anderen Onlinemedien.
So weit so tragisch. Andy Warhols Aussage aus dem Jahr 1968 «In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes» hat sich bestätigt. Speziell in der Saure-Gurken-Zeit des Sommerlochs. Waren es vor Jahrzehnten noch die immer wiederkehrenden Stories über das Loch Ness-Monster aus Schottland* und eine angebliche Frau, die ihrem Ehemann das beste Stück in irgendeiner nicht verifizierbaren Landschaft der Dritten Welt abgeschnitten haben soll, sind es heute Glee-Stars, die Geschichte für «15 minutes» schreiben. Denn Hand aufs Herz: 99 Prozent der Schweizer Bevölkerung dürften mit dem Begriff «Glee»-Star und dem Namen Naya Rivera wohl nichts anfangen können. Mein Wenigkeit eingeschlossen. Deshalb hier die WiKi-Erklärung.
* Inzwischen abgelöst durch den Kaiman vom Hallwilersee.
-
12.7.2020 - Tag der deutschen Sprache
Kosovarin kassierte zu Unrecht Arbeitslosengeld – Freispruch wegen mangelnder Sprachkenntnisse
Eine Kosovarin hat Nebenjobtätigkeiten nicht beim zuständigen RAV gemeldet und so zu hohe Arbeitslosengelder in der Gesamthöhe von rund 11700 Franken erhalten. Das Bezirksgericht Muri spricht sie vom Betrugsvorwurf frei.
Wer arbeitslos wird, meldet sich auf der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) an. So tat es auch Blerta (Name geändert) im Oktober 2016. Die heute 58-jährige Kosovarin lebt in einer Gemeinde im Bezirk Muri und verlor damals ihre Teilzeitstelle im 50-Prozent-Pensum in einem Restaurant im Kanton Zug.
Nebst ihrem verlorenen Hauptjob arbeitete Blerta wöchentlich auch noch eine Handvoll Stunden als Reinigungskraft in Privathaushalten. Diese beiden Tätigkeiten gab sie auf dem RAV-Formular aber nicht an und erhielt so in der Folge eine höhere Entschädigung aus der Arbeitslosenkasse ausbezahlt.
In der Zeitspanne von Januar 2017 bis Januar 2019 entstand der Arbeitslosenkasse dadurch ein Schaden von rund 11'700 Franken. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten klagte die Kosovarin deshalb dem mehrfachen Betrug an und forderte in der Anklageschrift eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bedingt, eine Busse von 2000 Franken plus einen siebenjährigen Landesverweis.
Trotz über 20 Jahren in der Schweiz kein Deutsch
Bei der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Muri zeigte sich rasch, dass besonders die sprachliche Hürde für Blerta ein Problem darstellt. Sie spricht und versteht fast kein Deutsch. Ein Dolmetscher half deshalb bei der Befragung Blertas durch Gerichtspräsident Markus Koch.
Jeden Monat musste die Angeklagte Formulare fürs RAV mit den Angaben zur Person ausfüllen. Darunter auch folgende: «Haben Sie bei einem oder mehreren Arbeitgebern gearbeitet?» Weshalb sie denn diese immer mit Nein beantwortet hätte, wollte der Richter wissen. Blertas Antwort: «Ich ging davon aus, dass sie nur für den Job im Restaurant galt.»
Schaden wird in Raten abbezahlt
Auch auf ähnliche Fragen, die auf ihr sprachliches Verständnis der RAV-Formulare zielten, antwortete Blerta oft mit: «Ich hatte das nicht verstanden.» Die Unterlagen seien alle auf Deutsch gewesen und auch ihr Mann spreche nicht gut Deutsch. Hilfe bei anderen Personen holte sie trotzdem nicht. Obwohl sie zwischen 1991 und 1998 sowie seit 2007 nun fast 21 Jahre in der Schweiz lebt, sind ihre Sprachkenntnisse bescheiden. Sie beteuerte, dass sie die Formulare nicht so ausgefüllt hätte, wenn sie sie richtig verstanden hätte. Seit Dezember 2019 zahlt Blerta den Schaden in monatlichen Raten dem RAV wieder zurück.
«Mein Wunsch ist, die deutsche Sprache zu lernen. Ich werde mir Mühe geben», meinte sie. Das Gericht sprach sie am Ende vom Vorwurf des Betrugs vollumfänglich frei. «Sie haben zwar zu viel Geld bekommen, weil Sie falsch ausgefüllt haben. Aber es ist Ihnen nicht nachweisbar, dass Sie so wussten, dass Sie zu viel Geld erhalten», sagte der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Die deutsche Sprache mutiert in der Schweiz langsam aber sicher zum Auslaufmodell. Das ist nicht unbedingt tragisch. Sprachen haben sich schon immer verändert. Es fragt sich nur noch, welche Sprache wird sich langfristig im Lande Wilhelm Tells durchsetzen? Tigrinya, Türkisch, Arabisch, Serbisch, Albanisch oder gar Suaheli? Tigrinya und Suaheli dürften aufgrund der zu erwartenden Fertilitätsraten die besten Aussichten haben.
-
9.7.2020 - Tag der Feuchtfröhlichen
27 Flaschen Schnaps für 21 Schüler aus Walenstadt SG – Schulpräsidentin organisiert Saufgelage für Minderjährige: Die Abschuss-Klasse
Der Abschluss der Sekundarklasse 3S aus Walenstadt SG endete in einem üblen Saufgelage. Nicht, weil die Teenies sich den Hochprozentigen illegal beschafften. Den Schnaps organisierte die Schulpräsidentin höchstpersönlich. Die betroffenen Eltern sind sauer und geschockt. Sie haben es geschafft: Die 21 Schüler der Sekundarklasse 3S aus Walenstadt SG haben die letzten obligatorischen Schultage hinter sich gebracht. Und das wurde zum Sommerferienbeginn ordentlich gefeiert. Die Party in Flumserberg endete letzten Freitag in einem Saufgelage.
Kein Wunder! Die Teenies hatten jede Menge Schnaps auf der Hütte. Tequila, Wodka, Jägermeister, Alkopops. Insgesamt 27 Flaschen. Bilder vom feuchtfröhlichen Abend landen später auch im Klassenchat auf Whatsapp. Ein Bild zeigt einen Jungen mit einer Tequilaflasche in der Hand. Stolz hält er das gute Stück und grinst selig.
Den harten Alkohol hatten sich die 14- bis 16-Jährigen nicht selbst besorgt – wie auch, sie sind ja alle noch unter 18 Jahren. Der Schnaps wurde den Jugendlichen in einer Kiste überreicht – von der Schulpräsidentin.
Oliver Zerres (47), dessen Tochter (15) auch beim Saufgelage war, bestätigt BLICK: «Schulratspräsidentin Pascale Dürr hat die Minderjährigen mit den Flaschen eingedeckt. Ihre Tochter hat an dem Abend auch mitgefeiert.» Der Vater ist mehr als sauer.
Am Anfang sei die Stimmung auf der Schi-Ri-Wip-Hütte noch ausgelassen gewesen, berichtet seine Tochter. Dann eskalierte die Lage, der Schnaps zeigte seine Wirkung. «Manche Jugendliche waren wie weggetreten, andere haben gekotzt. Es war ein absolutes Besäufnis», wie Vater Zerres später erfährt.
Seine Tochter sei mit der Situation überfordert gewesen, machte sich Sorgen. «Sie rief uns an und sagte, dass wir schnell kommen sollten», so der Druckerei-Mitarbeiter. Seine Frau fuhr gleich los. Oben angekommen, traf sie der Schlag. Jede Menge Schnaps, ein paar Jugendliche – alles ohne jegliche Aufsicht.
Dass dort Alkohol getrunken wurde, ist für das Ehepaar Zerres kein Problem: «Meine Frau und ich dachten da an Bier und Wein, aber doch nicht so viel Hochprozentiges.» Den harten Alkohol zahlten die Eltern sogar selbst – ohne es zu wissen. Zerres dazu: «Für die Feier und Übernachtung wurden 63 Franken pro Kind veranschlagt.» Heute weiss er: «Miete für die Hütte und Frühstück kosteten circa 700 Franken. Von dem Rest wurden die Schnapsflaschen gekauft.» Das habe die Schulratspräsidentin auch zugegeben: «Sie sagte, dass das Geld nicht ganz gereicht habe und sie sogar noch etwas drauflegen musste.»
Für Zerres und andere Eltern ein Skandal. In einem Brief (liegt BLICK vor) machen er und Sandra Reinhardt (43) ihrer Wut Luft und fordern das Geld zurück. Auch die Tochter (15) von Reinhardt war an dem Abend dabei und kümmerte sich um die betrunkenen Teenies. Die Krankenschwester kann nicht verstehen, dass den Jugendlichen der harte Alkohol auf dem Silbertablett serviert wurde. «Dass wir dafür auch noch gezahlt haben, ist die Höhe», sagt sie aufgebracht.
Schulratspräsidentin Pascale Dürr will sich auf Anfrage von BLICK noch nicht zu den Vorwürfen äussern und vertröstet auf Donnerstag. Gegenüber den aufgebrachten Eltern sagte sie laut Elternbrief, dass «so ein bisschen Alkohol nichts ausmache». Das sah 2008 noch anders aus. Damals stellte sie einen Lehrer frei, der mit einer Alkoholfahne zum Unterricht kam. Schreibt Blick.
Irgendwann und irgendwo müssen die kleinen Scheisserchen doch am und im eigenen Leib erfahren, wie es so ist, einen sitzen zu haben, um fürs künftige Leben Lehren daraus zu ziehen. Ob nun beim Schulabschluss, in der RS (hier spricht der Verfasser aus seiner eigenen Biografie) oder auf der Schütti in Luzern: Besser früh als spät. Für die meisten eine heilsame Erfahrung und für eine kleine Minderheit der Einstieg in die Droge Alkohol.
Diese Minderheit hat aber immerhin die Chance, als Gemeinderat zu enden, wie der Mellinger Gemeinderat Beat Gomes, der gerne mal feuchtfröhlich unterwegs ist, bewiesen hat. Oder als SP-Präsidentin. Bemerkte doch ex-SP-Präsidentin Christiane Brunner, in einem SRF-Interview auf ihre offensichtliche Vorliebe für Weisswein angesprochen: «Irgendwer muss ja den Schweizer Weisswein trinken.» Mehr Patriotismus geht nicht!
-
8.7.2020 - Tag der traurigen Schicksale
Migros-Tochter Saviva stellt Thomas Assfalk (63) mitten in der Corona-Krise auf der Strasse: «Wir haben keine Verwendung mehr für dich»
Über 16 Jahre lang hat Thomas Assfalk für die Migros-Tochter Saviva gearbeitet. Nun hat er die Kündigung bekommen. Dies wenige Jahre vor der Pensionierung. Er ist verzweifelt. Existenzängste plagen ihn.
Thomas Assfalk (63) aus Turbenthal ZH hält die Kündigung in den Händen und kämpft mit den Tränen. Er ist verzweifelt und wütend. Vor drei Wochen hat der Chauffeur und Logistiker von seinem Arbeitgeber, dem Gastrolieferanten Saviva – einer Migros-Tochter mit Sitz in Regensdorf ZH – den blauen Brief erhalten. Nach 16 Jahren im Betrieb. In einem Alter, in dem man kaum mehr einen Job findet. Und mitten in der Corona-Krise, wo sich gegenwärtig die Entlassungswelle auftürmt.
Das Kündigungsgespräch steckt ihm immer noch in den Knochen, seine Stimme stockt. Man habe ihn mit den Worten «Wir haben keine Verwendung mehr für dich» entlassen. «Daran habe ich immer noch zu beissen. So was hat mir noch nie jemand gesagt. Mir sind sofort die Tränen gekommen.»
Assfalk plagen Existenzängste. «Ich mache mir jeden Tag Gedanken, wie es weitergeht», sagt er. Und: «Mir fehlen bis zur Pension 1000 Franken im Monat.» Zusammen mit seiner Frau hat er die Finanzen bis zur Pension geplant und entsprechend eingeteilt. «Da ist kein Spielraum», sagt er und zeigt BLICK seine Berechnungen. Assfalk hat sein Leben lang gearbeitet.
Im vergangenen Herbst musste er sich einer Knieoperation unterziehen. Seither kann der Chauffeur keine Lastwagen mehr fahren. Sein Körper macht das Be- und Entladen der Ladefläche nicht mehr mit. Rollcontainer sind 300 Kilogramm schwer, gewisse Paletten bis zu einer halben Tonne. «Das kräfteraubende Hantieren auf der Hebebühne liegt schlicht nicht mehr drin», sagt der Zürcher Oberländer.
Praktisch zeitgleich mit Assfalks Knieoperation hat seine Arbeitgeberin Saviva die Logistikstruktur reorganisiert. Der Standort in Flawil SG, wo Assfalk gearbeitet hat, fiel weg. Die Arbeiten wurden im nahen Gossau SG zentralisiert. Für Assfalk gab es dort keine Stelle mehr. Er wurde nach Landquart GR geschickt, zur Saviva-Tochter Mérat.
Das hatte Folgen für seinen Tagesablauf. Assfalk musste um 2 Uhr morgens aufstehen. Klaglos fuhr er die 100 Kilometer von Turbenthal nach Landquart. Arbeitsbeginn im Bündnerland war um 5 Uhr. Für Mérat war er mit einem Lieferwagen unterwegs und belieferte Gastrokunden mit Fleisch. Die Kisten sind 20 Kilogramm schwer, das geht in die Knie.
Kündigung während Corona-Krise
In der Corona-Krise wurde die Grossmetzgerei in Landquart temporär stillgelegt, die Angestellten auf Kurzarbeit gesetzt. «Alles sei vorübergehend, hiess es», erinnert sich Assfalk. Die Arbeiten, die es noch zu erledigen gebe, würden von Zürich aus gemacht. «Jetzt ist klar, der Standort Landquart wird nur noch auf Sparflamme weitergeführt. Nur noch mit einem Chauffeur. Drei haben die Kündigung erhalten», sagt Assfalk.
BLICK hat Saviva mit der Geschichte von Thomas Assfalk konfrontiert und zahlreiche, konkrete Fragen gestellt. Die Antwort der Migros-Tochter fällt knapp aus. «Wie andere Unternehmen auch arbeiten wir immer an der Optimierung unserer Prozesse», sagt Saviva-Sprecherin Sereina Veraguth. Und: «Aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes können wir uns zum vorliegenden Fall nicht äussern.»
Ein paar Tage später, nachdem Assfalk BLICK seine Geschichte erzählt hat, gibt die Migros am 26. Juni bekannt: «Verkauf der Firma Saviva geplant.» Die Gruppe wolle sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Die Suche nach neuen Eigentümern im Gastro-Zustellgrosshandel laufe. «Verschiedene Optionen werden geprüft, die Details sind in Ausarbeitung», heisst es in der Migros-Mitteilung.
Für Saviva arbeiten rund 600 Personen. Für Assfalk und nach seinen Angaben eine Gruppe anderer ausgemusterter Angestellten, darunter auch eine über 62-jährige Person, ist die Sache gelaufen. Er ist den Job los. Mit seiner Geschichte will er den zahlreichen ähnlich Betroffenen in der Corona-Krise ein Gesicht geben. Schreibt Blick.
Es ist ein trauriges Schicksal für Thomas Assfalk, das aber noch viele Arbeitnehmer*innen heuer heimsuchen wird. Einzelne Firmen können durch die Lockdown-Schäden während der Coronakrise nicht anders und müssen wohl oder übel Personal entlassen. Andere wiederum werden die Gelegenheit benutzen, beim Personal hemmungslos aufzuräumen. So wie die Migros-Tochter Saviva.
Während sich die (noch-) Mutter Migros mit absurden Geisterdiskussionen um einen Mohrenkopf herumschlägt, schafft die (noch-) Tochter Saviva vollendete Tatsachen.
Schön ist das nicht für den betroffenen Thomas Assfalk. Die Würde, die ihm genommen wurde, könnte höchstens durch einen neuen Job wieder hergestellt werden. Doch wer gibt einem 63-Jährigen eine Chance?
Aus nachvollziehbaren Gründen wird kein Arbeitgeber bei Assfalk anklopfen. Die Sozialromantik hat die Wirtschaft längst hinter sich gelassen. Anstand, Moral und Ethik vertragen sich nur schwer mit dem brachialen Hardcore-Neoliberalismus der heutigen Zeit.
Allerdings bleibt ein sehr wichtiges Detail in diesem Blick-Artikel unerwähnt: Die vom Parlament beschlossene Übergangsrente für Ü60-Jährige, auch wenn diese für Thomas Assfalk nicht mehr in Frage kommt. Denn er kann die nächsten zwei Jahre 80 Prozent seines Gehalts von der AVL beziehen.
Aber für alle anderen Ü60-Jährigen, die den Job verlieren werden, hat der Bund mit der Übergangsrente ein intelligentes und sinnreiches Instrument geschaffen. Bleibt nur zu hoffen, dass die SVP ihr angedrohtes Referendum gegen die Übergangsrente nicht durchzieht. Wäre nach der Blocherschen Rentenforderung auch ein seltsam übles Verhalten der ehemaligen «Volch»-Partei.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
7.7.2020 - Tag der Menschenverachtung
Allfällige Gratismasken lösen im Aargau eine Kontroverse aus: von «einfach umsetzbar» bis «einfach lächerlich»
Soll der Kanton Gratismasken verteilen? Und falls ja: Wer soll sie bekommen? Diese Frage sorgt für eine Debatte in der Aargauer Politik. Die SP fordert kostenlose Masken für Niedrigverdiener. SVP und FDP halten hingegen nicht viel von diesem Vorschlag.
Seit gestern Morgen gilt die Maskenpflicht im ÖV. Erste Eindrücke zeigen: Herr und Frau Schweizer halten sich an die Vorgabe. Kein Problem, also? Doch, finden zahlreiche Stimmen. Denn bei täglichen Fahrten zur Arbeit könnte dies für Niedrigverdienende ins Geld gehen. So rechnet die Caritas Schweiz für eine Familie mit zwei Kindern über zwölf Jahren, in der alle vier täglich den ÖV benutzen, mit rund 200 Franken Zusatzkosten pro Monat.
Gabriela Suter strebt «einfach umsetzbare» Lösung an
Um das Problem zu lösen, schlägt die Schweizerische Kommission für Sozialhilfe (Skos) vor, dass die Kosten für die Hygienemasken direkt über die Sozialhilfe gedeckt werden. So könnte der Aufwand als «situationsbedingte Leistung» abgerechnet werden, so die Skos.
Einen anderen Ansatz verfolgt die SP Aargau: Diese will kostenlose Masken nicht nur für Sozialhilfebezüger, sondern für alle, die Krankenkassen-Prämienverbilligungen beziehen. «Das schliesst all jene, die Sozialhilfe beziehen, ein», so SP-Präsidentin und Nationalrätin Gabriela Suter. Denn die Verteilung von Gratismasken an Sozialhilfe-Bezüger geht der SP zu wenig weit. «Es haben auch Leute, die keine Sozialhilfe beziehen, finanzielle Schwierigkeiten, gerade wenn sie im Tieflohnbereich arbeiten oder auf Kurzarbeit gesetzt sind», sagt Suter.
Verteilen will Suter die Masken über die Gemeinden. «Die Gemeinden können die Masken am Besten verteilen, weil sie am nächsten bei den Leuten sind und so keine Portokosten anfallen», meint Suter. Die Grenze hat die SP bei den Prämienverbilligungsbeziehenden gezogen, weil «dieser Teil der Bevölkerung in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebt, deshalb am meisten unter den zusätzlichen Ausgaben leiden wird und die Lösung einfach umsetzbar ist», so Suter.
«Falscher Lösungsansatz», findet Martina Sigg
FDP-Grossrätin Martina Sigg sieht dies anders: «Die Grenze bei den Prämienverbilligungsbezügern zu ziehen, macht keinen Sinn.» Weil rund 25 Prozent der Bevölkerung Prämienverbilligungen beziehen, findet Sigg die Schwelle zu hoch angesetzt. «Das hiesse, bei 25 Prozent der Bevölkerung die Situation überprüfen und verarbeiten, das erscheint mir viel zu aufwendig», so Sigg. Viel sinnvoller findet Sigg die Abrechnung über die Sozialhilfe. «Wenn Masken vorgeschrieben sind, dann sind sie Teil des Grundbedarfs. Dieser wird von der Sozialhilfe bezahlt», sagt Sigg.
Komplett gegen den Gratismasken-Vorschlag ist SVP-Grossrätin Martina Bircher. Allein die Diskussion darüber, findet sie, ist «lächerlich, einfach lächerlich». Die Masken, so Bircher, seien mit rund 70 Rappen pro Stück so billig, dass jeder Schweizer sich das leisten könnte. Auch die Sozialhilfebeiträge für Masken findet sie «lachhaft». «Der Grundbedarf reicht für Alkohol und Tabak, da sollte auch Geld für Masken da sein», findet Bircher.
Die SVP-Politikerin schlägt vor, dass die, die «kein Geld ausgeben wollen für Masken», sich selbst welche nähen sollten. «Sozialhilfebezüger haben eh den ganzen Tag Zeit, da können sie sich ja wohl so eine Stoffmaske nähen», meint die Grossrätin. «Und sonst verzichten sie halt eine Woche auf Zigaretten, dann sind die Masken auch finanziert.» Schreibt die AZ.
«Sozialhilfebezüger haben eh den ganzen Tag Zeit, da können sie sich ja wohl so eine Stoffmaske nähen», meint die SVP-Grossrätin Martina Bircher. «Und sonst verzichten sie halt eine Woche auf Zigaretten, dann sind die Masken auch finanziert.»
Liebe AZ, das wohlgenährte SVP-Pummelchen mit den süssen Wurstfingern ist seit 2019 im Hohen Haus von und zu Bern als Nationalrätin angekommen. Nix da mit Grossrätin. Eine so hohe Politikerin unter Gewicht verkaufen geht gar nicht. Ein journalistisches No Go.
Der deutsche Kolumnist Henryk M. Broder beschrieb vor einigen Jahren die deutsche Politikerin Claudia Roth von den Grünen als «Doppelzentner fleischgewordene Dummheit». Diese Verbalinjurie ist für Schweizer Verhältnisse denn doch etwas zu krass und wäre wohl einklagbar. Also lassen wir sie sein. Zumal wir das exakte Gewicht der stämmigen SVP-Politikerin Martina Bircher nicht kennen. Eines aber ist gewiss: Ihre geschätzten 150 bis 180 Pfund Lebendgewicht stehen bezüglich Volumina in krassem Gegensatz zu ihrer Sozialkompetenz. Von Intellekt und Empathie ganz zu schweigen.
Man darf sich schon fragen, wer diese wohlbeleibte, von Machtbesoffenheit trunkene Frau Bircher gewählt hat, die in ihrer grenzenlosen Intoleranz, Menschenverachtung und Unwissenheit sämtliche Sozialhilfebezüger*innen in einen Topf wirft. Die Dame mit dem neckischen Pferdeschwanz wird im Herbst auf die Welt kommen.
Dieses ebenso dumme wie geschmacklose und menschenverachtende Zitat könnte nicht nur die Nationalratsflute einholen, sondern die gesamte SVP. Die Sozialhilfebezüger*innen werden auch bei der SVP zunehmen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Es ist schon auffällig, wie die gute alte Tante SVP in letzter Zeit alles tut, um sich selbst abzuschaffen. Ob das mit der drohenden Pleite bei der kommenden Abstimmung über die Begrenzungsinitiative zusammenhängt, sei dahingestellt.
Selbst dem Gebenedeiten vom Herrliberg scheint momentan jedes Fingerspitzengefühl für das von der SVP über Jahrzehnte wörtlich überstrapazierte «Volch» zu fehlen. Blochers frühere Kernkompetenzen sind möglicherweise in vorauseilendem Gehorsam den biologischen Gesetzen folgend bereits im Hades angekommen.
Wenn der alte Mann vom Herrliberg jetzt vom Staat seine Pensionsansprüche einfordert, auf die er nach seiner Abwahl als Bundesrat grossgekotzt verzichtet hatte, könnte er doch ein Zeichen setzen. Er legt ja Wert auf die Feststellung, dass sein Renten-Inkasso nichts mit der Liquidität auf dem Herrliberg zu tun habe. Ein paar Milliarden scheinen also noch vorhanden zu sein. Warum denn nicht ein paar Millionen Masken fürs «Volch» spenden, Herr Blocher?
Blocher wird nicht müde zu betonen, dass er diesem Staat nichts schenke. Vergisst aber zu erwähnen, dass die meisten seiner politischen Amtsträger*innen von genau diesem Staat leben. Manchmal sogar in doppelter Hinsicht: Der frühere SVP-Nationalrat Mörgeli schämte sich nicht, ununterbrochen über diesen «Staat» zu lästern, von dem er als Leiter des Medizinhistorischen Museums in Zürich und als Nationalrat sein gesamtes finanzielles Einkommen generierte. Auch Frau Bircher hatte nichts gegen einen Job mit einem bequemen XXL-Sessel bei der Post einzuwenden.
Die völlig aus der Zeit gefallenen Apologeten der reinen SVP-Lehre scheinen immer noch dem Anspruch zu folgen: L'état c'est moi.* Dieser Herrschaftsanspruch endete während der französischen Revolution auf dem Richtplatz unter der Guillotine, heutzutage wird er an der Wahlurne abgestraft.
Für Frau Bircher noch eine Diätempfehlung: Mehr Birchermüesli essen und weniger menschenverachtende Keulen absondern. Dann könnte aus ihr noch was werden. Nichts ist schon.
Anmerkung: Der Verfasser dieser Short-Kolumne ist sich bewusst, verbal die gleichen üblen Massenvernichtungswaffen einzusetzen wie Frau Bircher. Er möchte dieser furchtbaren Aargauerin damit zeigen, wie verletzlich Menschen sind, wenn sie mit Wortgewalt attackiert und blossgestellt werden. Übergewicht kann genau so gut zum Stigma mutieren wie Sozialhilfe für Sozialhilfeempfänger*innen.
* L'état c'est moi. Der französische Ausspruch l'état c'est moi, der sich mit «Der Staat bin ich» übersetzen lässt, ist ein wesentliches Schlagwort des Absolutismus und wird zumeist Ludwig XIV. zugeschrieben, wobei eigentlich unklar ist, wer die Wendung l'état c'est moi tatsächlich prägte.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
6.7.2020 - Tag des Wochenstarts
Besitzer hatten die Hoffnung schon aufgegeben: Die aufwendige Suche nach Tierschutzhund Nantha in Obersiggenthal
Dass ein junger oder jagdlich motivierter Hund mal ausbüxt, wenn der Halter nicht Acht gibt, weiss man. Anders war es bei Nantha. Der dreijährige Hund, der bislang das Leben nur in einem rumänischen Tierheim gekannt hatte, gelangte über eine deutsche Organisation («Initiative Karpatenstreuner») nach Kirchdorf zu Vivienne Sprang und Florian Lorenz. Sie haben ein besonderes Herz für Tiere.
Als sie auf einer Reise durch Kolumbien die vielen Streunerhunde sahen, war für sie klar: «Wir wollten einem solchen Tier ein Zuhause geben.» Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, schilderten sie, als sie Nantha zum ersten Mal im Internet gesehen hatten. Die Corona bedingte Wartezeit nutzten sie, um sich für einen guten Start mit dem ängstlichen, jungen Hund beraten zu lassen. Überglücklich nahmen sie Anfang Mai den Hund zu sich nach Hause. Sogenannte Tierschutzhunde haben eine Vorgeschichte und aufgrund ihrer Erfahrungen oft Angst vor Dingen, die ihnen fremd sind. Dazu gehören auch Menschen, insbesondere männliche, vor denen sie zurückscheuen. Da muss erst langsam Vertrauen wachsen, bis eine Bindung entstehen kann. Für Besitzer ist Vorsicht angebracht. Nantha hatte draussen immer ein Sicherheitsgeschirr und wurde nur an der Leine spazieren geführt. Doch eines Morgens passierte es.
Damit sich Nantha im Garten besser lösen konnte, öffnete Florian eine Schnalle des Geschirrs. Ein plötzliches, lautes Geräusch von nebenan versetzte Nantha derart in Angst, dass sie sich aus dem Geschirr befreite und das Weite suchte. Die Suche im Quartier blieb erfolglos – keine Spur mehr von Nantha. «Diese Zeit werden wir nie vergessen», sagen Vivienne Sprang und ihr Lebenspartner. Sie meldeten den Vorfall der Polizei und der Jagdaufsicht. Über «Naty’s Tiere in Not» und die Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ) gelangten sie an den Hundefänger Daniele Bennici. Lorenz legte nach dessen Anweisung mit Wurstwasser angereicherte Fährten zurück zum Haus, damit Nantha zurückfinden könnte. Als der Hund oberhalb von Kirchdorf gesichtet wurde, kam Bennici, stellte eine Falle auf, legte mit Futter sternförmige Schleppfährten dorthin und übernachtete mit Kamera bewaffnet in der Nähe. Ohne Erfolg.
Am zweiten Tag hingen Sprang und Lorenz Flyers in der Umgebung auf. Gleich mehrere Anrufe gingen ein. Doch dann war vier Tage lang Ruhe. «Zwischendurch hatten wir die Hoffnung verloren», schildert Vivienne Sprang diese Zeit. Am sechsten Tag wurde Nantha in Birmenstorf gesehen. Daniele Bennici installierte zwei Futterstellen mit Falle, während der zusätzlich beigezogene Pettrailer Markus Baumgartner das Flyern übernahm. Wieder ohne Erfolg.
Am anderen Morgen früh kam der Anruf, Nantha sei in Vogelsang an der Hauptstrasse gesichtet worden. Lorenz fuhr gleich hin und entdeckte Nantha für einen kurzen Augenblick. Jetzt den Hund nur ja nicht in Panik versetzen, sodass er erneut fliehen würde, erklärte Baumgartner, der zusammen mit Anwohnern das Gelände einzäunte, sodass es für Nantha kein Entweichen mehr gab. Mit der Drohne versuchte Baumgartner den Hund zu orten. Gegen Mittag kam Bennici, stellte eine grosse Falle auf und legte eine leckere Schleppfährte. Eine Verlockung, welcher der hungrige Hund nicht widerstehen würde. Nach drei Stunden Warten kam Nantha ins Blickfeld und ging, von einer Wildkamera gefilmt, in die Falle. «Wir konnten es kaum fassen vor Glück», erzählt Vivienne Sprang. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Beginnen wir den Start am heutigen Montag, an dem die Maskenpflicht für den ÖV beginnt, mit einer wunderbaren Geschichte, die uns mit einem Happy End in die Kalenderwoche 28 führt. Ein Happy End, das wir uns alle auch für die Corona-Pandemie wünschen.
-
5.7.2020 - Tag der Grillsteaks
So gelingt das Steak vom Grill jedes Mal
Aussen braun, innen saftig und rosa: Wie ein perfekt gegrilltes Steak aussieht, davon hat wohl jeder eine Vorstellung. Umso frustrierender, wenn das daheim auf dem Grill geröstete Fleisch dieser dann so gar nicht entspricht – zumal Steaks zu den teuersten Grillstücken gehören. Falls Ihnen das schon mal passiert ist, seien Sie getröstet: Sie sind nicht allein. Nicht umsonst werden Rindersteaks in vielen Profi-Küchen ganz sanft sous vide bei Niedrigtemperatur gegart und dann nur noch in der Pfanne nachgebräunt. Aber auch ohne high-tech können sie ein köstliches Steak auf dem Grill zubereiten. Schreibt die WELT.
Das ist doch mal eine Sonntagslektüre! Es lohnt sich, den ganzen Artikel zu lesen. En Guete!
-
4.7.2020 - Tag der Classe Politique
Bundesrat hat entschieden: Milliardär Blocher bekommt 2,7 Millionen Fr Rente!
Der Bundesrat soll nicht schlecht gestaunt haben. SVP-Vordenker Christoph Blocher (79), der von 2003 bis 2007 in der Landesregierung sass, fordert nun nach Jahren plötzlich die ihm zustehenden Ruhegehälter ein, auf die er bis heute verzichtet hat. Das berichtet die «Schweiz am Wochenende». Blocher bestätigt dies gegenüber BLICK.
Unter dem Strich geht es um 2,7 Millionen Franken. Das hat bei vielen für Erstaunen gesorgt. Immerhin zählt seine Familie gemäss «Bilanz» zu den zehn reichsten Schweizern.
Blocher braucht Bargeld
Blocher nennt zwei Gründe dafür, dass er nach Jahren das Ruhestandsgehalt einfordert. Einerseits wird der ehemalige Justizminister in diesem Jahr 80 Jahre alt – Zeit, Bilanz zu ziehen: «Man weiss nicht, was noch auf einen zukommt.»
Gleichzeitig gibt es wirtschaftliche Gründe. Sein Vermögen besteht vorab aus Firmenanteilen und Immobilien, doch damit lässt sich die Vermögenssteuer nicht bezahlen. Heisst: Blocher braucht Bargeld.
Bundesrat stimmt Antrag zu
Die Ruhegehalts-Regelung für Bundesräte ist immer wieder umstritten. Bisher aber scheiterten sämtliche Reformversuche. Ausgerechnet Blocher selber gehörte zu den Kritikern.
Der Bundesrat hat dem Antrag Blochers am Mittwoch zugestimmt. Der Beschluss wurde der Finanzdelegation des Parlamentes zur Zustimmung vorgelegt.
Gemäss Bundeskanzlei seien bisher noch nie Ruhegehälter rückwirkend ausbezahlt worden. Auch sei dies gesetzlich nicht klar geregelt. Dies will der Bundesrat nun nachholen, um eine Rückwirkung künftig zu verhindern.
«Habe Anspruch auf die Zahlung»
Im Bundesrat soll Blochers Forderung allerdings nicht sonderlich gut angekommen sein: 2,7 Millionen Franken sind sogar für den Bund ein grosser Batzen. Derzeit werden 20 alt Bundesräte finanziell unterstützt, was jährlich 4,5 Millionen Franken kostet.
Blocher lässt sich von Kritik nicht aus der Ruhe bringen. «Ich habe einen Rechtsanspruch auf diese Zahlung, stellt er klar. «Wäre ich gestorben, wäre das Ruhegehalt einfach verfallen. Aber dann bräuchte ich es ja auch nicht mehr.» Schreibt Blick.
«Die Sozialhilfe war als Überbrückungshilfe in Notlagen gedacht. Schleichend ist daraus etwas anderes geworden: ein dauerhaftes Ersatzeinkommen ohne Arbeitsleistung. Explodierende Kosten sind die Folge davon. Die Leidtragenden sind dabei die Steuerzahler und die wirklich Bedürftigen.
Die Sozialhilfe hat beispielsweise dort ihre Berechtigung, wo jemand wenige Jahre vor der Pensionierung die bisherige Stelle verliert, trotz festem Willen keine neue Arbeit findet und die Leistungen der Arbeitslosenversicherung ausgeschöpft sind. Oder wenn eine alleinerziehende Mutter vorläufig nicht arbeiten kann.
Die Sozialhilfe hat heute aber auch eine andere Seite. Das System lässt sich leicht ausnützen von jenen, die gar nicht arbeiten wollen. Und eine ganze Sozialindustrie verdient gut daran.» Schrieb die Parteizeitung der SVP am 23. Oktober 2014.
Es ist schön, dass die Steuerzahler nun endlich mal für einen wirklich Bedürftigen aufkommen. Ein Gschmäckle hat Blochers Forderung trotzdem, auch wenn dem von allen Göttern Gesalbten vom Herrliberg de jure die paar Millionen für ein dauerhaftes Ersatzeinkommen ohne Arbeitsleistung zustehen.
«Classe Politique» pure, die der alte Mann und das Mehr* wie kein anderer stets angeprangert hat. «An ihren Taten sollt ihr sie erkennen! Nicht an ihren Worten.» (1. Johannes 2,1-6). Und schon gar nicht an den bezahlten Auftragsbiografien von Somm** und Ackeret***, die nicht mal das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt wurden.
* «Der alte Mann und das Meer» (Originaltitel «The Old Man and the Sea») ist ein von Ernest Hemingway im Frühling 1951 auf Kuba geschriebener Kurzroman.
** Markus Somm – «Christoph Blocher - Der konservative Revolutionär»
*** Matthias Ackeret – «Das Blocher Prinzip»
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.7.2020 - Tag der Schweizer Berge
Schweizer reisen auf Inseln
Statt wie geplant in die Schweizer Berge zu fahren, ändern viele Schweizer kurzfristig ihre Ferienpläne und reisen ans Meer. Grund dafür sind die attraktiven Preise: Im Moment kosten Strandferien für eine vierköpfige Familie inklusive Flug und Mahlzeiten zwischen 2000 und 3000 Franken. Für den gleichen Preis gibt es in den Schweizer Bergen meist nur die Übernachtung. Besonders beliebt sind die Inseln Kreta, Rhodos und Zypern. Denn alle drei Inseln wurden weitgehend von der Corona-Pandemie verschont. Schreibt 20Minuten.
Ob es sich bei den 2'000 oder 3'000 Franken für Strandferien um Angebote für eine Woche oder zwei Wochen handelt, lässt 20Minuten offen. Egal. Tatsache ist, dass eine vierköpfige Familie sehr wohl auch in den Schweizer Bergen für die genannten Beträge tolle Ferien erleben kann*. Sofern man nicht ausgerechnet in Bernie Ecclestones Hotel Olden in Gstaad absteigt. Oder im Palace St. Moritz.
* Google hilft auf der Suche nach einer Feriendestination in der Schweiz weiter. Es sind momentan unglaublich viele Ferien-Sonderangebote für Schweizer Familien in den Schweizer Bergen online.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
2.7.2020 - Tag der Bürgerlichen
Aargauer Bürgerliche fordern: Keine Gnade bei Sozialhilfemissbrauch – jeder Verdacht soll angezeigt werden
In Coronazeiten erst recht: Bürgerliche fordern, dass bei Sozialhilfemissbrauch genauer hingeschaut wird. So hat FDP-Grossrat Adrian Schoop diese Woche einen Vorstoss eingereicht. Jeder Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch soll von den Mitarbeitenden der Sozialdienste künftig zwingend angezeigt werden müssen.
Fast 20'000 Aargauerinnen und Aargauer waren Ende Mai als stellensuchend gemeldet. Je mehr Menschen ihre Stelle verlieren, desto mehr sind auf Sozialhilfe angewiesen. Gleichzeitig dürften für manche Gemeinden wegen Corona die Steuereinnahmen zurückgehen. Deshalb sei es jetzt an der Zeit, bei Sozialhilfemissbräuchen ganz genau hinzuschauen, findet FDP-Grossrat Adrian Schoop.
«Damit diejenigen Menschen, die wirklich auf die Unterstützung angewiesen sind, diese auch weiterhin erhalten können.» Schoop hat diese Woche im Grossen Rat eine Motion eingereicht, die verlangt, dass Mitarbeitende der Sozialdienste künftig jeden Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch zwingend anzeigen müssen.
Das Anliegen kommt auch bei der FDP und CVP an
Stand heute müssen nur schwere Vergehen zur Anzeige gebracht werden, weniger schwere Straftaten nicht. «Dadurch bleiben einige Straftaten auch dann straflos, wenn es sich um mehr als Bagatellfälle handelt», sagt Schoop. Ab wann der ungerechtfertigte Bezug von Sozialhilfe ein schweres Vergehen darstellt, ist selbst juristisch nicht immer eindeutig. Die Höhe der bezogenen Sozialleistungen spielt hier eine Rolle, ebenso das Motiv der Bezügerin oder des Bezügers.
Von den Angestellten der Sozialdienste könne man nun aber nicht erwarten, dass sie diese «juristischen Feinunterscheidungen» selbst machen können, findet Adrian Schoop. Es sei deshalb einfacher, würden alle Verdachtsfälle künftig grundsätzlich einmal angezeigt. Unterstützt wird die Motion von einem Grossteil der SVP- und FDP-Fraktion sowie mehreren CVPlern.
Falsches Pflichtgefühl, Drohungen oder Unwissen
Gemäss Schoop sprechen verschiedene Gründe für eine Anzeigepflicht. Er sagt, aus Pflichtgefühl dem Bedürftigen gegenüber werde im Zweifelsfall eher von einer Anzeige abgesehen. Weiter gebe es Fälle, bei denen Druck auf die Mitarbeitenden des Sozialdienstes gemacht werde, sie sogar bedroht würden, und es deshalb zu keiner Anzeige käme.
«Viele kleine Gemeinden wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie zu diesem Mittel greifen könnten.» All dies führe dazu, dass Sozialhilfemissbrauch zu einer «gefahrlosen» Tat verkommen sei. Jetzt, in Coronazeiten, wo immer mehr Menschen auf dieses Geld angewiesen sind, sei es umso wichtiger, dass jeglicher Missbrauch geahndet werde.
Die Motion verlang nun aber nicht, dass sämtliche Fälle direkt bei der Staatsanwaltschaft landen. Damit die Verhältnismässigkeit gewahrt wird, sollen die kleineren Fälle zuerst einmal einer Vorinstanz vorgelegt werden. Das könnte etwa der zuständige Gemeinderat mit seinem Rechtsdienst sein. Dieser würde den Verdacht prüfen und ihn der Staatsanwaltschaft melden, wenn es sich juristisch nicht um einen Bagatellfall handelt. So soll in Zukunft also jeder Verdacht angezeigt werden –entweder bei der Staatsanwaltschaft oder beim Gemeinderat.
SP-Grossrat zweifelt an der Grösse des Problems
Erst vor zwei Wochen hat das Bezirksgericht Baden eine Frau schuldig gesprochen, die nicht alle Lohneinkünfte deklariert hatte, während sie gleichzeitig Sozialhilfe bezog. Die Frau wurde für fünf Jahre des Landes verwiesen. Angezeigt hatte die Frau der Turgemer Gemeinderat. «Dieser Fall zeigt, dass es noch viel Potenzial gibt. Es geht nicht darum, Sozialhilfebezüger grundsätzlich anzuprangern. Sondern die wenigen Ausnahmefälle vehement anzugehen und Missbräuche strikt zu ahnden, um die ehrlichen Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger zu schützen», sagt Schoop.
Auch Dieter Egli, Co-Fraktionspräsident der SP, möchte Sozialhilfemissbrauch nicht wegreden. Aber er bezweifelt, dass das Problem tatsächlich so gross ist, wie es dargestellt wird. «Es macht eher den Anschein, als würde hier nach vermeintlichen Schwachstellen der Sozialhilfe gesucht werden, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken.»
Die jetzigen Bestimmungen reichen aus
Dieter Egli verweist auf die juristische Diskussion, ab wann ein Sozialhilfemissbrauch angezeigt werden muss. Denn: Bagatellfälle sollen ja nach wie vor nicht direkt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden, sondern von einer anderen Instanz vorgeprüft werden. «Das beweist doch gerade, dass diese juristische Unterscheidung durchaus Sinn macht», so Egli.
Die Mitarbeitenden der Sozialdienste seien kompetent genug, um diese Unterscheidung machen zu können, sagt der SP-Grossrat. Und sie seien so professionell, dass sie sich nicht beeinflussen oder gar bedrohen lassen würden. Die jetzigen Bestimmungen würden ausreichen, findet Dieter Egli. «Das Prinzip der Sozialhilfe ist einfach. Das Erkennen von Sozialhilfemissbrauch ebenso.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Gegen die Aussagen von Adrian «gnadenlos» Schoop ist eigentlich nichts einzuwenden. Systemfehler haben es in der Regel so an sich, dass sie ausgenützt werden. Das ist bei der Sozialhilfe der Fall wie auch bei den von Bund und Kantonen gesprochenen Corona-Geldern und Corona-Krediten für Unternehmen.
Missbrauch findet dort statt, wo er zugelassen wird und gehört ausgemerzt. Da hat der «bürgerliche» Staatsmann Schoop absolut recht. Und weil auch für die «bürgerlichen» Staatsmänner die Unschuldsvermutung gilt, ist anzunehmen, dass der smarte FDP-Grossrat bei Skandalen um Veruntreuung von Corona-Hilfsgeldern durch Unternehmen ebenso gnadenlos hinschauen wird wie bei der Sozialhilfe. So weit so gut.
Wirklich ärgerlich an diesem AZ-Artikel ist die Titel-Headline: «Aargauer Bürgerliche». Wann beenden Parteien und Medien endlich diesen Blödsinn mit einem Relikt aus der Vergangenheit, das auf viele Menschen abstossend wirkt und längst aus der Zeit gefallen ist? Die französische Revolution ist vorbei, liebe «bürgerliche» Parteien.
Wer ist denn nun eigentlich «bürgerlich»? Sind das Politiker*innen mit einer Struwwelpeter-Frisur wie Schoop sie trägt? Erkennt man sie am lächerlich elitären FDP-Dress-Code-Designeranzug in Königsblau, den karierten, ebenfalls etwas aus der Zeit gefallenen Golfhosen der Präsidentin Greta Gössi oder den hellblauen Seidenhemden der freisinnigen FDP-Jungs, wie sie seinerzeit von der Führungsmannschaft der ehemaligen DDR-Jugendorganisation getragen wurden?
Dass die FDP-Dresscode-Diktatur die Individualität der jungen Parteigranden zerstört und aus ihnen närrische blaue Mäuse «ohne Schub» macht, scheint den CI-Verantwortlichen der Verdichtungspartei noch nie aufgefallen zu sein.
Doch was sagt uns der Begriff «Aargauer Bürgerliche»? Nichts. Das ist die echte Tragödie aller Parteien, die sich mit dem Kampfslogan «bürgerlich» schmücken. Die Aura des Begriffs besteht aus einem Nichts-Nutz. Zu nichts nützlich.
Oder wie Wikipedia schreibt: «Bürgerliche Partei ist ein Begriff der Politik, den manche Parteien zur Selbstbeschreibung nutzen. Welche Merkmale dieser Begriff impliziert, bleibt weitgehend unklar, sodass die Bezeichnung letztendlich nichtssagend ist. Der Begriff der bürgerlichen Partei bzw. des bürgerlichen Lagers wird oft als Kampfbegriff und in Abgrenzung zur politischen Linken gebraucht. Seine Verwendung ist umstritten, da in einer Demokratie alle Mitglieder der Gesellschaft Bürger sind, unabhängig von ihrer politischen Einstellung oder sozialen Herkunft.»
Nichtssagend. Sinnlos. Passt perfekt zu einer freisinnigen Partei. Frei von jeglichem Sinn.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
Foto by Adrian «gibt Schup» Schoop

-
1.7.2020 - Tag der Freude
Fast alle Gemeinden sagen ihre Anlässe zum Nationalfeiertag ab: Der grosse 1. August-Frust!
Eigentlich geht es hoch her am 1. August. Die Schweiz feiert ihren Nationaltag – und wie. Grosse Feste, Feuerwerk am Himmel. Das ganze Programm. Doch dieses Jahr heisst es kleiner Frust statt grosse Party-Lust.
Normalerweise wird der 1. August in der Schweiz in ganz grossem Stil zelebriert. In Städten und Gemeinden geht es hoch her. Es wird gesungen, gelacht und getanzt. Man sitzt beisammen und feiert den Nationalfeiertag der Schweiz.
Nicht so dieses Jahr. Alle grossen Bundesfeiern wurden abgesagt. Sogar die traditionelle Gedenkfeier auf der Rütliwiese findet dieses Jahr nicht statt. Einzig eine Mini-Feier unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist geplant. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (60) trifft auf der Wiese einige wenige Corona-Helden aus allen Kantonen.
Um die Corona-Infektionszahlen niedrig zu halten, hat der Bundesrat alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis Ende August verboten.
«Wir sind natürlich sehr enttäuscht, da wir uns sehr auf den Besuch von Bundesrätin Viola Amherd in Luzern gefreut und zusammen mit der diesjährigen Gastgemeinde Ermensee bereits ein tolles Unterhaltungsprogramm zusammengestellt hatten», sagt Diel Tatjana Schmid Meyer (38), Präsidentin des Organisations-Komitees, zu BLICK.
Die Feier sei so gut wie organisiert gewesen. Budget: rund 60'000 Franken. Dann kam das Coronavirus dazwischen. Einige Aufträge konnten storniert werden. Trotzdem kostet die Absage etwas weniger als 20'000 Franken.
Gleiches Spiel in Bern. Auch hier musste das Programm abgesagt werden. Budget für den Nationalfeiertag: 75'000 Franken. «Vorgesehen waren die Feierlichkeiten auf dem Bundesplatz, der Bundesgasse und auf der Kleinen Schanze. Das Organisationskomitee rechnete mit rund 25'000 Besucherinnen und Besuchern», sagt Jürg Wichtermann (56), Stadtschreiber der Stadt Bern, zu BLICK. Nun hofft man auf das nächste Jahr.
Ein Skandal für die SVP. Sie fordert: «Rettet den 1. August!». Die Partei plädiert dafür, trotz Corona den Nationalfeiertag zu zelebrieren. «Eine 1.-August-Feier darf auch schlicht sein und auf die patriotischen Grundwerte reduziert werden», schreibt die Partei in einer Mitteilung.
Was die SVP fordert, wurde in Brunnen SZ längst umgesetzt. Statt einer 1.-August-Feier wurde rechtzeitig ein Alternativprogramm organisiert. Kleinere Konzerte, Alphornbläser und ein Bimmelbähnli für die Kleinen entlang der Promenade. «Brunnen wird am 1. August frei zugänglich sein. Die Gastronomen erhalten zusätzliche Freiflächen für die Bewirtung, um die Abstandsvorschriften einhalten zu können», sagt Stefan Ryser (40) von Brunnen Schwyz Marketing.
Bei der normalen 1.-August-Feier werden über 1000 Personen erwartet. Für das Alternativprogramm dagegen weniger. Trotzdem werden Vorkehrungen getroffen, um grössere Menschenansammlungen zu verhindern.
Ryser zu BLICK: «Es wird zwar kleinere Konzerte geben. Die finden aber auf mobilen Bühnen statt. Auch unsere Alphornbläser werden sich so aufstellen, dass man zwar die Klänge hört, aber die Bläser nicht sieht.» Wo nötig, würden weitere Schutzmassnahmen wie das Contact Tracing eingesetzt werden.
Das geplante Feuerwerk findet aber nicht statt. Als Alternative werde gerade eine Lichtillumination im Dorfkern geprüft. Nicht nur Brunnen verzichtet dieses Jahr auf bunte Raketen am Himmel.
Das macht besonders Bugano-Chef Toni Bussmann (70) zu schaffen. Seit Jahren leitet er das Luzerner Unternehmen, das zu den grossen im Schweizer Feuerwerksgeschäft gehört. Wegen Corona brachen fast alle Bestellungen weg. «Bis dato finden etwa 2 bis 5 Prozent der üblichen 1.-August-Feiern statt, bei denen wir unser Material liefern. Aber ob die schlussendlich stattfinden, wird erst gegen Mitte Juli definitiv entschieden», erklärt Bussmann.
Der Bugano-Chef setzt nun auf den privaten Feuerwerk-Verkauf. «Wir hoffen nun, dass der Privatkonsum am 1. August positive Ergebnisse gibt, viele Schweizer und Schweizerinnen bleiben ja zu Hause und können unsern Nationalfeiertag mit einem schönen Schweizer Vulkan feiern.» Damit der 1. August trotz Corona gebührend gefeiert werden kann – wenn auch dieses Mal im kleinen Kreise. Schreibt Blick.
Des einen Leid ist des andern Freud. Tiere und Umwelt werden es auf ihre Art zu schätzen wissen, dass das stumpfsinnige «Geklöpf» und die unerträgliche Belastung der Natur mit fragwürdigen Chemikalien und Gestank bis zum Abwinken bis tief in alle Nacht hinein sich zumindest für einmal reduziert.
Und der Chlöpfmeister Toni Bussmann vom Luzerner Feuerwerkskörper-Unternehmen Bugano scheint irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein. Illuminationen erfüllen den Zweck besser als jeder Feuerwerkskörper und setzen der Phantasie erst noch keine Grenzen.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.6.2020 - Tag der 42-jährigen IT-Boys
Reto Hanselmann erleichtert nach Negativ-Test: Party-König appelliert an Party-Volk
Das Warten hat ein Ende: Reto Hanselmann (38) kann aufatmen. Der Corona-Test des Zürcher Partykönigs ist negativ. Hanselmann hatte sich Sonntagnachmittag testen lassen, nachdem er am 21. Juni eine Party im Zürcher Club Flamingo besuchte, an der ein Mann mehrere Leute mit dem Coronavirus angesteckt hatte. «Mir fällt ein Stein vom Herzen», sagt Hanselmann zu BLICK. «Ich bin sehr erleichtert, dass ich nun allen in meinem Umfeld, die ich in den letzten Tagen getroffen habe, meiner Coiffeuse, meinem Personaltrainer und meinen Freunden, Entwarnung geben kann.»
Das Warten auf das Testergebnis bereitete dem It-Boy, der sich seit Sonntag in seinem Haus in Zürich-Höngg in Selbstquarantäne befand, grosse Sorgen: «Ich hatte keine Angst um mich, aber ich hatte grosse Angst davor, andere angesteckt zu haben. Ich überlegte mir ständig, wen ich alles kontaktieren muss.»
Hanselmann feierte am besagten Abend im Flamingo Club mit rund 25 Freunden den 42. Geburtstag seiner Kollegin Edita. «Ich habe mich im Club richtig verhalten», betont er. «Ich war nie in der Masse, hielt mich den ganzen Abend in der Lounge auf und konnte Abstand halten.» Obwohl er beim Betreten des Clubs seine Kontaktdaten vollständig und korrekt hinterliess, ist er bis heute nicht kontaktiert worden. «Ich habe weder vom Club noch vom Kanton etwas gehört», so Hanselmann. «Das muss wirklich besser werden. Mir ist es wichtig, dass ich mich darauf verlassen kann, bei einer möglichen Ansteckung rechtzeitig informiert zu werden.»
Reto Hanselmann, der als Eventmanager selber Partys veranstaltet, hofft, dass die Nachtschwärmer aus dem Superspreader-Fall lernen. «An alle Clubbetreiber und Partygänger: Bitte, bitte, haltet euch an alle Regeln, sonst können wir bald gar keine Partys mehr feiern.» Schreibt Blick.
Der Hanselmann: Vom Saulus Partylus zum IT-Boy-Paulus*. Erinnert ein wenig an den Untergang der Titanic. Überheblichkeit, Ignoranz, Sorglosigkeit und Dummheit führten zur Kollision der Titanic mit einem Eisberg, womit die Party auf dem Luxusdampfer ein schreckliches Ende fand. Am Schluss blieben Titanic-Captain Edward Smith nur noch die Worte: «Women and children first? It's every man for himself on a sinking ship.» Übersetzt in die Hanselmannsche Sprachlogik: «Bitte, bitte, haltet euch an alle Regeln, sonst können wir bald gar keine Partys mehr feiern.» Was dann in der Tat wirklich und wahrhaftig schlimmer wäre als die auf der Intensivstation am Sauerstoffgerät angeschlossene Grossmutter von Hanselmann. Falls der 42-jährige «Boy» noch eine hat.
* Für alle, die noch weisse Socken tragen und nicht wissen, was ein IT-Boy ist: Der It-Boy ist das Pendant zum It-Girl und beschreibt junge Männer, die häufig in den Medien präsent sind und alles dafür tun, um berühmt zu werden. Der Beruf des It-Boys ist noch nicht offiziell anerkannt Welch' eine Diskriminierung! Da wäre nun wirklich mal eine schweizweite Demo angesagt. IT BOYS MATTER!
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
29.6.2020 - Tag der Dummheit
Rekord-Jongleur Paul Sahli (72) nach Velounfall im Spital Olten: «Ohne Helm wäre ich wohl nicht mehr da»
Der weltberühmte Fussball-Rekordjongleur Paul Sahli (72) hatte am Samstag einen schweren Velounfall. Er hatte aber riesiges Glück – auch dank seinem Helm. Doch die Schulter schmerzt am Tag danach noch immer. Paul Sahli (72) ist ein Ballvirtuose. Ein Jongliergott. Er hat 64 Einträge im Guinness-Buch der Rekorde. 1987 jonglierte er in Oslo 14 Stunden und 17 Minuten am Stück mit einem Fussball. Und kam in dieser Zeit auf fast 95'000 Ballberührungen. Er schaffte es gar mehrmals in die ZDF-Kultsendung «Wetten, dass ..?». Dort stieg er einmal eine Feuerwehrleiter hoch, während er mit einem Fussball jonglierte.
Doch nun hatte der Rentner aus Lostorf SO einen Velounfall, der schlimm hätte enden können. Passiert ist es am Samstag. «Ich fuhr mit dem Velo von Rothrist nach Aarwangen», erzählt Sahli gegenüber BLICK. Auf der Rückfahrt kommt es bei Murgenthal AG zum Unglück. Es ist eine gerade Strecke. Und es geht leicht bergab. «Ich war ein bisschen rassig unterwegs, wie immer mit dem Velo.»
Sahli wird kurz bewusstlos. Doch zum Glück trägt er einen Helm. «Hätte ich keinen Helm aufgehabt, wäre ich wohl nicht mehr da», sagt er am Tag nach dem Unfall. Es ist nicht Sahlis erster Verkehrsunfall: 2009 ist sein Auto das letzte in einer Staukolonne, als ein anderes Fahrzeug in ihn hineindonnert. «Ich hatte damals ein Schleudertrauma. Und riss mir an der Schulter drei Sehnen.» Dazu: Ablösung der Netzhaut, Hörverlust mit Tinnitus, bis heute anhaltende Rückenprobleme.
Als Sahli diesen Samstag nach der kurzen Bewusstlosigkeit wieder zu sich kam, waren bereits einige Helfer vor Ort. Am Bein hat er Prellungen, sein Ellbogen ist aufgeschürft. Und die Schulter tut sauweh. «Ich wollte nicht ins Spital. Denn ich bin nicht wehleidig.» Sahli lässt sich aber dennoch überzeugen. Ein Kollege bringt in anschliessend ins Spital nach Olten.
Am Sonntagnachmittag ist Sahli wieder bei sich zu Hause. «Ich habe grausame Schmerzen in der Schulter und im Arm.» Auf seine «Velotürli» will er aber künftig trotzdem nicht verzichten. «Das lasse ich mir nicht nehmen.» Schreibt Blick.
Alter schützt vor Torheit nicht. Oder wie Forrest Gump sagte: «Dumm ist, wer dumme Sachen macht.»
-
28.6.2020 - Tag der kinderlosen FDP-Mütter
FDP will mit «Enkelstrategie» in die Zukunft
«Es geht um eine Strategie, die aufzeigt, dass liberale und verantwortungsvolle Arbeit enkeltauglich sein muss», sagte FDP-Präsidentin Petra Gössi heute. Die Schweiz brauche einen Wirtschaftsplatz, der auch in Zukunft allen einen Arbeitsplatz garantiere. Zudem seien Sozialwerke nötig, «die gesichert sind, so dass auch unsere Enkelkinder den gleichen sozialen Schutzschild haben wie die heutigen Rentnerinnen und Rentner», sagte Gössi.
«Wir haben die Verantwortung, unseren Kindern und Enkelkindern einen intakten Lebensort zu hinterlassen, sowohl was die Umwelt, als auch die Infrastrukturen betrifft.» Sagt Petra Gössi, die kinderlose Präsidentin der FDP.
Weiter sagte Gössi, der Wind im eidgenössischen Parlament habe mit den letzten Wahlen deutlich geändert. «Die vereinigte Linke mit den Grünen und der SP arbeiten mit Unterstützung einer vermeintlich liberalen Linkspartei und einer sich selbst suchenden Mitte fröhlich an einer neuen Schweiz, die sich durch mehr Interventionismus auszeichnet», sagte Gössi. Vorrangig werde die eigene Klientel bedient. Lösungen für das Gesamtsystem würden nicht gesucht.
Vergessen gehe, dass es eigentlich die Steuerzahler und die Unternehmen seien, die am relevantesten für das Staatssystem seien. Deshalb müssten deren Interessen im Vordergrund stehen. «Ohne wirtschaftlichen Erfolg gibt es keine Steuereinnahmen und ohne Steuereinnahmen kann niemandem geholfen werden», sagte Gössi.
Seit Neustem spiele sich die SP-Sitze auch wie die vermeintliche Retterin der KMU auf. So kämpfe diese für staatlich verordnete Mietzinserlasse, ungeachtet dessen, «dass die Rechnung von unseren Pensionskassen bezahlt werden muss», sagte Gössi. Zudem würden damit zwei der wichtigsten Werte in der Verfassung, die Eigentums- und Vertragsfreiheit, beschnitten. Schreibt SRF.
Ausgerechnet «Greta» Gössi, die Frau ohne Kinder und ohne Ehering, entdeckt die Kinder und schlüpft – einmal mehr – in eine neue Rolle als «Mutter Theresa-Greta-Petra». Der von den «bürgerlich liberalen Freisinnigen» seit jeher frei von Sinnen instrumentalisierte Generationenkonflikt feiert ein Revival als dämliche Parole verpackt in neue Worte.
Der absolute Brüller der fleischgewordenen Wendehälsin Gössi aber ist ihr Vorwurf an die Parteien ausserhalb des «bürgerlichen» Blocks, diese würden ihre eigene Klientel bedienen.
Das sagt Greta-Petra ohne Schamröte im Gesicht und wippt dazu mit den mütterlichen Füssen in den Birkenstocksandalen.
Dass alle Parteien ohne Ausnahme in erster Linie ihre eigene Klientel bedienen ist eine altbekannte Tatsache und als solche sogar in den Parteiprogrammen festgeschrieben.
Wenn es aber eine Partei gibt, die das System der Klientelbewirtschaftung in den letzten Jahrzehnten pervertiert hat, dann mit Sicherheit die FDP.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
27.6.2020 - Tag der Cleverness
Kanzler Kurz kratzt an seinem Nimbus
Nach dieser Woche kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die ÖVP die Einrichtungen unserer Demokratie nicht ernst nimmt. Die Auftritte von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel waren von einer Missachtung der Abgeordneten getragen, die im Untersuchungsausschuss versuchen, die politischen Hintergründe von Postenbesetzungen in dieser Republik auszuleuchten. Nein, Kurz muss sich nicht alles gefallen lassen, Blümel auch nicht, aber die Herablassung und die unterschwellige Aggression, die hier zutage traten, waren nicht angebracht. Bei der Opposition übrigens auch nicht. "Die geht mir so am Oasch" ins versehentlich noch eingeschaltete Mikrofon zu sagen, wie das der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper offenbar im Ärger über die Verfahrensanwältin passierte, ist eine schwere Entgleisung, für die sie sich entschuldigen und nicht herausreden sollte. Gerade die Neos appellieren doch immer an den Anstand, hier wäre Gelegenheit, welchen zu zeigen.
Die Taktik der ÖVP scheint es jedenfalls zu sein, den U-Ausschuss lächerlich zu machen und zu diskreditieren, damit dessen Arbeit in der Öffentlichkeit nicht mehr ernst genommen wird. Man weiß ja nicht, was noch alles herauskommen könnte.
Die vermeintliche Ahnungslosigkeit und die Erinnerungslücken, mit denen sich Kurz und Blümel vor dem Ausschuss regelrecht brüsteten, sind eine Respektlosigkeit, lassen aber auch die Protagonisten nicht gut dastehen. Ein Kanzler, der über Vorgänge in der Republik nicht Bescheid weiß, ein Finanzminister, der sich kaum noch an das vergangene Jahr erinnern kann – echt jetzt?
Auch andere ÖVP-Spitzenrepräsentanten trugen diese Woche dazu bei, das politische Niveau nach unten zu drücken: Verfassungsministerin Karoline Edtstadler verglich bei einer Rede zum Baubeginn einer Shoah-Gedenkmauer die Massenvernichtung der Juden mit dem Unfalltod ihres Großvaters. Da war sie auch sehr traurig. Das war sicher nicht so gemeint, ist aber eine bodenlose Geschmacklosigkeit, die sich ein mit Intelligenz ausgestattetes Regierungsmitglied nicht leisten dürfte.
Apropos. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bewegt sich am Rande des politisch Erträglichen. Oder darüber hinaus. Die Ministerin hat diese Woche eine Reform des Bundesheeres präsentieren lassen, die eine Abkehr von der militärischen Landesverteidigung beinhaltet. Ein Kernstück der Verfassung würde damit ausgehebelt. Der Koalitionspartner wusste nicht Bescheid, der Bundespräsident, immerhin Oberbefehlshaber des Bundesheeres, auch nicht. Tanner ruderte zurück, tat ihre Reformpläne als schlecht geglückten Scherz ab.
Und dann dieser Fernsehauftritt. Das Interview in der "ZiB 2" war grotesk. Nicht nur, dass sich die Ministerin selbst zum Kasperl machte, das war eine Beleidigung der Intelligenz der Zuschauer, aber auch eine Zumutung für die Moderatorin. Dass Politiker keine Antworten geben und nur auswendig gelernte Sprechblasen aufsagen, ist man gewohnt, aber Tanner trieb es auf die Spitze.
Sich so dumm zu stellen ist eine Respektlosigkeit den Zuschauern gegenüber und eine Missachtung der Demokratie. In dieser Woche haben Kurz und seine Mannschaft schwer an seinem Nimbus als Kanzler gekratzt. Sie haben die Politik lächerlich gemacht. Sie haben uns allen keinen guten Dienst erwiesen; sich selbst auch nicht, das ist nicht einmal ein Trost. Schreibt Michael Völker in seiner Kolumne im STANDARD.
Ein österreichischer Freund, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, weil Charlie Stecher von der Salzburger Hopfen & Malz-Presse ja noch lebt, schrieb kürzlich eine WhatsApp-Nachricht: «Jo mei, Österreich is (ist, auf Deutsch) eh seit langem oa (eine, auf Deutsch) Bananenrepublik. Nicht erst seit HC Strache und Sebastian Kurz mit seiner Wasserleichenfrisur». Da hat der gute Charlie vermutlich recht, auch wenn die Wasserleichen es nicht verdienen, mit der Kurzschen Haartolle verglichen zu werden.
Jörg Haider, Sinowatz, Vranitzky, Klima, Schüssel, Gusenbauer, Faymann, Mitterlehner, Kern und wie sie alle hiessen, waren vermutlich in Sachen legaler und illegaler Kleptomanie zum Wohle der Partei und gelegentlich auch für sich selbst keine Kinder von nobler Zurückhaltung. Doch der vom israelischen Geheimdienst gehätschelte Sebastian Kurz hat das Parteispenden-System und den lukrativen Postenschacher für Parteimitglieder perfektioniert. Seine berühmt berüchtigte «Message Control» und eine gekünstelte Vergesslichkeit, die an die Demenz eines 80-Jährigen erinnert, gepaart mit einer Chuzpe sondergleichen, sind nur ein paar Mosaiksteinchen im politischen Handeln des elitären Politikers mit der brachialen Ideologie der «bürgerlichen» und freisinnigen (Frei von Sinnen) Jung-Neoliberalen.
Emmanuel Todd nennt in seinem auch und vor allem heute noch lesenswerten Buch «Weltmacht USA: Ein Nachruf» (Originaltitel: Après l’empire: Essai sur la décomposition du système américain) aus dem Jahr 2002 drei Gründe für den Untergang der Weltreiche seit der Antike: 1. Räumliche Überdehnung, 2. Zerfall der Demokratie und 3. die Zunahme der Dekadenz. Punkt zwei und drei sind in den Staaten der westlichen Wertegemeinschaft längst erreicht, wenn nicht gar überschritten. Punkt eins, die UdSSR lässt grüssen, in globaler Hinsicht mit Blick auf den Handel ebenfalls.
Doch wir Schweizerinnen und Schweizer sollten uns hüten, mit dem Finger nun auf Österreich zu zeigen. Mit einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung um + - 40 Prozent ist der Prozess des Demokratiezerfalls längst auch im Lande Wilhelm Tells angekommen. Über die zunehmende Dekadenz brauchen wir uns wohl kaum zu unterhalten.
Einen Unterschied zu Österreich gibt es allerdings: Unsere Eliten aus dem Hohen Haus sind etwas cleverer, werden liebevoll «Pöstchen-Jäger*innen» und / oder «Lobbyisten*innen» genannt, und lassen sich kaum erwischen. Ausgenommen «Kasachstan»-Christa Markwalder. Oder alt Nationalrat Christian Miesch. Beide von der SVP. Der Partei der Mühseligen und Beladenen scheint es tatsächlich an «Smartness» zu fehlen.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
26.6.2020 - Tag es nicht vorhandenen Verantwortungsbewusstseins
Alleingang der freiwilligen Massnahmen und Herdenimmunisierung misslungen: Warum Schwedens Covid-19-Sonderweg gescheitert ist
Schweden setzte auf den Alleingang durch die Coronakrise. Nun hat das Land pro Kopf bald so viele Todesopfer wie Italien. Die Eindämmung des Virus durch lockere Massnahmen und durch Appelle an das Verantwortungsbewusstsein von Bürgern ist gescheitert.
Schweden hat grösstenteils auf Freiwilligkeit und die Vernunft von Bürgern gesetzt, um das Coronavirus einzudämmen. Der Staat hat keinen Lockdown beschlossen. Die Bevölkerung sollte freiwillig Massnahmen ergreifen. Das öffentliche Leben ging praktisch normal weiter, während das restliche Europa und Länder rund um die Welt harsche Lockdowns einführten.
Schwedens Sonderweg erntete aufmerksame Blicke aus der ganzen Welt. Am Anfang sah das auch ganz gut aus. Infektionszahlen blieben unter dem europäischen Durchschnitt. Menschen genossen auf Terrassen von Cafés die Frühlingssonne, Schulen blieben geöffnet. Das Virus schien unter Kontrolle.
Diese Freiwilligkeit, das war das Konzept von Schwedens Chefepidemiologen Anders Tegnell (64), an dessen Seite sich auch Premierminister Stefan Löfven (62) oft zeigte. Drastische Eingriffe hielten beide für falsch. Auf Dauer könne man Menschen nicht zu Hause einsperren. Eine gewisse Zahl von Infektionsfällen sei tolerierbar, weil die Bevölkerung dadurch nach und nach Immunität aufbaue.
Doch es wollte nicht mit der angestrebten Herdenimmunisierung. Tegnell schob das Datum immer wieder hinaus, bis bessere Zahlen vorliegen würden. Inzwischen ist das Scheitern der Strategie deutlich geworden. Im April und im Mai sind in Schweden weit mehr Menschen als im langjährigen Durchschnitt gestorben. Dabei entsprechen die zusätzlichen Toten in etwa der Zahl der bislang 5230 Corona-Toten. Tegnell hat unlängst eingestanden, dass ein etwas restriktiverer Weg wohl besser für sein Land gewesen wäre.
Inzwischen weisen die Skandinavier rund 50 Corona-Tote pro 100'000 Einwohner auf. In der Schweiz liegt die Zahl bei 19,7. Damit zählt Schweden in diesem Verhältnis mehr Tote als Frankreich (44,3) oder auch die USA (36,7). In Europa weisen nur Belgien (84,8), Grossbritannien (64,3), Spanien (60,5) und Italien (57,3) eine höhere Corona-Sterblichkeit auf. Doch Belgien zählte auch Tote in Altersheimen teils ohne Corona-Test.
Steigende Zahl von Neuinfektionen
Die meisten Covid-19-Toten in Schweden beklagen Altersheime. Neun von zehn Corona-Toten im Land waren älter als 70. Und die Opferzahlen steigen weiterhin an. Eine Abflachung der Kurve, wie sie in den meisten europäischen Ländern deutlich erkennbar ist, ist weiterhin nicht abzusehen.
Während auch Neuinfektionen in vielen europäischen Ländern zurückgegangen sind, weist Schweden seit Monatsbeginn täglich rund 1000 neue Ansteckungen auf. Die aktuellste Zahl vom 24. Juni liegt gar bei 1610 Neuinfektionen, während 48 weitere Todesfälle gemeldet wurden. Zwei Tage zuvor verstarben 69 weitere Menschen am Virus. Geht es so weiter, könnte Schweden in rund einem Monat Italien bei der Todesrate überholen. Dies, während in der Schweiz in den vergangenen sieben Tagen nur zwei Virustote gemeldet wurden.
Unklar bleibt, wie Schweden auf den Ausbruch einer zweiten Welle reagieren würde. Ob das Land dann besser gewappnet wäre als seine Nachbarn Finnland, Norwegen oder auch Deutschland. Angesichts der vorliegenden Daten hat sich Schwedens Sonderweg soweit als Irrweg erwiesen. Schreibt Blick.
Dass Appelle an das Verantwortungsbewusstsein von Bürgern so sinnlos sind wie ein Fahrplan ohne die Eisenbahn der SBB sieht man am derzeitigen, nonchalanten Tri-Tra-Tralla-Benehmen tagtäglich auch in der Schweiz. Selbst wenn Daniel Koch und Bundesrat Berset viel Unsinn verzapft haben, ist ihre Warnung vor einer zweiten Welle nicht unbegründet, solange das Virus noch unter uns weilt und ein Impfstoff fehlt.
-
25.6.2020 - Tag der menschlichen Dummheit
Kantonsärzte mahnen zur Vorsicht bei Auslandreisen: Reisende bringen Coronavirus in die Schweiz zurück
Was zuvor schon in China der Fall war, erweist sich jetzt auch in der Schweiz als Problem. Während die Ansteckungslage im Land unter Kontrolle scheint, führen geöffnete Grenzen dazu, dass sich Menschen im Ausland anstecken und das Virus zurück ins Land bringen. Eine Zeit lang hatte China, das mutmassliche Ursprungsland der Coronavirus-Pandemie, die Infektionslage unter Kontrolle. Aber dann erwiesen sich Reisende, die nach China zurückkehrten, als Problem. Hunderte schleppten das Virus zurück ins Land ein. Nur ein striktes Quarantäne-Regime und neue Reisebeschränkungen halfen, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. In derselben Situation, die auch Thailand beobachtete, das den internationalen Flugverkehr erst im September wieder aufnehmen will, befindet sich jetzt offenbar auch die Schweiz. Demnach haben mehrere Reisende das Coronavirus aus dem Ausland in die Schweiz zurückgebracht. Das sagte der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, dem «Tages-Anzeiger». Es handle sich dabei nicht nur um Einzelfälle. Betroffen sind neben Zug auch mehrere andere Kantone. iese neuen, importierten Corona-Fälle folgen auf die Öffnung der Grenzen am 15. Juni. Mit Auslandreisen, konkret in den Corona-Hotspot Mailand, hatte die Corona-Welle in der Schweiz auch begonnen. Contact-Tracer der Kantone spüren diese neuen Ansteckungen auf. Befragungen ergeben dann, wo sich die Infizierten exponiert haben und wem sie das Virus möglicherweise weitergegeben haben könnten. Jetzt mahnen Kantonsärzte zur Vorsicht bei Auslandreisen, so Hauri. Die betroffenen Reisenden seien zuvor in «europäischen Ländern mit hoher Virusaktivität» unterwegs gewesen. Einzelne Staaten nennt Hauri nicht. Vor zehn Tagen wurden die Grenzen für Reisen im Schengen-Raum wieder geöffnet. Dazu gehören unter anderem die Länder Italien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien oder auch Schweden, in denen Covid-19 stärker verbreitet ist als in der Schweiz. Schreibt Blick.
Egoismus, Sorglosigkeit und Ignoranz verdrängen bei vielen Menschen die Tatsache, dass das Virus immer noch unter uns weilt. Und zwar weltweit. Wozu soll man sich denn Sorgen machen, werden sich die Reiselustigen wohl fragen? Der Bund bezahlt ja schliesslich die Kollateralschäden. Also «Hopp de Bäse» und rein ins nächste Flugzeug. Albert Einstein soll mal gesagt haben*: «Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.» Dem ist nichts hinzuzufügen. Ausser vielleicht, dass sich beide – Universum und Dummheit – ausdehnen.
* Die Echtheit des Einstein-Zitats ist nicht verbürgt, wird ihm aber zugeschrieben.
-
24.6.2020 - Tag von Frau Abdullah
Früher trug er einen Islamisten-Bart, heute hat er rot lackierte Fingernägel: der Mann, der Abdullah war
Ein Gründungsmitglied des Islamischen Zentralrats Schweiz steht vor dem Bundesstrafgericht wegen Terrorpropaganda. Inzwischen hat er sich von der Szene distanziert und spricht selbstkritisch über seine dunkle Phase. Er hat seine Fingernägel rot lackiert und trägt sieben Piercings. Damit lebt er seine weibliche Seite aus, wie er sagt. K. C. ist 35 Jahre alt und wohnt in einer Gemeinde der Nordwestschweiz. Zwischen 20 und 32 sah er ganz anders aus. Damals trug er einen fusseligen Bart und nannte sich Abdullah. Er war Islamist. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, 2014 und 2015 über Facebook und Whatsapp Propaganda für die Terrororganisation IS verbreitet zu haben. Deshalb steht er nun vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Abdullahs Geschichte beginnt er mit seiner Kindheit. Seine Mutter erzog ihn anthroposophisch. Die Anthroposophie, die esoterische Lehre von Rudolf Steiner, sei eine enge Weltanschauung – wie der Islamismus. Schon früh merkte er allerdings, dass er auch in anderer Hinsicht anders war. Niemand durfte davon erfahren: «In der Pubertät habe ich eine weibliche Seite in mir entdeckt. Mir gefiel es, Frauenkleider zu tragen. Das war aber ein Gesicht von mir, das ich verbergen wollte. Mit 18 wurde ich dann von einer Nachbarin erwischt, als ich meine Frauenkleider in einem Park versteckt hatte. Sie erzählte es meinen Eltern. Ich entwickelte Suizidgedanken. Sie schickten mich zu einer Therapeutin, die mich jedoch nicht verstand.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Oh Allahu akbar sei uns gnädig. Was es heutzutage alles gibt: Nebst schwulen, halbschwulen und asexuellen Ständer-Räten nun auch noch schwule Gotteskrieger! Langsam aber sicher wird's denn doch etwas zu bunt. Der Tag ist nicht mehr fern, an dem die vom Aussterben bedrohten Heten unter Artenschutz gestellt werden müssen.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
23.6.2020 - Tag der Dummschwätzer
Soll der Aargau 500 Flüchtlinge aufnehmen? Andreas Glarner hat eine andere Idee
Die Flüchtlingslager in Griechenland sind überfüllt. Organisationen aus dem Asylbereich verlangen, dass der Kanton mehr Flüchtlinge aufnimmt. Doch die Regierung lehnt dies ab und von rechts kommt heftiger politischer Gegenwind.
Turnschuhe, Flip-Flops, Gummistiefel. Kinderschuhe, Männerschuhe, Frauenschuhe. Wer am Wochenende in Aarau oder Baden unterwegs war, begegnete 500 Paar Schuhen. Aufgereiht vom Bahnhofplatz bis zum Schulhausplatz in Baden und vom Graben bis zum Casinopark in Aarau. Hinter der Installation anlässlich des Flüchtlingstags stecken mehr als zwanzig Aargauer Hilfswerke und Freiwilligenorganisationen – darunter der Verein Netzwerk Asyl Aargau.
Die 500 Paar Schuhe stehen symbolisch für 500 geflüchtete Menschen. 500 Menschen, die im Moment – zusammen mit mehreren Zehntausend anderen – in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln feststecken und für die es im Aargau Platz hätte, wie Netzwerk Asyl in einer Mitteilung schreibt. Wer mit dem Aargauer Appell solidarisierte, konnte direkt vor Ort eine Postkarte adressiert an Regierungsrat Urs Hofmann unterschreiben.
Von der Forderung hat die Regierung bereits Kenntnis. Ende April haben Netzwerk Asyl und andere Aargauer Organisationen wie Caritas Aargau oder das Heks den Regierungsrat dazu aufgefordert, 500 Menschen aus Griechenland im Kanton Aargau aufzunehmen. In den Flüchtlingscamps herrsche schlimmste Not. Die Menschen seien unter unwürdigsten Bedingungen eingeschlossen. Auf der Insel Lesbos gebe es nur gerade einen Wasserhahn für 1300 Personen und ein WC für 200 Personen. Die Lage der Menschen sei unerträglich, so Netzwerk Asyl in einer Mitteilung. In der Mitteilung findet sich auch eine Berechnung: 500 weitere Flüchtlinge auf 687'207 Aargauerinnen und Aargauer würden eine Quote von einem Flüchtling auf 1356 Einwohner des Kantons ergeben.
Das Anliegen wird auch politisch unterstützt, unter anderem von SP und Juso, den Grünen und den Jungen Grünen. Support für das Anliegen gibt es von SP-Aargau-Präsidentin und Nationalrätin Gabriela Suter, die selber in Aarau wohnt und auf Facebook einige Fotos postete: «Eindrückliche Aktion zum Weltflüchtlingstag. Der Aargau soll 500 geflüchtete Menschen aufnehmen», schrieb sie dazu. Als Dublin-Staat trage auch die Schweiz eine Mitverantwortung für die heute herrschende humanitäre Katastrophe auf den griechischen Inseln, ergänzte Suter. «Evakuieren, jetzt!», fordert sie.
Andreas Glarner, SVP-Aargau-Präsident und Nationalrat, besuchte vor rund drei Jahren selber ein Flüchtlingslager in Griechenland. «Es ist brutal, in welchen zum Teil menschenunwürdigen Umständen diese Menschen leben», sagte er damals im «Blick». Glarner hielt weiter fest: «Wir müssen jenen Flüchtlingen, die schon in Europa sind, mehr helfen, als wir das bislang taten.»
Wie steht der SVP-Asylchef zur Forderung, der Kanton Aargau solle 500 Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland aufnehmen? «Ich stehe zu meiner Aussage, dass wir diesen Menschen unbedingt helfen müssen, die Zustände in den Lagern auf den griechischen Inseln sind heute noch bedenklich schlecht», sagt Glarner auf Anfrage. Allerdings sei sein Aufruf, mehr zu tun für die Flüchtlinge, nicht als Einverständnis zu verstehen, mehr Migranten in den Aargau zu holen. «Wenn der Kanton etwas Sinnvolles tun möchte, dann soll er Geld an ein Hilfswerk spenden, das in Griechenland aktiv ist», sagt er.
Ähnlich argumentierte Glarner schon als Gemeindeammann von Oberwil-Lieli, das sich jahrelang geweigert hatte, Flüchtlinge im Dorf aufzunehmen. «Aus unserer Gemeinde kamen über 400'000 Franken an Spenden für das Hilfswerk Swisscross.help, so konnten die Verhältnisse in Griechenland verbessert werden», betont er. Es sei einfach, von Kanton und Bund die Aufnahme von Flüchtlingen zu fordern, «aber ich frage mich, was die Leute, die solche Aufrufe unterschrieben, selber tun.» Glarner sagt ausserdem, die Aufnahme von 500 Flüchtlingen würde das Problem nicht lösen: «In Afrika kommen alle zwölf Tage eine Millionen Menschen zur Welt, die sich ein besseres Leben wünschen.» Bei diesen Zahlenverhältnissen sei klar, dass die Schweiz nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen könne. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Um es gleich vorwegzunehmen: Was unser aller Dummschwätzer Andreas Glarner absondert, darf ruhig zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Easy come, easy go. Konvertiten wie Glarner, die vom Saulus zur Mutter Theresa der Flüchtlingskinder mutieren, sind nicht ernst zu nehmen und unterliegen Stimmungsschwankungen, die beim Psychiater vermutlich unter den Begriff «pathologisch» fallen würden.
Die Bemerkung aus dem von den Medien sorgsam gehüteten Tabuthema über die Fertilität der afrikanischen Frauen und Männer ist einmal mehr ein gezielter Brüller von Glarner, der an den SVP-Stammtischen wohl einige Schenkelklopfer erzeugen wird. Oder klammheimlichen Neid bei den Bauern, die eine Bäuerin suchen.
Aber im Zusammenhang mit den griechischen Flüchtlingslagern verwechselt Glarner, wie schon Johann Wolfgang von Goethe treffend bemerkte «Man liebt Ursache und Wirkung zu verwechseln», genau diese Ursachen und Wirkungen.
Die hehren Standards in der Flüchtlingspolitik der EU verursachen die griechischen Zustände. Eine Gemeinschaft, die nicht einmal ihre Grenzen schützen kann und ein verwerfliches Geschäft mit hilfsbedürftigen Menschen den Schleppern und NGO's überlässt, ist keine Wertegemeinschaft, sondern ein Armutszeugnis sondergleichen.
Es brauchte das Coronavirus, damit Griechenland erstmals in seiner Geschichte als EU-Mitgliedsstaat die Grenzen ohne Widerspruch aus der Brüsseler Gutmenschenzentrale schliessen durfte.
Dass Brüssel bisher noch immer sehenden Auges sowohl bei Griechenland wie auch bei Italien mit Hilfe vor Ort und mit Geldmitteln zuwartete, bis sich Tragödien menschlichen Leids und unvorstellbare Zustände in den Flüchtlingslagern zuspitzten, ist eine Tatsache. Den Griechen und Italienern fehlt scheinbar das Erpressungspotenzial von Erdogan, der mit der EU Katz und Maus spielt.
Und wer grosse Töne spuckt wie die Vertreter*innen der NGO's, die letztendlich auch nur von dieser Flüchtlingstragödie im wahrsten Sinne des Wortes leben, sollte ein Konzept mitliefern, wie die Zukunft der geretteten Flüchtlinge in der Schweiz erfolgreich zu gestalten ist.
Wer in einem Flüchtlings-Hotspot in der Schweiz lebt, kann ein Lied davon singen, dass die meisten und gutgemeinten staatlichen Umsetzungen bezüglich Schulung, Integration und Jobvermittlung bisher kläglich gescheitert sind. In Luzern enden sie in der Regel im Nirgendwo zwischen Europaplatz, Inseli und Aufschütti. Oder im Bestfall in einem der unzähligen arabischen Barbershops, die den Angestellten zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben bezahlen. Der Worstcase bedeutet allerdings Endstation Drogenverkauf, formerly known as Dealer, auf den vorerwähnten Trampelpfaden.
Und das alles hat sich mit der Coronakrise erst noch verschärft. Billiglohn-Arbeitnehmer*innen werden in naher Zukunft in der Schweiz keine Mangelware sein. Die Zuwendungen aus den Giesskannen der sozialen Hilfskassen allerdings schon. Denn Giesskannen haben es so an sich, irgendwann mal zu versiegen. Bundesrat Ueli Maurer fühlt sich ja nicht umsonst «nicht mehr so wohl in seiner Haut»* wie auch schon.
* Geäussert im Interview mit der NZZ.
-
22.6.2020 - Tag der Bullshit-Argumente
SVP fordert Risiko-Prämien – Sollen Kosovaren mehr Arbeitslosen-Beiträge zahlen?
Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist bei Ausländern grösser als bei Schweizern. Die SVP findet, dass sich das auch in den Beiträgen der Arbeitslosenversicherung niederschlagen muss. BLICK zeigt, was das bedeutet. Ausländer sind häufiger arbeitslos als Schweizer – das zeigt die offizielle Statistik. 2019 etwa betrug die Arbeitslosenquote der Schweizer 1,7 Prozent, jene der Ausländer aber 4,4 Prozent.
Angesichts dieser Zahlen findet es die SVP «ungerecht», dass alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich hohe Beiträge an die Arbeitslosenversicherung (ALV) bezahlen müssen. Am Freitag hat die Fraktion daher einen Vorstoss eingereicht, der das ändern soll: Wie hoch die Beiträge an die ALV sind, soll vom Risiko abhängen, dereinst auch Arbeitslosengeld zu beziehen.
Bei der Risikobeurteilung will die SVP nicht einfach zwischen Schweizern und Ausländern unterscheiden, sondern den einzelnen Nationalitäten. «Es kann doch nicht sein, dass etwa Arbeitnehmende aus Dänemark, die in der Schweiz eine Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent haben, gleich hohe Prämien zahlen müssen wie Osteuropäer, die viel häufiger arbeitslos sind», sagt der Zürcher Nationalrat Thomas Matter (54). Gemäss dieser Logik müssten Bürger afrikanischer Staaten am meisten in die ALV einzahlen – ihre Arbeitslosenquote lag 2019 bei 8 Prozent. Teuer würde es auch für Bulgaren (7,3 Prozent), Kosovaren (6,2 Prozent) und Rumänen (6 Prozent). Glimpflicher davonkommen dürften Deutsche (2,5 Prozent), Österreicher (2,4 Prozent) und Dänen (2,1 Prozent).
Das Vorbild findet die SVP in der Motorfahrzeugversicherung. Dort etwa sei es selbstverständlich, dass Personen aus Ex-Jugoslawien höhere Prämien zahlen, weil sie mehr Unfälle verursachen als Schweizer. Dieser Grundsatz, so die SVP, solle auch für die ALV gelten. Dass die Berechnung der Beiträge ziemlich viel Aufwand bedeuten würde, ist Matter bewusst. «Damit die Bürokratie nicht überhandnimmt, würden wir einen Mehrjahresdurchschnitt vorschlagen, so dass die Beiträge nur alle drei bis fünf Jahre neu berechnet werden müssten», schlägt er vor. Für Matter hätte das System einen weiteren grossen Vorteil: Weil die Hälfte der ALV-Beiträge durch die Arbeitgeber bezahlt wird, würde deren Anreiz sinken, «noch mehr Billigarbeiter mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko aus der EU zu holen».
Der Gedanke der SVP liesse sich natürlich weiterspinnen: Frauen müssten ebenfalls weniger ALV bezahlen, weil sie gemäss Statistik seltener arbeitslos sind als Männer. Und die Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen müsste höhere Beiträge zahlen als über 55-Jährige, weil auch sie ein höheres Risiko haben. Was den Vorteil hätte, dass der Anreiz, ältere Mitarbeiter auf die Strasse zu stellen, sinken würde – weil diese ja bei der ALV «günstiger» würden. Davon aber hält Matter nichts. «Ein altersbasierter Beitrag wäre mit grossen Risiken verbunden: Wenn die Arbeitslosigkeit bei den über 55-Jährigen steigt, würde man ihre Chance reduzieren, wieder einen Job zu finden.» Schreibt Blick.
O je! Die SVP lässt aber auch gar nichts unversucht, ihre eigene Partei abzuschaffen. Dämliche Bullshit-Argumente werden bemüht, um die langsam aber sicher aussterbende Hardcore-Klientel am äussersten Rand zu bedienen. Und dies vorgetragen von einem Thomas Matter, der noch nicht mal der Dümmste der Partei ist. Was bei der SVP etwas heissen will!
Das wird die Begeisterung an den Wahlurnen für die von Kampagnen- und Wahlniederlagen gebeutelte Partei auch nicht wesentlich in neue Höhen treiben. Vergleiche mit Motorfahrzeugversicherungen herbeizuziehen klingen zwar auf den ersten Blick gut, halten jedoch keiner vernünftigen Beurteilung statt. Private Versicherungsgesellschaften können nun mal im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten schalten und walten wie sie wollen. Staatliche Versicherungen können das nicht. Damit ist die Suppe bereits gegessen.
Zumal dieser SVP-Unsinn weiteren Modellen der Prämienberechnung für die AVL Tür und Tor öffnen würde. Was, wenn jemand plötzlich feststellt, dass unverhältnismässig viele SVP-Wähler*innen arbeitslos werden? Müssten dann die Heerscharen vom Herrliberger Jesus Christophorus, der seit den Wahlniederlagen längst nicht mehr trockenen Fusses über den Zürichsee marschieren kann, auch höhere Prämien bezahlen?
-
21.6.2020 - Tag des billigen Fleisches
Teure Billigproduktion – Lebensmittelproduktion und Corona
Die gehäuften Corona-Fälle in deutschen Schlachtbetrieben lenken die Aufmerksamkeit auf die Bedingungen der Fleischmassenproduktion: Billigarbeiter aus Osteuropa, in Massenquartieren untergebracht, enger Kontakt am Arbeitsplatz, Ansteckungsgefahr riesig. Analog dazu sah man vor kurzem die armseligen, unhygienisch wirkenden Quartiere für osteuropäische Erntehilfsarbeiter bei einem Gemüsebetrieb in Niederösterreich: So hat man sich eine sicherheitsgerechte Unterbringung in Corona-Zeiten eher nicht vorgestellt. Das Wiener Kalbsschnitzel im Wirtshaus stammt mit einiger Wahrscheinlichkeit aus den Niederlanden, berichtete die ORF-Doku "Am Schauplatz" vor kurzem. Nicht viel anders bei Rindern und Puten. Ist halt billiger. Heimische Bauern können da oft nicht mithalten. Wobei diese heile Welt – "aus heimischer Produktion" –, die uns oft in der Werbung begegnet, eben oft eine geschönte Realität ist. Die dunkle Kehrseite der billigen Lebensmittelproduktion ist den meisten wahrscheinlich bewusst, sie wird aber verdrängt. Genauso wie die gesundheitlichen Probleme durch den zu hohen Fleischkonsum, die Quälerei für die Tiere und die Umweltvernichtung durch riesige Anbauflächen für Tierfutter in den Entwicklungsländern (Brandrodungen am Amazonas). Verdrängung ist eben ein unheimlich starker psychologischer Mechanismus. Schreibt Hans Rauscher in DER STANDARD.
Die Corona-Pandemie hat unglaublich viele Schwachstellen in unserer globalisierten Wirtschaftswelt aufgedeckt. Gelernt haben wir daraus nichts. Die guten Vorsätze aus den hehren Leitartikeln sind alle längst in der Versenkung verschwunden. Nur das Virus und die ungelösten Probleme bleiben.
-
20.6.2020 - Tag des Kriegs um Worte
Robert Dubler: Bis zu 5000 Kartons in Verzug: «Ich kann gar nicht so viele Mohrenköpfe produzieren, wie die Leute wollen»
"Situation am Schalter ausser Kontrolle", heisst es fett in Orange auf der Startseite von Dubler Mohrenköpfe. Selten hat eine Süssspeise solch hohe Wellen geschlagen. Als die Migros Zürich die schokoladenüberzogene Schaumsüssigkeit von Dubler vor rund einer Woche aus den Regalen verbannte, flammte die Debatte, ob "Mohrenköpfe" noch "Mohrenköpfe" heissen dürfen – oder ob dies rassistisch sei, neu auf. Der Nachfrage von Dublers Mohrenköpfen tut dies keinen Abbruch. Im Gegenteil. Kunden rennen Produzent Robert Dubler seither die Bude ein. "Ich kann gar nicht so viel produzieren, wie die Leute wollen", sagt der 73-jährige Aargauer. Aktuell sei er mit 4000 bis 5000 bestellten Kartons in Verzug – und das, obwohl er an seinem Standort in Waltenschwil nur noch einen Karton pro Person herausgibt. "Die Leute reissen mir die Mohrenköpfe nur so aus der Hand", sagt Dubler und appelliert an seine Kunden: "Ich bitte Sie, Geduld zu haben", sagt er. Die Wartezeit für die beliebten Mohrenköpfe betrage aktuell bis zu zwei Wochen. Auch auf der Homepage werden Kunden in diesen Tagen gebeten, erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbeizukommen. Rassismus oder Tradition: Nicht zum ersten Mal gerät Robert Dubler zwischen die Fronten. Zuletzt gingen 2017 die Wogen wegen des Begriffs "Mohrenkopf" hoch. Rund 1500 Personen unterschrieben die Forderung, Dubler solle seine Süssigkeit umbenennen.
Damals zeigte sich die Migros Zürich noch unbeeindruckt. Nun beugte sie sich im Zuge der Black-Lives-Matter-Demonstrationen auf der ganzen Welt dem Druck und warf das Produkt aus dem Sortiment. Robert Dubler lässt das kalt. Den Rassismus-Vorwurf wies er bereits vor drei Jahren entschieden zurück. Am Namen seines Traditionsprodukts will er festhalten. "Es stört mich nicht, wenn der Mohrenkopf Diskussionen auslöst. Ich finde es gut, wenn über Rassismus diskutiert wird. Die Welt wird aber nicht weniger rassistisch, wenn ich den Namen ändere", sagte er kürzlich in einem Interview.
Robert Dubler hat bei der offensiven und knallharten Krisenbewältigung rund um seine Mohrenköpfe und den Presse-Shitstorm alles richtig gemacht und den Steinbruch-Tussies aus den Marketingabteilungen, die von frühmorgens bis spät in den Abend hinein ihre dämlichen Floskeln von der HSG St. Gallen herunterbeten, eine Lektion erteilt, die eigentlich in die Marketing-Lehrbücher eingehen müsste. Von Dubler lernen heisst siegen lernen und würde erst noch weniger Flops* produzieren. Haltung, Stil und Stärke zu zeigen, statt Social-Media-Müll zu produzieren. Nicht einzuknicken vor einer kleinen Minderheit, die lautstark über ihre Durchlauferhitzer in den Wald schreit; angestachelt von einem Giganten aus der Detailhandelsbranche, der sich wohl nicht bewusst war, dass schon David den Kampf gegen Goliath gewonnen hatte. Es wurde Dubler allerdings auch leicht gemacht. Denn diese Diskussion mit dem Keulenargument des Rassismus um ein einziges Wort war so durchschaubar und absurd, dass sie schlicht und einfach in den Köpfen nicht die gewollte Wirkung erzeugen konnte. Denn selbst Analphabeten leuchtete relativ schnell ein, dass durch diesen kruden Wortkrieg im Umkehrschluss mehr oder weniger der ganze Duden toxisch beladen wäre und selbst Johann Wolfgang von Goethes Verse auf dem Index landen würden. Nicht mal die geheiligte Bibel käme ungeschoren davon.
* Über 70 Prozent aller Produkteinführungen floppen. Jahrein, Jahraus beträgt die Floprate aller Neueinführungen in Deutschland zwischen 60 und 70 Prozent (vgl. z. B. Wildner, 1999). Haller & Twardawa (2008) stellen aufgrund ihrer Analysen ernüchtert fest, dass es «in Deutschland mehr als 80.000 beworbene Marken (gibt). 30.000 Artikel werden allein bei Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Jahr für Jahr neu eingeführt. Rund 70 Prozent davon verschwinden innerhalb von zwölf Monaten aus den Ordersätzen des Handels und nur magere 30 Prozent überleben».
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.6.2020 - Tag der griffigen Massnahmen
Drei Männer attackierten Zürcher LGBTQ-Model im Zug
Miruh Frutiger wurde im Zug von einer Gruppe Männer angegriffen. Grund dafür sei sein Äusseres gewesen, sagt Frutiger. Ein Politiker und LGBTQ-Organisationen wollen dem Hate Crime ein Ende setzen. Seine Beine sind lang, der Körper grazil. Die Haare trug er einmal lang. Auf dem Laufsteg überzeugt Miruh Frutiger als Mann oder Frau. Anstatt Bewunderung schlug dem Zürcher Model, das sich als gender-neutral-androgyn definiert, kürzlich aber viel Hass entgegen. Passiert sei es am Samstag, als er nach dem Besuch einer Vernissage in Genf in den Zug nach Zürich gestiegen sei, berichtet der 24-Jährige. «Im ansonsten leeren Zug setzten sich drei Männer in mein Abteil und begannen, mich auf Französisch zu beleidigen.» Er habe eine Kuhfelljacke und ein Crop Top getragen. «Die Männer beleidigten mich wegen meiner Jacke und meines Tops auf eine sexistische Art und Weise.» LGBTQ-Menschen werden immer wieder Opfer von Attacken. Etwa im Zürcher Nachtleben sind Schwule vor Pöbeleien nicht gefeit. SP-Nationalrat Angelo Barrile fordert im Kampf gegen Hate Crime nun griffige Massnahmen. In einem Vorstoss beauftragt er den Bundesrat, einen nationalen Aktionsplan zur Verminderung LGBTQ-feindlicher Hate Crimes und Gewalt zu erarbeiten. Dank dem Plan sollen Opfer auf kantonaler und kommunaler Ebene einfacheren Zugang zu Hilfsangeboten und Rechtsmitteln erhalten. Schreibt 20Minuten.
SP-Nationalrat Angelo Barrile führt auf beeindruckende Art und Weise vor, wie eine Partei sich selber abschafft. Und, frei nach Inspektor Colombo, eine Frage hätt' ich noch, Sir: Was ist ein Crop Top? Trägt man dazu LGBTQ-Fogal-Strümpfe?
-
18.6.2020 - Tag der Stützstrümpfe
Hoher Besuch: Merkel, Trump, Prinz Charles: Politpromis fordern Schweizer Sicherheitsapparat wie nie – das ist kostspielig
Es reisen immer mehr völkerrechtlich geschützte Personen in die Schweiz, das zeigen neue Zahlen. Der Staat muss für die Sicherheit des hohen Besuchs sorgen. Hinter vorgehaltener Hand kommen Schweizer Polizisten bis heute ins Schwärmen. Die Rede ist «von einem der grössten Sicherheitsevents in jüngerer Zeit»; vergleichbar nur noch mit einer Messe des Papstes vor Zehntausenden Gläubigen in Genf und einem viertägigen Staatsbesuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping: Die Visite von US-Präsident Donald Trump am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos war für die hiesigen Sicherheitsbehörden eine grosse Kiste. Zwar kümmerten sich wie immer Dutzende Personenschützer des Secret Service um den unmittelbaren Schutz des Präsidenten. Doch die Hauptverantwortung für die Unversehrtheit von Trump trug nicht das Personal aus dem Heimatland, sondern die offizielle Schweiz. Denn die Sicherheit von völkerrechtlich geschützten Personen fällt in die Zuständigkeit des jeweiligen Gaststaats, es ist eine hoheitliche Aufgabe. So regeln das internationale Abkommen. In deren Wirkungsbereich fallen Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und weitere Personen, die in einem offiziellen Auftrag ihre Regierung repräsentieren. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wer kennt das nicht, wenn man berühmt ist wie Harald «Harry fahr schon mal den Wagen vor» Schmidt und berüchtigt wie the Master of Disaster*? Als wir beide zusammen letztes Jahr im offenen Rolls Royce über die Luzerner Seebrücke fuhren, kam es zu Tumulten, wie sie Luzern noch nie erlebt hatte.
Unsere Fangruppe mit den Ü75-jährigen Knuspergirls kreischte wie wild, die feurigen Mädels mit den schneeweissen Haaren und den gichtgeplagten Wädlis rissen sich die Stützstrümpfe von den Beinen und schmissen ihre Geh-Hilfen ins Seebecken. Doch Polizei oder Personenschutz war nirgends zu sehen. Nur ein einsamer Rettungshelikopter der REGA kreiste vorsichtshalber über dem Vierwaldstättersee.
Aber Harry and the Master überlebten das Desaster wie durch ein Wunder ohne sichtbare Blessuren oder bleibende Schäden. Nochmal gut gegangen, kann man da nur sagen. Oder wie Harald Schmidt, Adorno zitierend, treffend bemerkte: «Nichts ist wahrer als die Lüge, weil die Wahrheit so verlogen ist**.»
* Den Master-Abschluss «Master of Disaster» gibt es tatsächlich und kann an der University of Copenhagen studiert werden. Oder beim Artillerie-Verein Zofingen.
** Hier irrte Harald Schmidt, der bekennender Adorno-Fan ist: «Manchmal lese ich Adorno, bis es mir kommt.» Das angebliche Adorno-Zitat stammt aus einer Liedzeile des Wiener Liedermachers André Heller.
Falls Sie einen Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
17.6.2020 - Tag des Freisinns ohne Sinn
Die sexuelle Orientierung eines Paares hat den Staat nicht zu interessieren
Christian Hochstrasser aus Rothrist impliziert in seinem Leserbrief, dass homosexuelle Eltern ihren Kindern kein gesundes mentales und emotionales Aufwachsen ermöglichen können. Ich kann verstehen, wenn die Vorstellung eines Kindes mit zwei Mamis oder zwei Papis im ersten Moment gewöhnungsbedürftig ist. Aber bei politischen Entscheiden sollte nicht das Bauchgefühl, sondern rechtsstaatliche Grundsätze und wissenschaftliche Fakten massgebend sein. Im Jahr 2017 publizierten Forscher der Columbia Law School eine Metaanalyse, die insgesamt 79 Einzelstudien umfasste. Die Forschung kam über eine Zeitspanne von drei Dekaden zum Konsensus, dass schwule oder lesbische Eltern keinen negativen Einfluss auf das Wohlergehen von Kindern in emotionaler, sozialer und pädagogischer Hinsicht haben. Reviews aus den USA (Manning et al., 2014) und Australien (Dempsey et al., 2017) bestätigen das. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Familienprozesse – also zum Beispiel die Qualität der Kindererziehung oder die Zufriedenheit in innerfamiliären Beziehungen – eine wichtigere Rolle spielen als Familienstrukturen wie zum Beispiel das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung der Eltern (Short et al., 2007). Als Naturwissenschaftler urteile ich gerne anhand von Fakten und als liberaler Politiker setze ich mich dafür ein, dass jeder Bürger die grösstmögliche Freiheit bekommt, solange sein Verhalten niemandem schadet. Momentan haben in der Schweiz homosexuelle nicht dieselben Freiheiten wie heterosexuelle Paare. Mit der Einführung der Ehe für alle und des Rechts zur gemeinschaftlichen Adoption nichtleiblicher Kinder können wir das ändern.
Ich akzeptiere, wenn Glaubensgemeinschaften diese Entwicklungen ablehnen. Was in ihrer Kirche oder Moschee erlaubt sein soll und was nicht, sollen sie weiterhin selbst entscheiden dürfen. Wo es aber um das Recht von Homosexuellen geht, vom Staat gleich behandelt zu werden wie Heterosexuelle, haben religiöse Gefühle nichts verloren. Den Staat hat die sexuelle Orientierung eines Paares nicht zu interessieren. Schreibt Tobias Hottiger, Einwohnerrat, Fraktionspräsident FDP, Zofingen in einem Leserbrief an das Zofinger Tagblatt.
Immer wieder erquickend und erlabend, mit welcher Vehemenz sich «liberale» Politiker für Minderheitenthemen in Szene setzen. Für ein paar Wählerstimmen springen sie frei von Sinnen über jedes Stöckchen, das ihnen hingehalten wird. Sie nennen sich ja nicht umsonst «Die Freisinnigen».
Den Kuchen der immer bedeutender werdenden Wählergruppe der Schwulen und Lesben will man nicht allein den Grüninnen / Grünen und der SP überlassen, sondern logischerweise selber auch ein Stück davon abschneiden. Da darf man auch mal eine Metaanalyse mit unglaublichen 79 (!) Einzelstudien – verteilt über die Zeitspanne von drei (!) Dekaden – an den Haaren herbeiziehen und salbungsvolle Worte von der «bürgerlich liberalen» Kanzel predigen.
Bei der Überbrückungsrente für Ü56-jährige Langzeitarbeitslose (von den gleichen «liberalen» Kräften auf Ü60 herabgewürgt) war der «Freisinn» nicht so gnädig wie gegenüber Schwulen und Lesben.
Nun denn, Arbeitnehmer*innen gehören seit jeher nicht unbedingt zum Wählerpotenzial der FDP und sind damit vernachlässigbar. Die darf man ruhig im Regen stehen lassen. Dazu ist man schliesslich seiner neoliberalen Klientel verpflichtet. Und nicht irgendwelchen menschlichen Schicksalen, die sich nicht in Wählerstimmen ummünzen lassen. Basta!
-
16.6.2020 - Tag der Entlassungen
Flughafen-Sicherheitsfirma feuert ältere Mitarbeiter – «Corona ist nur der Vorwand für unsere Entlassung»
Die Sicherheitsfirma Custodio entlässt vier Mitarbeiter wegen Corona-Wirtschaftsproblemen. Zwei stehen kurz vor der Pension. Die Firma nutze Corona nur als Alibi, kritisieren sie. Denn andere Angestellte, die für Custodio arbeiten, sind in Kurzarbeit. Der Bundesrat habe doch die Einführung von Kurzarbeit erleichtert, damit es wegen Corona keine Entlassungen gibt, sagt Hawre Berdat (49). Dennoch erhielten er und drei weitere langjährige Angestellte der Flughafen-Sicherheitsfirma Custodio Ende März die Kündigung. Mit einem blauen Brief konfrontiert war auch Jürg Meuli (62). Darin machte die Firma mit 400 Mitarbeitern «substanzielle Auftragsverluste wegen der Covid-19-Krise» geltend. Doch wenig später, im April, sind andere Mitarbeiter, die über eine Temporärfirma bei Custodio angestellt sind, in Kurzarbeit. Meuli schüttelt im Gespräch mit BLICK den Kopf: «Wenn sie mir tatsächlich wegen wirtschaftlichen Gründen kündigen mussten, dann hätten sie doch zuerst Kurzarbeit anordnen können.» Davon wollte die Firma nichts wissen. Custodio-Chef Herbert Höck (49) sagt auf Anfrage, dass er bei den direkt Angestellten in Zürich bislang keine Kurzarbeit eingeführt habe. «Viele Firmen haben Kündigungen rückgängig gemacht, nachdem sie Kurzarbeit geltend machen konnten», sagt Isabelle Lüthi von der Unia Zürich-Schaffhausen. Gerade für ältere Arbeitnehmende, für die die Arbeitssuche jetzt besonders schwierig sei, sei das nichts als fair. Besonders bitter ist es für Meuli, so kurz vor der Pensionierung ohne Job dazustehen. Da er über Jahre im Ausland lebte und nicht immer in AHV und Pensionskasse einzahlte, entstünde ihm eine grosse Vorsorgelücke, wenn er bis 65 keine Arbeit mehr findet. «Ich suche einen neuen Job, aber es ist schwierig in meinem Alter», führt er aus. Beide Entlassenen machen ihren Job seit Jahren mit Passion. Ein komisches Gefühl gegenüber dem Arbeitgeber hat Meuli erst seit letztem Herbst, als er sechs statt wie bisher nur fünf Ferienwochen für dieses Jahr eingab. Diese stehen ihm gemäss Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zu. Zuerst wollte ihm der Arbeitgeber nur fünf Wochen geben. Meuli insistierte auf sechs. Schliesslich hiess es, er hätte doch sechs Wochen zugute, es habe einen Systemfehler gegeben. Weitere rund 30 Mitarbeiter hätten darauf mehr zustehende Ferien gekriegt. «Seither nennen sie mich den Mister 6 Wochen», schmunzelt Meuli. Ende März folgt der Schlag – die Kündigung. Sein komisches Gefühl war berechtigt. «Leute, die den Mut haben, sich für ihre Rechte einzusetzen, werden unter dem Vorwand Corona entlassen», stellt er fest. Auch Berdat wurde offenbar sein Ferienanspruch zum Verhängnis. Letzten Herbst hat ihn der Custodio-Chef noch für seine Arbeit ausgezeichnet. Doch nachdem er im Januar um berechtigte fünf statt nur vier Ferienwochen bat, zitierte Herbert Höck ihn ins Büro. «Es war mein erstes Mitarbeitergespräch seit 13 Jahren», sagt Berdat. Der Chef habe ihm beschieden, ein gescheiter Mensch mache keine solchen Anfragen. Ebenfalls würde er am liebsten allen älteren Mitarbeitern kündigen, dann hätte er Ruhe vor solchen Feriengeschichten. Auch dass Berdat zu einem erkrankten Kind schauen musste, weil seine Frau arbeitete, passte Höck nicht. Gegenüber BLICK dementiert Herbert Höck, dass die Entlassungen im Zusammenhang mit gestellten Ferienansprüchen stünden. Entlassen habe man die Personen mit den meisten Abwesenheiten oder diejenigen, bei denen qualitative Defizite vorliegen. Bei Abwesenheit wegen einem kranken Kind erwarte er, dass die Absenzen mit der Partnerin geteilt würden, wenn diese auch arbeite. Corona sei ausserdem kein Kündigungsvorwand gewesen. Die Krise der Luftfahrt habe Custodio sehr hart getroffen. «Die Ferien wurden mir nicht gewährt, obwohl ich gemäss GAV klar einen Anspruch darauf habe», sagt Maria F.* (62), die fast ein Jahrzent für Custodio arbeitete und nun ebenfalls die Kündigung erhielt. Hinzu kommt, dass die Risikopatientin nach Eingabe des ärztlichen Attests noch einen Tag weiterarbeiten musste. Hier entgegnet Höck: «Die betroffene Mitarbeiterin gehörte, als sie für die Arbeit eingeplant war, gemäss Covid-19-Verordnung nicht zur Risikogruppe.» Der vierten Gekündigten, Gloria T.*, liegt vor allem auf dem Magen, dass ihr bis heute niemand den Grund für die überraschende Kündigung mitgeteilt hat. Von der Firma, für die sie sechs Jahre arbeitete, hätte sie mehr Charakter erwartet, erklärt die 54-Jährige. «Ich leiste die Arbeit immer noch eins zu eins, das ist mein Motto», sagt Berdat. Aber es mache ihn traurig, dass die Corona-Krise als Vorwand genommen werde, um Menschen in ihrer Existenz zu gefährden. Die Jobs der vier Entlassenen hat die von Custodio genutzte Temporärfirma schon länger wieder ausgeschrieben. * Namen geändert und der Redaktion bekannt. Schreibt Blick.
Kennen Sie den Film «M» (Eine Stadt sucht einen Mörder) von Fritz Lang? Nein? Dann haben Sie filmhistorisch gesehen eine gravierende Lücke, gehört doch der Film als eine der ersten deutschen Tonfilmproduktionen zur Liste der 100 besten Filme aller Zeiten und belegt dort den sechsten Platz, was zugleich die beste Platzierung für eine deutsche Filmproduktion ist. Nun denn, man muss und kann nicht alles wissen, dafür gibt's ja schliesslich Experten wie unseren Freund Res, das wandelnde Lexikon* vom Artillerie-Verein Zofingen.
In besagtem Film «M» spricht der Mörder in einer Filmsequenz die Worte: «Kann nicht. Muss!» Genau so erging es mir heute frühmorgens beim Lesen des oberwähnten Blick-Artikels, als rundum im Quartier noch die Hähne auf den Hennen krähten. «Kann nicht. Muss!» Nämlich meine Geschichte erzählen, über die ich mit meinem Freund Res von der historischen Abteilung des AVZ gestern noch am Telefon philosophierte. Glaubten wir beide an das Gute im Menschen und damit an ein Einzelschicksal, belehrt uns die Blick-Story heute eines Besseren. Urteilen Sie selbst.
Wie es sich für die katholische Stadt am Fusse des Pilatus gehört, zelebrierten wir in Luzern am 11. Juni den Feiertag «Fronleichnam». Zeit und Gelegenheit, die leeren Rotweinflaschen** systemgerecht nach der Flaschenfarbe zu entsorgen. Während ich eine Flasche nach der andern in den Container plumpsen liess, kam ein frisch und sportlich aussehender Mann auf einem knallroten, supermegageilen Bike daher geradelt, hielt neben mir an und sagte: «Herrlicher Tag, um den Glasmüll zu entsorgen.» - «Ja», sagte ich. «Besser geht nicht. Aber sagen Sie mal, ist dieses wunderschöne, knallrote Stahlross ein E-Bike?» Er verneinte und ich fragte, wie viele Kilometer er denn so pro Tag mit dem Vehikel zurücklege. Und damit begann ein interessantes, aber auch beklemmendes Gespräch.
Er hätte schon bald genügend Zeit um viele Kilometer pro Tag zu fahren, denn sein Job sei gekündigt worden. «Corona?», fragte ich? Nein, es liege an seinem Alter. Er sei 58 Jahre alt und nun, nach der Kurzarbeit, die vom Staat bezahlt wurde und während der nicht gekündigt werden kann, habe der Juniorchef die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den zwei ältesten Mitarbeitern im Betrieb gekündigt. Vordergründig wurde ihm als Kündigungsgrund mangelndes Auftragsvolumen für die Zeit bis Ende Jahr genannt. Doch unser sportlicher Freund mit dem knallroten Bike ist überzeugt, dass es an seinem Alter liegt. Denn ältere Arbeitnehmer verursachen höhere Sozialabgabekosten und haben Anrecht auf mehr Ferien. Dies alles erklärte er mir sehr sachlich und ruhig. Auch dass der Juniorchef sich entschieden hätte, bei unerwartet zunehmendem Auftragsvolumen Personal über Temporär-Firmen zu rekrutieren.
«Hoppala», meinte ich, «da haben Sie aber vermutlich mit Ihren 58 Jahren und dem zu erwartenden Andrang von Arbeitslosen in den nächsten Monaten sehr schlechte Karten.» «Ja», sagte er. Das habe ihm schon die Dame vom RAV ehrlicherweise erklärt. Doch sie habe ihm auch Mut gemacht. Unser Bike-Freund kann nun zwei Jahre lang stempeln, dann hat er das 60. Lebensjahr erreicht und profitiert demzufolge von der letzte Woche im Parlament verabschiedeten Überbrückungsrente für Ü60-Jährige. «Alles gut und recht, da haben unsere Politiker ja mal was richtig Vernünftiges auf die Beine gestellt», analysierte er. «Doch die SVP will ja das Referendum gegen die Überbrückungsrente ergreifen.»
Das war mir am Fronleichnamstag noch nicht bekannt. Ich wusste bisher nur, dass sich der solariumgebräunte Luzerner-FDP-Ständerat und freisinnige Pöstchenjäger Damian «ich bin nicht schwul»*** Müller schon im März 2020 explizit gegen die ursprünglich vom Bund vorgesehene Altersgrenze von 56 Jahren für den Eintritt in die Überbrückungsrente ausgesprochen hatte: «Mit 56 die Stelle verlieren, dann zwei Jahre Arbeitslosengeld, danach vielleicht etwas von den Reserven leben und noch ein wenig Zwischenverdienst und schon reicht es, mit 60 in die Überbrückungsleistung zu gehen.» Der Liebling aller Luzerner Schwiegermütter suggeriert damit im Umkehrschluss seiner gestammelten Weisheiten, dass daraus quasi ein Berufsmodell für ältere Arbeitnehmer*innen entstehe. Viel Vertrauen in die älteren Arbeitnehmer*innen hat der Mann mit dem verklemmten Sexleben scheinbar nicht. Man muss schon ziemlich abgehoben und weit von der Lebenswirklichkeit entfernt sein, um ein solch menschenverachtendes Statement abgeben zu können. Selbst bei einer intellektuellen Ödnis und geistiger Armut, wie der braungebrannte Schönling im blauen Massanzug sie vor sich herträgt, dessen geistige Ergüsse hauptsächlich aus Wikipedia und dem Parteiprogramm stammen. Dass sich ausgerechnet die SVP zur willfährigen Gehilfin von tragikomischen und lächerlichen Figuren der FDP macht, lässt einige Rückschlüsse über das Wort «bürgerlich» zu.
Nun sind Sie dran und dürfen urteilen. Oder auch einen Leserkommentar abgeben.
*Dieses redensartliche Bild geht auf die Antike zurück. In dem Werk «Leben des Porphyrius» schreibt Eunapius (um 345 n. Chr.) über den Lehrer des Porphyrius, den Philosophen Longinus (213-273 n. Chr.), er sei «eine lebende Bibliothek und ein wandelndes Museum» gewesen.
** Zweigelt von DENNER und MERLOT von Otto's, sofern Sie es genau wissen wollen. Born on the Fourth of July, (Deutsch: Am Tage des Herrn), feiere ich meinen 22. Geburtstag. Zum vierten Mal.
*** Müller äusserte sich im Vorfeld der Nationalratswahlen 2019 ungefragt in etlichen Interviews bei Luzerner Medien über seine Sexualität («ich bin nicht schwul»), die eigentlich niemanden interessierte, worüber aber selbst altgediente Journalisten staunten. Warum wird dieser von Müller selbst und ohne Not geschaffene Running Gag hier erwähnt? Damit sich die Wählerinen und Wähler Gedanken machen können, welch komische/n Bruder oder Schwester sie in den Ständerat gewählt haben. Wenn schon die erstaunten Journalisten nicht nachfragen.
Älteren Entlassenen droht lange Arbeitslosigkeit
Die Anzahl Arbeitsloser zwischen 50 und 64 Jahren erhöhte sich im Mai gegenüber dem Vorjahr um 40,6 Prozent auf 40'890. Verglichen mit dem Lockdown-Vormonat April sind dies 654 mehr ältere Arbeitnehmer ohne Job. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe lag letzten Monat mit drei Prozent unter dem Schweizer Schnitt von 3,4 Prozent.
Auf den ersten Blick scheinen die über 50-Jährigen weniger vom Stellenabbau betroffen zu sein als etwa die 15- bis 24-Jährigen mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent und absolut 17'758 Betroffenen. Doch bei der Suche nach einem neuen Job tun sich die Älteren deutlich schwerer: Die Stellensuche der über 50-Jährigen dauert rund anderthalbmal länger als im gesamtschweizerischen Durchschnitt und mehr als doppelt so lange wie bei den 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden.
Entsprechend haben über 50-Jährige eine höhere Langzeitarbeitslosenquote als die übrigen Altersgruppen. Der Anteil Langzeitarbeitsloser innerhalb der Gruppe der älteren Arbeitslosen lag 2018 bei 26,1 Prozent, bei den 25- bis 49-Jährigen sind es hingegen nur 12,7 Prozent.
Seit der Corona-Krise hätten sich bei den Gewerkschaften auffällig mehr über 55-Jährige gemeldet, sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB). Darunter befänden sich auch Fälle, wo Arbeitgeber zwar Kurzarbeit angemeldet, einzelne ältere Mitarbeiter aber davon ausgenommen hätten. Ihnen sei gekündigt worden. «Für die Betroffenen ist das ein Schock», betont Lampart. Denn sie hätten es in der Corona-Krise noch schwerer, wieder einen Job zu finden. Schreibt Blick.

-
15.6.2020 - Tag der naiven Marketingfloskeln
Schlechte Nachrichten für Schweizer Detailhändler an der Grenze
Eingekauft wurde nun lange Zeit nur auf der Schweizer Seite von Rheinfelden – das hat Raphael Carmeli in seinem Biogeschäft ein paar hundert Meter vor der Grenze besonders deutlich gemerkt. Es hat in der Kasse so geklingelt, wie sonst nie. Er hatte in den letzten Monaten ein Umsatzplus von etwa 60 Prozent. So etwas habe er noch nie erlebt, in seiner ganzen Laufbahn von über 40 Jahren, sagt Carmeli. Der Lebensmittel-Detailhandel ist der Gewinner der Krise. Laut dem Marktforschungsinstitut GfK ist der erste Quartalsumsatz 9.1 Prozent höher als im Vorjahr. Für dieses Umsatzplus geben die Experten als Gründe «Veränderungen im Konsumverhalten» an, insbesondere das Verbot des Einkaufstourismus. Das bemerkten vor allem die Grenzregionen. Die grossen Detailhändler wie zum Beispiel die Migros haben diesen Sprung ebenfalls bemerkt. In allen Regionen gibt es laut Mediensprecher Marcel Schlatter einen gehörigen Sprung in den Umsätzen. Doch es ist insbesondere in den Grenzregionen der Fall, wo der Umsatzzuwachs während der Krise noch einmal deutlich höher ist als anderswo. Laut Thomas Rudolph, Professor für Marketing und Internationales Handelsmanagement an der Universität St. Gallen, beträgt aufgrund der Grenzschliessung das Umsatzplus in der Lebensmittelbranche 825 Millionen Schweizer Franken. Dieses Geld geben die Schweizerinnen und Schweizer sonst im Ausland aus. Wenn die Grenze für den Einkauf wieder öffnet, dann fliesst dieses Geld aber vermutlich wieder ins Ausland. Thomas Rudolph appelliert an den Schweizer Detailhandel, dass dieser mit Nachhaltigkeit, guter Qualität und Umweltschutz werben solle. Dann liesse sich zumindest ein Teil des zusätzlichen Gewinns durch die Grenzschliessung auch nach der Öffnung am Montag in der Schweiz behalten. Kleinere Detailhändler wie Raphael Carmeli versuchen weiterhin dem Einkaufstourismus entgegenzuwirken. Sie setzen auf Solidarität und auf die Verbindungen, die sie während der Grenzschliessung aufgebaut haben. Schreibt SRF.
Was will uns der Professor für Marketing und Internationales Handelsmanagement an der Universität St. Gallen mit seinem kruden Appell und den Forderungen nach Nachhaltigkeit, guter Qualität und Umweltschutz an den Schweizer Detailhandel sagen? Dass der Schweizer Detailhandel, dessen Produkte häufig identisch sind mit denjenigen, die ennet der Grenze im grossen Kanton eingekauft werden, weder Nachhaltigkeit, gute Qualität noch Umweltschutz berücksichtigt? Ist denn eine Nivea-Creme aus Lörrach nachhaltiger und von höherer Qualität als diejenige aus dem Denner-Laden am Löwenplatz in Luzern oder der MIGROS in Zofingen? Wer einen Titel als Professor für Marketing und Internationales Handelsmanagement führt, sollte eigentlich wissen, dass die Einkäufe im grenznahen Ausland nur aus einem einzigen Grund getätigt werden: den exorbitant tieferen Preisen der Produkte. Hinzu kommt, dass die deutsche Mehrwertsteuer (7 - 19 Prozent) entweder gar nicht erst erhoben oder spätestens am Zoll den Schnäppchenjägern*innen zurückerstattet wird. An die Solidarität der Grenzshopper*innen zu appellieren hiesse Eulen nach Athen zu tragen und ist nicht nur sinnlos, sondern schlichtweg naiv. Da scheint dem guten Professor doch einiges an Menschenkenntnis zu fehlen. Dahergeschwafelte Marketingfloskeln entbehren halt öfters jeglicher Realität. Leider nicht der Dummheit.
-
14.6.2020 - Tag der Black-Lives-Matter Party
Ab auf die Strasse: Tausende protestieren an Black-Lives-Matter-Demos in Schweizer Städten
Am Samstag haben in mehreren Schweizer Städten zahlreiche Personen an unbewilligten Black-Live-Matters-Demonstrationen teilgenommen. So versammelten sich die Aktivisten unter anderem in Bern, Zürich, Luzern und St. Gallen. Wie die Zürcher Stadtpolizei auf Twitter schreibt, toleriere sie die unbewilligte Demonstration und begleite sie. Wie auf vielen Bilder der Kundgebungen zu sehen ist, tragen eine Vielzahl der Demonstranten Masken. Allerdings sind gemäss Schätzungen in mehreren Städten mehr als die eigentlich erlaubten 300 Personen unterwegs. Veranstaltungen und Demonstrationen sind wegen der Coronamassnahmen eigentlich nur bis zu dieser Teilnehmerzahl erlaubt. In Bern schätzt die «Berner Zeitung» 3000 Demonstrierende. Die Zürcher Polizei sprach von einem Demonstrationsumzug, der sich über mehrere hundert Meter zieht. Die Kundgebungen richten sich gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser der weltweiten Proteste war der gewaltsame Tod von George Floyd Ende Mai. Floyd war bei einer gewaltsamen Festnahme in Minneapolis durch den Polizisten getötet wurde. Ein Video dieses Vorfalls sorgte für heftige Reaktionen, die sich in teils riesigen Protestkundgebungen ausdrückten. In der Schweiz fanden bereits am vergangenen Wochenende mehrere Aktionen gegen Rassismus statt. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Liebe Journalisten, das waren keine Proteste! Lasst Euch das sagen von jemandem, der gestern mittendrin gestanden ist und sich die teilnehmenden Menschen genau angeschaut hat (siehe Bild). So viele Konsumenten und Lieferanten (called «Dealer») von Mary Jane vereint auf einem einzigen Platz mitten in der Stadt Luzern sieht man selten. Die «so genannte» Demo war nichts anderes als eine Party, mehrheitlich (geschätzte 90 Prozent) ohne Mindestabstand und Corona-Maske, veranstaltet von einer juvenilen, konsumorientierten Facebook-Fun-Generation mit sinnentleerten, hastig hingekrizelten, undifferenzierten Klugscheisser-Papp-Plakaten wie «Wer nicht gegen Rassismus ist, ist ein Rassist» und erinnert stark an die letztjährigen Sommerauftritte der Fridays for Future-Bewegung. Ähnlich den Fridays for Future-Kids wurde auch die gestrige Black Lives Matter-Bewegung begleitet von den üblichen unverbesserlichen, altesoterischen Schlümpfen, die, wie die Luzerner Uralt-Kantons- und Stadtparlamentarierin Heidi Joos bei der Verhaftung durch die Luzerner Polizei gerne mal den vampirhaften «Biss am Abend» an der Hand einer Polizistin ausüben. Nach der Nacht in einer Luzerner Polizeizelle beklagte sich Heidi Joos über sämtliche Kanäle, dass sie nicht mal genügend Toilettenpapier gehabt habe. Liebe Heidi Joos, erste Demonstranten-Regel: Man / Frau geht niemals mit Durchfall an eine Demo oder Party.
Hätten die Partys vor der amerikanischen Botschaft in Bern stattgefunden, könnte man durchaus grosses Verständnis und Anteilnahme aufbringen. Denn «Black Lives Matter» betrifft in erster Linie ein uramerikanisches Problem. Und dies seit vielen Jahrzehnten. Nicht erst seit George Floyd. Der «hässliche Amerikaner» ist ebenfalls nicht erst seit dem Vietnamkrieg da und er war auch nie weg. Doch der Hegemon ennet dem Atlantik gehört nun mal zur «westlichen Wertegemeinschaft» wie das Weihwasser zur Kirche. Den kann man nicht mit Sanktionen überziehen. Und auch nicht in den Gerichtshof von Den Haag schleppen. Doch die Konsumenten könnten ihm sehr wohl einen gehörigen Tritt in den Allerwertesten verpassen. So sie denn wollten. Denn nichts, aber auch wirklich nichts interessiert Amerika mehr als die Kurse an der Wall Street.
Man darf ohne rot zu werden behaupten, dass es der Schwarzen Bevölkerung hierzulande wohl um einiges besser geht als in Afrika oder in den USA. Die Schweiz lässt sich dies ja auch hunderte von Millionen Franken kosten. Mit der Black Lives Matter-Kampagne (Schwarze Leben Zählen) hat die Schweiz im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Amerikanische Polizeiaktionen wie «Würg the Gürk» finden im Schweizer Polizeialltag definitiv nicht statt. Ist ja auch ein grosser Unterschied zwischen einem Schweizer Polizist und einem US-Cop, der im schulischen Schnellverfahren innert neun Wochen vom Tellerwäscher zum Polizisten befördert wird. Von einem Schweizer Bewerber für den Polizeiberuf werden immerhin eine abgeschlossene Berufslehre und, wenn möglich, die abgeschlossene Rekrutenschule (Ausnahmen bestätigen die Regel) verlangt, bevor es in die zweijährige Ausbildung geht. Soviel zu den vielgeschmähten Schweizer Polizisten*innen.
Doch wie soll man das einer ebenso verwöhnten wie entfesselten Konsumgeneration der U30-Jährigen in den schicken Nike-Schuhen erklären, die vor, während und nach der «Rassismus»-Party Coca Cola trinkt, Starbucks-Coffee bis zum Abwinken schlürft, dank McDonald's-Fastfood immer dicker wird, mit dem sündhaft teuren iPhone die neuesten Facebook-Nachrichten konsumiert und sich abends mit dämlichen Netflix-Serien und einer RITALIN-Pille intus ins Nirwana kifft? Wer diesen so supermegageilen Way of American Life ohne Wimpernzucken konsumiert, zelebriert und akzeptiert, muss auch die hässlichen Seiten des amerikanischen Systems in Kauf nehmen. Sonst ist der / die / das nichts anderes als ein mit Verlogenheit und historischer Unkenntnis gesegneter Partygänger*in.
Es ist allerdings anzunehmen, dass diese von Amerika auf die Schweiz adaptierte Party-Bewegung «Black Lives Matter» (BLM) genau so schnell wieder verschwindet wie fast alle US-Bürgerbewegungen. Occupy Wall Street*, die Tausende von Anhängern und Sympathisanten in der Schweiz hatte, lässt grüssen. Schon in ein paar Monaten wird kein Hahn mehr nach Black Lives Matter krähen. Geschweige denn eine Henne. Nur das Problem wird bleiben. Jedenfalls in den USA.
*Occupy Wall Street (englisch für «Besetzt die Wall Street»; abgekürzt auch OWS) war ab dem 15. Oktober 2011 die grösste Protestbewegung in Nordamerika, die angeregt durch die sich rasch verbreitenden weltweiten Aufrufe im Internet im Zuge der Proteste in Spanien 2011/2012, des Arabischen Frühlings und der kanadischen Adbusters Media Foundation entstanden ist. Kalle Lasn, Gründer von Adbusters, und sein Chefredakteur Micah White initiierten erste Aktionen über soziale Netzwerke im Juni 2011. Im Gefolge wurden der Zuccotti Park in Lower Manhattan in New York City von Demonstranten besetzt und auf den früheren Namen Liberty Plaza Park provisorisch wieder umbenannt sowie ein Zeltdorf darauf errichtet. Dies geschah ausdrücklich mit Bezug auf die Besetzung des Tahrir-Platzes in Ägypten während des Arabischen Frühlings. Parallel registrierte Adbuster OccupyWallStreet.org als zugehörige Webadresse. Die zunächst nur auf die Abonnenten der Zeitschrift Adbusters begrenzte Aktion verbreitete sich weltweit. Die zentralen Forderungen der Bewegung waren eine stärkere Kontrolle des Banken- und Finanzsektors durch die Politik, die Verringerung des Einflusses der Wirtschaft auf politische Entscheidungen und die Reduzierung der sozialen Ungleichheit zwischen arm und reich. Die Parkbesetzung hatte wie die Bewegung von Beginn an einflussreiche Fürsprecher, so etwa Nancy Pelosi, Michael Bloomberg und die Ökonomen Jeffrey Sachs und Joseph E. Stiglitz. Quelle Wikipedia.

-
13.6.2020 - Tag des Tichleins deck dich
Notkredite in den eigenen Sack gesteckt: Behörden ermitteln gegen 132 Corona-Betrüger
Für Covid-19-Kredit-Betrüger hat niemand Verständnis. Weder im Freundeskreis noch bei den Strafverfolgungsbehörden. Und schon gar nicht der Bundesrat, der mit den Banken und der Nationalbank über Nacht das Programm mit den Überbrückungskrediten aus dem Boden gestampft hat. Seit dem 26. März können Firmen in Finanznöten bei ihrer Hausbank einen Covid-19-Kredit beantragen. «Ich gehe davon aus, dass Leute, die eine Firma haben und die ihr ganzes Vermögen in diese Firma gesteckt haben, auch so ehrlich sind, dass sie den Staat nicht über den Tisch ziehen wollen», sagte Finanzminister Ueli Maurer (69) damals. Und doch: Die Corona-Soforthilfe wird von Hunderten ausgenutzt! Nicht in allen Kantonen. Aber es sind Millionen, die den vorwiegend kleinen Betrieben eine wichtige Stütze in der Corona-Krise sein sollen. BLICK hat in allen 26 Kantonen nachgefragt, ob das Vertrauen des Finanzministers in die Bürger gerechtfertigt ist. Die Antworten kommen prompt, und die Botschaft ist glasklar: Betrügen in Zeiten von Corona geht gar nicht! Deshalb schauen die Behörden ganz genau hin. Das Fazit der Umfrage: Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln in 132 Fällen wegen des Verdachts auf Covid-19-Kredit-Betrug. Die Gesamtsumme der mutmasslich ertrogenen Kredite beläuft sich auf knapp 13 Millionen Franken. Das ist allerdings eine sehr grobe und eher konservative Schätzung. Zum Vergleich: Bis heute haben die Banken und der Bund 128’616 Corona-Kredite vergeben und eine Summe von knapp 15,3 Milliarden Franken ausgezahlt. Das meiste Geld dürfte in die Kantone mit einer grossen Wirtschaftskraft geflossen sein. Denn hier ist das Bedürfnis nach finanziellen Überlebenshilfen am grössten. Keine Wunder also, dass der Kanton Zürich die Liste mit den Betrugsfällen anführt. Schreibt Blick.
So naiv ist Bundesrat Ueli Maurer nun auch wieder nicht, wie der Blick-Artikel suggeriert. Denn Blick unterschlägt, dass Maurer seine Aussage über die Unternehmer, die den Staat nicht über den Tisch ziehen wollen, im gleichen Gespräch selbst ad absurdum geführt hat. Orakelte Maurer doch, er rechne damit, dass vermutlich etwa vier Milliarden der Hilfs- und Bürgschaftskredite abgeschrieben werden müssen. Ob das nun mit Betrugsabsicht einiger Unternehmen oder Unfähigkeit zur Krisenbewältigung angeschlagener Firmen zusammenhängt, liess Maurer offen.

-
12.6.2020 - Tag des Mohrenkopfs
«Mohrenköpfen» droht auch bei Spar und Volg der Rauswurf – Kunden rennen Dubler die Bude ein
Schlechte Nachrichten für «Mohrenkopf»-Produzent Robert Dubler: Auch die Detailhändler Spar und Volg denken darüber nach, seine Süssigkeiten aus den Regalen zu verbannen. «Wir erachten den Namen nicht mehr als zeitgemäss und werden mit dem Lieferanten das Gespräch suchen», wird eine Volg-Sprecherin im «Blick» zitiert. «Aufgrund der langjährigen und guten Geschäftsbeziehung sind wir bestrebt, eine faire Lösung zu finden.» Ein Entscheid sei noch nicht gefallen. Spar hat die Dubler-Mohrenköpfe in einigen Filialen im Angebot. «Als weltoffenes und multikulturelles Unternehmen liegt uns sehr viel daran, dass niemand diskriminiert wird», schreibt eine Mediensprecherin. Auf die Namensgebung werde heute sehr viel differenzierter reagiert. «Wir werden uns mit dieser Frage deshalb sorgfältig auseinandersetzen.» Man werde sich auch mit den «langjährigen Lieferanten», gemeint ist primär Dubler, in Verbindung setzen.
Denner diskutiert mit Hersteller über «Mohrenkönig mini»
Für Dubler ist die Aufregung um den Namen seiner Produkte absatzfördernd: «Die Kunden kamen am Donnerstagvormittag in rauen Mengen», sagt er. Er habe in zwei Stunden so viel verkauft wie am ganzen Mittwoch, und der sei gut gelaufen. Auch langfristig scheint er zu profitieren: Nach der letzten «Mohrenkopf»-Empörung vor zwei Jahren verzeichnete er rund zehn Prozent mehr Verkäufe. Tätig geworden ist auch Denner: Die Migros-Tochter verkauft in der Deutschschweiz den «Chocolat Mohrenkönig mini» von Chocolat Ammann in Heimberg (BE). Dieser fliegt Mitte August aus dem Standardsortiment und wird nur noch sporadisch in Aktionen angeboten. Das teilt ein Unternehmenssprecher mit. Man habe das schon vor der aktuellen Debatte entschieden. Ausserdem sei man mit dem Hersteller in Kontakt bezüglich eines alternativen Namens für das Produkt.
Junge SVP verteilt «Mohrenköpfe» in Zürich
Die Migros lancierte die neuerliche «Mohrenkopf»-Diskussion am Mittwoch. Sie kündigte an, die Dubler-Produkte aus dem Sortiment zu streichen. Sie waren in zwei Filialen der Zürcher Migros-Genossenschaft erhältlich. «Unter den aktuellen Entwicklungen verstehen wir, dass dieses Produkt als provozierend empfunden werden kann», schrieb eine Migros-Sprecherin. Sie bezog sich auf den gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd und die anschliessend weltweiten Proteste gegen Rassimus. Die Migros handelte sich mit ihrem Entscheid lobende Worte, aber auch viel Unverständnis ein. In Online-Umfragen mehrerer Medienportale erachten überwältigende Mehrheiten den Rauswurf als falsch. Die SVP-Jungparteien aus Zürich und Aargau waren derart empört, dass sie am Donnerstagmorgen beim Zürcher Hauptbahnhof eine Protestaktion durchführten: Sie verteilten 500 Dubler-«Mohrenköpfe». Dass die Migros sich von ihm abwendet, kann Dubler verkraften. Sie bringt ihm rund zwei Prozent des Umsatzes. Bei Volg sind es acht bis zehn Prozent. Die Hälfte der zehn Millionen «Mohrenköpfe», die er letztes Jahr produzierte, verkauft er über seinen Laden. Schreibt das Zofinger Tagblatt.
Diese Diskussion mit der üblichen Medienkampagne ist nur noch absurd, abgehoben und jeder realen Wirklichkeit entzogen. Vergleiche mit den US-Würgecops und dem Rassismus der «alten weissen Männer» Amerikas auf die Schweiz zu adaptieren wird dem Thema nicht gerecht und ist nur noch dumm und an den Haaren herbeigezogen.
Die Medien machen sich für ein paar lausige Klicks zu den Erfüllungsgehilfen für die Party der Schweizer Empörungskultur, die sich in infantilster Weise auf Facebook abfeiert.
Die Coronakrise ist abgeflacht. Der Medienhype mehr oder weniger vorbei. Das mediale Sommerloch naht. Da liegt es auf der Hand, den Rassismus oberflächlich und am Thema vorbei mit einem harmlosen Schoggiprodukt hochzujazzen.
Die Marketing-Fritzen*innen der Migros, die in den letzten Jahren nicht unbedingt mit glorreichen Ideen glänzten, um die fatale Entwicklung rund um den Gewinneinbruch des Konzerns und den daraus resultierenden Personalabbau zu korrigieren, lieferten dafür die peinliche Steilvorlage.
Am wirklichen Rassismus, der in allen Gesellschaften (und Religionen, wohlverstanden!) weltweit grassiert, wird auch der Rausschmiss des Dubler-Mohrenkopfs aus den Migros-Regalen nichts ändern.
Dass auch die Junge SVP auf den schlagzeilenträchtigen Zug aufspringt, ist verständlich und liegt in den Genen der Partei. Vor vielen Jahren, 2003 um genau zu sein, sprach ein damaliger Politiker und Parteipräsident, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, weil Ueli Maurer ja inzwischen zu höchsten Würden aufgestiegen ist, folgenden Satz: «Solange ich ‹Neger› sage, bleibt die Kamera bei mir»*.
*Für alle Ungläubigen: Google hilft mit den Stichworten «Maurer Neger» weiter.
-
11.6.2020 - Tag der Spenden
Nationalrat sagt Ja zur «Ehe für alle» und zur Samenspende
Der Nationalrat stimmt der «Ehe für alle» zu. Er gibt lesbischen Paaren zudem grünes Licht für den Zugang zur Samenspende. Damit stellt er sich gegen die Empfehlung seiner vorberatenden Kommission. Der Nationalrat hat die Vorlage heute weiterberaten, nachdem die Debatte letzte Woche unterbrochen werden musste. Die Forderung geht auf eine parlamentarische Initiative der Grünliberalen Fraktion zurück. Streitpunkt war, ob mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auch der Zugang zur Samenspende für lesbische Paare verbunden sein soll. Schreibt 20Minuten.
Wurde auch Zeit! Jetzt wissen wir flotten jungen Männer endlich, was wir wem an Weihnachten zu spenden haben. Harry, fahr schon mal den Yoghurtbecher vor. Hallelujah!
-
10.6.2020 - Tag der Brotrinde und Bestatter
Job-Schock: Migros schliesst Jowa-Regionalbäckerei in Zollikofen und Bestatter bleiben auf Särgen sitzen
Die Backwarentochter der Migros, die Jowa AG, richtet ihre Produktion neu aus. Für eine Grossbäckerei im bernischen Zollikofen bedeutet dies das Ende. Von der Schliessung betroffen sind insgesamt rund 220 Mitarbeitende. Sie sollen inner- und ausserhalb der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt werden, verspricht der orange Riese. Und es sei gemeinsam mit den Sozialpartnern ein Sozialplan ausgearbeitet worden. Schreibt Blick.
Weniger Covid-Tote als erwartet – Bestatter bleiben auf Särgen sitzen
Viele Bestatter wussten zu Beginn der Corona-Pandemie nicht, wie sich diese auf die Schweiz auswirken wird. Viele deckten sich vorsichtshalber mit Särgen ein, auf denen sie nun sitzen bleiben. Zu Beginn der Corona-Krise war für niemanden klar, was für Auswirkungen die Pandemie auf die Schweiz haben würde. Während das Virus in Italien bereits zu Tausenden Todesfällen geführt hatte, bereiteten sich die Bestatter hierzulande ebenfalls auf eine mögliche Todeswelle vor. «Nicht, dass man in dieser schwierigen Zeit noch dem Material nachspringen müsste», sagt der Bestatter Kurt Dänzer von der Trauerhilfe Hasler gegenüber SRF. Das Lager des Bestattungsunternehmens in Düdingen FR ist nun aber voll: 100 anstelle von 60 Särgen stapeln sich dort. Auch das Lager von Huguenin Bestattungen ist überfüllt. 20 Minuten berichtete im April darüber, dass sich das Unternehmen mit 400 bestellten Särgen auf die Pandemie vorbereitete. «Das ist sehr aussergewöhnlich, normalerweise haben wir nur ungefähr 40 Särge an Lager», sagte Geschäftsführer Kevin Huguenin im Interview. Schreibt 20Minuten.
Verdammt und zugenäht: Nur Ärger mit diesem vermaledeiten Coronavirus. Die einen bleiben auf dem Brot sitzen, die andern auf den Särgen, weil die Menschen der Risikogruppe partout nicht wegen einem dahergekommenen Virus sterben wollten. Vielleicht hätten die Bestatter halt dem guten Daniel Koch doch nicht allzu blind vertrauen sollen.
-
9.6.2020 - Tag des blauen Blocks
Kundin in Zürcher Apotheke vor ganzen Kundschaft blossgestellt: «Die mit dem blauen Block braucht die Pille danach»
Es geschah am Tag ihres Geburtstages. Stefanie C.* erfuhr die Demütigung ihres Lebens. «Noch nie habe ich mich in der Öffentlichkeit so blossgestellt und nackt gefühlt», sagt sie im Nachhinein. Sie will anonym bleiben, erzählt BLICK aber, wie sie an einem Abend in eine Zürcher Notfallapotheke ging und vor der ganzen Kundschaft über ihr Sexleben ausgefragt wurde. Die Geschichte beginnt mit einem Abendessen unter Freunden. Stefanie C. bereitet alles minutiös vor. Im Stress vergisst sie, ihren Verhütungsring rechtzeitig wieder einzusetzen. Dieser darf maximal drei Stunden pro Tag rausgenommen werden. Sonst ist der Schutz vor einer Schwangerschaft nicht mehr gegeben. «Sobald mir dies bewusst wurde, wusste ich, was mir blühte: die Pille danach.» Nach dem Essen macht sie sich auf den Weg zur Apotheke. Ihr Freund begleitet sie. Es ist 21.30 Uhr. Die erste Apotheke weist die beiden ab, sie machen sich auf zur Apotheke am Bellevue, wo zwei Angestellte zur Stunde arbeiten. Stefanie erklärt die Situation, sie erhält den «berüchtigten Schreibblock». Dort sind Fragen aufgelistet wie etwa, warum sie die Notfallverhütung benötige, ob sie Allergien habe oder Medikamente zu sich nehme. Schreibt Blick.
Und die Moral von der Schmonzetten-Gschicht? Den Verhütungsring* vergessen darf man nicht.
* Der Verhütungsring oder auch Vaginalring bzw. Monatsring genannt, ist ein Verhütungsmittel, welches mit Hormonen den Eisprung verhindert. Der Ring aus Kunststoff wird in die Vagina eingeführt und nach drei Wochen wieder entfernt. In den folgenden sieben Tagen ohne Ring setzt eine menstruationsähnliche Blutung ein. Derzeit sind zwei in Deutschland zugelassene Vaginalringe erhältlich, der NuvaRing von MSD und Circlet von Pfizer. Beide enthalten Etonogestrel und Ethinylestradiol. Quelle Wikipedia
-
8.6.2020 - Tag der dummen Fragen
Babys bitten am meisten um Asyl – wie es trotz Lockdown zu 330 Gesuchen in einem Monat kam
Das Coronavirus hat die Zuwanderung begrenzt. Arbeitskräfte aus EU/Efta- und Drittstaaten durften nur noch einreisen, wenn sie vor den im März erlassenen Restriktionen eine Bewilligung erhielten. Nach diversen Lockerungsetappen setzt der Bundesrat die volle Personenfreizügigkeit ab Mitte Juni wieder in Kraft. Auch Gesuche für Personen aus Drittstaaten werden wieder bearbeitet. Komplett verriegelt hat die Schweiz die Grenzen nie. Gesuche von EU/Efta-Staatsangehörigen, die einen systemrelevanten Beitrag zur wirtschaftlichen Landesversorgung leisten, etwa in den Bereichen Pflege, Lebensmittel oder Energie, wurden weiterhin entgegengenommen. Auch Spezialisten aus Drittstaaten wurden zugelassen, falls sie für das Gesundheitswesen unerlässlich waren oder dringende Service-Arbeiten, zum Beispiel an Kernkraftwerken, zu verrichten hatten. Wir zeigen in sechs Punkten auf, wie die Pandemie die Migration gesteuert hat. Für die ersten drei Monate des neuen Jahres betrug der Wanderungssaldo 18'386 Personen – ein sattes Plus von 9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Im April wanderten unter dem Coronaregime noch 3005 mehr Ausländer ein als aus. Zwei Drittel davon stammen aus dem EU/Efta-Raum sowie Grossbritannien. Die Kurzarbeit und die Arbeitslosigkeit kennen nur eine Richtung: Nach oben. Dennoch reisten im April 7144 Personen für einen neuen Job in die Schweiz ein. Im Vergleich zum April 2019 waren es 5000 weniger. Die grösste Gruppe stellten in diesem Jahr die Deutschen mit knapp 1300 Personen. Knapp 3400 Menschen kamen mit einem befristeten Arbeitsvertrag ins Land, darunter zahlreiche Erntehelfer aus Osteuropa und Portugal. Sie durften Spargeln stechen, Setzarbeiten verrichten oder im Obst- und Weinbau eingesetzt werden, weil der Bund die Landwirtschaftsbetriebe als systemrelevant für die Landesversorgung taxierte. Die Bauern konnten somit die benötigten Arbeitskräfte aus der EU weitgehend rekrutieren. Die irreguläre Migration erlahmte weitgehend. Gleichwohl registrierte das Staatssekretariat für Migration im April 332 neue Asylgesuche. Wie ist das möglich? Die Antwort ist einfach: 170 Gesuche entfallen auf Babys, die Asylbewerberinnen in der Schweiz gebaren. Den Rest machen der Familiennachzug und Mehrfachgesuche aus. Damit verbleiben 111 sogenannte «Primärgesuche». Es handelt sich um Personen, die entweder schon vorher illegal in der Schweiz lebten oder trotz des strengen Grenzregimes es schafften, die grüne Grenze zu überqueren. Gemäss der Einschätzung der SEM-Experten dürfte die erste Gruppe klar grösser sein. Zum Vergleich: Deutschland zählte im April rund 4000 Asylgesuche nach illegalen Grenzübertritten. Auf dem europäischen Festland hatten die Schlepper einen schweren Stand. Im April ertappten die Schweizer Zollbeamten noch 10 mutmassliche Menschenschmuggler, dreimal weniger als in dem Vorjahresmonat. Sie griffen im April 217 illegal eingewanderte Personen auf. Das sind 900 weniger als im Vorjahresmonat. Die Ursache ist simpel: Die wiedereingeführten Grenzkontrollen, die Schliessung von kleineren Grenzübergängen sowie der Unterbruch des internationalen Bus-, Bahn- und Flugverkehrs verunmöglichten es Migranten, in Europa weiterzuwandern. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Angeblich gibt es keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Ein Mann mit dem Namen Frank Wisniewski soll das geflügelte Wort mit dem Zusatz «Allerdings gibt es Fragen, die eindeutig die Dummheit des Fragestellers selbst beweisen» erweitert haben. No Risk no Fun: Gehen wir das Risiko ein, Wisniewskis Sicht der Dinge zu bestätigen und eine banale Frage zu stellen. Wie kann es sein, dass die Schweiz «systemrelevante» Tätigkeiten im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft trotz hohen Arbeitslosenzahlen* nur mit ausländischem Personal rekrutieren kann? Ist das nicht ein erschreckendes Armutszeugnis für eine Gesellschaft, auf das uns ausgerechnet die Corona-Pandemie aufmerksam gemacht hat?
Doch lasst uns nicht mit Defätismus in die neue Woche starten, sondern mit Zuversicht und Freude: 170 Asylgesuche entfallen auf Babys, die Asylbewerberinnen in der Schweiz im vergangenen Monat geboren haben. Damit lässt sich immerhin die Überalterung der Gesellschaft etwas abfedern. Das müsste selbst der SVP gefallen.
* Die jahresdurchschnittliche Zahl der als arbeitslos registrierten Personen fiel 2019 laut Seco um knapp 10 Prozent auf 106'932 zurück. Diese Glückseligmachende Zahl weist allerdings erhebliche Mängel auf. Dies bemängelte der Luzerner Nationalrat Franz Grüter schon 2018 mit einem Vorstoss im Parlament, wofür er sogar Zustimmung von links erhielt. Zumal zwischen den Begriffen «Arbeitslos» und «Erwerbslos» ein eklatanter Unterschied besteht.
-
7.6.2020 - Tag des verregneten Sommer-Sonntags
Corona-Kundgebung am Schwanenplatz: Ausser der Polizei war keiner da
«Glaube wenig, hinterfrage viel, denke selbst»: Unter diesem Motto haben Kritiker der Corona-Massnahmen auf einem Flyer zu einem Treffen aufgerufen. Am Samstag auf dem Luzerner Schwanenplatz. Gefolgt ist dem Aufruf niemand – ausser die Luzerner Polizei. Die Aktivistinnen wichen dann auf den Bahnhofplatz aus. Verteilt wurde der Flyer in verschiedene Briefkästen in der Stadt Luzern. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass man sich um die Grundrechte in der Schweiz sorge. Auf Basis des Notrechts hat der Bundesrat bekanntlich während der Corona-Pandemie die Grundrechte der Bevölkerung eingeschränkt. Die Flyer-Schreiber befürchten, dass dies nun zum Courant normal wird. Gefährdet sind aus ihrer Sicht:
• Recht auf Bewegungsfreiheit
• Recht auf Gedanken-, Wissens- und Religionsfreiheit
• Recht auf friedliche Versammlungen
Im Flyer wurde zu einem Austausch unter Gleichgesinnten aufgerufen, der an diesem Samstag um 14 Uhr auf dem Schwanenplatz stattfinden sollte. Es waren aber keine Aktivistinnen vor Ort, die sich als solche zu erkennen gegeben hätten. Stattdessen fand auf dem Bahnhofplatz eine kleinere Kundgebung statt, wie die Medienstelle der Luzerner Polizei auf Anfrage bestätigt. Es seien rund 25 Personen vor Ort gewesen. Eine polizeiliche Intervention war nicht nötig, da die Vorgaben gemäss Covid-19-Verordnung des Bundes eingehalten wurden. Damit verlief diese Kundgebung deutlich friedlicher als eine Mahnwache, am Pfingstwochenende, die letzte Woche für eine öffentliche Debatte gesorgt hat. Die ehemalige Kantonsrätin Heidi Joos war dabei verhaftet worden, nachdem sie im Zusammenhang mit einer Personenkontrolle eine Polizistin gebissen haben soll. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Weil Joos der Polizei gegenüber schwere Vorwürfe erhebt, wird von der Staatsanwaltschaft auch überprüft, ob sich die Polizisten strafbar gemacht haben. Schreibt ZentralPlus.
Das sind doch mal Lichtblicke an einem verregneten Wochenende: Stellt Euch vor, es ist Demo und keiner geht hin! Problem gelöst. So geht das in Luzern. Und bezüglich alt-Kantonsrätin Joos sollten wir uns mit vorschnellen Urteilen zurückhalten. Steckt nicht in jedem von uns ein Hauch von Hannibal Lecter, der Agent Starling mehr als nur die Hand abbeissen wollte? Joos soll ja lediglich zugebissen haben. Alles halb so wild; problematisch wird's erst, wenn Joos mal wirklich abbeisst und dann das Kochbuch hervorholt. Die ganze Aufregung um bissige Stuten wird als perfektes Sujet an der kommenden Fasnacht enden. So die denn stattfindet.
-
6.6.2020 - Tag des Freisinns ohne Sinn
«Absolut untragbar»: Die Coronakrise setzt der AHV zu – kommt nun das höhere Rentenalter?
Wegen der Coronakrise dürfte die AHV dieses Jahr rote Zahlen schreiben – trotz einer Zwei-Milliarden-Finanzspritze. Das verleiht der Forderung nach einer Erhöhung des Rentenalters Auftrieb. Die Finanzspritze hätte der AHV Luft verschaffen sollen. Zwei Milliarden Franken fliessen seit diesem Jahr zusätzlich, so hat es das Stimmvolk im Mai 2019 beschlossen. Trotzdem dürfte die AHV erneut rote Zahlen schreiben – wegen der Coronakrise. Das Bundesamt für Sozialversicherungen geht davon aus, dass das Umlageergebnis 2020 «sehr wahrscheinlich» negativ sein wird. Es wird also mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Das hat drei Gründe:
1. Wegen höherer Arbeitslosigkeit und dem Corona-Erwerbsersatz werden weniger AHV-Lohnbeiträge bezahlt.
2. Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer sinken, da wegen der Krise weniger konsumiert wird. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) rechnet deswegen mit «beträchtlichen» Einbussen.
3. Beim AHV-Ausgleichsfonds droht wegen der Coronakrise womöglich ein Anlageverlust.
Genaue Zahlen will der Bund Ende Juni veröffentlichen. Doch bereits jetzt sagen Politiker, dies verändere die Ausgangslage für die aktuelle AHV-Reform. Die Forderung nach einem höheren Rentenalter erhält Auftrieb. Vor allem FDP-Vertreter machen Druck – kürzlich etwa der Zürcher Ständerat Ruedi Noser. Die Jungfreisinnigen haben bereits früher eine Initiative lanciert. Es sind aber nicht nur Freisinnige, welche die Forderung öffentlich mittragen. Auch SVP-Ständerat Alex Kuprecht etwa sagt: «Die Frage des Rentenalters gewinnt wegen der aktuellen Situation an Bedeutung.» Er spricht sich für Rentenalter 66 aus; «die Frage ist noch, wie und wann». Am effektivsten, so sagt Kuprecht, wäre es, das Rentenalter schon mit der aktuellen Vorlage zu erhöhen. Doch man müsse abwägen, ob man damit nicht ein Scheitern der ganzen Reform riskiere – und ein höheres Rentenalter daher besser in einem nächsten Schritt angehe. Klar ist für Kuprecht: «Bis Ende des Jahrzehnts sollte das Rentenalter auf 66 Jahre steigen.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Eigentlich ist es nur noch erbärmlich, wie die Parlamentarier*innen frei von Sinnen rund um den Freisinn (besser bekannt unter dem Parteinamen FDP) das «höhere Rentenalter» wie eine Monstranz vor sich hertragen. Als ob es für ein Finanzierungssystem, dessen Grundzüge auf Otto von Bismarck* zurückgehen, der am 30. Juli 1898 verstorben ist, keine anderen Lösungen gäbe. Die Welt – und mit ihr die Wirtschaft inklusive Gesellschaft – haben sich seit 1889 wesentlich verändert. Nur der Freisinn ist stehengeblieben. Für die ideenlosen Jungfreisinnigen mit den antiquierten Keulenargumenten sollte sich die Mutterpartei FDP in Grund und Boden schämen. Ein Armutszeugnis sondergleichen. Aber wie Bertolt Brecht** schon gesagt haben soll: «Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlächter selber.» Und die grenzdebilen wählen sogar einen Ruedi Noser samt seinen gestammelten Weisheiten.
* Bismarck führte die Rentenversicherung ein. Im Mai 1889 verabschiedete der Reichstag des Deutschen Reiches unter Führung Otto von Bismarcks das Gesetz zur Alters- und Invaliditätsversicherung. Alle Arbeiter zwischen 16 und 70 Jahren mussten nun in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
** Dieses Sprichwort taucht erstmals 1874 auf einem Schweizer Stimmzettel zur Wahl der Züricher Steuerkommission auf, was von vielen Zeitungen damals amüsiert berichtet wurde. Der Witz des unbekannten Autors wurde in den Jahren darauf weit verbreitet und von Sozialdemokraten schon vor dem 1. Weltkrieg bei Wahlen oft als Slogan verwendet. In den letzten Jahrzehnten wird der Spruch irrtümlich oft Bertolt Brecht und manchmal auch Wilhelm Busch oder Heinrich Heine zugeschrieben.
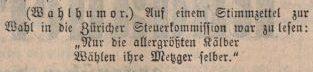
-
5.6.2020 - Tag der Autoposer
Coronavirus – Bentley streicht rund 1000 Stellen in Grossbritannien
Die britische Volkswagen-Luxusmarke Bentley will laut einem Medienbericht rund 1000 Stellen in Grossbritannien streichen. Schreibt Blick.
Die 1000 Stellen bei Bentley wären auch ohne Coronakrise gestrichen worden. Wer braucht schon einen Bentley? Mit dieser Karre lässt sich ja nicht mal mehr mit Kriegsbemalung à la Mario Balotelli in Pjöngjang Nord posen.

-
4.6.2020 - Tag der Botoxspritze
Boom in der Schönheitschirurgie: Nach dem Lockdown wächst der Wunsch nach Lifting
Aufgrund der Coronakrise steigt die Nachfrage nach Schönheistoperationen stark an. Nach dem Lockdown nutzen die Leute die freie Zeit im Homeoffice und das angesparte Feriengeld, berichtet Skinmed-Chef Felix Bertram. Sechs Wochen ging in den Kliniken von Felix Bertram (45) gar nichts mehr: Seit dem 27. April läuft – im Rahmen der zusätzlichen Coronahygienevorschriften – bei Skinmed wieder der Normalbetrieb. Im Bereich Dermatologie seien sie wieder bei etwa 80 bis 90 Prozent, erklärt Felix Bertram. «Das Vertrauen der Patienten ist zurück.» Wesentlich stürmischer als erwartet läuft es bei der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. «Da erleben wir einen Boom», sagt Bertram. «Normalerweise ist der Sommer eher schwach – das ist dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Bis Ende Juli sind wir nahezu ausgebucht.» Fachärztin Tatjana Lanaras (38) ergänzt, das sei ein allgemeiner Trend, Berufskollegen würden von ähnlichen Anstürmen berichten. Nach dem Lockdown zum Schönheitschirurgen: Was sind die Gründe? Ganz genau wissen es die Skinmed-Ärzte nicht, aber sie haben Indizien. «Eine wichtige Rolle spielt das Homeoffice – und das in mehrfacher Hinsicht», erklärt Tatjana Lanaras. Nach operativen Eingriffen und ästhetischen Behandlungen könnten die Patienten jeweils ein paar Tage nicht unter die Leute gehen. «Wenn man im Homeoffice arbeitet, kann man sich zu Hause auskurieren und hat keinen Arbeitsausfall», erklärt Tatjana Lanaras. «Und man muss sich erst noch nicht rechtfertigen.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Corona-Krise? War da was? Geht's uns schlecht? Nein! Denn während den Lockdown- und Home Office-Zeiten hatten wir endlich genügend Zeit, öfters in den Spiegel zu schauen und stellten mit Erschrecken fest, dass wir hässliche Entlein sind. Dies gilt es nun zwingend und hurtigen Schenkels with a little Help from Doctor Seltsam* and the Botoxspritze zu korrigieren. Welch glückliches Volk, das sich solche Sorgen und Nöte leisten kann. Faltencheck statt Faktencheck.
* Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben (Originaltitel: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) ist ein satirischer Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1964 über den Kalten Krieg und die nukleare Abschreckung. Er basiert auf dem Roman «Bei Rot: Alarm! Der Roman des Drucktastenkriegs» (Originaltitel: Red Alert) von Peter George. Quelle: Wikipedia

-
3.6.2020 - Tag von König Artus
Geheim-Gutachten warnt vor Stromriesen-Pleite: Geht ein AKW-Betreiber pleite, blechen die Steuerzahler
Das sollte die Öffentlichkeit nicht erfahren: Wenn einer der beiden Stromriesen Axpo oder Alpiq pleitegeht, droht ein Dominoeffekt. Ein Energieunternehmen nach dem anderen, das Partner eines AKW-Betreibers ist, könnte straucheln. Und damit besteht ein «hohes Risiko», dass der Bund – also der Steuerzahler – für die Atomkraftwerke zur Kasse gebeten wird. Das zeigt ein Gutachten mit dem sperrigen Namen «Risikobeurteilung der Folgen einer allfälligen Insolvenz einer Kernkraftwerk-Betreiberin oder deren Eigentümer für den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds». BLICK hatte per Öffentlichkeitsgesetz Einblick in die Risikobeurteilung des Anwaltsbüros Wenger Plattner verlangt und vom eidgenössischen Datenschützer grünes Licht erhalten. Doch seither wehrt sich die Atomlobby vor Gericht gegen die Veröffentlichung. BLICK hat das brisante Papier auf anderem Weg bekommen. Eigentlich sollen die Eigentümer von Atomkraftwerken nach dem Abstellen für den Rückbau und die Entsorgung aufkommen. Dazu wurden die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds (Stenfo) geschaffen. In diese müssen die Energieunternehmen einzahlen. Reicht das Geld in den Fonds nicht, müssen die AKW-Firmen Geld nachschiessen. Erst wenn das nicht mehr möglich ist, haftet der Bund. Laut Gutachten muss in der Praxis der Steuerzahler aber sehr rasch das Portemonnaie zücken. Und das kommt so: Zwar werden die ältesten Atomreaktoren, Beznau I und II, noch direkt von der Eigentümerin Axpo betrieben. Nicht aber Gösgen und Leibstadt. Letztere sind in Betreiberfirmen ausgegliedert. Die Rede ist in der Strombranche von «Partnerwerken». Sowohl bei der Leibstadt AG wie auch bei der Gösgen-Däniken AG sind neben Alpiq und Axpo noch andere Unternehmen beteiligt. Kommt es zu einer Insolvenz eines Partners in einer AKW-Betreiberfirma, steht die «Haftung einer Muttergesellschaft nicht zur Diskussion», heisst es in der Risikobeurteilung. Es sei denn, eine solche würde sich aus den Verträgen zwischen den Partnern ergeben. Die Rechtsexperten zweifeln daran, dass sich die Partner bei Gösgen und Leibstadt tatsächlich verpflichtet haben, Geld nachzuschiessen. Sorgen bereitet ihnen vor allem der Fall, dass eines der Schwergewichte, also Axpo oder Alpiq, ausfällt. «In einem solchen Fall würde der nicht gedeckte Kostenanteil eines ausgeschiedenen Aktionärs die finanzielle Situation der verbleibenden Aktionäre zusätzlich belasten, was im Sinn eines ‹Dominoeffekts› deren Insolvenz bewirken könnte», steht in der Analyse. Das Risiko dafür sei «hoch». Tatsächlich lassen die aktuell tiefen Strompreise nichts Gutes erahnen. Der Lockdown senkte die ohnehin schon tiefen Preise weiter. Wenn die Wirtschaft nur schleppend Fahrt aufnimmt, ist eine rasche Erholung kaum zu erwarten. Das bereitet den Stromproduzenten Sorge. Auf Anfrage beschwichtigen Alpiq und Axpo, man werde von den sehr tiefen Preisen kurzfristig nicht mit voller Wucht getroffen, da die Unternehmen den grössten Teil der Produktion abgesichert hätten. Stromfirmen machen das, indem sie einen Anteil des Stroms zwei, drei Jahre im Voraus verkaufen. Schreibt Blick.
Eigenartig. Ein Geheim-Gutachten, das nach drei Jahren plötzlich auf dem Tisch der Redaktion an der Dufourstrasse in Zürich landet, kann so geheim nicht wirklich sein. Ob Blick das «geheime Gutachten» direkt von der Mutter der Schweizer Atomlobby, genannt NZZ, erhalten hat, sei dahingestellt. Fakt ist: Jemand wollte, dass dieses «Geheim-Gutachten» durchgestochen wird und damit öffentlich Druck erzeugt. Ein ganz normales Vorgehen. Business as usual. Denn letztlich geht's ja nur um die tiefen Strompreise, die endlich nach den Vorstellungen der AKW-Betreiber nach oben korrigiert werden sollen. Die Entsorgung des Atom-Mülls ist längst geregelt. Die fällt frei nach dem neoliberalen Motto «Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren» so oder so den Steuerzahlern vor die Füsse. Oder wie König Artus* zu den Rittern der Tafelrunde gesagt haben soll: «Das Gute geht, das Schlechte bleibt. Der Starke wird immer den Schwachen besiegen.»
Erstaunlich. Derzeit wird im Zusammenhang mit den Corona-Schulden des Bundes von den Vertretern der freien und ungezügelten Markt- und Dividendenwirtschaft über willfährige Medien beinahe täglich mit den üblich drohenden Untertönen darauf hingewiesen, dass diese Schulden auf gar keinen Fall auf kommende Generationen abgewälzt werden dürfen. Dass der Atommüll mit all seinen Kosten, Gefahren und Risiken auf die Schultern der kommenden Generationen gelegt wird, stört die gleichen Sprachrohre überhaupt nicht.
* König Artus ist eine Sagengestalt, die in vielen literarischen Werken des europäischen Mittelalters in unterschiedlichem Kontext und unterschiedlicher Bedeutung auftaucht. Sein Herrschaftsgebiet wird in Britannien verortet. Ob Artus ein reales historisches Vorbild hatte, ist ungewiss und wird in der Geschichtswissenschaft inzwischen eher bezweifelt. Quelle Wikipedia.
-
2.6.2020 - Tag der Neuropsychologie
«Lernen Sie Saxophon spielen!» – So halten Sie Ihr Hirn im Alter fit
Neuropsychologe Lutz Jäncke (62) von der Universität Zürich hat Tipps, wie man sein Kopf auch im Alter in Schuss hält. Ganz klar, ab dem 65. Lebensjahr nimmt das Hirnvolumen im Durchschnitt um etwa 0,5 Prozent pro Jahr ab. Auch viele psychische Funktionen (Gedächtnis, Wahrnehmungsgeschwindigkeit etc.) verschlechtern sich im Alter. Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir in der Lage sind, unser Gehirn aktiv zu halten und es zu trainieren, um dem geistigen Abbau entgegenzuwirken und ihn zu kompensieren. Ich bin kein grosser Fan der häufig kommerziell angebotenen Brain-Jogging-Trainings. Sie können durchaus hilfreich sein, um anfangs wieder Zugang zum Lernen zu finden. Aber man muss bedenken, dass sich das Gehirn im Zuge der Evolution zu einem Problemlöseorgan entwickelt hat, mit dem wir Alltagsprobleme lösen müssen. In anderen Worten: Unser Gehirn muss uns helfen, unser Überleben zu gewährleisten. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit realen Problemen des Alltags auseinandersetzen. Insofern empfehle ich nicht das Auswendiglernen von Zahlen, die keine Bedeutung haben, sondern das Erlernen von etwas, was für uns wichtig ist. Warum nicht eine neue Sprache lernen, um sie in den Ferien anzuwenden? Oder endlich mal lernen, Saxophon zu spielen. Warum vertiefen wir uns nicht in Fragestellungen und Aufgaben, für die uns der Arbeits- und Familienalltag keine Zeit liess? Wichtig ist auch das Benutzen eines gewissen Masses an Disziplin bis ins hohe Alter. Sich gehen lassen und lange Phasen der Langeweile sind zu vermeiden. Um Ziele und Aufgaben zu erreichen, wird Selbstdisziplin benötigt, die letztlich vom Frontalcortex kontrolliert wird. Wird die Selbstdisziplin aktiviert, dann werden Neuronennetzwerke im Frontalcortex aktiv. Der Gebrauch dieser Neuronennetzwerke führt auch dazu, dass diese erhalten bleiben, statt durch Nichtgebrauch langsam ihre Vernetzung zu verringern. Auch körperlich aktiv zu bleiben, ist sehr wichtig. Dafür muss man seinen inneren Schweinehund überwinden. Das Gleiche gilt für geistige und soziale Tätigkeiten. Auch hierbei muss man sich gelegentlich überwinden, um sie zu nutzen. Schreibt Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich, im Blick.
Ein sehr guter Artikel von Professor Lutz Jäncke. Ob wir gleich zum Saxophon greifen müssen, sei dahingestellt. Eine Blockflöte würde vermutlich Sinn und Zweck auch erfüllen und erst noch die Nachbarn weniger stören. Eine neue Sprache zu erlernen ist ab einem gewissen Alter hingegen eher eine «Mission impossible». Das Auffrischen einer vor Jahrzehnten erlernten Fremdsprache wäre da Erfolg versprechender. Wer sich mit diesem Thema eingehender auseinandersetzen möchte, ist mit dem Buch «Die Alzheimerlüge» von Dr. med. Michael Nehls bestens bedient. Auch wenn das Buch sehr schwierig zu lesen ist (Anm. subjektive Meinung eines Nichtmediziners), vermittels es sehr viele brauchbare Tipps – auch in Bezug auf die Ernährung – um das Hirn täglich und konsequent auf Trab zu halten.

-
1.6.2020 - Tag der Zivilgesellschaft
Kein Zutritt: Lobbyisten müssen draussen bleiben
Die Interessenvertreter wollen zurück ins Parlament. Doch ihr Vorgehen sorgt unter den Ratsmitgliedern für Kopfschütteln. Sie gehören zum Bundeshaus wie die Ratsmitglieder, Schulklassen und Journalisten: die Lobbyisten. Zu normalen Zeiten tigern sie durch die Wandelhalle, führen mit Parlamentariern halblaute Gespräche und organisieren Anlässe mit gratis Zmittag. Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie tagt das Parlament nicht mehr im Bundeshaus, sondern in den weitläufigen Hallen der Berner Expo. Damit geht ein neues, striktes Zugangsregime einher: keine Besucher mehr, keine Schulklassen – und keine Lobbyisten. Die Interessenvertreter, die vom direkten Kontakt zu den Politikern leben, haben an der neuen Regelung wenig Freude. Aus diesem Grund hat die Schweizerische Public Affairs Gesellschaft (SPAG) kurz vor Beginn der Sommersession dem Parlamentsbüro einen Brief geschickt. Darin verlangt der Lobbyisten-Verband die Aufhebung der Zutrittsbeschränkung für die Interessenvertreter: «Gerne gehen wir (...) davon aus, dass Sie den Zugang auf das BernExpo Gelände während der kommenden Sommersession (...) sicherstellen.» Der forsche Tonfall der SPAG stösst einigen Parlamentariern sauer auf. SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel (54) findet den Brief «unglaublich dreist», wie er sagt. «Derzeit haben noch nicht einmal alle Parteisekretäre Zugang zum Provisorium. Und da meinen die Lobbyisten, sie hätten Priorität?» Ähnlich äussert sich die grüne Nationalrätin Irène Kälin (33). Sie verstehe zwar das Bedürfnis der Lobbyisten, ins Parlament zurückzukehren. Doch sei dies derzeit schlicht nicht möglich. Doch nicht nur der Anspruch auf eine Rückkehr ins Parlament sorgt bei den Ratsmitgliedern für Kopfschütteln. Sondern auch die Aussage, die Interessenvertreter hätten während des Lockdowns für zahlreiche Parlamentarier «Voten, Anträge [und] Vorstösse» erstellt, «die in unserem Milizsystem zur Bewältigung Ihrer Kommissions- und Sessionsarbeit nötig waren». Der Versuch des Verbandes, die Wichtigkeit der eigenen Arbeit zu betonen – und damit die Notwendigkeit einer Rückkehr zu unterstreichen – gerät den Ratsmitgliedern in den falschen Hals. Mit der Behauptung, Vorstösse für Politiker zu verfassen, habe sich die SPAG «massiv im Ton vergriffen», findet SVP-Politiker Büchel. «Falls Ratskollegen tatsächlich eins zu eins Vorstösse einreichen, welche Hintermänner für sie geschrieben haben, so ist das zumindest erstaunlich», sagt der St. Galler. «Wir sind als Volksvertreter gewählt, nicht als Wasserträger von Lobbyisten.» Scharfe Kritik kommt auch von Grünen-Nationalrätin Irène Kälin. Sie findet die Behauptung, man erstelle für die Ratsmitglieder Vorstösse, «arrogant und aggressiv». «Die Interessenvertreter geben sich damit eine Wichtigkeit, die ihnen nicht ganz zusteht.» «Natürlich versuchen Verbände immer wieder, uns Parlamentariern Gesetzesänderungen schmackhaft zu machen», sagt Kälin. Damit erreichten sie aber meist jene, die ohnehin auf ihrer Linie seien. Wiesli: «Der Zugang der Zivilgesellschaft zum Parlament ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Ein Parlament, das sich vom Rest der Schweiz abschottet, kann keine Volksvertretung sein.» Schreibt Blick.
Herrlich. Nun küren sich die Lobbyisten*innen schon zur selbsternannten «Zivilgesellschaft», ohne die Demokratie scheinbar nicht funktioniert. Manche sehen dies aber ganz anders* und betiteln die unsägliche Lobbyisten-Schwemme im Bundeshaus eher als Totengräber der Demokratie. Wie immer kommt es auf den Blick-Winkel an. Und damit ist für einmal nicht das Boulevardblättli von der Zürcher Dufourstrasse gemeint.
* Zum Beispiel «Lobbycontrol»: Lobbyismus höhlt die Demokratie aus: Zehn Thesen
-
31.5.2020 - Tag der Langohren
Frank A. Meyer – Blocher, der Besserwisser
Er ist die personifizierte Netflix-Serie der Schweizer Politik. Und ohne Umschweife sei hinzugefügt: Immer wieder ist er unterhaltsam, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise, mal absonderlich, mal paradox, mal abstrus, mal clownesk, mal einfach nur einfältig, wie es eben unvermeidlich ist für Netflix-Produktionen. Seit Jahren hält er uns bei Laune, was endlich einmal gewürdigt werden muss – und wozu die jüngste Folge der aktuellen Staffel ganz besonders Anlass bietet. Den Plot liefern die Corona-Massnahmen des Bundesrats und die Idee von BLICK, alt Bundesräte zur Kommentierung der Pandemiepolitik ihrer amtierenden Nachfolger aufzurufen. Die Befragten urteilten durchweg positiv. Die frühere Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf beispielsweise fand zur Vorgehensweise des Bundesrats folgende Worte: «Er hat zu Beginn der Krise sehr gut reagiert, als man Mitte März wirklich schwierige Entscheide fällen musste. Und er hat diese auch gut kommuniziert.» Ist damit alles gesagt? Natürlich nicht. Denn jetzt erfolgt der Auftritt des helvetischen Netflix-Helden: Christoph Blocher, Bundesrat von 2003 bis 2007. Aus Sicht des kurzzeitigen Regierungsmitglieds und ewigen SVP-Präsidenten haben die heutigen Amtsinhaber alles verpatzt, weil sie «den Kopf verloren und überhastete Massnahmen beschlossen, die nicht dringlich waren, aber absehbar grosse Schäden verursachen werden». Darum ist in den Augen des Veterans «der Schaden nun grösser, als ihn das Virus angerichtet hätte». Den derzeit politisch Verantwortlichen wirft er nichts Geringeres vor als «Unfug». Überdies hätten sie eine «Verwaltungsdiktatur» errichtet. Ja, Blochers neuster Netflix-Reisser hat es in sich. Und er vertreibt dem Zuschauer jede Corona-Langeweile – was im Serien-Geschäft als allergrösstes Lob verbucht werden darf. Dieses Lob ist sogar noch zu erweitern: Der Ehemalige, der mit notorischer Selbstgewissheit die sieben Nachfolger abqualifiziert, hat als Bundesrat keinen «Unfug» getrieben. Aus seiner Regierungszeit ist nur Beruhigendes zu vermelden: Er setzte nichts ins Werk, was «absehbar grosse Schäden» hätte verursachen können. Überhaupt ist, sieht man genau hin, nichts Bedeutendes erinnerlich, was seine Handschrift tragen würde. Er verdarb nicht einmal die Hinterlassenschaft seiner Vorgängerin Ruth Metzler. In der Tat, Christoph Blocher hat sich in seiner kurzen Amtszeit auffällig zurückgehalten mit Wirken und Walten – man könnte auch sagen, mit den Mühen der Regierungsebene, wäre diese Bemerkung nicht despektierlich, zudem unpräzis. Hat er doch während vier Bundesratsjahren nie auf die Kärrnerarbeit als Präzeptor seiner Partei und populistischer Polemiker verzichtet – anstrengende Verrichtungen fürwahr. Bemüht hat er sich also auf jeden Fall, hör- und sichtbar fürs ganze Land. Und noch bevor er Fatales vollbringen konnte, wurde er abgewählt – gerade rechtzeitig, um des Lobes für seine Bundesratspräsenz auf immer gewiss zu sein, wobei Letztere auf seiner Lebensstrecke doch etwas verloren wirkt. So bestätigt auch sein Fall die Volksweisheit: Nur wer nichts macht, macht nichts falsch! Das amtierende Bundesratskollegium dagegen hat in den vergangenen Monaten zu viel gemacht und zu viel machen müssen, um nichts falsch zu machen. Also wird der Blick zurück wohl oder übel Fehler offenbaren, zu Gaudi und Genuss all jener, die es immer schon besser gewusst haben. Triumphe der Besserwisser. Noch fehlt der Netflix-Serie mit Christoph Blocher der treffende Titel. Wie wärs mit: «Der Besserwisser»? Schreibt SonntagsBlick.
Frank A. Geier, wie er zu seiner aktiven Ringier-Zeit von etlichen Mitarbeitenden des Ringier-Konzerns – Adligenswil lässt grüssen – genannt wurde, arbeitet sich wieder einmal an Blocher ab. In Anlehnung an Erich Maria Remarque bleibt nur ein Fazit: Vom Herrliberg nichts Neues. Das gilt aber auch für FAG (Frank A. Meier), dem im Ringier-Konzern ebenfalls «Besserwisserei» par excellence nachgesagt wurde. Da treffen sich also zu Pfingsten einmal mehr zwei Esel, die sich gegenseitig «Langohr» schimpfen.
-
30.5.2020 - Tag der Flatulanz
Corona schneller erkennen: Jetzt kommt die Husten-App
Nach der Corona-Warn-App kommt jetzt die Husten-App. Die EPFL Lausanne will aufgrund des Tons des Hustens erkennen, ob eine Corona-Infektion vorliegt. Zwei Drittel der Corona-Erkrankten haben laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen trockenen Husten. Und der klingt anders als bei einer Erkältung oder bei Allergien, bei der in der Regel Schleim produziert wird. Das hat die Forscher der EPFL (Ecole polytechnique féderale de Lausanne) auf eine Idee gebracht: Kann man aufgrund des Hustens Rückschlüsse darauf ziehen, ob jemand sich das Coronavirus eingefangen hat? Ein Forscherteam ist nun dabei, eine App zu entwickeln, die genau das tun soll. Das Prinzip ist einfach: Man nimmt den eigenen Husten mit dem Handy auf, die App «Coughvid» analysiert den Ton und liefert dank künstlicher Intelligenz ein sofortiges Resultat. Allerdings wohl kein absolut zuverlässiges. «Wir hoffen, dass die App dereinst bis 70 Prozent akkurat ist», sagt Tomas Teijeiro (33), Informatiker aus Spanien und Teil des Forscherteams in Lausanne. Die App werde nie einen Corona-Test ersetzen, betont Teijeiro. «Aber sie kann einen Hinweis geben, ob ein Test angebracht ist.» Interessant dürfte sie vor allem auch aus Behördensicht sein. Denn neben dem Husten können Nutzer auch – freiwillig – ihre Standortdaten teilen. «Das könnte Hinweise auf Infektionsherde geben», so Teijeiro. Weitere Daten werden nicht registriert, die App soll für die Nutzer zudem kostenlos sein. Aktuell «sammeln» die Forscher noch Hustentöne, um sie entsprechend zu analysieren. Wer will, kann seinen Husten schon via «Coughvid»-Webseite an die Uni senden – allerdings noch ohne Resultat. Zusätzlich helfen Spitäler und Ärzte, in dem sie die Husterei von Corona-Erkrankten und anderen Patienten ebenfalls einsenden. Laut Teijeiro sind die Forscher nun dabei, all die gesammelten Hustentöne zu analysieren: «Wir hoffen, bis Ende Juni ein brauchbares Produkt zu haben.» Schreibt Blick.
Die Frage drängt sich da aber zwingend auf: Was ist mit der Flatulenz? Können bei starkem Biswind in der Hose nicht auch Viren entweichen? Eine Furz-App drängt sich bei diesen Überlegungen geradezu auf. Und wenn schon, dann bitte mit Tonaufnahmen.
-
29.5.2020 Tag der rechtsfreien Räume
Auf Kriegsfuss mit seinem Lieblingsmedium: Trump unterzeichnet Verfügung zur Reglementierung von Twitter und Co.
Mit den Internet-Konzernen Twitter & Konsorten verbindet Donald Trump eine Hassliebe. Er nutzt die virtuellen Plattformen zur Verbreitung von Propaganda – obwohl er der Meinung ist, dass sie ihre Marktmacht missbrauchten. Nun will der Präsident die sozialen Medien an die Kandare nehmen. Der amerikanische Präsident hat am Donnerstag eine präsidiale Verordnung unterzeichnet, die das Geschäftsmodell der grossen Internet-Plattformen in Frage stellt. Weil sich Twitter oder Facebook immer stärker wie traditionelle Medienunternehmen verhielten, und Meinungen verbreiteten, müssten die Unternehmen gleich wie eine Zeitung behandelt werden, sagte Donald Trump im Weissen Haus. Der amerikanische Präsident schlägt in einer neuen präsidialen Verordnung («Executive Order») vor, dass Twitter, Facebook oder YouTube künftig für den Inhalt, den Nutzer über ihre virtuellen Plattformen verbreiten, haftbar gemacht werden. Damit würde ein Wettbewerbsvorteil wegfallen, den Twitter & Konsorten im täglichen Kampf um Klicks gegenüber traditionellen Medienfirmen besitzen. Seine Regierung will das nationale Parlament zudem dazu auffordern, einen zentralen Passus in einem 1996 verabschiedeten Mediengesetz («Communications Decency Act») neu zu interpretieren, der Verleumdungsklagen gegen Twitter & Konsorten bisher verunmöglichte. Dieser rechtliche Schutzschild müsse wegfallen, weil sich die Plattformen nicht mehr neutral verhielten, sagte Trump. Welche Folgen hat diese Verordnung? Keine direkten, auch wenn Trump am Donnerstag laut darüber nachdachte, wie er das börsenkotierte Unternehmen Twitter zur Schliessung zwingen könnte. Im amerikanischen Politsystem steht es dem nationalen Parlament frei, Gesetzesvorschläge der Exekutive zu ignorieren. Dies geschieht häufig, insbesondere dann, wenn die Demokraten die eine Kammer (Repräsentantenhaus) beherrschen und die Republikaner die andere (Senat). Trump verglich die Internet-Plattformen im Weissen Haus mit Telefongesellschaften, die Gespräche zensierten. Dieser Vergleich aber hinkt. Telefongesellschaften werden von der Aufsichtsbehörde FCC reguliert; die grossen Internet-Firmen hingegen unterstehen keiner besonderen Kontrollbehörde. Die präsidiale Verordnung wird deshalb, früher oder später, einen Rechtsstreit provozieren. Schreibt die AZ.
Man muss Trump nicht mögen, aber wo er recht hat, hat er recht. Der rechtsfreie Raum der globalen Internetkonzerne gehört längst abgeschafft. In jeder Beziehung. Auch bei den Steuermodellen. Doch wie bei Trump meistens üblich, werden den Worten keine Taten folgen. Die perfekte Ausrede dürfte bereits auf seinem Tisch liegen: Die Demokraten im Repräsentantenhaus werden das zu verhindern wissen. Eine Krähe hakt der andern Krähe nur selten ein Auge aus. Das gilt auch und vor allem für die Eliten Amerikas.
-
28.5.2020 - Tag der Kollateralschäden
Algifor-Packung kann Abführmittel enthalten: Dieses Schmerzmittel kann in die Hosen gehen
Schweizweit werden Algifor-Packungen zurückgerufen. Statt dem Fieber- und Schmerzmittel befindet sich unter Umständen ein komplett anderes Medikament in der Schachtel. Eine Packung Algifor liegt in fast jedem Schweizer Apothekerschränkli. Es handelt sich um eines der gängigsten Schmerz- und Fiebermittel, das auch für Kinder geeignet ist. Nach Absprache mit Swissmedic führt die Herstellerin Verfora aus Villars-sur-Glâne FR nun einen Rückruf durch. Betroffen sind einzelne Packungen von Algifor Liquid Caps 400mg. Der Grund: Statt dem Schmerzmittel kann sich in der Verpackung ein Abführmittel mit dem Namen Dioctyl befinden. Höchst unangenehm für jeden, der wegen Kopfschmerzen eine Kapsel schluckt. Schreibt Blick.
Vielleicht ist es ja eine Verstopfung, die zu Kopfschmerzen führt. In diesem Fall wäre Algifor das einzig richtige und wahrhafte Mittel. Gewisse Kollateralschäden müssen schliesslich bei jedem Medikament in Kauf genommen werden. Oder wie der Wirt an der Reuss, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen weil Hans Gertsch ja noch lebt, im feinsten Berndeutsch sagen würde: «Das goht omegäng ine wie n'es Zäpfli.»
-
27.5.2020 - Tag der AZ-Empörung
Handlanger der Bauernlobby: Ringier lässt sich für Artikel über das schöne Landleben bezahlen
Der Bauernverband bezahlt für redaktionelle Artikel in Ringier-Zeitschriften wie der «Schweizer Illustrierten» – dahinter steckt auch politisches Kalkül. Die Leserschaft erfährt von alledem nichts. Sogar Bundesrat Guy Parmelin griff für die «Schweizer Illustrierte» in die Tasten. Als ehemaliger Winzer wisse der Landwirtschaftsminister schliesslich, was die Bauern jetzt benötigten, kündigte die Redaktion seinen Text an. Darum unterstütze Parmelin die «Schweizer Illustrierte»-Aktion «Mehr Schweiz im Teller» mit einem Aufruf an die Konsumenten. «Profitieren wir von unseren einheimischen Nahrungsmitteln, und seien wir dankbar dafür», schrieb er darin. Während der Coronakrise will die Zeitschrift eine Lanze für die Schweizer Bauern brechen. Journalisten dokumentieren im Rahmen der Aktion, wie die Spargeln vom Feld auf den Tisch kommen. Sie besuchen das «Reich der glücklichen Schweine» («Sauwohl mit viel Freilauf»). Oder sie schwärmen über das Agrolabel «Suisse Garantie»; es stelle «die inneren Werte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in den Vordergrund». «Vielleicht ist das etwas, was von der Coronazeit bleibt», schrieb Co-Chefredaktor Werner De Schepper in einem Editorial: «Dass wir wieder wissen wollen, wo unser Essen herkommt.» Beim Publikum kommt die Aktion, die parallel im Westschweizer Schwesterblatt «L’illustré» läuft, offenbar gut an. «Ich habe die Berichte richtig verschlungen», freute sich eine Leserbriefschreiberin. Gross sein dürfte die Freude auch beim Schweizer Bauernverband. Recherchen der Redaktion von CH Media zeigen: Der Ringier-Verlag lässt sich vom Verband dafür bezahlen, dass seine Journalisten in den Zeitschriften über die Landwirtschaft berichten. Damit macht er sich zum Handlanger der politischen Ziele der Bauernlobby – gerade mit Blick auf kommende Volksabstimmungen. Die Leserschaft erfährt von diesem Hintergrund nichts. Die stets positiv gefärbten Beiträge sind in Layout und Gestaltung identisch mit den anderen redaktionellen Seiten. Entsprechende Hinweise fehlen. Die Grenzen zwischen Werbung und unabhängiger, freier Berichterstattung werden nicht nur verwischt, sondern aufgehoben. Schreibt die AZ.
Da scheint aber die Empörung der AZ etwas arg gesucht. Mag ja sein, dass die SI den Artikel nicht als «Sponsored Content» gekennzeichnet hat. Muss sie vermutlich auch nicht, weil sich die Herangehensweise irgendwo in einer Grauzone bewegt. Solche Artikel würden sich auch in der AZ (wie auch in allen anderen Medienerzeugnissen) finden lassen, die direkt oder indirekt (durch Inserate) quer finanziert wurden. Die AZ als Leuchtturm und Vertreterin der «reinen Marktlehre», die bekannterweise alles richtet, scheut sich ja auch nicht fern jeglicher Empörung, Hilfsgelder aus der Corona-Giesskanne* des Bundes anzunehmen, die letztendlich von den Steuernzahlern*innen berappt werden. Erinnert irgendwie an die Geschichte vom Esel, der den andern Esel ein Langohr schimpft.
* Beim Giesskannenprinzip werden Subventionen ohne eingehende Prüfung des tatsächlichen Bedarfs gleichmässig über die gesamte Zielgruppe verteilt, ohne die unterschiedliche Dringlichkeit der Einzelfälle zu gewichten. Wikipedia
-
26.5.2020 - Tag des Doggystyles
Fachstellen legen Schutzkonzept für Puffs vor: Kein Gruppensex, dafür Doggy Style und gut lüften!
In Bordellen herrscht wegen der Corona-Pandemie derzeit tote Hose. Prostituierte sind mit einem Berufsverbot belegt. Nun legen Fachstellen ein detailliertes Schutzkonzept vor, das Sexarbeiterinnen das Anschaffen wieder ermöglichen soll. Ein Gummi zum Schutz – das reicht nicht mehr. Mit zahlreichen Massnahmen sollen Prostituierte ihre Arbeit trotz Coronavirus wieder aufnehmen können. Das fordert das Netzwerk Prokore, das sich für die Interessen von Sexarbeiterinnen einsetzt. Ihm gehören zahlreiche Beratungsstellen für Prostituierte an. Das Bündnis hat dem Bund nun ein detailliertes Schutzkonzept vorgelegt. Es sieht vor, dass die Prostituierten nach jedem Kunden Bettwäsche, Handtücher und Kleider bei mindestens 60 Grad waschen müssen. Freier und Prostituierte sollen «nach Möglichkeit» vor und nach dem Geschlechtsverkehr duschen. Zudem soll nach jedem Kundenkontakt das Zimmer für mindestens eine Viertelstunde gelüftet werden müssen. Auch was die angebotenen Dienstleistungen betrifft, sieht das Konzept Einschränkungen vor. Es sollen nur Stellungen praktiziert werden, «bei denen die Tröpfchenübertragung gering ist», heisst es. Das bedeutet konkret: Während dem Sex «muss zwischen den Köpfen der beiden Personen ein Abstand von mindestens einer Unterarmlänge sein». Auf Neudeutsch also: Doggy Style bevorzugt! Gruppensex soll nicht erlaubt sein, ebenso wie «gesichtsnahe Dienstleistungen», also zum Beispiel Oralsex. Während das Tragen einer Schutzmaske lediglich empfohlen wird, sollen Handschuhe bei Analverkehr Pflicht sein. Um mögliche Ansteckungsketten zurückverfolgen zu können, müssen Freier zudem ihre Kontaktdaten angeben. Diese sollen einen Monat lang aufbewahrt werden. Auf dem Strassenstrich könne man auch das Autokennzeichen notieren, heisst es im Schutzkonzept. Das Schutzkonzept liegt nun beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Es muss die Massnahmen nicht bewilligen. Vielmehr soll das Konzept als Diskussionsgrundlage dienen und einer baldigen Öffnung des Sexgewerbes den Boden ebnen. Schreibt Blick.
Wie schon Konfuzius sagte: «Essen und Beischlaf sind die beiden grossen Begierden des Mannes». Deshalb ist es an der Zeit, den Lockdown auch bei den sündigen Mädchen etwas zu lockern. Für alle, die noch immer weisse Socken tragen und nicht wissen was ein Doggystyle ist: Doggystyle ist weder ein Hundeguetzli noch eine Hunderasse, sondern bedeutet, «es» wie verliebte Hunde zu treiben. Kopulation nur von hinten. Sehr wichtig! Und Blasbalg-Spielchen dürfen nur mit Gesichtsmaske geblasen werden. Bitte jetzt nicht jammern. Einfach ausprobieren und neue Erfahrungen sammeln. An der Haldenstrasse in Luzern bezahlten früher die Kunden mit den Porsches und Maseratis für sowas 500 Franken. Heute kriegt man's zum M-Budgetpreis! Min-Jupes lüften inklusive. Corona bringt halt wirklich alles durcheinander.
-
25.5.2020 - Tag der Selbstbedienungsorgien
Ferrari, Aston Martin, Porsche: So verprassen Chefs ihre Corona-Kredite
Unfassbar! Mehrere Schweizer Unternehmer missbrauchen die Corona-Kredite vom Bund, um damit ihre verpfändeten Luxusschlitten zurück zu kaufen. Eigentlich ist das verboten. Doch die Chefs nutzen gekonnt ein Schlupfloch aus. Der Lockdown brachte besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in die Bredouille. Um die Firmen zu retten, verabschiedete der Bundesrat im März 2020 ein Rettungsprogramm. Konkret 40 Milliarden Franken. Eigentlich eine gute Sache. Doch manche Unternehmer missbrauchen die Corona-Kredite. Statt ihre Mitarbeiter zu bezahlen, kaufen sie ihre verpfändeten Luxusschlitten zurück. «Seit die Nothilfen für die Covid-19-Pandemie angelaufen sind, werden bei uns auffällig viele Luxusautos von Unternehmern wieder abgeholt», sagt Cedric Domeniconi, Chef von Auto-Pfandhaus.ch, zur «Sonntagszeitung». Ferrari, Aston Martin, Porsche. Zu Beginn der Corona-Krise wurden zahlreiche Edelkarossen beim Pfandhaus abgegeben. Nun rollen die teuren Autos wieder vom Hof. Die Kunden würden vorwiegend aus der Bau-, Immobilien- und Finanzbranche, erklärt Domeniconi. Woher die Unternehmer plötzlich das Geld haben, um ihre Luxusschlitten zurückzuholen, müssen sie nicht angeben. «Wir wissen aber, dass viele Kunden die Notkredite zum Rückkauf ihres Pfandkredits verwenden, den sie ursprünglich mit ihrem Auto gedeckt hatten», so der Pfandhaus-Chef zur «Sonntagszeitung». Schreibt Blick.
Wen wundert's? Sind ja wieder mal die üblichen Verdächtigen der moralischen und ethischen Verkommenheit involviert: Bau-, Immobilien- und Finanzbranche. Zumal halt eine vernünftige Kontrolle über die Verwendung der Gelder beim Giesskannenprinzip* kaum durchsetzbar ist.
* Beim Giesskannenprinzip werden Subventionen ohne eingehende Prüfung des tatsächlichen Bedarfs gleichmässig über die gesamte Zielgruppe verteilt, ohne die unterschiedliche Dringlichkeit der Einzelfälle zu gewichten. Wikipedia
-
24.5.2020 - Tag des Freisinns
Viele kriegen von Swiss Life keine Mietreduktion – doch keiner muckt auf: Die grosse Angst vor dem Immobilienhai
Zahlreiche KMU hoffen bisher vergeblich auf ein Entgegenkommen des Grosskonzerns bei der Miete. Ihr Ärger ist gross. Doch ihren Unmut öffentlich zu äussern, trauen sie sich nicht. Swiss Life ist die grösste private Immobilienbesitzerin der Schweiz. Dem Lebensversicherungskonzern gehören hier mehr als 1300 Liegenschaften. Gesamtwert des Portfolios: 33 Milliarden Franken. In der Corona-Krise wurde Swiss Life damit für Hunderte kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) wichtiger denn je: Wegen des Lockdowns sind sie darauf angewiesen, dass man ihnen bei der Miete entgegenkommt. Anfang April nährte Swiss Life ihre Hoffnungen noch – und verkündete, dass man «Kleinstbetriebe und Selbständige» in der Corona-Krise mit Mietzinsreduktionen unterstützen werde. Nun zeigt sich: Viele KMU, die bei Swiss Life eingemietet sind, müssen trotz Pandemie die volle Miete zahlen – insbesondere in Städten wie Zürich und Genf, wo die Geschäftsmieten am höchsten sind. SonntagsBlick hat mehr als ein Dutzend Swiss-Life-Mieter ausfindig gemacht: Gastronomen, Coiffeure, Juweliere, Inhaber von Fitnesscentern, Papeterien, Freizeitbetrieben und Schönheitssalons. Einige davon sind Selbständige mit nur einem Standort und einer Handvoll Mitarbeiter, andere etwas grösser mit mehreren Filialen und ein paar Dutzend Angestellten. Alle sind klassische Schweizer KMU. Doch abgesehen von einem Coiffeur in Basel und einer Schneiderei in Zürich hat keiner der angefragten Betriebe eine Mietzinsreduktion erhalten. Eine Gastronomin aus Zürich ärgert sich: «Seit mehr als zehn Jahren bezahle ich immer pünktlich meine Miete, pro Monat über 20'000 Franken. Insgesamt habe ich Swiss Life also schon fast drei Millionen Franken überwiesen. Und nun wollen sie mir in der Krise kein bisschen entgegenkommen? Das ist absolut unsäglich.» Die Wirtin möchte anonym bleiben – genau wie alle anderen Unternehmer, mit denen SonntagsBlick gesprochen hat. Am Telefon machen sie zwar ihrem Ärger über den unnachgiebigen Konzern lautstark Luft. Mit Name und Bild aber will niemand hinstehen. Alle haben Angst, dass sie bei der nächsten Mietzinsverhandlung mit Swiss Life die Quittung dafür erhalten – sprich: eine Mietzinserhöhung. «Der Fall Manor hat ja gezeigt, wie skrupellos Swiss Life mit unliebsamen Mietern umgeht», so der Inhaber eines Detailhandelsbetriebs mit zwei Dutzend Angestellten. Zur Erinnerung: Manor musste seine Niederlassung an der Zürcher Bahnhofstrasse Ende Januar räumen, weil das Warenhaus nicht bereit war, eine Mietzinserhöhung von 6,3 auf 19 Millionen pro Jahr zu akzeptieren. «Wenn Swiss Life sogar mit Manor so umspringt, was droht dann einem Kleinen wie mir?», fragt sich der Unternehmer. Um seine Angst zu verstehen, muss man wissen: Sobald ein Mietvertrag ausgelaufen ist und Verhandlungen über eine Verlängerung anstehen, sitzen Geschäftsmieter am kürzeren Hebel. Denn obwohl sie nur eingemietet sind, investieren sie zu Beginn oft mehrere Hunderttausend Franken in die Inneneinrichtung einer Liegenschaft – etwa für massgeschreinerte Tische, Bänke und Regale oder die perfekte Küche. «Ein Gastronom will deshalb in der Regel um jeden Preis verhindern, dass er umziehen muss – und das wissen die Eigentümer», sagt Urs Pfäffli (57), Präsident von Gastro Zürich-City. Die Fronten sind verhärtet. Betriebe, die bis jetzt keine Mietzinsreduktion erhielten, hoffen nun auf Unterstützung aus Bundesbern. Und diese bahnt sich an: Die Chancen stehen gut, dass das Parlament im Juni einen Mietzinserlass von 60 Prozent für die Dauer des Lockdowns beschliessen wird. Schreibt SonntagsBlick.
Aber aber. Warum wenden sich die Mieter*innen (und auch SoBli) nicht an den glorreichen, solariumgebräunten Luzerner Ständerat und Pöstchenjäger Damian «ich bin nicht schwul»* Müller? Der Gralshüter der wahren Leere (schreibt man wirklich ohne "h") des Neoliberalismus ist ja auf der Lohnleiste der Swiss-Life. Mal sehen, wie sich der Freisinnige im Parlament verhalten wird.
* In den Interviews vor den National- und Ständeratswahlen im Herbst 2019 legte Müller grossen Wert auf diese Äusserung in Interviews mit der LuzernerZeitung, ZentralPlus und anderen Medien, obschon ihn niemand danach gefragt hatte. Einige Journalisten wunderten sich zwar darüber, andere hingegen sprachen von «Pro-aktivem Management Müllers von gewissen Gerüchten», die um den Liebling aller Schwiegermütter zirkulieren. Nachgehakt hat allerdings keiner.

-
23.5.2020 - Tag der Gastronomie
Nach einer Woche schliesst er wieder: Schaffhauser Beizer kehrt in den Lockdown zurück
Die Einnahmen bleiben aus. Nicht einmal ein Mini-Team mit einer Person im Service und einer in der Küche ist rentabel. Das ist die Bilanz eines Schaffhauser Gastronomen. Er zieht die Konsequenzen. Die Ansage war klar: «Vielleicht schliesse ich in einer Woche wieder.» Das sagte der Schaffhauser Gastronom Albin von Euw (43) kurz vor der zaghaften Lockerung der Corona-Bestimmungen für die Beizen. Ein Blick ins Traditionshaus in Beringen SH zeigt: Der Restaurant-Besitzer hielt Wort. Das «Gmaandhaus», wie es die Einheimischen nennen, ist geschlossen. Die Auflagen der Behörden waren zu restriktiv, die Kunden zu zögerlich. Unterm Strich rechnete sich die Öffnung einfach nicht im Vergleich zur Vorjahreszeit. «Wir haben nur 28 Prozent vom Umsatz von 2019 erwirtschaftet», sagt von Euw. Selbst mit einem Mini-Team von einer Person im Service und einer Person in der Küche liesse sich so nicht kostendeckend arbeiten. Von Euw hat die Baisse vorausgesehen. Er war ein Kritiker der frühen Gastronomie-Öffnung. Die Schutzkonzepte seien zu streng, die Verunsicherung bei den Stammkunden zu gross. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn die Restaurants noch einige Wochen Zwangspause gehabt hätten, um dann ohne Auflagen aus dem Vollen schöpfen zu können. Kein Mindestabstand. Kein Daten-Sammeln. Kein Live-Musik-Verbot. Er versuchte es trotzdem. Immer im Hinterkopf aber die Möglichkeit, dass schon bald wieder Sendepause ist. Und so kam es nun auch. «Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir die für 2021 geplanten Renovierungsarbeiten auf jetzt vorverschoben», sagt von Euw. Die Wirtschaft bekomme neue Fenster, neue Elektroinstallationen würden verbaut, die Wohnung im Wirtshaus saniert. «Aus diesem Grund werden wir unser Restaurant bis und mit dem 3. August geschlossen halten. Unserer Wirtschaft und der Umwelt zuliebe.» Von Euw teilt das Schicksal mit zahlreichen anderen Gastro-Betrieben. Auch die Schweizer Bar-Welt leidet. «Der Kostendruck ist sehr gross», sagte unlängst auch Alex Bücheli, Chef der Zürcher Bar- und Club-Kommission, im Gespräch mit Blick TV. Im Schnitt würden Barbetreiber 11'000 Franken Miete im Monat bezahlen. «Sie haben 50 bis 75 Prozent weniger Umsatz als in normalen Zeiten. Es lohnt sich also nicht.» Zumal sich die Leute noch zurückhaltend zeigen würden und auch die Personal-Ausgaben kaum sinken – im Gegenteil. «Wegen der Schutzmassnahmen brauchen wir 20 bis 25 Prozent mehr Personal.» Schreibt Blick.
Es gibt noch weitaus tragischere Beispiele aus der Gastronomie im Zusammenhang mit dem Lockdown. Das Restaurant Schützenhaus auf der Luzerner Allmend bleibt ebenfalls geschlossen. Die Pächterin hat beim Konkursamt die Bilanz deponiert. Ob die Insolvenz allerdings nur der Coronakrise zuzuschreiben ist, sei dahingestellt.
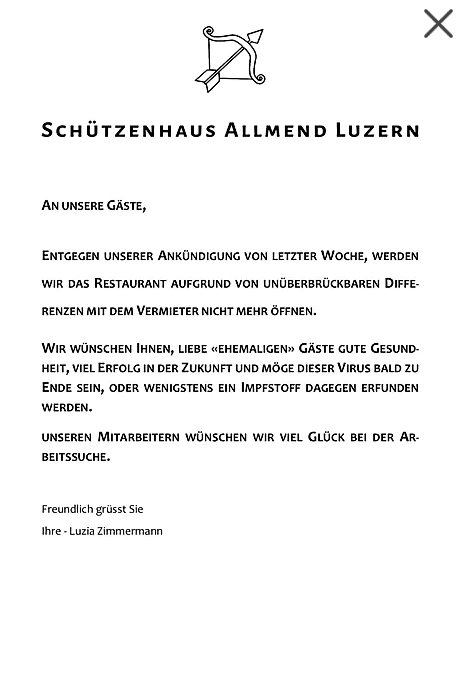
-
22.5.2020 - Tag der Weinbauern
SVP-Chef Albert Rösti (52) zu Corona-Krise und SVP-Initiative: «Der Bundesrat hat drei Wochen verloren»
Ohne die Corona-Krise wäre Albert Rösti bereits nicht mehr SVP-Präsident. Doch nun führt er die Partei nicht nur durch die Krise, sondern auch durch den Abstimmungskampf um die Begrenzungs-Initiative. Dort soll nun die Arbeitslosen-Karte stechen. Seiner Unzufriedenheit mit SVP-Bundesrat Permelin macht Rösti auf die Frage von Blick «Sie haben ihm (Parmelin, Anm.) die Leciten gelesen?» wie folgt Luft: «Ich habe meine Enttäuschung über seine Aussagen ausgedrückt. Bundesräte lassen sich nicht gerne führen.» Schreibt Blick.
Diese Aussage von Rösti darf man so nicht im Raum stehen lassen. Bundesräte lassen sich sehr wohl führen, wie das Beispiel Parmelin zeigt. Fragt sich allerdings von wem, wenn nicht von Rösti? Hat doch Weinbauer und SVP-Bundesrat Guy Parmelin* am vergangenen Freitag ein Corona-Hilfspaket von zehn Millionen Franken für die Schweizer Weinwirtschaft bewilligt, die schon 2019 – in a Time before Corona – serbelte. Ein Schelm wer Böses denkt.
* Zitat von Bundesrat Guy Parmelin im Interview mit der SI: «Wir haben die Pensionskassen und die AHV geplündert, ohne an die nächsten Generationen zu denken.» Und jetzt wird auch noch die Bundeskasse für die Weinbauern geplündert, damit die nächsten Generationen weiterhin den exzellenten Schweizer Wein trinken können? Also sowas von Generationengerechtigkeit...
-
21.5.2020 - Tag der Leserkommentare
Kurzarbeit: Wenn ein Leserkommentar interessanter ist als der veröffentlichte Artikel
Viele Schweizer Angestellte erhalten derzeit weniger Geld, weil sie in Kurzarbeit sind. In der Regel sind es Hunderte Franken pro Monat. Schreibt 20Minuten.
Der Artikel selbst ist oberflächlich und ohne wirklichen Background. Eine Corona-News der üblichen Art. Der Kommentar von 20Minuten-Leser Remo (siehe Screenshot) hingegen hat's in sich: «Mein Chef hat rückwirkend Kurzarbeit zu 100 Prozent beantragt. Wurde bewilligt. Und ich arbeitete die ganze Zeit 100%.... Ich kann nichts dagegen tun. Ich könnte das melden. Aber dann bin ich mein Job los. So läuft das lieber Bund!!»
Der Fairness halber sei festgehalten, dass es sich bei diesem Leserkommentar um einen Fake-Kommentar handeln könnte. Nichtsdestotrotz ist anzunehmen, dass mehr Schindluder mit der Corona-Giesskanne* des Bundes betrieben wird als wir uns vorstellen können. Auch das berühmt berüchtigte Übel, bekannt unter dem Namen «Söihäfeli Söideckeli», erlebt derzeit Hochkonjunktur. Vorangetrieben vor allem durch die Interessenvertreter*innen aus dem Hohen Haus von und zu Bern. Formerly known as «Parlament».
*Beim Giesskannenprinzip werden Subventionen ohne eingehende Prüfung des tatsächlichen Bedarfs gleichmässig über die gesamte Zielgruppe verteilt, ohne die unterschiedliche Dringlichkeit der Einzelfälle zu gewichten. Wikipedia
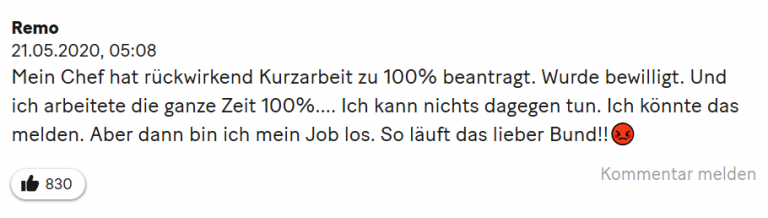
-
20.5.2020 - Tag der Disneyland-Experten
Trotz Corona-Krise – Hypothekarzinsen sacken auf neue Tiefs ab
Sind die Schweizer Hypothekarzinsen zu Beginn der Corona-Krise noch merklich angestiegen, hat sich die Richtung nun wieder merklich gekehrt. Schweizer Hypothekarzinsen sind auf Tiefflug. Entlang der sich erholenden Börsen fallen laut dem Vergleichsdienst Moneyland die Zinsen von Schweizer Festhypotheken seit rund anderthalb Monaten wieder. Zu Beginn der Corona-Krise Anfang März notierten die Hypothekarzinssätze gemäss dem Hypotheken-Index des Online-Vergleichsdienstes bei durchschnittlich 0,93 Prozent für fünfjährige und 1,02 Prozent für zehnjährige Laufzeiten, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. In Folge der Verschärfung der Corona-Krise stiegen die Hypothekarzinsen dann bis Ende März 2020 an. Für fünfjährigen Festhypotheken stiegen die durchschnittlichen Richtzinssätze auf 1,03 Prozent und die für zehnjährige Festhypotheken auf 1,26 Prozent, was einer Verteuerung im März von gut 20 Prozent entsprach. Seit Ende März verbilligten sich die fünfjährigen Festhypotheken auf 0,98 Prozent, während die Hypotheken mit zehnjähriger Laufzeit aktuell 1,11 Prozent im Schnitt betragen. Damit ist laut Moneyland rund die Hälfte des Zinsanstiegs vom März wieder einkassiert worden. Es gibt nun nur noch einen geringen Preisaufschlag für längere Laufzeiten. Der Markt erwartet zurzeit, dass die Zinsen längerfristig tief bleiben. «Für risikoaverse Hypothekarnehmer empfiehlt sich aufgrund des geringen Aufpreises eine Festhypothek mit längerer Laufzeit», sagt Felix Oeschger, Experte von Moneyland. Die Hypothekarzinssätze in den kommenden Monaten und Jahren lassen sich kaum prognostizieren. «Es ist aber durchaus denkbar, dass die Hypothekarzinsen weiter sinken und sogar neue historische Tiefstwerte erreichen», so Oeschger. Je nach Marktentwicklung könne aber auch das Gegenteil eintreten – «mittel- bis langfristig sind auch wieder steigende Zinsen nicht auszuschliessen.» Schreibt Blick.
Unglaublich, wie treffend Experte Oeschger von Disneyland, pardon, Moneyland die Entwicklung der Hypothekarzinssätze auf die Stelle hinter dem Komma genau voraussagt: Entweder sie sinken auf historischen Tiefstand oder sie steigen. Warum nicht gleich Mike Shiva anfragen? Fakt ist, dass die Hypothekarsätze auf sehr lange Zeit nicht steigen werden. Das ist von Bundesrat und Finma gewollt und längst beschlossen. Gewisse Hindernisse auf dem Weg zur eigenen Eigentumswohnung, ursprünglich von der Finma aus Angst vor einer Immobilienblase eingeführt, wurden vorübergehend wieder gelockert. Eine entsprechende Pressemitteilung aus dem Bundeshaus wurde scheinbar von Oeschger nicht gelesen. Oder glaubt dieser Experte vom Orakel aus Delphi wirklich daran, die «bürgerliche» Mehrheit in unserem Parlament würde die Immobilienspekulanten und mit ihr eine der Schlüsselwirtschaften im gelobten Land, wo Milch und Honig fliessen, aber die einheimische Butter knapp wird, einer Rezession ausliefern? Nachsitzen, Herr Oeschger. Oder gleich bei Mike Shiva anheuern. Dieser komische Vogel besitzt immerhin die Begabung, auch mal schlicht und einfach einem seiner mit unendlicher Mühsal beladenen Kunden*innen zum 5-Franken-Tarif pro Minute frisch von der Fettleber oder frei wie aus dem Kopftuch geschossen zu verkünden: «Eg weiss es ned - das chani Öich ned säge. Gäued. Use. Fertig. De Nöchst!»
-
19.5.2020 - Tag ders Guetzliteigs
Masha (55) trauert um ihre Mutter Gunda Dimitri (†86): Sie starb beim Guetzli backen
Sie hat sich verabschiedet wie ihr Mann Dimitri: ohne Leiden und mit einem Lächeln. Gunda Dimitri (†86) ist am Samstag verstorben – beim Guetslibacken ist sie für immer eingeschlafen. Am Samstagnachmittag haben sie Freunde noch an die Seepromenade in Ascona TI gebracht: Gunda Dimitri (†86) freute sich, dass sie seit dem Lockdown endlich wieder in geselliger Runde in einem Café sitzen konnte. Wieder daheim, mitten im Guetslibacken, schloss sie ihre Augen für immer: «Sie schleckte sich noch den Teig von den Fingern», erzählt Masha Dimitri (56). Schreibt Blick.
Gibt es eine angenehmere Art zu sterben, als sich lustvoll den Teig von den Fingern zu schlecken und friedlich ins Nirwana zu segeln? Definitiv NEIN!
-
18.5.2020 - Tag des geliebten Führers
Andreas Glarner will SVP-Präsident werden – und er fordert eine Kampfwahl: «Wir sind doch nicht bei der KPdSU»
Ständerat Werner Salzmann? Nationalrat Alfred Heer? Oder etwa sogar Nationalrat Andreas Glarner? Wer wird Nachfolger von SVP-Präsident Albert Rösti? Mindestens drei Politiker kandidieren. Die Wahl findet voraussichtlich im August statt. Die SVP ist die Partei, in der neue Präsidenten üblicherweise mit Applaus durchgewinkt werden, als Einerkandidaturen. Das war 2016 mit Albert Rösti so und 2008 mit Toni Brunner. Auch 1996 wurde Ueli Maurer als einziger Kandidat mit 333 gegen 27 Stimmen bei 62 Enthaltungen komfortabel gewählt. 2020 soll sich das ändern, wenn es nach Nationalrat Andreas Glarner geht. Drei Parlamentarier haben sich bisher bei der Findungskommission der SVP zu einer Kandidatur für die Nachfolge von Albert Rösti bereit erklärt: Ständerat Werner Salzmann (BE) und die Nationalräte Alfred Heer (ZH) und Andreas Glarner (AG). Glarner betont, er sei nur Kandidat, wenn Nationalrat Marcel Dettling (SZ) nicht antrete. «Für mich ist Dettling nach wie vor der Leuchtturm», sagt Glarner. «Tritt er an, kandidiere ich nicht. Tritt er nicht an, kandidiere ich.» Dann wäre für Glarner die Zeit gekommen, den Delegierten wieder einmal eine Auswahl zu präsentieren. «Ich wünsche mir einen Zweiervorschlag zusammen mit Alfred Heer», sagt Glarner. «Es wäre gut, wenn die SVP-Delegierten wieder einmal eine Auswahl hätten. Wir sind ja nicht die KPdSU.» Damit spricht Glarner die kommunistische Partei der ehemaligen Sowjetunion an. Schreibt die AZ.
Die KPdSU ist die SVP tatsächlich nicht. Die KPdSU wurde nämlich am 6. November 1991 aufgelöst. Da hat der Dummschwätzer AG für einmal tatsächlich recht. Dafür schwebt über der Partei noch immer der Hauch des geliebten Herrliberger Führers aus Pjöngjang, ohne dessen gefälliges Nicken und wohlfeil geöffnetes Portemonnaie rein gar nichts in der SVP läuft. Und auch die Tochter des Gesalbten dürfte ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

-
17.5.2020 - Tag der Hasardeure
Nach Anti-Lockdown-Demos: Nachtschwärmer holen sich Nachtleben in Basel zurück
An diesem Wochenende, nach einem Tag der Anti-Lockdown-Proteste, sind erstmals wieder Bars und Restaurants offen. Nachtschwärmer in Basel nutzten die Chance. Dabei wurden alle Corona-Regeln missachtet. Wer dem Anti-Lockdown-Protestlager angehört und wer nicht, ist nicht genau zu erörtern. Klar jedoch ist, dass sich am späten Abend in der Basler Steinenvorstadt zahlreiche Nachtschwärmer vergnügten, die sich kaum an Corona-Regeln und -Empfehlungen hielten. Viele geniessen die wieder offenen Bars und Restaurants. Von Social Distancing ist wenig zu sehen, anscheinend herrschte sehr gute Stimmung. Über Massnahmen oder ein Eingreifen von Sicherheitskräften wurde nichts bekannt. Ein Leserreporter schreibt: «Am Nachmittag werden Bussen verteilt, weil sie auf einer Decke auf der Wiese sitzen, und was ist in der Steine los in Basel?» Schreibt SonntagsBlick.
Die nächtlichen Zustände bezüglich Missachtung von Social Distancing von Basel sind beileibe keine regionale Erscheinung in der wunderbaren Stadt am Rheinknie. Man findet sie überall in den Schweizer Städten. Am Fusse des Pilatus sogar tagsüber. Wer's nicht glaubt, soll mal einen Schüttirundgang in Luzern riskieren. Heute wäre mit diesem Superwetter der ideale Zeitpunkt dafür. Einen schönen Sonntag wünscht der Artillerie-Verein Zofingen. Bleiben Sie gesund!
-
16.5.2020 - Tag des gestifelten Katers
Corona vernichtet 69 Stellen – Schuhhändler Pasito-Fricker ist konkurs!
Die im Schuhhandel tätige Pasito-Fricker AG mit Sitz in Spreitenbach AG ist konkurs. Der Einkauftourismus und die starke Konkurrenz durch Online-Käufe haben der Firma derart zugesetzt, dass sie ihre Bilanz deponieren musste. Verwaltungsratspräsident John Ammann bestätigte gegenüber der «Aargauer Zeitung» eine entsprechende Anzeige im Amtsblatt des Kantons Aargau. Die mehrwöchige Schliessung der Filialen im Zuge der Corona-Pandemie habe die Situation nochmals massiv verschärft. Pasito-Fricker habe über Wochen keine Umsätze mehr erzielen können. Auch habe das Unternehmen trotz Bemühungen keinen Überbrückungskredit bei den Banken erhalten. Damit sei die Überschuldung Tatsache geworden. Ammann bedauerte den Gang zum Konkursrichter ausserordentlich. Die Restrukturierungen in den vergangenen Jahren seien durch den Stillstand in den letzten zwei Monaten zunichte gemacht worden. Die 23 Filialen der Pasito-Fricker AG seien am (gestrigen) Freitag geschlossen worden. 69 Mitarbeitende seien vom Konkurs betroffen. Laut Ammann prüft das Unternehmen, wie es die Mitarbeitenden bestmöglich bei der Stellensuche unterstützen könne. Schreibt BLICK.
Corona ist in der Tat ein Virus der übelsten Art. Ihm aber nun jeden Konkurs in die Schuhe schieben zu wollen, funktioniert nicht. Schon gar nicht im Zusammenhang mit Schuhhändler Pasito-Fricker. Dass die schon seit längerer Zeit dahinserbelnde Firma keinen Überbrückungskredit von den Banken bekam, hat mit Corona rein gar nichts zu tun. Dafür aber umso mehr mit der verheerenden Bilanz von Pasito-Fricker. Corona hat den Prozess lediglich beschleunigt. So viel Ehrlichkeit muss sein.
-
15.5.2020 - Tag der Billigflieger
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Sommerferien im Ausland: Lieber noch warten mit buchen
Die Welt ennet der Landesgrenzen tut sich langsam wieder auf. Die Lust auf Ferien ist geweckt. Doch wie geht man am besten vor, um sich garantiert erholsame Sommerferien im Ausland zu sichern? BLICK hat bei Experten nachgefragt. Empfiehlt es sich, jetzt schon Sommerferien im Ausland zu buchen? Walter Kunz (59), Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbands (SRV), sagt: «Im Moment empfehlen wir, noch zwei, drei Wochen abzuwarten, bis der Bundesrat am 27. Mai die Details über die Lockerungen zu den Einreisebestimmungen entscheidet.» Schreibt BLICK.
Tausende warten noch immer auf die Rückerstattung von bezahlten Buchungen für Reisen, die wegen Corona abgesagt werden mussten. Selbst die grossartige SWISS lässt sich Zeit mit Rückerstattungen und vertröstet die Kunden*innen und wirft damit die simpelsten Anstandsregeln zwischen Kunden*innen und Lieferant über Bord. Doch Hunderttausende, darunter nicht wenige, die man letztes Jahr bei den «Fridays for Future»-Demos mitheucheln sah, können es kaum erwarten, samt Kind, Kegel und Labrador mit dem billigsten Billigflieger in das billigste aller billigen Strandhotels der billigsten Feriendestination zu jetten, die von Gleichgesinnten überflutet ist. Vergessen der von allem Anfang an unglaubwürdige Aufschrei, medial verstärkt durch die ebenso unzähligen wie lachhaften Leitartikel, angespornt durch die Corona-Krise den Sinn des Reisens, ja sogar des Lebens neu zu überdenken. Vielleicht wieder einmal geruhsam die Ferien in der Schweiz zu verbringen. Alles Makulatur von gestern. Dabei würde es einigen, die den Ballermann von Mallorca und den Kebabstrand von Antalia besser kennen als das Stanserhorn, nicht schaden, den geografischen Horizont der eigenen Heimat etwas zu erweitern.
Kleiner Tipp: Auch im Lötschental kann man traumhafte Ferientage verbringen. Auch wenn die Anreise etwas teurer ist als der Easy-Jet-Flug nach Mallorca.

-
14.5.2020 - Tag der Giesskanne
Die Reaktionen der Fussball- und Hockey-Klubs: GC verzichtet auf die Staatshilfe
Die Katze ist aus dem Sack: Der Bundesrat spricht 175 Millionen Franken für die Profiligen im Fussball. Schreibt Blick.
Lieber Blick, es sind insgesamt 350 Millionen für die Fussball- und Eishockeyligen, die aus der Giesskanne fliessen*. Es ist anzunehmen, dass dieser fette Kuchen nicht genau in der Mitte geteilt wird; die Fussballligen dürften da ein wesentlich grösseres Stück für sich abschneiden als die Eishockeyaner. Sion-Präsident Christian Constantin bringts auf den Punkt: «Das ist ein erfreulicher Schritt vorwärts für den Fussball. Auch wenn es natürlich nun kompliziert wird, denn mit der Kurzarbeit haben wir derzeit ein Mittel, mit welchem der Staat uns mit A-fonds-perdu-Beiträgen** hilft.» Dieser Zynismus («A-fonds-perdu-Beiträge») dürfte in vielen Ohren, in deren Garage keine protzigen Ferrari- und Lamborghini-Kollektionen stehen, wie Hohn klingen. Doch die abgrundgute Viola glaubt an das Gute im Menschen. Sie dürfte im Zusammenhang mit den Stargagen der Fussballer die einzige sein. Dass die exorbitanten Gehälter der modernen Gladiatoren in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent sinken werden, ist wohl eher als Beruhigungspille fürs murrende Volk gedacht denn als ernstzunehmendes Versprechen. Auch die «A-fonds-perdu-Beiträge» müssen letztendlich von irgendwem über Abgaben und Steuern bezahlt werden. Die verwöhnten Profisportler sind es nicht.
* Beim Giesskannenprinzip werden Subventionen ohne eingehende Prüfung des tatsächlichen Bedarfs gleichmässig über die gesamte Zielgruppe verteilt, ohne die unterschiedliche Dringlichkeit der Einzelfälle zu gewichten. Wikipedia
** Der Begriff A-fonds-perdu-Beitrag (französisch: verlorener Beitrag) wird im schweizerischen und liechtensteinischen Subventionswesen verwendet. Er bezeichnet Beiträge, meist Investitionsbeiträge oder Sanierungsbeiträge, auf deren Rückzahlung die öffentliche Hand von vornherein verzichtet. Wikipedia
-
13.5.2020 - Tag der Bioresonanz
Die Bioresonanz-Methode gilt als unwirksam – aber wird nun als Wundermittel gegen Corona angepriesen: Krankenkassen zahlen Millionen für Scientologen-Therapie
Die Bioresonanz-Therapie ist trotz der Kritik der Schulmedizin beliebt. Die Kosten für die Schwingungstherapie wird von Krankenkassen teilweise übernommen. Was die wenigsten wissen: Die Bioresonanz-Therapie ist eine Idee von hochrangigen Scientologen. Sandra Fust (48) aus Tobel TG hat offenbar längst, was Wissenschaftler weltweit fieberhaft suchen: ein Mittel gegen Corona. Für 39.90 Franken pro 100 Milliliter verkauft sie sogenannte Nosoden, die laut Auskunft ihrer Mitarbeiterin Covid-19-Patienten heilen sollen. Hergestellt wurde das Produkt mit Bioresonanz – einer Therapieform, die von Krankenkassen bei entsprechender Zusatzversicherung bezahlt wird. Dabei ist Bioresonanz nichts, auf das man sich mit Blick auf das Coronavirus verlassen dürfte. Diverse Studien haben bereits gezeigt, dass diese Therapieform unbrauchbare Ergebnisse liefert. «Diagnostischer und therapeutischer Unsinn», urteilt die Fachkommission der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie. Obwohl die Bioresonanz-Therapie aus medizinischer Sicht hochumstritten ist, glauben Krankenkassen allerdings an ihre Wirksamkeit. Etwa die Swica, wie Mediensprecherin Silvia Schnidrig sagt. Rund zwei Prozent der gesamten Leistungen im Bereich alternative Therapiemethoden entfallen jährlich auf Bioresonanz-Sitzungen. Dasselbe teilt die Krankenkasse Assura mit. Genaue Beträge wollen sie jedoch nicht bekannt geben. Alle Kassen zusammen dürften in den letzten Jahren aber summiert Millionen von Franken für Bioresonanz ausgegeben haben. Pikant wird das mit Blick auf den Ursprung der Bioresonanz-Therapie, ist sie doch ein Produkt von Scientologen. Schreibt BLICK.
Wen wunderts? Schauen Sie sich mal die üblichen Verdächtigen aus der Lobbyisten-Szene der Schweizer Krankenkassen bei Lobbywatch an: Für die FDP kassieren Olivier Français, Josef Dittli, Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, Anna Giacometti, Matthias Michel ab; für die CVP Ruth «Man verdient sich keine goldene Nase mit Mandaten im Gesundheitsbereich» Humbel, Martin Candinas, Leo Müller, Erich Ettlin; für die SVP Alex Kuprecht, Andrea Martina Geissbühler, Marco Chiesa; für die BDP Lorenz Hess, Martin Landolt; für die GLP wie erwartet Martin Bäumle und für die SP Baptiste Hurni. Das sind alles vom Volk gewählte Parlamentarier*innen. You get what you vote for. So einfach ist das.

-
12.5.2020 - Tag der Verschwörungstheorien
Irre Corona-Proteste ziehen immer mehr Menschen an: Was mache ich, wenn ein Freund an Verschwörungen glaubt?
In vier Schweizer Städten gingen am Samstag Menschen gegen die Corona-Massnahmen auf die Strasse. Wer sind sie und was wollen sie? BLICK beantwortet die wichtigsten Fragen.
Verschwörungstheorien gelten einigen Forschern als «anthropologische Konstante». Schreibt Wikipedia. Es gab sie schon immer und es wird sie immer geben. Blick beantwortet im eigentlichen Sinne keine Fragen, sondern verleiht den Verschwörungsesoterikern*innen nur eine zusätzliche Bühne. Macht damit aus einer Maus den berühmten Elefanten. Denn Hand aufs Herz: Wenn in Schweizer Städten ein paar Hundert Menschen demonstrieren und mit kruden Thesen Aufmerksamkeit produzieren, ist das eine vernachlässigbare Minderheit auf eine Gesamtbevölkerungszahl von 8,57 Millionen Schweizer*innen. Diese abstrusen Thesen mit einem Artikel widerlegen zu wollen ist in etwa so sinnvoll wie die Diskussion über Gott mit einem Atheisten (oder umgekehrt).
-
11.5.2020 - Tag des Wochenstarts mit einem Smiley
Seco sagt nicht, welche Branche wie viel Corona-Geld kassiert: 15 Milliarden unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Die Corona-Kredite sind das grösste Hilfsprogramm der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. 40 Milliarden Franken stellt der Bund als Kreditgarantie für krisengeschädigte Unternehmen bereit. 15 Milliarden wurden laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in den letzten sechs Wochen an Schweizer Unternehmen ausbezahlt. Nun stösst allerdings auf Kritik, dass bislang völlig unklar ist, welche Branchen und welche Unternehmen von diesen Summen profitieren werden. «Um die angemessene Verwendung von Steuergeldern sicherzustellen, ist es wichtig, Transparenz über die Unternehmen und Tätigkeitsbereiche zu erhalten, die von der Nothilfe profitierten», schreibt die Genfer Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger (47, Grüne) in einer Interpellation an den Bundesrat. «Bei solch gigantischen Summen an Steuergeldern müsse die Öffentlichkeit erfahren, wer davon profitiert und ob das Geld in Branchen fliesst, die klimaschädlich sind», glaubt auch Florian Kasser von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Er hat darum vom Seco eine Offenlegung der entsprechenden Informationen gefordert. Eingefädelt wurde das Kreditprogramm zwar durch das Finanzdepartement von Ueli Maurer (69, SVP) – durchgeführt jedoch wird es vom Seco, das im Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin (60, SVP) angesiedelt ist. Doch das Staatssekretariat verweigert in diesem Punkt jegliche Transparenz – und versteckt sich hinter folgender Argumentation: «Die Daten über die gewährten Bürgschaften befinden sich bei den Bürgschaftsorganisationen und werden dem Seco nicht übermittelt», lässt man dort auf Anfrage wissen. Die genannten Stellen seien privatrechtlicher Natur und damit nicht dem Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung unterstellt. Dem widerspricht die Aufsichtsbehörde der Bundesverwaltung, die Eidgenössische Finanzkontrolle. «Wir beauftragen das Seco, für uns jeweils den letzten Stand der Daten bei den Bürgschaftsorganisationen einzuholen», sagt Direktor Michel Huissoud (62). Und um keinen Zweifel entstehen zu lassen, ergänzt Huissoud: «Die Bürgschaftsorganisationen stellen den Datenabzug dem Seco zu.» Tatsächlich werden die Daten an die Wirtschaftsprüfer der Finanzkontrolle übermittelt. Die Frage, wer nun von den Milliardenkrediten profitiert hat, will aber auch sie nicht beantworten. Das sei Aufgabe des Seco, betont Huissoud. Seine Behörde habe lediglich den Auftrag, Fehler und Missbräuche aufzudecken. So werde beispielsweise überprüft, ob Unternehmen, die Corona-Kredite erhalten, Dividenden ausgeschüttet haben. Eine erste Auswertung hierzu liegt seit Donnerstag vor. «Grundsätzlich zeigt sich ein positives Bild», so Huissoud. Die schnelle und unbürokratische Hilfe des Bundes sei «nur vereinzelt» missbraucht worden. Details will die Finanzkontrolle vorerst jedoch nicht preisgeben. Zuerst werde das Dokument in der Finanzdelegation des Parlaments besprochen.
Welche Branchen oder Unternehmen nun von den Corona-Krediten profitiert haben, wird also nach wie vor geheim gehalten. Florian Kasser von Greenpeace hat sein Gesuch inzwischen an den Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes weitergezogen. Schreibt BLICK.
Vielleicht hat ja unser Res die 15 Milliarden erhalten. Verdient hätte er sie jedenfalls. An mir ging der monetäre Superkuchen spurlos vorbei. Dafür ass ich Erdbeeren aus Spanien. Täglich ein Kilogramm. Irgendwer muss ja das Importzeugs von ALDI essen. Oder?
-
10.5.2020 - Tag des Altruismus
Nationalbank-Chef Jordan: Coronakrise trifft die Schweizer Wirtschaft hart
Die Schweiz wird nach Ansicht von Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, noch Jahre an den Kosten der Coronakrise zu kauen haben. Die Krise sei weltweit dramatisch und und treffe auch die Schweizer Wirtschaft hart. Die Aktivität der Schweizer Wirtschaft entspreche derzeit nur etwa 70 bis 80 Prozent des normalen Niveaus, sagte Jordan in einem Interview mit der "SonntagsZeitung". Das verursache pro Monat Kosten von 11 bis 17 Milliarden Franken. Viele könnten sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, was diese Zahlen für den Wohlstand der Schweiz bedeuteten. Es sei mit dem grössten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg respektive seit der grossen Depression der 30er Jahre zu rechnen. Schreibt die AargauerZeitung.
Aber aber Herr Jordan. In der Finanzkrise 2008 haben Ihre Vorgänger Jean-Pierre Roth (Präsident der Schweizerischen Nationalbank) und Philipp Hildebrand (Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank zum damaligen Zeitpunkt, anschliessend Präsident der Schweizerischen Nationalbank und inzwischen Vice Chairman der US-Heuschrecke Blackrock) die systemrelevante UBS doch auch vor dem Untergang gerettet*. Nun bleibt Ihnen nichts anderes übrig, für die Schweizer Bevölkerung die für den täglichen Broterwerb systemrelevante Wirtschaft zu retten. Beweisen Sie, dass mit Ihnen der richtige Mann an der Spitze der SNB steht, der das Wort «Systemrelevanz» richtig deuten kann. Unabhängig vom Geschrei der parlamentarischen Strippenzieher*innen, für die in der Regel nur das eigene Hemd systemrelevant ist. Sollte Ihnen diese Herkules-Aufgabe misslingen, stehen auch Ihnen die Türen zur altruistischen Heuschrecke Blackrock offen.
* Am 16. Oktober 2008 präsentierten Schweizer Regierung und SNB ihren Hilfsplan zur Rettung der UBS: 6 Milliarden Franken vom Bund zur Wiederherstellung der Eigenmittel der Bank und 54 Milliarden Dollar von der Zentralbank, damit die UBS die illiquiden Wertpapiere in einen Spezialfonds transferieren und auf bessere Zeiten für den Wiederverkauf warten konnte. Diese Wertpapiere wurden auf einer von der SNB selbst auf den Cayman Inseln eingerichteten «Zweckgesellschaft» geparkt.
-
9.5.2020 - Tag der Schelme, die Böses denken
Wegen Homeoffice: «Es meldeten sich Kunden mit enormen Rückenschmerzen»
Wackliger Küchentisch statt höhenverstellbares Büropult, klappriger Gartenstuhl statt ergonomischer Office-Chair: Die Arbeitsbedingungen im Homeoffice sorgen bei vielen Bürolisten für Schmerzen, wie Fachpersonen bestätigen. Schreibt 20Minuten.
Nei aber ou! Man kann es mit Trash-Nachrichten auch übertreiben. Es sei denn, man macht daraus einen PR-Artikel für Büromöbelfirmen, die – rein zufällig – bei TAMEDIA Inserate-Kunden sind. Manus manum lavat, wie wir Lateiner*innen zu sagen pflegen.
-
8.5.2020 - Tag der kostenlosen Imagewerbung
Nestlé schenkt Gastrobranche 1 Million Franken
Nestlé will die Schweizer Gastrobetriebe bei der Wiedereröffnung unterstützen: Im Rahmen der neuen Initiative «Always open for you» leistet der Konzern ab nächster Woche Hilfe für 5000 Schweizer Gastronomieunternehmen im Gesamtwert von 1 Million Franken. Cafés, Hotels und Restaurants, die bereits Kunden des Konzerns sind, sollen etwa kostenlos dessen Produkte beziehen können – zudem will Nestlé im Rahmen der Initiative die Zahlungsfristen verlängern und Mietgebühren vorübergehend aussetzen, wie 20 Minuten exklusiv vom Unternehmen weiss. Dass der Konzern den angeschlagenen Firmen helfen will, findet Branchenkenner Peter Herzog von HC Hospitality Consulting löblich: «Das ist sehr ehrenwert, denn Nestlé müsste eigentlich gar nichts tun.» In dieser «Superkrise» sei jede Hilfe willkommen. Schreibt 20Minuten.
«Tue Gutes und rede darüber!» Getreu dieser uralten Marketingweisheit betreibt Nestlé beinahe kostenlose Imagewerbung in eigener Sache. Ist vermutlich günstiger, einige Produkte jetzt noch schnell gratis abzugeben, statt sie nach dem Verfall des Ablaufdatums auf Firmenkosten entsorgen zu müssen.
-
7.5.2020 - Tag des öffentlichen Raumes
Die Beiz soll auf die Strasse kommen: Die FDP fordert öffentlichen Raum für Restaurants und Läden
Mit den Auflagen werden es die Restaurants auch nach den Lockerungen nicht einfach haben. Baden und Aarau könnten dem Gewerbe öffentlichen Raum zur Verfügung stellen, fordern die FDP-Stadtparteien. Am Montag können Restaurants wieder öffnen: Allerdings sind coronabedingt pro Tisch nur vier Personen erlaubt, und zwischen jeder Gruppe muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. «Rentabel zu arbeiten, ist unter diesen Umständen beispielsweise für kleine Betriebe nicht einfach», sagt Stefan Jaecklin (FDP), Einwohnerrat in Baden. Er fordert die Stadt darum zusammen mit seinen Parteikollegen Mark Füllemann und Mischa Brandmaier dazu auf, unkompliziert Hilfe zu leisten. Hauptidee: «Die Stadt soll öffentlichen Raum gratis zur Verfügung stellen. Gastrobetriebe sollen den Aussenraum nutzen und ihre Gäste dort an Tischen bedienen können.» So könnte sichergestellt werden, dass auch kleinere Betriebe die Social-Distancing-Regeln einhalten und rentabel arbeiten könnten, schreiben sie in ihrer dringlichen Anfrage. Zusätzlich sollen die grossen öffentlichen Plätze der Stadt für Verkaufsstände zur Verfügung stehen: Der Kirchplatz, der Cordulaplatz, der unteren Bahnhofplatz und der Theaterplatz. Jedes Geschäft beziehungsweise jedes registrierte Gewerbe soll einen Marktplatz erhalten, so der Vorschlag. Auch in den Aussenquartieren, also beispielsweise im Kappelerhof oder Rütihof, sollen Marktstände des dort ansässigen Gewerbes zugelassen sein. Zur zusätzlichen hygienischen Absicherung soll die Stadtverwaltung bei den neuen Märkten Desinfektionsmittel und Masken zur Verfügung stellen. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Und was, wenn das Wetter nicht mitmacht? Dann dürfte der Kirchplatz die Gastronomie buchstäblich vom Regen in die Traufe führen. Warum nicht gleich in die Kirchen rein? Die sind – Ausnahmen bestätigen die Regel – ohnehin leer und der Abstand von zwei Metern zwischen den Holzbänken könnte mühelos eingehalten werden. Halleluja.
-
6.5.2020 - Tag der Schmiermittel
FDP-Ständerat Damian Müller fordert: «Gleiche Klimaziele für alle!»
Seit diesem Jahr gilt das vom Schweizer Stimmvolk vor drei Jahren verabschiedete Klimaziel für Neuwagen von 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Allerdings nicht für alle in die Schweiz importierten Neuwagen. Kleinere Hersteller, die im EU-Raum weniger als 10’000 Fahrzeuge pro Jahr auf den Markt bringen, profitieren von einer Sonderregelung der EU-Kommission – die vom Bundesrat für die Schweiz übernommen wurde. Das betrifft in unserem Land konkret 20 Marken – etwa Luxus-Sportwagenhersteller wie Aston Martin, Bentley, Ferrari oder McLaren, aber auch die europaweit besonders in der Schweiz populären Volksmarken Subaru oder Suzuki. Nun möchte FDP-Ständerat Damian Müller mit dieser Ungleichbehandlung aufräumen. In seiner im Parlament eingereichten Motion fordert der 35-jährige Luzerner, dass für alle Personenwagen die gleichen CO2-Zielvorgaben gelten und dass der Bundesrat die Verordnung des CO2-Gesetzes entsprechend anpassen soll. Schreibt BLICK.
Da haben die «Kleinen» wie Aston Martin, Bentley, Ferrari*, McLaren, Subaru und Suzuki wohl vergessen, ein bisschen Schmiermittel ins Getriebe des Pöstchenjägers Müller zu giessen.
* Ferrari liegt nach Börsenwert an vierter Stelle der Autobauer. Vor GM, Ford und Fiat Chrysler.

-
5.5.2020 - Tag der Dicidenden
«Dividenden-Stopp schadet den Arbeitnehmern»
Am Dienstag stimmt das Parlament über eine Motion ab, die einen Dividenden-Stopp für Firmen mit Kurzarbeit fordert. Laut Gegnern ist das kontraproduktiv. Geschlossene Geschäfte, einbrechende Werbeeinnahmen oder gestrichene Flüge – Die Corona-Krise hat die Schweizer Wirtschaft und somit auch den Arbeitsmarkt mit voller Wucht getroffen. Noch nie wurde so viel Kurzarbeit beantragt wie zu Zeiten von Covid-19: «Über ein Drittel der Beschäftigten sind in Kurzarbeit», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Montag an der Sondersession des Parlaments. Der Bundesrat will sechs zusätzliche Milliarden in die Arbeitslosenversicherung einschiessen, um die Kurzarbeitsentschädigungen zu finanzieren. Gleichzeitig schütten zahlreiche Unternehmen Dividenden an ihre Aktionäre aus. Schreibt 20Minuten.
Das kann man sehen wie man will: Jede Medaille hat zwei Seiten. Nicht selten sind ja auch Pensionskassen Aktionäre von Firmen, die 2019 noch solide Zahlen vorweisen konnten und jetzt vom Staat unterstützt werden müssen. Letztendlich werden die für die kommenden Jahre ausbleibenden Dividenden grosse Löcher in den Bilanzen der Pensionskassen hinterlassen, was für die versicherten Arbeitnehmer*innen bittere Folgen haben wird wird. Der Umwandlungssatz dürfte ins Bodenlose fallen und das Rentenalter auf 70+ erhöht werden. Womit endlich ein Kernanliegen der FDP-Präsidentin Petra Gössi erfüllt wäre, die bisher unermüdlich ein Absenken des Umwandlungssatzes und die Erhöhung des Pensionsalters forderte.
-
4.5.2020 - Tag des Wochenstarts
Liebes-Aus für «Bauer, ledig, sucht…»-Verkuppler: Moderator Marco Fritsche hat sich von seinem Mann getrennt
14 Jahre währte das Glück. Jetzt meldet «Bauer, ledig, sucht…»-Verkuppler Marco Fritsche das Liebes-Aus mit seinem langjährigen Partner. «Love is the anwer», meint Fritsche selbst dazu. Wie der TV-Star den Dämpfer einsteckt, beschreibt er auf Instagram: «Zur Kenntnisnahme: Nach acht Jahren Beziehung und sechs Jahren in eingetragener Partnerschaft haben wir uns vor einigen Wochen getrennt, und dementsprechend geht jeder wieder seinen eigenen Weg. Wir bleiben uns aber in Freundschaft und durch viele gemeinsame Freunde auch weiterhin verbunden.» Fritsche bittet Fans, «diese intime Tatsache» der Trennung zu respektieren. Auch Anfragen von Journalistenkollegen will er keine beantworten. Schreibt BLICK.
Was für ein missglückter Start in die neue Woche! Noch immer werden wir vom Coronavirus durchgeschüttelt und nun auch noch das: Der/die/das Fritsche steckt einen Dämpfer ein: Sein Mann macht sich hurtigen Schenkels vom Acker. Wir, die Einfühlsamen, verstehen Fritsches Wunsch, die Trennung zu respektieren ebenso wie seinen Entscheid, keine Anfragen zu beantworten. Frei nach Inspektor Colombo drängt sich da aber doch noch eine Frage auf: Warum plappert Fritsche denn wie ein Exhibitionist über seine triviale Beziehungskiste auf Instagram? Es darf mit grosser Sicherheit angenommen werden, dass sich 99,999 Prozent der Schweizer Bevölkerung nicht um diese Fogalstrumpf-Schmonzette kümmern. Ist in etwa so weltbewegend wie ein Sack Reis, der in China umgefallen ist.
-
3.5.2020 - Tag des Hauseigentümerverbands
SVP zu zusätzlichen Corona-Hilfen: Nein, nein, und nochmals nein
Der Bundesrat soll ab sofort auf Notrecht verzichten und weitere Eingriffe in die Wirtschaft während der Corona-Krise tunlichst vermeiden. Das verlangt die SVP-Fraktion. Gelder für die familienexterne Kinderbetreuung? Hilfe für geschlossene Läden, die Miete zahlen müssen? Die Antwort der SVP ist überall dieselbe. «Nein!». Zudem verlangt die Partei ein sofortiges Ende des Notstandes, wie sie am Samstag auf dem Berner Messegelände verkündet hat. Auf dem Messegelände beginnt nächste Woche die ausserordentliche Session. Es wird vor allem darum gehen, die vom Bundesrat gesprochenen Kredite und Unterstützungen zu genehmigen. Zusätzlich liegen bereits eine ganze Reihe von Vorstössen vor, die weitere Gelder für Corona-Betroffene fordern – über das Wirtschaftspaket des Bundesrates hinaus. Albert Rösti (52), Parteipräsident der SVP, kündigt bereits an, dass seine Partei sämtlichen solchen Vorstössen eine Absage erteilen will. Insbesondere das Thema Geschäftsmieten stösst der Volkspartei sauer auf. In beiden Räten liegen Vorstösse vor, die zumindest teilweise einen Schuldenerlass fordern. Mieterlasse wären «nichts anderes als eine staatlich angeordnete Enteignung», findet Rösti, und warnt vor der Büchse der Pandora. Die grösste Fraktion im Parlament kritisiert den Bundesrat für seine Massnahmen. Die Gefährlichkeit der Pandemie sei anfänglich überschätzt worden. «Die prognostizierte Katastrophe ist nicht eingetroffen.» Mit einem Vorstoss verlangt die SVP deshalb, dass auch bei einer allfälligen zweiten Corona-Welle auf einen Lockdown verzichtet wird. Für die über 65-Jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen – die sogenannte Risikogruppe – empfiehlt die SVP die Isolation. Schreibt SonntagsBlick.
Irgendwer muss ja in Zeiten des Giesskannenprinzips* auch noch Nein sagen. Wer, wenn nicht die SVP, bei der das «nein, nein, nein und nochmals nein» in der Partei-DNA für immer und ewig gespeichert ist? Zumal der Vorstand des HEV (Hauseigentümerverband) um Präsident Hans Egloff von der SVP dominiert wird. Parteipräsident Rösti agiert hier lediglich als «His Masters Voice». Und die Isolation der Risikogruppe Ü65+ käme wohl manchem Parteimitlied gelegen, fällt doch ausgerechnet der Gesalbte vom Herrliberg auch unter diese Gruppe.
* Beim Giesskannenprinzip werden Subventionen ohne eingehende Prüfung des tatsächlichen Bedarfs gleichmässig über die gesamte Zielgruppe verteilt, ohne die unterschiedliche Dringlichkeit der Einzelfälle zu gewichten. Wikipedia

-
2.5.2020 - Tag der Bronzestatuen
Angebliches Lebenszeichen nach 20 Tagen: Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ist zurück
Ist Diktator Kim Jong Un zurück? Laut Berichten von nordkoreanischen Staatsmedien soll er am Freitag an einer Zeremonie zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik in der Provinz Pyongan teilgenommen haben. Alle Anwesenden hätten «Hurra» gerufen, um Kims Einsatz um die Düngemittelindustrie zu würdigen. Zunächst wurden keine Bilder der Veranstaltung veröffentlicht. Eine unabhängige Bestätigung der Berichte gab es nicht, allerdings wurden Fotos veröffentlicht. Scheibt BLICK.
Der dicke Kim war gar nie weg. Er wird immer da sein. Selbst wenn er dann wirklich mal weg ist. Neben den Bronzestatuen von Grosspapa und Papa in Pjöngjang ist noch viel Platz.
-
1.5.2020 - Tag der sozialen Revolution im Nationalrat
Corona-Session: Nationalräte sollen auf halben Lohn verzichten: SVP-Nationalrat Lukas Reimann (37) fordert Taggeld-Verzicht
Nächste Woche trifft sich das Parlament zur Corona-Session. SVP-Nationalrat Lukas Reimann fordert die Ratskollegen zum Verzicht auf. Sie sollen bei dieser ausserordentlichen Session nur das halbe Taggeld beziehen. SP-Fraktionschef Roger Nordmann findet das «unsäglich». Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern (39) hat es vorgemacht: Die linke Politikerin verzichtet während sechs Monaten auf einen Fünftel ihres Gehalts – aus Solidarität mit jenen, die in der Corona-Krise finanzielle Einbussen erleiden. In Österreich wiederum spenden Bundeskanzler Sebastian Kurz (33, ÖVP) und seine Minister je einen Monatslohn. Diese Beispiele sollen nun auch in der Schweiz Schule machen. SVP-Nationalrat Lukas Reimann (37) hat deshalb einen Ordnungsantrag eingereicht, wonach der Nationalrat «auf 50 Prozent der Taggelder der Corona-Sondersession als Zeichen der Solidarität verzichtet». Unzählige Menschen in unserem Land seien von der Corona-Krise auch wirtschaftlich enorm betroffen, begründet der St. Galler seinen Antrag. Als Zeichen der Solidarität solle auch der Nationalrat einen kleinen Beitrag leisten. «Der Verzicht ist ein richtiges Signal», findet er. Die Sondersession, in welcher die milliardenschweren Corona-Massnahmen behandelt werden, beginnt nächsten Montag. Sie dauert voraussichtlich bis Donnerstag. Das heisst: Bei 200 Nationalräten und einem Taggeld von 440 Franken würde der Solidaritätsbeitrag insgesamt bis zu 176'000 Franken ausmachen. Zu BLICK sagt der SVPler, dass er am liebsten einen Totalverzicht hätte. Er verlange aber nur die Hälfte, um so die Chancen seines Antrags zur erhöhen. «Es ist ein massvoller Vorschlag», so Reimann. Das sehen aber nicht alle Parlamentarier so. «Dieser Vorschlag ist unsäglich. Wir brauchen jetzt keine populistische Forderungen, sondern sachliche Politik», sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann (47) zu BLICK. Gerade in der Krise müsse man dafür kämpfen, dass alle ihre Löhne erhalten würden und keine Arbeitsplätze verloren gingen, so Nordmann. «Einkommen zu kürzen, ist der falsche Weg. Jede Arbeit gehört entschädigt – auch unsere», sagt der Waadtländer. «Es ist aber typisch, dass der Vorschlag aus der Milliardärspartei SVP kommt – dort kann man sich offenbar mit Dividenden begnügen, Arbeitseinkommen hingegen sind unwichtig.» Die SP werde den Ordnungsantrag ablehnen, ist der Nationalrat überzeugt. Schreibt BLICK.
Wo SVP-Nationalrat und ANUS-Präsident Lukas Reimann recht hat, hat er recht. Herrlich der Konter von SP-Gierhals Roscheee Nordmann mit der «Milliardärspartei SVP». Wie sagte Blocher so trefflich? «Wüssed Sie, i dä SP do hets meh Millionäre als i der SVP.» Und damit hat der Gesalbte vom Herrliberg auch nicht ganz unrecht. Fakt ist: Wenn's ums Abkassieren geht, sind die Parlamentarier*innen ein einig Volk von Brüdern und Schwestern.
-
30.4.2020 _ Tag der Giesskanne
FCZ-Präsident Ancillo Canepa schlägt Alarm: «Geisterspiele kosten uns 20 Mio Franken»
FCZ-Präsident und Liga-Schwergewicht Ancillo Canepa (66) hat Angst, dass die Klubs an Geisterspielen zugrunde gehen. Er hofft auf Hilfe. Schreibt Blick.
Keine Angst, lieber Ancillo Canepa. Auch Ihre Branche wird als systemrelevant eingestuft werden und unter dem nie versiegenden Füllhorn der mit unendlichen Milliarden von Steuergeldern gefüllten Giesskanne* Platz nehmen dürfen.
* Beim Giesskannenprinzip werden Subventionen ohne eingehende Prüfung des tatsächlichen Bedarfs gleichmässig über die gesamte Zielgruppe verteilt, ohne die unterschiedliche Dringlichkeit der Einzelfälle zu gewichten. Quelle: Wikipedia
-
29.4.2020 - Tag der Konkursverschleppung
Kommission des Nationalrats fordert sofortige Hilfe für Zeitungen und Privatradios
Die nationalrätliche Fernmeldekommission will nicht warten, bis ordentliche Fördermassnahmen des Bundesrats in Kraft sind. Wegen der Corona-Pandemie bräuchten Schweizer Medien eine Übergangslösung. Die Corona-Krise bringe die Medien in eine paradoxe Situation, kommt die nationalrätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) zum Schluss. Während die Nachfrage nach medialen Angeboten markant gestiegen sei, seien die Werbeeinnahmen der Medienhäuser teilweise um 60 bis 95 Prozent eingebrochen, schreiben die Parlamentsdienste in einer Mitteilung vom Dienstag. Die KVF fordert deshalb Massnahmen – und zwar schnell. Konkret soll die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) mit zusätzlichen Mitteln unterstützt werden, damit sie die Texte ihres Basisdiensts in drei Landessprachen unentgeltlich allen Medien zur Verfügung stellen könne. Zeitungen sollen zudem von der Post kostenlos oder vergünstigt ausgeliefert werden können. Dies würde den Bund insgesamt 35 Millionen Franken kosten. Eine entsprechende Motion wurde mit 12 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen. Schreibt das Zofinger Tagblatt.
Es war zu erwarten, dass die Parlamentarier*innen in vorauseilendem Gehorsam die mit Milliarden gefüllte Giesskanne des Bundes für ihre Klientel fordern werden. Dass aber ausgerechnet Zeitungen und «Privatradios» mit Steuergeld gerettet werden sollen, ist nichts anderes als Konkursverschleppung. Das Sterben der seit langer Zeit dahinsiechenden klassischen Medien wie Zeitungen und «Privatradios» hat mit dem Coronavirus rein gar nichts zu tun. Corona beschleunigt lediglich eine ohnehin unabdingbare Bereinigung eines längst nicht mehr existierenden Marktes ohne jede Zukunft. Dass ausgerechnet die Apologeten der reinen und absolutistischen Marktlehre des Neoliberalismus über ihre Parlamentsvertreter*innen lautstark nach Staatshilfe schreien, darf als Tragikomödie Shakespearschen Ausmasses bezeichnet werden. Waren es doch über Jahre hinweg genau diese Medien, die das Mantra «Der Markt richtet alles» wie eine tibetanische Gebetstrommel vor sich her trugen und die «soziale Marktwirtschaft» als Saat des Bösen verteufelten. Dass es auch anders geht, beweist ausgerechnet die «linke» WOZ. Oder wie die österreichische Band «Rotz» aus Salzburg trefflich singt: «Jemand muss dafür bezahlen». Die Steuerzahler sollten es diesmal nicht sein.
-
28.4.2020 - Tag der Unterhaltungsorgie
Michael Wyss vom ZT: Einige Sport-Stars haben den Bezug zur Realität verloren
Es geht um viel Geld, um sehr viel Geld. Je höher der «normale» Monatslohn ist, umso höher ist auch die Einbusse, wenn man von Kurzarbeit oder wirtschaftlich bedingten Lohnausfällen betroffen ist. Das müssen derzeit viele der Topcracks in den verschiedensten Sportarten feststellen. Dass das wehtut, ist klar. Und dennoch ist es in keinster Weise nachvollziehbar, wie gewisse Stars momentan die Augen vor der Wirklichkeit verschliessen. Vielleicht hat es bei einigen mit dem fehlenden Bezug zur Normalität – oder schlicht mit fehlender Intelligenz zu tun. Entschuldigen können aber selbst solche Faktoren ihr Verhalten nicht. Es geht nicht um die Sportlerinnen und Sportler, die extrem viel dafür einsetzen, um in ihrer Disziplin erfolgreich zu sein und trotzdem nur so einigermassen «über die Runden» kommen. Es geht nicht um jene, die noch einem Teilzeitjob nachgehen, um ihr Sportlerdasein überhaupt finanzieren zu können. Es geht um die Grossverdiener, die ein Mehrfaches eines jeden Arbeiters erhalten und auch nach ihrer Karriere keinen einzigen Tag finanzielle Sorgen haben müssen. Sie haben scheinbar vergessen, wer eigentlich ihr fürstliches Gehalt bezahlt: Es sind die Fans. Deshalb ist das Theater gewisser Individuen nur noch beschämend. Zum Schluss ein gut gemeinter Rat an alle Unverbesserlichen: Es wird niemand merken, ob ein Ferrari weniger in der Garage steht oder eine Rolex weniger im Schrank liegt. Versprochen. Schreibt Michael Wyss im Zofinger Tagblatt.
Ein beinahe perfekter Kommentar von «Achilles», wie sich Michael Wyss in seiner Kolumne betitelt. Allerdings irrt er mit der Aussage, dass die «Fans» die aberwitzigen Gehälter der Sport-Stars (Fussball, Formel1, Tennis etc.) bezahlen. Die «Fans» stellen gemessen an der Gesamtbevölkerung nur eine kleine Minderheit dar. Wir alle, jeder einzelne Schweizer Haushalt, bezahlen den Schwachsinn. Einerseits über die Zwangsgebühren von SRF, das Millionen und Abermillionen für die entsprechenden Übertragungsrechte bei teilweise drastisch sinkenden Zuschauerzahlen für eine kleine Minderheit der «Angefressenen» bezahlt. Siehe Formel1, die durchschnittlich kaum mehr als 400'000 Zuschauer*innen vor den SRF-Bildschirm lockt. Andererseits bezahlt die Allgemeinheit, also die Steuerzahler*innen, die häufig durch gewisse «Fans» verursachten Nebenkosten im öffentlichen Raum, die nicht selten in den sechsstelligen Bereich hochschnellen. Hinzu kommt die direkte Werbung der Sponsoren, die indirekt und beinahe ausschliesslich allein von den Konsumenten*innen bezahlt wird. Wenn der Detailhändler «Otto's» aus Sursee beim FC Luzern als Hauptsponsor auftritt, leistet sogar der von Gölä* vielgeschmähte Junkie vom Luzerner Bahnhofplatz seinen Anteil an dieser über Jahrzehnte wie ein Krebsgeschwür ins Masslose wuchernden Unterhaltungsorgie.
* Gölä, der letztes Jahr bei Otto's Gratiskonzert auftrat, singt in seinem Song «La bambala lah»: (Die) «Penner vor dem Denner». Und setzt im BLICK-Interview noch einen drauf: «Gegen Penner habe ich nichts, aber gegen eine Politik, die zulässt, dass die Leute als «Penner vor dem Denner» enden. Unser System fördert es geradezu, dass junge Menschen das Geld vom Sozialamt erhalten, selbst wenn sie gar nicht krank sind. Und am Schluss hängen viele nur noch herum, trinken Bier und bekiffen sich. Oder sie hocken den ganzen Tag zu Hause und schauen sich dumme Serien an. Das regt mich auf!»
-
27.4.2020 - Tag der Nachrufe
UBS-Baumeister Marcel Ospel (†70): Steiler Aufstieg, brutaler Absturz
Er setzte alles auf eine Karte und kam ganz nach oben: Der verstorbene Ex-UBS-Präsident Marcel Ospel (†70) war zeitweise einer der am meisten bewunderten Banker der Welt. Doch in der Finanzkrise verlor er Posten und Ehre. Und wieder steht die Welt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit den 1930er-Jahren. Dabei ist es nur zwölf Jahre her, dass sie viel näher am Abgrund war: 2008 lag die Wirtschaft nicht still, weil die Regierungen das befohlen hatten, sondern weil sich das globale Finanzsystem im Lockdown befand. Keine Bank traute mehr der anderen, die angesehensten Geldhäuser hatten eben festgestellt, dass ihre Besitztümer zum Grossteil Schrott waren. Einer stand mittendrin: Für Marcel Ospel (†70) wurde die Finanzkrise zum persönlichen Waterloo. Seine Bank, die UBS, galt als stockkonservativ, doch tatsächlich hatte sie sich so stark verspekuliert wie weltweit kaum ein anderes Institut. 70 Milliarden Franken setzte sie in den Sand. Es habe ein bisschen reingenieselt, sagte Ospel nonchalant im Frühling 2007, als die ersten Verluste auftauchten. Zehn Monate später stand er mit dem Rücken zur Wand. Nach einer turbulenten, zehnstündigen Generalversammlung in der Basler St. Jakobshalle trat Ospel im Februar 2008 völlig erledigt vor die Presse. Niemand habe die Verluste sehen können, sagte er, sie seien wie eine Naturkatastrophe. Und wer, bitte schön, kann schon eine Naturkatastrophe voraussagen? Damit war klar: Superbanker Ospel, der 26 Millionen Franken im Jahr kassierte, war so ahnungslos wie der Rest der Welt. Eine Welle hatte ihn hochgespült, jetzt begrub sie ihn unter sich. Er hatte einfach seinen Analysten vertraut, und die hatten ihm gesagt: alles im grünen Bereich. Dabei war die UBS längst auf einen Eisberg aufgefahren. Ospels Karriere war beendet. Zwei Monate später, im April 2008, war er weg. Angeblich verzichtete er freiwillig auf die Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident der UBS. Später wurde bekannt, dass ihn die Aufsicht zum Rücktritt gezwungen hatte. Wie andere gefallene UBS-Granden zahlte er später einen zweistelligen Millionenbetrag an Boni zurück. Doch seinen Ruf konnte Ospel damit nicht retten. Schreibt BLICK.
Eine uralte Regel lehrt uns, über Tote nichts Schlechtes zu sagen. Oder zu schreiben. Und das ist gut so. Doch Ospel war nicht nur eine gefeierte Person der Öffentlichkeit, sondern schrieb auch Geschichte. Seine düstere Rolle vor und während der Finanzkrise, die wohl jeden anderen ins Gefängnis gebracht hätte, werden seine positiven Taten für immer überstrahlen. Die menschlich netten Gesten, wie zum Beispiel in seinem Basler Stammlokal ab und zu eine Lokalrunde zu schmeissen, verblassen gegenüber seiner skrupellosen Dreistigkeit. Dass BLICK in seinem Nachruf auch die dunklen Seiten des egozentrischen Bankiers erwähnt, der den Begriff «Bankster» wie kaum ein anderer in der Schweiz verkörperte, ist deshalb nicht nur angebracht, sondern auch löblich. Möge Marcel Ospel dennoch in Frieden ruhen.
-
26.4.2020 - Tag des Konjunktivs
Von Spanien zurück nach Hause: Flucht von Europa nach Afrika wegen Coronavirus-Krise
Migranten sollen Schleppern fast 6000 Euro bezahlen, um von Spanien zurück nach Hause zu fliehen. Das Coronavirus, Europas dramatischer Wirtschaftseinbruch und geschlossene Grenzen treiben Flüchtlinge offenbar zurück nach Afrika. Einige Menschenhändler-Netzwerke in Spanien scheinen neu in der Gegenrichtung zu operieren. Laut marokkanischen Medienberichten hat eine Gruppe von rund 100 Marokkanern rund 5800 Euro pro Kopf hingeblättert, um aus einem der am schlimmsten betroffenen Coronavirus-Hotspots Europas herausgeschmuggelt zu werden. Wie die britische «Daily Telegraph» berichtet, würden Migranten die Strasse von Gibraltar nicht länger überqueren, um ins gelobte Europa zu gelangen. Migranten fliehen im Gegenteil in die entgegengesetzte Richtung von Spanien nach Marokko, um dem Virus sowie Europas Wirtschaftsmisere und Reisebeschränkungen zu entkommen. Demnach hätten Ende März rund 100 Marokkaner die Südküste Spaniens in zwei Schlauchbooten verlassen. Die Überfahrt führte nach Larache in der Nähe von Tanger. Zum vereinbarten Preis von 5500 Euro pro Passagier kamen weitere knapp 290 Euro hinzu: Wegen der rauen See musste den Migranten laut der marokkanischen Zeitung «Al Ahdath Al Maghribia» von einem lokalen Führer an Land geholfen werden. Schreibt SonntagsBlick.
Das geht nun aber gar nicht! Was erlauben sich diese Flüchtlinge? Einfach rein ins Gummiboot und zurück nach Afrika? Und die NGO's bleiben womöglich auf ihren Rettungsbooten sitzen? Die Schweizer Asylzentren leer und die nationalen Flüchtlingsindustrien arbeitslos? Die Schweizer SVP und die deutsche AfD ohne Wahlthema? Nein! Ein weiterer «Corona»-Artikel ohne Fakten und mehr oder weniger ausschliesslich im Konjunktiv geschrieben. Absolut wertlos. Entbehrt jeder Glaubwürdigkeit und hält keinem Faktencheck statt. Kommt noch hinzu, dass die «Vermutungen» im Original aus der britischen Boulevardküche «Daily Telegraph» stammen und vom Schweizer Boulevard-Hotspot an der Zürcher Dufourstrasse kommentarlos übernommen wurden.
-
25.4.2020 - Tag der Glückseligkeit
Der Komiker und sein Mann öffnen die Kochtöpfe: Kochen wie Jonny Fischer und Michi Angehrn
In der Quarantäne werden die Prominenten zu Superköchen. Komiker Jonny Fischer kocht mit seinem Mann Michi Angehrn um die Wette. Schweizer-illustrierte.ch erlauben die beiden einen Blick in die Kochtöpfe und verraten ihre schönsten Rezepte. Wer von euch beiden ist der bessere Koch? Naja, mein Mann hat Koch gelernt und ist Food-Scout. Sein Job ist es, den ganzen Tag bei richtig guten Köchen zu probieren. Von daher habe ich fast keine Chance! Aber ich habe viel gelernt in den letzten sieben Jahren und habe jetzt für mich entdeckt, dass ich lieber Währschaftliches mit einem exklusiven Twist mache als Haute Cuisine. Schreibt die SCHWEIZER ILLUSTRIERTE.
Das ist doch mal eine Story in dieser schrecklichen Zeit der Virologen und Beatmungsgeräte für Risikopatienten mit dem unseligen Hang zur Schnappatmung. Harmonie ohne Ende und regenbogenfarbige Fogalstrümpfe statt weisse Socken. Grenzenloses Vertrauen zwischen den Ehepartnern statt Misstrauen. Denn Hand aufs Herz: Welcher heterosexuelle Mann würde seiner Frau erlauben, es (was immer dieses «es» auch sein möge) den ganzen Tag bei richtig guten Köchen zu probieren? Der Shitstorm wäre vorprogrammiert und eine #me too-Kampagne so sicher wie das Amen in der Kirche. Gerade jetzt bräuchten wir mehr Stories dieser Art, die Hoffnung und zuckersüsse Laune statt Defätismus, Todesangst und Schrecken verbreiten. Wo bleibt denn nur Sven Epiney? Der könnte doch wieder mal einen feinen Schoggikuchen backen. Am heimischen Herd. Zusammen mit seinem Mann. Oder – längst fällig – eine Kochsendung aus dem Ständerat: Kochen mit Damian Müller. So würden wir unseren Ständerat, der eigenen Angaben zufolge 18 Stunden pro Tag für uns im Schweisse seines Angesichts arbeitet, auch mal von einer ganz anderen, sehr persönlichen Seite kennenlernen.
-
24.4.2020 - Tag des Nikotins
Hilft Nikotin gegen das Coronavirus?
Eine französische Studie deutet darauf hin, dass Nikotin Corona-Infektionen verhindern könnte. Mit dem Rauchen sollte man trotzdem nicht anfangen. Rauchen schädigt die Gesundheit – doch in einem Punkt könnte das in Zigaretten enthaltene Nikotin nun hilfreich sein. Eine französischen Studie legt nahe, dass Raucher eine tiefere Gefahr haben könnten, sich mit dem Virus zu infizieren. Viele Ärzte und Suchtexperten warnen aber auf dem Fuss: Bewiesen ist nichts. Die Ergebnisse der Studie seien keinesfall wörtlich zu nehmen. Was aber sagt sie denn aus? Für die Studie wurden 350 hospitalisierte und 150 Personen mit nur leichten Symptomen untersucht. «Unter den Patienten waren nur fünf Prozent Raucher», sagt Professor Zahir Amoura, der die Studie verfasst hat. Seine These: Das Nikotin hindert den Corona-Virus daran, sich an den Zellrezeptoren anzuhängen. Das erschwert seine Ausbreitung im Körper. «Das Nikotin funktioniert wie ein Blocker», so Zahir. Zur Überprüfung der noch nicht bestätigten Befunde der Studie läuft nun eine weitere Testphase. Mittels drei Kontrollgruppen soll ermittelt werden, wie effektiv Nikotin im Kampf gegen das Corona-Virus tatsächlich sein könnte. In einem Spital in Paris wird dem Pflegepersonal Nikotinpflaster verabreicht, um zu prüfen, ob das gegen eine Ansteckung hilft. Einer zweiten Gruppe von Corona-Infizierten werden die Pflaster verabreicht, um herauszufinden, ob es die Symptome lindert. Schliesslich sollen die Pflaster auch bei Schwerkranken auf der Intensivstation zum Einsatz kommen. Allerdings ist Vorsicht geboten: Die WHO weist seit Beginn der Krise darauf hin, dass Raucher ein erhöhtes Risiko haben könnten, am Corona-Virus zu erkranken. Das weil die Lungenfunktion aufgrund des Tabakkonsums bei vielen Rauchern beeinträchtigt ist. Auch der französische Gesundheitsminister wies, auf die Studie angesprochen, darauf hin, dass Rauchen nach wie vor der Sterbegrund Nummer Eins in Frankreich sei. Schreibt 20Minuten.
Den Göttern sei Dank! Auf diese positive Meldung zünde ich mir jetzt gleich eine WINSTON* aus Dagmerseller Produktion an. Waaaaaaaaaaaaaaah, wie fein! Hells Bells! Geht rein wie ein Zäpfli. Zwei Vaterunser und ein Halleluja für die Samurais um Martyn Griffiths von der JT für dieses exzellente Produkt. Sagt auch meine 92-jährige Nachbarin Heidi, für die ich mit meinen 52 Jahren (zum zweiten Mal) sowas wie ein junges Rehböcklein bin und in diesen Lockdown-Zeiten den wöchentlichen Einkauf besorge. Auf ihrer Einkaufsliste steht zuoberst stets «Sieben Päkli Zigaretten!». Mit einem fetten Ausrufzeichen. Kommandieren kann sie noch immer. Scheint in ihrer DNA verankert zu sein. Sieben Päkli bedeuten im Umkehrschluss, dass unser aller Heidi, die auch mit 92 Jahren mindestens ein Buch pro Monat liest, jeden Tag ein Päkli WINSTON inhaliert. Auf die immer wiederkehrende Frage, ob sie denn nicht mit dem Rauchen aufhören wolle, hat die bemerkenswerte und geistig äusserst agile Frau, mit der man auch mal über Dürrenmatt oder Hölderlin diskutieren oder streiten kann, stets die gleiche Antwort: «Dann hätte ich vor 70 Jahren nicht damit anfangen sollen.» Basta! Eine mentholisierte Dunstwolke des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt weht durch den Raum.
*Nein, das ist kein SPONSORED CONTENT. Einfach eine kleine, aber wahre Geschichte aus dem Alltag von zwei Menschen aus der Corona-Risikogruppe, die eigentlich beide längst im Nirwana der endlosen Stille angekommen sein müssten. Nicht wegen Corona, sondern wegen dem Rauchen. Behaupten jedenfalls die «Experten», seit es die WHO gibt.
-
23.4.2020 - Tag der intelligenten Fragen
Verhindert Corona Remo Forrers Karriere?
Vor zwei Wochen hat Remo Forrer «The Voice of Switzerland» gewonnen. Jetzt ist seine erste Single «Home» da. Der 18-Jährige lanciert seine Karriere unter erschwerten Bedingungen. Schreibt das Hin- und Herpendlermagazin 20Minuten.
Wer ist Remo Forrer?
-
22.4.2020 - Tag der Mutter Magdalena
Martullo-Blocher-Angestellte müssen Ferienpläne offenlegen: Die Frau, die zu viel wissen will
Wie weit darf ein Arbeitgeber gehen, um Betrieb und Angestellte vor dem Coronavirus zu schützen? Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher macht hier eigene Leute hässig und ritzt am Arbeitsrecht, sagen Experten. Über SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (50) mit ihren Gesichtsmasken lacht heute niemand mehr. Im Gegenteil: Ihr neuster Coup mit selbstimportierten Hygienemasken für Coiffeusen und Coiffeure wird ihr wohl Tausende neue Wählerstimmen bescheren. Erst belächelt, dann verstummt, ist auch die Kritik an strengeren Vorsichtsmassnahmen, die in Martullos Unternehmen, der Ems-Chemie in Domat/Ems GR, schon Wochen vor dem Lockdown Mitte März eingeführt wurden. Dazu gehören etwa rote Markierungen auf den Tischen der Werkskantine – nur hier darf gegessen werden, anderswo nicht (BLICK berichtete). Doch es gibt auch Corona-Vorschriften, mit denen die Ems-Chefin übers Ziel hinausschiesst und sich im arbeitsrechtlichen Graubereich bewegt. Eine Gruppe von Ems-Angestellten, denen Martullo-Blocher zu weit geht, wendete sich an BLICK. Per Brief, mit internen Formularen, Weisungen und Aushängen, aber anonym. Sie wollten ihren Namen aus Angst, den Job zu verlieren, nicht öffentlich machen, schreiben sie. Die Echtheit der vorliegenden Dokumente und Weisungen, die an Personalverantwortliche aller Standorte der Ems-Gruppe in der Schweiz gingen und an den Anschlagbrettern hängen, stellt das Unternehmen nicht in Abrede. Manche der aufgeführten «Missstände», wie es im Brief heisst, lassen sich entkräften. So darf der Arbeitgeber das Tragen von Schutzmasken anordnen, wenn er sie den Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. Und er darf einen Corona-Test fordern, wenn ein Angestellter aus einer Risikoregion wieder an die Arbeit zurückkehrt. Zu weit geht Ems laut Arbeitsrechtlern jedoch bei der Kontrolle von privaten Auslandsaufenthalten. Hier geht es im Kern um die Ferienanträge, welche die Angestellten mittels Formular bei ihren Vorgesetzten einreichen müssen. Das Antragsformular, es liegt BLICK vor, ist kürzlich überarbeitet worden und enthält eine neue Spalte. Im Gegensatz zurzeit vor Corona verlangt die Ems-Führung jetzt die zusätzliche Angabe von Ort und Land, in denen Ferien geplant sind. Zum Beispiel: Lenzerheide GR, Schweiz, oder Sizilien, Italien. Darf der Arbeitgeber, in diesem Fall Ems, die Angabe des Ferienorts und -landes einfordern? Das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) weiss nichts von dieser Praxis. «Wir hatten keine Kenntnis von diesem Fall und wissen auch nicht, ob es weitere gibt», sagt KIGA-Amtsleiter Paul Schwendener (65). Ems gehe zu weit, sagt Jurist und Arbeitsrecht-Experte Thomas Geiser (67). «Die Arbeitgeberin darf diese Offenlegung nicht verlangen.» Entsprechend könne der Arbeitnehmer auch etwas gänzlich Falsches angeben, ohne dass sich daraus negative Konsequenzen für ihn ergäben. «Die Offenlegung wurde gestützt auf die Informationspflicht der Mitarbeiter/innen bei Reisen in Risikogebiete und -länder verlangt», heisst es in einer Stellungnahme von Ems an BLICK. Das Unternehmen bestätigt, dass das Antragsformular aufgrund der Corona-Krise eingeführt wurde. Damit wolle die Ems-Gruppe ihrer Fürsorgepflicht und rechtlichen Verpflichtungen nachkommen, die Gesundheit der Angestellten zu schützen, heisst es weiter. Schreibt unser aller BLIGG.
Unser täglich Magdalena Martullo-Bashing gib uns oh Herr des daily Boulevard Bullshits von der Dufourstrasse. MM (Magdalena Martullo) kann aber auch machen was sie will, BLIGG findet stets das berühmte Haar in der momentan aktuellen Bärlauchsuppe. Es gibt Schweizer Unternehmen, die von ihren Angestellten ganz andere Dinge zur Bewältigung der Coronakrise verlangen als die gute Martullo. Wie zum Beispiel Gratis-Arbeitsstunden für die serbelnde Holding, damit auch in Zeiten von Corona eine Millionendividende an die beiden Besitzer der nicht börsenkotierten Klitsche ausgeschüttet werden kann. Yachten im In- und Ausland kosten schliesslich eine Menge Geld. Martullo jedoch hat sich in der Coronakrise mit ihren Gratismasken zur «Mutter Magdalena» aller Mühseligen und Beladenen entwickelt. Wir sollten ihr einen Altar errichten, zu ihr mit gefalteten Händen und dem Körper Richtung Osten (Ems) gewendet stündlich beten und täglich eine Kerze anzünden. Die Heiligsprechung von Mutter Magdalena ist nur eine Frage der Zeit.
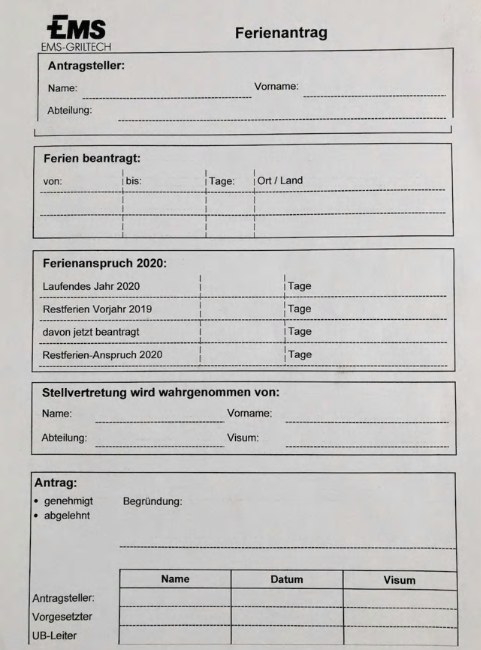
-
21.4.2020 - Tag des Barbiers von Aleppo
Unklare Vorgaben vor Wiedereröffnung: Coiffeuren stehen die Haare zu Berge!
Die Zwangspause ist vorbei, Coiffeursalons dürfen wieder öffnen. Doch noch ist unklar, welche Schutzmassnahmen im Detail gelten. Dabei sollten Betriebe schleunigst nötiges Material wie Masken und Mäntel bestellen. Nach einem Monat Zwangspause ist es bald so weit. Coiffeur-, Kosmetik- und Tattoo-Betriebe dürfen am Montag wieder öffnen. Das Problem: Wenige Tage vor der Neueröffnung ist noch immer unklar, welche Schutzmassnahmen gegen Covid 19 gelten. Der Bundesrat äusserte sich noch nicht im Detail dazu. Das bringt viele Betriebe unter Zeitdruck. Braucht es nur Schutzmasken oder auch Körperüberzüge? Es wäre höchste Zeit, das benötigte Material zu organisieren. Entsprechende Vorschläge legte der Branchenverband Coiffeur Suisse dem Bund vor Wochen vor. Mit unverbindlichen Vorschlägen: Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Einwegmäntel, Visiere oder Wegwerfbecher für Kaffee und Mineral. Wegen der Unklarheit gibt es Kritik. «Coiffeur Suisse, jetzt müsst ihr dem Bundesamt für Gesundheit Beine machen, sodass wir ganz genaue Informationen haben», schreibt ein Friseur auf der Facebookseite des Verbands. Ein zweiter Nutzer fragt: «Wie sollen wir Termine planen, wenn wir nicht einmal wissen, wie viele Stühle man besetzen darf?» Dagegen sieht Mirjam Blättler-Ambauen (42) die Eröffnung positiv. Die Co-Geschäftsführerin beim Coiffeursalon H2O Waser & Blättler in Beckenried NW erklärt BLICK: «Produkte, die ich brauche, habe ich gekauft oder bestellt. Dazu gehören Schutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel.» Schreibt Blick.
Die Frage, die sich allen leidenschaftlichen und hingebungsvollen Maskenträgern* der Risikogruppe Plus-Minus65 stellt: Wie soll einem die kosovarische Coiffeuse oder der Barbier aus Aleppo an der Baselstrasse in Luzern den Bart schneiden, ohne dass die überlebenswichtige Maske abgenommen wird?
* Auf den politisch korrekten Zusatz «Maskenträgerinnen» darf in diesem Fall für einmal verzichtet werden, ist doch anzunehmen, dass sich Bartwuchs auf die Maskenträger beschränkt. Abgesehen von einigen Ausnahmen wie der Buchverkäuferin «Lady McIntosh avec le Schnurrbart» in einem Luzerner Buchladen an der Hertensteinstrasse.

-
20.4.2020 - Tag der tanzenden Politiker
Angelo Barrile (43) ist SP-Nationalrat, Marco Hardmeier (43) Kandidat für die Aargauer Regierung: Dieses Politiker-Paar will hoch hinaus
Marco Hardmeier (43) und Angelo Barrile (43) sind schon ihr halbes Leben zusammen. Mindestens ebenso lange ist das schwule Paar in der SP aktiv. Nun stehen beide – mitten in der Corona-Krise – vor politischen Weichenstellungen. Beide rutschten 2010 im Abstand von wenigen Tagen ins jeweilige Kantonsparlament nach. Ein Zufall. Nicht die einzige Ähnlichkeit in ihren Biografien: Hardmeier ist nur einen Tag jünger als Barrile. Das halbe Leben verbringt das Paar Seite an Seite. Allerdings oft nur im übertragenen Sinne. Ihrer politischen Ämter wegen führen Hardmeier und Barrile seit 17 Jahren eine Fernbeziehung. Barrile lebt in einem Altbau am ehemaligen Strassenstrich am Sihlquai, Hardmeier mitten in der Aarauer Altstadt. An den Wochenenden sehen sie sich. Und immer am Donnerstagabend. «Dieser Termin ist uns heilig: Dann haben wir einen Tanzkurs», sagt Barrile. Beim Rumba führt er, beim Walzer Hardmeier. «Und wenn Tango drankommt, muss Marco dringend eine Zigi rauchen, und ich brauche einen Kafi.» Das Tanzen tue ihnen als Politiker gut, meint Hardmeier mit einem Augenzwinkern. Sie, die sonst gerne den Lead übernehmen, müssen auf dem Parkett auch einmal gehorchen. Schreibt BLICK.
«Dieser Termin ist uns heilig: Dann haben wir einen Tanzkurs», sagt Barrile. So schön. Süsser die Glocken nie klingen. Nachdem ich diese Zeilen gelesen hatte, rief ich sofort meinen Tanzpartner Harald «Harry, fahr schon mal den Wagen vor» Schmidt an und erzählte ihm diese wunderschöne Geschichte. Ich gebe es zu: wir beide haben am Smartphone geweint bis es uns kam. Und wir schämen uns nicht unserer Tränen. Tanzen mit der LAPSE (Anm. Lebensabschnittspartner*in)! Kein Wunder gibt's kaum noch Heten-Paare (Anm. Heterosexuelle Paare). Donnerstag ist unter heterosexuellen Umständen schliesslich Waschtag, wie mir der bekennende Hetero Harald erläuterte. Da habe Madame gefälligst bis Mitternacht in der Waschküche zu stehen, während Monsieur Ausgang auf der freien Wildbahn geniessen dürfe. Und die Moral von der Geschicht? Ohne Tanzen geht es nicht!

-
19.4.2020 - Tag der Dummschwätzer
WLAN für Aargauer Asylunterkünfte? Andreas Glarner findet: «Das ist eine elende Sauerei»
Fast 200'000 Franken gibt der Kanton Aargau aus, um die 50 Asylunterkünfte im Kanton mit WLAN auszustatten. Grund dafür ist die aktuelle Notlage durch das nach wie vor wütende Coronavirus (die AZ berichtete). Der SVP-Nationalrat und ehemalige Gemeindeammann von Oberwil-Lieli Andreas Glarner kann diesen Entscheid nicht nachvollziehen. Gegenüber dem Regionalsender Tele M1 sagt er: «Das ist eine elende Sauerei. Da sieht man die Prioritätensetzung der Regierung in der grössten Krise seit dem zweiten Weltkrieg.» Die Gründe für die Investition des Kantons sind klar: Man will verhindern, dass sich Asylbewerber in Zeiten von Corona an Bahnhöfe begeben, um dort das kostenlose WLAN zu nutzen. Hinzu kommt der Gedanke, dass die Bewohner von Asylunterkünften so besser untereinander kommunizieren können – sei es wegen Arbeitsstellen, wegen Deutschkursen oder der Schule. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Andreas Glarner at its best. Einmal mehr wird klar, warum wir den Mann ungestraft einen «Dummschwätzer» nennen dürfen.

-
18.4.2020 - Tag der Badi-Umfrage
Umfrage des Zofinger Tagblatts
Werden wir im Jahr 2020 jemals in die Badi dürfen? Fragt das Zofinger Tagblatt.
Zofingen hat 11'862 Einwohner*innen laut Angaben der Stadt Zofingen. 19 Teilnehmer*innen (inklusive meiner Wenigkeit) haben an der Umfrage teilgenommen (Stand 18.4.2020 07.24 Uhr). So richtig scheint das Thema die Zofinger*innen nicht zu interessieren, liegt doch die Beteiligung hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung hinter dem Komma. Es könnte natürlich auch noch andere Gründe geben wie mangelnde Auflage. Aber lassen wir das.
-
17.4.2020 - Tag des Gegackers aus dem Hühnerstall
Corona-Krise: Nicht alle sind zufrieden mit der Exit-Strategie des Bundesrats – Hochfahren mit angezogener Handbremse
«Ab heute planen wir unsere Zukunft neu», brachte Wirtschaftsminister Guy Parmelin (60, SVP) den Bundesratsentscheid auf den Punkt, schrittweise aus dem Corona-Lockdown auszusteigen. Dank dem Exit-Plan können Geschäfte jetzt Aktionen aufgleisen, um ihre Ware an Frau und Mann zu bringen. Doch die Landesregierung wirft den Konjunkturmotor vorsichtig an: Sie will verhindern, dass ein Hochschnellen der Ansteckungszahlen sie zwingt, Lockerungen wieder zurückzunehmen. «Wir wollen ein Stop-and-go verhindern», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (48, SP) gestern. Die Parteispitzen beurteilen den Entscheid unterschiedlich. Der SVP geht es nicht schnell genug. Für Parteichef Albert Rösti (52) ist das Vorgehen «viel zu wenig mutig». FDP-Chefin Petra Gössi (44) ist dankbar für Planungssicherheit. Sie sieht aber nicht ein, warum Coiffeure öffnen, während Läden vorerst geschlossen bleiben. Und dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse ist die Lockerung «zu zaghaft». Schreibt der BLICK.
Es war zu erwarten, dass die üblichen Verdächtigen aus dem Lager der abartigen Neolippen der FDP und SVP aus ihrem Hühnerstall gackern werden, egal, was immer auch der Bundesrat veranlasst. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, sagt ein altes Sprichwort. Die Apologeten der ungezügelten Marktwirtschaft, die – das sollten wir nie vergessen – als erste mit Brandbriefen an den Bundesrat um finanzielle Staatshilfen für ihre Klientel bettelten, die doch angeblich alles, aber auch wirklich alles laut dem Dogma der Hardcore-Schalmeien der reinen Wirtschaftslehre richten soll. Die Gesundheit der Schweizer Bürger*innen war dieser elitären Clique ziemlich egal. Auch das sollten wir nicht vergessen. Dass der Bundesrat mit seinen Entscheidungen für das gesamte Volk entscheiden muss und nicht nur für die Interessengruppe der Dividenden- und Boniempfänger*innen, kommt in den Statuten der «freisinnigen» Ideologien nicht vor. Man darf jetzt schon mit Grauen daran denken, welche Kakophonie uns erst nach dem Ende der Coronakrise von den Hohen Damen und Herren erreichen wird, die sie wie üblich mit der unsäglichen Spreizwürde der Etablierten absondern werden, als ob sie gerade auf dem Klo sitzen würden.
-
16.4.2020 - Tag der etwas anderen Analyse
COVID-19 - Zwischenbilanz oder eine Analyse der Moral, der medizinischen Fakten, sowie der aktuellen und zukünftigen politischen Entscheidungen - GASTKOMMENTAR von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt
Überlegungen eines besorgten Schweizer Bürgers: Vorwort: wieso nehme ich überhaupt Stellung? Aus 5 Gründen:
1. bin ich mit meiner Stiftung «EurAsia Heart – A Swiss Medical Foundation» seit mehr als 20 Jahren in EurAsien tätig, habe fast ein Jahr in China gearbeitet und seit 20 Jahren eine kontinuierliche Verbindung zum «Union Hospital of Tongji Medical College/Huazhong University of Science and Technology» in Wuhan, wo ich eine meiner vier Gastprofessuren in China habe. Die 20-jährige Verbindung zu Wuhan habe ich auch in den jetzigen Zeiten konstant aufrechthalten können.
2. ist COVID-19 nicht nur ein Problem der mechanischen Beatmung, sondern betrifft das Herz in ähnlicher Weise. 30% aller Patienten, welche die Intensivstation nicht überleben, versterben aus kardialen Gründen.
3. ist die letzt-mögliche Therapie des Lungenversagens eine invasiv-kardiologische, respektive kardiochirurgische: die Verwendung einer «ECMO», der Methode der «extrakorporellen Membran-Oxygenation», d.h. die Verbindung des Patienten mit einer externen, künstlichen Lunge, welche bei diesem Krankheitsbild die Funktion der Lunge des Patienten so lange übernehmen kann, bis diese wieder funktioniert.
4. bin ich – ganz einfach – um meine Meinung gefragt worden.
5. sind sowohl das Niveau der medialen Berichterstattung wie auch sehr viele Leser-Kommentare nicht ohne Widerspruch hinzunehmen und zwar in Bezug auf Fakten, Moral, Rassismus und Eugenik. Sie benötigen dringend einen Widerspruch durch zuverlässige Daten und Angaben.
Die dargelegten Fakten entstammen wissenschaftlichen Arbeiten, welche ein «peer-review» durchlaufen haben und in den besten medizinischen Zeitschriften publiziert worden sind. Viele dieser Fakten waren bis Ende Februar bekannt. Hätte man diese medizinischen Fakten zur Kenntnis genommen und wäre man fähig gewesen, Ideologie, Politik und Medizin zu trennen, wäre die Schweiz heute mit grosser Wahrscheinlichkeit in einer besseren Lage: wir hätten pro Kopf nicht die zweitmeisten COVID-19-positiven Leute weltweit und eine bedeutend kleinere Zahl an Menschen, welche ihr Leben im Rahmen dieser Pandemie verloren haben. Zudem hätten wir mit grosser Wahrscheinlichkeit keinen partiellen, unvollständigen «Lock-down» unserer Wirtschaft und keine kontroversen Diskussionen, wie wir hier wieder «herauskommen».
Anmerken möchte ich noch, dass alle wissenschaftlichen Arbeiten, die ich erwähne, bei mir im Original erhältlich sind. Sagt Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt und schreibt «Die Mittelländische» (ehemals «Grenchner Zeitung»).
Sie brauchen viel Zeit, um diesen zwar hervorragenden, aber ellenlangen Artikel zu lesen. Doch genau diese Zeit sollten Sie sich unvoreingenommen gönnen, um neue Aspekte, die bislang verborgen blieben und nicht thematisiert worden sind, aufnehmen zu können. Wie beispielsweise die teils unselige Berichterstattung vieler Medien rund um Corona. Um nur einen der vielen Aspekte zu nennen.
Nachtrag: Der Gastkommentar und Veröffentlichung des Manuskriptes "COVID-19 - eine Zwischenbilanz oder eine Analyse der Moral, der medizinischen Fakten, sowie der aktuellen und zukünftigen politischen Entscheidungen" von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt vom 7.4.2020 fand international riesige Beachtung und Zustimmung. In den ersten beiden Tagen wurde der Artikel bereits über 350'000 mal gelesen und tausendfach geteilt. Die Mittelländische hat deshalb bei Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt nachgefragt und 10 Fragen gestellt, die aktuell im Raum stehen.
-
15.4.2020 - Tag der Erntehelfer
Neuer Direktor des Bauernverbands über Selbstversorgung und fehlende Erntehelfer: «Wir sind stark gefordert»
Martin Rufer hat sein neues Amt als Direktor des Schweizer Bauernverbandes mitten in der Coronakrise angetreten. Im Gespräch äussert er sich über mangelnde Erntehelfer, neue Vertriebskanäle der Bauern und die Grundsatzfrage des Selbstversorgungsgrades.
Was beschäftigt die Bauern momentan am meisten?
Es kommen verschiedenste Fragen, etwa von Betrieben, die von den Verboten betroffen sind. Aber auch Fragen wie: was geschieht mit meinem Hof, wenn ich ein Aufgebot für die Armee bekomme? Welche versicherungstechnischen Fragen muss ich klären, wenn ich neue Erntehelfer einstelle? Arbeitsrechtliche Fragen sind ein grosses Thema: In ein paar Wochen werden wir sehen, wie viele osteuropäische Saisonniers tatsächlich noch in die Schweiz kommen und wie gross der Mangel sein wird. Hier können die zahlreichen inländischen Arbeitskräfte, die jetzt in der Kurzarbeit sind, etwas Abhilfe schaffen.
Könnte die Selbstversorgung jetzt an Bedeutung gewinnen? Dazu findet ja gerade eine politische Grundsatzdiskussion statt. Der Bund will den Selbstversorgungsgrad ab 2022 senken.
Die Coronakrise zeigt auf, dass kurze, nicht globalisierte Wertschöpfungsketten durchaus ihre Vorteile haben. Die regionale Produktion mit kürzeren Wegen ist zuverlässiger und robuster, die globalisierte anfälliger. Das gilt auch im Nahrungsmittelbereich. In der agrarpolitischen Diskussion werden wir dieses Thema sicher vertieft anschauen. Ein gewisser Grad an Selbstversorgung ist wichtig. Sagt Martin Rufer und schreibt die Aargauer Zeitung.
Martin Rufer ist ein pragmatischer Mann, dessen grösster Feind wohl die eigene Partei (Anm. FDP) sein dürfte. Seine Antworten auf die gestellten Fragen sind ausgewogen und unaufgeregt sachlich. Ein gutes und lesenswertes Interview. Das Thema der osteuropäischen Saisonniers kommt allerdings etwas zu kurz. Ist es für ein Land wie die Schweiz mit einer Erwerbslosigkeit von 4,8 Prozent im März 2019 (Erwerbslosigkeit berechnet nach internationaler Definition ILO) und Tausenden von erwerbslosen Asylanten, von den viele nur allzu gerne arbeiten würden, nicht ein Armutszeugnis, Erntehelfer aus Osteuropa einzufliegen? Oder wie Simon Wey, Arbeitsmarktexperte des Arbeitgeberverbandes in einem Interview mit der Handelszeitung sagte: «Es mangelt in der Schweiz nicht an Arbeit. Alles dreht sich um die Qualifikation der Arbeitskräfte. Wie können wir den niedrig qualifizierten Arbeitnehmenden die gefragten Qualifikationen vermitteln?», so Simon Wey. «Wer übernimmt hier welche Verantwortung?» Die Coronakrise könnte eine Chance sein, die richtigen Win-Win-Antworten auf Rufers berechtigte Ängste und Weys Fragen zu liefern. Wann, wenn nicht jetzt?
-
14.4.2020 - Tag der Kurzhaarschnitte
Liebe Magdalena Martullo: Kolumnistin Patti Basler schreibt einen offenen Brief
«What do you do when the beamer breaks down?», hast du einst gefragt, «You first fix the beamer» war die richtige Antwort, die du gleich selber geben musstest, weil dein Mitarbeiter die sinking steps nicht verinnerlicht hatte.
Du bist eine zupackende Feministin, die dies nicht an die grosse Glocke hängt und höchstens mit dem praktischen Kurzhaarschnitt manifestiert. Eine Trendsetterin: Du trugst schon Schutzmaske, als es noch nicht in war. Wahrscheinlich wirst du die momentan grassierende Solidarität mit Minderheiten auch ablegen, bevor sie nicht mehr en vogue ist. Sinkende Boote soll man frühzeitig verlassen, you know the seven sinking steps.
Aber zuerst schaffst du 600'000 Masken an für Coiffeur-Salons, denen du sie ohne persönlichen Gewinn verkaufst.
Du kritisierst Bundesrat und Gesundheitssystem dafür, ein bisschen zu sehr auf den jahrelang von SVP und FDP gepredigten Liberalismus gehört zu haben. Lagerbestände wurden gesenkt, das staatliche Ethanollager aufgelöst, Spitäler auf Wirtschaftlichkeit getrimmt, lieber lohnende Hüftgelenk-Operationen als intensive Langzeitpflege. Es gibt nicht einmal genügend Klopapier.
Natürlich möchtest du weniger Staat, nur nicht in Krisen, da empfiehlst du China als Vorbild, das seine Bürgerinnen auf Schritt und Tritt überwacht. Gleichzeitig mahnst du, dass sich erwachsene Menschen nicht herumkommandieren lassen möchten; da hast du als Arbeitgeberin wohl Erfahrung.
Deine Kritik hat System: Staatliche Einrichtungen werden erst schlechtgeredet, dann kaputtgespart, im Krisenfall zeigt man mit dem Finger drauf: Seht, wie der Staat alles falsch macht! Wir haben es ja gesagt! Das scheint zu funktionieren: KiTas und Schulen, Gesundheitssystem, IV, Kesb haben einen schlechten Ruf. Alte und Kranke, Seniorinnen, aber auch Bauern, Ärztinnen, Lehrer gelten nur noch als lästige Kostenfaktoren.
Ausser in Krisen, wo sie plötzlich schützenswert oder systemrelevant sind. Im Gegensatz zu Selbständigen und KMU können sie mit Lohnfortzahlung rechnen.
Hier kommt die grandiose Idee von deinem Parteifreund Thomas Burgherr ins Spiel: Gutverdienende sollen 1 Prozent ihres Einkommens abgeben, um die Ausfälle der KMU zu decken. Eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, ein Mindestlohn für gefährdete Unternehmen und Selbstständige, bezahlt mit einer Art Steuer von Privilegierten. Das ist bahnbrechend. Stell dir vor, wenn Grossunternehmen und sehr gut Verdienende sogar noch einige Prozente mehr einbezahlen! Was du damit bewirken könntest! Da erscheinen 600'000 Schutzmasken geradezu knauserig. Wenn alle solidarisch mitmachen, man würde so vieles schaffen: Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsysteme sowie Coiffeur-Mindestlöhne, die der reichen Schweiz würdig sind.
Vielleicht möchtest du dir dann auch einmal eine Frisur leisten, die mehr als 70.- wert ist.
Natürlich hältst du dich, trotz aller Kritik, an die Regeln des Bundesrats, wäschst deine Hände mit Seife und in Unschuld und posierst im eigenen Garten. Zum Glück hast du das explizit erwähnt, denn nur schon auf dem gezeigten Bildausschnitt passt locker ein Senioren-Pflegeheim mit 20 Intensivbetten samt Schutzmasken-Lagerschuppen. So macht social distancing schon fast Spass. Da sind wir uns ähnlich, ich lebe ebenfalls privilegiert.
Deshalb hier mein Rat: Chill’s! In Zukunft musst du gar nicht zur Virologie-Expertin werden oder in Eigenregie Schutzmasken anschaffen – denn du bist der Staat. Zusammen mit uns allen. Als reicher und einflussreicher Teil dieses Staates kannst du getrost an Experten, Wissenschafterinnen und zuständige Behörden delegieren, welche von unseren Steuern angemessen bezahlt werden. So dass es nie mehr mangelt in zukünftigen Krisen. Auch nicht an Klopapier. Denn mit der unsichtbaren Hand wischst nicht mal du den Hintern.
Es grüsst
sozial distanziert
Patti Basler.
P.S. What do you do, when the system breaks down? You first fix the system.
Schreibt Patti Basler in der AZ.
Intelligente Satire vom Feinsten. Patti Basler at its best! Besser geht nicht. Deshalb ist der offene Brief nicht gekürzt. Möge die AZ dies für einmal verzeihen. Das Meisterinnenwerk der begnadeten Kolumnistin verdient es.
-
13.4.2020 - Tag der Risikogruppen
Mr. Corona Daniel Koch wird 65: Ab heute gehört er zur Risikogruppe
Jetzt gehört er selbst zur Risikogruppe: Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit wird 65. Vorerst darf der Corona-Delegierte des Bundes aber noch nicht in den Ruhestand. Mit stoischer Ruhe referiert er über Infektionsketten, Hygienemassnahmen und Sinn- und Unsinn des Maskentragens: Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist zum Gesicht der Corona-Pandemie in der Schweiz geworden. Dabei ist er seit heute Montag im AHV-Alter. Seinen Posten als Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten hat er abgegeben, nun ist er der offizielle Corona-Delegierte des Bundes. Schreibt BLICK.
Je nach Sichtweise war Daniel Koch für viele seit jeher ein Sicherheitsrisiko. Unabhängig von seinem Alter.
-
12.4.2020 - Tag der Ostereier
Hühner sind beliebt, aber nicht geliebt: Unsere namenlosen Freunde
Das Huhn ist viel mehr als eine günstige Eiweissquelle, es ist auch ein faszinierendes, vielfältiges Wesen. Zu Ostern eine Ode an das beliebteste Haustier, dem wir mit so wenig Liebe begegnen. Es ist Ostern, und es riecht nach Gas. Nach den Feiertagen haben die ausgelaugten Legehennen ihren Dienst getan und werden entsorgt. Für die Tötung fährt die mobile Begasungsanlage auf dem Hühnerbetrieb vor, der bis zu 18 000 Tiere fassen darf. Ein Franken pro totes Huhn. Die Kadaver werden für die Produktion von Biogas verwendet – Suppenhühner kauft kaum jemand mehr. Kein Wunder, wenn die importierte Pouletbrust 1.40 Franken pro hundert Gramm kostet. Wir wollen Ihnen das Osterei nicht verderben. Aber schauen Sie sich morgen das farbige Oval noch kurz an, bevor Sie es tütschen. Ist es nicht ein Wunderwerk der Natur? So filigran und doch so stabil. Für die Kelten stand am Anfang der Welt nicht das Wort, sondern das Ei. Schreibt SonntagsBlick.
Eine Ode an das Huhn, wie wir alle sie uns an Ostern wünschen. Frohe Festtage und bleibt gesund und munter.
-
11.4.2020 - Tag der Hamsterhasen
Confiseur Walter Speck nimmt Corona-Shopper auf die Schippe – Dieser Schoggihase hamstert WC-Papier
Mit einem speziellen Osterhasen nimmt Confiseur Walter Speck die Menschen auf die Schippe, die WC-Papier hamstern. Der Hase ist ein Renner, Speck musste die Produktion hochfahren. Walter Speck (55), Inhaber der gleichnamigen Confiserie in Zug, leidet unter den Auswirkungen der Coronakrise. Die Cafés sind geschlossen, sämtliche Catering-Aufträge sind storniert. «Im Moment ist unser Umsatz um 80 Prozent eingebrochen», sagt er zu BLICK. Speck hat auf Kurzarbeit umgestellt und einen Hilfskredit beantragt. «Vor allem die Fixkosten wie etwa die Mieten belasten uns.» Auch in der Krise hat Speck aber seine Kreativität nicht verloren und einen besonderen «Hamsterhasen» kreiert. Der Schoggihase ist in zwei Rollen WC-Papier eingepackt. «Mit einem Augenzwinkern nehme ich so die vielen WC-Papier-Hamsterer auf die Schippe», sagt er. Einen Osterhasen mit Schutzmaske, wie ihn Berufskollegen herstellen, würde er aber nie machen. Walter Speck (55), Inhaber der gleichnamigen Confiserie in Zug, leidet unter den Auswirkungen der Coronakrise. Die Cafés sind geschlossen, sämtliche Catering-Aufträge sind storniert. «Im Moment ist unser Umsatz um 80 Prozent eingebrochen», sagt er zu BLICK. Speck hat auf Kurzarbeit umgestellt und einen Hilfskredit beantragt. «Vor allem die Fixkosten wie etwa die Mieten belasten uns.» Auch in der Krise hat Speck aber seine Kreativität nicht verloren und einen besonderen «Hamsterhasen» kreiert. Der Schoggihase ist in zwei Rollen WC-Papier eingepackt. «Mit einem Augenzwinkern nehme ich so die vielen WC-Papier-Hamsterer auf die Schippe», sagt er. Einen Osterhasen mit Schutzmaske, wie ihn Berufskollegen herstellen, würde er aber nie machen. Schreibt BLICK.
Die Frage, die uns alle bewegt: Wurde der Hamsterhase wegen dem WC-Papier gekauft oder wegen Specks feiner Schokolade? Whatever. Ein bisschen Humor kann in Zeiten wie diesen nicht schaden. Frohe Ostern und bleibt gesund.
-
10.4.2020 - Tag der virtuellen Osterhasen
US-Aktienmarkt auf Erholungskurs - Kreditprogramm der Fed
Dank eines billionenschweren Kreditprogramms der US-Notenbank (Fed) hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag an seine jüngste Erholung angeknüpft. Der Dow stieg um 1,22 Prozent auf 23'719 Punkte, nachdem er zur Wochenmitte bereits unter anderem von der Hoffnung auf ein schrittweises Hochfahren der unter dem Corona-Virus leidenden US-Wirtschaft profitiert hatte. Innert Wochenfrist bedeutet dies ein Plus von 12,67 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 1,45 Prozent auf 2789,82 Zähler. Er verzeichnete mit einem Plus von gut 12 Prozent sogar den höchsten Wochengewinn seit 1974. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,11 Prozent auf 8238,53 Punkte zu. Am Freitag bleiben die Börsen dann wegen eines Feiertages geschlossen. Schreibt BLICK.
«Er (S&P 500) verzeichnete mit einem Plus von gut 12 Prozent sogar den höchsten Wochengewinn seit 1974.» Die Party geht weiter. As usual. Noch vor kurzer Zeit malten sämtliche «Börsenexperten» die Apokalypse an die Wand. Der endgültige Tod des Abendlandes wurde durch die «verheerende Vernichtung von Börsenwerten» beschworen. Doch Börsenwerte vernichten sich nicht, solange die am Aktienmarkt gehandelten Unternehmen keinen Konkurs hinlegen. Sie wechseln nur die Besitzer. Real existieren sie sowieso nicht. Oder wie Blocher in einem Interview treffend bemerkte: «Wüssed Sie, Aktie, da isch numme Bildschirmgeld.» Also können diese virtuellen Werte auch nicht «verbrannt» werden, wie die NZZ in einem ihrer Artikel orakelte. Einen Schoggi-Osterhasen, der nur virtuell im Internet herumhüpft, kann man ja auch nicht essen. BlackRock, die heimliche Weltmacht, & Co. werden sich jetzt jedenfalls die Hände reiben und die Champagnerkorken knallen lassen: Coronakrise und tiefste Börsenkurse seit langer Zeit zielstrebig genutzt, günstig eingekauft und innert wenigen Tagen Milliarden dazugewonnen. Schönere Ostertage hatte Laurence D. Fink wohl noch nie in seinem Leben. So geht Rock'n'Roll.
-
9.4.2020 - Tag der Hoffnung
Abt Urban Federer im grossen Interview: «Hoffentlich werden wir nach der Krise nicht sein wie vorher»
Auch Abt Urban Federer vom Kloster Einsiedeln erlebt eine Osterwoche, die es so noch nie gab. Im BLICK-Interview spricht er über Social Distancing, Online-Gottesdienst und weshalb er hofft, dass wir nach der Krise anders sind als davor. Er trägt ein grosses Kreuz und einen bekannten Namen. Abt Urban Federer (51) ist entfernt verwandt mit Tennis-Star Roger Federer (38) und der Bruder von alt CVP-Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (54). Als 59. Abt des Klosters Einsiedeln erlebt auch er eine Osterwoche, die es so noch nie gab. Im BLICK beantwortet er die Frage, ob das Coronavirus eine Gottesstrafe ist und was wir aus dieser schwierigen Situation lernen müssen. Werden wir nach der Krise sein wie vorher? «Ich hoffe nicht, denn dann hätten wir die Krise nicht verstanden. Wir werden noch lange mit der Folge der Krise beschäftigt sein und brauchen auch weiterhin die gegenseitige Unterstützung». Sagt Abt Urban Federer und schreibt BLICK.
Ihre Hoffnung, die bekannterweise immer zuletzt stirbt, in Gottes Ohr, Hochwürden! Doch leider zeigt die Vergangenheit der menschlichen Spezies, dass das Verstehen einer Krise und die daraus folgenden Taten zwei paar verschiedene Schuhe sind, die in der DNA von «Gottes eigenen Geschöpfen» (Copyright by Ronald Reagan) nicht vorhanden sind. Wäre Ihre Hoffnung berechtigt, gäbe es spätestens seit dem Ende des zweiten Weltkriegs und dem Nürnberger Tribunal keine blutigen Kriege mehr. Um nur ein einziges Beispiel zu nennen. Die Liste der Katastrophen, aus denen die Menschheit und die aus ihr herausragenden «Wertegemeinschaften», auch und besonders die kirchlichen, nichts, aber auch wirklich rein gar nichts gelernt haben, liesse sich unendlich fortsetzen. Trotzdem vielen Dank für Ihre aufmunternde Osterbotschaft in diesen schwierigen Tagen.
-
8.4.2020 - Tag der Tratschtanten aus den Parteizentralen
Parteien streiten über Ende des Lockdowns – Ja, lockern! Nein, warten!
Ungewohnt harmonisch haben sich die Parteien hinter die Massnahmen des Bundesrats gegen die Corona-Epidemie gestellt. Doch geht es um die Frage, wie die Schweiz wieder zurück in die Normalität findet, ists mit der Einigkeit vorbei. So viel Harmonie war unheimlich. Geeint wie nie stellten sich die Parteien im Kampf gegen das Coronavirus hinter den Bundesrat. Frei von jeder Ideologie. Niemand versuchte, aus der Krise politischen Profit zu schlagen. Doch damit ist es jetzt vorbei. Je länger der Lockdown dauert, desto mehr erwachen die Parteien aus der Krisenstarre. Die politische Einigkeit endet dort, wo sie begonnen hat: bei den Massnahmen zur Eindämmung des Virus. Dass diese nötig waren, darin sind sich alle einig. Doch die Frage, wann und wie die Schweiz nun wieder aus dem Notstand herausfinden muss, sorgt für Zoff. er SVP um Noch-Präsident Albert Rösti (52) kann es mit der Aufhebung des Corona-Notstands nicht schnell genug gehen. Als erste Partei präsentierte sie bereits vergangene Woche ihre Strategie aus dem Lockdown. Ab dem 20. April sollen nur noch Risikopersonen daheim bleiben, Schulen schrittweise geöffnet werden, Läden und Restaurants wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die SVP ist zudem für eine Maskenpflicht. Hauptsache, die Wirtschaft kommt schnell wieder in Gang. Am Dienstag legte die Partei nochmal nach. Sie fordert, dass ab sofort wieder das Parlament den Schlüssel für die Staatskasse hat. Der Bundesrat soll im Alleingang kein 40-Milliarden-Hilfspaket mehr schnüren dürfen. «Das Notrecht ist sobald als möglich zu beenden», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (41). Die SP warnt: Eine allzu frühe Lockerung der Sicherheitsmassnahmen ist aus ihrer Sicht gefährlich. Zu gross ist die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. Die Sozialdemokraten unterstützen denn auch das vorsichtige Rantasten des Bundesrats. Erst in zwei bis drei Wochen wisse man genauer, «wo wir real sind», sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann (47). Die Parteispitze trägt auch das Hilfspaket des Bundesrats für die Wirtschaft mit. Das aber reicht SP-Präsident Christian Levrat (49) noch nicht. Es brauche weitere Massnahmen für Selbständigerwerbende, Kitas, den Tourismus und Mieter. Für die FDP war richtig, dass der Bundesrat den Corona-Notstand verhängt hat. Doch genug ist genug! Jetzt bräuchten Bevölkerung und Wirtschaft endlich Perspektiven für einen schrittweisen Übergang zur Normalität, findet FDP-Präsidentin Petra Gössi (44). Sie fordert, dass alle Geschäfte wieder öffnen sollen, die die Sicherheitsmassnahmen des Bundesamts für Gesundheit einhalten können. Schreibt BLICK.
Da ist sie wieder, diese unerträgliche Kakophonie der parteiübergreifenden Pöstchenjäger*innen der Gebenedeiten. Als ob die Bevölkerung mit dem Coronavirus nicht schon genug Kummer und Sorge am Hals hätte, drängt sich auch noch das Virus der Tratschtanten aus den Parteizentralen mit ihren vorgestanzten, nach Aufmerksamkeit heischenden Weisheiten und Klientel-Botschaften in unser Bewusstsein. Mit der klaren Absicht, auf dass wir ja nicht diese unseligen Schwätzerinnen und Schwätzer vergessen, derweil der Bundesrat einen exzellenten Job macht und im Gegensatz zum Palaver der Parteigranden grosse Verantwortung für sein Tun und Handeln übernehmen muss.

-
7.4.2020 - Tag der Sehnsucht nach dem Männersport
Ungewohntes Leben ohne Sport
Viele Menschen können nicht verstehen, wie man sich während 25 Jahren tagein, tagaus im Berufsleben hauptsächlich mit Sport befassen kann. Sport sei doch eine – bestimmt schöne – Nebensache und sicher nicht mehr. Dass dem tatsächlich so ist, muss auch ich in diesen Wochen schmerzlich erfahren. Es geht momentan um Wichtigeres als Siege und Rekorde, es geht ums nackte Überleben. Und trotzdem beschäftigt mich die Lage der Sportwelt natürlich mehr als andere. Es ist nicht etwa so, dass sich die Sportredaktion jetzt auf die faule Haut legen würde und wartet, bis alles vorbei ist. Es geht darum, Geschichten zu suchen und zu finden, die nicht wie in der Normalität oft mit Spielen oder Wettkämpfen zu tun haben. Es geht um Menschen, um deren Sorgen und Ängste – selbstverständlich auch, was ihre persönliche Zukunft betrifft. In einer Zeit, in der mehr Einwohner als gewohnt in den eigenen vier Wänden verbringen, möchten wir ihnen trotzdem etwas zum Lesen bieten, das zumindest zwischendurch im Ansatz mit dem Alltag zu tun hat. Und zu diesem gehört auch der Sport. Ich selbst bin etwas auf Entzug. Für jemanden, der gerne auch ausserhalb der beruflichen Tätigkeit einmal einen Match besucht und zu den treusten Zuschauern von Sportproduktionen im TV gehört, ist es nicht ganz einfach, die Zeit zu füllen, die sonst für Passivsport eingesetzt wird. Ich vermisse den Kampf Mann gegen Mann, die Jagd nach Medaillen und die Stimmung auf den Zuschauerrängen. Selbstverständlich sind das Probleme weit unter den Existenzsorgen, aber ich kann es trotzdem kaum erwarten, bis alles wieder etwas normaler ist und auch der Sport wieder im Alltag angekommen ist. Schreibt ACHILLES alias Michael Wyss im Zofinger Tagblatt.
Hat der Achilles aber komische Sorgen! Er vermisst den Kampf «Mann gegen Mann». Als ob es keine Frauen im Sportgeschehen geben würde.
-
6.4.2020 - Tag der Quasseltanten
GLP-Nationalrat Bäumle will den Stillstand mit App und Massentests beenden
GLP-Nationalrat Martin Bäumle ist überzeugt: Mit Stichprobentests und Bewegungsdaten ist ein Ausstieg aus dem Stillstand möglich. Er hat ein detailliertes Massnahmenpaket ausgearbeitet. Martin Bäumle ist ein Zahlenmensch. Excel-Tabellen sind eine Leidenschaft des ausgebildeten Chemikers und Atmosphärenwissenschafters aus Dübendorf ZH. Bei den Nationalratswahlen 2011 bewies der damalige Parteipräsident der Grünliberalen sein Flair für Mathematik: Dank geschickten Listenverbindung eroberte die GLP sechs zusätzliche Sitze. Auch das Coronavirus treibt Zahlenmensch Bäumle um. «Die letzten drei Wochen habe ich sämtliche verfügbaren Daten verarbeitet und analysiert». Das Ergebnis der Arbeit: Ein sieben Seiten langes, detailliertes Massnahmenpaket, welches dieser Zeitung vorliegt. Noch spiegelt es lediglich Bäumles persönliche Haltung wieder. Bald sollen sich die GLP-Parteigremien damit befassen. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Martin Bäumle ist ein Zahlenmensch, behauptet die AZ. Wirklich? Wäre dem so, hätten die Bilanzen der Green Cross Schweiz wohl kaum gefälscht werden können, ohne dass der Alleswisser vom Dienst etwas gemerkt hätte. Muss denn jetzt wirklich jede Knallcharge aus der Politik ihren unsäglichen Senf zu einem Thema abgeben, das uns ohnehin schon genug Kummer und Ängste bereitet? Nach den gestrigen Suaden der FDP-Wendehälse Greta Gössi und Damian «ich bin nicht schwul» Müller nun auch noch die Quasseltante von der GLP. Diese furchtbaren Selbstdarsteller*innen und Pöstchenjäger sollten jetzt für einmal schweigen und nicht wie üblich versuchen, das Vertrauen, das der Bundesrat bei der Bevölkerung geniesst, zu hintertreiben. Die Schweizer Bevölkerung vermisst vieles in dieser Zeit. Parteienmüll, Parteiprogramme und die dumpfe Kakophonie der üblichen Verdächtigen gehören definitiv nicht dazu. Wir sind im Kampf gegen ein Virus und nicht im Wahlkampf, der scheinbar bei diesen mediengeilen Schwätzern und Plaudertaschen nebst der üblichen Klientelpolitik ihr ganzes Dasein bestimmt.

-
5.4.2020 - Tag des Hausarrests
Kolumne von Helmut Hubacher: Wochenschau aus dem Hausarrest
SP-Doyen Helmut Hubacher fällt auf, dass seine Frisur die Form verliert, Roger Köppel das Vertrauen in den Rechtsstaat und Lukas Bärfuss die Fassung. Wenn der Coiffeur noch lange Haarschnittverbot hat, wird es kritisch. Meine Frisur verliert langsam die Form und ähnelt bald einmal einem Krähennest. Beim Ausgehverbot für Senioren muss das nur meine Gret aushalten. Die sieht übrigens oben auch nicht eleganter aus. Von Frisur ist bald keine Rede mehr. Auf Roger Köppel ist einfach Verlass. Der SVP-Nationalrat und Chefredaktor der «Weltwoche» fährt wieder einmal Geisterbahn. In der Ausgabe vom Donnerstag dieser Woche malt er das Ende der Schweiz, wie sie heute noch ist, an die Wand. Ich zitiere: «Die Sozialisten richten sich auf den ewigen Lockdown ein. Sie wollen die Marktwirtschaft durch eine Staatswirtschaft ersetzen.» Um sicher zu sein, dass ihn auch noch der hinterletzte Depp versteht, doppelt er nach: Die SP wolle die Corona-Krise ausnützen, «um Freiheit und Marktwirtschaft abzuschaffen». Bei solchem Geschütz musste ich meine Kolumne im letzten Moment umschreiben. Als Erstes möchte ich Roger Köppel versichern, SP-Politiker sind normal wie andere Bürger und keineswegs verrückt geworden. Das bestätigt die NZZ vom 1. April als unverdächtiges, bürgerliches Hoforgan. SP-Bundesrat Alain Berset spiele «die Rolle seines Lebens». Die Zeitung vergleicht ihn mit General Henri Guisan, der im Zweiten Weltkrieg «den Widerstandsgeist von Volk und Armee beseelte, so, wie heute Berset den Durchhaltewillen beschwört»: Das ist ein dickes Kompliment an den SP-Bundesrat. Zweitens darf ich Roger Köppel an die Machtstruktur im Bundeshaus erinnern. Nach wie vor haben wir eine bürgerliche Mehrheit – und zwar seit es den Bundesstaat von 1848 gibt. Also seit 172 Jahren. Köppels Angst, die SP werde nach Ende der Corona-Krise die Macht übernehmen, ist unbegründet. Leider, füge ich hinzu. Drittens begreife ich hingegen Köppel, dass er wenig Vertrauen in diese Rechtsmehrheit hat. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit ein paar Dutzend Ökonomen hat in der Viruskrise grandios versagt. Allen voran Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch mit ihrem Chefökonomen Eric Scheidegger. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga soll verzweifelt ausgerufen haben: «Sie können es einfach nicht.» Departementschef Bundesrat Guy Parmelin musste die Sozialpartner vom Schweizerischen Arbeitgeberverband und vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund zu Hilfe rufen. Die BaZ hat ja berichtet, wie der Chefökonom vom Bund mit seinem Team 15 Milliönchen Franken vorgeschlagen hatte. Das Hilfspaket von 42 Milliarden Franken haben die Sozialpartner geschnürt. Viertens hat Professor Harald Weizer, Direktor der Stiftung für Zukunftsfähigkeit an der Universität Flensburg, mit einem Vorurteil aufgeräumt. Nämlich: «Das Gerede von der Marktwirtschaft, die es schon richten wird, hat sich erledigt. Nicht nur die Wirtschaft, auch die Wirtschaftswissenschaft liegt im Wachkoma. Sie hat ausser dem Ruf nach dem Staat nichts zu bieten.» («Basler Zeitung», 1.4.2020). Das müsste Köppel mehr beunruhigen als sein SP-Angsttraum. Schreibt BAZ online.
Eine Kolumne, die sich zu lesen lohnt. Hubacher at its best.
-
4.4.2020 - Tag der Milliardenkredite
Nationalrat Jauslin warnt vor Bschiss mit Corona-Krediten – und verärgert KMU-Kollegen
Zuerst 20, jetzt bereits 40 Milliarden Franken gibt der Bundesrat frei, um Firmen in der Corona-Krise mit Gratis-Krediten zu helfen. Weil alles sehr schnell gehen muss, sieht FDP-Nationalrat und Unternehmer Matthias Jauslin die Gefahr von Missbrauch. Er erklärt, wie auch er locker eine Viertel Million abholen könnte. Auch Unternehmer und FDP-Nationalrat Matthias Jauslin bekommt die Corona-Krise schleichend zu spüren. Weil die Industrie weniger produziere, brauche es weniger Umbauarbeiten bei den Elektroinstallationen, die seine Firma anbiete, sagt Jauslin. Noch haben seine 30 Mitarbeitenden in Wohlen Vollbeschäftigung. Jauslin hat aber vorsorglich Kurzarbeit angemeldet, auch wenn er hofft, nicht davon Gebrauch machen zu müssen. Jauslin findet es wichtig, dass den KMU in dieser Krise unkompliziert geholfen wird. Was dem freisinnigen Politiker aber aufstösst, ist, wie Firmen aufgrund der Nothilfe des Bundes ohne weitere Überprüfung zu einem zinslosen Kredit kommen. Von den gesprochenen 20 Milliarden Franken sind bereits über 14 Milliarden aufgebraucht. Am Freitag sprach der Bundesrat deshalb weitere 20 Milliarden Franken. Kredite bis 500 000 Franken sind zu 100 Prozent vom Bund abgesichert. Jauslin hat sich die Verordnung und das Antragsformular näher angeschaut. Sein Fazit: Man müsse nur ein paar Punkte ankreuzen, Adresse einsetzen, unterschreiben und schon bekomme man den Kredit. «Der Covid-19-Kredit ist eine gute Sache, birgt aber auch Risiken», so Jauslin. Auf Twitter hatte er am Mittwoch noch das Wort «Fehlkonstruktion» verwendet. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Dass Jauslin nicht ganz Unrecht hatte, beweist die Tatsache, dass der Bundesrat gestern Instrumente zur Prüfung der «Coronakrise» nachgeschoben hat. Wie sagt der Volksmund so schön? «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.»
-
3.4.2020 - Tag der menschlichen Dummheit
Coronafalle Hallwilersee: Braucht es vor dem Ansturm vom Wochenende eine Sperre des beliebten Ausflugziels?
Am Wochenende wird ein Ansturm von Spaziergängern erwartet. Aber anders als im Kanton Zürich wird der See nicht gesperrt und die Kapazitäten der Parkplätze werden nicht reduziert. Die Polizei ruft dazu auf, auszuweichen. Und sie wird verstärkt kontrollieren. Die Aargauer lieben den Hallwilersee. Ganz besonders, wenn das Wetter schön ist und die Temperaturen angenehm sind – so, wie es dieses Wochenende sein soll. Ideale Bedingungen für einen Spaziergang oder ein Picknick. Aber lässt sich in Zeiten von Corona das Social Distancing einhalten? Müssen die Behörden nicht etwas gegen den grossen Ansturm unternehmen? Fest steht: Andere Kantone, allen vor Zürich, haben einschneidende Massnahmen ergriffen. So ist das Stadtzürcher Seebecken schon seit fast zwei Wochen für Spaziergänger weitgehend gesperrt. Ebenso der kleine Katzensee, wo die Polizei am letzten Sonntag intervenieren musste. Und am Donnerstag schrieb die Stadt Uster über die Situation am Greifensee: «Die öffentlichen Parkplätze waren am letzten Sonntag voll besetzt und auf den Rad- und Gehwegen waren so viele Personen unterwegs, dass die empfohlene Distanz von zwei Metern nicht mehr gewährleistet war.» Die sieben Greifensee-Gemeinden haben deshalb beschlossen, ab Samstag alle öffentlichen Parkplätze zu sperren. «Sie leisten damit einen Beitrag, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen», heisst es in einer Mitteilung. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Es wird dem Kanton Aargau (leider) wie bereits der Stadt Luzern keine andere Möglichkeit bleiben als die Sperrung des Areals. Denn wie schon Albert Einstein treffend sagte: «Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.»
-
2.4.2020 - Tag der Vollpfosten und kollabierenden Medien
Kampf gegen Virus: Ist die Corona-Impfung da, soll sie Pflicht sein
Künftig sollen sich alle Menschen gegen Covid-19 impfen müssen, finden Politiker. Impfgegner wehren sich, bevor es überhaupt einen Impfstoff gibt. Über 850'000 Menschen haben sich weltweit mit der Lungenkrankheit Covid-19 angesteckt, mehr als 42'000 Menschen sind daran gestorben. Mit Hochdruck arbeiten Forscher an der Entwicklung eines Impfstoffs, der das Virus eindämmt. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson etwa geht davon aus, dass ein Impfstoffkandidat spätestens im September 2020 in einer Phase-1-Studie an Menschen getestet werden kann. Anfang 2021 solle ein Impfstoff für den Notfallgebrauch zur Verfügung gestellt werden können. Schon jetzt bringen sich Impfgegner in Stellung. «Nie im Leben würde ich mich gegen Corona impfen», sagt Josef Zahner, Mitglied des impfkritischen Netzwerks Impfentscheid. Impfungen enthielten viele giftige Stoffe, zum Beispiel Formaldehyd, was zum Platzen der Lungenbläschen führen könne. «Der Nutzen von Impfungen ist fraglich. Mit der Corona-Hysterie werden viele Menschen in Angst versetzt. Dabei sterben weit weniger Menschen als bei der Wintergrippe 2018 und 2019.» Weil Impfgegner auf die Barrikaden gehen, noch bevor die Impfung da ist, bricht die Diskussion um die obligatorische Impfung los: «Es ist nicht auszuschliessen, dass die Behörden eine schweizweite Impfpflicht gegen das Coronavirus einführen werden», sagt Alessandro Diana, Arzt und Infektiologe an der Clinique des Grangettes in Genf. Selbstverständlich müsse zuvor aber sichergestellt sein, dass der Impfstoff sicher sei und Komplikationen ausgeschlossen werden könnten. Zuerst geimpft werden müssten seiner Meinung nach die Personen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Schreibt 20Minuten.
Wäre es in Zeiten wie diesen nicht geradezu wohltuend, wenn man solche Geisterdiskussionen über Eier, die das Huhn noch nicht gelegt hat, gar nicht erst führen und einfach schweigen würde? Das gilt für die Medien wie für die irrlichternden Vollpfosten der Impfgegner mit ihrem esoterisch angehauchten Halbwissen. Kein Wunder, kollabiert gerade die Printauflage von 20Minuten.
-
1.4.2020 - Tag der Erfüllungsgehilfen
Hygienemasken gegen Coronaviren: Das BAG widerspricht seinen eigenen Empfehlungen
Während andere Länder eine Maskenpflicht einführen, ist die Schweiz zurückhaltend. Gesunden Personen rät das Bundesamt für Gesundheit gar davon ab, eine Schutzmaske zu tragen – obwohl der offizielle Pandemieplan anderes vorsieht. Das dürfte daran liegen, dass Masken noch immer Mangelware sind. Mit den weiter steigenden Corona-Fallzahlen in der Schweiz wird die Frage zentral, ob Schutzmasken helfen können, die Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. In Österreich gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht in Supermärkten. «So eine Maske kostet nicht viel», sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz jüngst zu seinen Landsleuten. Auch in Asien ist das Maskentragen in der Öffentlichkeit eine wichtige Massnahme im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. In der Schweiz sträuben sich die offiziellen Stellen bis jetzt, eine Empfehlung zum Maskentragen abzugeben. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in den vergangenen Wochen verschiedentlich erklärt, dass Masken, vor allem die sogenannten Hygienemasken, nur einen Nutzen hätten, wenn die Person selbst krank sei. Einen Schutz vor Ansteckung gebe es damit nicht. Am Dienstag sagte Koch an einer Medienorientierung in Luzern, es gebe keine wissenschaftliche Studie, die beweise, dass einfache Schutzmasken wirksam seien. Schreibt die NZZ.
Abgrundguteste NZZ! Du warst mal eine der Ikonen unter den europäischen Zeitschriften. Deine Korrespondenten vor Ort und die Kolumnisten bürgten als wahrhaftige Experten für höchste journalistische Qualität. Vor allem im Sinne der investigativen Berichterstattung. Dein Feuilleton war ein Hort grenzenloser Poesie, gepaart mit Intellekt und herausragender Intelligenz. Als Opinionleader warst du weltweit ein Massstab für Qualität und Integrität im Journalismus. Wo immer man in eine Metropole dieser Welt hinkam, sei es New York, Wien, Rom, Berlin oder Singapur, du warst dort in den Verkaufsregalen vertreten. Doch das sind Tempi Passati, wie wir Lateiner zu sagen pflegen. Deine Artikel mit brachial marktliberalem Gedankengut jenseits aller journalistischen Gepflogenheiten bezüglich Neutralität und teilweise sogar redaktionellen Eingriffen durch den Verwaltungsrat (Stichwort Energiewende), worüber deine altgedienten Journalisten mehr als nur entsetzt waren, liessen dich in den letzten Jahren verkommen zur Wirtschafts-«BRAVO» der alten weissen Männer. Du hast auch nie ein Mittel gefunden, den durch das Internet verschuldeten Auflageschwund durch intelligente Massnahmen im Digitalbereich aufzufangen. Dabei hättest ausgerechnet du alle notwendigen Mittel dafür zur Verfügung gehabt. Deine Firewall in Ehren, aber sie ist kontraproduktiv. Zu alledem kommt noch Trägheit hinzu. News sind im Zeitalter des Internets reine Temposache. Nur der frühe Vogel frisst den Wurm. «Die News von heute sind der kalte Kaffe von morgen». Dieses wunderbare Zitat unseres Webmasters findest du auf der AVZ-Website unter der Rubrik «Zitate». Das Thema «Hygienemasken» heute aufzugreifen, nachdem es schon seit Tagen bei allen Medien längst verwurstet ist, wird dir kaum Klicks bringen. Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Hinzu kommt noch die unerträgliche Werbung vom Onlineverkäufer Hygieneprodukte24, der unübersehbar ausgerechnet Hygienemasken zum Wucherpreis von 289 Franken für hundert Stück in deinem Artikel anbietet. Hygienemasken notabene, die in Luzerner Apotheken für 70 Franken pro 100 Stück verkauft werden. Damit machst du dich zum Erfüllungsgehilfen für die verabscheuungswürdige Abzocke eines schäbigen Trittbrettfahrers und Kriegsgewinnlers in Zeiten der Not, der eine Situation erbarmungslos ausnutzt. Ein Verlag mit Anstand hätte dieses Inserat niemals angenommen! Das wird deinen Niedergang nur noch beschleunigen, auch wenn du jetzt als getreue Apologetin des lupenreinen Neoliberalismus, wonach der Markt doch eigentlich alles richten müsste, bereits Bundeshilfe für dein Presse-Imperium angefordert hast. Dass man in Krisenzeiten durchaus massiv zulegen kann beweist das kleine aber feine Onlineportal vom Artillerie-Verein Zofingen. Mit seriösen Beiträgen ohne Effekthascherei und Hysterie steigerte der Artillerie-Verein Zofingen die Besucherzahlen im März gegenüber Februar um 20 Prozent. Von den Kleinen lernen heisst manchmal siegen lernen.
Den vielen Besucherinnen und Besuchern vom Artillerieverein Zofingen an dieser Stelle herzlichen Dank. Bleibt gesund!

-
31.3.2020 - Tag der Leitmedien
Kritik an Argumentation: War das BAG bei den Masken nicht ehrlich?
Österreich setzt auf Masken, das BAG winkt immer noch ab: Politiker werfen dem BAG Intransparenz vor. Seit Wochen verteidigt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seinen Appell: Gesunde Personen sollten in der Öffentlichkeit keine Hygienemasken tragen, da diese keinen effektiven Schutz bieten würden. Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim BAG, warnte wiederholt vor einem falschen Sicherheitsgefühl durch Masken. Diese könnten dazu führen, dass man die Hände weniger wasche, sich vielleicht mehr an die Maske und ins Gesicht fasse und die Distanz nicht einhalte. Diese Argumentation ist umstritten, da beim Coronavirus nicht alle Infizierten überhaupt Symptome entwickeln. Masken verhindern aber, dass sie Tröpfchen in die Luft husten und weitere Leute anstecken. Elaine Shuo Feng, Epidemiologin an der Universität Oxford, geht davon aus, dass Regierungen vor allem aufgrund des eingeschränkten Angebots an Masken von deren Tragen abrieten, wie sie in der Fachzeitschrift «Science» erklärte. Nun gilt in Österreich ab Mittwoch im Kampf gegen weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Weil das BAG damit argumentierte, die Masken würden eine falsche Sicherheit vermitteln, fühlen sich Schweizer Politiker vom BAG verschaukelt. «Das BAG hat zu wenig transparent kommuniziert», kritisiert etwa Grünen-Nationalrat Bastien Girod. Da die Masken ein knappes Gut seien, habe das BAG vor allem strategisch kommuniziert. «Es ist aber klar, dass es auch sinnvoll ist, wenn gesunde Personen Masken tragen.» Hätten Masken keinen Nutzen, würde auch das Spitalpersonal darauf verzichten. Schreibt 20Minuten.
Nun kommen sie doch noch aus den Löchern, unsere wunderbaren Opinionleader (Meinungsmacher) und Leitmedien der Schweizer Pressezunft. Mit einiger Verspätung stellen sie die Frage, die sich auch der Artillerie-Verein Zofingen stellte. Allerdings nicht erst heute, sondern am 28.3.2020 (scrollen nach unten hilft weiter). In der «Schlagzeile des Tages» wies der AVZ nicht nur auf die Widersprüchlichkeit von Daniel Kochs (BAG) Aussage hin, sondern lieferte auch die Antwort. Die Maske ist nicht das Allheilmittel gegen das Coronavirus, aber sie ist ein Teil des gesamten Schutzpaketes. Die Bevölkerung steht bisher hinter den Verordnungen und Massnahmen des Bundesrates. Das ist ein kostbares Gut. Doch Stimmungen können in Krisenzeiten sehr schnell kippen. Vor allem dann, wenn die Menschen das Gefühl nicht los werden, dass sie angelogen werden. Ehrlichkeit und volle Transparenz sind das oberste Gebot für die Exekutive in Krisenzeiten. Daniel Koch wäre kein Stein aus der Krone gefallen, hätte er schlicht und einfach die Wahrheit erzählt. Dass die Schweiz nämlich im zeitlichen Vorfeld der Corona-Pandemie, die sich ja schon im Dezember 2019 abzeichnete, mit der Bestellung (bzw. Eigenproduktion) der Masken versagte. Diese Tatsache wäre von den Bürgerinnen und Bürgern mehrheitlich auch akzeptiert worden. Ein Versagen wird in der Regel eher toleriert als eine ziemlich plumpe und dumme Lüge. In Krisenzeiten will niemand angelogen werden. Da braucht es das unbedingte Vertrauen der Menschen zu ihren Behörden. Eine schlechte Figur in dieser Angelegenheit machen aber auch unsere Medien, die zwar mit unzähligen, schrillen, nach Aufmerksamkeit heischenden Coronavirus-Artikeln und ihren fragwürdigen Experten das berühmte Overdose-Fass längst zum Überlaufen gebracht haben, die simpelsten Fragen aber nicht oder erst mit unakzeptierbarer Verspätung* stellen. Kein Wunder, geht es ihnen nicht besonders gut. Dauern die Krisenmassnahmen länger als gedacht, wird es in der Zeit nach Corona einige der Blättlis nicht mehr geben. Und niemand wird sie vermissen.
* Die AZ beschäftigt sich beispielsweise heute, am 31.3.2020 in drei (!) Artikeln mit dieser Frage.
-
30.3.2020 - Tag der Glückspost
Liebesglück in der Quarantäne: Denner-Erbe Cedric Schweri (43) heiratet wieder
Denner-Erbe Cédric Schweri ist sich sicher: Jennifer Lenti ist die Richtige. Der Heiratsantrag erfolgte ganz klassisch, die standesamtliche Trauung ist im Juni in der Schweiz geplant. Allerdings sitzt Schweri derzeit mit Lenti in Argentinien fest – Corona-Quarantäne! Schreibt BLICK.
Eine dieser Glückspost-Geschichten, die normalerweise kaum jemand zur Kenntnis nimmt, es sei denn, man (besser gesagt: Frau) sitzt gerade in einem Coiffeursalon. Doch in Zeiten des medial hyperventilierenden Coronafiebers und der geschlossenen Coiffeursalons sind solche Herz-Schmerz-Geschichten beinahe eine Wohltat.
-
29.3.2020 - Tag der von Dummheit und Gicht geplagten Wanderer
Polizei musste Katzensee sperren: Schönes Wetter lockte Menschen nach draussen – trotz Corona
«Bleiben Sie zu Hause!», das ist die Hauptempfehlung des Bundesrats im Kampf gegen das Coronavirus. Am heutigen Samstag wollten die Leute aber lieber draussen sein. Die Polizei hatten alle Hände voll zu tun. Die Schweizer bleiben zu Hause. Die Handy-Daten der letzten Tage zeigten, dass immer weniger Menschen unterwegs waren (BLICK berichtete). Doch mit dem ersten Wochenendtag zeigt sich an vielen Orten ein anderes Bild. Das schöne Wetter am heutigen Samstag lockt unzählige Menschen nach draussen.Obwohl der Bund empfiehlt, zu Hause zu bleiben. Mehrere BLICK-Leserreporter schickten Fotos von Menschen, die sich nicht an die Massnahmen zu halten scheinen. Die Aufregung ist gross. «Gewisse Leute kapieren es einfach nicht!», schreibt einer. Um 15 Uhr beobachtet er eine geschlossene Sportanlage beim Hardhof in Zürich. Mindestens fünf Personen lässt die Anweisung kalt. Munter trainieren sie an den Geräten. Auch am Fluss sieht es nicht anders aus. «Ich finde es eine unglaubliche Frechheit, was sich manche Personen erlauben. Das Seeufer ist zu und so weicht man an die Limmat aus!!!», schreibt eine Leserin. Auf dem von ihr eingesendeten Foto sind mehrere Dutzend Personen an den Treppen des Wipkingerparks in Zürich zu sehen. Schreibt SonntagsBlick.
Liebe Luzernerinnen und Luzerner: Jetzt ja nicht mit dem desinfizierten Innerschweizer Zeigefinger auf die Zürcher zeigen. Der Aufmarsch der Spaziergängerinnen und Spaziergänger am Luzerner Quai am gestrigen Samstag bei traumhaftem Frühlingswetter war der reinste Horror. Ein Massenauflauf sondergleichen. Wie bereits am vorletzten Sonntag. Social Distancing ist unter solchen Umständen beim besten Willen nicht einzuhalten. Hinzu kommt das erschreckende Bild der Risikogruppe der Seniorinnen und Senioren, die's auf Teufel komm raus nicht sein lassen können, am Quai zu flanieren und händchenhaltend ihre ewige Liebe zu demonstrieren, die schon bald ein tragisches Ende nehmen könnte. Dummheit macht scheinbar auch vor Gicht und Krampfadern nicht Halt. Dabei gibt es in Luzern viele andere, sehr schöne, gemütliche und bequeme Wanderwege, die kaum frequentiert werden. Sollte der Quai sinnvollerweise polizeilich geschlossen werden, braucht sich niemand zu wundern. In Wuhan wäre das schon längst passiert. Von den Chinesen lernen, heisst Corona zu besiegen lernen.
-
28.3.2020 - Tag der Hygienemasken
BAG: Bund hat genügend Hygienemasken an Lager – Schweizer Maskenproduktion läuft an
Der Bund verfüge wieder über genügend Hygienemasken an Lager, sagte Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Freitagabend. Diese seien vorrangig reserviert für Personal im Gesundheitswesen. Das Tragen von Hygienemasken mache Sinn, wenn man krank sei oder im Gesundheitswesen arbeite, sagte Koch im Interview mit der Sendung «10vor10» weiter. Ansonsten seien Handhygiene und Distanzhalten der bessere Schutz gegen das Coronavirus. Die Masken sollen deshalb von Arbeitnehmenden im Gesundheitswesen getragen werden, vor allem im Umgang mit Risikopatienten. Momentan verfüge der Bund über 17 Millionen Masken an Lager. Zwei Millionen Masken würden täglich benötigt, so Koch. Inzwischen hat sich die Lage um den Export von medizinischem Schutzmaterial entspannt: So bestehen in Deutschland keine Einschränkungen mehr beim Export von diesem Material in die Schweiz, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Die Waren seien unterwegs oder bereits im Land. Alle dem Seco bekannten Probleme seien gelöst. Am vergangenen Freitag hatte Wirtschaftsminister Parmelin einen «Durchbruch» bei der Lieferung von Schutzmaterial aus der EU für die Schweiz verkündet. Die Schweiz könne umgehend mit der Produktion von Schutzmasken starten, sagte Koch zudem am Montag. Die Maschinen dafür seien vorhanden. So sollen täglich rund 40'000 Masken im eigenen Land produziert werden. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Das ist doch endlich mal eine positive Nachricht! Doch die Aussage von Daniel Koch betreffend Tragen der Hygienemasken scheint noch immer auf einen gewaltigen Mangel an Masken für die Gesamtbevölkerung hinzuweisen. Es macht durchaus für alle Menschen Sinn, sowohl die Gesichtsmaske zu tragen wie auch die – eigentlich selbstverständlichen – Ratschläge vom BAG bezüglich Handhygiene und Distanzhalten strikt zu befolgen. Das eine tun und das andere nicht lassen. Würden Gesichtsmasken tatsächlich nichts nützen, stellt sich die Frage, warum sie denn dem Personal im Gesundheitswesen empfohlen werden? Widersprüchlicher kann man kaum herumeiern. Die chinesischen Experten (und auch viele europäische wie der deutsche Virologe und Podcast-Star Christian Drosten) wundern sich, weshalb in Europa Maskentragen nicht zur Pflicht erklärt wurde. Ja warum wohl? Weil die Masken schlicht und einfach für die breite Masse der Bevölkerung nicht verfügbar sind.
-
27.3.2020 - Tag der Gesalbten
Soll Politik stillstehen? Aargauer Nationalrätin findet: «Parlament muss Auftrag erfüllen, dafür ist es gewählt»
Erste Reaktionen im Aargau zur Corona-Session sind mehrheitlich positiv. Für die SP-Aargau-Präsidentin und Nationalrätin Gabriela Suter ist klar, dass das Parlament bald wieder zusammentreten muss, so wie es jetzt auch geschieht. Es müsse handlungsfähig bleiben, «in einer derartigen Krise wie jetzt ist das sogar noch wichtiger». Es gehe darum, die Notverordnungen des Bundesrates durch das Parlament zu überprüfen und zu legitimieren: «Je länger der Ausnahmezustand herrscht, desto dringender muss das Parlament wieder tagen.» Es soll natürlich primär um die Bewältigung der Coronakrise gehen. Sie hofft, dass auch andere Geschäfte Platz haben: «Wir müssen rasch die Schlussabstimmung zu den Überbrückungsrenten durchführen. Das CO2-Gesetz hat ebenfalls hohe Dringlichkeit.» Zum Schutz von Risikopersonen müsse man in der Session aber eine sichere Lösung finden.
Glarner: Es braucht im Moment keine Session
Für den Nationalrat und SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner dagegen ist klar: «Es braucht im Moment keine Session. Der Bundesrat handelt nach Notrecht, aber derzeit mit viel Augenmass. Solange das so bleibt und die Finanzdelegation sein Handeln unterstützen kann, muss das Parlament nicht eingreifen. Wir können ohnehin nur die Beschlüsse abnicken.» Er hat keine Sorge, dass man das Notrecht wie nach dem 2. Weltkrieg nur schwer wieder wegbrächte: «Die rechtliche Situation ist heute eine ganz andere.» Klar sei alles vorzubereiten, dass eine nächste Session stattfinden kann, aber: «Es gibt keine Geschäfte, die nicht ein paar Monate warten können. Es geht vielen linken Parlamentariern doch mehr darum, sich in der Krise – die ich keinesfalls verharmlosen will – am Rednerpult zu produzieren und endlich wieder Sitzungsgeld zu kassieren.»
Binder: Auch Parlament muss funktionieren
Es gehe nicht darum, dass das Parlament die Aufgaben des Bundesrates übernimmt, diese seien in der momentanen Notlage nicht teilbar, sagt Nationalrätin und CVP-Aargau-Präsidentin Marianne Binder. «Es geht darum, dass das Parlament seinen eigenen Auftrag erfüllt und seine Geschäfte behandelt. Dafür ist es gewählt. Ich begrüsse diese Session.» Dass sich die erste Macht im Staat selbst ausser Kraft gesetzt hat und seither weder handlungs- noch beschlussfähig war, ist für Binder aus demokratie- und staatspolitischer Sicht sehr heikel: «Von Schulen, Universitäten und Wirtschaft erwarten wir, dass sie digital funktionieren, so auch vom Parlamentsbetrieb. Rechtlich ist das möglich.» Dass man nun in eine Messehalle geht, sei aber in Ordnung. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wir sollten jetzt nicht in Defätismus verfallen und über die Wichtigtuerei as usual der vom Schweizer Volk an der Wahlurne Gesalbten und von der Wirtschaft Geschmierten herziehen. Viele Schweizerinnen und Schweizer verlieren derzeit als Folge fehlender Einnahmen Geld. Viel Geld sogar. Der Bundesrat versucht, so solidarisch wie irgendwie nur möglich allen zu helfen. Das gilt aber (bis jetzt) nicht für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Hohen Haus von und zu Bern, die mangels fehlenden Gelegenheiten nicht ihrem üblichen Lobbyismus und den sprichwörtlichen Mauscheleien in den Hinterzimmern nachgehen können und dadurch auch deftige Einnahmenverluste im Lobbykässeli in Kauf nehmen müssen. Hinzu kommt ein gewisser Ansehensverlust bei der Bevölkerung, die plötzlich realisiert, dass die Coronakrise ganz ohne die Expertinnen und Experten aus dem Parlament vom Bundesrat allein gemeistert wird. Mit hoher Akzeptanz beim Volk. Niemand vermisst derzeit die Schalmeien und Pöstchenjäger*innen aus dem National- und Ständerat. Im Gegenteil! Viele Menschen sind sogar froh, dass das übliche Palaver für einmal unterbleibt. Trotzdem ist der Bundesrat zwingend angewiesen, die Verluste der Parlamentarierinnen und Parlamentarier ebenfalls über sein Massnahmenpaket auszugleichen. Müssen doch die Ärmsten und Ärmstinnen von ihrem kläglichen Einkommen als Auserwählte des Volkes leben. (Ironie aus.)
PS: Es kommt nicht alle Tage vor, dass man Glarner beipflichten muss. Allerdings sind seine Pfeile, die er gegen die «Linken» abschiesst, unvollständig. Nur ein Teil der Wahrheit, wie so oft bei Glarner. Die liberale neoliberale Partei FDP (orchestriert von der CVP) schreit nämlich genau so laut wie die SP nach einer Parlamentssession. Pöstchenjäger Müller aus dem Ständerat hat bereits die Messe Luzern als Tagungsort vorgeschlagen. Und dies vor Tagen. So viel Wahrheit, lieber Andi, muss sein. Auch für einen Dumpfplauderer, wie wir Dich laut Gerichtsurteil nennen dürfen.
-
26.3.2020 - Tag der geklauten Jeanshose
Trump'sche Balkanpolitik: Kosovarische Regierung gestürzt
Mittwochnacht wurde die Regierung Kurti durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht. Die USA unter Trump stellen sich in der Kosovo-Politik nun klar gegen die Europäer. Viele Bürger in Prishtina trommelten auf Töpfe oder Eisenstangen auf ihren Balkonen, um den Sturz der Regierung zu verhindern. Gäbe es keine Ausgangssperren wegen der Coronavirus-Krise, wären die Straßen der kosovarischen Hauptstadt am Mittwoch wahrscheinlich voll von Demonstranten gegen die alten Kader gewesen. Denn trotz der Warnung der Gesundheitsbehörden, dass eine Zusammenkunft der Parlamentarier zu gefährlich sei, wurde die Koalition der Vetëvendosje (VV) unter Premierminister Albin Kurti mit der Demokratischen Liga (LDK), die seit Februar in Amt ist, dort Mittwochnacht per Misstrauensvotum gestürzt. Offiziell ging es um einen Streit, ob der Ausnahmezustand ausgerufen werden sollte oder nicht. Präsident Hashim Thaçi, der größte innenpolitische Gegner von Kurti, versuchte dies zu erreichen, weil er als Staatschef dadurch mehr Durchgriffsrechte bekommen wollte. Die alten Kader der LDK, die sogenannte "Dinosaurier-Fraktion", folgten dem Präsidenten, weil sie selbst die Koalition verlassen wollen. Das hat allerdings nichts mit der Coronavirus-Krise oder Maßnahmen dagegen zu tun, sondern mit dem US-Gesandten für Kosovo und Serbien, Trumps Geheimdienstdirektor Richard Grenell. Dieser hat die "Dinosaurier-Fraktion" der LDK auf seine Seite gezogen. Grenell will gemeinsam mit Thaçi und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić ein Abkommen zwischen Serbien und dem Kosovo durchziehen. Seine Aufgabe ist es nämlich, für seinen Chef Trump einen außenpolitischen "Erfolg" vor den US-Wahlen zu liefern. Kurti ist allerdings gegen einen solchen intransparenten Deal, und wurde offenbar deswegen ausgehebelt. Nach dem Misstrauensvotum sagte er, dass diejenigen Kosovaren die sich in Washington mit Grenell getroffen hätten, mit viel Macht "von oben" ausgestattet worden seien – damit spielte er auf den Ex-LDK-Außenminister Skender Hyseni an, der vor zwei Wochen mit dem Trump-Gesandten zusammen gekommen war und offenbar danach das Koalitionsende eingeleitet hatte. Viele Kosovaren machten sich angesichts der sich überstürzenden Ereignisse und der Vorgangsweise von heimischen wie internationalen Politikern und Honorardiplomaten Sorgen um die Demokratie, gibt der Wissenschafter zu Bedenken. "Es gibt zudem immer mehr Tendenzen zu autoritären Zügen. Manche versuchen die Pandemie auszunutzen, um das durchzuziehen." Thaçi forderte etwa die Polizeikräfte auf, die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Covid-19-Krise nicht einzuhalten. Er behauptete, dass diese verfassungswidrig seien. Thaçi versucht sich im Kosovo und im Ausland als "Mann der Amerikaner" darzustellen. Er ist allerdings wegen seiner Kriegsvergangenheit erpressbar. Es ist nicht auszuschließen, dass er vor dem kosovarischen Sondergericht für Kriegsverbrechen in Den Haag landet. Schreibt DER STANDARD.
Der Hardliner Richard Grenell und die Trump-Administration beweisen einmal mehr, dass die hehren Botschaften der Leitartikel von wegen «Die Welt hält in der schlimmsten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen» – geschrieben von den transatlantischen Speichelleckern in den Redaktionsstuben der «westlichen Wertegemeinschaft» – nichts anderes sind, als nach Zeilenhonorar bezahlter Müll.
Kleine Schmonzette am Rande: Der ehemalige UCK-Chef und jetzige Präsident der Republik Kosovo, Hashim Thaçi, könnte vor dem kosovarischen Sondergericht für Kriegsverbrechen in Den Haag landen. Thaçi lebte vor dem Kosovokrieg für einige Zeit als Student in der Zentralschweiz. SVP-Nationalrat Sebastian Frehner reichte deswegen eine Interpellation bezüglich «Kriminellen Aktivitäten von Hashim Thaçi und der UCK in der Schweiz» ein. Unter anderem liess der Kosovare im Emmen Center damals eine Jeans mitlaufen, wurde aber in flagranti beim Diebstahl erwischt und die Luzerner Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren ein, das lange Zeit öffentlich im Internet einsehbar war. Doch kaum war der Kosovare im Staatsamt angelangt, wurde der Interneteintrag auf wundersame Art gelöscht. So wie Ueli Maurers «Neger»-Video auf Youtube, in dem Maurer vor dem Parlament im Hohen Haus zu Bern erklärte, wie man in Bern einen Schwarzafrikaner nenne, am Tag seiner Wahl zum Bundesrat auf ebenfalls wundersame Art gelöscht wurde. Die uralte Internetweisheit, dass das Internet niemanden und nichts vergesse, wird damit ad absurdum geführt. Sachen gibt's...
-
25.3.2020 - Tag der Scheisshauspapier-Experten
Schweizer hamstern WC-Papier: Ökonom Bruno S. Frey sagt warum
Der Wirtschaftsprofessor Bruno S. Frey ist ein Pionier der ökonomischen Glücksforschung. Er sagt, warum Hamstern sinnvoll sein kann und wieso das Parlament wieder tagen muss. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Gut zu wissen, dass nun auch der Pionier der Glücksforschung und Scheisshauspapier-Experte S. Frey seinen Kommentar zum Thema Coronavirus absondern durfte. Langsam aber sicher nervt die Inflation der unsäglichen und nichtssagenden Corona-Artikel. Der Peak ist erreicht! Weniger wäre mehr. Zitieren wir nochmals Karl Valentin: «Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.»
-
24.3.2020 - Tag der irrationalen Visionen
In den Köpfen wird das Virus überleben
Die Körper immunisieren sich gegen Corona. Doch vieles wird nie mehr so sein wie früher. Hätte im Dezember 2019 jemand das jetzige Befinden der Welt beschrieben, wäre diese Person in psychologischer Behandlung gelandet. So ein Irrsinn. Nun, nach über einer Woche Ausnahmezustand, fühlt sich diese Stimme fast normal an. Und vielleicht ist sie bereits ein Teil von uns geworden. Ein Mikroorganismus hat fertiggebracht, woran die mächtigsten Politiker gescheitert wären: Menschen verzichten auf Tätigkeiten, die für unverzichtbar galten. Demokratische Staaten setzen Massnahmen durch, die man bis vor kurzem als totalitär bekämpft hätte. Notrecht herrscht. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer erleben zum ersten Mal, dass die Welt nicht so funktioniert, wie man es ihnen versprochen hat. Doch irgendwann wird die Plage vorbei sein. Dann geht es wieder los. Bereits wird ausgiebig über die Post-Corona-Welt nachgedacht. Die entscheidende Frage dabei lautet: Wie lange wird Covid-19 in unseren Köpfen bleiben, nachdem sich die Körper dagegen immunisiert haben? Auf ein Nachwirken des kollektiven Zu-Hause-Sitzens hoffen auch Freunde der Digitalisierung. Die unfreiwillige Nutzung von Homeoffice, Homeschooling und Homeshopping lasse viele Menschen deren Vorteile erkennen. Dadurch werde sich der Alltag auch nach der Befreiung stärker in virtuellen Räumen abspielen. Weitere Post-Corona-Prognosen lauten: Der Nationalstaat werde erstarken, die Globalisierung hingegen schwächeln. Staatliches Durchgreifen und eine breite Überwachung würden leichter akzeptiert. Der öffentliche Verkehr werde sich nie mehr richtig vom Seuchenherd-Image erholen, das Gleiche gelte für Grossveranstaltungen. Dafür werde gemeinschaftliches Handeln höher geschätzt. Schreibt die Berner Zeitung.
Beat Metzlers Meinung tönt zu schön um wahr zu sein. Dass sich Home Office langfristig als neues Arbeitsmodell in vielen, dafür prädestinierten Betrieben etablieren wird, ist unbestritten. Hat aber weniger mit dem Coronavirus als mit der Digitalisierung zu tun. Das Virus trägt lediglich zur Beschleunigung und Akzeptanz bei. Zu glauben, dass sich an der Globalisierung oder unserem Umgang mit dem Klimawandel eine Kehrtwendung zum Besseren vollziehen wird, ist irrationales Wunschdenken. Erinnern wir uns doch einmal für einen kurzen Moment an die letzte grosse Krise, die die globale Finanz- und Wirtschaftswelt durchgeschüttelt hat: Die Weltfinanzkrise. Johann Niklaus Schneider-Ammann, damals noch FDP-Nationalrat, geisselte im Parlament die Banksters und deren schamlose Bonunszahlungen ebenso wie den Hilferuf nach dem Staat. (Was, nota bene, die FDP auch in der jetzigen Coronakrise hemmungslos betreibt.) Schneider-Ammann forderte eine drastische Regulierung des Bankensystems. 2010 wurde er bei der Ersatzwahl für Hans-Rudolf Merz zum Bundesrat gewählt und hielt sich ab diesem Zeitpunkt an Adenauers Worte: «Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.» Das Bankensystem wurde mit wenigen Ausnahmen kaum reguliert und die unsäglichen Boni flossen weiter bis zum heutigen Tag. Nein, lieber Beat Metzler, so gern man ihren Visionen für eine bessere Welt in den Zeiten nach dem Coronavirus folgen würde: Da braucht es einiges mehr, bis in den Köpfen der bis ins Mark vom brachialen Neoliberalismus verseuchten Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Das tödliche Virus mit dem Namen Neoliberalismus hat sich noch nie um Tote gekümmert. Für die Börsenwerte hingegen schon.
-
23.3.2020 - Tag der Privatisierungspartei
Kampf gegen Corona: Bundesrat berät sich mit Parteichefs
Im Kampf gegen das Coronavirus regiert der Bundesrat jetzt per Notrecht. Das Parlament hat die Session abgebrochen. Die Volksabstimmungen vom 17. Mai sind abgesagt. Zeitlich befristet, stärkt die Krise die Landesregierung auf Kosten der anderen Gewalten im Staat. Dennoch möchte der Bundesrat nicht auf den Rat der Parteien verzichten. Regelmässige Sitzungen mit deren Vertretern sind in Planung. Und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (59, SP) hat die Parteipräsidenten für kommende Woche zu einem Treffen eingeladen. Ort und Zeitpunkt sind noch offen. «Tatsächlich habe ich mit den Präsidenten der anderen Parteien den gleichen Gedanken diskutiert und begrüsse die Einladung der Bundespräsidentin ausdrücklich», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister (57). Es gehe darum, dass der Bundesrat die Möglichkeit erhält, «das Parlament und die Parteien zu spüren und mit uns zu diskutieren». Niemand denke, die Landesregierung wende das Notrecht nicht sorgfältig an. «Vielmehr können die Diskussionen in dieser Runde dem Bundesrat den Rücken stärken. Denn sein Korrektiv, das Parlament, tagt nun einmal nicht.» Die Schweiz steht laut Pfister erst am Beginn der Krise. Die aber sei «die grösste Herausforderung für unser Land seit Ende des Zweiten Weltkriegs». Kritik am Bundesrat werde noch kommen, so der Zuger. «Umso wichtiger scheint es mir, dass sich die Politik in einer ersten Phase in Geschlossenheit übt.» SVP-Chef Albert Rösti (52) betont die Einigkeit der Parteien mit gleichem Nachdruck: «Es ist wichtig, dass wir hinter der Landesregierung stehen, sie aber auch kritisch begleiten.» Zumal erste Misstöne laut werden. Rösti stört etwa die Kritik an Bundesrat Guy Parmelin (60, SVP), die darin deutlich wurde, dass die FDP öffentlich rasche Massnahmen zum Schutze der Schweizer Betriebe forderte. Dies sei «unnötig», meint der SVP-Parteipräsident, Parmelin habe zur Sicherung der Liquidität in kurzer Zeit ein bedarfsgerechtes und unbürokratisches Wirtschaftspaket bereitgestellt. Die Räte halten derweil an der Sondersession vom 4. und 5. Mai fest. Die Parlamentsdienste sondieren jedoch bereits Ausweichstandorte. Eine Möglichkeit ist aus der Sicht des freisinnigen Ständerats Damian Müller (35) die Stadt Luzern. «Wir können es uns nicht leisten, den Parlamentsbetrieb zu lange ruhen zu lassen», sagt der Luzerner, der den Ratspräsidien bereits einen detaillierten Plan vorgelegt hat. «Ich bin der Auffassung, dass in einer solchen Krisensituation die Räte als Legislative handlungsfähig bleiben müssen.» Müller steht mit der Messe Luzern in Kontakt, die den Politikern genügend Platz bieten könnte, um die Abstandsregeln einzuhalten. «Hier, im Herzen der Schweiz, können wir den Parlamentsbetrieb vorübergehend wieder hochfahren», so Ständerat Müller. Unter einer Bedingung: «Wenn sich Parlamentarier nun treffen, ob in den Kommissionen oder im Plenum, müssen sie auf das Virus getestet werden.» Schreibt BLICK.
SVP-Präsident Albert Rösti drückt sein Missbehagen gegenüber dem «Offenen Brief der FDP - Die Liberalen an Bundesrat Guy Parmelin» zurückhaltend aus: Der Brief sei «unnötig» gewesen, sagt Rösti. Das ist zwar richtig, beleuchtet aber nur einen Aspekt des öffentlichen FDP-Pamphlets. Das Abscheuliche und Abstossendste an diesem Hetzbrief bringt Rösti nicht zur Sprache. Dass ausgerechnet die Partei von Frau Gössi, die seit Jahrzehnten nur die zwei Schlagworte «Privatisierung» und «Steuersenkung» kennt, sofort nach Staatshilfe für ihre Klientel schreit, tönt wie Hohn in den Ohren entsetzter Bürgerinnen und Bürger, entspricht aber dem Wendehals-Charakter der gesamten Führungsmannschaft dieses unseligen Klientelvereins.
Der FDP-Brief an Bundesrat Parmelin offenbart auf erschreckende Art und Weise Blau auf Weiss die Verkommenheit, Empathielosigkeit und Charakterschwäche einer Partei, die sich auch noch «Die Liberalen» zu nennen wagt. Mit keinem einzigen Wort wird darauf hingewiesen, dass das Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle stehen. Im Gegenteil: Für die Parlamentsmannschaft der «Freien Demokratischen Lobbyisten-Partei», die sich für ihre Lobbyarbeit fürstlich bezahlen lässt, steht die Liquidität der Unternehmen an erster Stelle. Nicht die Menschen. Es geht wirklich nur ums Geld. Nicht um die Gesundheit. Nicht um die Toten, die bereits wegen dem Corona-Virus, das sich nota bene nicht privatisieren lässt, gestorben sind. Da passt der Krisenplan eines FDP-Mitglieds ja wunderbar zur Geisteshaltung seiner Partei, beginnen die salbungsvollen Worte des «Krisenmanagers» an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Holding mit den Worten «Zuoberst steht das Wohl unserer Holding». Das muss man sich erst mal auf der Zunge vergehen lassen.
Der Luzerner FDP-Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller setzt dem Ganzen in seiner geistig intellektuellen Ödnis die Krone auf: «Parlamentarier müssen auf das Virus getestet werden». Dem solariumgebräunten Schönling, bei Luzerner Studenten inzwischen als «Liebling aller Schwiegermütter» zur reinen Witzfigur mutiert, liegt das Wohl der Parlamentarier logischerweise vor dem Wohl des Volkes. Parlamentarier first. Danach erst das einfältige Wahlvolk. Ist ja aus Sicht von Müller verständlich. Ohne Parlamentseinwirkung sind seine fürstlich belohnten Lobbyarbeiten in den Kommissionen vermutlich nicht abrufbar. Den Armseligen im Geiste vom Schlage des Pöstchenjägers Müller, der sich gerne abschätzend über «Professoren» äussert, selber aber noch nie eine Universität von Innen gesehen hat, wäre tatsächlich ein Test zu empfehlen. Der Corona-Test ist es definitiv nicht. Ein IQ-Test schon eher.

-
22.3.2020 - Tag der Meinungsfreiheit
Deutschland, ein Coronaland: Wir müssen jetzt gemeinsam lernen
Jetzt schlägt die Stunde von solidarischen Nachbarn. Und die von Denunzianten und Verleumdern. Die einen kümmern sich um die Alten nebenan, die andern stellen massenweise Fotos von Leuten ins Netz, die sich angeblich falsch verhalten. Spaziergänger im Park und Väter mit vollen Einkaufswagen kommen in Nahaufnahme an den Twitter-Pranger. Doch warum hat der Blockwart einen legitimen Grund, draußen zu sein, der Geblitzte aber nicht? Vielleicht bringt der Familienvater auch noch seinen alten Eltern Klopapier mit, und vielleicht macht die WG einen vorsichtigen Spaziergang, weil sie sich eh die Wohnung teilt. Sogar die Polizei ist gelassener als so mancher Privatwachtmeister. In der Partystadt Berlin berichten die Beamten von größtenteils einsichtigem Jungvolk. Auf Twitter warnen sie die Denunzianten: „Die ggf. noch geöffnete Kneipe ist kein Grund, unseren Notruf zu wählen.“ Schreibt Livia Gerster einen weiteren «Kommentar» in der FAZ, auf den niemand wirklich gewartet hat.
Livia Gersters Kommentar ist so flüssig wie der Papst: nämlich überflüssig. Karl Valentin würde es kurz und bündig auf den Punkt bringen: «Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.»
-
21.3.2020 - Tag der Hoffnung
Hirnforschung: Nachschub für defekte Nerven
Sind schwere Hirnleiden wie Alzheimer oder Chorea Huntington therapierbar, indem man Zellen im Gehirn umprogrammiert? Das Werkzeug dafür jedenfalls nimmt Formen an. Verschwundene oder geschädigte Nervenzellen im Gehirn scheinen von unserem Körper bis zu einem gewissen Teil selbst ersetzt werden zu können. So kann etwa einer Einbuße der Bewegungsfähigkeit entgegenwirkt werden. Für Schäden am Gehirn, die unsere Motorik beeinflussen, können Unfälle und Schlaganfälle der Grund sein, aber auch degenerative Erkrankungen können zu Zellverlusten im Gehirn führen. Der Frage, ob dieser Schaden wirklich unwiderruflich ist, stellen sich Forscher seit längerem weltweit; ihre Ergebnisse lassen hoffen. Chorea Huntington dient in Experimenten häufig exemplarisch für die Klasse neurodegenerativer Krankheiten. Diese Erbkrankheit des Zentralnervensystems lässt sich bis heute kaum behandeln und führt statistisch etwa 15 Jahre nach dem Auftreten der ersten Symptome zum Tod. Schuld ist eine Genmutation, infolge derer es durch ein fehlerhaftes Protein zu einer Nervenschädigung kommt. Gong Chen von der Jinan University in China und sein internationales Forschungsteam stellen in „Nature Communications“ eine Möglichkeit in Aussicht, verlorene Nervenzellen direkt im Körper durch Umwandlung anderer körpereigener Zellen zu ersetzen. Dafür machten die Forscher sich die umliegenden Astrozyten, eine Gruppe von Gliazellen, zunutze. Gliazellen sind der häufigste Zelltyp in den Gehirnen von erwachsenen Säugetieren und bilden somit theoretisch eine reichhaltige Quelle an körpereigenen Zellen. Dieser Aspekt ist wichtig, denn gerade in der Nutzung körpereigener Zellen und der Vermeidung von Transplantationen liegt die Hoffnung auf neue Heilmethoden. Gliazellen galten zunächst vor allem als Stützgewebe des Nervensystems. Doch in den letzten Jahren wurden immer mehr Funktionen der die Neuronen umgebenden Zellen bekannt. Bereits 2002 gelang einer Forschergruppe um Magdalena Götz vom Max-Planck-Institut für Neurologie in München der Nachweis einer Entwicklung von einer bestimmten Art Gliazellen zu Neuronen, hier noch außerhalb von Lebewesen. „Ich halte die Umwandlung von Astroglia in Neurone in der Tat für einen vielversprechenden Ansatz“, sagt Götz über die Arbeit von Chen. Im Jahr 2014 veröffentlichte sie zusammen mit Leda Dimou, derzeit tätig am Neurozentrum der Universität Ulm, Forschungsergebnisse, welche die Funktion von Gliazellen als Vorläuferzellen und Stammzellen stützen. Die Forscherinnen demonstrierten in dieser Studie die Möglichkeiten, die diese Zellen als Quelle für neue Nervenzellen bei der Reparatur von Hirnzellen bieten können. Schreibt die FAZ.
Auch wenn es in Zeiten, in denen weltweit nur noch der Krisenmodus gepflegt wird, nicht unbedingt opportun ist, Hölderlin zu zitieren: «Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.»
-
20.3.2020 - Tag der Banken
Nationalbank-Präsident Thomas Jordan hilft den Banken – und warnt sie: Finanzspritze ist nicht für Dividenden!
Die Nationalbank macht sich Sorgen um die Wirtschaft. Noch aber habe es genügend Liquidität im System, beruhigt Nationalbankpräsident Thomas Jordan im Gespräch mit Blick TV. Und erklärt, warum Devisenkäufe derzeit das beste Mittel sind. Die SNB hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Sie erhöht den Negativzins-Freibetrag der Banken und prüft zusätzliche Massnahmen. Der Leitzins bleibt bei minus 0,75 Prozent. Ausserdem will sie weiterhin am Devisenmarkt intervenieren, um eine weitere Aufwertung des Frankens zu verhindern. In Krisenzeiten flüchten sich Anleger gerne in sichere Währungen wie den Franken. «Wir müssen immer eine Güterabwägung machen: Welches geldpolitische Instrument wirkt in dieser Situation am besten? Wir sind zum Schluss gekommen, dass es jetzt besser ist, die Devisenmarktinterventionen zu verstärken, um die Aufwertung des Frankens zu reduzieren», so Jordan. Das helfe der Wirtschaft mehr als eine weitere Senkung der Negativzinsen. Das sei die richtige Strategie, sagte Jordan am Morgen an einer Telefonkonferenz: «Zinssenkungen helfen nicht immer, wir müssen nun das Virus bekämpfen, und wir müssen vor allem sicherstellen, das es genügend Liquidität im Finanzsystem hat.» Grossen Sorgen macht sich die Nationalbank um die Schweizer Wirtschaft. «Wir müssen damit rechnen, dass es zu einem starken Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz kommt», befürchtet Jordan: «Viele Läden sind geschlossen, Fabriken fahren die Produktion herunter, bestimmte Dienstleistungen können nicht mehr erbracht werden.» Die Negativzinsen hat die SNB nicht verschärft, im Gegenteil: Die Nationalbank hat den Freibetrag für Banken, für den diese keine Negativzinsen auf ihren Guthaben bei der SNB bezahlen müssen, nochmals erhöht. Das sollte die Banken um rund 600 Millionen Franken entlasten. «Das wäre sehr ungünstig, müssten nun auch Kleinsparer Negativzinsen bezahlen. Auch deshalb entlasten wir die Banken, damit das nicht passiert», so Jordan. «Wir geben den Banken mehr Spielraum, damit sie ihre Verantwortung für die Wirtschaft besser wahrnehmen können.» An der Telefonkonferenz am Vormittag wies Jordan explizit darauf hin, dass die Banken den Spielraum nicht nützen sollten, um mehr Dividenden auszuschütten. Er sei aber fest überzeugt, dass sie sich ihrer Rolle bewusst seien. Schreibt BLICK.
Thomas Jordan, ein kluger Mann, ist fest überzeugt, dass sich die Banken ihrer Rolle bewusst sind. Glaubt Jordan nach den bitteren Erfahrungen mit etlichen Banken in der Finanzkrise 2007 wirklich noch an das Gute im Bankster?
-
19.3.2020 - Tag des babylonischen Sprachengewirrs
Coronavirus in der Schweiz: So gelangen Migranten an die wichtigen Informationen
Auch Menschen, die keine Landessprache verstehen, müssen die Corona-Verhaltensregeln kennen. Der Bund setzt dabei teilweise auf Migranten-Medien. Alle Menschen in der Schweiz, egal, welche Sprache sie sprechen, müssten die Botschaften des Bundes zum Coronavirus verstehen. Das sagt Simone Eigenmann, Kampagnenleiterin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Deshalb seien die roten Plakate mit den Verhaltensregeln in einfacher Sprache gehalten und mit Piktogrammen gestaltet. Auch würden die Informationen und Plakate laufend in weitere Sprachen übersetzt. Auf der Kampagnen-Webseite werde in den Sprachen Albanisch, Arabisch, Mandarin, Portugiesisch, Serbisch, Spanisch und Türkisch informiert. «Weitere Sprachen folgen: Farsi, Kurdisch, Somali, Tamilisch und Tigrinya», sagt Eigenmann. Doch um die vielen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz zu erreichen, brauche es mehr. «Wir sind deshalb auf Migrationsmedien und -organisationen zugegangen und haben ihnen die Faktenblätter zur Verfügung gestellt», so die BAG-Kampagnenleiterin. Es handelt sich dabei um Migrationsmedien wie Miges-Media – die Medienplattform des Roten Kreuzes. Oder auch Diaspora TV – ein Internet-Kleinstsender, der von Migrantinnen und Migranten ehrenamtlich betrieben wird. Schreibt SRF.
Die Massnahmen rund um die Plakate und Flyer des BAG sind vernünftig, auch wenn sie etwas spät kommen. Doch ob die Migrationsmedien wirklich von der Mehrheit der Asylantinnen und Asylanten genutzt werden, darf mit einem grossen Fragezeichen versehen werden. Einfach gestaltete Videos, durch die kantonalen Asylbehörden direkt auf WhatsApp gesendet, könnten möglicherweise weiterhelfen. Denn die Behörden haben die Handynummern ihrer Klientel und WhatsApp gehört bei allen Flüchtlingen, Asylantinnen / Asylanten und Gastarbeitern zum Survival Kit. China und Südkorea haben uns auf eindrückliche Art und Weise gezeigt, welche Macht das Handy bei der Bekämpfung von Corona darstellt. Man muss diese Macht nur nutzen.
-
18.3.2020 - Tag der StreamerInnen
Bakom will Internet für Home-Office freihalten: «Der Bundesrat fordert dazu auf, die Dienste zurückhaltend zu nutzen»
Um Kapazitäten für Home-Office freizuhalten, kann das Bakom datenintensive Dienste wie Netflix abstellen. Soweit ist es noch nicht – aber die Bundespräsidentin ruft zur Mässigung auf. Wegen des Coronavirus sitzen viele zu Hause – und vertreiben sich die Zeit auch mit Serien und Filmen auf Netflix. Doch wie lange noch? Letzten Freitag berichtet der «Tages-Anzeiger», dass das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) datenintensive Streamingdienste wie Netflix limitieren oder abstellen könnte. So blieben mehr Kapazitäten für Leute im Home-Office übrig, die nun zu Hause Videokonferenzen abhalten oder grosse Datenmengen verschicken müssen. Heute Dienstag machte dann plötzlich das Gerücht unter Techinsidern die Runde, dass schon am Freitag Schluss mit Netflix & Co. sein könnte. Darauf heisst es beim Bakom: «Es gab weder heute noch zu einem anderen Zeitpunkt ein Treffen zwischen dem Bakom und Vertretern der Telekommunikationsbranche bezüglich einer Nutzungsbeschränkung von Netflix oder anderen Streamingdiensten. Auch ist die Behauptung, die Nutzung dieser Dienste werde demnächst eingeschränkt, nicht korrekt.» Allerdings ergänzt das Bakom nach Rücksprache mit dem Generalsekretariat des UVEK wie folgt: «Der Bundesrat fordert dazu auf, die Dienste zurückhaltend zu nutzen, wozu insbesondere datenintensive Dienste wie die Übertragung von Video-Dateien gehören. So bleiben genügend Ressourcen für die wichtigen Dienste frei.» Und weiter heisst es aus dem Departement von Bundespräsidentin Simonetta Sommarua: «Sollten gravierende Engpässe entstehen, habe der Bund die Möglichkeit, nicht versorgungsrelevante Dienste einzuschränken oder zu blockieren (Art 48 Abs.1 FMG)». Wie also schon bei den Corona-Massnahmen im realen Leben zählt die Landesregierung also auf die Solidarität der Bevölkerung. Mehr Internet-Kapazität stellt übrigens die Kabelnetzbetreiberin UPC zur Verfügung. So werden während der Zeit des Notstands Kunden mit langsamen Internet-Abos auf mindestens 100 Megabit/s upgegraded – und zwar kostenlos. Laut UPC profitieren rund 165‘000 Kunden von diesem Spezialangebot. Schreibt BLICK.
Haben wir wirklich keine anderen Sorgen als die mögliche Abschaltung von Netflix? Die Welt würde ohne Netflix ganz bestimmt nicht untergehen. Sie würde vermutlich für die Menschen, die Home-Office betreiben, auch nicht wesentlich besser. Die Gruppe der Hardcore-Netflix-Konsumenten, die sich den (vorwiegenden) US-Schwachsinn selbst zu Tageszeiten ansehen müssen, dürfte überschaubar sein. Und dass UPC ein Kapazitäts-Upgrade durchführt ist nicht mehr als ein billiger Werbegag. Kostet die UPC nichts und bringt den Kunden nichts. Denn niemand, aber auch wirklich niemand, erhält je von seinem Anbieter die versprochene Übertragungs-Kapazität. Steht ja nicht umsonst im Kleingedruckten der AGB aller Internetanbieter.
-
17.3.2020 - Tg der Hamster
Shoppen, Freizeit, Arbeiten... Das ist ab Dienstag noch erlaubt
Der Bundesrat greift zu Notrecht, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. BLICK zeigt, was das für unser Leben bedeutet. Welche Läden haben noch offen? Lebensmittelläden, Take-away, Betriebskantinen, Lieferdienste, Apotheken und Drogerien bleiben geöffnet. Auch die Post, Tankstellen, Banken, Hotels, die öffentliche Verwaltung und soziale Einrichtungen können offen bleiben. Gibt es Einschränkungen beim Einkaufen? In jenen Läden, die noch geöffnet sind: nein. Der Bundesrat sieht in seiner Verordnung keine Einschränkungen für Einkäufe vor. Es gibt deshalb keinen Grund für Hamsterkäufe. Die Versorgung der gesamten Bevölkerung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Waren des täglichen Lebens sei gesichert. «Es ist nicht nötig, Notvorräte anzulegen», sagt Bundesrat Alain Berset (47). Schreibt BLICK.
Es wird etwas arg viel über «Hamsterkäufe» geschrieben. Wenn quasi von einer Minute zur andern am Freitag, dem Dreizehnten, sämtliche Schulen geschlossen werden und berufstätige Eltern sich in ihrem Alltag komplett neu organisieren müssen, ist es mehr als verständlich, dass man sich beim Samstags-Einkauf mit dem Notwendigsten eindeckt. Weil zu Hause vielleicht die Kinder auf Mama oder Papa warten, sind tägliche Einkäufe für viele Berufstätige nicht mehr möglich. Dass man da am Wochenende zwei Packungen Salz kauft statt wie üblicherweise nur eine liegt auf der Hand und hat mit «Hamsterkäufen» rein gar nichts zu tun. Wenn einer, wie in den Boulevardmedien als Beweis für abartiges Hamster-Kaufverhalten veröffentlicht, 48 Tuben Mayonnaise auf Vorrat kauft, ist dieser Jemand allerdings ein Leckerbissen für jeden Psychiater, und verdient es nicht, mit den putzigen Hamstern verglichen zu werden. Und wenn dann am Samstag Nachmittag kurz vor Ladenschluss in Luzern bei COOP, ALDI und MIGROS als logische Folge die Salzregale leergefegt sind und sich am Montag darauf die gleichen Salzregale immer noch mit gähnender Leere den Kundinnen und Kunden präsentieren, hat das ebenfalls nichts mit Hamsterkäufen zu tun, sondern mit der Dummheit der Logistikabteilung der einzelnen Unternehmen. Das Wort «Hamsterkäufe» wird auch dem Hamster nicht gerecht, der pflanzliche Vorräte für den Winter anlegt und damit Vorsorge trifft für die möglicherweise von der Natur vorgegebene Notfallsituation. Ein Winter* kann ja durchaus mal etwas länger dauern. Da ist es für die Hamsterfamilie nicht schlecht, zum Überleben ein paar Vorräte im Bau zu haben. Klopapier und Mayonnaise gehören nicht dazu. Das täglich Salz hingegen schon.
* Liebe Kinder: In Zeiten vor dem Klimawandel gab es früher (vor vielen vielen Jahren) tatsächlich Jahr für Jahr Wintermonate, in denen die Landschaft – hinunter bis ins tiefste Flachland – mit hohen Schneedecken eingehüllt war, was es den Hamstern (und den Hamsterinnen, um politisch absolut korrekt zu sein) unmöglich machte, nach pflanzlicher Nahrung zu suchen. Der/die das Hamster*in wird also zu Unrecht als Synonym für eine schlechte Eigenschaft der menschlichen Spezies herbeigezogen.
-
16.3.2020 - Tag der Gier
Hotspot Ischgl: Gier und Versagen in Tirol
In Österreich gab’s am Sonntag traumhaftes Wetter. Beinahe Kaiserwetter, würde man in Tirol sagen, wenn der Himmel strahlend blau ist und die Pisten perfekt präpariert sind. In den Bergen bot sich ein vertrauter Anblick: ungestörter Skibetrieb. Sessellifte und Gondeln schaukelten zu fröhlicher Zithermusik auf die Tiroler Berge, in Hochkössen, in Finkenberg und wie die Skigebiete alle heißen. Sogar in Teilen des wegen der Corona-Pandemie gesperrten Paznauntales, wo das Skiresort Ischgl liegt, konnte man Ski fahren. Ischgl, das ist der Hotspot der Corona-Infektionen in Österreich – gemäß einer bereits vor zehn Tagen erfolgten Warnung der isländischen Gesundheitsbehörden und jüngst auch nach Hinweisen des Robert-Koch-Instituts. Von einer Après-Ski-Bar im "Ballermann der Alpen" gingen vermutlich dutzende Infektionen internationaler Skiurlauber mit dem Virus aus. Täglich mehren sich in Dänemark, Schweden, und vor allem in Deutschland Berichte über neue positiv getestete Fälle von Personen, die eines gemeinsam haben: Sie kamen direkt vom Skiurlaub in Ischgl. Durch Sekundärinfektion nach der Rückkehr geht die Zahl in die Hunderte. Umso gespenstischer, ja verstörender war, dass die Tiroler Behörden den Skibetrieb nicht schon vor Tagen sofort eingestellt beziehungsweise die Gäste in Ischgl isoliert haben, sondern sie völlig ungeordnet ausreisen ließen. 300 buchten laut Tiroler Tageszeitung noch Freitag in Innsbrucker Hotels um. Tiroler Notärzte warnten seit Tagen, dass eine Katastrophe im Aufziehen sei. Aber die Landesregierung schlug die Warnungen in den Wind, sah offenbar keinen Grund, nach dem gesicherten Wissen über die Ansteckungen in Ischgl schon vor einer Woche die Notbremse zu ziehen. Ein Versehen? Die Gier hat die Verantwortung für die Gesundheit der Bürger und der Gäste besiegt. Man wollte diese letzte "starke Touristenwoche" noch "mitnehmen", auf dass die Kassen der Liftbetreiber und Hoteliers klingeln. Schreibt DER STANDARD.
Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Sagte Mahatma Gandhi. Dem ist nichts hinzuzufügen.
-
15.3.2020 - Tag des Sommermärchens
Eskalation am Fifa-Prozess: Das «Sommermärchen» wird zu Michael Laubers Albtraum
Ein Verteidiger hat dem Bundesstrafgericht Verstoss gegen das Epidemiegesetz vorgeworfen. Jetzt liegen die Verhandlungen auf Eis. Die Verjährung rückt näher. Aufsehen erregte der Prozess am Bundesstrafgericht in Bellinzona TI schon seit Beginn. Im Schatten der Corona- Krise aber ist er nun völlig aus dem Ruder gelaufen: Die Verhandlungen gegen vier Angeklagte im Zusammenhang mit der Fussball-WM 2006 in Deutschland liegen auf Eis. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtete, befindet sich ein Beschuldigter, der ehemalige DFB-Boss Wolfgang Niersbach (69), wegen Verdacht auf Corona-Infektion in seinem privaten Umfeld in Quarantäne. Der Stopp wurde am Donnerstag beschlossen; für die Ankläger muss der Entscheid ein Schlag in die Magengrube gewesen sein. Denn die Schweizerische Bundesanwaltschaft muss vor dem 27. April ein Urteil erreichen, sonst ist das Delikt verjährt – der lang ersehnte erste Fifa-Prozess von Bundesanwalt Michael Lauber (54) würde als Fiasko enden. Gerichtspräsidentin Sylvia Frei (62) begründete den Schritt mit Eingaben der Verteidigung, die geprüft werden müssten. Unter welch enormem Druck das Tribunal steht, offenbart der Antrag, den der Anwalt von Horst R. Schmidt (78) am Donnerstag eingereicht hatte. Ex-Fifa-Funktionär Schmidt war 2006 Mitorganisator des «deutschen Sommermärchens» und wird von der Bundesanwaltschaft des Betrugs beschuldigt. In dem Schreiben, das SonntagsBlick vorliegt, erhebt Schmidt-Verteidiger Nathan Landshut heftigste Vorwürfe gegen das Gericht: Er wirft diesem vor, mit der Hauptverhandlung gegen das Epidemiegesetz und die Notverordnung der Tessiner Regierung zu verstossen. «Die Teilnahme an den Hauptverhandlungen ist für meinen Klienten lebensbedrohlich und unter den gegebenen Umständen nicht zumutbar.» Tatsächlich ist der Südkanton zum Notstandsgebiet erklärt worden, und der Angeklagte Schmidt gehört aufgrund seines Alters zur Risikogruppe. Landshut doppelt nach: «Wenn Sie meinen alten und schwer kranken Klienten zwingen, sich für mehrere Wochen in ein Notstandsgebiet zu begeben, verstossen Sie nicht nur gegen das Epidemiegesetz, sondern auch (...) gegen den Grundsatz der Menschenwürde und gegen den Grundsatz des rechtsstaatlichen Strafverfahrens.» Schreibt der SonntagsBlick.
Frei nach dem Album des Reggaemusikers Peter Tosh oder dem US-Amerikanischen «Equal Rights Amendment»: Equal Rights for All (People). Das gilt auch für den Angeschuldigten Wolfgang Niersbach. Keine Frage! Sollte man auch ohne wenn und aber akzeptieren. Unverständlich in Zeiten der Digitalisierung ist allerdings, warum die Befragung eines Angeklagten nicht via Internet durchgeführt werden kann. Niersbach liegt ja nicht auf dem Sterbebett, sondern geniesst vermutlich seine Sommermärchen-Millionen.
-
14.3.2020 - Tag der Hysterie
Leitartikel von Ringier-CEO Marc Walder: Notrecht und Solidarität
Am Freitag verkündete der Bundesrat die Verschärfung der Corona-Massnahmen. Hier schreibt der CEO von Ringier, Marc Walder, auf was es jetzt ankommt. Unser aller Leben verändert sich. Für viele von uns radikal. Während mehreren Wochen, vielleicht gar Monaten. Wir sind konfrontiert mit einer Situation, die wir uns bis vor kurzem nicht hätten vorstellen können. Vielleicht noch nicht einmal am Anfang dieser Woche. Und jetzt, auf einmal, ist es Realität: Die Schweiz befindet sich in einer Ausnahmesituation. Die Länder um uns herum ebenso. Kein Unterricht an den Schulen. Strengste Einreisebeschränkungen. Sport- und Kulturwelt stehen still. Wir arbeiten von zu Hause aus, zumindest jene, denen dies möglich ist. Weltweit haben sich bisher 128 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Und – auch wenn ein grosser, grosser Teil sich dabei fühlt wie bei einer Grippe: Mehr als 4700 Menschen mussten ihr Leben lassen. So tragisch dies ist: Grund zur Panik besteht nicht. Hamsterkäufe sind nicht notwendig. Kritische Infrastruktur wird aufrechterhalten in der Schweiz: Lebensmittelläden, medizinische Einrichtungen, Apotheken, Banken, der öffentliche Verkehr. Wir dürfen in der Aufregung nicht vergessen, warum die Regierungen vieler Länder Notrecht ergreifen: Es ist ein drastischer Akt, der am Ende Solidarität bedeutet. Solidarität mit jenen Menschen, denen das Coronavirus gefährlich werden kann. Nur durch radikale Massnahmen kann die Ausbreitung verzögert werden, damit nicht zu viele Menschen aufs Mal erkranken. Damit unsere medizinischen Einrichtungen, unsere Spitäler nicht kollabieren. Damit es keine Todesfälle gibt, die hätten verhindert werden können. Nur durch radikale Massnahmen kann eine Situation wie in Italien verhindert werden, wo nicht mehr alle Kranken so behandelt werden können, wie es medizinisch erforderlich wäre. Schreibt Ringier-CEO Marc Walder im BLIGG.
Nun: Niemand wird mit vorgehaltener Pistole gezwungen, sämtliche Corona-Artikel zu lesen, die sich in einer beinahe unerträglichen Hyperinflation sondergleichen in den Medien präsentieren. Trotzdem sei die Frage erlaubt, ob denn wirklich jeder und jede nach dem Prinzip JEKAMI seinen / ihren vermeintlichen Hirnschmalz vor Publikum entblössen und damit selbstverständliche Alltäglichkeiten, Kalendersprüche und Lebensweisheiten absondern muss, auf die niemand gewartet hat? Die, seien wir doch mal ehrlich, nur der reinen Klickgeilheit und Selbstbeweihräucherung dienen und – mit Verlaub – der Kategorie «Bullshit» zuzuordnen sind.
-
13.3.2020 - Tag der Christina Luft
Luca Hänni und Michèle haben sich getrennt
Am Donnerstagabend posteten Luca Hänni und Michèle Affolter zeitgleich dasselbe gemeinsame Selfie. Mit lieben Worten füreinander verkünden die beiden ihre Trennung. Diese Woche spekulierten Fans und Medien, ob sich bei Luca Hänni (25) und Michèle Affolter (27) eine Trennung anbahnt – und ob Lucas «Let's Dance»-Tanzpartnerin Christina Luft (30) etwas damit zu tun haben könnte. Eine entsprechende Anfrage liess Michèle unbeantwortet und Luca wollte sich nicht zum Thema äussern. Am Donnerstagabend um etwa 17 Uhr haben nun beide einen Instagram-Post mit demselben gemeinsamen Selfie abgesetzt – aber mit sehr unterschiedlichen Captions. Luca schreibt: «Das hier ist eine Wahnsinns-Frau und hat nur das Beste verdient. Es tut mir leid, dass ich mich erst mal selber finden muss und mich auf mich konzentriere.» Klingt durchaus nach Trennung, right? Schreibt 20Minuten.
Right! Das ist doch mal eine Meldung vom Pendlermagazin an Tagen wie diesen, in denen ein Virus die hyperventilierenden News von 20Minuten im Übermass bis zur totalen Overdose beherrscht. Ich habe geweint, als ich die Schlagzeile las. Christina Luft hat sich einfach in Luft aufgelöst? Right!
-
12.3.2020 - Tag der offenen Tür bei Amorana
Verkäufer von Sex-Toy-Händler Amorana haben gut lachen: Darum beflügelt Coronavirus das Sexleben
Seit die Leute wegen dem Coronavirus mehr zu Hause sind, erlebt der grösste Schweiz Sex-Toy-Händler Amorana ein deutliches Umsatzplus. Die starke Nachfrage zeigt sich nicht nur beim Spielzeug. Auch die Bestellungen von Kondomen haben sich verdoppelt. Die Folgen des Coronavirus haben beim grössten Schweizer Sex-Toy- und Wellness-Händler Amorana zu einem unerwarteten Bestellungsandrang geführt. «Seit dem 1. März verzeichnen wir 53 Prozent mehr Umsatz als im letzten Jahr um diese Zeit», sagt Amorana-Co-Geschäftsführer und -Mitgründer Alan Frei (37) dem BLICK. Allein die Verkäufe von Vibratoren, Dildos und Masturbatoren hätten sich verdoppelt. Frei weiss aus der Datenanalyse: Weil viele Schweizerinnen und Schweizer das Haus nicht mehr verlassen, kann der Online-Händler derzeit doppelt profitieren. «Wenn die Leute zu Hause sind, haben sie mehr Zeit für sich und den Partner oder die Partnerin. Zudem können sie bei uns bestellen, ohne das Haus zu verlassen», erklärt Frei. Dass sich auch der Absatz von Kondomen verdoppelt hat, begründet er damit, dass die Leute sich grundsätzlich wieder mehr um Hygiene kümmerten und sich schützen wollten. Auch ein Nebeneffekt der Corona-Epidemie. Schreibt BLICK.
Des einen Freud ist des andern Leid.
-
11.3.2020 - Tag der Apokalypse im üppigen Hosenanzug
Bundeskanzlerin Merkel zu Coronavirus: «60 bis 70 Prozent in Deutschland werden sich infizieren»
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet damit, dass sich zwei von drei Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infizieren könnten. Bei der bisherigen Sterblichkeitsrate von 3,4 Prozent würde das eine Opferzahl von gegen zwei Millionen bedeuten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) rechnet damit, dass sich zwei von drei Menschen der deutschen Bevölkerung mit dem Covid-19-Virus anstecken könnten. «60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland werden sich mit dem Coronavirus infizieren», sagte die deutsche Regierungschefin (CDU) laut der «Bild» in der Fraktionssitzung am Dienstag. Nach Merkels Worten habe im Saal Stille geherrscht. Doch Merkel sprach abseits der Mikrofone, hinter verschlossenen Türen. Die Hauptlast, so Merkel bei der Sitzung, liege bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (39), der derzeit jedoch noch nicht viel von Verboten hält. Während das Corona-Epizentrum Europas, Italien, die Totalabschottung beschlossen hat, agiert Spahn noch vergleichsweise entspannt. Der Minister empfiehlt, auf Grossveranstaltungen von mehr als 1000 Menschen zu verzichten. Merkel habe jedoch «darauf hingewiesen», dass noch mehr Veranstaltungen abgesagt werden müssten, um die Verbreitung des Virus zu einzudämmen. Spahn habe die Einschätzung von Merkel offenbar bestätigt. Mit 60 bis 70 Prozent Infizierten müsse gerechnet werden - wenn es nicht vorab gelinge, einen Impfstoff zu entwickeln und grossflächig zum Einsatz zu bringen. Derzeit sind in Deutschland 1457 Corona-Infektionen bestätigt. Zwei Menschen starben, 18 haben sich vom Virus erholt. Schreibt BLICK.
Merkel spricht viel wenn der Tag lang ist. So sagte sie 2015 «Wir schaffen das» und lag völlig daneben mit ihrer optimistischen Prognose. Bleibt zu hoffen, dass auch die apokalyptische Prophezeiung bezüglich Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in den üppigen Hosenanzug geht.
-
10.3.2020 - Tag der Coronaimmobilien
Wertkorrekturen und mehr Leerstände: So trifft die Corona-Krise Schweizer Immobilien-Besitzer
Auf dem Immobilienmarkt sind wegen des Coronavirus Preisrückgänge zu erwarten. Betroffen sind unterschiedliche Arten von Immobilien. Das zeigt eine Studie der UBS. Die Auswirkungen des Coronavirus dürften auch an der Schweizer Wirtschaft und auf dem heimischen Immobilienmarkt nicht spurlos vorüber gehen. Die Ökonomen der UBS erwarten, dass es bei einer ähnlich schweren Rezession wie 2009 teils zu substantiellen Wertkorrekturen bei Immobilien kommen dürfte. «Im Falle einer Rezession wären sowohl im Luxussegment als auch bei Renditeliegenschaften grössere Wertverluste wahrscheinlich», so Matthias Holzhey, UBS-Ökonom und Leiter Swiss Real Estate. Schreibt BLICK.
Das arme Coronavirus! Es muss aber auch wirklich für alles herhalten. Die Leerstände und Geistersiedlungen waren schon Tatsache, als das Coronavirus noch in weiter Ferne und Jahre von uns entfernt in irgendwelchen asiatischen Fressalien vor sich hin dümpelte. Und dass Wertverluste bei den Immobilien irgendwann kommen werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Hat aber mit Corona recht wenig zu tun. Sonst müsste man ja im Umkehrschluss die Immobilien-Haie unter Quarantäne stecken.
-
9.3.2020 - Tag der Milliardärs-Spuhlen
Köppel geht auf Peter Spuhler los: «Milliardär, der seine Schäfchen im Trockenen hat»
Peter Spuhler, ehemaliger SVP-Nationalrat und Chef von Stadler Rail, warnte in einem Interview mit CH Media vor der Begrenzungsinitiative der SVP. Diese würde, sofern mit der Europäischen Union kein Deal zustande kommt, innert 12 Monaten zur Kündigung der Personenfreizügigkeit führen. Dazu sagt Spuhler: «Die Initiative ist ein Frontalangriff nicht nur auf die Personenfreizügigkeit, sondern auf die Bilateralen insgesamt.» Zur Frage, wie wichtig für Stadler Rail die Personenfreizügigkeit sei, was das Besetzen von offenen Stellen angehe, führt Spuhler aus: «Sie ist wichtig, aber lassen Sie mich zuerst etwas Grundsätzliches sagen: Wir müssen die Befürchtungen der Globalisierungsverlierer ernst nehmen. Es ist nicht nachhaltig, wenn die Schweizer Bevölkerung jedes Jahr durch Zuwanderung um 1 Prozent oder 80'000 Personen wächst. Das müssen wir lösen.» Gemäss Peter Spuhler seien mit dem Wegfall der Freizügigkeit die ganzen Bilateralen I in Gefahr, deshalb erachte er die Begrenzungsinitiative der SVP als extrem. Sie sei gefährlich für den Wirtschaftsstandort Schweiz, es sei für ihn zudem nicht nachvollziehbar, warum die SVP auf diese Initiative setze. Als Unternehmer müsse und werde er sich dagegen wehren. Das Problem der übermässigen Zuwanderung müsse gelöst werden, aber «bitte nicht auf extreme Art». Nun greift der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel Spuhler frontal an. Auf Twitter schreibt der Weltwoche-Chef: «Eigeninteresse vor Landesinteresse. Für den Milliardär, der seine Schäfchen im Trockenen hat, sind alle, die eine masslose Zuwanderung begrenzen wollen, ‹Globalisierungsverlierer›. Könnte es sein, dass sie einfach nur vernünftig sind?» Schreibt Watson.
PS: Zum ganzen Interview mit Spuhler gehs hier
Passiert auch nicht alle Tage, dass man dem rhetorischen Maschinengewehr Roger Köppel zustimmen muss.
-
8.3.2020 - Tag von Urs Schwaller
Die Post-Spitze lässt sich die Zukunft etwas kosten: 25'325 Fr für externe Berater – pro Tag!
Die Post-Spitze um Präsident Urs Schwaller und CEO Roberto Cirillo setzen auf McKinsey & Co., um die Zukunft des gelben Riesen zu planen. Ein teurer Spass. Die jüngsten Erfahrungen der Post mit externen Dienstleistern waren durchzogen bis desolat: Der KPMG fielen jahrelang fiktive Postauto-Buchungen nicht auf. Und die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, die den Skandal aufklären sollte, liess in ihrem Untersuchungsbericht ein entscheidendes Protokoll unerwähnt. Trotz allem – oder gerade deshalb – ist der Post-Spitze um Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller (67) und CEO Roberto Cirillo (48) die Lust auf externe Unterstützung nicht vergangen. Im Gegenteil: Der gelbe Riese holt laufend neue Ratgeber ins Haus – und lässt sich das auch etwas kosten. Schreibt SonntagsBlick.
Der Name Urs Schwaller ist und war schon immer Programm. Der lässt seine Freunde von McKinsey & Co. nicht im Stich. Wer etwas anderes von diesem Herrn erwartet hat, gibt sich naiven Illusionen hin. So läuft das nun mal, wenn Chefpositionen in Staatsbetrieben mit abgehalfterten Polit-Rentnern besetzt werden.
-
7.3.2020 - Outingday
Schwinger Orlik outet sich als homosexuell: «Ich tue das auch für meinen Sohn»
Curdin Orlik hat einen vierjährigen Sohn. Das Resultat aus mehreren Beziehungen mit Frauen. Jahrelang rang der Schwinger mit sich selbst. Curdin Orlik wagt das Coming-Out. Als erster männlicher noch aktiver Spitzensportler. Einer der Gründe für den mutigen Schritt: sein vierjähriger Sohn. «Ich tue das auch für meinen Sohn. Ihn will ich auf gar keinen Fall anlügen», sagt er gegenüber dem «Tagesanzeiger-Magazin». «Ich hätte mir gewünscht, bereits als Kind zu erfahren, dass es viele verschiedene Lebensformen gibt und dass jede in Ordnung ist. Aber so war es nicht.» Schreibt BLICK.
An Curdin Orlik könnte sich ein Luzerner FDP-Politiker ein Beispiel nehmen. Wär's nicht besser, sich mit Stil selber zu outen, bevor es irgendein Boulevardblättli macht? Die Story, die gar keine Story ist, bruzzelt nämlich längst in der Pfanne einer Boulevard-Garküche. Und ewig kann sich der Liebling aller Luzerner Schwiegermütter die Geschichte trotz Protektion von ganz Oben nicht von seinem Astralkörper halten.
-
6.3.2020 - Tag der Sündenböcke
Beschämende Koalitionen in der Flüchtlingskrise
Recep Tayyip Erdogan ist das perfekte Feindbild. Der türkische Präsident regiert sein Land autoritär bis brutal, trägt mit seiner Intervention zur Eskalation in Syrien bei und greift auch in der aktuellen Krise zu verwerflichen Strategien. Sein Satz von den "geöffneten Toren" hat tausende Flüchtlinge in falscher Hoffnung an die türkisch-griechische Grenze gelotst, obwohl dort kein Weiterkommen in die EU ist. Österreichs Regierung hat nicht gezögert, auf den Sündenbock einzuprügeln – und Applaus vom Boulevard geerntet. PR-technisch hat Sebastian Kurz mit den Grünen als Beiwagerl alles richtig gemacht. Wie ein Staatsmann verhalten hat er sich nicht. Doch von einem Revival von 2015, als unkontrolliert über die Grenze strömende Asylwerber so vielen Bürgern Angst machten, ist ja auch keine Rede. Es geht darum, einer begrenzten Zahl besonders notleidender Menschen zu helfen – etwa, wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorschlägt, unbegleiteten Kindern, die in manchem griechischen Lager um ihre Gesundheit und sogar ihr Leben fürchten müssen. Wenn schon ein nationaler Schulterschluss, dann für diesen humanitären Akt – selbst wenn die faire Aufteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten wieder nicht zustande kommt. Das kann, das muss sich eines der reichsten Länder der Erde leisten. Schreibt DER STANDARD.
Wirklich stimmig ist dieser (sehr kurze) Artikel von Gerald John nicht, weil er Fakten weglässt. In der Tat ist es eine kaum auszuhaltende Tragödie rund um die Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern. Doch Kanzler Kurz hat sich mit einem ernüchternden Statement dazu geäussert, dem man nicht viel entgegenhalten kann: Wer diese Kinder aufnimmt ist verpflichtet, auch deren Angehörige anschliessend aufzunehmen. Man darf sich jetzt wirklich fragen, warum hat die hehre Wertegemeinschaft der EU nicht längst dafür gesorgt, dass wenigstens die Kinder in Griechenland menschenwürdig untergebracht werden? Die Kinderbilder der Unmenschlichkeit gingen um die Welt, als der Sultan noch Monate davon entfernt war, die Schleusen zu öffnen. Die Politik hätte genügend Zeit gehabt, das Problem vernünftig zu lösen. Das hätte sie allerdings etwas gekostet. Geld, das die von den Medien und Erdogan getriebenen Politiker*Innen nun an den Bosporus überweisen müssen.
-
5.3.2020 - Tag der Automobilsalons
Das Corona-Virus gefährdet die Zukunft des Genfer Autosalons: Ein Experte sieht traditionelle Motorshow in Gefahr
Am Donnerstag hätte der Autosalon beginnen sollen. Die Absage wegen des Corona-Virus könnte gemäss dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer das Ende für die Motorshow bedeuten. Auto Schweiz und der grösste Schweizer Autoimporteur widersprechen. Ferdinand Dudenhöffer: Die Gefahr ist gross, dass die kurzfristige Absage den seidenen Faden gekappt hat, an dem der Autosalon sowieso schon hing. Wir schätzen, dass die anwesenden Automarken zusammen mehr als 100 Millionen Euro verloren haben für Standaufbau, -mieten, Hotels usw.. Das wird die Entscheidung der Autohersteller, ob sie im nächsten Jahr wieder kommen, erheblich belasten. Die Zukunft von Genf steht auf dem Spiel. Besucherschwund, weniger teilnehmende Autobauer, weniger Werbewirkung, weniger Berichterstattung in den Medien. Der Auftritt ist für die Autobauer aber sehr teuer, das zahlt sich immer weniger aus. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Das künftige Ende der Autosalons hat nun aber mal wirklich rein gar nichts mit dem Coronavirus zu tun, ausser der temporär der drohenden Epidemie geschuldeten Absage 2020. Langfristig sind derartige Autoshows so oder so ein Auslaufmodell. Sie entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist. Zeiten wandeln sich und bei der jungen Generation hat das Auto längst nicht mehr den Stellenwert von Mobilität und Freiheit, den es bei den älteren Semestern noch immer geniesst. Hinzu kommt die Digitalisierung mit ihrer grenzenlosen Onlinevermarktung. Autohersteller können ihre neuen Produkte via Internet und Livestreams ebenso werbewirksam und mit viel grösserer Reichweite als auf einem Autosalon präsentieren. Mit dem Verzicht auf diese reinen Prestigeveranstaltungen sparen sie zudem noch Millionen und haben als willkommenen Nebeneffekt keine Fridays-for-Future-Demos mit brennenden Autos (der letztjährige Autosalon in Frankfurt lässt grüssen!*) vor der Halle.
* Es gibt ja Gründe, weshalb der deutsche Automobilsalon von Frankfurt nach München verlagert wurde. Das Coronavirus gehört nicht zu diesen Gründen. Brennende Autos aber schon.
-
4.3.2020 - Tag des Sebastian Kurz
Flüchtlinge: Realismus und Empathie: Europa lebt am Rande einer Krisenregion, die sich selbst zerfleischt
Gerald Knaus ist ein österreichischer Politikberater, der auf dem Gebiet des Flüchtlingswesens Expertise, Realismus und Empathie vereint. Seinem Rat sind die deutsche Regierung und die EU gefolgt, das EU-Erdogan-Abkommen ist seine Konzeption. In Österreich wird er von der Regierung nicht zurate gezogen, weil sich seine differenzierten Analysen und Lösungsvorschläge nicht mit dem schlichten heimischen "Kein Durchwinken mehr / Illegale Migration stoppen"-Psalmodieren vertragen. Dienstagabend war Knaus in der "ZiB 2" und sprach in zweierlei Richtung Klartext: Erstens wird die EU weiter der Türkei und Griechenland dabei helfen müssen, die enormen Lasten der Fluchtwelle aus Syrien und anderswoher zu tragen. Zweitens: Ein gewisses Maß an kontrollierter Verteilung von Flüchtlingen in Europa wird es geben müssen. Das heißt nicht, dass sich ein 2015 wiederholen soll/darf. Nur etwa ein Drittel der damaligen Flüchtlinge waren Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Die anderen waren Afghanen, Nordafrikaner, die sich anschlossen. Auch denen geht es nicht gut, auch sie haben Fluchtgründe, aber viele kamen, weil sie sich in Europa Besseres erhofften. Aktuell an der türkisch/griechischen Grenze gestrandet sind hauptsächlich Afghanen, Pakistaner und Bangladescher. Die Realität ist, dass Europa nicht die immensen Probleme einer ganzen Weltgegend, etwa den hundertjährigen innerislamischen Krieg, schultern kann. In einem hat die "Grenzen dicht"-Truppe rund um Sebastian Kurz ja recht: Ein undifferenziertes Hereinnehmen wie 2015 geht nicht (mehr). Europa muss auch entscheiden können, wer ein Recht auf humanitäre Hilfe hat, wer eine wertvolle Arbeitskraft ist, und wer nicht. Schreibt DER STANDARD.
Autor Hans Rauscher bringt es auf den Punkt: Aktuell an der türkisch/griechischen Grenze gestrandet sind hauptsächlich Afghanen, Pakistaner und Bangladescher. Wenigstens auf Sebastian Kurz, der nach seiner ersten Wahl zum österreichischen Bundeskanzler von der europäischen Presse als «Baby Hitler» beschimpft wurde, ist noch Verlass. Der smarte Populist Sebastian weiss eben, mit welchen Argumenten er die Wahlen fulminant gewonnen hat. Und – er hält sein Wort! Würde er es brechen, wäre er sehr schnell wieder weg vom Fenster und würde damit nur Österreichs «braune Pest» stärken. Dann doch noch lieber den türkisen «Baby Hitler» als die ekelhaft braune Sauce rund um Hofer und Kickl.

-
3.3.2020 - Tag der Weltenlenker
Thüringen: AfD stellt den Faschisten Höcke für Ministerpräsidentenwahl auf
Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) im ostdeutschen Bundesland Thüringen schickt ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Das teilte die AfD-Fraktion am Montag in Erfurt mit. Höcke tritt damit gegen den Linke-Politiker und ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow an. Sämtliche Angebote der AfD "für eine Zusammenarbeit der bestehenden bürgerlichen Mehrheit" im Thüringer Landtag und für eine Beendigung von Rot-Rot-Grün seien von CDU und FDP ausgeschlagen worden, erklärte Torben Braga, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. "Sollte Bodo Ramelow am kommenden Mittwoch mehr als die 42 Stimmen des rot-rot-grünen Lagers erhalten und als Ministerpräsident gewählt werden, soll für jeden Betrachter klar sein, dass diese Stimmen nicht von der AfD kamen." CDU und FDP hätten dann ihr Versprechen gebrochen, Ramelow nicht zu wählen und ein Fortbestehen von Rot-Rot-Grün nicht zu ermöglichen, erklärte Braga. Schreibt DER STANDARD.
Sollte sich die «Völkerwanderung von 2015» (Anm. Originalzitat von AfD-Chef Meuthen) dank Erdogans raffinierter Erpressungsstrategie wiederholen, wird der Faschist Höcke schon bald nicht mehr als Ministerpräsident eines kleinen deutschen Bundeslandes kandidieren, sondern als nächster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Auch Salvini wird sich in Italien die Hände reiben. Und in Moskau lächelt sich der einzige Stratege der «Weltenlenker*Innen» vermutlich ins Fäustchen.
-
2.3.2020 - Tag von König Artus
Bedrohte Datenschutz-Anerkennung: Schon wieder eine Retourkutsche der EU?
Braut sich in Brüssel neues Ungemach für die Schweiz zusammen? Die Europäische Union könnte einen weiteren politisch motivierten Nadelstich setzen, um Bundesbern zu einer Unterzeichnung des institutionellen Rahmenabkommens zu bewegen. Erneut würde damit der Zugang für Schweizer Unternehmen zum EU-Binnenmarkt erheblich erschwert. Diesmal geht es um den Datenschutz: Spätestens am 25. Mai muss die EU-Kommission entscheiden, ob sie die Schweiz weiterhin als Drittstaat anerkennt, der Personendaten ausreichend schützt. Grosse Teile der Wirtschaft sind auf diese Einstufung angewiesen. Verliert die Schweiz diese Anerkennung, können einheimische Unternehmen mit solchen aus der EU nicht mehr einfach Daten austauschen. Ihr bürokratischer Aufwand stiege markant. Kundenadressen aus einem EU-Land etwa dürften nur mit Auflagen in die Schweiz übermittelt werden. Und will eine Schweizer Firma weiterhin mit Firmen aus dem EU-Markt ins Geschäft kommen, muss sie vor jedem Vertragsabschluss garantieren, dass sie die Datenschutzstandards der Union einhält. Es droht ein juristischer Papierkrieg. Fakt ist: Das geltende Datenschutzgesetz stammt aus einer Zeit, als «Internet» noch ein Fremdwort war. Sein Schutzniveau ist nicht mehr gleichwertig mit jenem der EU, die ihre Gesetze schon 2018 verschärft hat. Kein Wunder, drängten die Schweizer Wirtschaftsverbände darauf, die Behandlung des neuen Gesetzes im Parlament rasch vorwärtszutreiben. Schreibt die Aargauer Zeitung.
The Empire strikes back. Wie oft haben wir uns schon über The Donald, den grössten «Dealmaker» aller Zeiten und seine «Deals» lustig gemacht. Doch das derzeitige Verhältnis EU / Schweiz bewegt sich ebenfalls in diesem Modus: Come on, let's make a Deal. Und wie schon König Artus zu den Rittern der Tafelrunde gesprochen haben soll, «wird der Starke immer den Schwachen besiegen». Ziemlich schlechte Karten also für die Schweiz.
-
1.3.2020 - Frühlingsbeginn
Weil er Homöopathie gegen das Coronavirus empfiehlt: Sturm der Entrüstung gegen Nationalrat Portmann
Ein homöopathisches Mittel hilft «eine Corona-Infektion abschwächen», twitterte Hans-Peter Portmann. Und erntet heftigste Kritik. Der FDP-Nationalrat kontert: Mehr Abwehrkräfte würden sicherlich nicht schaden. Aussenpolitiker Hans-Peter Portmann (57) begibt sich auf heikles medizinisches Eis. Am Freitagabend, am Tag, an dem der Bund aufgrund des Coronavirus die Notlage ausrief und alle Grossveranstaltungen verbot, twitterte der FDP-Nationalrat die Empfehlung, man solle doch mit Kügeli Symptome des gefährlichen Virus bekämpfen. Der Zürcher empfiehlt das Mittelchen des französischen Herstellers Boiron – einer Firma mit einem jährlichen Umsatz von rund 600 Millionen Euro und fast 4000 Angestellten. Und bittet die Twitter-Gemeinde, seine Information breit zu streuen. Dies passiert zwar – aber nicht so, wie es sich der Nationalrat wohl gewünscht hat. Portmann erntet einen Shitstorm! Über 150 Personen kritisierten seinen Tweet in teils scharfen Voten. «Ihnen fehlt Bildung, wenn Sie die Gesellschaft mit solch gefährlichen Behauptungen in die Irre führen», echauffiert sich ein User. Und ein weiterer meint: «Eigentlich wäre jetzt eher der Zeitpunkt, klipp und klar darauf hinzuweisen, dass von homöopathischen Mitteln & Co keine Hilfe zu erwarten ist.» Beda Stadler (69), emeritierter Professor für Immunologie, sagt auf BLICK-Anfrage, dass es bei jeder gesundheitlichen Krise Homöopathen gebe, welche versuchen, aus der Lage Profit zu schlagen. Das seien Abzocker, die alles noch viel schlimmer machen würden. «Wer heute immer noch glaubt, dass Homöopathie mehr bewirkt als ein Placebo-Effekt, hat einen Dachschaden», so Stadler. Schreibt BLICK.
Könnte es sein, dass FDP-Nationalrat Portmann Homöopathie mit Homopathie verwechselt? Sowas kann sehr schnell passieren. Dieses vernetflixte «ö» hat's in sich. Der reinste Zungenbrecher*In. Einem FDP-Politiker quasi einen Dachschaden vorzuwerfen geht ja noch. Aber Abzocker? Das ist eindeutig zu viel des Guten. Ein FDP-Politiker kann niemals ein Abzocker sein. Das müsste auch dieser emeritierte Professor wissen.
-
29.2.2020 - Kein Tag wie jeder
Bund erwägt Spezialspitäler nur für Corona-Patienten
In einem Brief an die Schweizer Ärzte kündigt das Bundesamt für Gesundheit neue Massnahmen an. Für den Fall, dass sich die Situation stark verschlimmere, «würden wir drastischere Massnahmen ins Auge fassen», hält Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim BAG, im Schreiben fest. «Zum Beispiel einzelne Spitäler nur für Coronavirus-Fälle reservieren.» Noch seien die Massnahmen nicht angebracht. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wir sparen in der Regel nicht mit Kritik an unserer Regierung. Das ist auch gut so. Doch für die Massnahmen im Umgang mit dem Coronavirus zum Schutz der Bevölkerung muss man sie loben. Eine Basler Fasnacht zu verbieten braucht Mut. Und diesen Mut, eine für viele Fasnachtfans sicherlich harte Entscheidung zu fällen, zeigt der Bundesrat. Chapeau!
-
28.2.2020 - Säbelrasseln
Türkei fordert Nato-Beistand nach Tod von Soldaten in Syrien
Nach einem Luftangriff auf türkische Soldaten mit zahlreichen Toten in der nordsyrischen Provinz Idlib hat die Türkei Beistand von Nato und der internationalen Gemeinschaft gefordert. Als Vergeltung griff die Türkei in der Nacht zu Freitag Stellungen der syrischen Regierungstruppen an, wie der türkische Kommunikationsdirektor, Fahrettin Altun, mitteilte. „Wir rufen die gesamte internationale Gesellschaft dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen“, hieß es darin. Der Sprecher der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Ömer Celik, forderte, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen. Gleichzeitig drohte er kaum verhohlen damit, syrischen Flüchtlingen im Land die Grenzen in Richtung Europa zu öffnen: „Unsere Flüchtlingspolitik bleibt dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten“, sagte er. Schreibt die FAZ.
Säbelrasseln bei einem Mitglied der hehren Wertegemeinschaft des westlichen Verteidigungsbündnis NATO. Hochschaukeln bis es kracht? Vergleichen heisst nicht gleichsetzen. Wohlverstanden! Doch ein kurzer Blick in die Vergangenheit lohnt sich immer.
-
27.2.2020 - Tag der Jubelchöre
Politischer Aschermittwoch: Friedrich Merz in Apolda – Und die Basis jubelt
Zwei Stunden muss der Kandidat aushalten, bis er endlich auf die Bühne darf. Lustig ist Merz in der Tat nicht, seinen einzigen, nun ja, Brüller zündet er im Mittelteil: «Wenn ich im Fernsehen sehe, mit welch verklärten Blicken der Herr Habeck und die Frau Baerbock angeschaut werden, denke ich, ich bin nicht einer Talkshow, sondern bei Parship.de. Alle 30 Sekunden verliebt sich ein deutscher Journalist in Robert Habeck.» Ansonsten bleibt Merz mahnend-kämpferisch, motivierend und bisweilen staatsmännisch. Er kritisiert Bodo Ramelow, weil dieser ohne Mehrheit wieder Regierungschef werden will, lässt auch die Thüringer CDU nicht ungeschoren, nein, sie werde für ihr Verhalten bei der nächsten Wahl einen Preis zu zahlen haben. «So ist Demokratie», ruft Merz in die kurzzeitig stille Halle. «Aber wir halten trotzdem zusammen», sagt er und verspricht zur grossen Erleichterung, dass die gesamte CDU bei nächsten Wahlkampf in Thüringen helfen werde. Merz hat sich warmgeredet, auch er schwitzt, legt bald sein Sakko über einen Notenständer der pausierenden Kapelle und wischt sich mit einer Serviette den Schweiss aus dem Gesicht. Er entwirft grosse Bilder von der Rolle Europas zwischen Amerika und China, spricht über die Folgen des Klimawandels und fordert ein gutes Verhältnis mit Russland. Erst am Ende kommt er dann auch auf seine Kandidatur zu sprechen, wiederholt, dass die vergangenen 15 Jahre zwar gute Jahre für Deutschland waren, und dass man das auch Angela Merkel zu verdanken habe, er aber angesichts der Umfragewerte für die Union «nicht für ein Weiter so», sondern «für Aufbruch und Erneuerung» antrete. Nichts kann auch die CDU hier in Apolda und erst recht in Thüringen mehr brauchen als das. Die Menge feiert Merz wie einen Superstar, als habe er bereits gewonnen. Dabei war Thüringen für ihn gerade mal der Anfang. Schreibt die FAZ.
Das deutsche Volk scheint zum Jubeln geboren zu sein. Besonders dann, wenn ein neuer Messias daherkommt, der übers Wasser gehen kann, ohne dass sein Füsse nass werden. Was bisher nur Chuck Norris gelungen ist.
-
26.2.2020 - Aschermittwoch
US-Serie lief im Nationalratssaal: SP-Badran wundert sich über «Friends» im Bundeshaus
Wo sonst die Abstimmungsresultate des Nationalrats angezeigt werden, lief auf einmal eine US-Serie. Zum Erstaunen von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Für die Freunde amerikanischen Comedy-Serien hätte sich gestern ein Besuch im Bundeshaus gelohnt. Auf den Bildschirmen im Nationalratssaal, wo normalerweise die beratenen Geschäfte aufgeführt und die Abstimmungsresultate angezeigt werden, wurde für einmal eine US-Sitcom übertragen. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (58, ZH) nahm an einer Sitzung der nationalrätlichen Wirtschaftskommission teil und wurde Zeugin des überraschenden Einspielers. Worauf sie flugs twitterte: «Premiere im Nationalratssaal: Übertragung der Serie ‹Friends›. Preisfrage: wie kommts?» Badrans Preisfrage beantwortet Mark Stucki von den Parlamentsdiensten: «Im Rahmen von Tests an den technischen Installationen in den Ratssälen wird auch die Einspielung von Videosignalen auf die Bildschirme überprüft. Es handelte sich um einen solchen Test», erklärt er. Die Tests fanden und finden während dieser Tage laufend durch eine externe Firma statt. «Auch, um die Operators zu schulen.» Trotzdem: Warum lief im Nationalratssaal eine US-Serie über den Bildschirm? «Reiner Zufall!», so Stucki. «Bei den Tests wurde irgendein Sender eingespielt.» Da sei halt gerade «Man with a Plan» gelaufen. Schmunzelnd schiebt er nach: «Tiefere Beweggründe liegen keine dahinter.» Schreibt BLICK.
Ein bisschen Abwechslung sei auch unseren Parlamentariern und *Innen (Genderstern, gällid) gegönnt, arbeiten sie doch im Schweisse ihres Angesichts von frühmorgens, wenn der Hahn auf der Henne kräht, bis spätabends zum Wohle der Bevölkerung und stetig tieferen Krankenkassenprämien.
-
25.2.2020 - Tag der Lachnummern
Gefährliches Virus nahe an unserer Grenze: SVP nutzt Corona-Angst für ihre Initiative
Das Coronavirus ist bedrohlich nahe an der Schweizer Grenze, im Tessin herrscht wegen den vielen Grenzgängern Alarmbereitschaft. Doch mittlerweile schwappt die Angst vor dem Coronavirus auf die ganze Schweiz über. Eine Angst, welche die SVP nun für politische Zwecke nutzt. Sie weibelt gegen die Personenfreizügigkeit. So fordert SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (41) via Twitter, «endlich systematische Grenzkontrollen einzuführen». Die EU versage auch hier, schreibt er. Und wirbt für ein Ja zur Begrenzungs-Initiative der SVP, die am 17. Mai vors Volk kommt. Das kommt bei Gewerkschaftsboss und SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard (51, VD) schlecht an. Er wirft der SVP vor, mit dem Coronavirus Stimmung zu machen. «Es gibt eine zusätzliche Gefahr neben dem Virus selbst, das ist die Panikmache und politische Instrumentalisierung», sagt der Präsident des Gewerkschaftsbund zu BLICK. Die SVP instrumentalisiere eine «ernste Situation», da müssten auch die politischen Akteure ernst und glaubwürdig bleiben, so Maillard. «Eine Kampagne kann nicht mit solchen Argumenten geführt werden.» Wenn nötig, könne der Bund jederzeit Grenzkontrollen organisieren –«unabhängig von der SVP-Initiative». Panikmache zur politischen Zwecke? SVP-Nationalrat Thomas Aeschi wehrt sich gegen diesen Vorwurf. «Auf keinen Fall!», sagt er zu BLICK. Die Situation dürfe man nicht missbrauchen, sagt er. Doch die Lage sei hochdramatisch, da müsse der Bund reagieren. «Der Bund muss dringend Grenzkontrollen einführen. Wir müssen wissen, wann welche Personen reinkommen.» Und sobald es einen Fall in der Schweiz gebe, müsse die Grenze sofort geschlossen werden. Schreibt BLICK.
Was ist denn da so falsch an Aeschis Aussage bzw. Forderung? «Wir müssen wissen, wann welche Personen reinkommen.» Dieses Wissen betrifft nicht nur das Coronavirus. Es wäre auch gut informiert zu sein, welche Leute nach einer Verurteilung durch die Staatsanwaltschaft mit Abschiebung und einem 5-jährigem Einreiseverbot in die Schweiz zwei Wochen später dennoch wieder im Alpenland anzutreffen sind. Rumänien, Osteuropa und der Balkan lassen dank offenen Grenzen grüssen. Fragen Sie doch mal einen Vertreter der Stadt-Luzerner- oder Aargauer Polizei und Sie werden feststellen, dass dieses «Einreiseverbot» die reinste Lachnummer ist.
-
24.2.2020 - Güdismontag
Bund pfeift Krankenkasse zurück: Sympany lockte mit illegalen Rabatten
Die Krankenkasse Sympany hat es beim Kundenfang übertrieben. Sie legte rund 8000 Kunden rein, die ihre Grundversicherung letztes Jahr gekündigt hatten. Und bot ihnen bis zu 500 Franken an, wenn sie blieben. Doch das Bundesamt für Gesundheit intervenierte. Die Krankenkassen buhlen nicht nur mit Gutscheinen um neue Kunden. Sie machen abtrünnigen Versicherten auch mit Geschenken den Hof. Eine neue Masche hat sich die Krankenkasse Sympany einfallen lassen. Mit illegalen Spezialtarifen wollte sie Kunden in der Grundversicherung zurückgewinnen, die bereits gekündigt hatten. Der Versicherte Thomas Rose* (48) kündigte den Sympany-Vertrag seiner Familie letzten Herbst. Er hatte schon ein Angebot einer günstigeren Krankenkasse auf dem Pult liegen. Darauf rief ihn ein Sympany-Mitarbeiter an. «Er fragte mich, ob meine Familie bereit wäre zu bleiben, wenn Sympany den Differenzbetrag begleicht», sagt der Kunde. Rose war einverstanden, nachdem ihm Sympany schriftlich eine Gutschrift von 1600 Franken per Februar 2020 bestätigt hatte. Doch die Gutschrift blieb aus. Stattdessen erhielt Rose einen Brief von Sympany. Dieser liegt BLICK vor. Darin zieht Sympany das Gutschriftversprechen zurück. Der Grund: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat festgestellt, dass das Rückkehrangebot in der Grundversicherung rechtswidrig war. Schreibt BLICK.
Und? Wundert sich da jemand? KK-Business as usual. Lassen wir uns vom längst alltäglich gewordenen Ärger mit den Krankenkassen nicht den Wochenstart vermiesen. Ab nach Luzern, wo der Güdismontag zelebriert und gefeiert wird.
-
23.2.2020 - Tag der stabilen Genies
Bernie Sanders straft bei der Vorwahl in Nevada die Konkurrenz ab
Der Spitzenkandidat des linken Flügels hat seine Führungsposition im Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber durch seinen deutlichen Sieg in Nevada weiter konsolidiert. Die Unruhe steigt unter den Gemässigten, die weiter gegeneinander im Wettbewerb liegen. Der selbst erklärte «demokratische Sozialist» Bernie Sanders hat seinen Vorsprung in den ersten Vorwahlen für die Präsidentschaft mit einem klaren Sieg in Nevada ausgebaut. Bereits am Samstagnachmittag (Ortszeit) erklärte die Nachrichtenagentur AP Sanders auf der Basis der vorläufigen Resultate zum Sieger. Er hatte am Abend rund doppelt so viel Zuspruch wie der nächstfolgende Bewerber, der frühere Vizepräsident Joe Biden. Dahinter folgten nochmals deutlich abgeschlagen Pete Buttigieg, Elizabeth Warren sowie Tom Steyer, der ausserordentlich viel Geld in diese Vorwahl investiert hatte. Schreibt die NZZ.
Sieht richtig gut aus für the stable Genius*. Ein 78-jähriger Herausforderer? Dagegen ist ja Trump mit seinen 73 Jahren der reinste Jungbrunnen. Wozu sollte denn The Donald noch den russischen Geheimdienst brauchen, den die US-Medien – und die transatlantische Durchlauferhitzerpresse, die von den US-Agenturen jeden Blödsinn übernimmt – in ihrer Paranoia auf der Jagd nach Schlagzeilen als Bösewicht herbei schreiben? Ganz so, als ob nicht die USA selber genügend fragwürdige Geheimdienstklitschen hätte, denen man so ziemlich alles zutrauen darf. Ohne jetzt eine Verschwörungstheorie zu lancieren, darf man getrost davon ausgehen, dass bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA irgendeiner der amerikanischen Geheimdienste in irgendeiner Form ebenfalls mitgewirkt hat. Man darf sicherlich fragen, weshalb sich das FBI so kurz vor der Wahl die unsägliche Hillary vorgeknöpft hat.
* Es wird Zeit, dass auch einmal erklärt wird, was The Donald eigentlich mit seinem Tweet «I am a very stable Genius» wirklich meinte. Fälschlicherweise interpretierten alle westlichen und unwestlichen (neue Wortschöpfung, copyright by LUZART) Medien diese Äusserung als grossgekotzte Angeberei von einem intellektuell etwas minderbemittelten US-Präsidenten, der sich selber als Genie bezeichnet. In Tat und Wahrheit aber ist «THE STABLE GENIUS ACT» ein vom US-Abgeordneten Brendan Boyle verfasster Gesetzentwurf, wonach Präsidentschaftskandidaten eine ärztliche Untersuchung ablegen und die Ergebnisse vor den allgemeinen Wahlen öffentlich bekannt geben müssen. Nachlesbar auf Wikipedia (Englisch).
-
22.2.2020 - Tag der Strafmilliarden
Abtretender UBS-Chef warnt vor Abstieg des Schweizer Finanzplatzes
Der abtretende UBS-Chef Sergio Ermotti hat in einem Zeitungsinterview vor einem Abstieg des Schweizer Finanzplatzes wegen des Brexits gewarnt. Mehrere Länder würden die Regulierung nutzen, um die eigenen Bankinstitute im internationalen Wettbewerb zu bevorzugen. «Nach dem Brexit werden die Briten mit aller Kraft versuchen, den Finanzplatz zu stärken. Durch eine strenge, aber pragmatische Regulierung», sagte Ermotti in einem Interview mit den «CH Media"-Zeitungen vom Samstag. «In der Schweiz fehlt dieser Pragmatismus manchmal.» Die Schweiz sei zwar aus politischer und regulatorischer Sicht weiterhin ein Standortvorteil für eine Grossbank, sagte der 59-jährige Tessiner. Die Schweiz müsse aber aufpassen, dass sie nicht ins Hintertreffen gerate. «Unser Referenzpunkt muss der Finanzplatz London sein.» «Nach dem Brexit werden die Briten mit aller Kraft versuchen, den Finanzplatz zu stärken. Durch eine strenge, aber pragmatische Regulierung», sagte Ermotti in einem Interview mit den «CH Media"-Zeitungen vom Samstag. «In der Schweiz fehlt dieser Pragmatismus manchmal.» Die Schweiz sei zwar aus politischer und regulatorischer Sicht weiterhin ein Standortvorteil für eine Grossbank, sagte der 59-jährige Tessiner. Die Schweiz müsse aber aufpassen, dass sie nicht ins Hintertreffen gerate. «Unser Referenzpunkt muss der Finanzplatz London sein.» Schreibt BLICK.
Was er, der Motti, in diesem Interview absondert, darf der Rubrik «Realsatire» zugeordnet werden. Für den Abstieg des Schweizer Finanzplatzes haben die Bankster bis jetzt selbst gesorgt. Es war ja nicht «die Schweiz», die die UBS bei der letzten Finanzkrise beinahe in den Bankrott getrieben hat, sondern der glorreiche Oberbankster Marcel Ospel. «Die Schweiz» hat die UBS damals aber gerettet. Wie viele Strafmilliarden musste denn «die beste Bank der Schweiz» unter Ermotti allein an die USA bezahlen? Gegen diese Summe, mit der die AHV auf Jahrzehnte hätte saniert werden können, sind ja selbst die Boni der UBS-Bankster Almosen. Und bezüglich Regulierung und Vorschriften der Schweizer Banken durch die Regierung braucht sich Ermotti nun wirklich keine Sorgen zu machen. Die unzähligen Bank-Lobbyisten* aus dem Parlament geben sich im Hohen Haus in Bern die Türklinken in die Hand, wenn am Zürcher Paradeplatz auch nur gehüstelt wird.
* Ein Blick auf Lobbywatch gibt Auskunft. Sie werden staunen, wen Sie da so antreffen.

-
21.2.2020 - Tag der Spreizwürde
Nach Morden in Hanau: Klingbeil fordert Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat nach dem mutmasslich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert. Man müsse das klar benennen: «Da hat einer geschossen in Hanau, danach sieht es aus, aber es waren viele, die ihn munitioniert haben und da gehört die AfD definitiv mit dazu.» Die Partei habe das gesellschaftliche Klima in den letzten Monaten und Jahren vergiftet, sagte Klingbeil. «Es ist doch völlig klar, dass die AfD eine Partei ist, die beobachtet werden muss vom Verfassungsschutz.» Er sei dafür, dass das sehr schnell in den Sicherheitsorganen entschieden werde und dass es dazu komme. Schreibt die FAZ.
Die AfD ist eine unappetitliche Partei mit Protagonisten, die man ungestraft gemäss einem Gerichtsurteil «Faschisten» und «Nazis» nennen darf. Doch Klingbeils Instrumentalisierung eines furchtbaren Verbrechens für parteipolitische Zwecke ist nicht weniger unappetitlich und wird nicht nur den ermordeten Opfern nicht gerecht, sondern dürfte der AfD einmal mehr genau die Opferrolle bescheren, die sie wie keine andere Partei in Wählerstimmen umzusetzen vermag. Es gibt Gründe, weshalb sich diese widerlichen Parteien vom Schlage einer AfD in ganz Europa etablieren und in die Parlamente einziehen konnten. Diese Gründe sind bei den Altparteien und den verkommenen und abgehobenen Politeliten mit der unsäglichen Spreizwürde der Etablierten zu suchen. Darüber müsste Klingbeil zwingend nachdenken, bevor seine Partei in die völlige Bedeutungslosigkeit versinkt.
-
20.2.2020 - Tag der Cleverness
Ibiza-Ermittlungen: Ermittler decken Grossspenden an FPÖ-Vereine auf
Schon wieder eine Grossspende: Am 8. Mai 2018 war der blaue Nationalratsabgeordnete Markus Tschank wohl bester Stimmung. "Patria Austria hat €100 k erhalten!", schrieb er seinem damaligen Klubobmann Johann Gudenus per Whatsapp. "Top", antwortete dieser. Das ist nur einer von vielen Chats, die zeigen, wie intensiv sich FPÖ-Politiker mit einem Netzwerk an Vereinen beschäftigten, deren eigentlicher Zweck nach wie vor unklar ist. Ihre Existenz war nach dem berüchtigten Ibiza-Video publik geworden, in dem der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache davon sprach, dass man Spenden "vorbei am Rechnungshof" schleusen, also vor der Öffentlichkeit verstecken kann. Ermittler versuchen seit dem Erscheinen des Videos im Mai 2019, derartige Vereine zu finden, übrigens nicht nur bei der FPÖ. Dort wurde man aber rasch fündig: Mindestens vier verdächtige Vereine wurden identifiziert. Vorstandspositionen werden von demselben Kreis an Personen belegt, darunter auch von Markus Braun, Schwager der "blauen Glücksfee" Peter Sidlo, dessen Bestellung zum Casinos-Vorstand Politik und Justiz beschäftigt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Im Zentrum des Netzwerks dürfte der Verein Austria in Motion stehen. Markus Braun ist dort Obmann, die Rechtsanwälte Tschank, Peter Skolek und Alexander Landbauer waren hintereinander Kassier. Laut einem von Braun beauftragten Wirtschaftsprüfer hatte der Verein im Mai 2019 rund 340.000 Euro zur Verfügung. Spenden dafür haben laut Ermittlern beispielsweise Gudenus und Strache gekeilt. Laut Zeugen gab Gudenus an, der Verein unterstütze "Personen, denen es schlecht gehe", sowie "österreichische Traditionen und Werte". Die Ermittler sehen das anders. Sie denken, dass Austria in Motion genau wie Patria Austria, "Wirtschaft für Österreich" und das "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP) in "Absprache mit Heinz-Christian Strache bzw. Johann Gudenus" mit dem Vorsatz gegründet wurden, "finanzielle Zuwendungen für die FPÖ respektive Heinz-Christian Strache zu lukrieren". Schreibt DER STANDARD.
Das tönt nach einem grossen Skandal. Ist es aber nicht. Business as usual im österreichischen Parteiensumpf. Halt! Auf keinen Fall jetzt mit dem Zeigefinger auf Österreich zeigen: Läuft in der Schweiz in etwa ähnlich ab, allerdings etwas cleverer. Oder in Anlehnung an Forrest Gump: «Dumm ist, wer sich erwischen lässt.»
-
19.2.2020 - Tag des verlorenen Unrechtsbewusstsein
Wie sich der Genfer Fast-Bundesrat Pierre Maudet gegen die Publikation eines Interviews wehrt
Auch eineinhalb Jahre nach Bekanntwerden der Affäre um Pierre Maudet, ist der Genfer Magistrat noch im Amt und kämpft mit allen Mitteln um seine politische Zukunft. Dazu gehört auch, ein ihm unliebsames Interview zu verhindern, das CH Media mit ihm geführt hat. Das ist die Geschichte. Der Magistrat empfängt die beiden schreibenden Journalisten – die Politikchefin und den Romandie-Korrespondenten – in seinem grosszügigen Büro in der Genfer Altstadt, an einem Mittwoch. Er ist gut vorbereitet, hat sich Antworten notiert. Zwei Tage nach dem Interviewtermin, an einem Freitag, wird bekannt, dass Maudets politischer Verbündeter, FDP-Mitglied Simon Brandt, von der Polizei verhaftet wurde. Die Frage steht im Raum, ob Brandt Maudet vertrauliche Informationen weitergab. Am selben Tag erhält Maudet den Interviewtext zum Gegenlesen und er verspricht, bis am Montagmorgen seine Korrekturen zu schicken. Schreibt die AZ.
Es lohnt sich, die ganze Geschichte um das Interview der AZ mit Maudet zu lesen. Ein Sittengemälde par excellence. In einem Satz des nicht veröffentlichten Interviews betont der wendige FDP-Fast-Bundesrat, nicht die Medien sollen über ihn richten und dass es keine perfekten Politiker gebe. Da muss man dem unersättlichen Gierhals aus Genf tatsächlich zustimmen. Die perfekten Politiker gibt es nicht. Kann es auch gar nicht geben. Das ist und war schon immer eine Utopie. Zu unterschiedlich sind die Ansprüche und Erwartungen einer heterogenen Gesellschaft. Den perfekten Politiker verlangt aber auch niemand. Doch ein Minimum von Moral, Ethik und Anstand würde den hohen Damen und Herren aus der Politik nicht schaden. Diese tragenden Grundpfeiler jeder Demokratie sucht man speziell bei den jüngeren FDP-Politikerinnen und Politikern jedoch vergebens. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb FDP-Politiker vom Schlage eines Maudets jedwelches Unrechtsbewusstsein verloren haben. Der Fairness halber sei erwähnt, dass es die schwarzen Schafe vom Kaliber Maudets in jeder Partei gibt. Auch ein Christoph Mörgeli von der SVP schämte sich nicht, einerseits täglich über das Schweizer Parlament und den Staat als solches zu lamentieren und sich andererseits hemmungslos bei genau diesem Staat als Angestellter eines staatlichen Museums und Mitglied des Nationalrates finanziell zu bedienen und damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Auch der Mörgelis gibt es viele im ach so hohen Haus von Bern. Allerdings fällt auf, dass beinahe immer einer oder mehrere FDP-Granden an vorderster Front in Vorgänge verstrickt sind, die zum Himmel stinken. Siehe die neueste Affäre um die Krypto AG in Zug.
-
18.2.2020 Tag der Politfloskeln
Pass ab Geburt, weniger Arbeiten, Erbschaftssteuer: So wollen Wermuth und Meyer die Schweiz umkrempeln
Am Montag haben die SP-Papabili Cédric Wermuth und Mattea Meyer ihr Programm vorgestellt. Und das hat es in sich. Am Mittwoch endet die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von SP-Boss Christian Levrat (48). Dass sich noch jemand meldet, ist eher unwahrscheinlich. Das heisst: Am 5. April wird es zum Duell zwischen den beiden Tandems Cedric Wermuth (33)/Mattea Meyer (32) und Priska Seiler Graf (51)/Mathias Reynard (32) kommen. Und so langsam schälen sich die Unterschiede der Duos heraus. Während Seiler Graf und Reynard ihre Stärke in der persönlichen Breite des Tickets sehen (Unterwalliser und Zürcherin, junger Mann und ältere Frau, linker Gewerkschafter und moderate Exekutivpolitikerin), hat das Duo Meyer/Wermuth am Montag ein eigentliches Programm veröffentlicht. Unter dem Titel «Linker Aufbruch» kündigen sie an, wie sie die SP – und die Schweiz – verändern wollen.
Bürgerrecht: Den Schweizerpass soll es ab der Geburt geben. Wer hier geboren ist, soll automatisch Schweizer werden. So wie das in Frankreich der Fall ist. Wermuth und Meyer kündigen an, sich für das sogenannte «ius solis» einzusetzen, denn: «Wer hier lebt, gehört dazu.» Das wäre eine Abkehr von den traditionellen Einbürgerungsverfahren, zumindest für Secondos und Secondas.
Arbeit: Selbstverständlich kämpfen Meyer und Wermuth mit den Gewerkschaften für Mindestlöhne und eine 13. AHV-Rente. Und sie wollen die Digitalisierung nutzen, um «die Lohnarbeit sinnhafter zu machen». So wollen sie das Recht auf Bildung stärken. Aber – das eine alte Juso-Forderung – die Lohnarbeitszeit reduzieren.
Wohnen: Tiefere Mieten sollen über einen gesetzlichen Renditedeckel erreicht werden.
Gesundheitskosten: Wermuth und Meyer wollen die unter Levrat aufgegleiste Prämien-Initiative weiterverfolgen. Diese verlangt, dass ein Haushalt nur noch 10 Prozent seines Einkommens für Krankenkassenprämien ausgeben soll. Der Rest würde via Steuern finanziert.
Kinderbetreuung: Auch über Steuern sollen mehr Krippenplätze finanziert werden.
Steuern: Für Wermuth und Meyer ist klar: Arbeit und auch die Renten sollen steuerlich entlastet werden. Dafür wollen sie das Kapital stärker belasten. Das versucht derzeit die Juso mit ihrer 99-Prozent-Initiative, die verlangt, dass Dividenden und Zinserträge eineinhalbmal so stark besteuert werden wie Löhne. Zudem wollen sich Wermuth und Meyer für einen schweizweiten Mindeststeuersatz für Firmen einsetzen – und so den Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen eindämmen.
Klima: Bereits vor ein paar Wochen hat Meyer in einem Interview in der «Republik» den Masterplan für die Finanzierung der Klimapolitik vorgelegt: Klimapolitische Massnahmen sollen finanziert werden, indem man eine Erbschaftssteuer für Super-Reiche einführt.
Ob diese doch ziemlich unverbindlichen und etwas altbacken wirkenden Zukunftsvisionen mit den üblichen Politfloskeln reichen, einen neuen und glaubwürdigen Markenkern für die SP zu schaffen, ist mehr als fragwürdig. Das Thema «Digitalisierung», mit dem in der Zukunft so ziemlich alles in unserer Gesellschaft zusammenhängen wird, kommt nicht einmal vor. Zumal die SP ihre früher gefürchtete Kampagnenfähigkeit niemals zurückgewinnen wird, solange sie in der Regierung vertreten ist. So ist das nun mal lieber Cédric: Den Fünfer und das Weggli gibt es nicht. Glaubwürdige Erneuerung der guten alten Tante SP kann nur in der Opposition stattfinden.
-
17.2.2020 - Tag der Inkontinenz
Ab sofort gibts mehr Liebe, Sex und Dating
Der neue Kanal OneLove ist live: 20 Minuten bringt täglich Storys zu allen Themen rund um Liebe, Sex und Dating. Mehr Liebe, mehr Klartext: Ab dem 17. Februar 2020 thematisiert 20 Minuten online und im Print jeden Tag Themen rund um Beziehungen und Bauchkribbeln, LGBTQ+ und Body Positivity, Verhütung und sexuelle Gesundheit, Übergriffe und Sicherheit. Dazu wurde ein neues Ressort und der neue Kanal OneLove geschaffen. 20 Minuten kann dabei auf Experten zählen, die Wissenswertes zu Liebe, Sex und Dating vermitteln. Schreibt 20Minuten.
Wir wollen doch die neue Woche mit einer positiven Schlagzeile beginnen. 20Minuten lanciert, worauf die Welt bisher vergeblich gewartet hat. Frei nach Verona Feldbusch: Hier werden Sie geholfen. Von Impotenz über Inkontinenz bis hin zur richtigen Stellung – unser aller Pendlermagazin hat die richtigen Antworten auf Ihre Probleme.
-
16.2.2020 - Tag des Boulevard-Fernsehens
Erster digitaler Sender der Schweiz: Morgen legen wir los mit Blick TV
Blick TV läuft täglich von 6 Uhr bis 23 Uhr auf Blick.ch und in der Blick-App. Der Fokus liegt auf Breaking News, Sport und Unterhaltung. Blick TV läuft täglich von 6 Uhr bis 23 Uhr auf Blick.ch und in der Blick-App. Der Fokus liegt auf Breaking News, Sport und Unterhaltung. Blick TV sendet aus den zwei neuen, topmodernen Studios im Ringier Pressehaus in Zürich. Aktuell besteht das Kernteam von Blick TV aus 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. «Ringier hat den Mut, das Fernsehen zu erobern und fürs Internet neu zu erfinden. Ich freue mich riesig auf die Arbeit mit meinem kompetenten, kreativen und schlagkräftigen Team», sagt Jonas Projer, Chefredaktor von Blick TV. Im Viertelstunden-Rhythmus sendet das digitale TV Informationen zu Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung. Zu sehen ist das neue Angebot auf Blick.ch und in der Blick-App. Die mobile Version von Blick TV kann dank eines neuartigen Players sowohl im Hoch- als auch im Querformat geschaut werden. Alle Beiträge werden untertitelt, was die Smartphone-Nutzung unterwegs und den barrierefreien Zugang ermöglicht. Darüber hinaus werden die Userinnen und User auf Blick.ch deutlich mehr On-Demand Videos finden. Schreibt BLICK.
Qualitativ ist logischerweise vom Zürcher Dufourstrasse-Boulvard in Sachen TV rein gar nichts zu erwarten. Der übliche Sex-, Crime- und Unterhaltungsmüll. Dennoch muss man vor dem Zofinger Medien-Pionier Michael Ringier den Hut ziehen: Er schafft es immer wieder, das Ringier Imperium auch in Zeiten der digitalen Herausforderungen richtig zu positionieren. Ringier weiss, was seine Klientel verlangt. Und genau das liefert er. Die Welt besteht nun mal nicht nur aus Nobelpreisträgern. Chapeau Michael Ringier!
-
15.2.2020 - Tag der Schamlosigkeit
Entscheid zur Crypto-PUK muss warten: Plötzlich zaudert die FDP
FDP-Präsidentin Petra Gössi brachte als eine der ersten eine Crypto-PUK ins Spiel. Doch nun zögern ausgerechnet die Freisinnigen, ob sie eine Parlamentarische Untersuchungskommission überhaupt wollen. Sie war eine der ersten Politikerinnen, die sich nach der Aufdeckung der Crypto-Affäre zu Wort meldete. FDP-Präsidentin Petra Gössi (44) forderte umgehend eine politische Reaktion: «Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob eine PUK nötig ist», erklärte sie im «Tagesanzeiger». Die FDP prüfe gar, ob sie in der Frühlingssession selbst einen Antrag auf eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) stelle, so Gössi. «Das habe ich mit Fraktionschef Beat Walti und Vizepräsident Andrea Caroni so abgesprochen.» Es gehe nicht an, dass man erst im Sommer wisse, was Sache ist. Nur zwei Tage später scheint die FDP den Fuss wieder vom Gaspedal genommen zu haben. Gestern wollte das Büro des Nationalrates darüber entscheiden, ob eine PUK eingesetzt werden soll, um die Affäre um die Zuger Crypto AG zu beleuchten. Doch der Entscheid wurde auf Anfang März vertagt. «Das Büro will zuerst den Präsidenten der Geschäftsprüfungsdelegation anhören und auch dem Bundesrat sein Recht auf Anhörung gewähren», so Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (49, FDP). Dies sehe das Parlamentsgesetz so vor. Schreibt BLICK.
FDP-Politiker wollen lückenlose Aufklärung - oder doch nicht?
Die Empörung ist allenthalben gross. SP, Grüne, aber auch SVP-Doyen Christoph Blocher fordern eine PUK, eine Parlamentarische Untersuchungs-Kommission. FDP-Nationalrat Thierry Burkart forderte auf Twitter als einer der Ersten Konsequenzen. Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller pochte in der «Rundschau» auf eine «lückenlose Aufarbeitung» – der Bundesrat, speziell das VBS, sei gefragt. Der Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Ständerats sagt: «Wir können diese Berichte nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben.» Man müsse «Tempo Teufel Klarheit schaffen». FDP-Parteichefin Petra Gössi verkündete deshalb bereits am Dienstagabend gegenüber der TX Group, dass eine PUK eine «ernsthafte Option» sei. Womöglich reichen die Freisinnigen den Antrag in der Frühlingssession im März gleich selbst ein. Doch für den Freisinn verspricht die Untersuchung der Vorfälle um die Crypto-Affäre unangenehm zu werden, gibt SP-Generalsekretär Michael Sorg zu bedenken. Denn bei genauerem Hinsehen offenbart sich: die Protagonisten sind fast alle Mitglieder der FDP. Etwa der ehemalige FDP-Bundesrat Kaspar Villiger, erst Verteidigungs-, später Finanzminister. Er soll gewusst haben, dass die Zuger Firma von ausländischen Geheimdiensten kontrolliert wurde, habe aber geschwiegen. «Handlangerdienste für Drittstaaten, die den Ruf der Schweiz als verlässlich neutrales Land beschädigen können, hätte ich niemals gedeckt», dementiert dieser. Oder Georg Stucky, alt FDP-Nationalrat, ehemaliger Zuger Regierungsrat und Verwaltungsratsmitglied der Crypto AG. Gemäss CIA-Papier ist er vom CEO der Firma über die Spionage-Operationen informiert gewesen. Heute kann er sich daran jedoch nicht mehr erinnern, wie er sagt. Oder Peter Regli, damaliger Chef des militärischen Nachrichtendienstes und FDP-Mitglied. Er sagt nichts zu den Vorwürfen, seine Behörde sei informiert gewesen über die Vorgänge zwischen US- und deutschen Geheimdiensten in der Crypto AG. Oder der ehemalige Chef des Nachrichtendienstes, FDP-Mitglied Markus Seiler. Er ist heute Generalsekretär im Aussendepartement von FDP-Bundesrat Ignazio Cassis. Oder Rolf Schweiger, Zuger FDP-Ständerat zwischen 1999 und 2011 und kurzzeitig Präsident der FDP Schweiz. Auch er sass im Verwaltungsrat der Crypto AG. CH Media schreibt heute: «Die Crypto-Affäre könnte sich zu einer FDP-Affäre auswachsen.» Im Verwaltungsrat der Crypto AG seien zahlreiche Zuger Persönlichkeiten gesessen: «Anwälte an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, tief verankert in der FDP und dotiert mit zahlreichen Mandaten.» FDP-Chefin Gössi will die Crypto-Affäre gegenüber der «TX Group» nicht auf eine bestimmte Partei reduzieren. Die Verantwortung sei jeweils bei verschiedenen Bundesräten aus unterschiedlichen Parteien und Departementen gelegen. Ob die Beteuerungen der FDP-Verantwortungsträger stimmen, wird die Untersuchung zeigen. Der ehemalige deutsche Geheimdienstberater Bernd Schmidbauer ist in der «Rundschau» wenig überzeugt: «Ich hatte ja direkten Kontakt zur Spitze Schweizer Dienste und nehme an, dass sie nicht uninformiert waren.» Schreibt NAU.
Man kann wirklich nur noch staunen, was aus dieser ehemals staatstragenden und für die Schweiz so wichtigen Partei des Freisinns geworden ist. Wäre die Schweizer FDP in Italien unterwegs, würde man ohne Wimpernzucken von mafiösen Zuständen sprechen. In der Schweiz nennt man die «Mafia» jedoch «Connections». Tönt etwas unverbindlicher, kommt aber auf's Gleiche raus. Die Wendehälse der FDP-Neolippen, insbesondere die jüngeren Semester, die frei von jeglicher Moral und Ethik sind und sich schamlos dank ihren politischen Ämtern privat beim Staat bedienen, siehe Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, betätigen sich als Totengräber der Demokratie.
-
14.2.2020 - Valentinstag
Thiams letzter Auftritt: «Ich gehe mit reinem Gewissen»
Die Credit Suisse präsentierte an einer Medienkonferenz ihre Zahlen. Zugleich war es der letzte Auftritt des scheidenden Chefs Tidjane Thiam. Was bleibt, wenn der Vorhang fällt? Eine Credit Suisse, die nach dem Beschattungsskandal ihre Glaubwürdigkeit verloren hat – nicht bei den Investoren, aber in der öffentlichen Wahrnehmung. Was bleibt, ist ein geschasster Chef Tidjane Thiam (57), der an der gestrigen Medienkonferenz abermals betonte, dass die Bank, der er knapp fünf Jahre lang vorstand, fast alles richtig gemacht habe. Und ein neuer Chef, Thomas Gottstein (55), der den «Wachstumskurs» des Finanzinstituts weiter führen will und sich artig bei seinem Vorgänger, seinem «Freund», bedankte. Was bleibt, sind auch die nackten Fakten: Die Papiere der CS haben in der Ära Thiam gut 40 Prozent an Wert eingebüsst. Anderen europäischen Banken erging es indes nicht besser. Was bleibt, ist der von Thiam forcierte Ausbau der Vermögensverwaltung zulasten des Investmentbankings. Die anfänglich viel zu hoch gesteckten Ziele musste er nach unten anpassen. Das versprochene Wachstum kam nur in Ansätzen. Doch die Bank hat die Kosten gesenkt und steht kapitalmässig wieder solide da. Und so geizte Thiam nicht mit Eigenlob: «Ich bin unheimlich stolz darauf, was die Credit Suisse während meiner Zeit bei der Bank erreicht hat.» Nämlich: Kosten gesenkt, Gewinn gesteigert, Kapitalbasis gestärkt, neue Gelder angezogen und Geld den Aktionären ausgeschüttet. Besonders stolz ist Thiam, dass die verwalteten Vermögen auf rund 1,5 Billionen Franken gestiegen sind. Schreibt BLICK.
Das ist doch endlich mal eine positive Nachricht: Ein Bankster geht mit reinem Gewissen. Und einem prall gefüllten Portemonnaie. Kann nicht jeder von sich behaupten.
-
13.2.2020 - Tag des Freisinns
Neue Dokumente belasten ehemaliges FDP-Spitzenpersonal: Was wusste Alt-Bundesrat Kaspar Villiger?
Die Affäre um die Crypto AG weitet sich aus: Wer wusste was über die Spionageoperation? Alt-Bundesrat Kaspar Villiger wehrt sich gegen Vorwürfe. Es ist ein Schlüsselsatz. Im Jahr 1994 erklärte ein ehemaliger Kadermann der Crypto AG in der Sendung «Rundschau» des Schweizer Fernsehens: «Ich weiss, dass deutsche und amerikanische Geheimdienste Crypto-Geräte so manipulierten, dass sie für diese Dienste abhörbar wurden.» 26 Jahre ist es her, seit P. F. diesen Satz in aller Öffentlichkeit sagte. In einem Land, das die Neutralität zu seinen wichtigsten Werten zählt, blieb er ohne Konsequenzen. Weshalb? P. F. äusserte sich nur anonym, er hatte Angst. «Es wäre lebensgefährlich», sagte er zu Frank Garbely, dem Autor des damaligen Fernsehbeitrages. Ebenso fehlte das Interesse an einer Aufklärung seitens der Behörden. 1977 hatte die Crypto den Ingenieur P. F. entlassen. Der amerikanische Geheimdienst NSA hatte sich beim Crypto-Chef Heinz Wagner beschwert, dass diplomatische Depeschen aus Syrien nicht mehr lesbar waren. P. F. war zuvor mehrmals nach Damaskus gereist, um die Schwächen der syrischen Kryptogeräte zu beheben. In den Papieren der CIA heisst es: «P. F. hatte das Rubikon-Geheimnis herausgefunden, und es war bei ihm nicht sicher.» P. F. lebt noch, will sich aber nicht äussern. Garbely hat mehrere Gespräche mit ihm geführt. Der Journalist sagt dieser Zeitung: «P. F. war ein hoher Offizier beim Nachrichtendienst. Er war der Chiffrierexperte.» Nach seinem Weggang meldete er seinen Verdacht dem Verteidigungsdepartement (damals EMD) und einem befreundeten Offizier. Dieser schaltete die Bundesanwaltschaft ein, P. F. wurde mehrfach angehört, doch die Übung wurde später abgebrochen. Der zuständige Ermittler der Bundesanwaltschaft liess P. F. wissen: «Mein Chef hat mich zurückgepfiffen.» 1994 kam es zu einer zweiten Untersuchung durch die Bundesanwaltschaft, auch diese wurde eingestellt. Gemäss dem CIA-Bericht, aus dem die «Rundschau» zitiert, halfen Mitwisser des Schweizer Nachrichtendienstes aktiv mit, die Untersuchungen gegen die Crypto AG abzuwenden.
Garbely sagt, P. F. habe immer gehofft, dass die Wahrheit ans Licht komme, zum Beispiel im Zuge der Fichenaffäre. Doch: «Die Fichen von P. F. waren gesäubert, kein Wort über die Crypto AG.» Zudem seien wenigstens zwei Schlüsseldossiers der Bundesanwaltschaft zur Crypto verschwunden: «Man kennt die Signaturen, doch die Dossiers sind unauffindbar», sagt Crypto-Kenner Garbely. Nach seinen Informationen hätten mindestens ein halbes Dutzend Offiziere des Nachrichtendiensts gewusst, dass die Crypto AG Chiffriergeräte manipulierte und die Neutralität der Schweiz massiv verletzte. Die blockfreien Staaten kauften ihr Material nämlich deshalb in Zug ein, weil sie der neutralen Schweiz vertraut hatten. Für Garbely ist offensichtlich, dass die Schweizer Behörden inklusive dem Bundesrat über die Verbindungen zwischen der Crypto AG und dem amerikanischen und deutschen Nachrichtendienst Bescheid gewusst hatten. Zu diesem Schluss kommen auch die nun publik gewordenen Recherchen. Besonders pikant: Nach Informationen der «Rundschau» hatte der damalige Verteidigungsminister Kaspar Villiger (FDP) Kenntnisse darüber, dass die Crypto den beiden Geheimdiensten gehörte. Ebenso über die Operation Rubikon. Trotz moralischer Bedenken habe der FDP-Bundesrat die Sache unter den Tisch gewischt: «Villiger wusste, wem das Unternehmen gehörte und fühlte sich moralisch verpflichtet, dies offenzulegen», heisst es im CIA-Papier. Doch Villiger habe nichts unternommen: «Offensichtlich hat Villiger den Mund gehalten.» Die Crypto-Affäre könnte sich zu einer FDP-Affäre auswachsen. Im Verwaltungsrat der Crypto AG sassen Zuger Persönlichkeiten ähnlichen Zuschnitts: Anwälte an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, tief verankert in der FDP und dotiert mit zahlreichen Mandaten. Besonders hervorgetan hat sich Georg Stucky, eine wirkungsmächtige Figur im Kanton. Schreibt die AZ.
Die Crypto-Affäre und ihr freisinniger Anstrich. Ob Sex mit kleinen Buben in Thailand oder sonstige Mauscheleien, bei denen es etwas zu holen gibt, sei es Sex oder Geld: Die «liberale» Partei des hässlichen Neoliberalismus ist immer irgendwie mit einem ihrer honorigen Granden verstrickt, wenn's zu stinken anfängt. Wen wundert's, dass diese feinen Damen und Herren der «Mitte», wie die FDP ihre politische Heimat bezeichnet, auffallend oft aus dem Kanton Zug stammen?

-
12.2.2020 - Tag der Sippenhaftung
Syrer (15) attackiert schwulen FDP-Banker – Hans-Peter Portmann will ganze Familie ausschaffen und fordert «Sippenhaftung»
Ein 15-jähriger Syrer soll im Zürcher Niederdorf Schwule mit einem Messer angegriffen haben. FDP-Nationalrat Portmann fordert die Ausschaffung der ganzen Familie des Syrers, sollte diese ihr Gastrecht missbraucht und Integrationspflichten nicht erfüllt haben. Am Wochenende kam es im Zürcher Niederdorf zu einem Messerangriff auf Schwule. Die Polizei verhaftete einen tatverdächtigen 15-jährigen Flüchtling aus Syrien. Der schwule Banker und FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann (56) stellte am Dienstag auf Twitter eine umstrittene «Null-Toleranz bei Hate-Crime»-Forderung. Der Zürcher Nationalrat will, dass die ganze Familie des jungen Syrers ausgeschafft wird, sollte diese ihre Integrationspflichten verletzt haben. Schreibt BLICK.
Die FDP und ihre verklemmten schwulen Parteimitglieder, ob geoutet oder ungeoutet: So richtig liberal scheinen sie gegenüber bösen Buben nur in Thailand zu sein. In der Schweiz predigen sie stramme Law & Order-Floskeln.
-
11.2.2020 - Tag der Phrasendrescher
Wieder Mauschelei bei Green Cross: Martin Bäumle schliesst heimlichen Deal mit beschuldigter Ex-Chefin
Green-Cross-Präsident Martin Bäumle machte die Ex-Direktorin für das Finanzdebakel der Organisation verantwortlich. Doch nun hat er heimlich die Strafanzeige gegen Nathalie Gysi zurückgezogen. Bereits 2018 hat er Finanzprobleme über Monate verschwiegen. Die Vorwürfe, die Green-Cross-Schweiz-Präsident Martin Bäumle (55) gegen seine Ex-Geschäftsführerin Nathalie Gysi (49) erhoben hatte, waren massiv. Sie habe die Bilanz und Erfolgsrechnung gefälscht, sagte der Zürcher GLP-Nationalrat, als er letzten April erstmals über die prekäre Finanzlage der Umweltorganisation informierte. Er musste eingestehen, dass er erst im August 2018 realisierte, dass die Liquidität der Stiftung weitaus geringer war, als von Gysi kommuniziert. Dies obwohl sich die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin bereits seit dem Vorjahr immer mehr verschlechtert hätte. Darauf entliess er sie umgehend. Wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung reichte der Stiftungsrat Ende 2018 gegen Gysi eine Strafanzeige ein. Aber Bäumle verschwieg der Öffentlichkeit und den Spendern über Monate, dass Green Cross Schweiz vor dem Konkurs stand. Erst als BLICK und andere Medien Dokumente zugespielt erhielten und im letzten April über die finanzielle Schieflage berichteten, machte der Green-Cross-Chef die Finanzsituation transparent. Obwohl beim grossen Reinemachen keine 200'000 Franken mehr in der Kasse waren, sagte er damals, er wolle das Vertrauen der Spender wieder zurückzugewinnen, indem Green Cross Schweiz «alles transparent macht und den grossen Einsatz aufzeigt, um die Organisation zu retten». Nun entdeckte BLICK auf der Green-Cross-Webseite eine dürre Mitteilung, wonach Green Cross Schweiz und Gysi ihre Differenzen beigelegt hätten. Weiter: «In der Folge ist Green Cross Schweiz an der Fortführung eines Strafverfahrens wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung nicht mehr interessiert und hat eine Desinteresseerklärung abgegeben.» Schreibt BLICK.
Wer von diesem unsäglichen Phrasendrescher Bäumle etwas anderes als Trickserei und Mauschelei erwartet hat, ist schlicht und einfach nur noch naiv. Politiker dieses Typus sind ein weiterer Grund für die Politikverdrossenheit, die letztendlich zu Wahlbeteiligungen von 40 Prozent (im besten Fall) führt. Es ist ja nicht so, dass man diesen Hohepriestern der Mauschelei, die zu Totengräbern der Demokratie verkommen sind, nichts zutraut. Das verheerende Verdikt in der öffentlichen Wahrnehmung dieser grandiosen Eliten jenseits jeglicher Moral und Ethik offenbart das pure Gegenteil: Dass man ihnen eben alles zutraut.
-
10.2.2020 - Tag nach der Wahl
Kein einig Volk von Mietern
Stadt-Land-Graben bei der Mietwohnungs-Initiative – und ein «Rösti»-Graben beim Anti-Diskriminierungsgesetz. Klares Ja zum Anti-Diskriminierungsgesetz und eine deutliche Absage an die Mietwohnungsinitiative: Der erste Abstimmungssonntag des Jahres verlief ohne Überraschungen. Trotzdem entwickelte sich eine hitzige Diskussion. Zu reden gab vor allem die Mietwohnungs-Initiative. Denn diese, waren sich die Parteichefs einig, traf einen Nerv in der Bevölkerung. Zumindest in den grossen Städten. SP-Vizepräsident Beat Jans kritisierte die Bürgerlichen scharf. Diese ignorierten das wichtigste Problem des Mittelstandes, nämlich die exorbitanten Mieten in den Städten. «Das Problem ist gewaltig. Es brennt.» Schreibt SRF.
Tja, so kommt's dann halt, wenn 41 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung abstimmen und 59 Prozent der Wahlurne fernbleiben. Amerikanische Verhältnisse. Oder wie die Amis zu sagen pflegen: «40 Prozent der US-Bevölkerung wählen den amerikanischen Präsidenten und 60 Prozent wundern sich nachher darüber, welches Arschloch gewählt wurde». (Anmerkungen: Gemäss Schätzungen lag die Wahlbeteiligung bei der Wahl des Präsidenten Donald Trump am 8. November 2016 bei 60,2 Prozent.)
-
9.2.2020 - Tag der Faschisten
Machtspiele in Erfurt: Schachmatt
Von der Finte der Thüringer AfD wollen CDU und FDP überrascht gewesen sein. Dabei sagt die AfD, ihr sei geholfen worden. Und dann war Thomas Kemmerich plötzlich Ministerpräsident von Thüringen. Wirklich so plötzlich? „Kemmerich stand im Schach“, sagt einer von der AfD im Rückblick. Tatsächlich hatten die Fraktionen diesen Wahltag vorher durchgespielt. Es ging um Züge des Gegners und darum, was die Verfassung als Konter zulässt. Eigentlich aber ging es um die Macht. Auch die CDU machte einen Plan. Zunächst in der Fraktion, die traf sich am Montag. Am Dienstag saß sie dann mit dem Landesvorstand zusammen. Es lag Spannung in der Luft. Denn die Fraktion war sich keineswegs einig darüber, wie sie zur AfD stand. Zwar gab es einen Beschluss der Bundespartei. Der lautete: keine Zusammenarbeit. Das konnte man allerdings so oder so auslegen. Die strengste Auslegung: in keiner Weise am gleichen Strang ziehen. Die lockerste: keine Koalition. Für einige Thüringer CDU-Leute war klar, dass sie sich an die strenge Auslegung halten wollten. Andere bevorzugten die lockere. Im Herbst war der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, Michael Heym, sogar noch weiter vorgeprescht. Er hatte mit Blick auf das Wahlergebnis der AfD gesagt: „Man tut der Demokratie keinen Gefallen, wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt.“ Sollte heißen: AfD einbeziehen. Kurz darauf kursierte ein Brief, in dem 17 CDU-Politiker aus Thüringen „ergebnisoffene“ Gespräche auch mit der AfD forderten. Auch ein weiterer Landtagsabgeordneter zählte zu den Unterzeichnern. Schreibt die FAZ.
Spannender Artikel der FAZ. Einmal mehr bewahrheitet sich Otto von Bismarcks Zitat «Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd». Erschreckend ist die Tatsache, wie die «bürgerlichen» Eliten für den eigenen Machterhalt sogar mit Faschisten paktieren. Viele Menschen fragen sich nun, ob mit der AFD und dem Faschisten* Bernd Björn Höcke ER, der GRÖFAZ, wieder da ist? Nein! Hitler war gar nie weg. Zumindest nicht in den Köpfen sehr vieler «bürgerlicher» Menschen, die sich mit dem Argument «es war ja nicht alles schlecht» selbst befriedigen. Die AfD ist kein Produkt von ein paar rechtsextremen Spinnern. Sie kommt aus der vielzitierten «Mitte der Gesellschaft». Wer das nicht akzeptieren will, soll sich mal die Liste der AfD-Bundestagsabgeordneten und deren Berufe und akademischen Titel zu Gemüte führen. Ebenso lohnt sich für alle Zweifler eine Recherche, wie viele AfD-Mitglieder denn von der FDP und CDU/CSU zur Faschistenpartei übergelaufen sind. Wohlwissend, dass sie mit einem Wolf im Schafspelz paktieren.

-
8.2.2020 - Tag der Psychopathen
Rache nach dem Freispruch: Trump feuert zwei wichtige Impeachment-Zeugen
Das Amtsenthebungsverfahren ist gelaufen – doch Donald Trump scheint noch Rechnungen offen zu haben. Mit Gordon Sondland und Alexander Vindman entliess er zwei Zeugen, die ihn schwer belastet hatten. Donald Trumps erste Stellungnahme nach dem Freispruch im Impeachment-Verfahren war eine Abrechnung mit dem politischen Gegner und den wenigen Kritikern in den eigenen Reihen gewesen. Den harten Worten lässt der US-Präsident nun Taten folgen. Zwei Schlüsselzeugen, die während der Impeachment-Ermittlungen gegen ihn ausgesagt hatten, wurden am Freitag (Ortszeit) von ihren Aufgaben entbunden. Er verbannte den Oberstleutnant und Ukraine-Experten Alexander Vindman aus dem Weissen Haus, wo dieser als Berater des Nationalen Sicherheitsrates tätig war. Kurz darauf sagte der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, mehreren US-Medien, ihm sei mitgeteilt worden, dass der Präsident ihn mit sofortiger Wirkung als Botschafter abberufen wolle. Schreibt DER SPIEGEL.
Diese Reaktion von The Donald war zu erwarten. Sie erinnert irgendwie an den triebgesteuerten Psychopathen aus dem legendären Film «M - eine Stadt sucht einen Mörder» von Fritz Lang aus dem Jahre 1931, der in einer Filmszene vor sich hin brabbelt: «Kann nicht. Muss!»

-
7.2.2020 - Tag der Druckereischliessungen
Limmatdruck AG steht vor Schliessung wegen «schlechter Performance» – 150 Mitarbeiter betroffen
Die Meldung, welche die Redaktion am Donnerstagmorgen erreichte, war in perfektem Manager-Deutsch verfasst: «Um den Anforderungen des Marktes an höchste Effizienz und Exzellenz in einem hochkompetitiven Umfeld gerecht zu werden, hinterfragt die AR Packaging kontinuierlich die operative Ausrichtung der Unternehmensgruppe.» Oft lassen solcherlei Sätze nichts Gutes erahnen. Das ist vorliegend nicht anders. Denn wenig später heisst es: «Die Performance am Standort Spreitenbach ist seit einiger Zeit hinter den Erwartungen zurück geblieben, daher ist die Option, einen substanziellen Teil der Produktion von der Limmatdruck/ Zeiler AG zu verlagern, ernsthaft in Betracht zu ziehen.» Das mögliche Aus der Limmatdruck/Zeiler AG wäre gleichbedeutend mit dem Ende einer 43-jährigen Spreitenbacher Firmengeschichte. Die Limmatdruck AG hat ihre Wurzeln in der Druckereiabteilung des Migros-Genossenschafts-Bundes und wurde 1945 als Genossenschaft zur Limmat gegründet. Gleichzeitig mit der Umbenennung in Limmatdruck AG bezog die Druckerei 1977 in Spreitenbach einen Neubau . Wichtigster Auftrag war damals der Druck der Wochenzeitung «Wir Brückenbauer» (heute Migros-Magazin). Im Jahre 2000 wurde die bernische Zeiler AG, ein Familienunternehmen, übernommen, das erfolgreich in den Bereichen Verpackungen und Verpackungstechnik tätig war, und man konzentrierte sich fortan auf das Geschäft mit hochwertigen Verpackungen. 2011 übernahm die deutsche RLC Packaging Group das Unternehmen und konzentrierte die Firma auf die beiden Standorte Spreitenbach und Köniz BE. 2018 wurde der Standort in Köniz geschlossen. Im November 2019 wiederum übernahm die schwedische AR Packaging Holding die deutsche RLC Packaging (und somit auch die Limmatdruck AG) sowie die K+D AG mit Sitz in St. Gallen. Insgesamt umfasste die Akquisition neun Werke, die zusammen einen Umsatz von knapp 300 Millionen Franken erwirtschafteten. Nur zwei Monate später steht nun also fest, dass die Limmatdruck/Zeiler AG in Spreitenbach mit grosser Wahrscheinlichkeit geschlossen wird. Dazu heisst es in der Medienmitteilung: «Erste Analysen im Rahmen der Integration der neuen Unternehmen haben einen klaren Handlungsbedarf im Hinblick auf die Situation in der Schweiz aufgezeigt; ein denkbares Szenario wäre der Ausbau und die Fokussierung der Produktion auf den Standort von K+D in St. Gallen.» Harald Schulz, CEO von AR Packaging, schreibt dazu: «Wir sind überzeugt, dass es möglich ist, auch in Hochkostenländern wie der Schweiz erfolgreich zu produzieren, sofern eine höchst effiziente Infrastruktur vorhanden ist.» Doch genau das sei leider in Spreitenbach nicht der Fall. «Die Performance am Standort Spreitenbach ist seit einiger Zeit hinter den Erwartungen zurück geblieben, daher ist die Option, einen substanziellen Teil der Produktion von der Limmatdruck/Zeiler AG zur K+D AG zu verlagern, ernsthaft in Betracht zu ziehen.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Die «veraltete Infrastruktur» - sprich Maschinenpark – ist ein vorgeschobener Grund. Eine Infrastruktur kann man mit entsprechenden Investitionen erneuern. Dazu muss aber das Marktumfeld stimmen. Hier liegt der Hase begraben. Die grossen Druckaufträge wie Zeitungen, Prospekte und Kataloge fehlen im Zeitalter der Digitalisierung schlicht und einfach. Das musste selbst Michael Ringier schmerzhaft erfahren, als er für die ehemals «modernste Druckerei Europas» den Stecker zog: «Ringier Adligenswil» mit 172 Mitarbeitern wurde im November 2017 binnen Tagen geschlossen. Das tut weh, ist aber als Folge des veränderten Umfeldes nicht aufzuhalten. Die Digitalisierung steht erst am Anfang und wird noch viele Betriebe schlucken.
-
6.2.2020 - Humbelday
Rentenreform: Ruth Humbel greift Arbeitgeberverband an
Neue Präsidentin der Sozialkommission gibt Kompromiss von Gewerkschaften und Arbeitgebern geringe Chancen. Eine zügige Reform der zweiten Säule der Altersvorsorge wird immer unwahrscheinlicher. Die neue Präsidentin der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) bezeichnet die Erfolgsaussichten des in der Vernehmlassung stehenden Kompromissvorschlags der Sozialpartner als gering. «Wenn am Ende nur die Gewerkschaften, die linken Parteien und die Spitze des Arbeitgeberverbandes dahinter stehen, hat der Vorschlag keine Chance», sagt die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Der Arbeitgeberverband habe im vergangenen Sommer offenbar einer Lösung zugestimmt, die von den eigenen Mitgliederverbänden nicht mitgetragen werde. «Detailhandel, Baumeister, Banken, die Pharma – alle haben sich abgewendet und schlagen ein eigenes Modell vor. Wer steht eigentlich noch hinter dem Kompromiss?» Humbel ist nicht gut zu sprechen auf den Arbeitgeberverband. Sie sagt, dieselben Verbandsexponenten, die bei der Volksabstimmung zur Altersvorsorge 2020 vor drei Jahren eine Erhöhung der AHV-Rente um monatlich 70 Franken «mit unglaublicher Vehemenz» bekämpft hätten, forderten nun im Rahmen des sozialpartnerschaftlichen Kompromisses einen umlagefinanzierten 200-Franken-Zuschlag in der zweiten Säule. Das sei «unglaubwürdig und irritierend». Schreibt die Aargauer Zeitung.
Ruth Humbel? Ist das nicht die furchtbare Neolippe von der CVP Aargau, die bei den Wahlen 2019 mit ihren Worten «Man verdient sich keine goldene Nase mit Mandaten im Gesundheitsbereich» für eines der dümmsten Zitate des Jahrhunderts sorgte? Es darf angenommen werden, dass sich die gute Frau aus dem Aargau mit Lobby-Mandaten aus Wirtschaft und Industrie eine zumindest silberne Nase verdient. Wenn nicht, würde sie etwas falsch machen und bräuchte dringend Nachhilfe beim Luzerner Ständerat Damian Müller.
-
5.2.2020 - Tag der undankbaren Berufe
Das sind die undankbarsten Berufe
Viele Menschen quälen sich täglich durch den Arbeitsalltag: Anerkennung kommt nur selten und der Lohn könnte auch höher sein. Eine Studie zeigt nun, welches die undankbarsten Jobs in Deutschland sind. Schreibt Blick.
Dürfte in der Schweiz ziemlich ähnlich sein.
-
4.2.2020 - Tag der MIGROS
Milliarden-Deal jetzt offiziell: Benko und Thai Central kaufen Globus für über eine Milliarde
Die Migros verkauft Globus und verschiedene Immobilien an die thailändische Central Group und deren österreichischen Partner Signa-Gruppe. Diese kauften das Unternehmen zu gleichen Teilen, wie die Central Group aus Bangkok am Dienstag mitteilte. Der Kaufpreis betrage mehr als eine Milliarde Franken. Schreibt BLICK
Und wer kauft MANOR? Dürfte der nächste Kandidat sein.
-
3.2.2020 - Tag der Personenfreizügigkeit
Ein Dorf wehrt sich: Kanton Bern will Transitplatz für Fahrende bauen – Widerstand ist gross
Schweizweit fehlen Plätze für Jenische, Sinti und Roma. Wie schwierig die Suche nach Standorten ist, zeigt sich gerade im Kanton Bern. Es gibt weder Post noch Laden in Wileroltigen. Dafür grosse Bauernhäuser, viel Platz, viel Grün, und vor allem: viel Ruhe. Ein Stück heile Welt, sagt Armin Mürner, «aber leider nur noch auf der einen Seite des Dorfes». Auf der anderen Seite ist die Welt für ihn nicht mehr in Ordnung. Denn dort soll ein Transitplatz für ausländische Fahrende entstehen. Die Berner Regierung hat das 370-Einwohner-Dorf Wileroltigen nach langer Suche ausgewählt; am Sonntag stimmt der Kanton Bern darüber ab. Der Transitplatz soll bei einem Rastplatz an der Autobahn Bern – Murten entstehen, ein Kilometer vom Dorf entfernt. Armin Mürner, gelernter Metzger und ehemaliger Seemann, kämpft an vorderster Front dagegen. Der parteilose 72-Jährige erzählt von den schlechten Erfahrungen, die das Dorf schon gemacht hat. Im Sommer 2017 hatten rund 500 ausländische Fahrende während Wochen neben dem Rastplatz Halt gemacht – und landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Armin Mürner betont, er sei nicht gegen Fahrende. Er sagt es präventiv, noch bevor eine Frage in diese Richtung zielt. «Es geht um die Gleichstellung», sagt er. «Wenn Fahrende Farbe einfach das Loch runterlassen, zahlt der Kanton nachher das Auspumpen. Wenn ein hiesiger Maler dasselbe macht, wird er gebüsst», ärgert er sich. Die Behörden trauten sich nicht, bei den Fahrenden durchzugreifen, weil es sich um eine Minderheit handelt, glaubt er. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Ohne bestehende Vorurteile zu unterstützen oder gar neue aufzubauen: Man kann den Widerstand begreifen. Ein Blick in die täglichen «Blaulicht»-Meldungen über Diebstähle und Trickbetrügereien der Schweizer Polizei zeigt ein erschreckendes Bild aus der obgenannten Gruppe der Jenischen, Sintis und Romas, die durch die Schweiz ziehen. Meistens, und das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, sind Menschen aus dieser Gruppe, vorwiegend aus Rumänien, in diese Alltagskriminalität verwickelt. Das kostet jedes Mal ein Stückchen Lebensqualität, vor allem für die älteren Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, die in der Regel von diesen Trickbetrügereien und Diebstählen betroffen sind. Hinzu kommt die Lachnummer in beinahe jeder Medienmitteilung der zuständigen Kantonspolizei, dass der / die Festgenommene mit einer Landesverweisung und einer Einreisesperre von fünf Jahren ausgewiesen worden sei. Dass die gleichen Leute zwei oder drei Wochen später wieder in der Schweiz auftauchen, wird Ihnen jeder Polizist bestätigen. Mit dieser zügellosen Personenfreizügigkeit wurde ein Monster geschaffen, das nicht mehr beherrschbar ist und auch bei den Polizisten nur noch Frust hervorruft.
-
2.2.2020 - Tag der Auswanderer
Immer mehr Menschen zieht es ins Ausland – das hat auch politische Folgen: Schweizer wandern in Scharen aus
Die Schweizer zieht es weg: nach Frankreich, Deutschland und in die USA. Aber auch nach Australien oder Thailand. In den letzten Jahren hat die Anzahl Schweizer, die ihre Heimat verlassen, deutlich zugenommen. Gleichzeitig sind weniger Auslandschweizer zurückgekehrt. Das Resultat: Auf 24'000 Rückkehrer kamen 2017 und 2018 rund 32'000 Auswanderer (für 2019 sind noch keine Zahlen erhältlich). Unter dem Strich zählt das Land damit 8000 Schweizer weniger. Schlüsselt man die Zahlen auf, so zeigt sich: 36 Prozent aller Auswanderer sind zwischen 20 und 35 Jahren alt. Damit sind es überdurchschnittlich oft Junge, die ihre Koffer packen. Bei ihnen stehen laut Michael Siegenthaler, Arbeitsmarktexperte bei der ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF), die Aufnahme eines Studiums oder der Antritt einer Stelle im Vordergrund. Bei einer zweiten Gruppe handelt es sich um frühere Einwanderer, die nun als Doppelbürger in ihre Heimat zurückkehren: Italiener oder Portugiesen etwa. Die dritte Gruppe machen die Älteren aus, insbesondere die 64- und 65-Jährigen – also die Rentner. Schreibt SonntagsBlick.
Keine Bange! Wir werden die 10-Millionen-Hürde dennoch schaffen. Vermutlich schneller als uns lieb ist. Der Sultan vom Bosporus braucht nur die Schleusen zu öffnen und schon ist es passiert. Ob das gut oder schlecht ist? Darüber scheiden sich die Geister.
-
1.2.2020 -Tag des SVP-Präsidenten
Harzige Suche nach neuem SVP-Präsidenten: Franz Grüter steht nur als Vize bereit
Die SVP Luzern sieht ihren Nationalrat Franz Grüter an der Spitze der SVP Schweiz – und hat ihn bei der Findungskommission nominiert. Dieser will jedoch maximal Vizepräsident werden. Auch eine weitere Frau sagt ab. Am Dienstag hatte die Zürcher SVP-Parteileitung Nationalrat Alfred Heer (58) als Bewerber auf das Amt des SVP-Präsidenten bei der Findungskommission angemeldet. Heer habe die SVP des Kantons Zürich während sieben Jahren sehr erfolgreich geführt. Sein Leistungsausweis lasse sich sehen, während Heers Präsidium sei die Kantonalpartei bestens aufgestellt gewesen. Nun zieht die SVP Luzern nach: Sie schlägt Nationalrat Franz Grüter (56) offiziell als Nachfolger von Noch-Präsident Albert Rösti (52) vor. Grüter selber aber stellt erneut klar, dass er aus beruflichen Gründen nicht als Präsident zur Verfügung stehe. «Das geht einfach nicht.» Schreibt BLICK.
Schade, kann man da nur sagen. Und dies ist keineswegs als Pflege des Kantönligeistes zu verstehen. Nein, Grüter wäre genau der Mann, der mit seiner ruhigen, bedachten und dennoch bestimmten Art und seinen unbestrittenen Kenntnissen und Kontakten aus dem IT-Bereich die SVP – und mit ihr die Schweiz – in die digitale Zukunft führen könnte. Aber man wünscht sich ja bei der SVP einen Polterer, egal ob's dann ein Dummschwätzer aus der geistig intellektuellen Ödnis eines Glarner Zigerkrapfens ist. Da verstehen einige alte Granden aus der Parteispitze längst nicht mehr, um was es geht. Nämlich um die Zukunft der Schweiz im Wandel der Zeit, bei dem die SVP eine wichtige Rolle spielen könnte. Und so verwundert einen die meistgehörte Antwort auf die Frage «was halten Sie von Franz Grüter?» auch nicht sonderlich: «Franz Grüter? Ein guter Mann, aber in der falschen Partei.» Welch unüberlegtes Statement! Ein guter Mann kann in jeder Partei etwas bewegen. Bewegung würde der good old Bauernpartei und den verkrusteten Ansichten der Partei-Oldtimer gewiss nicht schaden. Aber so ist es halt, wenn man die Alten nicht ins Stöckli schicken kann, weil sie noch immer die Kampagnen bezahlen. Wie sagt der Volksmund so schön? Wer bezahlt befiehlt.
-
31.1.2020 - Tag der Feigenblätter
Ex-GLP-Politiker Eric von Schulthess (60) verkauft Safari-Reisen mit Abschussgarantie: Ein toter Leopard kostet 5000 Euro extra
Bis Sonntag findet in Deutschland die grösste Jagdmesse Europas statt. Anbieter aus aller Welt verkaufen Dienstleistungen und Produkte – darunter auch Jagdreisen. Tierschützer sind empört. Einer der Anbieter kommt aus der Schweiz und berichtet offen über seine Safaris. In Dortmund findet derzeit die grösste Jagdmesse Europas statt – die «Jagd und Hund». Zu finden gibt es alles, was das Jägerherz begehrt. Bekleidung, Waffen, Zubehör. Dazu Angebote für sogenannte Trophäenreisen – samt Preislisten. Der Abschuss eines Löwen kostet rund 36'400 Euro, ein Elefant ist für 27'300 Euro zu haben. Über 100 Veranstalter buhlen um die schiesswütige Kundschaft. Zu einem Reporter der «Bild»-Zeitung sagt einer der Anbieter: «Du musst halt schiessen können und bezahlen. Wir fahren bei Leoparden auf 30 Meter ran, schiessen dem Tier erst in die Beine, du kannst es dann erlegen.» Unter den Anbietern findet sich auch eine Firma aus der Schweiz: Capra Adventures aus Grenchen SO. Inhaber: Eric von Schulthess (60), Ex-Präsident der GLP Grenchen. Er weiss, dass die Jagdreisen polarisieren. Trotzdem sieht er nichts Falsches darin. Solche Reisen seien sehr streng reglementiert. «Unseriöse Anbieter haben in diesem Geschäft keine Chance», sagt er zu BLICK. Und: «Der Erlös solcher Lizenzen kommt auch dem Artenschutz zugute. Auch regionale Schulen und Spitäler profitieren davon finanziell sowie vom Fleisch.»
Da fehlen einem die Worte. Das Feigenblatt «Artenschutz» als Rechtfertigung zu verwenden, zeigt wessen Geistes Kind GLP-Politiker von Schulthess ist. Allerdings braucht es immer zwei «to Tango»: Einen Anbieter und einen Konsumenten. Wer die widerwärtigere Person der Beiden ist, sei dahingestellt.
-
30.1.2020 - Tag der leeren Kirchen und vollen Schlauchboote
Die Schweizer Kirchen zahlen für die Rettung von Migranten im Mittelmeer
Die deutschen Protestanten machten es vor, nun ziehen die hiesigen Kirchen nach: Sie unterstützen das Bündnis «United4Rescue», das Rettungsschiffe ins Mittelmeer schickt. Das Engagement hat heikle Aspekte. Über tausend Migranten ertranken letztes Jahr im Mittelmeer beim Versuch, in Europa eine bessere Zukunft zu finden. Ein unerträglicher Zustand, finden viele humanitäre Organisationen. Aktiv geworden ist auch die Evangelische Kirche in Deutschland: Sie ist massgeblich am Bündnis «United4Rescue» beteiligt. Dieses ist derzeit auf der Suche nach einem Schiff, das vor der afrikanischen Küste Flüchtlinge aus Seenot retten soll. Betreiben würde das Schiff die Organisation Sea-Watch, für die auch die bekannte und umstrittene Kapitänin Carola Rackete tätig ist. Verhandlungen laufen derzeit über einen Kauf des Forschungsschiffs «Poseidon» aus Kiel, das rund eine Million Euro kosten würde. Nun wird klar, dass «United4Rescue» auch Geld von den Schweizer Reformierten bekommt. Gottfried Locher, Präsident der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS), sagt auf Anfrage, die Unterstützung betrage «einige tausend Franken». Als Grund für das Engagement gibt er an, es sei nicht akzeptabel, dass vor unseren Augen ständig Menschen ertränken. Die Kirchenvertreter wüssten, dass es keine einfachen Antworten auf das Flüchtlingselend und die gefährlichen Überquerungen Richtung Europa gebe, betont der höchste Protestant des Landes. Aber wenn die staatliche Seenotrettung nicht genüge, brauche es von anderer Stelle Hilfe im Kampf gegen das tägliche Sterben im Mittelmeer. «Das sagen wir ohne ein Gefühl der moralischen Überlegenheit, sondern im Wissen darum, dass jede Lösung neue Probleme mit sich bringt.» Natürlich kennt auch Gottfried Locher die Anschuldigungen, mit denen sich die humanitären Organisationen konfrontiert sehen. Kritiker sagen, die Retter würden den Migrationsstrom noch verstärken, quasi einen «Sog» erzeugen. Fabrice Leggeri, der Direktor der EU-Grenzwache Frontex, wirft den Seenotrettern sogar vor, dass sie ungewollt Kriminellen hülfen. Laut Leggeri packen Schlepper marode Boote in Libyen mit Migranten voll – und wenn die Route feststehe, informierten die Schlepper ein Rettungsschiff, damit es das Boot aufgreifen könne. Schreibt die NZZ.
In der Schweiz wie auch anderswo sind etliche katholische und reformierte Kirchen zur Umnutzung oder gar zum Verkauf ausgeschrieben. Google hilft Ihnen weiter, falls Sie ein passendes Kirchengebäude erwerben möchten. «In den letzten 25 Jahren wurden schweizweit über 200 Kirchen, Kapellen und Klöster teilweise aufgegeben, abgerissen oder umfunktioniert. In den ehemals heiligen Räumen finden Technopartys statt, werden Ausstellung gezeigt, Casinos betrieben oder es wohnen Leute darin» war in einer Doku von SRF zu vernehmen. Und warum passiert das? Weil die christlichen Kirchen leer sind. Da lohnt es sich für die kirchlichen Organisationen, die Rettung von Migranten in Seenot zu unterstützen, denn die Schlauchboote sind vollgepfercht mit Menschen. Die könnten die leeren Gotteshäuser wieder füllen und mit Leben erwecken. Nur dumm, dass es sich bei den meisten Migranten, die übers Mittelmeer den Weg nach Europa suchen, um Muslime handelt. Und die werden wohl kaum eine christliche Kirche besuchen.
-
29.1.2020 - Tag der Obszönitäten
So hoch ist die Busse, die Roger Federer für seine Obszönität erhält
Roger Federer muss für seine verbale Entgleisung in den Viertelfinals der Australian Open eine Busse über 3000 australische Dollar entrichten. Es war eine der vielen kleinen und grossen Dramen in den Viertelfinals der Australian Open: Roger Federer, der – frustriert von Schmerzen in der Leistengegend – flucht und von Schiedsrichterin Marijana Velijovic eine Verwarnung wegen «Obszönität» erhält und die Linienrichterin, die verbale Entgleisung gemeldet hatte, zur Rede stellt. Als hart empfand der Schweizer die Verwarnung. Welche Worte er gewählt habe, ist nicht abschliessend geklärt. Federer sagte: «Ein Mix zwischen Englisch und Schweizerdeutsch.» Seis drum: Er könne die Verwarnung akzeptieren. Wie auch die Busse, die er dafür erhält und die sich auf 3000 australische Dollar beläuft, was knapp 2000 Schweizer Franken entspricht. Sein Sieg in den Viertelfinals der Australian Open, bei dem er gleich sieben Matchbälle abwehrte, bringt Federer 1 Million australische Dollar (zirka 660'000 Franken) ein. Federer hat in seiner Karriere knapp 130 Millionen Dollar Preisgeld erspielt. Den Grossteil seines Einkommens erwirtschaftet Federer indes neben dem Tennisplatz. Gemäss Wirtschaftsmagazin «Forbes» verdiente er im letzten Jahr 93,4 Millionen US-Dollar. Schreibt die Aargauer Zeitung.
«Chom jetz» kann natürlich in Zeiten der Weinsteins und Hashtags wirklich als Obszönität gewertet werden. Wobei sich schon die Frage stellt, was denn an einer Aufforderung zum Orgasmus obszön sein soll. Sei's drum: Federer wird die Busse verkraften. Wenn nicht, können wir immer noch eine Sammelaktion für ihn starten, damit er wenigstens zu einer warmen Suppe kommt.
-
28.2.2020 - Tag der Milliardäre
Im Tennis zählt vor allem eines: das Geld
Beim Laver-Cup gibt es für die Tennisstars Antrittsgagen in Millionenhöhe. Nun will der Fussballer Gérard Piqué ein neues Tennis-Turnier lancieren. Der Clou daran: Der Gewinner erhält 10 Millionen Euro. Tennis Australia ist nicht nur der Organisator des Australian Open, sondern zusammen mit der ATP auch der Initiator des neuen ATP-Cups sowie Stakeholder an Roger Federers Laver-Cup. Der ATP-Cup zielt direkt auf den reformierten Davis-Cup und damit die Haupteinnahmequelle des internationalen Verbandes ITF. Der Laver-Cup ist eine Exhibition, von der ein paar wenige privilegierte Spieler profitieren und die einen der attraktivsten Termine im Kalender belegt. Dass ausgerechnet einer der wichtigsten Mitgliedverbände die Interessen der ITF hintertreibt und den Schulterschluss mit der Konkurrenz sucht, weckt innerhalb der Tennisszene Unmut. Die ITF ist deshalb wild entschlossen, die Machtprobe mit dem Laver-Cup zu suchen. Schon 2021 will sie mit dem Davis-Cup vom unattraktiven November-Termin in den September vorrücken. Entsprechende Gespräche zwischen der ITF und der ATP sind angelaufen. Zu diesen eingeladen wurden auch Roger Federer und sein Agent Tony Godsick. Doch der Amerikaner zeigt sich nicht verhandlungsbereit. Gegenüber der ITF signalisierte er: «Wir bleiben, wo wir sind.» Godsicks Argument ist das Geld. Der Laver-Cup offeriert den Topspielern Antrittsgagen in siebenstelliger Höhe. Gemessen daran ist das Preisgeld von 250'000 Dollar für jeden des Siegerteams schon fast ein Sackgeld. Angesichts des sportlichen Werts ist das aber nicht mehr als konsequent. Der Laver-Cup ist einer der letzten sportlichen Wettbewerbe, die sich am Gedankengut Pierre de Coubertins orientieren. Der Gründer der modernen Olympischen Spiele hat den Satz geprägt: «Teilnehmen ist wichtiger als siegen.» Mit dem kleinen, aber nicht unerheblichen Unterschied, dass die Spieler am Laver-Cup im Gegensatz zu den Olympiateilnehmern der ersten Stunde nicht für Ruhm und Ehre antreten, sondern vor allem für Dollars. Schreibt NZZ.
Im Tennis geht's nur ums Geld? Wer hätte das gedacht? Das ist doch mal eine überraschende Neuigkeit. Derweil streiten sich die Experten, ob Roger Federer nun Milliardär wird in diesem Jahr oder nicht.
-
27.1.2020
Ösi-Kanzler kurz im exklusiven BLICK-Interview: Konservativ und öko – geht das?
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (33) regiert neu mit den Grünen. Im Interview spricht er über diese überraschende Koalition, seine Rezepte gegen den Klimawandel und sein wichtigstes Thema: illegale Migration. Sebastian Kurz kann wieder lachen, als BLICK ihn bei Sonnenschein am WEF in Davos GR trifft. Er hat das turbulenteste und härteste Jahr seines Lebens hinter sich – seine Regierung implodiert, er abgesetzt, Neuwahlen, Sieg. Seit drei Wochen führt er eine neue Regierung mit den Grünen an. Seiner Popularität hat all das nicht geschadet, offenbar auch in der Schweiz nicht: Als wir für das Foto auf die Strasse gehen, bittet ihn eine entzückte Davoserin um ein Selfie. Schreibt BLICK.
Man wird das Gefühl nicht los, dass Sebastian Kurz noch immer der Koalition mit der «Burschenschaft» FPÖ – Partei kann man diese Schmuddelhaufen nach Ibiza ja kaum mehr nennen ohne rot zu werden – nachtrauert.
-
26.2.2020 - Tag der nimmersatten Gierhälse
Damian Müller sichert sich Lobby-Mandate: Freisinniger Pöstchen-Jäger
Damian Müller sitzt erst seit Kurzem in der Gesundheitskommission. Jetzt hat er bereits drei neue Lobby-Mandate aus dem Gesundheitssektor. Ihm kann es nicht schnell genug gehen. Erst seit Dezember sitzt FDP-Ständerat Damian Müller (35) in der einflussreichen Gesundheitskommission des Ständerates. Nun hat sich der Luzerner bereits drei neue Lobby-Mandate im Gesundheitssektor gesichert. Wie der «Tagesanzeiger» berichtet, sitzt Müller neu in der «Groupe de réfléxion» der Krankenkasse Groupe Mutuel, im «Sounding Board» des Ärzteverbandes FMH und im Beirat des Krankenkassenvergleichsdienstes Comparis. Die Mandate sind auch im Register der Interessenbindungen aufgeführt, das die Parlamentsdienste diese Woche publiziert haben. Von der Groupe Mutuel erhält der Gesundheitspolitiker 4000 Franken pro Jahr – für durchschnittlich vier Sitzungen. Auf bis zu 8000 Franken kommt der Freisinnige bei Comparis. Die halbtägigen Sitzungen werden gemäss dem Tagesanzeiger mit je 2000 Franken entschädigt. Und auch bei der FMH dürften ihm etwa 10'000 Franken winken. Insgesamt fliessen also rund 20'000 Franken in Müllers Portemonnaie. Schreibt BLICK.
Damian «ich bin nicht schwul» Müller war sich nicht zu schade, im Wahlkampf vom Herbst 2019 mit jedem, aber auch wirklich jedem Journalisten über seine etwas komplizierte oder – je nach Sichtweise – eigenartige Sexualität zu reden. Ungefragt, wohlverstanden! In den Redaktionsstuben herrschte darüber ziemliche Verwirrung. Doch statt mit der pro aktiven Schadenbegrenzungsleier «ich bin nicht schwul» den Gerüchten über seine Schwulität vorzubeugen, hätte der ebenso wendige wie nimmersatte Gierhals und «Gesundheitspolitiker» der Luzerner FDP zum Thema Gesundheitspolitik, das im Klima-Wahlkampf so ganz nebenbei als Randnotiz auch noch stattfand, als Beispiel ein Statement wie «ich bin nicht käuflich» abgeben können. Was allerdings vermutlich auch nicht unbedingt der Wahrheit entsprochen hätte. Und da wundern wir uns über Wahlverdrossenheit? Genau solch schmierige Politikertypen sind die Sargnägel unserer Demokratie und fördern mit ihrer fast schon kleptomanen Unverschämtheit die Erstarkung der Populisten. Trump, Strache, Orban, Salvini und wie sie alle heissen, sind nicht vom Himmel gefallen.
Die von BLICK genannten Zahlen der Beiträge, die Müller in seinen Sack stecken darf, entlarven das Statement der Aargauer CVP-Politkkerin Ruth Humbel «Man verdient sich keine goldene Nase mit Mandaten im Gesundheitsbereich» nicht nur als Bullshit, sondern als pure Wählertäuschung. Es sei denn, CVP-Frau Humbel ist dermassen abgehoben, dass sie längst nicht mehr weiss, wie lange ein normaler «Büezer» in der Schweiz für 20'000 Franken arbeiten muss, wofür Damian «ich bin nicht schwul» Müller ein paar wenige Stunden – wenn überhaupt – Lobbyismus betreibt.
-
25.1.2020 - Tag der Marktwirtschaft
Kongos Delegation prellt am WEF die Zeche in Arosa – abgezockte Hoteliers stinksauer: «Fette Klunker, aber kein Geld»
Anlässlich des WEF in Davos hat ein Teil der kongolesischen Delegation in Arosa logiert – und in gleich zwei Hotels die Zeche geprellt. Insgesamt 10'000 Franken sind ausstehend. Im BLICK packen die beiden Bündner Hotelbetreiber jetzt aus. Die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik waren dieser Tage am Weltwirtschaftsforum in Davos GR anzutreffen. Unter ihnen auch der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi (56). Begleitet wurde er von einer Heerschar an Delegierten. Doch weil der Platz knapp war und die Preise während des WEF in Davos exorbitant sind, mussten rund 20 kongolesische Delegierte auf Arosa GR ausweichen. Dort haben sie im Hotel Chamanna Bed & Breakfast des Bündner Hoteliers Marco Bühler (34) logiert. «Sie sind mit Limousinen vorgefahren, trugen Rolex-Uhren, Diamanten und Louis-Vuitton-Taschen», sagt Bühler zu BLICK. Sie buchten 20 Zimmer für 20 Personen während zwei Nächten. Kostenpunkt: 6868 Franken. Scheinbar zu viel für die kongolesische Delegation. Sie prellte die Zeche! «Fette Klunker tragen, aber kein Geld haben», prangert Bühler an. BLICK liegen entsprechende Dokumente vor. Und Recherchen zeigen: Bühler ist nicht der Einzige, dem es so erging. Auch im Hotel Bellevue in Arosa wurden Zimmer für die Entourage des kongolesischen Präsidenten gebucht, aber nicht bezahlt. Konkret: Zehn Zimmer für fünf Nächte. Der Preis: 7300 Franken. Schreibt BLICK.
Na ja, das Desaster hält sich ja noch in Grenzen. So funktioniert nun mal die Marktwirtschaft, die bekannterweise alles regelt. Selbst in Afrika. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Stellt Euch vor, die ganze Delegation hätte Asyl beantragt. Was das erst kosten würde! Gehen wir doch mit einem Smile ins Wochenende. Oder wie die Amis zu sagen pflegen: Think positive. So great. Amazing.
-
24.2.2020 - Tag der Durchlauferhitzer
Vorsicht, Facebook-Virus! Claude Longchamp (62) heimtückisch gehackt
Ein Klick und der Computer ist infiziert. Politologe Claude Longchamp wurde Opfer von Internet-Kriminellen – und leitete den Virus gleich an die Politiker weiter. «Uii, da wurde mein Konto offensichtlich aus dem Umfeld des Schweizer Parlaments wohl unbeabsichtigt gehackt», warnt Politologe Claude Longchamp (62) seine 3325 Facebook-Freunde. «Und ich habe ganz offensichtlich solche von ParlamentarierInnen gehackt, ebenso unbeabsichtigt.»
Über die App «Messenger» hat Longchamp ein Video erhalten, das ihn betreffe. Von einem Ständerat. Den Namen nennt er nicht. «Fälschlicherweise habe ich das angeklickt, dann aber nicht angesehen, weil ich skeptisch wurde», sagt Longchamp zu BLICK. «Offenbar habe ich dabei aber schon zu viel gemacht und das Video weitergeleitet.» Er sei erst seit einem halben Jahr auf Facebook «und habe den Fall noch nicht erlebt». Schreibt BLICK.
Ein Hauch von Jeff Bozos schwebt über dem Fliegenmann. Irgendwie - und ich stehe dazu - herrscht eine klammheimliche Freude. Wie kann man nur so dämlich sein? Diese Frage richtet sich an alle Social Media-Apologeten. Sie sind einfach zu weltfremd, zu abgehoben, um sich mit den Risiken ihrer geliebten Durchlauferhitzer wie Facebook, Instagram, Twitter und Messenger auseinanderzusetzen, geschweige denn sie zu verstehen.
-
23.1.2020 - Tag der Klimaflüchtlinge
«Historischer» Uno-Entscheid gibt zu reden: Bleiberecht für Klimaflüchtlinge
Die Rede ist von einem «wegweisenden Urteil»: Der Uno-Menschenrechtsausschuss in Genf hat erstmals festgehalten, dass auch Klimaflüchtlinge ein Recht auf Schutz haben. Was bedeutet dieser Entscheid für die Schweiz? Ioane Teitiota hat verloren. Endgültig. Durch sämtliche Instanzen hat sich der dreifache Familienvater aus dem Pazifik-Inselstaat Kiribati gekämpft – bis nach Genf. Doch auch vor dem Uno-Menschenrechtsausschuss, der in der Schweiz seinen Hauptsitz hat, ist Teitiota abgeblitzt. Für Menschenrechtsorganisationen ist das Urteil des Uno-Gremiums, das jetzt bekannt geworden ist, trotzdem ein Erfolg – und was für einer! Von einem «historischen Fall» ist die Rede. Von einem «wegweisenden Urteil». Denn im Entscheid heisst es, dass Klimaflüchtlinge ein Recht auf Schutz haben. Das bedeutet, dass sie nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen, wenn ihr Leben dort wegen des Klimawandels in Gefahr ist. Es ist das erste Mal, dass ein internationales Organ den Schutz festhält. Schreibt BLICK.
Wenn eine Lawine rollt, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Da kommen gute Zeiten auf die SVP zu. Wie gut sie für die Bürgerinnen und Bürger werden, wenn dieses Fass ohne Boden, die Büchse der Pandora, erst aufgemacht ist, wird die Zukunft zeigen. Warum fällt mir jetzt ausgerechnet folgendes Zitat vom grossartigen Peter Scholl-Latour (1924 - 2014) ein? «Wer halb Kalkutta aufnimmt hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta!»
-
22.1.2020 - Tag der Fuhrhalter
SVP-Präsident Glarner: «Wir haben die Themen AHV und Krankenversicherung verschlafen»
Als neuer Präsident der SVP Aargau will Andreas Glarner die Volkspartei wieder auf «Blocher-Kurs» bringen. Spaltet er damit die SVP noch mehr oder bringt er sie tatsächlich zurück auf die Erfolgsspur? Der umstrittene Asylchef der SVP Schweiz und neue Präsident der SVP Aargau Andreas Glarner ist Gast im TalkTäglich. «Die klassischen SVP-Themen sind im Moment bei den Leuten einfach nicht zuoberst», konstatiert Cavalli. Glarner gibt sich selbstkritisch: «Wir haben ein paar Themen verschlafen, zum Beispiel die AHV oder die Krankenversicherung.» Beim Thema Lobbyismus geht Glarner mit seinen Parteigenossen hart ins Gericht: «Wir waren hier keinen Dreck besser als andere Parteien. Auch wir hatten 'Fuhrhalter', die plötzlich bei Krankenkassen im Vorstand sassen», teilt er gegen Ulrich Giezendanner aus - bekanntermassen sind die beiden keine dicken Freunde. Lobbyisten müssten aus der Gesundheitskommission ausgeschlossen werden, fordert Glarner. Er habe sich bereits früher mit diesem Anliegen an die Parteileitung gewandt. Schreibt die AZ.
Das sind ja schon mal gute Ansätze und klare Analysen von Glarner. Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann hat beispielsweise ihren Wahlkampf im Herbst 2019 für den Einzug in den Nationalrat genau mit den von Glarner beschriebenen Themen geführt und gewonnen. Ohne Facebook-, Twitter- und Instagram-Account notabene. Für seine «Mission Impossible» beim Kampf gegen die «Fuhrhalter» (Anmerkung: ... und «Fuhrhalterinnen», denn im Bereich Krankenkassen-Lobbyismus stimmt für einmal die Frauenquote) kann man ihm nur Glück und Durchhaltevermögen wünschen, sofern er seine Ansagen wirklich ernst meint. Die Hoffnung stirbt ja bekannterweise zuletzt. Und so wie Saulus zu Paulus mutierte, könnte auch aus einem «Dummschwätzer» ein veritabler Politiker werden.
-
21.1.2020 - Tag der Neolippen
«Cassis ist der Bundesrat von Glencore und Nestle» – Regula Rytz im Interview
Die Klima- und Verkehrswende müsse sozialverträglich über die Bühne gehen, sagt Grünen-Präsidentin Regula Rytz. Sie will deshalb Familien mit Kindern und Jugendlichen gezielt entlasten – beim öffentlichen Verkehr. Und äussert sich zu Bundesrat Cassis: «Er ist der Bundesrat der Konzerne wie Glencore oder Nestle. Er will die Einwicklungszusammenarbeit zu einem Hilfsdienst für private Wirtschaftsinteressen umbauen. Und er hat die Europapolitik mit dem Angriff auf den Lohnschutz in die Sackgasse geführt. Scheitert das Rahmenabkommen, dann ist auch Cassis auf der ganzen Linie gescheitert. Das muss Konsequenzen haben.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Dass sich Bundesrat Cassis sich vor allem als Wurmfortsatz von Glencore und Nestle auszeichnet, ist eigentlich eine altbekannte Tatsache und die logische Konsequenz im Verhalten eines Politikers der Neolippen-Partei FDP. Wer etwas anderes erwartet und ihn trotzdem gewählt hat, muss irgendwas geraucht, gesnifft oder geschluckt haben, was die Sinne total betäubt. Soll in diesen Kreisen ja öfters vorkommen, wie hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird. Was - im Umkehrschluss - die manchmal etwas arg blasssen Nasen gewisser ParlamentarierInnen erklären würde.
-
20.1.2020 - Tag der Beton-Hasardeure
«Der Flyer ist ein unsägliches Lügenpamphlet»: Gegner der Miet-Initiative hausieren mit alten Zahlen
777 Millionen Franken habe der Bund schon mit der Förderung von günstigem Wohnraum verloren, behaupten die Gegner der Miet-Initiative. «Lüge», sagt Mit-Initiantin Jacqueline Badran. Drei Millionen Flyer landeten in den vergangenen Tagen in den Schweizer Haushalten. Darin warnen die vom Hauseigentümer-Verband angeführten Gegner der Miet-Initiative eindringlich vor einer «Verstaatlichung des Wohnungsmarkts». Als knackigstes Nein-Argument führen sie dabei «777 Millionen Franken Verluste des Bundes seit den 90er-Jahren mit Wohnbaudarlehen» an. Ein Argument, bei welchem SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (58, ZH) an die Decke geht! «Der Flyer ist ein unsägliches Lügenpamphlet», wettert sie. «Die 777 Millionen haben mit dem heutigen Wohnraumförderungs-Gesetz und mit der Initiative null und nichts zu tun. Damit wird das Stimmvolk in die Irre geführt!» Auch Grünen-Nationalrat Michael Töngi (52, LU) ärgert sich: «Mit uralten Zahlen zu hausieren, ist reine Polemik», so das Vorstandsmitglied des Mieterverbands. HEV-Präsident Hans Egloff (60) wehrt sich gegen den Vorwurf der Irreführung: «Man weiss ja nie, was noch kommt. Bei den Bürgschaften für die Hochseeschifffahrt haben auch alle behauptet, das sei ein Supergeschäft. Jetzt zahlen wir Hunderte von Millionen.» Er räumt zwar ein, dass sich die 777 Millionen auf das alte Gesetz beziehen. Trotzdem sei deren Verwendung im aktuellen Abstimmungskampf gerechtfertigt. «Wir wollen damit zeigen, dass der Bund mit seinem Engagement in der Wohnbaupolitik schon einmal viel Geld verlocht hat», so der frühere SVP-Nationalrat. «Der Bund soll die Wohnbauförderung den Kantonen und Gemeinden überlassen. Die wissen besser, wo Bedarf besteht.» Auch für GLP-Nationalrat Martin Bäumle (55, ZH) ist klar: «Faktisch steht da nichts Falsches und die Quelle ist sauber deklariert», so der Co-Präsident des Nein-Komitees. Und: «Plakative Zuspitzungen gehören zu Abstimmungen.» Schreibt BLICK.
Es war wie vom AVZ in einer früheren «Schlagzeile des Tages» vorausgesagt anzunehmen, dass die üblichen Verdächtigen aus dem Sumpf der Immobilienspekulanten vor der Abstimmung mit den ganz grossen Kanonen auffahren. Was erwarten wir denn anderes von Leuten wie HEV-Präsident Hans Egloff und dem notorischen Faktenverdreher GLP-Nationalrat Martin Bäumle, der in seiner Funktion als Green-Cross Präsident Schweiz mit dem Verschweigen von Fakten für einen unappetitlichen Skandal sorgte? Fake News gehören in der Immobilienbranche wie bei Politikern seit jeher zum Business as usual. Man schaue sich nur einmal die Prospekte der angebotenen Immobilien dieser Branche an. Da sich die Zunft der unseligen Beton-Hasardeure gegenseitig aus purer Dummheit (oder Unfähigkeit) auch noch die unsäglichen Claims abschreibt, preist sie ihre Objekte häufig mit der Superlative «Wohnen mit Weitsicht» an, obschon ein Blick vom Balkon der angebotenen Wohnung meistens das Gegenteil beweist, steht doch da in Zeiten des verdichteten Bauens nur 15 Meter entfernt (je nach gesetzlicher Auflage des Minimalabstandes) ausgerechnet der Nachbarsblock, der jegliche Weitsicht verhindert. Was von Bäumle vermutlich mit der Bemerkung gekontert würde, dass schliesslich auch 15 Meter Weitsicht sei. Womit er nicht einmal ganz unrecht hat, kommt es doch einzig und allein auf den Blickwinkel an. Und der ist bei den Immobilienfritzen leicht verschoben.
-
19.1.2020 - Tag der Exklusivität
Exklusive Rednerin: 9000 Franken für Doris Leuthard
Doris Leuthard bleibt nach ihrem Rücktritt aus der Regierung eine gefragte Frau. Davon weiss sie zu profitieren. Wer die Ex-Magistratin für eine Rede buchen will, muss mit der Agentur Speakers verhandeln. «Die Höhe der Honorare ist Verhandlungssache und ist abhängig von der Art der Veranstaltung», sagt Speakers-Chefin Esther Girsberger auf Anfrage. Zu besagtem Honorar will sie sich nicht äussern. Doris Leuthard selbst argumentiert gegenüber SonntagsBlick, sie habe viele Anfragen und akzeptiere ein paar wenige pro Jahr, «teils pro bono, teils eben bezahlt». Es gebe viele spannende Themen, sie beschränke sich aber auf jene, mit denen sie sich auskenne. Schreibt SonntagsBlick.
Von irgendwas muss ja die exklusive Rentnerin wohl ihren Lebensunterhalt bestreiten, oder? Mit der 220'000-Franken-Rente lässt sich ja nicht mal der Stromverbrauch Ihres Teslas finanzieren. Also weg mit Euren Neidkeulen! Doris ist keine Hillary. Die nimmt nämlich 50'000 Dollar pro Auftritt. Und nicht lächerliche 9'000 Fränkli.
-
18.1.2020 - Tag des sonnigen Weekends
Roger Hallam (53) ist der Anführer einer ultraradikalen Klimabewegung: «Wir wollen Millionen dazu bringen, Gesetze zu brechen»
Er hat die radikalste Umweltschutzbewegung ins Leben gerufen. Nun will XR-Mitgründer Roger Hallam Millionen Menschen für seine Sache gewinnen – mit drastischen Mitteln. Das muss man erst mal schaffen: der eigenen radikalen Bewegung zu radikal zu sein. Der Klimaaktivist Roger Hallam (53) hat es geschafft. Nachdem der Mitgründer von Extinction Rebellion (dt. Rebellion gegen das Aussterben) in einem Interview mit der «Zeit» den Holocaust relativiert hatte, distanzierten sich die deutsche Ortsgruppe und Schweizer Aktivisten von dem Briten. Kritiker werfen ihm Panikmache vor. Auch am Worldwebforum in Zürich trat Hallam am Freitag wie ein Weltuntergangsprophet auf. Lob gibts nur für Greta Thunberg (17), die am selben Tag in Lausanne VD weilte. Dem Vielflieger-Publikum schleuderte er wütend entgegen: «Ihr werdet sterben!» Er will sie bekehren. «Ich mache hier gleich einen Workshop», erklärt er. Schreibt BLICK.
Viel Lärm um stupide Schlagzeilen wie «ihr werdet sterben». Dass wir alle eines Tages sterben werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das bevorstehende Weekend sollten wir uns von diesem etwas obskuren Bartli und seinen kruden Statements nicht verderben lassen. Gehen wir lieber mit unseren wunderbaren russischen Windhunden an der Sonne spazieren.

-
17.1.2020 - Tag der MIGROS Bank
Migros Bank steigert Gewinn 2019 um 12 Prozent
Die Migros Bank hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als im Vorjahr und damit ein neues Rekordergebnis eingefahren. Dabei spielten aber Immobilienverkäufe eine Rolle. Im Kerngeschäft legten sowohl Volumen als auch Erträge zu. Schreibt BLICK.
Immerhin präsentiert eine der unzähligen MIGROS-Abteilungen hervorragende Zahlen. Beim Mutterkonzern sieht's ja etwas anders aus. Noch nicht ganz Rot, aber leicht Orange.
-
16.1.2020 - Tag der dummschwätzenden Sanierungsfälle
Andreas Glarner ist neuer Parteipräsident: «Die SVP Aargau ist ein Sanierungsfall, sie soll ein Leuchtturm werden»
Die Delegierten der SVP Aargau haben Andreas Glarner zum neuen Parteipräsidenten gewählt. Er überzeugte am Montagabend eine klare Mehrheit mit einer Brandrede. Er wird Nachfolger von Thomas Burgherr. Gegenkandidat Rolf Jäggi erreichte nur rund ein Drittel aller Stimmen. Im Vorfeld des gestrigen Parteitags in Lupfig galt parteiintern eher Rolf Jäggi als Favorit, weil Glarner als zu extrem galt, der eventuell SVP-Sympathisanten vertreiben könne. Doch es kam anders. Das zeichnete ab, je länger der Parteitag am Mittwochabend in Lupfig dauerte. Die Stimmung und die Voten im Saal kippten eindeutig zugunsten von Andreas Glarner. Andreas Glarner sprach nach Jäggi und versprach nicht zuviel mit seiner angekündigten «Brandrede». Glarner kam gleich zur Sache und mahnte seine Parteikollegen, dass es nicht so weiter gehen könne. «Die SVP ist ein Sanierungsfall», sagte Glarner. «Ja, wenn man jeden fünften Kunden verliert, also Wähler, ist man ein Sanierungsfall.» Glarner machte klar: Die nationalen Themen seien entscheidend, auch bei den Grossratswahlen. Es gebe kaum kantonale Themen, die im Sorgenbarometer der Schweizer wirklich wichtig seien. Glarner kritisierte Parteikollege Werner Laube, ohne dessen Namen zu nennen, der ihn in einem AZ-Artikel als «Imageproblem für die SVP» bezeichnet hatte. Glarner griff auch die Medien an: «Wir machen unseren Job nicht richtig, wenn die Medien uns plötzlich lieben würden.» Glarner nannte und kritisierte explizit auch die AZ. Im Gegensatz zu Jäggi nahm Glarner auf Vorbild Christoph Blocher Bezug. Nur dank ihm sei die SVP heute so stark. Glarner versprach, als Präsident die SVP Aargau zum «Leuchtturm für andere SVP-Sektionen in der Schweiz zu machen». Glarner Szenenapplaus. «Sie werden es keinen Tag bereuen, wenn Sie mir die Stimme geben.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Ein Parteipräsident, den man laut Gerichtsurteil folgenlos einen «Dummschwätzer» nennen darf, ist tatsächlich ein Sanierungsfall. Da hat der grosse Social Media-Polterer recht. Jetzt muss Glarner nur noch den Hobel am richtigen Platz ansetzen, dann wird vielleicht doch noch was aus ihm. Nichts ist schon.
-
15.1.2020 - Tag der geschlossenen Hose
Minnas G. (30) wurde bei den Lenzerheide Bergbahnen fristlos entlassen: «Ich habe doch nur Pornos geschaut!»
Minnas G. (30) schaute im Pausenraum Pornos. Und wurde von der Lenzerheide Bergbahnen AG (LBB) dafür rausgeschmissen. Das findet er übertrieben. Denn: «Meine Hose war immer zu!» Die LBB ergänzt ihr Reglement nun mit einem Porno-Passus. Er arbeitete hart als Saisonnier und Betriebsangestellter bei den Lenzerheide Bergbahnen AG (LBB). Bis vor wenigen Tagen reichte Minnas G.* (30) den Gästen am Skilift Valbella den Bügel. Doch letzte Woche erhielt er die fristlose Kündigung. Der Vorwurf: Er soll bei der Arbeit Pornos geschaut haben – vor anderen Mitarbeitern. Gegenüber BLICK gibt der Entlassene unverhohlen zu: «Ja, ich habe im Pausenraum Pornos geschaut. Die fristlose Kündigung finde ich aber übertrieben.» Er relativiert den Vorfall: «Meine Hose war ja immer zu!» Und: «Es war auf meinem privaten Tablet morgens, bevor der Betrieb losging.» Schreibt BLIGG.
«Meine Hose war ja immer zu!» Das war möglicherweise der entscheidende Fehler, der zur Kündigung führte. Mit geschlossener Hose Porno schauen ist ein No Go. Von ex-Stadtpräsident Geri Müller lernen heisst siegen lernen.
-
14.1.2020 - Tag des Greta-Trains
Im Tunnel wirds unangenehm wegen undichter Klimaanlagen: Durchzug im neuen Stadler-Zug
Der kupferfarbene Traverso ist das neue Zugpferd der SOB-Flotte. In Sachen Komfort macht er etwas her. Doch im Tunnel weht den Fahrgästen ein rauer Wind um die Nase. Erste Mängel müssen behoben werden. Derzeit fröstelt es Passagiere auf der Voralpenroute der Südostbahn (SOB) von St. Gallen nach Luzern. Genauer: im Rickentunnel. Während der vierminütigen Durchfahrt weht im neuen Stadler-Zug ein spürbarer Wind – im Innenraum bei den Fahrgästen! Ein Konstruktionsproblem. Eine Kinderkrankheit. Der Traverso, das neue Zugpferd der SOB, rollt erst seit letztem Juni über die Gleise. Und die ersten Monate zeigen: Es gibt ein Problem bei den Klimaanlagen. Dabei schwärmte Toni Häne (56), Leiter des SBB-Personenverkehrs, bei der Präsentation vor wenigen Monaten: «Alles hochwertig, eindeutig!» Schreibt BLICK.
Blick irrt sich wieder mal gewaltig. STADLER ist wie immer der Zeit voraus. Der bemängelte Durchzug ist beabsichtig, denn damit fährt der «Traverso» als erste Zugskomposition der Welt absolut CO2-frei und klimaneutral durch die Landschaft. Wie Peter Spuhler von STADLER Rail auf Anfrage des Artillerie-Vereins Zofingen mitteilt, wird das Modell «Traverso» ab sofort nur noch als «Greta-Train» verkauft.

-
13.1.2020 - Tag des Showdown
Showdown ums Aargauer SVP-Präsidium: Parteikollege schiesst scharf gegen Glarner, Jäggi geht als Favorit ins Rennen
Am Mittwoch wählt die SVP Aargau einen neuen Parteipräsidenten. Kandidat Andreas Glarner hat einen schweren Stand. Der langjährige Wahlkampfleiter Werner Laube warnt: Glarner sei ein Imageproblem für die SVP. Gegenkandidat Rolf Jäggi geht als Favorit ins Rennen, auch bei ihm gibt es aber Fragezeichen. Nicht alle in der SVP waren erfreut, als vor Wochenfrist die Namen der zwei Nominierten für das Parteipräsidium bekannt wurden. Andreas Glarner zu extrem, Rolf Jäggi zu farblos, fanden einige SVP-Politiker. Ein ehemaliger Parlamentarier bat die Parteileitung sogar, nochmals über die Bücher zu gehen und die Wahl im Zweifelsfall zu Gunsten einer erweiterten Auswahl zu verschieben. Glarner versucht es nicht zum ersten Mal mit dem Sprung an die Parteispitze. Bereits 2005 trat er an, unterlag damals aber Thomas Lüpold. 2012 brachte sich Glarner wieder als Parteipräsident ins Spiel, verzichtete dann aber zu Gunsten von Thomas Burgherr auf eine Kandidatur. Jetzt versucht es Glarner nochmals. Trotz Aufstieg in den Nationalrat und landesweiter Bekanntheit hat Glarner bei seinen Aargauer Parteikollegen aber einen schweren Stand. Wer sich umhört, stösst immer wieder auf Bedenken gegenüber Glarner als möglichen Parteichef.
«Andy Glarner ist ein Imageproblem für die SVP»
Offen und ungeschminkt sagt dies Werner Laube, der langjährige Wahlkampfleiter der SVP Aargau. Laube traut Glarner zwar durchaus zu, «das Amt als Präsident der SVP Aargau problemlos bewältigen zu können» und attestiert ihm, «mutig für seine Überzeugung hinzustehen» und «im rechten Spektrum der Partei Wähler mobilisieren zu können». Aber für Laube überwiegen die Negativpunkte: «Seine provokative, manchmal unbedachte und oft auf die Person zielende Art wirkt auch für viele Wähler und Sympathisanten der SVP unsympathisch.» Vor allem Frauen und Junge, glaubt Laube, könnten sich nicht mit Glarner identifizieren. «Andy Glarner ist keine Identitätsfigur für die SVP Aargau; gemässigte Parteimitglieder und Sympathisanten könnten sich von der SVP abwenden.» Laubes Fazit: «Andy Glarner ist aus meiner Sicht ein Imageproblem für die SVP und keine Identifikationsfigur für die SVP Aargau.» Das sind harte Worte gegenüber einem Parteikollegen. Darauf angesprochen, kontert Glarner gewohnt angriffig: «Das sind keine echten SVPler», meint er zur Befürchtung, er würde gemässigte Mitglieder und Sympathisanten abschrecken. «Es geht hier nicht um die Ausrichtung», so Glarner, «Jäggi und ich sind inhaltlich nicht weit auseinander. Es geht mehr darum, wie wir unsere Politik verkaufen. Und da stehe ich für ein pointiertes Auftreten. Der Schmusekurs der letzten Jahre war nachweislich nicht erfolgreich.» Schreibt die AZ.
Unser aller Fastfinger Andy, der seine «pointierten» Social Media-Posts meistens so schnell online stellt, dass die Hirnfunktion zeitlich kaum Schritt halten kann, darf gemäss Gerichtsentscheid «Dummschwätzer» genannt werden. Das ist eigentlich nur die logische Konsequenz für einen, der ausschliesslich die Strategie «Angriff» beherrscht, in der Verteidigung jedoch jämmerlich versagt und sich dadurch öfters der öffentlichen Lächerlichkeit preis gibt. Zitieren wir Napoleon I. Bonaparte: «Die Kriegskunst besteht in der Berechnung einer grossen Anzahl Fälle, deren Eintritt auf dem Kriegsschauplatz als möglich angenommen werden muss.» Glarner darf zwar folgenlos «Dummschwätzer» genannt werden; dumm ist er deswegen trotzdem nicht. Im Gegenteil. Doch leider fehlen ihm für den Aargauer SVP-Präsidentensessel die strategischen Fähigkeiten der Voraussicht, wie sie Napoleon beschreibt, die der Korse allerdings auch nicht immer befolgt hat. Und, wie die Geschichte beweist, letztendlich trotz seiner «pointierten» Reden immer wieder gescheitert ist. Es darf angenommen werden, dass auch die Aargauer SVP unter Glarner ihr Waterloo erleben würde.
-
12.1.2020 - Sonntag der intellektuellen Ödnis
Heissunger auf Mietwohnungen: Diesen Firmen gehört die Schweiz
Swisslife, UBS, Credit Suisse, ZKB und Migros gehören Zehntausende Mietobjekte. Insgesamt sind bereits 40 Prozent im Eigentum von Unternehmen. Privatbesitzer ziehen sich zunehmend zurück. Hunderte Menschen, alte und junge, zuversichtliche und erschöpfte, stehen in Zürich für eine preiswerte Wohnung an. Die Schlange reicht über mehrere Strassenzüge, geht sogar ums Eck. Solche Szenen wurden zum Sinnbild verfehlter Wohnungspolitik. Knapper und daher hoch begehrter Wohnraum hat vor allem in den Metropolen zu ständig steigenden Mietpreisen geführt. Jetzt macht der Notstand nationale Schlagzeilen: In einem Monat stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ab, die von Bund und Kantonen verlangt, preisgünstige Mietobjekte verstärkt zu fördern. Bei der Abstimmung geht es auch um eine Glaubensfrage: Welche Wohnungsbaupolitik die Wähler wollen. In den letzten Jahren haben Fonds, Versicherungen, Anlagestiftungen, Bankengruppen und Pensionskassen immer mehr Grundbesitz angehäuft und dort Gebäude hochgezogen. Warum sie einen solchen Heisshunger auf Häuser entwickeln, liegt auf der Hand: In Zeiten von Negativzinsen versprechen Immobilien attraktivere Renditen als andere Anlagen. Eine absurde Folge dieser Entwicklung: Weil auch Pensionskassen eine möglichst satte Rendite anstreben, um ihre Renten zu sichern, zahlen deren Mieter im Interesse der eigenen PK-Vorsorge eine höhere Miete. Schreibt SonntagsBlick.
Die Immobilienfirmen haben zu viel Macht, schreibt SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty. Wie wahr! Und wer sichert sie ihnen dauerhaft? Frei nach Rolf Hochhuth: Die furchtbaren Lobbyisten des Parlaments. Beispiel gefällig? Der solariumgebräunte Luzerner FDP-Ständerat und Liebling aller Schwiegermütter Damian Müller ist einer dieser Spezies, der in sämtlichen Interviews vor der Herbstwahl 2019 nicht müde wurde, stets ungefragt und vermutlich proaktiv mit einem klaren Bekenntnis zu seiner intellektuellen Ödnis darüber zu palavern, dass er um Gotts Willen nicht schwul sei, anstatt detailliert über seinen Teilzeitjob bei Swisslife und seine Mandate bei Innerschweizer Immobilienklitschen (Architekturbüros etc.) zu reden. Ein Schelm wer Böses denkt.
-
11.1.2020 - Tag der Onlineshop-Medien
Beizentauglich, machtbewusst und fleissig: So muss Röstis Nachfolger sein
Dieses Wochenende stellt die SVP die Weichen für die Nachfolge von Albert Rösti. BLICK sagt, was der künftige SVP-Präsident können muss. Dieses Wochenende schafft die SVP-Spitze Klarheit. An ihrer jährlichen Kadertagung im Vier-Stern Hotel Bad Horn in Horn TG wird sie eingrenzen, wer Nachfolger von Parteipräsident Albert Rösti (52) werden soll. Am Freitag legte der neunköpfige Parteileitungsausschuss das Anforderungsprofil für die Kandidaten fest: Was muss der Neue können, was muss er leisten? Sechs Eigenschaften sind unerlässlich:
1. Der Stil des netten Albert Röstis gehört der Vergangenheit an. Das Experiment «hart in der Sache, anständig im Ton» ist gescheitert. Röstis Nachfolger wird wieder mehr provozieren müssen – so wie seine Vorgänger Toni Brunner (45) und Ueli Maurer (69) das taten. Allerdings: Ein richtiger Scharfmacher fehlt bei den möglichen Nachfolgern.
2. Auch wenn sich in der SVP-Elite vermehrt Akademiker tummeln: Der Präsident muss Beizentauglich sein. Dort ankommen, wo die SVP ihre Wähler hat – auf dem Land, in den kleineren Gemeinden, bei den Büezern, Bauern und Rentnern. Hier hätten sicher Malermeisterin Sollberger und Landwirt Dettling Vorteile.
3. Der Neue muss begeistern können – bei den letzten Wahlen sind viele SVP-Sympathisanten den Urnen ferngeblieben. Auch mit Initiativen und Referenden tut sich die grösste Partei des Landes schwer. Die SVP muss ihre Leute wieder mobilisieren – sonst verpuffen die politischen Forderungen.
4. Gleichzeitig braucht die SVP einen Strategen an der Spitze – einen, der mit anderen Parteien dealen und sie gleichzeitig vor sich hertreiben kann. Das ist Rösti zu wenig gelungen – im Bundeshaus gab mehr und mehr Fraktionschef Thomas Aeschi (40) den Ton an.
5. Das heisst auch: Der neue Präsident muss Lust an der Macht haben. Nicht nur, um sich als Leitwolf durchzusetzen, sondern auch, um die Kantonalparteien auf Linie zu bringen.
6. Französisch-Kenntnisse sind mehr als nur von Vorteil. Um die stockende Eroberung der Romandie voranzutreiben, ist der neue SVP-Chef am besten bilingue.
Herrlich! Unser aller Onlineshop* mit angegliedertem Boulevardblättchen «diktiert» der SVP das Anforderungsprofil für den zukünftigen Parteipräsidenten. Der Artillerie-Verein Zofingen liefert noch einen siebten Punkt: Unwählbar sind alle Kandidaten der SVP, die öffentlich «Dummschwätzer» genannt werden dürfen. Womit der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner bereits aus dem Rennen ist. Mehr noch: Unter dieser Prämisse muss man sich fragen, ob da überhaupt noch jemand aus den Reihen der SVP in Frage kommt? Einige, auf die Punkt sieben nicht zutrifft, haben ja bedauerlicherweise längst abgesagt. Wie zum Beispiel der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter. Schade. Sehr schade sogar. Der Mann hätte alle Voraussetzungen, die SVP mit Anstand und der notwendigen Kompetenz in die Zukunft zu führen, in der die Digitalisierung eine wesentliche Rolle spielen wird.
* Sehen Sie sich unter dem «BLIGG-Impressum» mal die Onlineshop-Aktivitäten von Ringier an. Dann verstehen Sie auch, weshalb BLIGG bei jedem Aufruf über das Internet mit vollkommen lächerlichen Argumenten um Ihre Registrierung buhlt. Es geht nur um Ihre persönlichen Daten. Die sind für jeden Online-Händler bares Geld wert. Der Fairness halber sei erwähnt, dass alle dem Tod geweihten Printmedien diese Unart praktizieren. Teilweise wird sogar die Telefonnummer für die «Freischaltung» verlangt (SRF). Da wundert man sich, dass unser Datenschützer ruhig auf seinem gemütlichen Stuhl sitzen bleibt.
-
10.1.2020 - Tag der asiatischen Touristen
Touristen aus Indien sorgen für Besucherrekord in Baden – doch nicht allen ist zum Jubeln zumute
Noch vor wenigen Jahren waren Gäste aus Indien in Baden eine Seltenheit. 1500 Mal übernachteten sie im Jahr 2015 in der Stadt, machten damit nur einen Bruchteil aller Logiernächte aus. An der Spitze der Herkunftsländer lagen damals (hinter der Schweiz) Deutschland und die Vereinigten Staaten. Inzwischen sind die Inderinnen und Inder die wichtigsten ausländischen Hotelgäste geworden: Die Zahl ihrer Übernachtungen in der Stadt ist um das Achtfache gestiegen, lag 2018 bei 12850 und in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres bereits wieder bei über 11'000. Schreibt die AZ.
Und so haben alle Schweizer Städte ihre ganz speziellen Gäste. Baden freut sich über etwas mehr als 10'000 Inder und Luzern ist inzwischen der unumstrittene Hotspot für Uhren, die flottesten Senioren und Chinesen. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass inzwischen knapp 300'000 Chinesen die schönste Stadt der Welt, also Luzern, pro Jahr (heim)suchen. Von solchen Zahlen ist Baden noch weit entfernt. Und etwas soll hier nicht unerwähnt bleiben: Die chinesischen Gäste haben auch so ihre ganz speziellen Eigenarten. Laut und ausgiebig Furzen am Esstisch im China-Restaurant und auf der Rolltreppe im Manor-Kaufhaus ist nur eine davon. Aber die Gäste aus Indien sind noch etwas spezieller. Die verrichten gleich die Notdurft in einer Ecke auf Charly Buchers Touristenschiff und fackeln die Hotelsuite ab. Vor zehn Jahren weigerten sich deshalb einige Luzerner Hotels, indische Gäste zu beherbergen. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Man nimmt ihnen an der Rezeption schon beim Einchecken die Gaskocher ab. Höflich aber bestimmt. Don't curry. Be Happy.
-
9.1.2020 - Tag der Insolvenz bei der BDP
CVP und BDP wälzen Zukunftspläne: Mit Fusion gegen den Untergang?
Kommt's nun doch zum Zusammenschluss der CVP und BDP? Hinter den Kulissen loten die Parteichefs Varianten aus. Einige Kantone machen Dampf. Die Mitteparteien denken laut über ihre Zukunft nach – und wälzen im Geheimem mögliche Strategien. Einerseits die CVP. Parteichef Gerhard Pfister (57) lässt derzeit analysieren, ob das «C» aus dem Parteinamen verschwinden soll. «Ich hatte im Wahlkampf viele Reaktionen von Leuten, deren politische Positionen mit denjenigen der CVP übereinstimmen. Sie unterstützten unsere Politik, sagten aber, sie könnten keine katholische Partei wählen», sagte er im BLICK-Interview. «Darauf müssen wir als Partei, die durchaus christliche Werte wie Solidarität vertritt, deswegen aber nicht konfessionell ausgerichtet ist, eine Antwort finden.» Ein Entscheid soll bereits im Juni fallen. Schreibt BLICK.
Eigenartig. Gilt doch in der Schweiz die geheiligte Doktrin, dass der Markt alles regelt. Der Markt hat an den Wahlurnen im vergangenen Herbst 2019 ein klares Urteil gesprochen: Die BDP braucht niemand mehr – ein paar Hardcore-Gläubige und die an den Futtertrögen des Staates mampfenden BDP-«Staatsbeamten» ausgenommen. Normalerweise schickt doch unser aller Markt gescheiterte Unternehmen in die Insolvenz oder schliesst sie. Wickelt sie ab. Doch die BDP will eine Fusion mit der CVP. Vermutlich als Infusion für die ansonsten arbeitslosen BDP-ParlamentarierInnen. Die können ja nicht alle auch noch bei den Schweizer Krankenkassen untergebracht werden. Diese Posten sind schliesslich längst von FDP, SVP, SP, Grüninnen und Grünen und der CVP besetzt. Irgendwen vergessen? Stimmt: Denis Kläfiger, der etwas arg sonnengebräunte Chef der BDP Luzern, arbeitet ebenfalls bei einer Krankenkassen-Versicherung.

-
8.1.2020 - Tag der Skistöcke
Weisse Pracht, schwarze Zahlen, rote Köpfe an den Festtagen: Alpiner Tourismus jubelt über starken Saisonstart – anders die Skifahrer
Rekordandrang in höher gelegenen Wintersportgebieten: Der Boom über die Festtage freut die Bergbahnen und ärgert manchen Skifahrer. Zum Start der Wintersaison zog es die Menschen auf die Skipisten. Die Bergbahnen transportierten rund 17 Prozent mehr Gäste als in den letzten fünf Jahren, wie der Verband Seilbahnen Schweiz mitteilt. Einige Skigebiete erreichten neue Tagesrekorde. Die Kehrseite: Auf vielen Pisten wurde es eng. Die Wartezeiten vor den Liften waren teilweise hoch, doch oft war das nicht das Hauptproblem, weil in den grossen Skigebieten die Kapazitäten in den letzten Jahren ausgebaut wurden. Eben noch die Tourismuskrise, und nun ist es auch wieder recht: zu viele Leute in den Bergen, Dichtestress, Overtourism! Für die Overtourism-These gibt es reichlich anekdotische Evidenz. Buchungssysteme sind unter dem Andrang kollabiert, hochgelobte Apps ebenso. Tagestouristen steckten im Stau, mussten sich vor den Ticketschaltern gedulden. In Parkhäusern kommt es zu Staus und später zur Schlagzeile: «Die Leute im Parkhaus wurden aggressiv.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Was sagt eigentlich Greta (Gössi, die klimabakterische Wendehalspäpstin) zu diesem Thema? Und was meint ihr warmherziger Ständerat Damian Müller aus dem Kanton Luzern, der sich im Wahlkampf vom letzten Herbst mit seinen lauwarmen* Statements so vehement für eine Flugticketabgabe einsetzte? Wäre da nicht eine klimatisch bedingte Skipistenticketsteuer fällig? Das wäre doch eigentlich nur die logische Konsequenz aus den Verlogenheitsparolen der Wendehalspartei der «Freien Demokraten».
* Um allfälligen Klagen wegen «Verbalinjurien» vorzubeugen: Der Begriff «lauwarm» wird in keiner Art und Weise in Bezug auf sexuelle Präferenzen irgendeiner Person verwendet, sondern ausschliesslich, wirklich und wahrhaftig nur im Zusammenhang mit dem lauwarmen Klima in unseren winterlichen Breitengraden. Alle anderen Deutungen dieses Begriffes sind frei erfunden.
-
7.1.2020 - Tag der Aargauer Nebelschwaden
Das Mittelland ist die Badewanne des Nebels
Kräftige Gewitter in den Sommermonaten und Schneefälle sowie heftige Stürme im Winter. Das ist es , was Meteorologen lieben – also Spannung und Abwechslung. Je nachdem, wie intensiv man sich mit dem Wetter beschäftigt, kommt es vor, dass man mehrmals täglich die Wettermodelle konsultiert, um sich über die neusten Berechnungen zu informieren. Als am zuverlässigsten gilt unter den meisten Schweizer Meteorologen das europäische Wettermodell des European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) in Grossbritannien, an welchem sich die Schweiz gemeinsam mit 21 weiteren europäischen Staaten beteiligt. Als Abgleich wird mit zweiter Priorität meist das US-amerikanische Global Forecast System (GFS) konsultiert, welches vier Mal täglich – und somit doppelt so oft wie das europäische Modell – die Prognosen neu berechnet. Schreibt das Zofinger Tagblatt.
Liebe Aargauerinnen und Aargauer. Nebel ist für Euch nicht nur eine triste Angelegenheit, sondern auch ein sehr gefährlicher Zustand. Sieht man doch die weissen Socken nicht im Nebelmeer. Doch frei nach Hölderlin wächst in der Gefahr das Rettende auch. Wenn Euch die Nebelschwaden aufs Gemüt drücken, besuchen Sie doch ganz einfach die wunderschöne Stadt Luzern. Am Fusse des Pilatus scheint stets die Sonne und Regentage kennt man kaum. Ausserdem können Sie mit «learning by doing» den ersten Crash-Sprachkurs in chinesisch absolvieren, was für die Zukunft wohl bald wichtiger als Ihre Englischkenntnisse sein wird.

-
6.1.2020 - Tag der Wendehälse
FDP-Präsidentin Gössi teilt im grossen Interview gegen links und rechts aus: «Die SVP politisiert an der Bevölkerung vorbei»
Die Öko-Welle hat die FDP in Bedrängnis gebracht. Die Partei werde vermehrt Referenden ergreifen müssen, ist Petra Gössi überzeugt. Die FDP-Präsidentin spricht über den neuen Parteikurs, die Europa-Politik und das soziale Sprengpotenzial der Negativzinsen. FDP-Chefin Petra Gössi (43) führt ihre Partei seit vier Jahren. Als sie die FDP von ihrem Vorgänger Philipp Müller (67) übernommen hat, hatte dieser eine Trendumkehr geschafft. Mit der Partei ging es wieder aufwärts. Doch bei den Wahlen vom Oktober 2019 wählten nur noch 15,1 Prozent freisinnig. Gössi lässt sich davon aber nicht entmutigen, wie sie beim Treffen in ihrem Büro in Zürich bei Kaffee und Weihnachtsschoggi klarmacht. Schreibt BLIGG.
Oh je, Frau Gössi mit ihrem warmseligen Personal teilt nach allen Seiten aus. Vermutlich als Folge einer tiefen Frustration, resultierend aus ihrer unglaubwürdigen Wendehalspolitik bei den letzten Wahlen und dem desaströsen Wahlergebnis. Kommt hinzu, dass längst hinter jedem Wasserfall die Messer gegen das Parteipräsidium gewetzt werden.
-
5.1.2020 - Tag der kalkulierten Insta-Posts
Hater attackieren Morena für Vergewaltigungs-Post
Body-Positivity-Star Morena Diaz hat auf Instagram geschrieben, dass sie vergewaltigt wurde. Die Reaktionen darauf fallen teils heftig aus. «Ich wurde vergewaltigt und es tut immer noch weh.» Mit diesem Bekenntnis sorgte die bekannte Aargauer Primarschullehrerin Morena Diaz am vergangenen Donnerstag für Aufsehen. Der Vorfall hat sich laut ihres Posts drei Tage vor Heiligabend 2018 nach einem gemeinsamen Abendessen ereignet. Ihr Fall sei kein Einzelfall, schreibt sie im Post, und deshalb breche sie nun ihr Schweigen. Während viele diesen Schritt unterstützen und Diaz dafür loben, gibt es auch einige, die ihre Geschichte anzweifeln. «Sie sind eine feige Lügnerin», steht in einem Kommentar. «Sie sollten sich schämen», in einem weiteren. «Wen wundert's, bei jemandem, der sich so präsentieren muss», schreibt jemand – und dies öffentlich. Schreibt 20Minuten.
Na ja, Body-Positivity-Star Morena Diaz hat vermutlich mit voller Absicht einen kalkulierten Post über ihre Vergewaltigung auf Instagram veröffentlicht. Wohlwissend, was auf sie zukommen wird. Wenn nicht, müsste an Ihrer Intelligenz gezweifelt werden. In ihrem Business sind Klicks, Verlinkungen und Reaktionen bares Geld wert. Man ist fast geneigt zu sagen «Gleich und Gleich gesellt sich gern». Denn ohne diese Dumpfbacken-Follower wäre Diaz kein Star. Wertfrei: Was immer auch ein «Body-Positivity-Star» sein soll. Mögen die Reaktionen auch noch so krude sein und sich jenseits von Gut und Böse bewegen. Dazu kommen noch die Durchlauferhitzer wie 20 Minuten, die über die «attackierte Morena» berichten und damit das Publikum jenseits von Instagram bedienen, denen der Insta-Müll und Morenas Befindlichkeiten normalerweise am Allerwertesten vorbeigehen. Was der AVZ jetzt übrigens auch gerade tut. So wir denn ehrlich sein wollen ... :)
-
4.1.2020 - Tag der kleinen Yasna
Zentralschweizer Neujahrsbaby: Pünktlicher hätte die kleine Yasna gar nicht auf die Welt kommen können
Für die Familie Kabiri aus Erstfeld war die Silvesternacht kurz. Um 01:41 Uhr kam die kleine Yasna auf die Welt und ist somit das erste Baby in der Zentralschweiz, das im neuen Jahr geboren wurde. Für die Eltern geht ein grosser Wusch in Erfüllung. «Endlich! Ein Mädchen!» Die Freude bei Mutter Hasina Kabiri (23) und der ganzen Familie ist riesig. Kurz nach Mitternacht um 01:41 Uhr wurde die kleine Yasna geboren. Schon beim ersten Kind hatte das Paar, das aus Afghanistan stammt, ein Mädchen erwartet. Man habe rosa Kleider gekauft, doch dann kam ein Bub auf die Welt. Das war vor fünf Jahren, inzwischen lebt die Familie im Kanton Uri. Vor drei Jahren dann kam der zweite Sohn auf die Welt. Der Geburtstermin wurde damals auf den Neujahrstag errechnet. Doch das Baby kam ein paar Tage zu früh und wurde am 29. Dezember geboren. Sie habe schon schmunzeln müssen, als bei der dritten Schwangerschaft wieder der 1. Januar errechnet worden war, erzählt Hasina Kabiri. Diesmal stimmte der Termin, Yasna hätte also nicht pünktlicher auf die Welt kommen können. Schreibt die LZ.
Das ist doch mal eine schöne Geschichte zum Jahresanfang in einer kriegerischen Welt. Drücken wir der kleinen Yasna sinnbildlich für alle ErdenbewohnerInnen die Daumen, dass alles gut wird.
-
3.1.2020 - Tag der Amag-Erbin
Wohnen auf nur 45 Quadratmeter in Zollikerberg ZH: Amag-Erbin baut 40 Mikro-Häuser
In Zollikerberg ZH entstehen 40 sogenannte Tiny Houses. Die Häuser mit maximal 60 Quadratmetern Wohnfläche sollen einem neuen Bedürfnis gerecht werden. Die Baueingabe erfolgt noch Anfang Jahr. Ein neuartiges Bauprojekt für das neue Jahr: Am Zollikerberg soll eine Überbauung mit insgesamt 40 Mietwohnungen in Form von Tiny Houses entstehen. Die Mikrohäuser an der Forchbahn-Haltestelle Waldburg in Zollikerberg ZH werden zwischen 45 bis 60 Quadratmeter gross sein. Jede Wohnung soll einen eigenen, ebenerdigen Hauseingang erhalten, was den Wohnungen die Qualität von kleinen Einfamilienhäusern gibt. Der Wohnraum erstreckt sich meist über zwei Geschosse und umfasst zwei bis drei Zimmer. Jedes Mikrohaus kommt zudem mit einem kleinen Garten von 20 bis 30 Quadratmetern daher. Das Ziel der Projektverantwortlichen der Immobilienfirma UTO Real Estate Management (UTO): Die Miete der Tiny Houses soll rund 2000 Franken pro Monat betragen. «In dieser Grösse gibt es in Zürich derzeit nichts Ähnliches zu mieten», sagt Niels Lehmann, Projektentwickler bei UTO REM. Lehmann sagt, die Tiny Houses würden einem neuen Bedürfnis der Menschen entsprechen: «Die Menschen wollen weniger Fläche verbrauchen und ihren Konsum einschränken.» Bei der Miete könne man viel sparen. Schreibt BLIGG.
Endlich mal eine Erbin, die mit ihrem Erbe etwas Sinnvolles auf die Beine stellt: Wohnraum, der flächenmässig den Bedürfnissen vieler Menschen entspricht. Daran gibt es nichts auszusetzen. Ausser der Tatsache, dass die Immobilienfritzen den Trend längst kennen, ihn aber bewusst nicht umsetzen. Weniger Wohnfläche = weniger Gewinn. Oder um es auf den Punkt zu bringen: Die Gier siegt über die Vernunft. Siehe Geistersiedlung in Wohlenschwil.
-
2.1.2020 - Tag der Mietzinse
BLICK beantwortet die wichtigsten Fragen zur Miet-Initiative: Erbitterter Kampf um billigere Wohnungen
Am 9. Februar 2020 stimmen wir über die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ab. Gemäss Umfrage kommt sie im Volk gut an. Doch was will der Mieterverband genau? BLICK beantwortet die wichtigsten Fragen. Schreibt BLIGG.
Liebe Immobilien-Spekulanten, Ihr dürft frohen Mutes auch im neuen Jahr weiter spekulieren bis Eure Blase platzt. Fürchtet Euch nicht, Ihr Unseligen. Dass die von der SP halbherzig unterstützte Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» vom Volk abgelehnt wird, ist (fast) so sicher wie das Amen in der Kirche. Dafür werden die Kommunikations- und Marketing-Stalinorgeln der vereinten Immobilienhaie schon sorgen. Auch die Kanonen der üblichen Verdächtigen aus den Lobbyisten-Parteien der FDP, CVP und – nicht zu vergessen – die Partei der «kleinen» Leute, die am meisten unter den Mieten leiden – unser aller SVP, werden aus allen Löchern schiessen und das ihrige zum Scheitern der Initiative beitragen. Schliesslich werden sie dafür bezahlt. Wessen Brot ich ess', dessen Lied ich sing'. Und das betroffene Wahlvolk? Wird wie immer bei solchen Abstimmungen an der Urne fehlen. Jedenfalls diejenigen, denen die hohen Schweizer Wohnungsmieten am meisten weh tun. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Zumal der Mieterverband nicht annähernd über die Mobilisierungsmöglichkeiten der mächtigen Immobilien-Lobby verfügt.
PS: Bei einer Umfrage vom Handelsblatt über das Image von Berufen belegten die Immobilienhändler den zweitschlechtesten Platz, getoppt nur noch von den Versicherungsvertretern.
-
1.1.2020 - Tag der Veganerfürze
«Bekam Wohnung nicht, weil ich Veganer bin»
Grillpartys, Babystillen und Luxusprobleme: Zwei Veganer äussern sich in unserer Videoserie zu Klischees und Vorurteilen. Berichtet in Wort und Bild 20Minuten.
Irgendwie verständlich, dass die Veganer keine Wohnung bekommen. Veganer-Fürze sollen ja fürchterlich stinken. Von all den exotischen Früchten aus fernen Kontinenten, die täglich extra für die Veganer eingeflogen werden. Und Veganerinnen und Veganer, ja selbst ihre Kinder, würden sogar auf Rolltreppen in Kaufhäusern ab und zu einen fahren lassen. Hört man jedenfalls. Wer will mit solchen Leuten erst in einem Lift ins Penthouse fahren? Niemand!